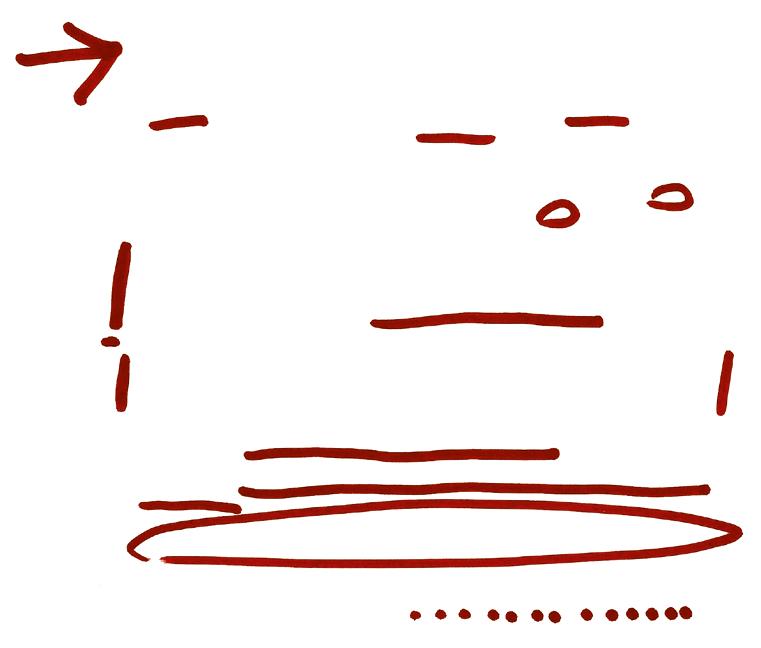Thema
Wer hat Recht auf Asyl, und wie viele? „Welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen?“ Angesichts der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 hat die Gesellschaft für Analytische Philosophie Philosophinnen und Philosophen aufgerufen, diese Frage zu beantworten. Ziel: Eine vernünftige Debatte anzuregen. Unter anderen hat Marie-Luisa Frick, Philosophie-Professorin an der Universität Innsbruck, dazu Stellung bezogen. Ihr Fazit: „Wenn das Recht an Verbindlichkeit verliert und die Zonen der Unordnung wachsen, rettet uns keine kosmopolitische Moral.“
Text: Gerhard Thoma, Fotos: Uni Innsbruck, UNHC
34 |
R
und 100.000 Flüchtlinge kamen 2015 nach Österreich, in Schweden waren es 150.000, in Deutschland rund eine Million. Tausende harren unter menschenunwürdigen Bedingungen an den EU-Außengrenzen aus. Die Flüchtlingsfrage bleibt eine der dringendsten politischen und humanitären Herausforderungen. Wer ist überhaupt ein Flüchtling? Prof. Dr. Marie-Luisa Frick verweist auf das Völkerrecht, die Genfer Flüchtlingskonvention (1951) und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948). Demnach ist ein Flüchtling ein Mensch, der das Recht hat, im Falle von sozialer oder politischer Verfolgung in einem (Nachbar-)Land um Asyl anzusuchen. Ob der Flüchtling tatsächlich schutzbedürftig ist, muss in einem rechtsstaatlichen Verfahren geklärt werden. Der enge Flüchtlingsbegriff aus den 1950er Jahren hat sich geweitet. Man spricht heute von Wirtschaftsflüchtlingen, Kriegsflüchtlingen, Klimaflüchtlingen, politischen Flüchtlingen, Armutsflüchtlingen. Für Frick ist klar: „In der Diversifizierung der Begriffe kommen nicht nur politische Fronten zum Ausdruck, in ihr spiegelt sich auch eine profunde Hilflosigkeit im Umgang mit der Unübersichtlichkeit, ja Abgründigkeit der gegenwärtigen Weltsituation.“ Und, so die Philosophin weiter, man könne davon ausgehen, „dass eine Situation wie die gegenwärtige von den Urhebern der Flüchtlingskonvention
und der Menschenrechtserklärung nicht antizipiert, ja gerade als zu vermeidendes Horrorszenario betrachtet wurde.“ Sie gibt zu bedenken, dass der historische Kontext, in dem das Asylrecht in den 1950er Jahren postuliert wurde, ein anderer war: „Ein Staat verfolgt ethnische Minderheiten und Dissidenten, die aber im Nachbarland Schutz finden. Der Zwang, sein Land zu verlassen, sollte kein Massenschicksal sein. Wir sehen heute, dass diese Utopie gescheitert ist.“ Das Asylrecht scheint der gegenwärtigen Situation hinterher zu hinken. Es war für eine überschaubare Zahl von Dissidenten angedacht, nicht für die Aufnahme von Hunderttausenden Menschen. Auf der einen Seite gibt es Menschenrechtsaktivisten, die unbeirrt auf die Einhaltung der proklamierten Asylrechte pochen, notfalls mit juristischem Nachdruck. Auf der anderen Seite stehen jene Bürgerinnen und Bürger, welche die Menschen- und Flüchtlingsrechte zwar ebenfalls hochhalten, aber kein Vertrauen mehr in das internationale Recht haben. Zum Beispiel darf kein Flüchtling aus Österreich abgeschoben werden, der in seiner alten Heimat um Leib und Leben fürchten muss. Damals durchaus sinnvoll, wenn man an Verfolgten der ehemaligen Ostblock-Staaten denkt. Heute können sich auf dieses Menschen- und Völkerrecht sogar Kriminelle, Kriegsverbrecher und Terroristen juristisch berufen, um ihre Abschiebung aus Österreich und der EU zu verhindern.
Marie-Luisa Frick, Professorin für Philosophie an der Universität Innsbruck: Europa sollte sich zu einer proaktiven Aufnahmepolitik durchringen, statt Schlepper über die Chancen von Menschen entscheiden zu lassen.
Umgekehrt dürfen Flüchtlingsfamilien, die seit Jahren in Vorarlberg lebten und sich gut integriert haben, legal abgeschoben werden. So wachsen in der Bevölkerung ideologische Gräben, Unsicherheit und ein moralisches Dilemma.
Ideale und wirkliche Welten
Da scheint einiges im Argen zu liegen und es stellt sich die Frage: Welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen? Bei der Beantwortung dieser Fragen orientiert sich Frick an der ursprünglichen Zielrichtung der Menschenrechte und der Flüchtlingskonvention. Zunächst äußert sie sich skeptisch zu den Anhängern einer ‚kosmopolitischen Ethik‘. Diese berufen sich auf den europäischen Humanismus und sind der Meinung, dass die internationalen Menschenrechte und die aktuelle Flüchtlingskonvention von höherem Wert seien als die staatlichen Rechte. Wer anderer Meinung ist, wird nicht selten als Unmensch, Rassist und rechtsextrem abgestempelt. Österreich sei demnach verpflichtet, zahlreiche weitere Asylwerber aus Flüchtlingslagern in Griechenland, Spanien und Italien aufzunehmen. Dagegen argumentiert Frick, „dass Menschenrechte zwar in der Tat keine Nationalität haben, aber kein Staat alleine alle Menschenrechte sichern kann“. Jedes einzelne Land stößt früher oder später an seine Möglichkeiten: Arbeitsplätze, Wohnungen, soziale Leistungen etc. „Und da ein Weltstaat