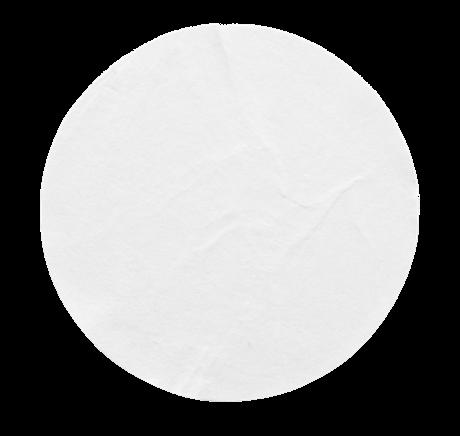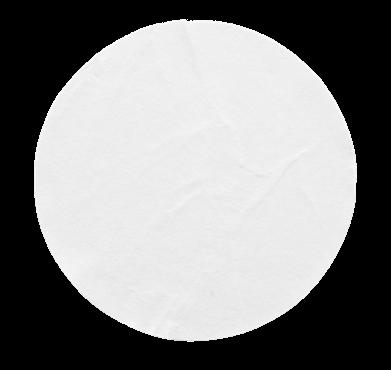
6 minute read
Die Fehler der anderen
DIE FEELER DER ANDERN
Der Weg zum Erfolg ist nie geradlinig. Je höher die Gipfel sind, die man erreicht, desto mehr Fehltritte können am Weg geschehen. Keine Branche und kein Unternehmen schafft es ohne Fehler an die Spitze. Doch der Umgang mit diesen ist es, an dem sich die Spreu vom Weizen trennt.
Text: Daniel Feichtner
Daran, dass der Tourismus Tirol geprägt hat wie kein anderer Wirtschaftszweig, gibt es keine Zweifel. Als eines der ersten Länder weltweit gelang es dem „Tourismusland Nummer eins“, den Fremdenverkehr beständig zu monetarisieren und weiterzuentwickeln, um daran weit über die einst erahnten wirtschaftlichen Potenziale hinauszuwachsen. Heute berührt die Branche nahezu alle Bereiche in Tirol – von der Wirtschaft an sich über die Arbeitswelt und die Infrastruktur bis hin zum privaten Leben der Tiroler.
Als solch omnipräsente Realität wirft der Tourismus viel Licht, aber manchmal auch Schatten. Teile der Bevölkerung betrachten die wirtschaftliche Triebfeder ihres Landes zusehend differenziert. Themen wie Umwelt- und Klimaschutz traten ebenso in den Vordergrund wie regionale Preisentwicklung, Overtourism und mehr. Für manche Tiroler ist also nicht alles Gold, was glänzt.
Allein ist der Tourismus damit nicht, wie ein Blick in andere Branchen zeigt. Denn, ganz salopp gesagt, fallen dort, wo gehobelt wird, auch Späne. So wäre es illusorisch, anzunehmen, einem Unternehmen oder gar einer ganzen Branche würde der Aufstieg ohne jede Fehlentwicklung gelingen. Dass das die Fehler, die am Weg an die Spitze passieren, nicht rechtfertigt, ist klar. Doch schlussendlich kommt es darauf an, wie mit dem Geschehenen umgegangen wird. Das machen andere vor – im Negativen wie im Positiven.
SCHEIN & SEIN
Das Image der Mineralölindustrie kann spätestens seit den 1990ern bestenfalls als „angeschlagen“ bezeichnet werden. Ölkatastrophen, dubiose Geschäftspraktiken, der Klimawandel und mehr haben sie in Verruf gebracht. Das veranlasste British Petrol Anfang der Jahrtausendwende zu einer Imageoffensive. Ein an ein Sonnenrad angelehntes Logo sollte Energie in allen Formen repräsentieren, das Akronym „bp“ bald synonym mit „beyond petrol“ (jenseits von Erdöl) stehen und eine über 200 Millionen Dollar schwere Kampagne der Öffentlichkeit ein völlig neues Unternehmen vorstellen. Kurzfristig zeigten diese Maßnahmen Wirkung. Die öffentliche Wahrnehmung von bp als umweltbewusstem Unternehmen stieg. Dazu trugen auch Investitionen in alternative Energieträger bei. Das Budget belief sich 2008 dafür auf 1,5 Milliarden Dollar – während parallel allerdings 20 Milliarden in Erdöl investiert wurden. Auch andere Vorsätze hielten nicht lange. Noch während bp kräftig Negativschlagzeilen für den DeepwaterHorizonVorfall im Golf von Mexiko sammelte, stampfte der Energiekonzern 2011 nach 35 Jahren seine Solardivision ein, obwohl diese zu den Marktführern zählte. 2012 ereilte mehrere Biotreibstoffprojekte das gleiche Schicksal. Das aggressive Rebranding half bp ohne Zweifel für zwei Jahrzehnte, seine Marktführerposition zu verteidigen.
Ohne den Worten Taten folgen zu lassen, war die Imageinvestition jedoch in etwa so nachhaltig wie die fossile Brennstoffindustrie selbst, und so sieht sie sich heute mehr im Kreuzfeuer der Kritik denn je.
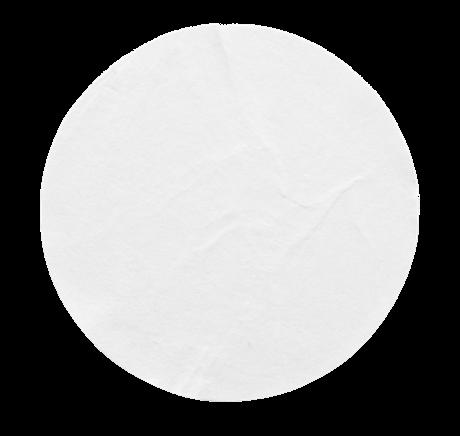
PROBLEM & LÖSUNG
Unverschuldet einem PRDesaster gegenüber sah sich der USPharmakonzern Johnson & Johnson 1982. Ein bis heute unbekannter Täter schmuggelte in Chicago mit Cyanid präparierte Kapseln in mehrere Flaschen des rezeptfrei erhältlichen Schmerzmittels Tylenol. Sieben Menschen starben an dem vergifteten Medikament. Johnson & Johnsons Marktanteil fiel daraufhin von 35 auf 8 Prozent. Doch der Pharmakonzern reagierte schnell – und vor allem offen. Anstatt zu beruhigen und den Schutz des wertvollen Markennamens in den Vordergrund zu stellen, eskalierte der Konzern die Situation aus eigenem Antrieb. Sobald die Verbindung zwischen den Todesfällen und dem Medikament ersichtlich wurde, stellte der Konzern die Produktion der Kapseln ein, startete eine groß angelegte Rückrufaktion und trat selbst an die Medien heran, um die Bevölkerung zu informieren und zu warnen. Weniger als ein Jahr später war Johnson & Johnson wieder USMarktführer und Tylenol, in dessen Marketing vor dem Vorfall Unsummen investiert worden war, zurück in den Regalen, diesmal mit manipuliersicheren Siegeln versehen, wie sie heute nahezu überall üblich sind.
Neben der zielgerichteten Problemlösung war es so vor allem das Priorisieren des öffentlichen Interesses vor dem Schutz der eigenen Investition, das schlussendlich Johnson & Johnson ebenso wie seine lukrative Marke gerettet haben dürfte.
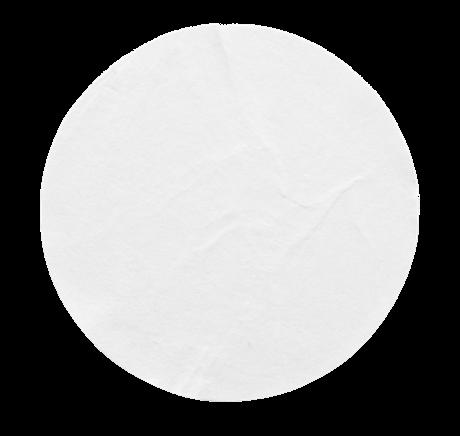
EINGESTÄNDNIS
Die SmartphoneWelt trennt sich seit jeher in zwei Lager. Doch während die Loyalität der iOSJünger gegenüber dem Exklusivhersteller Apple zwangsläufig außer Frage steht, wird im AndroidSegment regelmäßig um die Spitze gerungen. 2016 kam die eigentlich etablierte Position des Platzhirschs Samsung schwer ins Wanken, als sich Berichte häuften, denen zufolge das neue Flaggschiffmodell Note 7 spontan Feuer fangen würde. Zehn Tage später leitete der südkoreanische Konzern eine freiwillige, weltweite Rückrufaktion für die Telefone in die Wege – inklusive breiter medialer Berichterstattung. Diese Maßnahme half, sich von weiteren Vorfällen mit in Brand geratenen Telefonen zu distanzieren. Denn Benutzer, deren Telefone nach dem Rückruf in Flammen aufgingen, hatten sich offenbar bewusst dazu entschieden, das Angebot nicht zu nutzen. Gut einen Monat nach den ersten Vorfällen kündigte Samsung zudem an, die Produktion des betroffenen Modells nicht wieder aufzunehmen, und übernahm die volle Verantwortung – auch wenn das Problem offenbar nicht beim Konzern selbst lag, sondern bei den Herstellern der Batterien. Diese nannte Samsung selbst bewusst nicht namentlich und verzichtete auch darauf, rechtliche Schritte einzuleiten.
Anstatt des Fingerzeigs entschied sich Samsung, das Thema ad acta zu legen, und schaffte es so, den Fehlschlag relativ zügig hinter sich zu lassen und seine Marktposition auch trotz des Debakels erfolgreich zu verteidigen.
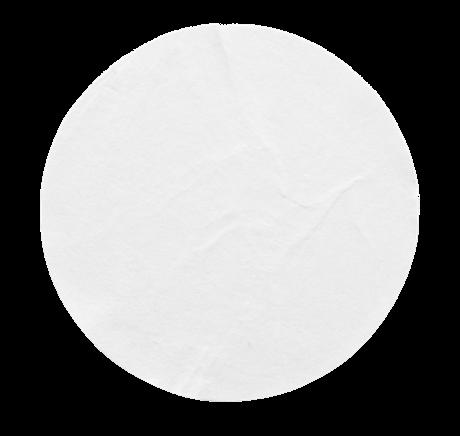
KURSKORREKTUREN
Kaum ein Großunternehmen hat mehr Erfahrung mit PRKrisen gesammelt als McDonald’s. Von der berühmten Klage wegen zu heißem Kaffee über Styroporverpackungen und Regenwaldrodungen bis hin zur Übergewichtsepidemie und aktuell den Dumpinglöhnen findet sich der Konzern regelmäßig in der Kritik. Dennoch ist es dem Fastfoodgiganten gelungen, seine Popularität aufrechtzuerhalten. Ermöglicht hat das eine gut durchdachte Strategie. Anstatt Kritik grundsätzlich mit Dementi zu begegnen, beweist der Konzern immer wieder ein offenes Ohr, verbunden mit Flexibilität, schneller Reaktion und dem Willen zur Innovation. Styropor ist vor Jahrzehnten Papier gewichen, das bald durch „Graspapier“ ersetzt werden soll. Fleisch bezieht der Konzern in Europa zu einem großen Teil aus dem jeweiligen Land und hat mittlerweile Fleischersatzprodukte in das Angebot integriert. Und als der Film „Super Size Me“ 2004 heftige Kritik an dem Unternehmen übte, stellte es im selben Jahr seine Menüoptionen um. All diese imageorientierten Initiativen werden natürlich kommuniziert – allerdings in der Regel nicht ohne, dass Kampagnen handfeste und ersichtliche Maßnahmen zugrunde liegen. Dabei dürfte man sich bei McDonald’s durchaus bewusst sein, dass der Konzern viele seiner Kritiker nie zu seinen Kunden zählen wird. Das muss er aber auch nicht.
Dank der Spitzenposition genügt es, mit ständigen Kurskorrekturen dem Zeitgeist und dem moralischen Kompass der breiten Masse ausreichend gerecht zu werden, um deren Gunst nicht zu verlieren.
SUPER-GAU
Die Mutter aller PRKrisen erlebte Volkswagen Ende 2015 mit dem Abgasskandal. Von der Manipulation waren weltweit mehr als elf Millionen Fahrzeuge betroffen. Als „Diesel Gate“ öffentlich wurde, fielen VWs Aktien um mehr als 60 Prozent – und das noch bevor der Konzern zu Milliardenstrafen verurteilt wurde. Volkswagen reagierte schnell und radikal. CEO Martin Winterkorn nahm fünf Tage nach Publikwerden des Skandals den Hut. An seine Stelle trat PorscheChef Matthias Müller, der ausreichend Distanz zu den Vorfällen hatte. Der ihm direkt unterstehende Managementstab wurde halbiert, wodurch „effizienter und schneller bessere Entscheidungen“ getroffen werden sollten. Zudem wurden Managementboni gekürzt – eine Maßnahme, die Geld einsparte, aber vor allem Öffentlichkeitswirkung hatte. Zur Kompensation der unmittelbaren finanziellen Einbußen baute VW zudem weltweit 30.000 Stellen ab – allerdings ohne Entlassungen, die den Konzern zusätzlich in ein schlechtes Licht gerückt hätten. Finanziell abgesichert und unter neuer Führung machte sich VW daran, den Skandal in der öffentlichen Wahrnehmung so schnell wie möglich hinter sich zu lassen. Dazu beschleunigte der Konzern seine EMobilitätsstrategie drastisch. Mit 16 geplanten Elektrofahrzeugfabriken, 30 neuen elektrischen Fahrzeugmodellen und 9.000 neu geschaffenen Stellen verkündete man, sich an die ElektroantriebsWeltspitze katapultieren und bis 2030 rund ein Drittel des Konzernumsatzes auf diesen Sektor verlagern zu wollen. Wohl nur diesem „Restructure, Reduce, Redevelop, Rebrand” getauften Maßnahmenpaket hat VW es zu verdanken, dass es weniger als zwölf Monate nach Bekanntwerden des Skandals gelang, die an Toyota und General Motors verlorene Marktführerposition zurückzuerobern.
Hätte der Konzern nicht so schnell und entschieden reagiert, nicht volle Verantwortung übernommen und nicht die Flucht nach vorne in die Innovation gewagt, wäre das ohne Zweifel nicht geglückt.