Special Nachhaltig handeln

Freiwilligenarbeit verbindet die Schweiz UBS
Monitoringprojekte
Die Natur mit KI besser verstehen


Freiwilligenarbeit verbindet die Schweiz UBS
Monitoringprojekte
Die Natur mit KI besser verstehen
Interview Als Hersteller von Kräuterbonbons, Pastillen und Tees hat sich Ricola aktiv für eine nachhaltige Zukunft positioniert. CEO Thomas P. Meier erläutert, warum Nachhaltigkeit für sein Unternehmen mehr ist als ein Etikett und weshalb Ricola stolz ist auf die Zertifizierung als «B Corporation».
Herr Meier, wie viele andere Unternehmen betont auch die Ricola AG, Nachhaltigkeit gehöre zu ihrer DNA. Wie ernst ist das gemeint?
Thomas P. Meier: Ricola verdankt der Natur alles, darum setzen wir bereits seit unserer Gründung im Jahr 1930 konsequent auf Nachhaltigkeit. Echte Nachhaltigkeit kann nur durch eine ganzheitliche und systematische Herangehensweise erreicht werden, die sowohl ökologische, ökonomische als auch soziale Aspekte berücksichtigt. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, meinen wir aber neben ökologischen auch soziale und ökonomische Aspekte. So sind uns beispielsweise zufriedene und motivierte Mitarbeitende, eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur und vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Lieferanten wichtig.
Auch die aktive Unterstützung sozialer Initiativen und von Kunst sind fester Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Als Familienunternehmen denken wir in Generationen. Unser Handeln ist daher geprägt von einer wirtschaftlich nachhaltigen Unternehmensführung, die nicht auf kurzfristige Gewinne setzt, sondern auf langfristige Stabilität, Verlässlichkeit und Beständigkeit. So schaffen wir ein solides Fundament für eine erfolgreiche Zukunft – für unsere Mitarbeitenden, unsere Partner, die Gesellschaft und die Natur.
Verfügen Sie über eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie?
Eine verschriftlichte Nachhaltigkeitsstrategie gibt es seit dem Jahr 2022. Tatsächlich stellen wir aber schon seit der Gründung unseres Unternehmens ökologische, ökonomische und soziale Aspekte ins Zentrum unseres Handelns. Seit dem Jahr 2020 ist zudem die erwähnte Nachhaltigkeitsstrategie Teil unserer Geschäftsstrategie. Dabei fokussieren wir sechs verschiedene Handlungsfelder: Landwirtschaft, Abfall, Verpackung, Klima, Wasser, Beschaffung. Für diese haben wir klare, messbare Ziele definiert und setzen entsprechende Massnahmen um, um diese Ziele zu erreichen. Ich gehe gerne auf zwei Beispiele ein: Bis im Jahr 2030 werden 80 Prozent unserer Rohstoffe gemäss unseren landwirtschaftlichen Grundsätzen angebaut. Diese ermöglichen gesunde Böden und fördern die Biodiversität. Schon heute werden die in unseren Bonbons verwendeten Alpenkräuter gemäss den Richtlinien von Bio Suisse von rund 100 Schweizer Vertragsbäuerinnen und -bauern angebaut. Ausserdem unterstützen wir den nachhaltigen Anbau von Zuckerrüben gemäss den Grundsätzen von IP Suisse. Besondere Bedeutung lassen wir auch dem Thema Energie zukommen. So setzen wir beispielsweise in der Produktion ausschliesslich auf erneuerbare Energiequellen. Unser Ziel ist es, bis 2030 unsere indirekten CO2-Emissionen pro verdientem Franken um rund die Hälfte zu senken. Das heisst: Für die gleiche wirtschaftliche Leistung soll deutlich weniger CO2 entstehen.

Ricola-CEO Thomas P. Meier: «Ein gutes Gleichgewicht mit den Ökosystemen, in die wir eingebunden sind, ist für uns ein Schlüsselfaktor.»
Ist der Nachhaltigkeitsgedanke auch ein zentraler Aspekt Ihres Business Development – wenn es um das Erschliessen neuer Geschäftsfelder und Märkte geht? Nachhaltigkeit spielt bei all unseren Tätigkeiten eine zentrale Rolle und beschränkt sich nicht nur auf die Qualität der Rohstoffe und deren Verarbeitung. Wir haben generell sehr hohe Standards, die unserer Geschäftsführung zugrunde liegen. Diese definieren unser Verhalten in sozialer, ökologischer und ethischer Hinsicht. Beispielsweise erwarten wir von allen unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie diese Standards ebenfalls einhalten. Konkret bedeutet dies, dass sie sich dazu verpflichten, effiziente Managementsysteme, Richtlinien, Verfahren und Schulungen zu nutzen, um die im Verhaltenskodex festgelegten Standards und Erwar-

«Ricola ist kerngesund und gut aufgestellt. Wir haben vielversprechende
Innovationen in der Pipeline.»
tungen einzuhalten. Entsprechend diesen Standards wählen wir auch allfällige neue Geschäftsfelder und Märkte aus.
Ricola produziert neun Milliarden Kräuterbonbons im Jahr. Mit Abstand der grösste Abnehmer sind die USA. Ist diese starke Marktposition für Ricola angesichts der deutlich gestiegenen USImportzölle unter Präsident Trump zum Problem geworden?
Die US-Zölle treffen uns natürlich wie andere exportierende Unternehmen stark. Ricola ist aber ein kerngesundes Unternehmen und insgesamt gut aufgestellt und wird weiterhin am Standort Laufen festhalten. Wir haben vielversprechende Innovationen in der Pipeline und eine starke Marke, die überall auf der Welt das Ansehen unserer Konsumentinnen und Konsumenten geniesst. Umgehend nach der Ankündigung der neuen Zölle haben wir uns dieser Herausforderung gestellt und eine interne Taskforce ins Leben gerufen. Diese Taskforce beobachtet die Entwicklung genau und arbeitet intensiv daran, geeignete Massnahmen zu entwickeln. Wir sehen beispielsweise leichte Preiserhöhungen um 10 Prozent ab Dezember dieses Jahres für den US-amerikanischen Markt vor und arbeiten daran, unsere Kosten – beispielsweise bei der Beschaffung von Verpackungsmaterial – zu reduzieren. Wir sind nun sehr erleichtert, dass die Gespräche von Schweizer Wirtschaftsvertretern und unserer Regierung zu einer deutlichen Reduktion der US-Zölle geführt haben. Dieser wichtige Schritt gibt uns die nötige Planungssicherheit im US-Markt.
Welche Auslandsmärkte stehen für Sie jetzt besonders im Fokus?
Asien ist ein sehr wichtiger und rasant wachsender Markt für Ricola. Aber auch in Europa haben wir noch viel Potenzial.
Auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit hat Ricola nach eigener Aussage einen wichtigen Meilenstein erreicht und ist inzwischen eine zertifizierte «B Corporation». Was verbirgt sich hinter diesem Label? Ende 2023 wurde Ricola als B Corporation zertifiziert. Darauf sind wir stolz, denn es ist eine Bestätigung unseres langjährigen Engagements für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, unserer Umwelt und unserem sozialen Umfeld. Als B Corporation sind wir verpflichtet sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten nachhaltig gestaltet sind, dass wir Schwachstellen konsequent beseitigen und zugleich neue Herausforderungen angehen. Ein kontinuierliches Herantasten, Abwägen und stetige Verbesserungen sind gefragt. Die Zertifizierung als B Corporation war allerdings erst der Anfang: Alle drei Jahre wiederholen wir das B Impact Assessment und stellen so sicher, dass wir nicht stehen bleiben, sondern uns kontinuierlich weiterentwickeln.
Worin liegen für Sie die grössten Herausforderungen in den kommenden Jahren? Ricola steht wie alle Lebensmittelhersteller vor Herausforderungen durch strengere Nachhaltigkeitsregeln, volatile geopolitische Entwicklungen und veränderte Konsumgewohnheiten. Gleichzeitig bieten genau diese Trends Chancen für uns: Im Bereich Nachhaltigkeit haben wir heute schon einen grossen Vorsprung, und als traditionsreiche, glaubwürdige Marke mit Fokus auf Natur und Gesundheit sowie natürlichen, pflanzlichen Premiumprodukten liegen wir im Trend.
Es heisst häufig in Wirtschaftskreisen, die Politik in der Schweiz und in der EU übertreibe es mit ihren detaillierten Nachhaltigkeitsregularien für Unternehmen. Sehen Sie das auch so? Wir verdanken der Natur alles und sind deshalb der Ansicht, dass wir auch alles unternehmen müssen, um sie zu erhalten. Mit einer ganzheitlichen und systematischen Herangehensweise können wir dazu beitragen, die Natur auch für die Zukunft zu erhalten. Regeln und Labels sind dabei grundsätzlich wichtig, weil sie einen verlässlichen Rahmen vorgeben. Auf der anderen Seite ist auch Augenmass nötig, und die Politik muss realistische Ziele verfolgen und vernünftige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft setzen. Es gibt zunehmend Regeln in der Schweiz und der EU, welche einen unsagbaren administrativen Aufwand zur Folge haben und über deren effektiven Nutzen man sich zum Teil streiten kann. Interview: Elmar zur Bonsen
Nachhaltig handeln
Neun Milliarden Bonbons pro Jahr
Das Unternehmen Ricola geht zurück auf Bäckermeister Emil Richterich, der 1930 die Confiseriefabrik Richterich & Compagnie in seinem Geburtsort Laufen (Baselland) gründete. Zusammen mit seinen Mitarbeitenden entwickelte er zahlreiche Bonbonspezialitäten. Richterich beschäftigte sich intensiv mit der Heilkraft von Kräutern und mischte 1940 zum ersten Mal die berühmt gewordene Rezeptur aus 13 Kräutern. Auch heute ist Ricola noch ein Familienbetrieb, in dem bereits die 4. Generation der Eigentümerfamilie aktiv ist. Das Unternehmen produziert mit seinen weltweit mehr als 600 Mitarbeitenden neun Milliarden Bonbons pro Jahr.
Meinung Nachhaltigkeit ist kein Zukunftsversprechen, sondern Realität – sie prägt unser Handeln heute. Mit Sustainable Switzerland zeigen wir, wie Unternehmen Verantwortung übernehmen und nachhaltige Lösungen entwickeln. Von Felix Graf
Geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten bestimmen aktuell die Schlagzeilen – doch die Klimakrise mit ihren sichtbaren Folgen bleibt die zentrale Herausforderung unserer Zeit. Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Bergrutsche oder Hochwasser führen uns vor Augen: Nachhaltiges Handeln ist heute Voraussetzung für Stabilität, Sicherheit und langfristigen Erfolg. Der wichtigste Treiber für eine zukunftsfähige Entwicklung ist die Wirtschaft. Unternehmen verfügen über den stärksten Hebel – durch Innovation, Unternehmertum und Geschäftsmodelle, die Mensch und Umwelt schonen und gleichzeitig dauerhaft tragfähig sind. Wer diese Chance nicht nutzt, verbaut sich und uns allen wertvolle Zukunftsperspektiven.
In die Strategie integrieren Die Schweizer Bevölkerung gehört im internationalen Vergleich zu den besonders sensibilisierten Konsumentinnen und Konsumenten – und zugleich zu einer Gesellschaft mit hoher Konsumbereitschaft. Energieverbrauch, Kreislaufwirtschaft und soziale Verantwortung beeinflussen Kaufentscheide und prägen das Image von Marken. Für Unternehmen ist das mehr als eine kommunikative Erwartung – es ist ein Wettbewerbsfaktor. Wer langfristig bestehen will, muss Nachhaltigkeit fest in Strategie, Werte und Prozesse integrieren.
Erfreuliches aus der Nachhaltigkeitswelt
In Zeiten des Klimawandels gibt es auch hoffnungssvolle Nachrichten. So berichtet das Bundesamt für Umwelt, dass sich der Treibhausgasausstoss in der Schweiz in den letzten Jahren weiter reduziert hat –auf zuletzt 40,85 Millionen Tonnen CO2Äquivalente. Das ist zwar immer noch enorm, entspricht aber einer Verringerung von 26 Prozent gegenüber 1990. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, angetrieben durch das revidierte CO2-Gesetz, das den Treibhausgasausstoss in der Schweiz bis 2030 halbieren soll.
Bemerkenswert ist auch, dass sich bis Mitte dieses Jahres 257 Schweizer Firmen der internationalen Science Based Targets initiative (SBTi) angeschlossen haben. Sie verpflichten sich damit zu wissenschaftlich fundierten CO2-Reduktionszielen, die dem Pariser Klimaabkommen entsprechen. Ins Bild passt, dass auch die Stromproduktion hierzulande stetig weniger CO2Emissionen verursacht. Heute stammen bereits etwa drei Viertel des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Studien zufolge wird das rasante Wachstum des Stromverbrauchs weltweit inzwischen vom noch schnelleren Wachstum der erneuerbaren Energien ausgeglichen, ja sogar leicht übertroffen. Auch in China und Indien sinken jetzt die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung.
Ein historisches Novum: Erneuerbare Energien haben in der ersten Hälfte dieses Jahres Kohle weltweit als wichtigste Stromquelle überholt, wie aus neuen Daten des globalen Energie-Thinktanks Ember hervorgeht. Die Frage ist nur, ob der massive Ausbau von Solarenergie, Wind- und Wasserkraft schnell genug erfolgt, um die international vereinbarten Klimaziele bis 2030 noch zu erreichen.
Immer mehr Schweizer Unternehmen beweisen, dass nachhaltiges Wirtschaften funktioniert. Startups und KMU richten ihre Geschäftsmodelle neu aus und setzen auf Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien und faire Lieferketten. Auch etablierte Unternehmen und «Hidden Champions» profitieren von energetischen Effizienzmassnahmen und resilienten Wertschöpfungsketten. Diese Beispiele – konkrete Best Practice – machen wir mit unserer Nachhaltigkeitsplattform Sustainable Switzerland bekannt und erlebbar. Sie zeigen, wie nachhaltige Geschäftsmodelle Zugang zu neuen Märkten eröffnen, Risiken reduzieren und die Arbeitgeberattraktivität steigern.
Im Spannungsfeld zwischen kurzfristigem wirtschaftlichem Erfolg und langfristiger unternehmerischer Verantwortung braucht es pragmatische Lösungen –ohne das grosse Ziel aus den Augen zu verlieren. Genau hier setzt Sustainable Switzerland an. Gemeinsam mit starken Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft liefern wir Informationen, stellen Lösungen vor und machen Menschen sichtbar, die sie entwickeln. Wir vernetzen Kompetenzen, fördern den öffentlichen Dialog – und geben nachhaltigem Handeln eine Bühne.
Blick hinter die Kulissen Wie Nachhaltigkeit konkret gelebt wird, erleben wir immer wieder aus erster Hand. Bei unseren Besuchen der Unternehmen Ricola und Breitling konnten wir dieses Jahr eindrücklich sehen, wie

«Wir schaffen Raum für Austausch, Inspiration und Kooperationen.»
nachhaltige Strategien in der Praxis funktionieren. Mit Mitgliedern unseres Entrepreneurs Clubs haben wir hinter die Kulissen geschaut und spannende Innovationen und wirksam verankerte Nachhaltigkeitsstrategien kennengelernt. Dieses Wissen und die «Lessons learned» wollen wir künftig noch stärker teilen. Gemeinsam mit unseren Part-
nern, erfolgreichen Unternehmen und angesehenen Hochschulen, engagieren wir uns für eine nachhaltige Schweiz –und für eine Plattform, die Impulse gibt, Lösungen vernetzt und Best Practice sichtbar macht. Genau dafür haben wir Sustainable Switzerland gegründet.
Felix
«Wir wollen Vorbilder sichtbar machen und andere inspirieren»
Die Nachhaltigkeitsplattform Sustainable Switzerland hat erstmals einen Award für «Sustainable Shapers» verliehen. Die Erwartungen seien deutlich übertroffen worden, sagt die Plattform-Verantwortliche Tina Baumberger.
Sie haben in diesem Jahr erstmals Pioniere und Vordenkerinnen der Nachhaltigkeit mit dem Award «Sustainable Shapers» geehrt. Was war der Grund dafür, diese Auszeichnung ins Leben zu rufen? Tina Baumberger: Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Bei den bestehenden Nachhaltigkeits-Awards stehen oft Unternehmen, Startups und Organisationen im Vordergrund, aber selten die Köpfe dahinter. Deshalb haben wir mit den Sustainable Shapers eine Auszeichnung ins Leben gerufen, die bewusst Persönlichkeiten und ihre Leistungen ins Zentrum stellt. Ausserdem stellen wir immer wieder fest, dass Gesichter und persönliche Geschichten auch im Kontext der Nachhaltigkeit auf grosses Interesse stossen. Mit den Sustainable Shapers können wir Vorbilder sichtbar machen, andere inspirieren und Pioniere miteinander vernetzen (s. Bericht Seite 8). Das gelingt uns offenbar gut. Wir freuen uns darauf, die Auszeichnung auch im nächsten Jahr wieder zu verleihen.
Sustainable Switzerland wurde vor fast vier Jahren vom Unternehmen NZZ lanciert – zusammen mit namhaften Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft lanciert. Welche Rolle spielen diese Partnerschaften heute noch?
Eine unverändert grosse, besonders auch in der strategischen Ausrichtung unserer Plattform. Die Partner sind Vertreter wichtiger Branchen, die eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Transformation spielen. Durch sie haben wir direkten Zugang zu aktuellen Themen, Innovationen und auch Herausforderungen, welche die nachhaltige Entwicklung in der Schweiz mit sich bringt. Unsere
Vision ist es, in Zukunft alle Branchen in der Schweiz an Bord unserer Plattform zu haben – von grossen Unternehmen bis zu KMU-Vertretern. Wir wollen bereits bestehende Synergien ausbauen und die nachhaltige Entwicklung der Schweiz beschleunigen. Neben den strategischen Partnern nehmen heute schon zahlreiche weitere Organisationen und Unternehmen an unserer Plattform teil –darunter auch NGOs und Bildungsinstitutionen.
Waren die Partner Ihrer Plattform auch am Award für die «Sustainable Shapers» beteiligt?
Das Konzept und der mehrstufige Evaluationsmechanismus wurde gemeinsam mit unserem Main Partner, der Boston Consulting Group, entwickelt und umgesetzt. Auch die anderen Partner haben einen massgeblichen Beitrag geleistet.
Sind Sie mit der Resonanz auf die Preisverleihung zufrieden?
Ja, sehr. Wir haben von der Nominierungsphase bis zur Auszeichnung viel positives Feedback erhalten, sowohl von der Öffentlichkeit als auch von den Nominierten selbst. Es sind über 240 Nominierungen eingegangen, was unsere Erwartungen deutlich übertroffen hat. Auch die Qualität der Nominierungen hat uns überzeugt. Einmal mehr ist deutlich geworden, wie viel Pioniergeist in diesem Land vorhanden ist.
Sustainable Switzerland hat sich auch mit Informationen und Berichten rund um das Thema Nachhaltigkeit einen Namen gemacht. Welche Medienkanäle werden besonders genutzt?
Wir verfolgen eine multimediale Strategie mit dem Ziel, unsere Inhalte möglichst breit zugänglich zu machen. Daher bereiten wir unsere Inhalte in verschiedenen Formaten auf, von journalistisch gemachten Themenseiten in der «NZZ» und der «NZZ am Sonntag» über unsere Zeitungsbeilagen, die übersetzt auch in den Partnermedien «Le Temps» und «Corriere del Ticino» erscheinen, bis hin zu Videos, die wir zum grössten Teil selbst produzieren. Neben unserem Portal sustainableswitzerland.ch, das als sogenannter Content Hub fungiert, stehen natürlich Social Media im Fokus. Dort verzeichnen wir ein stetiges Wachstum der Community und holen die Nutzerinnen und Nutzer mit multimedialen

Storys ab. Was ebenfalls auf positive Resonanz stösst, sind unsere Webinare, die wir seit Anfang des Jahres anbieten.
Weiterbildung steht also hoch im Kurs? Ja, die Nachfrage ist gross. Wir haben aus diesem Grund auch unseren «Bildungskompass» entwickelt. Mit ihm lässt sich online ermitteln, welcher Nachhaltigkeitslehrgang in der Schweiz am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Zudem stellen wir auf unserer Website auch viele nützliche Tools für die Unternehmenspraxis vor.
Können Sie uns schon verraten, was Sustainable Switzerland im neuen Jahr alles vorhat? 2026 steht bei uns ganz im Zeichen der wirksamen Vernetzung. Das heisst, wir wollen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen «Inhalt und Wissensvermittlung» sowie «Community und Events» noch stärker miteinander verknüpfen und dafür sorgen, dass nachhaltige Lösungen schneller Realität werden. Die breitere Öffentlichkeit werden wir neu auch im Rahmen eines Live-Events bei der Climate Week Zurich im kommenden Mai ansprechen (s. Bericht S. 16). Für die Wirtschaft und die Wissenschaft halten wir an den erfolgreichen Community- und Event-Formaten fest und entwickeln diese weiter. Für den Sustainable Switzerland Circle (bisher Entrepreneurs Club) haben wir wieder ein spannendes Jahresprogramm mit einmaligen Einblicken in Vorbereitung. Wir eruieren laufend zusätzliche Synergien mit anderen NachhaltigkeitsCommunitys, die ergänzende Formate wie etwa Workshops bieten.
Zahlen & Fakten Die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ist auch für die Schweiz eine grosse Herausforderung. Es geht dabei um ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche und Themenfelder – soziale, wirtschaftliche und ökologische.
000 000
Nachhaltige Investitionen
Das Gesamtvolumen nachhaltigkeitsbezogener Investitionen in der Schweiz ist im vergangenen Jahr auf 1881 Milliarden Franken gestiegen – ein Wachstum von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein klarer Aufwärtstrend nach dem moderaten Zuwachs im Jahr 2023. Dies geht aus der Schweizer Marktstudie «Nachhaltige Anlagen 2025» von Swiss Sustainable Finance (SSF) hervor. Die ermittelten Zahlen widerlegen nach Angaben des Verbands für die Schweiz den viel zitierten Gegenwind für Nachhaltigkeitsthemen. Sie seien «ein Zeichen dafür, dass sowohl private wie institutionelle Investoren die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in ihre Anlageentscheidungen als wichtig erachten, um damit
31,4
Erneuerbare Energien
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in der Schweiz wird laut GlobalData von 11,4 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2024 auf 31,4 TWh im Jahr 2035 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,7 Prozent im Zeitraum 2024–2035 entspricht. Erreicht wird dieses Plus durch den Betrieb von grossen Wasser- und Pumpspeicherkraftwerken, den Ausbau der Photovoltaik und politische Massnahmen, die darauf abzielen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Weltweit waren 2024 bereits 92,5 Prozent der neu gebauten Kapazität zur Stromerzeugung erneuerbar. Spitzenreiter China hat im ersten Halbjahr 2025 doppelt so viel erneuerbare Energieversorgung zugebaut wie der gesamte Rest der Welt zusammen.
Stress bleibt eine zentrale Herausforderung – gerade auch für die Gesundheit: Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung (25 Prozent) fühlt sich relativ häufig oder sogar sehr häufig gestresst, besonders Frauen und jüngere Altersgruppen sind betroffen. Dies hat eine Studie der Sanitas-Krankenversicherung ergeben. Die Mehrheit (57 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen gibt zudem an, heute deutlich häufiger gestresst zu sein als noch vor fünf Jahren. Fast jede/r zweite Befragte (45 Prozent) bestätigt, dass sich Stress bei ihnen stark oder sehr stark auf die körperliche Gesundheit auswirkt.
ihre Risiken besser zu kontrollieren und einen Beitrag zur einer nachhaltigeren Wirtschaft zu leisten». Besonders stark entwickelten sich 2024 thematische Nachhaltigkeitsinvestments (+16 Prozent). Gemeint sind gezielte Investments in Unternehmen, die Lösungen für bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte anbieten, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, Wassermanagement, Kreislaufwirtschaft oder gesunde Ernährung. Ein noch grösseres Plus verzeichneten Anlagen mit Klimaausrichtung (+33 Prozent) und sogenannte Impact-Investments (+27 Prozent), die neben einer finanziellen Rendite eine nachweisbare und messbare positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen sollen.
Cyberkriminalität verursacht rasant steigende Kosten
Geschätzte
Quelle: Cybersicherheit in Zahlen 2025/26, Statista Market Insights
Schrumpfen der Gletscher
Die Gletscher in der Schweiz sind in diesem Jahr weiter massiv geschmolzen. Durch den schneearmen Winter, kombiniert mit Hitzewellen im Juni und August, hat das Gletschervolumen um drei Prozent abgenommen. Das entspricht einem Verlust von 1,4 Milliarden Kubikmetern – der viertgrösste Schwund seit Beginn der Messungen im Jahr 1950. Über einen Zeitraum von zehn Jahren betrachtet, hat die Eismasse sogar um ein Viertel abgenommen, wie das Schweizerische Gletschermessnetz (Glamos) berichtet. Mehr als 1000 kleine Gletscher sind den
Angaben zufolge bereits verschwunden. Vor allem Eisriesen unterhalb von 3000 Metern Höhe haben 2025 stark gelitten. So nahm die Eisdicke zum Beispiel am Claridenfirn (GL), dem Glacier de la Plaine Morte (BE) oder dem Silvrettagletscher (GR) im Durchschnitt um über zwei Meter ab. Den Experten zufolge tragen die stetig schwindenden Gletscher dazu bei, dass sich das Gebirge immer mehr destabilisiert. Dies könne vermehrt zu Ereignissen wie im Lötschental führen, wo im Mai dieses Jahres eine Lawine aus Fels und Eis das Dorf Blatten verschüttet hat.
2182%
Cyberkriminalität
In den vergangenen Jahren hat sich Cyberkriminalität zu einem der grössten Risikofaktoren für Unternehmen, Behörden, aber auch Privatpersonen entwickelt. Der Blick auf die steigende Zahl der dokumentierten IT-Schwachstellen ist besonders besorgniserregend, wie es in einem aktuellen Statista-Report heisst. Parallel zur Zunahme der Sicherheitslücken seien die Schadenskosten förmlich explodiert. Während sich die Anzahl der IT-Schwachstellen zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppelt hätte, seien die durch Cyberangriffe verursachten Kosten im selben Zeitraum sogar um das Achtfache auf 8,46 Billionen Euro angestiegen (s. Grafik). Schätzungen zufolge werden die Schäden 2030 bei 16,43 Billionen Euro liegen.
25% 60% 2060 1 400 000 000
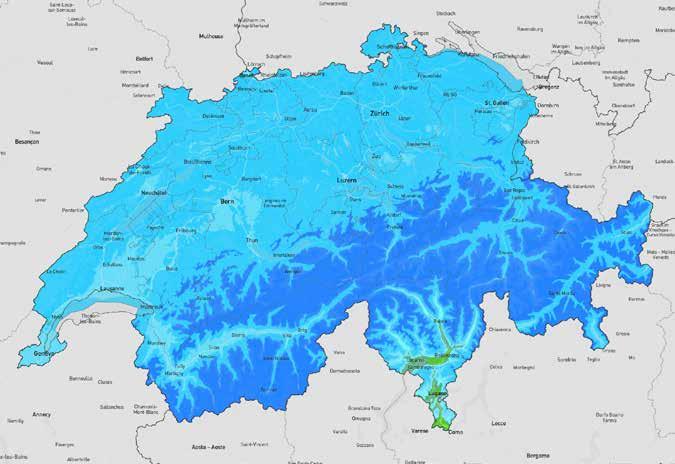
Luftqualität
Die Luftqualität in der Schweiz hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Allein die Belastung durch besonders gesundheitsschädliche, ultrafeine Staubpartikel (Durchmesser bis 2,5 Mikrometer) ist seit 1998 um etwa 60 Prozent gesunken. Trotzdem werden in vielen Orten die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation für Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid nach wie vor überschritten. Die höchsten Feinstaubbelastungen treten in verkehrsreichen Regionen und Städten des Mittellands und den Südtälern des Tessins auf. Aktuelle Informationen liefert Meteotest im Auftrag des Bundesamts für Umwelt: meteotest.ch/wetter/luftbelastung.
100 000
Umweltschädliche
Mode
Die Schweiz gehört zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Kleiderkonsum weltweit. Jährlich fallen hierzulande etwa 100 000 Tonnen Altkleider an. Die Textilien landen zu einem grossen Teil im Abfall, werden verbrannt oder in Entwicklungsländer entsorgt. Probleme bereitet besonders die «Fast Fashion»: Trendige Kollektionen werden in Massenfertigung und minderer Qualität extrem schnell in Ländern mit niedrigen Lohnkosten produziert. Das führt zu einer Wegwerfkultur und erheblichen Umweltschäden. Initiativen wie der Schweizer Modefonds wollen die Industrie dazu verpflichten, Kosten für ökologische und soziale Schäden zu tragen und nachhaltige Mode zu fördern.
2 600 000
Food Waste
Nach Uno-Angaben werden weltweit heute rund 32 Prozent der produzierten Lebensmittel nicht konsumiert – sie gehen entweder in der Lieferkette verloren oder werden im Einzelhandel, in der Gastronomie und in Haushalten weggeworfen. Besonders hoch ist der Anteil der Verluste in der Lieferkette in der Region Subsahara-Afrika, wo 23 Prozent der Lebensmittel bereits vor dem Verkauf verloren gehen. In Asien liegt dieser Wert bei 14 Prozent, in Lateinamerika bei 13 Prozent. In Europa sind es aufgrund effizienter Logistik und Infrastruktur nur 6 Prozent. Doch auch hier ist die Verschwendung enorm. Laut Bundesamt für Umwelt landen allein in der Schweiz jährlich etwa 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.

Klima-Risikoanalyse
Der Klimawandel birgt immer mehr Risiken für Mensch und Natur. Das grösste Risiko bestehe in der zunehmenden Hitzebelastung für die menschliche Gesundheit, schreibt das Bundesamt für Umwelt in seinem Bericht «KlimaRisikoanalyse für die Schweiz». Angestiegen seien auch die Risiken durch Sommertrockenheit. Laut der Analyse wird bis 2060 in den Sommermonaten bis zu einem Viertel weniger Regen fallen, die Trockenperioden dürften generell länger dauern. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf die Land- und Waldwirtschaft, aber auch auf die Ökosysteme. Es drohen vermehrt Naturgefahren und ein Verlust der Artenvielfalt.

Meinung Wer Nachhaltigkeit als linearen Fortschrittsprozess versteht, wird zwangsläufig enttäuscht. Doch das sollte uns nicht vom Weg abbringen. Von Leonard Creutzburg
Seit wann verläuft Geschichte linear? Das war noch nie so – wie jede Historikerin und jeder Historiker weiss. Und doch erwarten wir genau das, wenn es um Nachhaltigkeit geht: stetigen Fortschritt, ohne Rückschritt, ohne Umwege. Wir wollen Veränderung, aber nur, wenn sie ohne Querelen verläuft. Nachhaltigkeit soll die Welt retten, ohne unseren Alltag zu stören. Doch wer glaubt, die ökologische Transformation verlaufe reibungslos, hat die Geschichte sozialer Umbrüche nicht verstanden. Denn auch wenn Transformation Technik braucht, ist sie vor allem eines: ein grosser gesellschaftlicher Anpassungsprozess. Und dieser verlangt nach sozialen Innovationen – und nach Debatten, die nicht immer harmonisch verlaufen.
Falsche Erwartungen
Die gegenwärtige Ernüchterung angesichts der unübersichtlichen Weltlage ist daher kein Zufall, sondern Folge falscher Erwartungen und Annahmen. Erstens sind Gesellschaften vielschichtige Systeme. Man kann nicht an X drehen und erwarten, dass Y herauskommt. Transformation ist komplex, besonders in hoch spezialisierten Gesell-

schaften wie der unseren. Dies anzuerkennen, ist eine grundlegende Einsicht. Zweitens beruhen demokratische Gesellschaften auf Auseinandersetzung. Wer definiert, was die «richtige» Nachhaltigkeitstransformation ist? Der Verweis auf die Wissenschaft greift hier zu kurz. Gewiss liefert die (Natur-)Wissenschaft Fakten – etwa, dass Netto-Null als Zielbild gesetzt ist. Doch über den Weg dorthin entscheidet keine Formel, sondern die demokratische Debatte. Sie ist anstrengend, aber notwendig. Drittens folgt menschliches Verhalten selten reiner Vernunft. Erkenntnis führt nicht automatisch zu Handlung. Wissen ist Voraussetzung, doch neue Infrastrukturen und persönliche Erfahrungen sind ebenso entscheidend. Was bedeutet das für die derzeit sichtbaren – vermeintlichen oder tatsächlichen – Rückschritte in der Nachhaltigkeitspolitik?
Erstens muss die ökologische Transformation ganzheitlich gedacht werden. Jede lokale oder persönliche Anpassung ist Teil des grösseren Ganzen; jedes kleine Projekt trägt zum Mosaik bei. Zweitens ist die demokratische Streitkultur kein «Kulturkampf», sondern Ausdruck funktionierender De-
«Transformation ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf –mit Richtungswechseln und Pausen.»
mokratie. Dieses inflationär genutzte Unwort verschleiert, dass Demokratie von Debatte lebt – allerdings auf der Basis gemeinsamer Tatsachen. Über die Klimaerhitzung kann nur gesprochen wenn, wenn ihre Existenz anerkannt wird. Und das ist, entgegen manchen Schlagzeilen, der Fall: In der Schweiz sehen 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung die Klimakrise als ernst zu nehmende Bedrohung an. Drittens braucht Wandel Zeit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier; Anpassungen erfordern Übung und soziale Einbettung – im Freundeskreis, im Quartier, in der Nachbarschaft. Am Beispiel der Verkehrspolitik lässt sich das gut illustrieren. Viele Städte wollen den öffentlichen Raum sicherer und lebenswerter gestalten – mehr Freiheit für die Mehrheit. Dazu braucht es weniger Autos. Solche Prozesse sind langwierig und umstritten: Wer darf wann noch wohin fahren? Welche Ausnahmen gelten? Doch Erfahrungen zeigen: Nach Pilotphasen bleiben autofreie Strassen fast überall bestehen. Weil die Menschen merken, dass das Leben in einem grüneren, ruhigeren und sichereren Umfeld angenehmer ist – und sich ihre Gewohnheiten anpassen. Solche Erfahrun-
gen sind entscheidend: Sie übersetzen abstrakte Nachhaltigkeitsziele in konkrete Lebensqualität. So wird Transformation erfahr- und erlebbar – und damit politisch tragfähig.
Das grosse Ziel Was folgt daraus? Transformation ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf – mit Umwegen, Pausen und Richtungswechseln. Entscheidend ist, dass wir uns weiterbewegen, Schritt für Schritt – Rückschläge gehören dazu. Und manchmal kann es plötzlich sehr schnell gehen: Sozialer Wandel verläuft eben nicht linear, sondern kann zuweilen auch Sprünge nach vorn machen.
Ob nun Donald Trump im Weissen Haus sitzt oder nicht: Der Weg bleibt derselbe. Zukunft entsteht im Zickzack. Das grosse Ziel müssen wir dabei stets im Blick behalten: wieder innerhalb der planetaren Grenzen zu agieren – denn nur so kann unsere Gesellschaft langfristig bestehen. In diesem Sinne: Laufen wir weiter!
Der Autor ist Verantwortlicher für neue Wirtschaftsmodelle und Zukunftsfragen beim WWF Schweiz.
Best Practice Mit dem Neubau auf dem JED Campus in Zürich-Schlieren setzt die Bauherrin Swiss Prime Site neue Massstäbe für nachhaltiges Bauen. Sie zeigt, wie ESG-Ziele konsequent umgesetzt werden können.
Das Ende 2024 in Betrieb genommene Gebäude auf dem JED Campus in Zürich-Schlieren umfasst rund 18000 Quadratmeter flexibel nutzbare Büro- und Laborflächen. Es handelt sich dabei um ein zukunftsweisendes Bauwerk, das dem nachhaltigen 2226-Konzept des Architekturbüros Baumschlager Eberle folgt. Dieses Konzept ermöglicht es, vollständig auf aktive Heizung, Kühlung oder mechanische Lüftung zu verzichten. Stattdessen sorgen massive Wände, sensorgesteuerte Lüftungselemente und optimal platzierte Fenster für ein ganzjährig angenehmes Raumklima – ganz ohne konventionelle Gebäudetechnik.
Grüne Rückzugsorte
Die offene, lichtdurchflutete Architektur wird durch mehrere begrünte Terrassen ergänzt, die eine harmonische Verbindung zwischen Innen- und Aussenraum schaffen. Diese grünen Rückzugsorte fördern nicht nur das Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer, sondern leisten auch einen Beitrag zur Biodiversität und zum Mikroklima auf dem gesamten Campus. In Kombination mit
dem vielfältigen Freizeit- und Gastronomieangebot auf dem Areal entsteht ein inspirierendes Umfeld, das den Austausch zwischen den Mietparteien sowie mit dem Quartier aktiv unterstützt. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Projekts: Der verwendete Zirkulit-Beton® verfügt über einen hohen Sekundärrohstoffanteil und bindet dauerhaft rund 83 Tonnen CO2. Auch die Regenwassernutzung und die extensive Dachbegrünung sind wichtige Elemente des ökologischen Gesamtkonzepts. Diese Massnahmen tragen nicht nur zur Ressourcenschonung bei, sondern verbessern auch die Energie- und Umweltbilanz des Gebäudes. Die hohe Qualität und Nachhaltigkeit des Neubaus wird durch die SNBSGold-Zertifizierung (Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz) unterstrichen. Ergänzt wird dies durch digitale Gebäudesimulationen, die bereits in der Planungsphase eine präzise Optimierung der Energieflüsse und des Nutzerkomforts ermöglichten.
Swiss Prime Site, eine führende Immobiliengesellschaft in Europa, verfolgt das Ziel, ihr gesamtes Immobi-
lienportfolio bis 2040 klimaneutral zu betreiben. Seit 2019 konnten die unternehmenseigenen CO2-Emissionen bereits um 45 Prozent reduziert werden –ein klares Zeichen für das Engagement in Richtung Klimaschutz. Darüber hinaus ist das Unternehmen Mitinitiantin der «Charta Kreislauforientiertes Bauen». Mit dieser Selbstverpflichtung setzt sich Swiss Prime Site dafür ein, den Einsatz nicht erneuerbarer Rohstoffe zu halbieren und die Wiederverwendbarkeit von Baumaterialien systematisch zu fördern.
Flexible Raumgestaltung
Mit der Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2024 wurde der JED Campus architektonisch und funktional komplettiert. Die Nutzung als Büro- und Laborgebäude ermöglicht eine flexible Raumgestaltung, die sich an die Bedürfnisse unterschiedlichster Mieter anpassen lässt. Damit entsteht ein attraktiver Standort für Unternehmen, Startups und Forschungseinrichtungen gleichermassen – und ein lebendiger Ort, der das Quartier nachhaltig bereichert.

Innovation Biodiversität zu messen ist aufwendig. Das Startup DNAir will das mit einer neuartigen Technologie, die DNA-Spuren aus der Luft auswertet, ändern. Möglich sind solche Fortschritte auch dank des Google-Programms «Startups for Sustainable Development».

Umwelt-DNA wird im Labor aus den Luftproben extrahiert. Das genetische Material gibt Aufschluss über den
STEPHAN LEHMANN-MALDONADO
Welche Falter flattern in der Stadtluft? Finden sich in den Hecken noch Blindschleichen? Und wächst am Wegesrand wirklich Spitzwegerich? Solche Fragen klingen nach Naturkundeunterricht. Doch sie halten zunehmend Behörden, Organisationen und Unternehmen auf Trab. Denn Biodiversität ist vom exotischen Hobby von Naturfreunden zu einem wichtigen Punkt auf der Agenda von Entscheidungsträgern geworden. Betriebe, die ihre Biodiversitätsrisiken im Griff haben, erlangen eher eine Genehmigung, können sich mit lokalen Gemeinschaften besser verständigen und punkten bei Investoren.
Dass Biodiversität für die Menschheit überlebenswichtig ist, leuchtet schnell ein: Die Vielfalt an Arten und Ökosystemen versorgt uns mit sauberem Wasser, schützt vor Naturkatastrophen und reguliert das Klima. Weniger bekannt ist ihre Bedeutung speziell für die Wirtschaft. Tatsächlich hängt die Hälfte der globalen Wertschöpfung – von der Lebensmittelindustrie über die Baubranche bis zur Pharmaindustrie – von der Natur ab, wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) in einer Studie schwarz auf weiss nachweist.
Ein Gamechanger
Das Problem ist nur: Biodiversität ist wesentlich komplexer zu erfassen als beispielsweise ein Treibhausgas. «Man hat erst sieben Prozent der Erdoberfläche auf Biodiversität untersucht. Es klafft eine immense Lücke zwischen unserem Wissensstand und der Realität», sagt Stephanie Feeny, Co-Gründerin des Startups DNAir aus Zürich. Aussagen über die biologische Vielfalt an einem Ort zu machen bedeutete bisher eine Herkulesaufgabe. Forschertrupps mussten tagelang Arten suchen, beobachten, zählen, sammeln und einordnen – was Biodiversitätsanalysen äusserst aufwendig und kostspielig machte. Genau das will das Zürcher Startup DNAir mit seiner zum Patent angemeldeten Technologie ändern. Tiere, Pilze
und Pflanzen geben nämlich Fragmente von genetischem Material ab. Zum Beispiel über ihren Atem, ihre Schuppen, den Schleim, den Kot oder ihre Bewegungen gelangt die Umwelt-DNA, auch eDNA genannt, in die Luft. «Mit unserer Technologie fangen wir die eDNA fast jeder lebenden Spezies in der Luft ein und werten sie aus», erklärt Feeny. Die Analyse verrät, wie es um die Fauna und Flora in einem bestimmten Gebiet steht. Oft erhält man dabei sogar Hinweise zu Arten, welche die Forschenden nie zu Gesicht bekommen haben. «Wir können Biodiversitätsrisiken wesentlich schneller und günstiger beurteilen als mit herkömmlichen Methoden», sagt Feeny. Die Technologie von DNAir birgt das Potenzial, zum Gamechanger zu werden. Sie macht es möglich, ganze Ökosysteme zu überwachen, relativ rasch Einschätzungen über grössere Gebiete abzugeben und Aussagen über Veränderungen der Biodiversität im Zeitverlauf zu machen. So lassen sich etwa die Auswirkungen eines Projekts anhand effektiver und automatisierter DNA-SamplingDaten beurteilen. Statt tagelanger Streifzüge durch die Gegend genügen dafür einige Stichproben aus der Luft.
Aktuell vergleicht ein Pilotprojekt des Schweizerischen Bundesamts für Umwelt (Bafu), der ETH Zürich und der Stiftung Valery die Daten, die mit der DNAir-Technologie gesammelt wurden, mit Daten aus konventionellen Methoden. «Wir verstehen uns jedoch nicht als Konkurrenz zu anderen Ansätzen. Vielmehr stellt unsere Technologie ein ergänzendes Mittel dar, um die Biodiversität unseres Planeten überhaupt erfassbar zu machen», betont Feeny.
Für Feeny ist DNAir nicht das erste Startup. Zuvor war sie Chief Growth Officer von Restor, einem Spin-off der ETH, welches das persönliche Umweltengagement mit Datensätzen aus aller Welt verknüpft. «Schon bei Restor habe ich Spezialisten von Google Schweiz kennen gelernt. Sie konnten uns damals in vielen Bereichen weiterhelfen», erinnert sich Feeny. Bei der ETH ist sie dann dem Wissenschaftler Fabian Roger über den
Weg gelaufen, der seit mehreren Jahren an der Analyse von DNA-Fragmenten in der Luft forschte. Die beiden merkten rasch, dass sie sich fachlich ergänzten und aus ihrem Knowhow ein marktfähiges Produkt entwickeln könnten.
Unterstützung von Google
Kein Wunder, dass auch DNAir an Google herantrat, um sich rund um die Entwicklung ihres Modells, das eDNADaten auswerten sollte, beraten zu lassen. Schnell fanden sich mehrere Ansatzpunkte, um das junge Unternehmen weiterzubringen. Zuerst unterstützten die Profis von Google die Crew von DNAir darin, die Benutzerfläche für einen ersten Prototyp zu gestalten – das geschah im Rahmen der Google Climate Action Challenge. «So haben wir als Startup kostenlos Zugang zu Erfahrung und Expertise erhalten. Das hat unsere Produktentwicklung beschleunigt und optimiert», sagt Feeny.
DNAir ist eines von einem Dutzend Schweizer Unternehmen, die sowohl von Googles Startup-Förderprogramm «Google for StartUps» wie auch von Googles Initiative «Startups for Sustai-
«Wir können Biodiversitätsrisiken wesentlich schneller und günstiger beurteilen.»

nable Development» profitiert. Letztere fördert gezielt innovative Jungunternehmen, die zu Lösungen für die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Uno beitragen. «DNAir erfüllt dieses Kriterium. Das Unternehmen trägt zum Entwicklungsziel 15, dem Leben an Land, bei. Denn seine Technologie hilft, die Gesundheit des Ökosystems zu bewerten», erklärt Dennis Tietz, Strategic Partnerships Development Lead von Google Schweiz. Die Idee des Förderprogramms «Startups for Sustainable Development» stammt ursprünglich vom Google-Forschungszentrum in Tel Aviv. Heute unterstützt es rund 400 Startups in mehr als 70 Ländern in verschiedensten Bereichen – von Personaldienstleistungen bis hin zu KI-Technologien. «Für uns ist die Zusammenarbeit mit den Startups eine Gelegenheit, neue Trends früh zu erkennen und uns mit Herausforderungen in aufstrebenden Märkten zu befassen», sagt Tietz.
KI-Potenzial nutzen
Was darf ein Startup erwarten, das sich für das Programm qualifiziert? Google setzt laut Tietz auf drei Ebenen an. Erstens erhalten Startups Zugang zu einem Netzwerk von Experten aus verschiedenen Fachgebieten. «Zweitens verbinden wir sie mit Investitionspartnern inklusive Wagniskapitalgebern, damit sie ihre Lösung skalieren können», so Tietz weiter. Drittens stellt Google den Startups seine Technologieplattformen zur Verfügung. Besonders viel verspricht sich der Technologiekonzern dabei von der KI. «Wir glauben, dass KI und kollektives Handeln ein enormes Potenzial bergen, um eine nachhaltigere und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft aufzubauen», sagt Tietz. Eine aktuelle Studie von Google deutet darauf hin, dass allein die generative KI in den nächsten zehn Jahren 1,2 Billionen Euro zur europäischen Wirtschaft beitragen kann. Aber wie hilft KI konkret, Umweltprobleme anzupacken? Dennis Tietz nennt Beispiele: Kürzlich führte Google einen ersten FireSat-Satelliten ein. Dieser erkennt Waldbrände im frühen Stadium. Mit dem öffentlich zugänglichen Tool Google Maps kann man einfach kraftstoffsparende Flugrouten planen. Den Einwand, dass die KI dabei selbst auch Energie verschlingt, kontert Tietz: «Die Internationale Energieagentur schätzt, dass die weitreichende Einführung bestehender KI-Anwendungen bis 2035 zu Emissionsreduzierungen führen könnte, die fast drei- bis fünfmal höher sind als die prognostizierten Emissionen von Rechenzentren.»
Schon heute zeichnet sich ab: Die Bedeutung der Biodiversität nimmt für viele Branchen sowie für den Regulator weiter zu. In zehn Jahren könnten Luftproben so selbstverständlich sein wie Wasseranalysen heute. «Wir stehen erst am Anfang», sagen Tietz und Feeny. Doch dieser Anfang klingt vielversprechend. Die Antworten auf unsere drängendsten Fragen zur Biodiversität könnten tatsächlich im Wind wehen – wir müssen sie nur einfangen.
Bei DNAir und Google laufen die Vorbereitungen für die Climate Week Zurich im Mai 2026 bereits auf Hochtouren. «Wir haben die Chance, uns der Öffentlichkeit an Events vorzustellen», sagt Stephanie Feeny, Co-Founder von DNAir. Auch Google will Akzente setzen und zum Dialog über Themen wie künstliche Intelligenz (KI), Dekarbonisierung der Lieferkette und fortschrittliche Technologien anregen. Als Gründungspartner des Grossereignisses organisiert Google nicht nur eigene Events, sondern stellt auch seine Räume zur Verfügung.
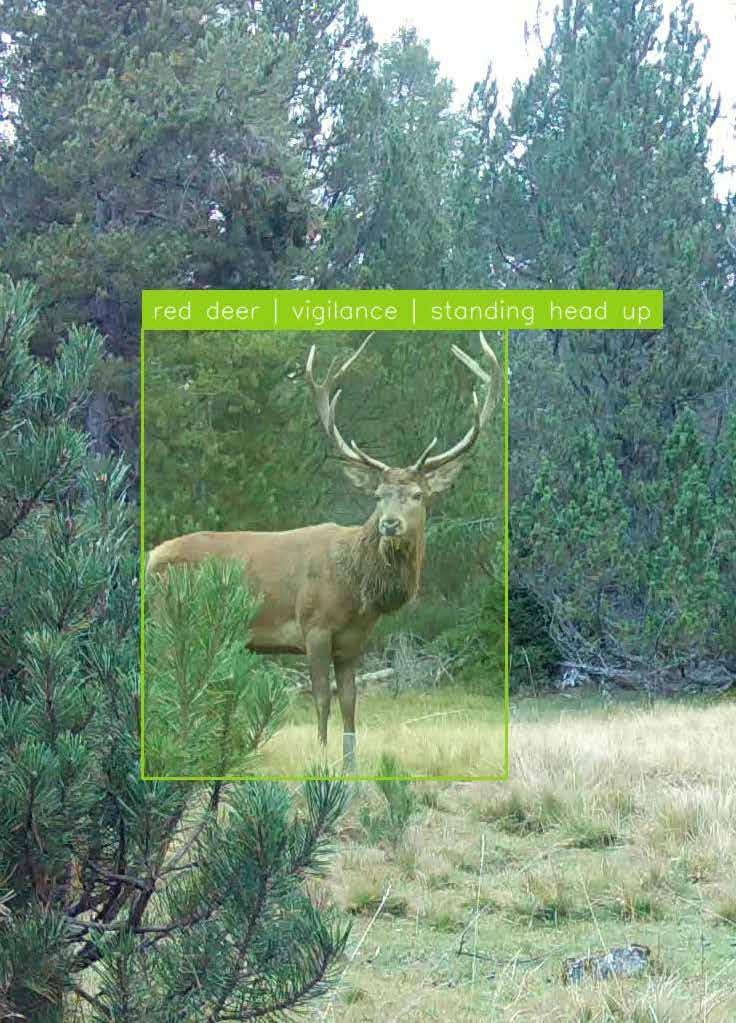

Forschung Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aufnahmen von Satelliten, Drohnen und Kamerafallen sprechen im Labor von Devis Tuia sogar ganze Bände. Der EPFL-Wissenschaftler analysiert komplexe Informationen über den Zustand unseres Planeten.
SUSANNE WEDLICH
Wir sind umgeben von Sensoren, die unablässig enorme Mengen an Daten über uns und unsere Umwelt erfassen: Smartphones in unseren Taschen, Videokameras in den Strassen, Drohnen in der Luft und Satelliten im Weltraum. Obwohl wir diese Daten oft als Mittel zur Überwachung betrachten, bieten sie auch bedeutende Möglichkeiten für wirkungsvolle Forschungsarbeiten.
«Wir nutzen diese Sensordaten für unsere Arbeit», sagt Devis Tuia, Leiter des Environmental Computational Science and Earth Observation Laboratory (ECEO) an der EPFL. «Aber keine Sorge: Unsere Untersuchungen sind komplett transparent und als Werkzeug für den Umweltschutz angelegt. Wir kombinieren Daten der Erdbeobachtung mit KI-Methoden wie dem maschinellen Lernen, um etwa den Zustand von Korallenriffen, die Verbreitung von Tierarten in unseren Bergen oder die Veränderungen in Regenwäldern zu erfassen.»
Vom Aussterben bedroht
In den Tropen finden sich einige der wichtigsten Waldökosysteme der Erde. Ihnen setzen nun aber die Klimakrise und menschliche Aktivitäten wie die Ausweitung der Landwirtschaft und des Bergbaus massiv zu. Schätzungen zufolge gehen global jährlich rund fünf Millionen Hektar Wald verloren, eine Fläche, die grösser ist als die Schweiz. Dadurch werden enorme Mengen an klimaschädlichem Kohlendioxid freigesetzt. Darüber hinaus sind die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt immens, da Hunderte von Arten nun vom Aussterben bedroht sind.
Da die Entwaldung durch regional unterschiedliche Faktoren vorangetrieben wird, kann es keine Lösung geben, die global wirksam ist. Ein maschinelles Lernmodell, das unter anderem von Tuias Team entwickelt wurde, nutzt Zeitreihen von Satellitenaufnahmen, um abzuschätzen, was passiert, nachdem der
Tropenwald verloren gegangen ist. Das KI-Modell erstellte eine Karte, die grundlegende Unterschiede beim Waldverlust in Südamerika, Südostasien und der Subsahara-Region in Afrika zeigt. Sie dient als Grundlage, um regional passende Massnahmen zu entwickeln. Es sind aber nicht nur die grünen Wälder auf den Kontinenten gefährdet, sondern auch die «Regenwälder der Meere»: die Korallenriffe. Sie bilden die grössten von Lebewesen geschaffenen Strukturen dieses Planeten mit einer Gesamtfläche von 600 000 Quadratkilometern. Auch hier gefährden die Klimakrise und die Nutzung der Ökosysteme durch den Menschen ganze Lebensräume mitsamt ihrer Fauna. Und auch hier müssen regionale Besonderheiten berücksichtigt werden, um passende Lösungen zu entwickeln. Zu diesem Zweck hat Tuias Team die offene Software DeepReefMap entwickelt. Sie basiert auf Deep Learning, einem Teilbereich des maschinellen Lernens, bei dem künstliche neuronale Netze, ähnlich wie das menschliche Gehirn, aus grossen Datenmengen lernen. DeepReefMap nutzt Unterwasservideos, wie sie beispielsweise von Tauchern mit GoPro-Kameras aufgenommen werden, um Korallenriffe zu kartieren, zu überwachen und in 3D-Modellen abzubilden. Es handelt sich um eine kostengünstige, gross angelegte Monitoringlösung, die speziell entwickelt wurde, um das Engagement unterentwickelter Regionen zu stärken und wirksame Naturschutzstrategien zu unterstützen.
Monitoring von Korallenriffen
«Wir haben DeepReefMap im Roten Meer erprobt und dabei eng mit lokalen Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern zusammengearbeitet», sagt Tuia. «So konnten wir eine Art Komplettpaket für den Naturschutz liefern, das weit über den KI-Ansatz hinausgeht.» Nun sollen Projekte in anderen Ländern und Regionen mit anderen Korallenriffen folgen, um den KI-Ansatz so agil und
anpassungsfähig wie möglich zu machen. Dann kann diese Technologie vielleicht auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Der Bedarf an KI-basierten Methoden dieser Art ist so gross wie die Lücken in unserem Wissen über globale Biodiversität. Um diese zu schliessen, muss Material aus verschiedenen Datenquellen genutzt werden, etwa Bilder, Audioaufnahmen, Texte und vielleicht auch DNA. Der Mensch allein stösst bei der Auswertung jedoch schnell an seine Grenzen. KI kann dagegen auch gigantische Mengen verschiedenartiger Daten organisieren, katalogisieren, durchsuchen und verarbeiten – kurz: auf massgeschneiderte Art und Weise analysieren. Das gelingt aber nur in Kooperationen über traditionelle Fächergrenzen hinweg. Hier müssen Experten aus so unterschiedlichen Bereichen wie Ökologie und Naturschutz, aber auch Datenwissenschaft und maschinelles Lernen zusammenkommen – so wie bei Tuias Projekten: «Keine einzelne Disziplin hat alle Antworten», betont der Wissenschaftler. «Aber gemeinsam können wir echte Veränderungen bewirken.» Für ihn ist das ein Herzensthema, weil er sich schon immer für das Wohlergehen der Natur interessiert hat. Deshalb hat er Geografie und Umweltwissenschaften studiert, später aber seine Liebe zur Informatik entdeckt: «Jetzt bin ich froh, an der Schnittstelle meiner beiden Leidenschaften arbeiten zu können, um vielleicht einen kleinen Beitrag zur Zukunft unseres Planeten zu leisten. » Indem er beispielsweise dem Privatleben alpiner Säugetiere nachspürt: Wann gehen Füchse in den Bergen auf die Jagd? Wohin genau wandern die Wölfe? Was treiben Rothirsche eigentlich, wenn sie denken, dass keiner zusieht? Und noch wichtiger: Ändern die Tiere ihr Verhalten, weil sich die Klimakrise und menschliche Aktivitäten massiv auf ihre Lebensräume in den Bergen auswirken? Auch in diesem Fall scheitern gängige Methoden oft. Direkte Beobachtungen durch den Menschen sind nur schwer systematisch durchzuführen. Sie können
die Tiere stören und so ihr Verhalten beeinflussen. An Tieren angebrachte Sensoren sind nützlich, um erste Verhaltensinformationen in grossem Massstab zu erhalten, lassen jedoch die feineren Details der einzelnen Tiere und ihre Interaktionen mit ihrer Umgebung ausser Acht. Kamerafallen werden dagegen fest installiert und zeichnen auf, wenn sich ein Tier in der Nähe bewegt. Sie halten einzigartige Verhaltensweisen und Interaktionen fest und sind dabei nur minimalinvasiv. Gerade in lang laufenden Projekten werden oft so viele Daten gesammelt, dass die Forscher diese kaum noch sinnvoll auswerten können.
Arten automatisch erkennen
Genau hier setzt der von Tuias Team in einer Kooperation entwickelte MammAlps-Datensatz an. Im Schweizerischen Nationalpark, der ebenfalls am Projekt beteiligt ist, wurden zunächst neun Videofallen installiert. Diese filmten Tiere wie Füchse, Wölfe und Rehe aus unterschiedlichen Perspektiven und zeichneten auch deren Geräusche auf. So entstanden mehr als acht Stunden dichtes Videomaterial: eine Tierbeobachtung nach der anderen. Die Forscher sichteten das Material und analysierten es. Sie zählten die Tiere und identifizierten die Arten, kategorisierten aber auch Verhaltensweisen wie Gehen, Grasen und Schnüffeln. Der Datensatz soll noch erweitert werden, um auch kleinere und seltenere Arten zu berücksichtigen. Eine erste Version ist bereits jetzt frei zugänglich, um KI-Modelle zu trainieren. Diese werden auf der Grundlage lernen, Tierarten und Verhaltensweisen automatisch zu erkennen, was dann zur Unterstützung der Forschung von Ökologen genutzt werden kann. MammAlps ist eine wichtige, neuartige Ressource – und gilt als neuer Standard der Tierbeobachtung.
«Ich möchte eine Gemeinschaft kluger Köpfe – Studierende, Forscher und Praktiker – aufbauen, die Technologien entwickeln und einsetzen, die für die Na-
tur wichtig sind», sagt Tuia. «Ich will faktenbasierte Erkenntnisse über die Auswirkungen des Klimawandels und anderer menschengemachter Veränderungen auf der Erde liefern. Nur so können wir als Gemeinschaft die richtigen Entscheidungen treffen – für die nächsten Generationen aller Lebewesen.»
Devis Tuia, ein gebürtiger Tessiner, hat zunächst Geografie an der Universität Lausanne und anschliessend Umwelttechnik an der EPFL studiert. Er promovierte im Bereich Fernerkundung an der Universität Lausanne. 2014 wurde Tuia Assistenzprofessor an der Universität Zürich, später ausserordentlicher Professor und dann ordentlicher Professor an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Seit 2020 leitet er das Labor für Computational Science for Environment and Earth Observation (ECEO) an der EPFL Valais/Wallis in Sion.

Award Sustainable Switzerland hat erstmals 15 Persönlichkeiten geehrt, die einen herausragenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.
ELMAR ZUR BONSEN
Zum ersten Mal sind am diesjährigen Sustainable Switzerland Forum (SSF) in Bern jeweils fünf «Sustainable Shapers» in drei Kategorien ausgezeichnet worden. Geehrt wurden Persönlichkeiten, die mit aussergewöhnlichem unternehmerischen, wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Engagement die nachhaltige Entwicklung vorantreiben – in und aus der Schweiz heraus. Eine hochkarätig besetzte Jury hatte die Preisträgerinnen und Preisträger aus mehr als 240 Nominierungen ausgewählt.
Leadership & Transformation
Einer der fünf Preisträger in der Kategorie Leadership & Transformation ist Albin Kälin, Gründer und CEO von Epeaswitzerland. Er zählt zu den Wegbereitern der Kreislaufwirtschaft. Als Brückenbauer zwischen Praxis, Forschung und Politik setzt er sich für zirkuläres Design in der Industrie ein.
Christian Zeyer, Co-CEO von Swisscleantech, engagiert sich für eine nachhaltige Wirtschaft und prägt auch die nationale Klimapolitik mit. Zusammen mit der Wohnbaugenossenschaft Oberfeld hat er mit seinem Unternehmen eine der ersten CO2-armen Siedlungen der Schweiz realisiert.
Hans-Dietrich Reckhaus, CEO der Reckhaus AG, hat sein Unternehmen vom Hersteller chemischer Insektenbekämpfungsmittel zum Vorreiter des Biodiversitätsschutzes transformiert. Zusammen mit Wirtschaftspartnern trägt er zur Schaffung insektenfreundlicher Lebensräume bei.
Julia Carpenter senkt als Mitgründerin und CEO des Startups Apheros, einer Ausgliederung der ETH Zürich, mit einem neuartigen Kühlsystem den Stromverbrauch von Rechenzentren. Die skalierbare Technologie verbessert die Energieeffizienz in der ICT-Infrastruktur und leistet einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Sektors.
Oliver Brunschwiler, Verwaltungsrat und Investor, erzielt mit strategischer Beratung und gezielten Anlagen messbare CO2-Reduktionen. Daneben gibt er sein Wissen als Dozent an eine neue Generation von Führungskräften weiter.
Knowledge & Opinion
In der Kategorie Knowledge & Opinion ist Nathalie Agosti eine von fünf Siegerinnen und Siegern. Als Gründerin und Managing Director der Beratungsfirma Outlive Advisory positioniert sie Themen wie mentale Gesundheit und Gleichstellung als Führungsaufgaben in der Wirtschaft. Durch
kreative Kampagnen erreicht sie eine breite Öffentlichkeit.
Der ebenfalls ausgezeichnete Walter Stahel hat das Institut für Produktdauerforschung gegründet. Er ist Professor, Autor und Mitglied des Club of Rome, Pionier und Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft sowie Ehrenpräsident des Vereins Next Generations.
Simone Nägeli ist Mitgründerin und Co-Geschäftsleiterin des Bildungsnetzwerks Acker Schweiz. Die Organisation vermittelt Kindern Naturerfahrungen und Ernährungskompetenzen. Davon haben bereits mehr als 12 000 Kids profitiert. Acker Schweiz gilt als Vorzeigebeispiel für transformative Bildung.
Mathis Wackernagel, Mitgründer des Global Footprint Network, hat mit dem ökologischen Fussabdruck ein global genutztes Instrument zur Messung von Nachhaltigkeit geschaffen. Mit dem «Earth Overshoot Day» sensibilisiert Wackernagel jährlich Millionen Menschen für die Übernutzung unseres Planeten.
Die Künstlerin Ursula Biemann verbindet Kunst mit ökologischer und wissenschaftskritischer Reflexion. Mit Projekten wie der Mitbegründung einer indigenen Universität im Amazonas fördert sie den Dialog zwischen den Kulturen – und inspiriert Bildungsprozesse weit über die Kunstwelt hinaus.

Vision & Innovation
Einer der Ausgezeichneten in dieser Kategorie ist der CFO und Mitgründer von Ecorobotix, Aurélien Demaurex. Mit seinem Unternehmen treibt er den Wandel zu einer umweltschonenden Landwirtschaft voran. Eine von Ecorobotix entwickelte Feldspritze spart mithilfe KI-gesteuerter Präzisionstechnologie in hohem Masse Düngemittel und Pestizide ein. Philipp Furler ist Mitgründer und CEO von Synhelion, einem Unternehmen, das aus der ETH Zürich hervorgegangen ist und CO2-neutrale Treibstoffe aus Sonnenenergie, CO2 und Wasser entwickelt. Erste Anwendungen bestätigen das Potenzial zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors.
Pirmin Jung, Gründer und CEO der Pirmin Jung Schweiz AG, ist ein Sustainable Shaper auf dem Gebiet des Holzbaus. Mit klarem Nachhaltigkeitsan-
spruch plant er innovative Grossbauten aus Holz. Projekte wie das «Haus des Holzes» zeigen, wie Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung im Bauwesen zusammenfinden.
Nicolas Rochat hat mit Mover Plastic Free Sportswear die erste plastikfreie Sportbekleidungsmarke gegründet, er führt das Unternehmen heute als CEO. Mit Materialinnovationen und Kooperationen setzt Rochat neue Standards in der Branche und klärt über Gesundheits- und Umweltgefahren von synthetischen Textilien auf.
Zu den Geehrten gehört auch Vincent Vida, Gründer und CEO von UpGrain. Er hat ein Verfahren entwickelt, mit dem das Abfallprodukt Biertreber in nährstoffreiche Zutaten für die Lebensmittelbranche verwandelt wird. Mit Europas grösster Upcycling-Anlage spart Upgrain dabei zusätzlich jährlich Tausende Tonnen CO2 ein.
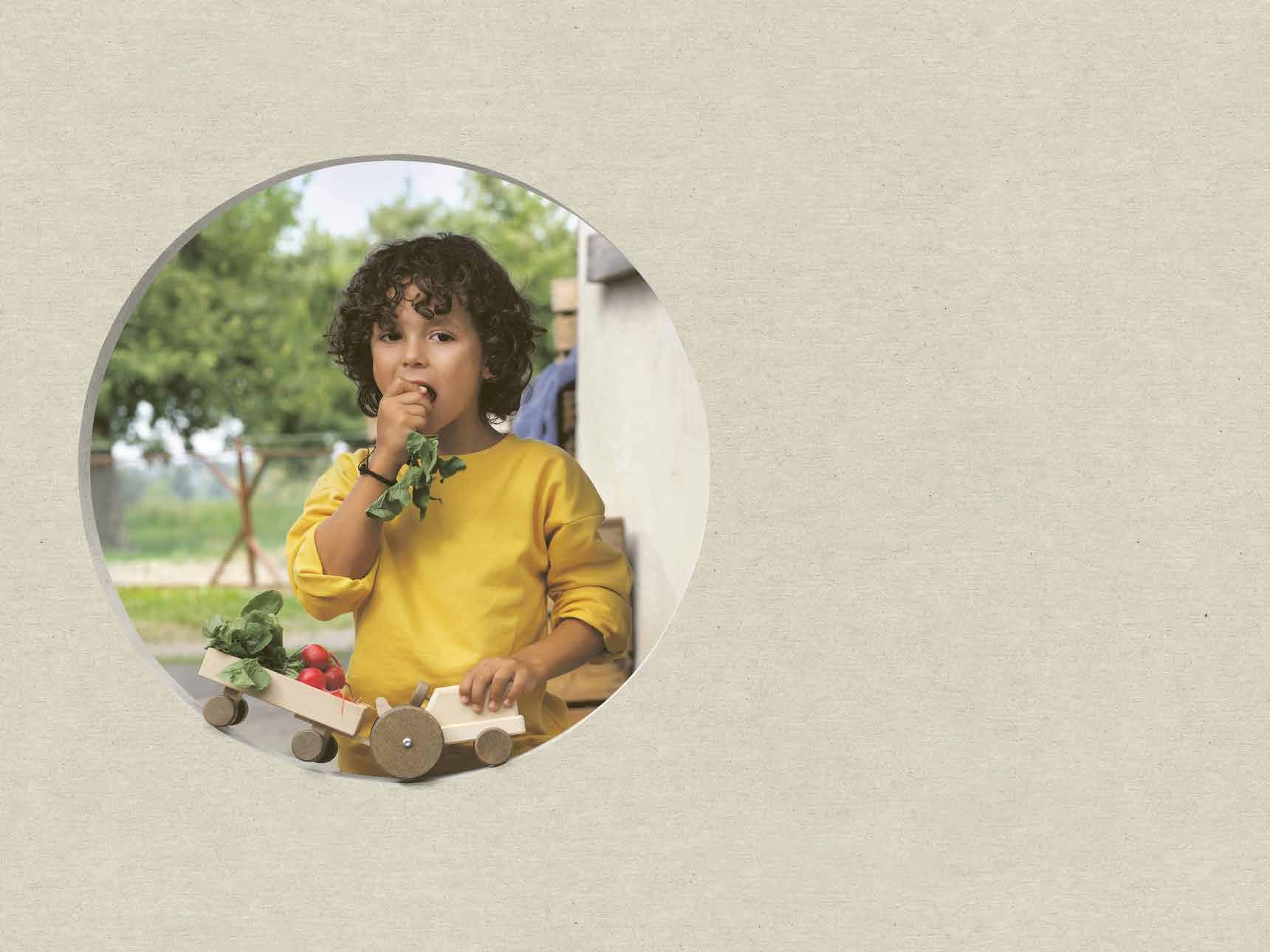
«P ap i, wa ru m fa hren wi rZug undunser Gemüse
st wage n? »
Damitwir fürunsereKinder eine Antwor thaben ,set zenwir unsfür Netto- Null -E missionen bisspätestens2050ein
Tatens tatt WorteN r. 102: Wirt ra nsport ierenWaren , wa nn immermög lich ,per Ba hn
Best Practice Ende Oktober hat die BMW Group ihre neueste iFactory in Betrieb genommen. Die zukunftsweisende Fabrik ermöglicht eine flexible Fahrzeugproduktion mit fast 90 Prozent tieferen CO2e-Emissionen als in traditionellen Werken.

ROBERTO STEFANO
Wenn in der jüngsten iFactory von BMW in Debrecen (Ungarn) rund 1000 Industrieroboter aus gut 450 Einzelblechen sowie einigen Aluminiumteilen die Karosserie des neuen BMW iX3 fertigen, erinnert dies an eine perfekt einstudierte Choreografie. Hochpräzise und effizient bewegen sich die Roboterarme im Takt. Pro Karosserie sind 4500 Schweisspunkte nötig. Diese bringen – erstmals in Europa –neuartige Schweisszangen an, die mit Strom statt Luftdruck betrieben werden, was eine deutlich wirkungsvollere Energienutzung erlaubt. Die einzelnen Teile werden nach Möglichkeit so miteinander verbunden, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer wieder leicht getrennt werden können und einfach wiederverwertbar sind. Jeder Montageschritt wird von Kameras genau überwacht. Digitale Technologien unterstützen den reibungslosen Ablauf und eine effektive und auch nachhaltigere Produktion. Effizient, digital und nachhaltiger –am neusten und innovativsten BMWStandort in Debrecen haben die Münchner ihr Konzept der iFactory, dass für alle Werke des Herstellers gilt, so konsequent wie noch an keiner anderen Produktionsstätte umgesetzt. Das iFactoryPrinzip steht für eine Produktion mit schlanken und effizienten Strukturen, einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, dem gezielten Einsatz digitaler Innovationen sowie dem Fokus auf die Mitarbeitenden.
Digitaler Zwilling
In diesem Sinne wurde das Werk in Debrecen vollständig digital geplant und zunächst als virtuelle Fabrik realisiert. Bereits im März 2023 erfolgte der virtuelle Produktionsanlauf, wodurch alle Prozesse vorab getestet und die realen Produktionslinien anschliessend präzise nach dem digitalen Zwilling aufgebaut werden konnten. Erstmals orientiert sich damit ein Produktionsstand-
ort nicht an einem einzelnen Leitwerk der BMW Group. Stattdessen bündelt er das Knowhow aus zahlreichen weltweiten Standorten, um eine effiziente und dennoch emissionsarme Produktionsstätte zu schaffen.
Verzicht auf fossile Brennstoffe
Einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion der CO2e-Emissionen in der Produktion des neuen BMW iX3 leistet die Lackiererei. Während Lackierereien traditionell mit Gas betrieben werden, um die hohen Temperaturen von bis zu 180 Grad Celsius zu erreichen, setzt das BMW-Werk in Debrecen vollständig auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Auf fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas wird im Normalbetrieb gänzlich verzichtet. Stattdessen deckt eine 50 Hektar grosse Photovoltaikanlage bis zu 25 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Werks direkt vor Ort ab. Fällt überschüssiger Solarstrom an – beispielsweise an arbeitsfreien Tagen –, wird dieser in einem 1800 Kubik-
meter grossen Wärmespeicher gesammelt, mit dem die Produktion auch an kalten Wintertagen warm gehalten werden kann.
Durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen können allein in der Lackiererei jährlich bis zu 12 000 Tonnen CO2e eingespart werden. Dies entspricht rund 60 000 Flügen von Zürich nach New York – also etwa 165 Flüge pro Tag: ein beeindruckender Wert. Die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Prozesse zieht sich durch die gesamte iFactory – oftmals unterstützt durch digitale Technologien. Im Presswerk beispielsweise, wo aus Stahl- und Alublechen die ersten Karosseriebauteile für ein neues Fahrzeug entstehen und das Metall unter dem hohen Druck der Pressen geformt wird, übernehmen digitale Lösungen wichtige Hilfsfunktionen. Kameras überwachen den Vorgang, eine KI erkennt beim Vergleich mit hinterlegten Referenzbildern automatisch mögliche Risse im Material und zeigt diese auf einem Bildschirm an. Mangel-

hafte Teile sowie bis zu 60 Tonnen Verschnitt, die jeden Tag bei Vollauslastung des Werks anfallen, werden – wie in anderen Werken der BMW Group auch –in einen geschlossenen Materialkreislauf für Stahl- und Alu-Blechabfälle überführt. Eine etwa 300 Meter lange Fördertechnik transportiert die Metallreste zum Verladen. Das gesammelte Material wird ausserhalb des Werks recycelt und für die Herstellung von neuen Stahloder Alu-Metallbahnen verwendet. In der BMW-iFactory bilden Maschinen, Fahrzeuge, Logistiksysteme und die Menschen zusammen ein Ökosystem. Auf grossen Bildschirmen ist sichtbar, wo Material knapp wird, wann eine Maschine gewartet werden muss oder wie sich die Geschwindigkeit einzelner Linien verändert. Meldet eine Anlage erste Schwächen, informiert sie automatisch das Wartungsteam, lange bevor die Maschine zu einem Stillstand kommt. Dank der vorausschauenden Instandhaltung, wie sie in Debrecen Alltag ist, können kostspielige Ausfälle und Ressourcenverschwendung vermieden werden.

Trotz aller Automatisierung bleibt der Mensch in der iFactory von BMW ein zentrales Element des Systems. Am neuen Standort arbeiten Fachkräfte, die mit Daten ebenso vertraut sind wie mit Werkzeugen, wobei Tablets Papierlisten ersetzen, während Augmented-RealityBrillen am Objekt aufzeigen, wo ein Bauteil eingesetzt werden muss.
Die Montageplätze sind ergonomisch gestaltet, Roboter übernehmen monotone Arbeiten, Menschen sichern Qualität und Prozessstabilität. BMW nennt dies «kollaborative Produktion». Es geht nicht darum, Menschen zu ersetzen, sondern sie durch Technik zu entlasten und besser in die Abläufe einzubinden.
Labor für die Zukunft
Die iFactory in Debrecen ist für die BMW Group mehr als nur ein Werk. Sie ist auch ein Labor für die Zukunft. Hier testen die Münchner, was später in anderen Fabriken Standard werden soll. Die Verbindung von digitaler Planung, KI-gesteuerter Qualitätssicherung und CO2-freier Energieversorgung macht Debrecen einzigartig – und soll zum Vorbild für die gesamte Branche werden: intelligente, vernetzte und nachhaltige Produktion, die Ressourcen spart und damit den CO2-Fussabdruck der Fahrzeuge um fast 90 Prozent reduziert.
In der Praxis zeigen sich diese Fortschritte eindrücklich an dem in Debrecen produzierten BMW iX3: Bereits nach 21 500 Kilometern fährt er klimafreundlicher als ein vergleichbarer Verbrenner – mit Grünstrom sogar schon nach 17 500 Kilometern, mit Schweizer Strommix nach rund 18 500 Kilometern. Bei dem neuen Fahrzeug geht Nachhaltigkeit aber noch weiter: Rund ein Drittel des iX3 besteht aus recycelten Materialien. Dies unterstreicht den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz der BMW Group – und zeigt, wie verantwortlich moderne Mobilität heute sein kann.
Sustainable Switzerland Die Partner der Schweizer Nachhaltigkeitsplattform erläutern, welche Handlungsfelder für sie in diesem Jahr im Vordergrund stehen.
Environment, Social, Governance (ESG) – diese drei Begriffe stehen für die grossen Ziele und Herausforderungen unserer Zeit: den Schutz der Umwelt und des Klimas, die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Gewährleistung einer nachhaltigen Unternehmensführung.
Auch wenn zuletzt andere Themen wie der Gaza-Konflikt, die Auswirkungen der US-Zollpolitik oder Russlands Angriffe auf die Ukraine in den Vordergrund gerückt sind, bleibt Nachhaltigkeit eine zentrale Aufgabe. Mehr noch: Angesichts der fortschreitenden Erderwärmung und im Zeichen zunehmender geopolitischer Spannungen haben riskoresistente Lieferketten, CO2-Reduktion, nachhaltiger Ressourcenverbrauch und die Wahrung der Menschenrechte an Bedeutung gewonnen.
In vielen Unternehmen werden daher nach wie vor neue ESG-Projekte lanciert und vielfältige Initiativen auf den Weg gebracht. Die Partner der Nachhaltigkeitsplattform Sustainable Switzerland berichten im Folgenden, welche Aktivitäten und Projekte sie selbst im Laufe dieses Jahres gestartet haben, welche Ziele sie verfolgen und was sie bereits erreicht haben.
Das neue Klima- und Innovationsgesetz verlangt von Schweizer Firmen, ein Netto-Null-Ziel für ihre Emissionen zu setzen. Grosse Unternehmen übertragen diesen Druck auf ihre Lieferketten, was viele KMU betrifft.
Swisscom realisiert aktuell ein Pilotprojekt zur Unterstützung von KMU bei der Emissionsreduktion. Die neue Plattform konzentriert sich zu-

nächst auf Carrosserie- und Lackbetriebe und erleichtert die präzise Erfassung von CO2-Emissionen sowie die Planung und Umsetzung effizienter Reduktionsmassnahmen. Die Plattform ist offen und kann Daten aus bereits vorhandenen Nachhaltigkeitstools importieren und exportieren. Sie fördert so den harmonisierten Datenaustausch zwischen Unternehmen und vermeidet zeitaufwendiges Mehrfachreporting.
Ihre volle Wirkung enfaltet die Reduktionsplattform im Zusammenspiel mit Partnern, Lieferanten und Branchenakteuren. Gemeinsam entsteht ein Ecosystem, das Wissen und bewährte Praktiken bündelt, wodurch die nachhaltige Entwicklung der Branche gefördert wird. Die Lösung erleichtert den Unternehmen eine revisionssichere und transparente Erfüllung der Reporting-Anforderungen sowie den Einstieg ins Emissionsmanagement ohne doppelte Datenerfassung.
Nach der Pilotphase wird das Konzept auch für andere Branchen geöffnet, um weiteren KMU bei der zukunftssicheren Betriebsführung zu helfen.
Res Witschi, Nachhaltige Digitalisierung, Swisscom
Nachhaltig handeln
Ambitionen
Zusammen packen wir’s: Die Partner der Plattform Sustainable Switzerland verfolgen in ihren Unternehmen und Organisationen ambitionierte Ziele auf ganz unterschiedlichen Feldern der Nachhaltigkeit. Sie wollen die nachhaltige Entwicklung der Schweiz beschleunigen –und gehen mit gutem Beispiel voran. Was sie in den nächsten Jahren in den Bereichen Um-
welt, Soziales und Governance (ESG) erreichen möchten, haben sie für uns auf den Punkt gebracht.
Für weitere Informationen diesen QR-Code scannen.
Wir haben in unserem im Juni vorgestellten Umweltbericht 2025, der sich auf die Kernthemen Energie, KI und Resilienz konzentriert, mehrere neue Initiativen aufgeführt. Die drei wichtigsten Themenschwerpunkte 2025 sind für uns:
1. Gezielter KI-Einsatz: Google lanciert die Startup-Accelerators «KI für Energie» und «KI für die Natur», um die Entwicklung von KI-Applikationen in der Energiewirtschaft sowie spezifische Umweltherausforderungen anzugehen. Zudem wird die KIgestützte Technologie zur Vermeidung von Kondensstreifen in Partnerschaft mit Eurocontrol auf den europäischen Luftraum ausgeweitet.

2. Dekarbonisierung der Lieferkette: Die Bemühungen werden durch einen neuen Fokus auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigt, um die Herstellung von Google-Produkten mit 100 Prozent sauberer Energie abzudecken. Die Strategie priorisiert die Emissionsreduktion in drei Schlüsselbereichen: saubere Elektrizität für Rechenzentren und die zugehörige Lieferkette sowie ein kohlenstoffarmer Bau von Rechenzentren.
3. Einsatz fortschrittlicher Technologien: 2025 wurden wichtige Technologien eingeführt oder erweitert, darunter der erste von Google lancierte FireSat-Satellit zur KI-gestützten Früherkennung von Waldbränden, die nun weltweite Verfügbarkeit der kraftstoffsparenden Routenplanung in Google Maps und der Ausbau von Geothermieprojekten zur Gewinnung CO2-freier Elektrizität in Taiwan.
Dennis Tietz, Strategic Partnerships Manager, Google Schweiz
Nachhaltigkeit beginnt im Dialog. An der ETH Zürich verstehen wir Kommunikation nicht nur als Informationsaustausch, sondern als strategische und vielschichtige Aufgabe. Sie schafft Lern- und Begegnungsräume und verbindet faktenbasierte Inhalte mit Erkenntnistiefe. In unserer Kommunikation zum Netto-Null-Ziel sprechen wir von einer Expedition, auf der die ETH-Gemeinschaft unterwegs ist. Dabei setzen wir bewusst auf menschenzentrierte und immersive Narrative. So zum Beispiel im Dialogformat «Contours of Change» am

diesjährigen Sustainable Switzerland Forum. Es machte erlebbar, wie spielerische Elemente den wissenschaftsbasierten Dialog mit Perspektivenwechseln anregen können.
Die Kampagne «Kostbare Ressourcen» rückte 2024 das Thema Ressourcenschonung mit aktivierenden «Calls to Action» innerhalb der ETHGemeinschaft in den Fokus. Daran knüpft «Art of Transformation» an: Die diesjährige Herbstkampagne zeigt, wie scheinbar wertlose Restmaterialien –etwa aus dem Laborkontext der ETH – in ästhetische und zugleich nützliche Objekte verwandelt werden und dadurch neue Bedeutungszusammenhänge entstehen: Material wird zu Medium, Form zu Haltung, und Haltung zu einem ressourcenschonenden Bewusstsein, das an der ETH vielerorts bereits gedeiht.
Unsere Kommunikationsformate bauen Brücken zwischen Forschung, unserem Hochschulcampus und der Gesellschaft. Diesen Ansatz einer modernen Nachhaltigkeitskultur teilen wir regelmässig auch mit unseren internationalen Partnern –zum Beispiel im Rahmen der IARU (International Alliance of Research Universities) oder des ISCN (International Sustainable Campus Network). So wird durch Kommunikation die Grundlage für ein Verständnis geschaffen, das nachhaltigen Wandel voranbringt.
Julia Ramseier, Kommunikationsmanagerin, ETH Sustainability
UBS hat in diesem Jahr die Arbeit an der Erweiterung des Angebots und der Weiterentwicklung der internen Rahmenwerke fortgesetzt, um Kundinnen und Kunden beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Für Immobilienbesitzende stellen wir den digitalen Renovationsrechner neu auch im UBS e-banking zur Verfügung. Mit diesem kann ein individuell zugeschnittener Renovationsplan erstellt werden, inklusive einer Schätzung der zu erwartenden Renovationskosten und des konkreten Einsparpotenzials beim Energieverbrauch. Damit wollen wir energieeffiziente Renovationen weiter fördern und erleichtern. UBS entwickelt ihre nachhaltigen Finanzierungslösungen stetig weiter, um sie auch für kleinere Unternehmen zugänglicher zu machen. Dabei wird sichergestellt, dass die hohen Marktstandards erhalten bleiben. Die Konditionen richten sich nach dem Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Kundinnen und Kunden.

Über unsere Plattform UBS Helpetica, das Freiwilligennetzwerk für mehr Nachhaltigkeit, haben neben Privatpersonen auch Mitarbeitende von KMU die Möglichkeit, als Team sich freiwillig für soziale und ökologische Projekte zu engagieren. Ein weiterer Schwerpunkt von UBS liegt auf der Förderung von Innovation. Gemeinsam mit den Startup Nights haben wir dieses Jahr den Impact Tech Award lanciert. Prämiert werden jeweils drei Schweizer Startups, die wirtschaftlichen Erfolg mit einem messbaren gesellschaftlichen oder ökologischen Nutzen verbinden.
Matteo Bernardoni, Co-Head Client Needs –Product Management and Sustainability, UBS Switzerland
Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen ist fester Bestandteil der Strategie der BMW Group. Unsere Umweltziele umfassen den Schutz von Klima und Natur, die Förderung der Ressourceneffizienz sowie die Einhaltung hoher Umweltstandards entlang der gesamten Lieferkette. Wir bekennen uns klar zum Pariser Klimaabkommen und zur Reduktion von CO2-Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Ein gutes Beispiel ist der neue BMW iX3, das erste Serienmodell der Neuen

Egal, ob sie Mathematik, Mikrotechnik, Lebenswissenschaften oder Architektur studieren – die 1865 Erstsemester-Studierenden der EPFL haben im Frühjahrssemester den gross angelegten Start des gemeinsamen Kurses zur Nachhaltigkeit erlebt. Für die Hochschule ist es eine echte Herausforderung, so vielen Studierenden, die zudem aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen stammen, ein und denselben Kurs zu vermitteln.
Dieser neue Pflichtkurs wird im Verlauf des Jahres von mehr als einem Dutzend Fachleuten be-

treut und umfasst zahlreiche praktische Workshops. Er wurde aufgrund einer vor einigen Jahren an der EPFL durchgeführten Umfrage eingeführt, die zeigte, dass 60 Prozent der Studierenden sich nicht ausreichend auf soziale und ökologische Fragen vorbereitet fühlten. «Indem wir ihnen dieses Wissen gemeinsam vermitteln, wollen wir die Studentinnen und Studenten dazu anregen, über die Grenzen ihrer Disziplin hinauszuschauen, einen weiteren Blickwinkel einzunehmen und ihre Perspektive zu erweitern», betont Siroune Der Sarkissian, Projektleiterin für Nachhaltigkeit in der Lehre. «Es ist ein wichtiger Kurs an der Schnittstelle zwischen den sogenannten exakten Wissenschaften, den Geistes- und Sozialwissenschaften, der Wirtschaft und der Politik. Sein Ziel ist es, wache Ingenieurinnen, Ingenieure und Architektinnen, Architekten hervorzubringen, die die Herausforderungen der Welt verstehen und ihren zukünftigen beruflichen Fussabdruck im Sinne der Nachhaltigkeit reflektieren», erklärt Professor Jérôme Chappellaz, Hauptdozent des Kurses.
Siroune Der Sarkissian, Projektleiterin für Nachhaltigkeit in der Lehre, EPFL
Die Mobiliar Mit dem SAC für mehr Resilienz in den Alpen
Als genossenschaftliche Versicherung wollen wir mit unserem Engagement die Gesellschaft, aber auch Siedlungsgebiete und Bergregionen stärken und somit zu deren Resilienz beitragen. Die Partnerschaft mit dem Schweizer Alpen-Club ist ein Beispiel dafür, wie wir dies konkret umsetzen: Wir unterstützen den SAC dabei, die Wasserversorgung sicherzustellen und die Energieversorgung auf erneuerbare Quellen umzustellen.

BCG
Klasse: Er bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 805 Kilometern und senkt den Product Carbon Footprint in der Lieferkette gegenüber dem Vorgänger um 35 Prozent. Zudem fertigen wir ihn im Werk Debrecen im regulären Betrieb ohne fossile Brennstoffe.
In der Schweiz treiben wir Elektromobilität gezielt voran – durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur an unserem Standort und bei Handelspartnern sowie durch Programme, die Mitarbeitenden den Einstieg ins elektrische Fahren erleichtern. Im sozialen Bereich übernehmen wir Verantwortung: Wir sichern hohe Sozial- und Arbeitsstandards in der Lieferkette und fördern das gesellschaftliche Engagement unserer Mitarbeitenden. So haben sich unsere Teams aus Dielsdorf kürzlich mit freiwilligen Einsätzen im benachbarten Naturschutzgebiet Neeracherried für Biodiversität eingesetzt. Im Bereich Governance setzen wir auf robuste Compliance, Transparenz und glaubwürdige Unternehmensführung. Aktuell arbeiten wir an einer erweiterten ESG-Ausrichtung, um unseren positiven Beitrag in der Schweiz weiter zu verstärken.
Sven Grützmacher, Director Corporate Communications, BMW Group Switzerland
Gletscherschwund, weniger Schnee, häufigere Trockenperioden: Die Folgen der Klimaveränderungen treffen die SAC-Hütten unmittelbar. Besonders kritisch ist der zunehmende Wassermangel –denn ohne Wasser kein Betrieb. Hier setzt unsere Partnerschaft mit dem SAC an, die wir 2024 aufgebaut haben. Als Hauptpartnerin unterstützt die Mobiliar den SAC dabei, seine 152 Hütten fit für die Zukunft zu machen. So etwa bei der Chelenalphütte bei Göschenen: Hier wurde aufgrund des Gletscherschwundes die Wasserfassung verbessert, die nicht mehr gewährleistet war, und zusätzlich eine Zisterne eingebaut, die Regenwasser speichert und nutzbar macht. Oder bei der Dossenhütte im Berner Oberland, wo neu eine hochgebirgstaugliche, wassersparende Geschirrwaschmaschine und eine Photovoltaikanlage für effiziente Energieversorgung bereitstehen. Beide Projekte haben wir finanziell unterstützt, damit die Hütten nachhaltiger werden und zukunftsfähig bleiben. Unsere Initiativen sollen nicht nur unmittelbar wirken, sondern langfristig einen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt leisten, auch für kommende Generationen.
Belinda Walther Weger, Leiterin Public Affairs & Nachhaltigkeit, Die Mobiliar
2025 stand für BCG in Central Europe Schweiz im Zeichen ambitionierter Nachhaltigkeitsinitiativen, die einen klaren Beitrag zur Emissionsreduktion und Ressourcenschonung leisten. Aufbauend auf unserer globalen Net-Zero-Verpflichtung bis 2030, konnten wir unsere eigenen Emissionen bereits um über 90 Prozent (Scope 1 & 2) und 58 Prozent pro Kopf im Bereich Geschäftsreisen reduzieren. Parallel investieren wir in Carbon-RemovalTechnologien und zählen heute zu den zehn grössten Käufern langlebiger CO2-Entnahmekredite weltweit. Neben unseren internen Massnahmen treiben wir konkrete Projekte mit Partnern in der Schweiz voran. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit BirdLife Schweiz, damit BirdLife seine Wirkung für die Biodiversität und intakte Ökosysteme weiter steigern kann. Zudem begleiten wir Unternehmen bei der Dekarbonisierung von Lieferketten, bei zirkulären Geschäftsmodellen und beim Aufbau klimafester Strukturen – etwa durch Strategien für Textilrecycling oder CO2-arme Produktionsprozesse.

Wie eine aktuelle BCG-Studie zeigt, könnten klimabedingte Risiken bis zum Jahr 2100 bis zu einem Drittel der globalen Wirtschaftsleistung auslöschen – ein eindrücklicher Beleg dafür, dass die Kosten der Untätigkeit bei Klima- und Biodiversitätsschutz rasant steigen.
Unsere Erfahrung zeigt: Nachhaltigkeit gelingt, wenn sie Teil der Unternehmensstrategie wird. BCG Schweiz versteht sich als Partner, um Transformation messbar zu machen – von der Analyse über Impact-Quantifizierung bis zur Umsetzung. Damit leisten wir einen Beitrag, die Klimaund Ressourcenherausforderungen unserer Zeit zu bewältigen und neue Wachstumschancen für die Schweizer Wirtschaft nachhaltig zu erschliessen.

STEPHAN LEHMANN-MALDONADO
Zwei Frauen joggen am Basler Rheinufer entlang, beide in orangefarbenen Leuchtgilets. Sie laufen beinahe im Gleichschritt. Denn ihre Hände sind locker durch ein Band verbunden. «Achtung, jetzt kommen wir auf einen schmaleren Kiesweg!», ruft die eine der anderen zu. Sie ist ein Guide des Vereins Blind-Jogging und mit einer sehbehinderten Läuferin unterwegs. Die gemeinnützige Organisation bildet Sehende zu Begleitenden für Blinde und Sehbehinderte aus und vermittelt diese an sie.
Die Ausbildung zum Blinden-Guide dauert einen Tag, aber sie verändert alle Teilnehmenden nachhaltig: «Diese Erfahrung lässt mich die Welt mit anderen Augen sehen», sagt eine Kursteilnehmerin. Sie ist nur eine von zahlreichen Freiwilligen, die über die Plattform UBS Helpetica auf «Blind-Jogging» aufmerksam geworden sind.
Mehr Freiwillige
Auch Gabor Szirt, Präsident und Gründungsmitglied von Blind-Jogging und selbst Blinden-Guide, blickt zufrieden auf das Projekt zurück: «Dank der Kooperation mit UBS Helpetica konnten wir in den letzten Jahren viele Menschen zu ehrenamtlichen Blinden-Guides ausbilden», sagt er.
Das Projekt «Blinden-Guides für Lauftrainings» ist eines von mehr als 950 Projekten, die UBS Helpetica bereits realisiert hat. UBS lancierte die
Engagement Seit fünf Jahren bringt UBS Helpetica gemeinnützige Projekte und Freiwillige zusammen. 950 Vorhaben wurden schon realisiert – von Bewerbungstrainings bis zum Renovieren von Trockenmauern in den Bergen. Und es entstehen immer neue Ideen.
Vermittlungsplattform für Freiwilligenarbeit in der Schweiz vor fünf Jahren, um gemeinnützige Projekte, Ideen und Freiwillige zusammenzubringen. Sie arbeitet inzwischen mit mehr als 180 Non-Profit-Organisationen partnerschaftlich zusammen. Das Spektrum der Angebote reicht von Einsätzen gegen Foodwaste bis hin zu Bewerbungstrainings für Jugendliche und schutzbedürftige Menschen. «Jedes realisierte Projekt bringt uns einen Schritt näher zu einer besseren Lebensqualität in der Schweiz – und ist ein konkreter Beitrag zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der Uno», sagt Kaja Bertoli, Head Products, Channels & Marketing von UBS.
Als eines der ersten Unternehmen in der Schweiz hat UBS die Mitarbeitenden schon vor mehr als 20 Jahren zu Freiwil-

ligenarbeit motiviert: «Heute schenken rund 5 000 Kolleginnen und Kollegen jährlich über 50 000 Stunden ihrer Zeit für gemeinnützige Projekte», berichtet Bertoli und fügt an: «Mit UBS Helpetica haben wir vor fünf Jahren einen neuen Weg eingeschlagen. Wir öffneten unsere Plattform und unser Netzwerk für die Öffentlichkeit und konnten dadurch unser gesellschaftliches Engagement in der Schweiz vervielfachen.» Die Resonanz zeigt, wie stark die Wirkung ist, wenn Menschen gemeinsam anpacken.
Erlebnisreiche Einsätze
Wie kommt UBS Helpetica auf die Vielfalt an Projekten? Ganz einfach: Gemeinnützige Organisationen sowie Privatpersonen können Ideen für Freiwilligeneinsätze in den Bereichen Umwelt, Soziales, Bildung und Unternehmertum einreichen. Davon wird reger Gebrauch gemacht: Seit Bestehen der Plattform sind 1300 Ideen eingegangen.
Bei jedem eingereichten Projekt prüft ein Expertengremium, wie es sich auf das Gemeinwohl in der Schweiz auswirken dürfte. Erfüllt es die Kriterien von UBS Helpetica, wird das Projekt auf der Plattform publiziert. Wer sich freiwillig engagieren möchte, kann auf UBS Helpetica ein passendes Projekt finden, das seinen Interessen entspricht – und sich auch gleich anmelden.
Angesichts des fünfjährigen Jubiläums sind bei UBS Helpetica zahlreiche Schreiben von Partnern eingetroffen. Unisono bestätigen sie, dass UBS Helpetica ihren Projekten und Organisationen zu einer neuen Sichtbarkeit verholfen habe. «Wir schätzen die Plattform sehr. Dank ihr konnten wir zahlreiche Freiwillige in der ganzen Schweiz
erreichen und erlebnisreiche Einsätze für Mensch und Natur durchführen», schreibt zum Beispiel Fabian Freuler, Projektleiter Natur & Landschaft des Naturparks Beverin. Der Naturpark-Verbund rund um den Piz Beverin hat ein ambitioniertes Ziel: Er will die kostbaren Natur- und Kulturgüter bewahren, die lokale Wirtschaft stärken und den naturnahen Tourismus fördern. Projekte wie dieses lassen sich nur mit Freiwilligenarbeit verwirklichen. So haben Freiwillige letztes Jahr beispielsweise eine 100-jährige Trockenmauer auf der Alp Durnan erneuert. «Die Arbeiten empfand ich als Mischung aus Naturerlebnis, Sport und Meditation», lautete das Feedback einer Teilnehmerin. Eine Naturerfahrung etwas anderer Art konnten freiwillige Helferinnen und Helfer im Greyerzerland machen. In einem Wald des Parc de la Pépinière sanierten sie im Frühling einen Entdeckungspfad, der die breite Öffentlichkeit für Wildbienen sensibilisiert und anschaulich aufzeigt, wieso der Schutz ihres Lebensraums wichtig ist. Dabei hat das Projekt des Vereins FreeTheBees eine hohe Dringlichkeit: Von über 600 heimischen Wildbienenarten sind bereits mehr als 10 Prozent ausgestorben und 45 Prozent gefährdet.
Chancen für KMU
Neben den öffentlichen Projekten für die breite Bevölkerung bietet UBS Helpetica auch Corporate-VolunteeringProjekte an. Unternehmen können Projekte exklusiv für ihre Mitarbeitenden buchen. Ihr Vorteil: Ihre Mitarbeitenden können an einem professionell organisierten Freiwilligeneinsatz teilnehmen –
bei sehr geringem Aufwand für das Unternehmen. Die Erfahrung zeigt: Bei ihren Engagements tauchen die Freiwilligen in neue Welten ein und schärfen ihr Bewusstsein für die gesellschaftliche Verantwortung. Darüber hinaus stärken die Einsätze den Teamgeist und fördern die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Auch fürs Corporate Volunteering reicht die Bandbreite vom Einsatz gegen Foodwaste bis hin zur Bekämpfung von Neophyten, um die einheimische Biodiversität zu fördern.
Gegen den Trend
Ist es einfach, Freiwillige für ein nachhaltiges Projekt zu motivieren? Seit der Pandemie ist es anspruchsvoller geworden, heisst es bei vielen Non-Profit-Organisationen. Mit ihrem schweizweiten Netzwerk unterstützt UBS Helpetica Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen dabei, unkompliziert zueinanderzufinden. Zudem vereinfacht sie sowohl die Auswahl wie auch die Durchführung von Freiwilligeneinsätzen. Kurz: UBS Helpetica ist ein innovativer Ansatz, um das Gemeinwohl zu fördern und sich gegenseitig zu unterstützen. Niemand verkörpert das als Sinnbild schöner als die beiden Joggerinnen in Basel: Gemeinsam kommt man besser zum Ziel.
Nachhaltig handeln
UBS Helpetica ist eine Vermittlungsplattform für Freiwilligenarbeit in der Schweiz: Hier treffen sich gemeinnützige Organisationen sowie Menschen, die eine nachhaltig wirksame Projektidee in den Bereichen Umwelt, Soziales, Bildung und Unternehmertum haben, mit Freiwilligen, die sich in einem solchen Projekt engagieren wollen. Interessierte können sich auf dem Portal direkt für ein Projekt ihrer Wahl anmelden.
Für weitere Informationen diesen QR-Code scannen.
ROBERTO STEFANO
Mit den ersten Schneefällen verändert sich nicht nur die Landschaft, sondern auch die Situation auf den Strassen: Rutschige Fahrbahnen und eine schlechte Sicht erhöhen die Unfallgefahr und führen Jahr für Jahr zu einem Anstieg der Carrosserieschäden. Deren Reparatur ist komplex, aufwendig und vor allem energieintensiv. Besonders Lackierkabinen und Trocknungsanlagen sowie die Arbeit mit Kompressoren und Schweissgeräten verbrauchen sehr viel Energie. Werden ganze Teile wie Türen, Stossstangen oder Kühlerhauben ersetzt statt repariert, steigt der Ressourcenverbrauch zusätzlich an. Alles in allem ist mit einer Fahrzeugreparatur in den Carrosserie- und Lackbetrieben ein erheblicher CO2-Ausstoss verbunden. Umso mehr braucht es griffige Massnahmen, will die Branche, wie im Dekarbonisierungsfahrplan festgehalten, bis 2050 das Ziel Netto-Null erreichen. Denn viele Betriebe – insbesondere KMU – stehen erst am Anfang ihrer Reise. Zwar erfassen sie schon heute zahlreiche Daten zur CO2-Berechnung für Kunden, Regulatoren oder Versicherungen. Doch die reine Messung reicht nicht aus. Damit sich der Aufwand längerfristig lohnt, sind auch effektive und kosteneffiziente Massnahmen erforderlich. Noch mangelt es allerdings an geeigneten Hilfestellungen für die Betriebe, die sowohl die Messungen als auch die Massnahmenplanung übernehmen.
Druck aus der Lieferkette
Gleichzeitig wird der Ruf nach mehr Nachhaltigkeit aus der Lieferkette immer lauter. Wollen die vor- und nachgelagerten Unternehmen ihre Verantwortung vollständig wahrnehmen, reicht es nicht, wenn sie sich nur auf ihren eigenen Betrieb konzentrieren. «CO2-Emissionen entstehen nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch vor- und nachgelagert, etwa beim Ein- oder Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen», erklärt Christian Zeunert, Strategie und Nachhaltigkeit bei der Zurich Versicherung Schweiz. Daher liegt es im Interesse aller Beteiligten, die Emissionen der einzelnen Betriebe möglichst gering zu halten. «Die Carrosserie- und Lackbetriebe können einige Massnahmen ergreifen, um in Zusammenarbeit mit Partnern aus ihrer Wertschöpfungskette energie- und ressourceneffizienter zu werden – inklusive des Grundsatzes ‹Reparatur vor Ersatz, wo sinnvoll›», ergänzt Zeunert. Um ihnen ein geeignetes Werkzeug bereitzustellen, haben sich mit dem Lackhersteller AkzoNobel, dem Automobilunternehmen Amag, den Versicherern Zurich und Allianz sowie dem ICTUnternehmen Swisscom gleich mehrere namhafte Unternehmen in einem Pilotprojekt zusammengeschlossen. Ihr Ziel: eine Lösung, die Emissionen einfach messbar macht, kosteneffiziente Reduktionsmassnahmen verständlich aufzeigt und so einen realistischen Weg zu NettoNull ermöglicht.
Best Practice Carosseriereparaturen und Lackierarbeiten sind energieintensiv. Eine neue digitale Plattform soll die Betriebe dabei unterstützen, ihre Emissionen zu erfassen und Reduktionsmassnahmen zu ergreifen. Gemeinsam initiiert haben das Pilotprojekt Amag, Akzo Nobel, Zurich, Allianz und Swisscom. Die Zusammenarbeit bringt viele Vorteile.

Das Reparieren und Lackieren von Autos verursacht viele Emissionen. Über eine neue Plattform lässt sich der CO2-Ausstoss effizient erfassen – und zielgerichtet reduzieren. SHUTTERSTOCK
Den Startpunkt bildet das Erfassen der CO2-Emissionen der Betriebe, die heute in der Regel anhand von Fragebögen erhoben werden. «Diese Fragenkataloge sind oftmals uneinheitlich, kompliziert und erfordern ein erhöhtes Know-how der Befragten», weiss Salvatore Malomo, Business Development Manager bei Azko Nobel. Dies sei nicht gerade förderlich für die Qualität der Daten. Zudem werden solche Erhebungen von vielen Unternehmen separat durchgeführt, was mit einem hohen Zeitaufwand bei den KMU verbunden ist. «Mit einer einheitlichen, einfachen, aber branchenspezifischen Befragung kann man bereits einen erheblichen Fortschritt erzielen», ist Malomo überzeugt. Das Ziel der Initianten war deshalb eine Plattform, welche die wesentlichen Emissionsquellen einbezieht und so den Betrieben eine praktikable und effiziente
«Viele KMU stehen unter Druck. Ihnen muss man aufzeigen, dass es sich lohnt, Emissionen zu senken.»
Res Witschi, Swisscom
Unterstützung auf dem Weg zu NettoNull bietet. «KMU haben wenig Zeit und oftmals nur einen beschränkten Zugang zu den für die Berechnung nötigen Informationen. Umso wichtiger war es für uns, nur jene Datenpunkte abzufragen, mit denen ein wesentlicher Teil der CO2Emissionen berechnet werden kann», erklärt Res Witschi, Delegierter für nachhaltige Digitalisierung bei Swisscom.
Offen für andere Systeme Neben der einfachen Anwendung überzeugt die Plattform aufgrund ihrer Offenheit für andere Systeme: Wer bereits mit einem Tool oder begleitet durch einen Berater seine CO2-Emissionen bestimmt hat, muss diese nicht nochmals neu erfassen. Bestehende Datensätze können einfach eingebunden, hochgeladen und harmonisiert werden.

So werden Doppelspurigkeiten vermieden und die Vergleichbarkeit von Emissionen innerhalb der Branche sichergestellt. Die Plattform bildet deshalb auch keine Konkurrenz zu bestehenden Tools, sondern ergänzt diese und stellt die Vergleichbarkeit sicher. Sind die Daten erst einmal erfasst, lassen sich im Dashboard der Plattform die daraus ermittelten CO2-Emissionen sowie geeignete Reduktionspfade berechnen und grafisch visualisieren. Die Betriebe haben auch die Möglichkeit, notwendige Angaben mit anderen Firmen für deren CO2-Reporting zu teilen. Schliesslich erlaubt es die Plattform den Betrieben, die optimalen Investitionszeitpunkte so zu planen, dass CO2Reduktion und Kosteneinsparungen in Einklang gebracht werden. «Viele KMU sind wirtschaftlich unter Druck. Mit der Plattform können wir aufzeigen, dass es sich lohnt, die CO2-Emissionen zu senken – und das in Franken und Rappen», ergänzt Witschi.
Kooperation zahlt sich aus Das Pilotprojekt für Carrosserie- und Lackbetriebe ist nicht nur aufgrund der anwenderfreundlichen und zielgruppengerechten Lösung aussergewöhnlich, sondern auch wegen ihrer Entstehung. Statt eigenständige Modelle zu entwickeln, haben die Initianten von Anfang an die Vorteile und das Potenzial einer Kooperation erkannt und sich für dieses Vorhaben zusammengeschlossen – auch wenn sie sonst Mitbewerber sind. Zudem konnten weitere Akteure einbezogen werden. Ein Ansatz, der auch in anderen Bereichen Schule machen könnte. «Wir verfolgen alle das gleiche Ziel: Wir wollen die CO2-Emissionen in der Wertschöpfungsketten der Carrosserie- und Lackbetriebe reduzieren und die Be-
triebe dabei unterstützen. Dann macht es auch Sinn, wenn wir zusammen ans Werk gehen», sagt Ina Walthert, Head of Group Sustainability bei der Amag. Und dieses Vorgehen scheint Früchte zu tragen: Mit Swisscom als technischem Entwickler sowie Gestalter und Vermittler innerhalb des Ökosystems konnten für die Plattform-Testphase zehn Betriebe aus der Carrosserie- und Lackbranche gewonnen werden. Deren Rückmeldungen sind äusserst positiv ausgefallen und ermutigend. «Der Mehrwert der neuen Lösung ist für uns klar ersichtlich. Die Bereitstellung der notwendigen Daten zur CO2-Berechnung hat bei mir einen Prozess in Gang gebracht, bei dem ich durch gezielte Massnahmen CO2 und Kosten sparen werde», bestätigt Achim Loth von der Carrosserie Erni AG.
Derzeit befindet sich die Plattform noch in der Testphase. Das Ziel der Initianten ist es aber, bereits nächstes Jahr ein Roll-out durchzuführen, wenn das finale Fazit der Carrosserie- und Lackbetriebe sowie der Kooperationspartner ebenfalls positiv ausfällt. Anschliessend will man rund 250 KMU für die neue Lösung begeistern und ihnen damit eine genauso einfache wie wirkungsvolle Unterstützung auf dem Weg zu NettoNull bieten. In der Zwischenzeit finden Gesprächen mit weiteren Unternehmen aus anderen Sparten statt, die ähnliche Bedürfnisse wie die Carrosserie- und Lackbetriebe kennen. Denn die Plattform ist nicht auf eine einzelne Branche beschränkt, sondern soll möglichst breit zum Einsatz kommen. Für Simon Meili, verantwortlich für Nachhaltigkeit im Schaden und den Versicherungsprodukten bei der Allianz Suisse, ist denn auch klar: «Wollen wir Netto-Null-Emissionen bis 2050 erreichen, kommen wir nur gemeinsam ans Ziel.»
Engagement Im Rahmen von Aktionen wie «Samedi du partage» übernimmt Lidl Schweiz Verantwortung für die Gesellschaft.
ELMAR ZUR BONSEN
In wenigen Tagen, am 28. und 29. November, ist es wieder so weit, dann werden zahlreiche Westschweizer Einkaufszentren und Geschäfte zu Schauplätzen einer ungewöhnlichen Solidaritätsaktion. So wie in den letzten Jahren stehen beim «Samedi du partage», einer Sammelaktion für armutsbetroffene Menschen, zahlreiche Freiwillige vor und in den Läden und bitten Kundinnen und Kunden, ein zusätzliches Produkt in den Einkaufswagen zu legen und es für Bedürftige zu spenden. Eine kleine Geste mit grosser Wirkung. Denn mit den gesammelten Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs können soziale Einrichtungen und Suppenküchen in der Region ihre Vorräte auffüllen und so Tausenden bedürftigen Menschen auf ganz direkte Weise helfen. Gefragt sind vor allem Grundnahrungsmittel wie Reis, Öl, Konserven oder Hygieneartikel. Schülerinnen und Schüler, Familien, Vereine, Rentner und Rentnerinnen sowie Mitarbeitende machen mit, erkennbar an ihren blauen Schürzen und den pinkfarbenen oder grünen Tragetaschen, die längst zum Markenzeichen der Aktion geworden sind. Manche verteilen Flyer, andere stapeln Kisten, wieder andere sagen «Merci» für jedes Päckchen, das den Besitzer wechselt. «Es ist unglaublich, zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, einen Teil ihrer Einkäufe an andere abzugeben, denen es nicht so gut geht», erzählt Amélie Höllmüller, Kommunikations- und Fundraising-Managerin bei Samedi du partage. «Am Ende des Tages stapeln sich die Paletten, und man spürt, dass hier echte Gemeinschaft entsteht.»
Anspruchsvolle Logistik
Den Samedi du partage (auf Deutsch: «Samstag des Teilens») gibt es bereits seit mehreren Jahren. Lidl Schweiz ist seit 2019 in Genf und seit 2023 in der ganzen Westschweiz mit dabei – aus Überzeugung und als Ausdruck nachhaltigen Engagements. In 33 Westschweizer Filialen des Detailhändlers machen die Mitarbeitenden auf die Solidaritätsaktion aufmerksam, und viele Kundinnen und Kunden ziehen spontan mit. Allein im vergangenen Juni sind am Samedi du partage in den beteiligten Lidl-Geschäften insgesamt 18 Tonnen Lebensmittel und Hygieneprodukte gesammelt worden. Die gespendeten Waren werden an den Ausgängen der Filialen abgegeben
und von Lidl Schweiz zu Hilfsorganisationen transportiert, wo sie sortiert und anschliessend über die Partnerverbände und Sozialdienste an Menschen in prekären Verhältnissen weiterverteilt werden. Die Sammlung, Lagerung und Verteilung der grossen Warenmengen ist logistisch und kostenmässig durchaus anspruchsvoll. «Auch hier kommt es darauf an, jede Verschwendung zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Hilfe schnell und effizient geleistet wird», so Amélie Höllmüller.
Toni Wolf, Vertriebsleiter bei Lidl Schweiz, erläutert, was sein Unternehmen bei Samedi du partage antreibt: «Als landesweit tätiger Detailhändler und Akteur mit einer Vorbildfunktion möchten wir einen spürbaren Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung und zum Gemeinwohl in der Schweiz leisten, dies auch als lokaler Arbeitgeber. Die Aktion bietet eine tolle Gelegenheit, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden bedürftige Menschen aus der Region zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein.»
Der Samedi du partage erinnert laut
Amélie Höllmüller daran, dass Solidarität keine abstrakte Idee ist, sondern zum Beispiel schon mit einer Dose Thunfisch oder einem Paket Nudeln beginnt. «Wer mitmacht, trägt dazu bei, dass in zahlreichen westschweizerischen Städten und Gemeinden niemand vergessen wird –und dass aus einem Samstag mehr wird als nur ein Einkaufstag: ein Tag des Teilens.» Angesichts der angespannten wirtschaftlichen und sozialen Lage, die durch steigende Preise und sinkende Kaufkraft gekennzeichnet ist, ruft Höllmüller dazu auf, auch den nächsten Samedi du partage am kommenden Wochenende tatkräftig zu unterstützen –durch ehrenamtliche Mitarbeit und die Bereitschaft zum Spenden.
Für Lidl Schweiz bildet die Beteiligung an der Westschweizer Solidaritätskampagne nur eines von mehreren sozialen Engagements. Das Unternehmen ist gerade auf lokaler und regionaler Ebene als gefragter Förderer zur Stelle: Hiervon profitieren vor allem örtliche Vereine, aber auch Schul- und Ferienlager, die für ihre Aktivitäten Naturalspenden, Gutscheine oder finanziellen Zuschüsse erhalten.
Spenden erhöht
Eine Aktion grösseren Stils ist die Kampagne «A Lidl Help», die der Detailhändler bereits mehrfach in seinen schweizweiten Filialen durchgeführt

Insgesamt 33 Westschweizer Lidl-Filialen beteiligen sich an der Solidaritätsaktion «Samedi du partage»
hat: Kundinnen und Kunden konnten lang haltbare Grundnahrungsmittel an armutsbetroffene Personen spenden. Lidl Schweiz selbst legte auf jeden dieser Artikel das identische Produkt nochmals obendrauf oder ergänzte die Spenden durch entsprechende Geldbeträge. Die Waren wurden jeweils an die gemeinnützigen Organisationen Schweizer Tafel und Tischlein deck dich geliefert. «A Lidl Help» ist bisher fünf Mal durchgeführt worden – mit grossem Erfolg. Kundinnen und Kunden des Detailhändlers spendeten seit 2020 insgesamt mehr als 73 000 Produkte. Lidl Schweiz arbeitet auch noch an anderer Stelle mit der Schweizer Tafel und Tischlein deck dich zusammen, ebenso auch mit dem Centre Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL) und weiteren regionalen Akteuren. «Täglich holen diese Organisationen unsere einwandfreien, aber nicht mehr den Kundenbedürfnissen entsprechenden Lebensmittel ab», so Lidl-Vertriebsleiter Wolf.

Tiefkühlgeeignete Produkte mit einem Verbrauchsdatum wie Frischfleisch und Frischfisch werden neuerdings am Tag des Verbrauchsdatums zur Verlängerung der Haltbarkeit auch eingefroren. Die Lebensmittelhilfe-Organisationen holen die Kisten ab und verteilen die gekühlten und tiefgekühlten Produkte an soziale Institutionen oder direkt an armutsbetroffene Personen. Eine Aktion im XXL-Format: «Allein zum Ende des Geschäftsjahrs 2024 konnten mit unseren über 500 Tonnen gespendeten Lebensmitteln rund 1,5 Millionen Mahlzeiten zubereitet werden», berichtet Toni Wolf.
Engagierte Mitarbeitende Kampagnen dieser Art erfüllen gleich mehrere Zwecke auf einmal: Sie mobilisieren die spendenbereite Kundschaft, schärfen schweizweit das Bewusstsein für Armut und Bedürftigkeit und sorgen für konkrete, unmittelbare Hilfe. Der soziale Einsatz wird bei Lidl Schweiz aber nicht nur in Projekten nach aussen getragen, sondern auch intern gefördert. So hat sich der Detailhändler zum Ziel gesetzt, dass jährlich 10 Prozent der Mitarbeitenden mit einem Pensum von über 40 Prozent sich im Rahmen eines Corporate-Volunteering-Tages engagieren. Ein Beispiel ist – neben dem Samedi du partage – die Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz, bei der Freiwillige aus dem Unternehmen in bestimmten Naturschutzprojekten mit anpacken, etwa beim Schutz von artenreichen Wiesen. Auf diese Weise werden Umweltund Sozialprojekte personell unterstützt. Gleichzeitig stärken solche Einsätze das Gemeinschaftsgefühl im Unternehmen – und sie sensibilisieren die Mitarbeitenden für Nachhaltigkeitsthemen.
Nachhaltig handeln
Soziales Engagement geht für Lidl Schweiz Hand in Hand mit Nachhaltigkeit und Transparenz. Das zeigt sich in mehreren Dimensionen: Nachhaltigkeit gehört für Lidl Schweiz zum Kern des eigenen unternehmerischen Wertesystems. Im Fokus stehen die Themen «Biodiversität achten», «Klima schützen», «Ressourcen schonen», «Fair handeln», «Gesundheit fördern» und «Dialog führen».
In seinen Nachhaltigkeitsberichten gibt Lidl Schweiz unter anderem Auskunft über Verpackungskreisläufe, CO2-Emissionen, Energieverbräuche und Biodiversitätsmassnahmen.
Das Unternehmen hat eine überarbeitete Nachhaltigkeitswebsite lanciert, um Zahlen, Fakten und Projekte noch transparenter zu präsentieren. Die Website «Gesagt, getan» bietet detaillierte Einblicke in das nachhaltige Handeln von Lidl Schweiz.
Für weitere Informationen diesen QR-Code scannen
Umwelt Die Stadt Zürich will die Treibhausgasemissionen bis 2040 auf netto null senken. Damit das gelingt, müssen alle mithelfen – auch die Kulturinstitutionen. Ein Pilotprojekt schafft die Grundlagen dafür.

Das seit 1957 bestehende Kammerorchester Camerata Zürich spielt im Schweizer Musikleben eine wichtige Rolle –
MANFRED PAPST
Die durch den Menschen verursachte Erderwärmung ist das spürbarste Zeichen eines immer rascher verlaufenden Klimawandels, der ökologische und soziale Krisen befürchten lässt. Die Begrenzung der globalen Erwärmung ist deshalb ein Hauptziel der Umweltpolitik. Diese ist darauf angewiesen, dass sowohl die grossen «Player» zu internationaler Zusammenarbeit finden als auch nationale und lokale Initiativen greifen. Hier setzt die Stadt Zürich an. Sie will die direkten Treibhausgasemissionen bis 2040 auf Netto-Null senken; die indirekten Emissionen sollen bis 2040
gegenüber dem Stand von 1990 um 30 Prozent reduziert werden. Die Zürcher Stimmbevölkerung hat den städtischen Klimaschutzzielen 2022 mit einer klaren Mehrheit zugestimmt. Um diesen Entscheid umzusetzen, werden die städtischen Strategien, Planungen und Massnahmen derzeit überprüft, verschärft oder neu erarbeitet. Massnahmen zur Reduktion der direkten Treibhausgasemissionen werden hauptsächlich in den Bereichen Gebäude, Energie und Mobilität umgesetzt. Dabei geht es etwa um den Ersatz fossiler Heizungen durch klimafreundliche Lösungen, den Ausbau der Fernwärme oder die Produktion von erneuerbarem Strom.
Die indirekten Treibhausgasemissionen kann die Stadtverwaltung – abgesehen von einer klimafreundlichen Beschaffung – kaum unmittelbar beeinflussen. Hier setzt sie vor allem Massnahmen um, die klimafreundliches Verhalten ermöglichen und erleichtern, beispielsweise durch Beratung oder die Bereitstellung und Förderung von klimafreundlichen Alternativen zu den bestehenden Lösungen.
Fundierte Methoden
Damit Emissionen gesenkt werden können, muss man erst einmal genau wissen, wo überall sie anfallen. Deshalb gewinnt
die Klimabilanzierung auch im Kulturbereich zunehmend an Bedeutung. Besonders bei städtisch geförderten Kulturinstitutionen wie Orchestern oder Konzerthäusern wird transparentes Reporting zu Energieverbrauch, Mobilität und Ressourcen künftig eine zentrale Rolle spielen. Im Rahmen eines städtischen Pilotprojekts haben daher insgesamt sechs Kulturinstitutionen – darunter die Musikinstitutionen Camerata Zürich und Tonhalle Zürich – kürzlich eine neue Klimabilanz erstellt, und zwar auf Basis des international breit anerkannten Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Eine möglichst transparente und umfassende Erfassung der Treibhausgas-
«Künstlerische Exzellenz und Nachhaltigkeit schliessen sich nicht aus»
Interview mit Gustavo de Freitas, Direktor der Camerata Zürich, über die Klimabilanzierung des Kammerorchesters
Herr de Freitas, was hat Sie dazu bewogen, eine Klimabilanzierung für die Camerata Zürich erstellen zu lassen? Gustavo de Freitas: Als eine von der Stadt und dem Kanton Zürich subventionierte Kulturinstitution liegt es in unserer Verantwortung, zum Klimaziel unserer Stadt beizutragen. Die Klimabilanzierung ist ein Angebot der Stadt Zürich, das uns ermöglicht, unsere Emissionen besser zu verstehen. Es war eine interessante Erfahrung, unser eigenes Tun einmal nicht aus der künstlerischen oder administrativen Perspektive zu betrachten, sondern aus einer rein ökologischen.
Und was haben Sie dabei gelernt? Ich habe nun ein klares Bild, wo wir überhaupt Emissionen verursachen. Da wir weder über ein eigenes Gebäude noch über ein Gastronomieangebot verfügen, war von vornherein klar, dass unser CO2-Abdruck gering ausfallen würde. Spannender war der Blick auf Logistik, Material und Infrastruktur: Wie viel Papier wird für Noten benötigt? Welche Transporte und Reisen fallen an? Solche Fragen helfen uns, Routineprozesse zu hinterfragen.
Welche Posten fallen am stärksten ins Gewicht?
Ganz klar die Mobilität. Für uns heisst das konkret: Wie reisen unsere Gastkünstler an und wie kommt das Publikum zu uns? Wir arbeiten mit internationalen Musikerinnen und Musikern zusammen, was gewisse Reisewege mit sich bringt. Das Publikum ist überwiegend lokal, aber auch da summieren sich viele kurze Strecken. In diesen Berei-

chen können wir etwas optimieren, allerdings darf dies nie auf Kosten der künstlerischen Qualität geschehen.
Welche Zahl steht für Sie unter dem Strich?
Wir liegen insgesamt bei rund 8,5 Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht einem Hinund Rückflug von drei Personen von Zürich nach New York. Für ein Kammerorchester mit einem Dutzend Projekten pro Saison ist das verschwindend klein. Zwei Drittel dieser Menge sind auf die Personenmobilität zurückzuführen – davon etwa 60 Prozent auf Reisen von Gastkünstlerinnen und Gastkünstlern und 30 Prozent auf die Mobilität des Publikums.
Was folgern Sie daraus?
Dass künstlerische Exzellenz und Nachhaltigkeit sich nicht ausschliessen müssen. Wir werden selbstverständlich weiterhin internationale Künstlerinnen und Künstler einladen und auch Gastspiele im Ausland realisieren. Das gehört zu unserer künstlerischen Mission und zu unserem Bildungsauftrag. Eine Kulturinstitution darf nie primär aus der Emissionsperspektive betrachtet werden. Das wäre sehr kurzsichtig. Wir
fördern Bildung, Austausch und Verständnis zwischen Menschen und Kulturen, und das ist ebenfalls nachhaltige Arbeit, wenn auch auf einer anderen Ebene.
Wie könnten Sie Emissionen optimieren?
Man kann Anreize schaffen: zum Beispiel eine zusätzliche Hotelnacht anbieten, wenn Gastkünstler mit dem Zug anreisen, oder dem Publikum schon beim Ticketkauf die bequeme Anreise mit dem öV empfehlen. Interessant ist: Nur vier Prozent unseres Publikums kommen mit dem Auto, verursachen aber rund die Hälfte der Publikumsemissionen. Kleine Massnahmen können also durchaus grosse Wirkung erzielen.
Welche Summe ziehen Sie?
Unsere Klimabilanzierung hat bestätigt, dass künstlerische Exzellenz und ökologisches Bewusstsein gut vereinbar sind, solange man das Thema mit Augenmass behandelt. Für uns war das eine Übung, die uns konkret hilft, bewusster zu handeln. Und sie zeigt klar: Auch mit relativ bescheidenen Mitteln kann eine Institution wie die Camerata Zürich durch zielgerichtetes Handeln kulturell, gesellschaftlich und ökologisch viel bewegen.
«Eine
allumfassende Treibhausgasbilanzierung ist essenziell
für die
Ausarbeitung wirkungsvoller Massnahmen.»
Simon Muntwiler, Nachhaltigkeitsmanager ETH Zürich

bilanz gemäss GHG Protocol verfolgt auch die ETH Zürich. Diese setzt sich für fundierte Methoden der Klimabilanzierung sowie für ein verlässliches Reporting ein und stellt ihr Wissen dazu proaktiv zur Verfügung. Ziel des Wissensaustauschs ist es, dass Institutionen in die Lage versetzt werden, einen messbaren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten und –im Falle von Kulturinstitutionen – ihren kulturellen Auftrag auch hinsichtlich der Klimawirkung einzuordnen. «An der ETH bemühen wir uns, die Treibhausgasemissionen für die ETH selber möglichst genau zu berechnen», sagt Simon Muntwiler, Nachhaltigkeitsmanager im Stab ETH Sustainability. «Unser Bestreben ist es, die Ergebnisse und auch die Berechnungsgrundlagen möglichst transparent zu kommunizieren und damit einen hohen Standard zu setzen.» Der ETH Zürich dient die Klimabilanzierung als wichtige Grundlage für die Ausarbeitung von wirkungsvollen Massnahmen auf dem Weg zu netto null Treibhausgasemissionen. Daher erachtet es Simon Muntwiler auch als sehr unterstützenswert, dass dank dem Pilotprojekt der Stadt Zürich Institutionen wie das Kammerorchester Camerata Zürich befähigt werden, diese Grundlage für sich ebenfalls zu erarbeiten und sinnvoll einzusetzen. Obwohl sich die absolute Menge der Emissionen der Camerata Zürich und der ETH stark unterscheiden, resultieren für beide ähnliche Dilemmata – zum Beispiel im Hinblick auf Flugreisen. Umso wichtiger sind eine transparente Kommunikation und das Teilen von Best-Practice-Ansätzen.
Im Prozess viel gelernt
Die Erstellung einer allumfassenden Klimabilanz war für die ETH ein lehrreicher Prozess – dasselbe gilt für die Camerata Zürich. Das seit 1957 bestehende Kammerorchester, das im Schweizer Musikleben eine wichtige Rolle spielt, beschäftigt 16 Berufsmusikerinnen und -musiker. Das Ensemble verfügt weder über eigene Proberäume noch über einen eigenen Konzertsaal, und es geht selten auf grössere Tourneen. Wie sieht seine Klimabilanz aus, und wie hat Gustavo de Freitas, seit 2022 Direktor der Camerata Zürich, das Projekt erlebt? Darüber spricht er im nebenstehenden Interview. «Ich habe in dem Prozess viel gelernt», bilanziert er, «und weiss jetzt, wo wir Einsparungen vornehmen können, ohne Abstriche an unserer künstlerischen Exzellenz zu machen.»
Unternehmen Nach Angaben der Ratingagentur Inrate schneiden die hier ansässigen Firmen im internationalen Vergleich gut ab. Die Schweiz setzt auf konkrete Ziele und hat die regulatorischen Vorgaben für nachhaltige Finanzen still und stetig ausgebaut.
ROB MITCHELL
Im Laufe dieses Jahres war in Banken, in der Vermögensverwaltung und in der Unternehmenslandschaft weltweit ein Trend zu beobachten: Man rückte deutlich von der Linie ab, Nachhaltigkeitsthemen zu priorisieren. Wesentliche Einflussfaktoren hierfür sind anhaltende regulatorische Unsicherheiten sowie ein politischer Kurswechsel bezüglich Klimaneutralität und internationale Klimaabkommen – insbesondere in den USA. Von diesem offensichtlichen Gegenwind scheint die Schweiz bislang nicht beeindruckt zu sein. Sie verfolgte weiterhin ihren Ansatz auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft: Seit 2022, als die Vorgaben zur nichtfinanziellen Berichterstattung im Obligationenrecht in Kraft traten, hat sie auch die regulatorische Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Finanzwirtschaft still und stetig ausgebaut. Eine Analyse der Schweizer Nachhaltigkeitsagentur Inrate zeigt, dass Schweizer Unternehmen im ESG-Gesamtleistungsranking (ESG steht für Environment, Social und Governance) den achten Platz unter 28 OECD-Staaten einnehmen – damit gehören sie mit einer Durchschnittsbewertung (Note B) eindeutig zur Spitzengruppe. Besonders deutlich ist diese konstante Performance in den Sektoren Energie, Kommunikation und Rohstoffe –genau jenen Branchen, die andernorts unter strenger ESG-Beobachtung stehen.
Geschäftsrisiken im Fokus
Am 1. Januar 2025 trat in der Schweiz das Klima- und Innovationsgesetz in Kraft. Es schreibt Netto-Null-Emissionen bis 2050 als gesetzliche Verpflichtung für alle Unternehmen im Land fest. Zudem stellt das Gesetz Fördermittel in Höhe von 1,2 Milliarden Franken bereit, wobei bis zu 50 Prozent der Kapital- und Betriebskosten für innovative Dekarbonisierungsprojekte übernommen werden können. «Die Schweiz setzt auf Wesentlichkeit statt auf symbolische Gesten», erklärt Saurabh Srivastava, Managing Director von Inrate. «Die ESG-Rahmenwerke hierzulande fokussieren sich auf

reale Geschäftsrisiken, insbesondere auf klimabezogene finanzielle Risiken. Sowohl Vermögensinhaber als auch -verwalter erkennen den Wert dieser Analysen weiterhin an.»
Zwei relativ neue Rahmenwerke unterstreichen die fortwährende Bedeutung von Nachhaltigkeit im Schweizer Investitionsprozess. Der Swiss Stewardship Code, im Oktober 2023 von der Asset Management Association Switzerland (AMAS) und Swiss Sustainable Finance (SSF) eingeführt, ist ein Regelwerk, das auf Freiwilligkeit beruht und das Konzept der «doppelten Wesentlichkeit» vorsieht: Unternehmen müssen nicht nur offenlegen, wie Umwelt- und Sozialfaktoren ihre finanzielle Lage beeinflussen, sondern auch, wie ihre Geschäftstätigkeit die Umwelt und die Gesellschaft beeinflusst. Obwohl die doppelte Wesentlichkeit kein exklusiv schweizerisches Konzept ist, gilt sie als fortschrittlich. Als zentrales Element auch der EU-Gesetzgebung zur Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung stellt sie einen umfassenderen Ansatz dar als die ausschliessliche Betrachtung finanzieller Risiken. Die neun Prinzipien des Stewardship Codes reichen von Governance-Strukturen, die Nachhaltigkeit auf Vorstandsebene verankern, bis hin zu Abstimmungsmechanismen, die auf langfristige Wertschöpfung abzielen. Damit positioniert sich die Schweiz vor vielen europäischen Ländern, die noch mit den regulatorischen Herausforderungen nachhaltiger Finanzwirtschaft ringen.
Signifikante Verbesserungen
«Der Code geht weit über reine Compliance hinaus, da er den aktiven Dialog mit Portfoliounternehmen, Eskalationsstrategien und eine transparente Berichterstattung betont», so Saurabh Srivastava. «Er hat die Produktentwicklung bei grossen Datenanbietern beeinflusst, Engagement-Strategien institutioneller Investoren geprägt und dient als Vorlage für an-
«Nachhaltigkeit in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln»
Event Die Climate Week Zurich 2026 will zielgerichtete Lösungen für eine nachhaltige Zukunft voranbringen. Sustainable Switzerland ist einer der Partner.
dere Länder, die Alternativen zu überregulierenden Ansätzen suchen.» Dieser aktive Dialog trägt nachweislich zur Leistungsverbesserung bei, wie der Engagement Report 2024 von Inrate zeigt. «Wir konnten feststellen, dass eine aktive Einbindung tatsächlich Wirkung zeigt», berichtet der Nachhaltigkeitsexperte. «Bei 95 der von uns analysierten Unternehmen, bei denen das der Fall ist, konnten wir signifikante Verbesserungen bei 75 Leistungsindikatoren sowie eine stärkere Übereinstimmung bei den Zielen ihres Engagements feststellen.» Ein weiteres Rahmenwerk, das die nachhaltige Ausrichtung der Schweiz unterstreicht, ist das Finma-Rundschreiben 2026/1 zu naturbezogenen finanziellen Risiken, das Ende 2024 veröffentlicht wurde. Es enthält verbindliche Vorgaben für Banken und Versicherungen, Risiken proaktiv zu managen – mit klaren Governance-Strukturen und einer Bewertung der finanziellen Wesentlichkeit von Risikoexpositionen. Diese Risiken müs-
auch interessierte Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Die Veranstaltenden betonen, dass sie mit der Climate Week aber nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch eine messbare Wirkung im privaten wie im öffentlichen Sektor erreichen wollen: durch Partnerschaften, Investitionen und veränderte Verhaltensweisen.
Motor für Innovation
ELMAR ZUR BONSEN
Sechs Tage lang wird sich Zürich im kommenden Frühjahr in eine Bühne für Klimaschutz, Innovation und Transformation für die breite Öffentlichkeit sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik verwandeln. Rund 150 Events, Workshops, Exkursionen und Diskussionsforen stehen vom 4. bis 9. Mai 2026 auf dem Programm der Climate Week Zurich. Angestossen wurde die Initiative von ecoinvent, Google, GreenBuzz und vielen weiteren Partnern, die zeitnah hinzustiessen, wie die ETH Zürich, der Kanton Zürich und auch Sustainable Switzerland.
Die Climate Week Zurich versteht sich als dezentrale Plattform für Nachhaltigkeit und Innovation, die Akteure
aus Kultur, Politik, Unternehmenswelt und Wissenschaft zusammenbringt. Dem unabhängigen, gemeinnützigen Trägerverein geht es darum, Anpassungs-, Resilienz- und Risikominderungsstrategien zu beschleunigen – sowohl lokal als auch global. Gemeinsam mit allen Organisationen, die sich in der Schweiz für Nachhaltigkeit engagieren, soll die Zusammenarbeit gestärkt, die Einbindung weiterer Partner erleichtert und der Dialog mit europäischen Vertreterinnen und Vertretern intensiviert werden.
Mutiges Handeln
«Wir unterstützen Initiativen, die beweisen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können», erklärt Johannes Pokorny, Managing Director der Climate Week Zurich. «Unsere Mission ist es, den richtigen Rahmen zu schaffen, um branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, die Nachhaltigkeit in einen Wettbewerbsvorteil verwandelt. Wir glauben, dass wirtschaftliche Transformation nur durch mutiges, gemein-
schaftliches und integratives Handeln möglich ist, das Mensch, Planet und Profit in Einklang bringt.»
Aktuell engagieren sich bereits mehr als 20 Experten aus verschiedenen Branchen im Team der Climate Week Zurich. Das breit gefächerte Programm wird ab dem kommenden Februar auf der Website climateweekzurich.org abrufbar sein (s. Kasten) und soll sowohl Fachleute als

«Das Impact Measurement ist für uns zentral. Wir möchten im Anschluss an die Climate Week Zurich genau herausfinden, welchen Mehrwert wir geliefert haben, um zukünftige Ausgaben zu gestalten. Von unseren Partnern verlangen wir deshalb auch, dass sie ganz konkrete Vorstellungen davon haben, wen und was sie mit ihren Events erreichen möchten», so Johannes Pokorny. «Ob Sie als Fachkraft Ihre Organisation zukunftssicher machen möchten, als Politiker die Bedürfnisse von Wirtschaft und Gesellschaft verstehen möchten, als Bürger sinnvolle Massnahmen ergreifen möchten oder als Student Ihre zukünftige Karriere erkunden möchten –die Climate Week Zurich bietet Inspiration, praktisches Wissen und wertvolle Kontakte.»
Für Zürich sei die Climate Week 2026 darum mehr als ein Event, betont Johannes Pokorny. «Die Stadt könnte ein Motor sein für Innovation, neue Geschäftsmodelle und partizipative Projekte. Sie hat die Chance, sich als führender Standort für klimafreundliche Technologien und nachhaltiges Wirtschaften in Europa zu profilieren. Wir sind für alle Organisationen offen, mit uns hier zusammenzuarbeiten.»
sen in bestehende Risikokategorien wie Kredit-, Markt- oder operationelle Risiken integriert werden, statt separat behandelt zu werden. Die Umsetzung erfolgt gestaffelt: Grosse Institute müssen bis Januar 2026, kleinere bis 2027 und alle bis spätestens 2028 vollständige Naturrisikoabdeckungen vorweisen. «Dieser Zeitplan trägt der Tatsache Rechnung, dass Banken und Versicherer noch nicht über die nötige Dateninfrastruktur, über Analysekapazitäten und Expertise im Risikomanagement verfügen, um Naturrisiken umfassend zu bewerten», erklärt Saurabh Srivastava. «Zwar verfügen alle Institute über Programme zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, und 90 Prozent haben kurzfristige Reduktionsziele, doch bei Themen wie Biodiversitätsrisiken sind die Offenlegungen bislang noch sehr begrenzt.»
Trotz der Fortschritte durch diese beiden Rahmenwerke wäre es jedoch irreführend, die ESG-Landschaft in der Schweiz als durchwegs positiv darzustellen. Es bestehen weiterhin regulatorische Unsicherheiten sowie eine komplexe Mischung aus freiwilligen und verpflichtenden Kodizes – einige mit Fokus auf doppelte Wesentlichkeit, andere ausschliesslich auf finanzielle Materialität. Zudem gibt es Unterschiede zwischen den Ansätzen der Schweiz und der EU: Während die Schweizer Vorgaben stärker auf Aktivitäten der Unternehmen setzen, welche die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen, liegt der Schwerpunkt der EU auf risikobasierter Berichterstattung.
Die Bedeutung von ESG-Ratings hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Diese dienen dazu, Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen nach ökologischen, sozialen und GovernanceKriterien zu bewerten, um vor allem Investoren besser zu informieren. Dazu werden öffentlich zugängliche Daten analysiert und Interviews durchgeführt. Das Ergebnis wird meist als Note oder Punktzahl dargestellt.
Nachhaltig handeln
Sustainable Switzerland lädt im Rahmen der Climate Week Zurich zu einer Veranstaltung am 5. Mai 2026 ein. Das Programm der Climate Week gliedert sich in mehrere Themenstränge:
Transformation und Resilienz umfasst die Aspekte Risikomanagement, Lieferketten, nachhaltige Energie, Natur- und Artenvielfalt.
Finanzierung und Innovation beinhaltet Green Finance, Nature Tech, datenbasierte Lösungen und Kreislaufwirtschaft.
Politik und Governance fokussiert auf soziale Gerechtigkeit und Klimadiplomatie.
Wandel in Wirtschaft und Industrie richtet sich auf neue Geschäftsmodelle und branchenspezifische Transformation.
Kultur, Bildung und gesellschaftliches Engagement bietet lebendige Formate wie Quiz- oder ComedyAbende, Programme in Gemeindezentren und Theateraufführungen. climateweekzurich.org
Wirtschaft Kriege, Klimaschocks, Pandemien – angesichts weltweiter Krisen brauchen Unternehmen effiziente und zugleich widerstandsfähige Lieferketten. BCG empfiehlt einen neuen Ansatz: das «Cost of Resilience»-Modell.
GLEES
Globale Lieferketten sind wie Lebensadern für die Wirtschaft. Doch ein weitgehend reibungsloser freier Handel war gestern. Das hat viele Gründe. Ein besonders augenfälliger ist der amerikanisch-chinesische Handelsstreit, der in diesem Jahr immer wieder neu befeuert wurde. Seit April hat US-Präsident Donald Trump Zölle insbesondere auf chinesische Importe in grossem Stil ausgeweitet, einiges wieder zurückgenommen, um später erneut nachzulegen. Zeitweise erreichten die US-Zölle für Waren aus China 145 Prozent. Aber auch die Schweiz, die EU, Kanada und andere exportorientierte Handelspartner waren betroffen und reagierten zum Teil mit Gegenmassnahmen.
Die Dynamik im Welthandel hat sich 2025 intensiviert: Eine zunehmende Fragmentierung, Handelshemmnisse und geopolitische Spannungen zwingen Unternehmen dazu, ihre Beschaffungsstrategien und Produktionsnetzwerke neu zu denken. Vor diesem Hintergrund analysiert die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) in einer aktuellen Studie, wie Unternehmen die Balance zwischen Effizienz, also einem hohen Kostenbewusstsein, und Widerstandsfähigkeit, die wiederum Kosten verursacht, neu justieren müssen – ein Ansatz, der als «Cost of Resilience»-Modell bekannt ist.
Vier Megatrends
Die aktuellen Handelskonflikte bedeuten im Kern nichts anderes, als dass Staaten ihre ökonomische Stärke ausspielen, um eigene Interessen durchzusetzen. Darunter fallen für BCG übrigens auch gigantische staatliche Anreize in Milliardenhöhe, um die jeweiligen heimischen Industriezweige zu fördern. BCG sieht in solcher «Economic Statecraft» einen von insgesamt vier Megatrends, die das Lieferkettenmanagement von Unternehmen beeinflussen und damit vor grosse Herausforderungen stellen. Bei den drei anderen Megatrends handelt es sich um Klimarisiken, den zunehmenden Fachkräftemangel und den Siegeszug der Robotik. In ihrer Studie mit dem Titel «Balancing Cost and Resilience: The New Supply Chain Challenge» führen die Autoren aus, inwieweit diese Megatrends einen ohnehin schon vollzogenen Paradigmenwechsel in der globalen Beschaffung noch weiter antreiben.
Paradigmenwechsel? Tatsächlich hat sich laut BCG die Mentalität in der Beschaffung grundlegend geändert: Jahrzehntelang galt das Mantra «Cost is King». Hauptsache billig. Effizienz, Massenproduktion, Just-in-Time-Lieferung und Verlagerung von Produktion in Niedriglohnländer waren das Mass aller Dinge.
Dann kam Covid-19. Und 2022 griff Russland die Ukraine an. Plötzlich standen Fabriken still, Lieferketten rissen ab, wichtige Bauteile fehlten, Preise gingen durch die Decke. Es folgte ein radikaler Schwenk im Lieferkettenmanagement hin zur Devise «Resilienz um jeden Preis». Unternehmen reagierten
mit der Rückerverlagerung von Produktion, höheren Lagerbeständen und doppelter Absicherung, Diversifikation der Lieferketten mit mehr Nähe zu den Absatzmärkten… Doch das ist teuer –zu teuer. Die Explosion der Zölle 2025 dürfte einen Wendepunkt markiert haben. Denn BCG rechnet vor, dass heute dadurch immerhin 20 bis 30 Prozent der Gewinnmargen (EBIT) in sämtlichen Industrien auf dem Spiel stehen. Auch wenn sich natürlich schnell wieder alles ändern könnte.
Agil auf Störungen reagieren Doch im Sinne des Vorsorgeprinzips steht nun jedes Unternehmen vor der zentralen Frage: Wie kann man im Lieferkettenmanagement global wettbewerbsfähig bleiben und sich zugleich resilient aufstellen? BCG empfiehlt ein Betriebsmodell auf Basis einer «Kosten der Resilienz»-Mentalität. Die grosse Kunst besteht hierbei darin, Produktions- und Beschaffungsnetzwerke zu etablieren, die agil auf neue Hürden und unerwartete Störungen reagieren können, ohne Margen oder Marktanteile einzubüssen.
Dr. Johanna Pütz, Partnerin bei BCG und Expertin für Klima und Nachhaltigkeit mit Fokus auf Industriegüter und den Automobilsektor, bringt den Ansatz so auf den Punkt: «Wer Lieferketten nur an Kosten misst, wird in dieser Dekade Marktanteile verlieren. Der neue Standard ist der Cost of Resilience: Widerstandsfähigkeit als gezielte Investition, nicht als Zusatzkosten – verankert in Strategie, Budgets und Entscheidungen.»
Dieser Wandel im Management ist möglicherweise leichter gesagt als getan. Die alten Erfolgsrezepte, davon ist man bei BCG überzeugt, reichen jedenfalls nicht mehr aus. Denn die aktuellen Trends bringen selbst frühere Kostenführer ins Straucheln. Was also ist zu tun?
Dazu noch einmal ein Blick auf die Megatrends, Stichwort Klimarisiken: BCG hat bei einer Untersuchung der 50 grössten Produktionszentren weltweit errechnet, dass etwa acht Prozent der globalen Produktion durch Klimarisiken gefährdet sind, insbesondere die Elektronikfertigung und die Halbleiterproduktion in Asien. Johanna Pütz betont daher: «Klimabedingte Extremwetter sind längst kein ESG-Nebenthema mehr, sondern ein operatives Risiko:


vernachlässigt, droht Marktanteile zu verlieren.
Rund ein Drittel des weltweiten Hafenumschlags ist hoher Gefährdung ausgesetzt.» Das zwingt Unternehmen, erst einmal diese Risiken für ihre Standorte zu identifizieren. Eine solche erweiterte Risikoanalyse sehen übrigens die Schweiz und die EU in ihren Vorgaben beziehungsweise Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung vor. Die BCG-Geschäftsführerin und Partnerin macht klar: «Resilienz beginnt mit Transparenz, gefolgt von Standort- und Netzwerkentscheidungen – nicht erst im Krisenfall, sondern als Teil der strategischen Planung»
Das nächste Risiko, das es zu managen gilt, ist der Arbeitskräftemangel –heute zunehmend auch im Blue-CollarBereich, also in der Fertigung. Die gute Nachricht: Laut BCG möchten 23 Prozent der globalen Fachkräfte aktiv ins Ausland wechseln. Unternehmen, die auf diesem globalen Arbeitsmarkt mithalten wollen, müssen allerdings politische Lobbyarbeit betreiben und selbst fit dafür sein: Es geht um Visabestimmungen, Einwanderungspolitik und Ausbildungsprogramme, aber auch um Standortentscheidungen und ein kluges Employer Branding. Denn die besonders gefragten digitalen Talente suchen technologieorientierte Arbeitgeber und lebenswerte Grossstädte mit guter TechInfrastruktur. Nicht von ungefähr verlegte Oracle seinen Hauptsitz in die «Silicon Hills» von Austin in Texas.
Die Suche nach qualifizierten Fachkräften hängt auch eng mit dem Trend zur Einführung von Robotik zusammen. Diese disruptive Innovation könnte laut BCG vor allem dem Automobilsektor und der Logistik einen Produktivitätsschub um bis zu 50 Prozent verschaffen. China hat zwar bei der Installation von
Robotern weltweit die Nase vorn. Doch in der Produktion, Forschung und Anwendung sind Japan und Westeuropa führend. Wenn aber durch Robotik die Kosten drastisch sinken, stellt sich die Frage nach dem Sinn einer globalen Produktion mit ihren Lieferkettenproblemen.
Wettbewerbsfähigkeit sichern
Die Prüfung all dieser Trends inklusive Szenarienanalysen zur Geopolitik und zum Klima und die daraus folgende Festlegung der Strategie sind also unverzichtbar. So unterschiedlich Branchen «ticken» mögen: Erfolgreiche Unternehmen setzen laut BCG auf ähnliche Massnahmen. Sie eröffnen mehr Standorte für die eigene Produktion, diversifizieren jene der Zulieferbetriebe und sichern sich ab, indem sie mehrere
Nachhaltig handeln
Lieferanten für ein und dasselbe Produkt unter Vertrag nehmen (Dual Sourcing). Zudem bauen sie verstärkt auf regionale statt globale Lieferketten, auf Joint Ventures und multinationale Lieferkettenbroker, die mit Fabriken in vielen Ländern für mehr Flexibilität in der Beschaffung sorgen. Last, but not least brauchen Unternehmen auch die dafür geeigneten Lieferkettenexperten (s. Kasten). Diese Führungskräfte müssen ein breiteres Spektrum an Risiken als bisher managen und entsprechende Leistungsindikatoren im Unternehmen etablieren, mit denen sich der Gesamtwert der Beschaffung messen und Kompromisse zwischen Kosten und Resilienz bewerten lassen. Unternehmen, die es schaffen, beides auszubalancieren, sichern sich nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten wachsender Unsicherheit.
Sechs Massnahmen, um Kosten und Resilienz in den Griff zu bekommen:
1. Transparenz über die gesamte Lieferkette schaffen.
2. Risikomanagement auf geopolitische, klimatische und technologische Indikatoren ausweiten.
3. Automatisierung gezielt in die Standortwahl und Netzwerkplanung integrieren.
4. Klimarisiken frühzeitig in die strategische Planung einbeziehen.
5. Verfügbarkeit von Arbeitskräften als zentrales Kriterium bei Investitionsentscheidungen berücksichtigen.
6. Neue Leistungsindikatoren zur Bewertung des «Cost of Resilience» einführen.
Forschung Digitale Tools erleichtern, beschleunigen, ermöglichen. Doch immer mehr Menschen fühlen sich davon gestresst.
Das Mobiliar Lab für Analytik an der ETH Zürich erforscht, wie neue Technologien fürs Stressmanagement eingesetzt werden können.

MARTINA SCHÄFER
Daheim am Computer, Smartphone daneben. Eine Nachricht macht «ding!», eine andere «plopp». Noch schnell eine Antwort in den Chat, ein Mail verschicken. Der nächste Call beginnt, nebenher ein WhatsApp. Später kochen, essen, nochmals vor den Computer.
Digitale Technologien prägen unseren Alltag. Die vielen kleinen Helfer machen uns effizienter und vernetzen uns mit der Familie, dem Freundeskreis, der Firma und der Welt. Zeitlich und örtlich arbeiten wir so flexibel wie noch nie.
Diese digitale Freiheit hilft uns, private und berufliche Verpflichtungen besser zu vereinbaren. Doch sie schafft auch neuen Druck. Ständige Unterbrechungen, permanente Erreichbarkeit: Immer mehr Menschen fühlen sich im digitalen Dauerfeuer gestresst und erschöpft.
«Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol ermöglichen uns körperliche und geistige Spitzenleistungen, etwa für einen Sprint oder eine wichtige Präsentation», sagt Erika Meins, Leiterin des Mobiliar Lab für Analytik an der ETH Zürich. Stresshormone sind eine gute Sache –allerdings nur für kurze Herausforderungen. «Stress am Arbeitsplatz dauert oft länger an und es fehlt der körperliche Abbau», sagt sie. «Positiver Stress wird zu negativem Stress, wenn wir nicht mehr abschalten können, wenn er chronisch wird.»
Maus misst Stress
Am Mobiliar Lab für Analytik wird seit 2018 zum verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz und anderen neuen Technologien geforscht. Auch das Thema Stress ist ein Forschungsschwerpunkt. Bisher wurden digitale Arbeitsunterbrechungen meist nur hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Arbeitsleistung und Produktivität erforscht. Im Lab wurde erstmals bewiesen, dass sie sich auch auf die Menge des freigesetzten Cortisols auswirken – und damit auf die biologische Stressreaktion. Unter Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) gelang den Forschenden im Lab auch, lediglich mit Maus- und Tastaturaktivität Stress am Arbeitsplatz zu erkennen – ohne Smartwatch oder andere Geräte. Bewegt sich der Mauszei-
ger häufiger und zackig, ist das ein Hinweis auf Stress. Mit dieser Methode ist er sogar zuverlässiger erkennbar, als wenn nur die Herzrate aufgezeichnet wird. Stress zu messen, ist das eine, Strategien gegen chronischen Stress zu entwickeln, das andere: «In Bezug auf Stress können neue Technologien und künstliche Intelligenz gleichzeitig Teil und Lösung des Problems sein», erklärt Erika Meins. So hat das Lab ein Virtual-Reality-gestütztes Stressbewältigungstraining entwickelt. Dabei wird über die Atmung die eigene Herzaktivität kontrolliert. Sensoren messen, wie sich das Training auf die Herzfrequenz auswirkt. Sinkt diese, sinkt auch die Anspannung und in der virtuellen Landschaft der VR-Brille geht in Echtzeit die Sonne unter. Die damit erzielte körperliche Entspannung ist deutlich stärker als das
«Neue Technologien und KI können
Teil und Lösung des Problems sein.»
Erika Meins, Leiterin Mobiliar Lab an der ETH Zürich
gleiche Training vor einem normalen Bildschirm. Die technologische Begleitung wird unnötig, sobald die Methode einmal erlernt ist. Wenige Atemzüge genügen dann, um sich zu entspannen.
Kunst trifft Forschung
Wie sich das VR-Atemtraining anfühlt, testen Besuchende und Mitarbeitende zurzeit in einer Ausstellung am Hauptsitz der Mobiliar in Bern. Unter dem Titel «CTRL+ALT+RELAX, eine Ausstellung zum Durchatmen» vermischt sich Kunst mit digitalen Interaktionen. Speziell für die Ausstellung hat Mélodie Mousset das VR-Kunstwerk «Empathy Creatures» entwickelt, die auch an der Biennale in Venedig gezeigt wurde.
Die französische Künstlerin, die in Zürich lebt und arbeitet, war «Artist in
Barbara Agoba, Personalchefin der Mobiliar, über Gesundheit im Arbeitsalltag.
Es gibt viele Arten, mit Stress umzugehen: ihn bekämpfen, vermeiden oder abbauen. Wie handhaben Sie dies? Barbara Agoba: Am meisten hilft mir, dass ich im Moment präsent bin und mir immer wieder bewusst mache, wofür ich dankbar bin und sein darf. Die kleinen «Glücksmomente» im Alltag geben mir Energie, etwa ein guter Austausch im Team, der Sonnenaufgang, auch ein Spaziergang über Mittag oder das gemeinsame Abendessen mit meiner Familie. Und ich achte auf meinen Schlaf.
Wann ist Stress für Sie positiv? Es macht mir beispielsweise Freude, wenn ich gemeinsam mit meinem Team schwierige Themen erfolgreich umsetzen kann. Die positiven Aspekte der Arbeit kommen heutzutage gerade auch in den Medien oft zu kurz. Dabei spielen beim Thema Gesundheit auch der soziale Austausch, der strukturierte Alltag, sich einbringen und entwickeln können eine zentrale Rolle.
Als Leiterin Human Resources haben Sie eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeitenden. Was tut die Mobiliar, damit ihre Mitarbeitenden auch in stressigen Zeiten gesund bleiben?
Wir leben eine Unternehmenskultur, in der sich die Menschen auf Augenhöhe

begegnen und einander wertschätzen. Wir schützen und respektieren die Persönlichkeit und die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Unsere Führungspersonen orientieren sich am gemeinsamen Führungsverständnis. Ausserdem hat die Mobiliar flexible Arbeitsbedingungen, damit die Mitarbeitenden ihr Berufs- und Privatleben auch nach ihren Bedürfnissen gestalten können.
Welche Hilfestellungen bietet die Mobiliar in der Praxis an?
Da gibt es eine breite Palette, etwa interne Kurse zum Thema Resilienz, zum Umgang mit Belastung und Stress oder Erste Hilfe für die psychische Gesundheit. Beim Team Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) unserer Tochter XpertCenter können unsere Mitarbeitenden – und auch externe KMU –Dienstleistungen rund ums Thema Gesundheit am Arbeitsplatz buchen. Und in der aktuellen Ausstellung entdecken sie spielerisch, wie virtuelle Realitäten aktiv zur Entspannung beitragen können.
Residence» am Mobiliar Lab und hat sich für ihr Werk von dessen Stressforschung inspirieren lassen. In der Installation nehmen Besuchende mithilfe einer VR-Brille direkten Einfluss auf das Wohlbefinden einer virtuellen Kreatur, ähnlich dem Tamagotchi der 1990erJahre.
Technische Spielereien? Mitnichten. Erika Meins sieht grosses Potenzial beim Einsatz solcher Technologien fürs Stressmanagement. Im Lab werden weitere Anwendungen entwickelt, die beim Vorbeugen von chronischem Stress helfen sollen: eine App, die gezielte Muskelentspannung mit Biofeedback in VR-Technologie kombiniert, sowie eine sprachgesteuerte, personalisierte VR-Umgebung. Doch Technologie löst nicht alles. «Die richtige Balance beim Einsatz von Technologie ist wichtig», sagt Meins. «Zum Beispiel durch bildschirmfreie Pausen.» Neben einem guten Selbstmanagement stehen auch die Arbeitgeber in der Pflicht. «In unserer digitalen Arbeitswelt braucht es ein neues Verständnis für verantwortungsvolle Zusammenarbeit, etwa wenn es um Präsenzzeiten und störungsfreies Arbeiten geht.» Denn viel schneller als unsere von der Evolution geprägte Stressreaktion im Körper lässt sich die Arbeitskultur in einem Unternehmen weiterentwickeln.
«CTRL+ALT+RELAX, eine Ausstellung zum Durchatmen» am Hauptsitz der Mobiliar, Bundesgasse 35 in Bern, dauert noch bis am 31.12.2025. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.00–17.00 Uhr. Mehr Infos, auch zum Rahmenprogramm auf mobiliar.ch/relax
Nachhaltig handeln
Stress reduzieren im (digitalen) Alltag
Damit der Druck nicht zu gross und Stress nicht chronisch wird, gibt es verschiedene Vorkehrungen, die Sie treffen können:
Auf individueller Ebene:
Benachrichtigungen bei Mailund Chat-Programmen abschalten
Zeiten für fokussiertes Arbeiten einrichten
Anrufen, wenn etwas zur Erledigung mehr als drei E-Mails braucht
Bildschirmfreie Pausen einlegen, den sozialen Austausch pflegen
Atemtechniken zur Stressreduktion üben
Auf Unternehmensebene:
Flexible Arbeitsmodelle im Hinblick auf Pensum, Ort und Arbeitszeiten
Handlungsspielraum geben
Sensibilisierung der Mitarbeitenden und Vorgesetzten zum Thema (mentale) Gesundheit und Resilienz
Regelmässig den Mitarbeitenden «den Puls fühlen», zum Beispiel über Befragungen
Systematisches Absenzenzmanagement
Ergonomische, bedürfnisgerechte Arbeitsplätze
Interview Sandrine Dixson-Declève, Umweltwissenschaftlerin und Ehrenpräsidentin des Club of Rome, über systemischen Wandel, den Widerstand gegen Klima- und Gleichstellungsziele – und warum sie dennoch hoffnungsvoll bleibt.
Frau Dixson-Declève, der Club of Rome warnt seit über fünfzig Jahren vor den Gefahren grenzenlosen Wachstums. Hat die Welt nicht zugehört?
Sandrine Dixson-Declève: Ich arbeite seit 35 Jahren in diesem Feld – und wir haben substanzielle Fortschritte erzielt: in der Chemikaliengesetzgebung, bei Umweltmanagementsystemen, Nachhaltigkeit, Fahrzeugemissionen, Kraftstoffqualität und der Dekarbonisierung. Wir haben tatsächlich etwas bewegt. Und ja, dabei haben wir manche kräftig verärgert – das werte ich als gutes Zeichen. Jetzt geht es darum, diese Erfolge zu kanalisieren und für die nächste Phase zu nutzen: mehr Menschen mitzunehmen und Veränderung in ihrem Alltag spürbar zu machen. Da haben wir bislang unsere Chancen liegen lassen. In unserem Bericht «Earth for All» wollen wir daher die Deutungshoheit zurückgewinnen – und zeigen, dass dieser Weg zwar mit Hindernissen bewachsen ist, wir aber dennoch einen wertegeleiteten Kurs halten können.
Sind wir noch auf Kurs, um die Nachhaltigkeitsziele der UNO, die insgesamt 17 Sustainable Development Goals (SDGs), zu erreichen?
Die nüchterne Wahrheit lautet: Wir verfehlen weltweit die meisten SDGs. Es gibt massiven Widerstand gegen ESG –die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung –, gegen Diversität und Klimaziele, und das nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Und wir adressieren die nötigen systemischen Veränderungen nicht. Unsere Wirtschaft ist überfinanzialisiert, getrieben von Geld, Profit und vielfach auch Macht. Aktionäre diktieren, wie Unternehmen handeln. Deshalb müssen wir über Wachstum und Bruttoinlandprodukt hinausdenken –hin zu einer Wirtschaft, die zugleich den Menschen, dem Planeten und dem Wohlstand dient.
Ihr Bericht «Earth for All» skizziert zentrale Hebel für eine lebenswerte Zukunft. Die Hauptaussage lautet: Es ist nicht zu spät. Gilt das angesichts der aktuellen Weltlage noch immer? Ja, absolut. Wir haben die Lösungen –aber die Gesellschaft muss die Macht zurückerobern. Wir brauchen den Mut, jenen entgegenzutreten, die ihre Position allein für das Eigeninteresse ausnutzen, statt dem Gemeinwohl zu dienen. Das sind keine «kommunistischen» Ideen, sondern tief verankerte europäische Werte. Wir stehen an einem Scheideweg: auf der einen Seite eine eigennützige Regierungsführung – der «TechBro-Feudalismus» der USA –, auf der anderen Seite Führungskräfte, die stark von den Ereignissen in den Vereinigten Staaten, in Russland, China und auch vom Gaza-Konflikt absorbiert sind. Europa muss sein Selbstverständnis zurückgewinnen und einen eigenständigen, wertegeleiteten Weg wählen.
Wie viel Zeit bleibt uns dafür? Keine! Wir müssen jetzt handeln. Selbstzufriedenheit ist mit schuld an unserer aktuellen Weltlage. Die aktuelle US-Regierung fährt Bemühungen zum Klimaund Umweltschutz zurück, Europa steht unter Druck, Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit zu priorisieren – teils zulasten von Umweltauflagen. Viele Unternehmen sind zurückhaltend, um nicht ins Visier zu geraten. Aber wir müssen jetzt aufstehen, sonst ist es zu spät.
Was muss sich Ihrer Meinung nach konkret ändern? Wir werden gebremst durch Überfinanzialisierung und das Primat der Aktionäre: Kapitalflüsse dienen nicht Menschen, dem Planeten und dem Wohlstand der Allgemeinheit; Unternehmensführungen

und Politik sind von kurzfristigem Profit- und Machtdenken geprägt; geopolitisch dominieren Egos, die humanistische Werte verdrängen. Zudem verwehren wir weiterhin vielen Frauen den Zugang zu Bildung, politischen Ämtern und Aufsichtsräten – diese strukturelle Entmachtung schwächt ganze Gesellschaften.
Gleichstellung ist also eine zentrale Lösung?
Ja. Viele der heutigen Konflikte wurzeln in Frustration: Öl- und Gaskonzerne wollen Profite zurückgewinnen; TechBros (Anm. der Redaktion: umgangssprachlich für Personen in der Technologiebranche, die sich selbst als stereotyp männlich wahrnehmen, insbesondere in Unternehmen des Silicon Valley) suchen Kontrolle über Frauen, Technologie und die ganze Weltgemeinschaft –eine dystopische Vision. Die Trumpsche Weltanschauung des «Make America Great Again» steht für patriarchalische und teils monarchische Sehnsüchte. Wir müssen Frauen ihren rechtmässigen Platz in der Gesellschaft geben. Gleichstellung ist kein «Gender-Add-on», sie stellt humanistische Werte wieder her und stärkt zugleich die Wirtschaft.
Wie realistisch ist systemischer Wandel in der heutigen Zeit?
Ich sehe keine Alternative. Der Widerstand existiert, weil wir Fortschritte gemacht und damit viele Personen in Machtpositionen verärgert haben. Dazu zählen Politiker, die autokratische Totalmacht anstreben, und Unternehmen, die
nicht für die Werte einstehen, die unsere Wirtschaft leiten sollten. Menschen sollten sich entfalten können, nicht nur überleben. Der jüngste UN-Fortschrittsbericht zeigt: wirtschaftliche Entwicklung stagniert, Lebensqualitätsindikatoren sinken – auch in Europa.
Welchen Einfluss kann die Schweiz ausüben, um den Wandel voranzutreiben?
Nachhaltig handeln
1972 erschütterte ein Buch die Fortschrittsgläubigkeit der Welt: «Die Grenzen des Wachstums». Der erste Bericht an den Club of Rome gilt seither als die einflussreichste Publikation zur drohenden Überlastung unseres Planeten. Zum 50-jährigen Jubiläum haben internationale Fachleute, darunter Sandrine Dixson-Declève, abermals in die Zukunft geblickt und im Rahmen der Initiative Earth for All eine Art SurvivalGuide für unsere krisengeschüttelte Welt vorgelegt. Um den «trägen Tanker Erde von seinem zerstörerischen Kurs abzubringen», verbinden sie wissenschaftliche Erkenntnisse mit innovativen Ideen für eine andere Wirtschaft. Mithilfe von Computermodellen haben sie zwei Szenarien für die Zukunft ent-
Die Schweiz kann in mehreren Bereichen viel bewirken. Ihre Neutralität ermöglicht es, Länder an einen Tisch zu bringen – für eine erneuerte europäische wie auch globale Vision. Als international verankerter Finanzplatz kann sie den Wandel nicht nur finanzieren, sondern die Finanzwelt auch so verändern, dass die Kapitalflüsse dem Planeten und dem allgemeinen Wohlstand dienen.
Und zu Hause – jenseits von Neutralität und Finanzplatz? Als wohlhabendes Land konsumiert die Schweiz überproportional – Verantwortung liegt deshalb in einem bewussten Konsum. Es geht nicht um den moralischen Zeigefinger gegenüber Einzelnen, sondern um öffentliche Programme: erneuerbare Energien ausbauen und Investoren in die Pflicht nehmen, Ernährungssysteme auf regenerative Praktiken umstellen und die Folgen von Importen für Mensch und Natur berücksichtigen.
Auch die soziale Dimension darf nicht fehlen: Die Schweiz ist teuer; Obdachlosigkeit, Drogenkonsum und psychische Belastungen nehmen zu. Wir müssen soziale und ökologische Wendepunkte gemeinsam angehen.
Junge Menschen wachsen heute mit multiplen Krisen auf. Was raten Sie einer Generation, die sich nach Orientierung und Hoffnung sehnt?
Halten Sie die Spannung zwischen Verzweiflung und Hoffnung aus. Wir müssen ehrlich sein: Es ist schwer. Entscheidungsträger müssen den Menschen zuhören und konkrete Lösungen liefern, damit sich die Gesellschaft entfalten kann. Ein gutes Beispiel dafür sind die «Gilets Jaunes» in Frankreich: Es war nicht die Erhöhung der Dieselsteuer per se, die die Gelbwesten-Bewegung ausgelöst hat. Zwei Wochen zuvor schaffte Frankreich die Vermögenssteuer ab. Viele hatten deshalb das Gefühl, der Mittelstand trage nun die finanzielle Last, während die Reichsten davonkämen. Daher ist es wichtig, dass Regierungen zuhören und echte Lösungen liefern. Entscheidend ist auch, alternative Wege aufzuzeigen: Was bedeutet es, wenn wir so weitermachen wie bisher, und was passiert, wenn wir dagegenhalten? Klimapolitisch haben wir die im Pariser Klimaabkommen gesetzte 1,5-Grad-Grenze bereits überschritten. Rasch zurück können wir nicht – aber wir können uns dieser Realität stellen und den Wandel positiv nutzen. Sind es diese Lösungen, die Ihnen Hoffnung geben? Ja. Diese Lösungen geben mir Hoffnung –und der schlichte Umstand, dass ich keine andere Wahl sehe: Entweder man gibt auf oder man kämpft weiter. Ich bin die Enkelin einer Widerstandskämpferin, die Konzentrationslager überlebt hat. Darum glaube ich zutiefst, dass wir mit Mut standhalten müssen. Das ist der einzige Weg.
Interview: Anja Ruoss
wickelt und detailliert aufgezeigt, was global geschehen müsste.
Szenario 1: «Zu wenig, zu spät» In diesem Szenario wird der derzeit eingeschlagene Weg der wirtschaftlichen Entwicklung, der weitgehend auf nicht nachhaltigen Produktionsweisen und Konsummustern beruht, fortgesetzt.
Die Auswertung zeigt, dass ein derartiges «Weiter so» Ungleichheiten verstärkt und der Klimakrise nicht genug entgegensetzen kann, um ihre dramatischen Folgen zu verhindern.
Szenario 2: «Grosser Sprung»
In diesem Szenario treffen Politik und Wirtschaft mutige Entscheidungen und tätigen Investitionen, die den sozialen
Zusammenhalt stärken, Vertrauen aufbauen, Armut national wie global verringern, Ernährungs- und Energiesysteme nachhaltig umgestalten und ein Wirtschaftssystem etablieren, das das Wohlergehen aller auf einem begrenzten Planeten sicherstellt.
Fünf Kehrtwenden Um die Menschheit auf einen ökologisch tragfähigen, sozial gerechten Pfad zu bringen, schlagen die Fachleute fünf zentrale «Turnarounds» vor, jeweils verbunden mit konkreten Massnahmen und Zielen: Armut überwinden, Ungleichheit abbauen, Frauen ermächtigen, gesundes Ernährungssystem aufbauen, Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen: earth4all.life


17 000privateLadepunkte in Betrieb
Ihre führende E-Mobilitätsgruppe der Schweiz
e360.ag/emobilitaetsgruppe