BASSENGE

Auktion 126
ZEICHNUNGEN DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS


ZEICHNUNGEN DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS
AUKTION 126
ZEICHNUNGEN DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS
Freitag, 28. November 2025
Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin
Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: art@bassenge.com . www.bassenge.com



Dr. Ruth Baljöhr
Telefon: +49 30 - 893 80 29 22
r.baljoehr@bassenge.com

David Bassenge
Telefon: +49 30 - 893 80 29 17 david@bassenge.com
Eva Dalvai
Telefon: +49 30 - 893 80 29 80
e.dalvai@bassenge.com

Lea Kellhuber
Telefon: +49 30 - 893 80 29 20
l.kellhuber@bassenge.com
Nadine Keul
Telefon: +49 30 - 893 80 29 21
n.keul@bassenge.com

Harald Weinhold
Telefon: +49 30 - 893 80 29 13
h.weinhold@bassenge.com
Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind.
Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei

Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.
ZEICHNUNGEN DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS
Erdener Straße 5A 14193 Berlin
Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November 10 bis 18 Uhr
Dienstag, 25. November 10 bis 17 Uhr
Vorbesichtigung ausgewählter Werke in München
12. bis 14. November 2025
täglich von 11 bis 18 Uhr
Galeriestraße 2B (2. Etage), 80539 München

MITTWOCH, 26. November 2025
Vormittag 10.00 Uhr
Nachmittag 15.00 Uhr
Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5261
Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5262-5347
Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5348-5475
Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5476-5714
DONNERSTAG, 27. November 2025
Vormittag 11.00 Uhr
FREITAG, 28. November 2025
Vormittag 11.00 Uhr
Nachmittag 16.00 Uhr
SONNABEND, 29. November 2025
Vormittag 11.00 Uhr
Nachmittag 16.00 Uhr
Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6231 Rahmen Nr. 6232-6256
Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6500-6770
Moderne und Zeitgenössische Kunst I Nr. 7000-7284
Moderne und Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8315
Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4101
Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4102-4252
VORBESICHTIGUNGEN
Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts
Erdener Straße 5A, 14193 Berlin
Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 25. November 10.00–17.00 Uhr
Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II
Rankestraße 24, 10789 Berlin
Donnerstag, 20. November bis Donnerstag, 27. November, 10.00–18.00 Uhr
Fotografie und Fotokunst des 19. bis 21. Jahrhunderts
Rankestraße 24, 10789 Berlin
Montag, 17. November bis Freitag, 21. November, 10.00–18.00 Uhr, Samstag 22. November, 10.00–16.00 Uhr, Sonntag geschlossen, Montag, 24. November bis Donnerstag 27. November, 10.00–18.00 Uhr, Freitag, 28. November 10.00–15.00 Uhr
Schutzgebühr Katalog: 20 €
Umschlag: Los 6632, Georg Friedrich Kersting und Los 6619, Johann Adam Klein
Seite 4: Los 6756, Hans Nägeli

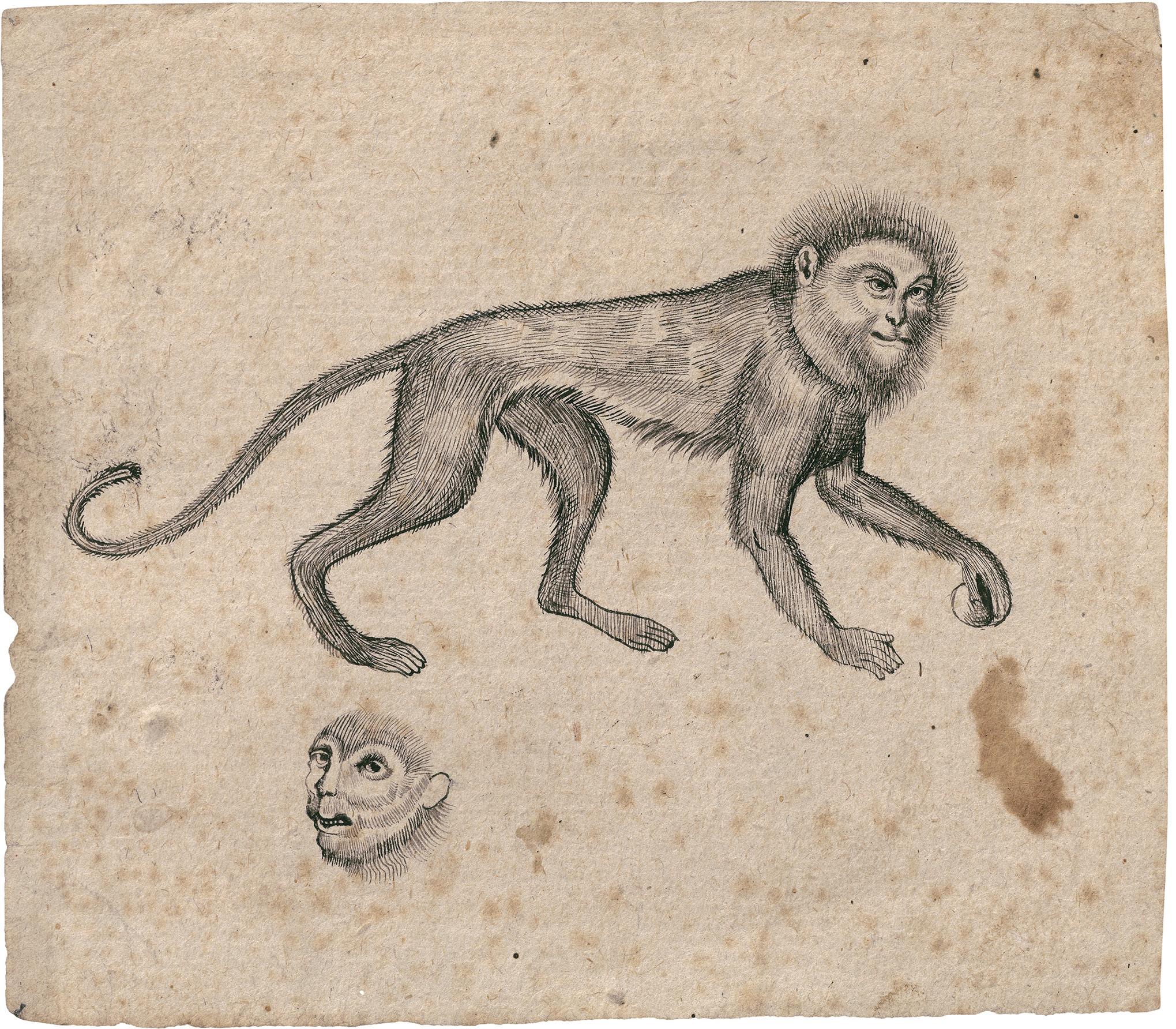
6500
Nordeuropäisch
6500 wohl 16. Jh. Studienblatt mit Meerkatze. Feder in Schwarz auf Bütten. 11,2 x 12,8 cm. 750 €
Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts
6501 Ende 16. Jh. Johannes der Täufer und die verdammten Seelen in der Vorhölle.
Feder in Braun, auf alter Sammlermontage mehrfach eingefasst und mit goldener Zierleiste. 19,4 x 14,3 cm. 900 €
Provenienz: Aus einer bislang unidentifizierten Sammlung (Lugt 1908a).
Entstanden in Zusammenhang mit der sogenannten Dürer-Renaissance im ausgehenden 16. Jahrhundert, gibt die Zeichnung detailliert einen Ausschnitt aus Albrechts Dürers 1510 entstandenen Holzschnitt „Christus in der Vorhölle“ (Meder 121) aus der Großen Passion wieder.


Süddeutsch
6502 um 1600. Landschaft mit Venus, Amor und einem Satyr.
Feder in Grau, grau laviert. 24,8 x 17,4 cm. Wz. Kleines Wappen.
600 €


verso
Deutsch
6503 1593. Elegante Gesellschaft in einer venezianischen Gondel beim Genuss von Wein.
Deckfarben mit Goldhöhung, verso das Wappen der bayrischen Kaufmannsfamilie Hartbrunner (Hartprunner).
9 x 14,2 cm. In ein Papier des späten 16. Jh. eingelassen, dieses mit Wz. Stadttor (Fragment).
2.800 €
Jobst Harrich (1579–1617, Nürnberg)

6504 Weibliche Figur mit Flinte und Weinglas (Stammbuchblatt).
Gouache über brauner Feder, Silberhöhungen (teils oxidiert). 15,6 x 8,9 cm. Unten signiert und datiert „Jobst Harrich geschen zu / Nürnberg Ao 1599“, oben der eigen-
händige Sinnspruch „Sauff auß oder span[n] mir die Bixen [Büchse]“, verso mit ausführlichen Sammlerbezeichnungen in brauner Feder. Wz. Turm (Fragment).
1.200 €
Provenienz: Johann Andreas Boerner (1795-1862), Nürnberg. Dessen Auktion bei Rudolph Weigel, Leipzig, Catalog der Börner‘schen Kunstsammlung (fünfte Abtheilung), Auktion 28. Nov. 1864, Los 101.

Burkhard Schramman (tätig in Süddeutschland um 1647)
6505 Titelblattentwurf zu Sympert Visscher und Johannes Battista Trilaci „Logica, bilanx philosophica, arte et marte liberata“.
Grauer Stift. 31,6 x 19,1 cm. Unten links signiert „Burchardt Schramman fecit“, unten rechts bez. „Wolffgang Kilian“ sowie mit weiteren eigenh. Bezeichnungen. Um 1647. Wz. Bekrönter Doppelkopfadler mit Sichel im Brustschild.
800 €
Die Zeichnung bereitet den gestochenen Titel für die 1647 im Verlag von Christopher Katzenberger erschienene Publikation vor. Beigegeben drei weitere Zeichnungen des 17. und 18. Jh. „Abschied der Apostelfürsten (alte Zuschreibung an Januarius Zick), „Daniel in der Löwengrube“ und „Bischof und Heiliger (alte Zuschreibung an Rottmayr).
Johann Rottenhammer (1564 München – 1625 Augsburg)
6506 Umkreis. Diana und Aktäon.
Feder in Schwarz über Graphit und Rötel, rotbraun laviert. 27,8 x 36,4 cm. Wz. Bekröntes Wappen mit Buchstabe B und Nebenmarke (vgl. Briquet 8079, ab 1562).
2.400 €
Die schöne, flüssig ausgeführte Zeichnung mit der Darstellung von „Diana und Aktäon“ gibt ein in der Kunst des späten 16. Jahrhunderts häufig behandeltes mythologisches Thema wieder, das sich auf Grund seiner unterschwellig erotischen Komponente einer größeren Beliebtheit erfreute bei Künstlern, die zu dieser Zeit im süddeutschen Raum und am Prager Hof von Rudolf II. tätig waren. Die Zeichnung wurde in der Vergangenheit als eigenhändige Arbeit Johann Rottenhammers betrachtet, vielmehr dürfte es sich jedoch um ein Werk eines im Umkreis des Künstlers tätigen Meisters handeln. Es gibt in abgewandelter Form ein Gemälde Rottenhammers wieder, das heute im Stadtmuseum Simeonstift in Trier aufbewahrt wird.
Johann Rottenhammer
6507 Umkreis. Die neun Musen auf dem Parnass, musizierend.
Feder in Grau, grau laviert. 15 x 14,2 cm.
800 €
Provenienz: Dr. George Hamilton, Massachusetts. Privatsammlung Ohio.



Sieneser Schule
6508 um 1600. Maria mit Kind in den Wolken und Heilige.
Feder in Braun, verso: eine weitere Studie „Zwei Heilige“ in brauner Feder. 19 x 12,8 cm.
450 €
Italienisch
6509 17. Jh. Die Beschneidung Christi. Feder in Braun, braun und grau laviert, verso: „Figurenstudie“ in Rötel. 18 x 13,8 cm. Verso eine alte Zuschreibung in brauner Feder „Caracci“.
400 €


Giovanni Battista Paggi (1554–1627, Genua)
6510 Die Himmelfahrt Mariae. Feder in Braun, braun laviert, im Oval. 34 x 23,2 cm. 3.000 €
Provenienz: Aus einer unbekannten Sammlung „D.G.R.“ (Lugt 757b). Wilhelm Suida (1877-1959), New York, durch Erbfolge: Bertina Suida (1922-1992) und Robert L. Manning (1924-1996), New York. Privatsammlung USA.


Italienisch
6511 16. oder 17. Jh. Stehendes Skelett mit erhobenem Arm.
Schwarze Kreide, alt aufgezogen. 41 x 22,5 cm. Wz. undeutlich.
1.500 €
Italienisch
6512 um 1580. Szene in einer Grotte mit Satyrn. Feder in Braun, graubraun laviert, über Spuren von Rötel. 25 x 33,7 cm. Verso Klebeetikett aus einem alten Auktionskatalog, dort als „Franz Floris“ beschrieben.
1.200 €
Provenienz: Sammlung Jonathan Richardson, London (Lugt 2184). Sammlung Prokop Toman, Prag (Lugt 2401).
Sammlung Benno Moser (Lugt 1828a).
Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts
Florentiner Schule
6513 16. Jh. Rückenfigur eines Nobile im weiten Mantel mit Barett.
Schwarze und rote Kreide, verso: Figurenstudie in schwarzem Stift. 37,8 x 21,2 cm. Unten rechts in brauner Feder von alter Hand bez. „Nella Loggia alla Scal....“. Wz. Schild mit Einhorn und Banden (vgl. Woodward 226: Rom, 2. Hälfte 16. Jh.).
1.200 €

6514

Domenico Piola (1627–1703, Genua)
6514 Allegorie der Geschichte. Pinsel in Braun, weiß gehöht über Vorzeichnung in Graphit. 28,1 x 17 cm.
1.500 €
Provenienz: Sammlung Suida-Manning, New York.

Italienisch
6515 spätes 16. Jh. Reiterschlacht. Feder in Braun, über schwarzer Kreide, braun laviert und weiß gehöht, quadriert, auf blauem Bütten, auf einen Sammlerkarton aufgezogen. 21,4 x 36,8 cm. Verso auf der Montierung mit Feder der Sammlervermerk von De La Gardie „Hyllan IX“.
2.400 €
Provenienz: Sammlung Graf Jacob Gustaf de la Gardie (1768-1842), Schloss Löberöd, Schweden (Lugt 2722a).
Durch Erbfolge bis 2020 im Besitz des Gutshofs Borrestad. Privatsammlung, Schweden.
Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Italienisch
6517 16. Jh. Pluto, zu seinen Füßen Cerberus und Amor. Feder in Braun, weiß gehöht, von gleicher Hand Korrekturen in brauner Feder auf aufgeklebten Papierfragmenten, aufgezogen, auf dem Untersatzpapier von alter Hand mit schwarzem Stift figural eingefasst. 26 x 11,6 cm (inkl. Untersatzpapier).
750 €
Italienisch
6516 17. Jh. Die hl. Anna, stehend. Feder in Braun, grau laviert, aufgezogen. 17,3 x 7,9 cm.
750 €
Provenienz: Mit einem Stempelfragment unten links, womöglich der Herzöge von Genua-Savoyen (vgl. Lugt 47a).


Sieneser Schule
6518 16. Jh. Der verlorene Sohn. Feder in Braun, partiell grau laviert, auf einem alten Untersatz. 27,3 x 47 cm. Unten bezeichnet „AASI“, auf dem Untersatz verso eine alte Zuschreibung an Ventura Salimbeni.
1.800 €
Giovanni Francesco Grimaldi (gen. Il Bolognese, 1606 Bologna - 1680 Rom)
6518a Entwurf für die Spanische Treppe in Rom (Progetto per la Scalinata di Trinità dei Monti). Feder in Braun über Rötel, verso weitere Skizzen in brauner Feder, alt aufgezogen und montiert. 25,9 x 22,4 cm. Rechts unten in brauner Feder alt nummeriert „2“. (1660). Rückwand mit schwer leserlichem, handschriftlich bezeichnetem Etikett.
12.000 €
Provenienz: Christie’s, London, Auktion am 7. Juli 1998, Los 114. Privatsammlung Bayern.
Wurde die Zeichnung in der Vergangenheit noch mit der Anlage der Villa Pamphilj in Zusammenhang gebracht, so konnte sie nun, zum 300ährigen Jubiläum der Spanischen Treppe im Jahr 2025, das in Rom mit einer eigenen Ausstellung gefeiert wird, als Entwurfszeichnung von Giovanni Francesco Grimaldi für die Scalinata di Trinità dei Monti identifiziert werden.
Grimaldi stand als Künstler und Architekt in Rom im Dienst des Vatikans und des Hochadels. Zwischen 1649 und 1651 war er in Paris im Auftrag Ludwig XIV. und Kardinal Jules Mazarins tätig. Mazarin, der einflussreichste erste Minister Frankreichs, begann 1660 mit der Planung der Prachttreppe. Er ließ verschiedene Künstler und Architekten Entwürfe für den Bau einer Freitreppe anfertigen, darunter Giovanni Francesco Grimaldi. Eine Präsentationszeichnung von Grimaldi auf blauem Papier ging, laut erhaltenem Schriftwechsel zwischen Mazarin und Abt Elpidio Benedetti, Mazarin im Oktober 1660 zu. Während Mazarin den Plan Grimaldis für seine Erhabenheit und Würde pries, wurde er von Benedetti als zu prunkvoll und zu kostspielig angesehen. Die vorliegende Federzeichnung, vermutlich ein Blatt aus einem Skizzenbuch, bietet erstmals Gelegenheit, in Grimaldis Gestaltungspläne für die Spanische Treppe Einblick zu nehmen. Der Entwurf folgt Mazarins Vorgabe einer Mehrstufenanlage mit gebogenen Aufgängen in der mittleren Ebene. Die Aufgabenstellung scheint auch einen Brunnen mit Flussgöttern und eine Widmung an Ludwig XIV. vorgesehen zu haben. Spiegelte man den detailreichen Entwurf, so zeigte sich die grandiose
Gesamtansicht der repräsentativen Anlage. Der Brunnen mit den beiden liegenden Flussgöttern findet sich ebenfalls in Entwürfen von Elpidio Benedetti, gezeichnet 1660 von der römischen Malerin und Architektin Plautilla Bricci (s. Biblioteca Apostolica Vaticana. Chigi P. VII 10, pt. B, cc. 30-31 sowie Nationalmuseum Stockholm, Inv. NMH CC 790.)
Wie in der Repräsentationszeichnung Benedettis findet sich zu der Luftperspektive Grimaldis auch eine zweite plastische Skizze, die das Prinzip der Anlage veranschaulicht. Eine gradläufig eingeschwungene Treppe führt zum ersten Plateau. Von dort laufen in ovaler Biegung Arkadengänge zur zweiten Ebene. Sie werden bekrönt durch zwei von Putten gehaltene Portraitmedaillons, vermutlich von Ludwig XIV. Zwei weitläufige Rampen treffen mit den weiteren Treppenanlagen auf der oberen Ebene zusammen. Das aufwändige Triumphportal einer ovalen Fassade beschließt mit seinen bossierten Pilastern den Prospekt der zweiten Ebene. Die seitlichen Treppenanlagen führen in einem ovalen Pavillon auf das obere Plateau. Darüber rahmt eine weitläufige Kolonnade mit Balustern die Aussicht auf die Stadt und fasst den Vorplatz der französischen Nationalkirche architektonisch ein Die Architektur des Hauses rechts ist stark an dem Gebäude orientiert, das damals an den noch wilden landschaftlichen Aufgang zur Kirche angrenzte (vgl. den Kupferstich von Giovanni Battista Falda: Fontana nella Piazza della Trinità dei Monti). Vergleicht man spätere Zeichnungen für die Spanische Treppe, etwa den berühmten Entwurf von Alessandro Specchi von etwa 1721 (Fondo Lanciani in der Biblioteca Archeologia e Storia dell‘Arte, Rom, Inv. 54861), so zeigt sich, dass die grundlegende Vision Grimaldis in weiten Teilen unverändert übernommen wurde. Grimaldis Entwurf würde damit die Ursprungsidee für die ikonische Treppenanlange zeigen, die auch heute noch zu den bedeutendsten Bauwerken des Barock zählt und ein Besuchermagnet in der Ewigen Stadt ist. Dass Grimaldis Pläne letztendlich nicht weiterverfolgt wurden, mag darin begründet sein, dass der gleichzeitig in Ausführung begriffene Entwurf für den Petersplatz von Gian Lorenzo Bernini aus Sicht des Vatikans keinesfalls übertroffen werden sollte. Isabella Chapman hat nach Vorlage des Originals die Zuschreibung an Giovanni Francesco Grimaldi bestätigt. Sie gab den Hinweis auf einen verschollenen Entwurf des Künstlers für Kardinal Mazarin.
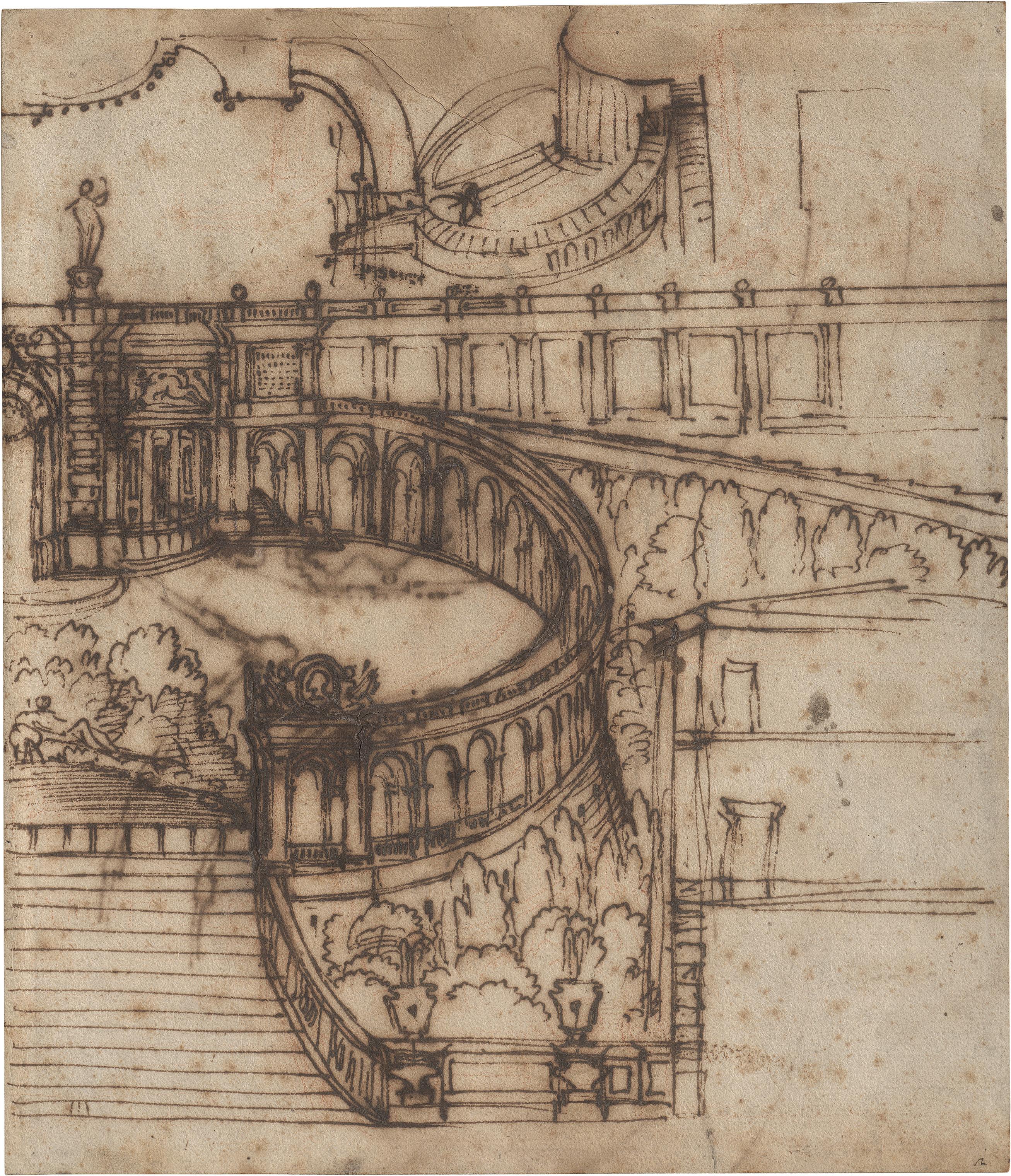



Carlo Giuseppe Carpi (1676 Parma – 1730 Bologna)
6519 Entwürfe für Quadraturmalerei. 2 Zeichnungen, je Feder in Braun, braun laviert. 17 x 25,9 cm; 13,7 x 18,4 cm. Jeweils signiert „Carpi“, ein Blatt verso alt bezeichnet „No 18“. Wz. undeutlich.
1.200 €
Provenienz: Pietro Scarpa, Venedig. Seither deutsche Privatsammlung.
Abbildung auch Seite 217
Italienisch
6520 16. Jh. Studienblatt mit Entwürfen zu Zwickeln mit Darstellung von Evangelisten und Putti. Feder in Braun. 27,3 x 26,5 cm. Innerhalb der Darstellung in einer Hand wohl des 16. Jh. in brauner Feder bez. „Titiano“.
1.200 €
Pier Francesco Mazzucchelli (gen. il Morazzone, 1573 Morazzone b. Varese – 1626 Piacenza)
6521 Das Wappen des Hauses Savoyen von Engeln getragen. Feder in Grau und Braun, braun laviert und weiß gehöht auf blauem Bütten. 21,3 x 37,1 cm.
4.000 €
Provenienz: Sammlung Giuseppe Vallardi, Mailand (Lugt 1223).
Italienisch
6522 17. Jh. Tankred tauft die sterbende Clorinde. Rötel, aufgezogen. 18,3 x 24 cm. Oben links alt nummeriert „2641.
800 €
Provenienz: Sammlung Stephan von Licht, Wien (Lugt 789b).
Abbildung Seite 26



Pietro Dandini (1646–1712, Florenz)
6523 Studienblatt mit Anbetungsszene und weiteren Figuren.
Rötel, verso: Figurenstudien in Rötel. 27,6 x 43,1 cm.
600 €
Provenienz: Sammlung Dandini, Florenz. Sammlung Giovanni Targioni Tozzetti (1712-1783), Florenz. Dr. Carmen Hertz Gräfin Finckenstein (1889-1971), Ascona. Familienbesitz, Norddeutschland. Beigegeben von demselben ein weiteres Blatt mit Figurenstudien, recto in Rötel, verso in schwarzer Kreide, wohl eigenh. monogrammiert „P.D.“.
Italienisch
6524 um 1600. Römischer Soldat, einen Mann überfallend.
Pinsel in Braun über Graphit, auf Papier des 18. Jh. kaschiert, an den oberen Ecken montiert. 28,2 x 34,8 cm.
900 €
Provenienz: Sammlung Giuseppe Chiantorre, Turin (Lugt 540).
Beigegeben eine italienische Zeichnung des 17. Jh. „Sitzender Mann mit Wanderstock und Schüssel“ (schwarze und weiße Kreide auf blauem Papier), ebfalls aus der Sammlung Giuseppe Chiantorre.
Französisch
6525 17./18. Jh. Götterversammlung auf dem Olymp. Feder in Braun, braun laviert, teils weiß gehöht, über Graphit, quadriert, alt aufgezogen. 36,3 x 27,5 cm (im Oval).
800 €
Nach dem verlorenen Deckenfresko Vouets für die Bibliothek im Hotel Séguier in Paris, das durch den Nachstich Michel Dorignys von 1640 größere Bekanntheit erreichte. Beigegeben eine Sebastien Bourdon zugeschriebene Zeichnung „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ sowie von Jean-Baptiste Pillement „Flusslandschaft mit verfallener Palastanlage“.
Marco Marcola (um 1740–1793, Verona)
6526 zugeschrieben. Minerva und Amor führen Herkules auf den Pfad der Tugend. Feder in Braun, braun laviert. 24,2 x 26,9 cm.
750 €
Eine in der Handschrift eng verwandte Zeichnung Marco Marcolas, „Mucius Scaevola legt seine rechte Hand ins Feuer“, findet sich heute im Metropolitan Museum of Art, New York (Inv.Nr. 64.132.2).




Jacob van der Ulft (1627 Gorkum – 1689 Noordwijk)
6527 Eine südliche Hafenszene.
Feder und Pinsel in Braun, braun laviert. 27,8 x 22,8 cm.
2.800 €
Provenienz: Aus der Sammlung Johann Goll van Franckenstein (Lugt 2987).
Charakteristisches Blatt dieses autodidaktisch gebildeten Künstlers, der von 1660 bis 1679 Bürgermeister seiner Geburtsstadt Gorkum war. Sein zeichnerisches Œuvre umfasst zahlreiche Blätter mit italienischen Sujets. Vermutlich war van der Ulft jedoch nie in Italien, wie bereits Arnold Houbraken erwähnt, sondern orientierte sich an Zeichnungen niederländischer Italianisanten. Insbesondere hat van der Ulft nach Vorlagen von Jan de Bisschop gearbeitet, mit dessen Schaffen seine Arbeiten stilistisch und thematisch eng verwandt sind, so dass in der Vergangenheit oft Verwechslungen stattgefunden haben. Eine sehr häufig von van der Ulft verwendete Technik ist die Pinselzeichnungen in Braun, die sich durch ihre flüssigen, treffsicheren Lavierungen und ihre markante Kontrastwirkung auszeichnen. So auch die vorliegende schöne und visuell einprägsame Darstellung eines italienischen Hafens, welche größte Spontaneität atmet und durch ihre recht virtuose Erfassung des warmen
Sonnenlichtes verzaubert.
Niederländisch
6528 17. Jh. Fischer in einer Ruinenlandschaft. Pinsel und Feder in Grau, auf einen Sammlerkarton aufgezogen. 19,5 x 25,1 cm. Oben am Rand alt handschriftl. bez. „R [...] Jacob Salomon / S. Ruisdael“, auf dem Sammlerkarton unten „Ruisdael N°1“, verso mit Feder der Vermerk des Sammlers De La Gardie „Hyllan VIII“.
3.000 €
Provenienz: Sammlung Graf Jacob Gustaf de la Gardie (1768-1842), Schloss Löberöd, Schweden (Lugt 2722a).
Durch Erbfolge bis 2020 im Besitz des Gutshofs Borrestad. Privatsammlung, Schweden.



Niederländisch
6529 17. Jh. Blick in eine Gracht mit Steinbrücke. Schwarze Kreide, grau laviert, in brauner Feder eingefasst. 18,2 x 27,5 cm.
1.200 €
Nicolaes Berchem (1620 Haarlem – 1683 Amsterdam)
6530 zugeschrieben. Terrainstudie mit großen Blattpflanzen.
Schwarze Kreide. 14,5 x 18,6 cm. Wz. Wappenfragment mit goldenem Vlies.
800 €
Provenienz: Mit unbekanntem Sammlermonogramm in Bleistift „F.N.“ (nicht bei Lugt).
Ein vergleichbares, ebenfalls Nicolaes Berchem zugeschriebenes Blatt befindet sich im Rijksmuseum in Amsterdam (Inv. RP-T-1889-A-1902).
Niederländisch
6531 17. Jh. Stehender Kavalier, einen Hut haltend. Schwarze Kreide, weiß gehöht, spätere Einfassung in brauner Feder, auf blauem Papier. 19 x 9,8 cm.
750 €
Johan Verwer
(tätig 1647–1660 in Haarlem)
6532 Pflanzenstudie mit Rankengewächsen und Gräsern.
Feder in Braun, teils über Rötel, Pinsel in Grau. 18,9 x 28,2 cm (unregelmäßig beschnitten).
12.000 €
Das Sujet von nahansichtig dargestellten Pflanzen vor weißem Grund, das Gespür für die Eigenheit eines jeden Gewächses, der filigrane Duktus, und die vorwiegende Verwendung der Lavierung zur Konturierung der Blätter rücken diese Arbeit motivisch und stilistisch in unmittelbare Nähe zu den beiden einzigen bekannten Zeichnungen, die dem in Haarlem tätigen Johan Verwer sicher zugewiesen werden können. Ein signiertes und 1669 datiertes Blatt in Privatbesitz stammt aus der ehemaligen Sammlung Johan Quirijn van Regteren Altena (dessen Auktion bei Christie‘s, Amsterdam, am 10. Juli 2014, Los 56). Die zweite Pflanzenstudie, vormals Jan Wijnants zugeschrieben, bewahrt das British Museum in London (Inv. Oo,9.63). Ein weiteres dem Künstler zugeschriebenes Blatt befand sich ebenfalls in der Sammlung van Regteren Altena (Christie‘s, Amsterdam, Auktion am 10. Dezember 2014, Los 203).


Niederländisch
6533 17. Jh. Wiesenstück mit Gräsern und Blattgewächsen.
Schwarze Kreide, dunkelgrau laviert und weiß gehöht, auf blauem Papier. 19,9 x 36,4 cm.
1.800 €
Provenienz: Mit unbekanntem Sammlermonogramm in Bleistift „F.N.“ (nicht bei Lugt).
Salomon van Ruysdael (1600/03 Naarden – 1670 Haarlem)
6534 zugeschrieben. Landschaft mit Kopfweiden. Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf grünlichem Papier. 29,1 x 24,1 cm. Unten links mit Bleistift bezeichnet „S. Ruysdael“.
900 €
Provenienz: Karl Eduard von Liphart (1808-1891, Lugt 1687). Dessen Enkel Reinhold von Liphart (Lugt 1758).
Seine Auktion C.G. Boerner, Leipzig, am 26.-27. April 1898, Los 821 (als „Salomon Ruysdael“).


Bolognesisch
6535 um 1700. Landschaft mit Baum auf einem felsigen Abhang.
Feder in Braun, Graphit, an den Ecken montiert. 23,6 x 18,5 cm (oben leicht abgerundet). Wz. Vogel auf Ast.
600 €
Beigegeben eine Federzeichnung der Schule von Guercino „Betende Frau mit Schleier“.



Flämisch
6536 17. Jh. „Festina Lente“ (Zwei Putti treiben eine Schildkröte zur Eile an); „Facit Munificum“ (Zwei Putti verteilen Almosen).
2 Gouachen auf Papier. Je ca. 12,2 x 14,5 cm (Einfassungslinie). (Unausgerahmt beschrieben).
1.200 €
Literatur: Jörg Nimmergut, Anna-Maria Wager: Miniaturen-Dosen, München 1982, S. 211 mit Farbabbildung F 41.
Nach zwei Emblemata aus Otto van Veens Werk „Amoris Divini emblemata“, das 1615 in Antwerpen erschien. Verso mit den Devisen: „Nescit tarda molimina Spiritus sancti gratia, cuius praecipuus fructus Amor est“ (S. 69) bzw. „Semper habet unde det cui plenum est pectus“ (S. 54).
P. Fezant (tätig um 1680)
6537 Satyr und Nymphe. Gouache auf Pergament. 13,6 x 10,5 cm. Unten rechts im schwarzen Rand in Gold signiert „P. Fezant Pinxit.“. 800 €
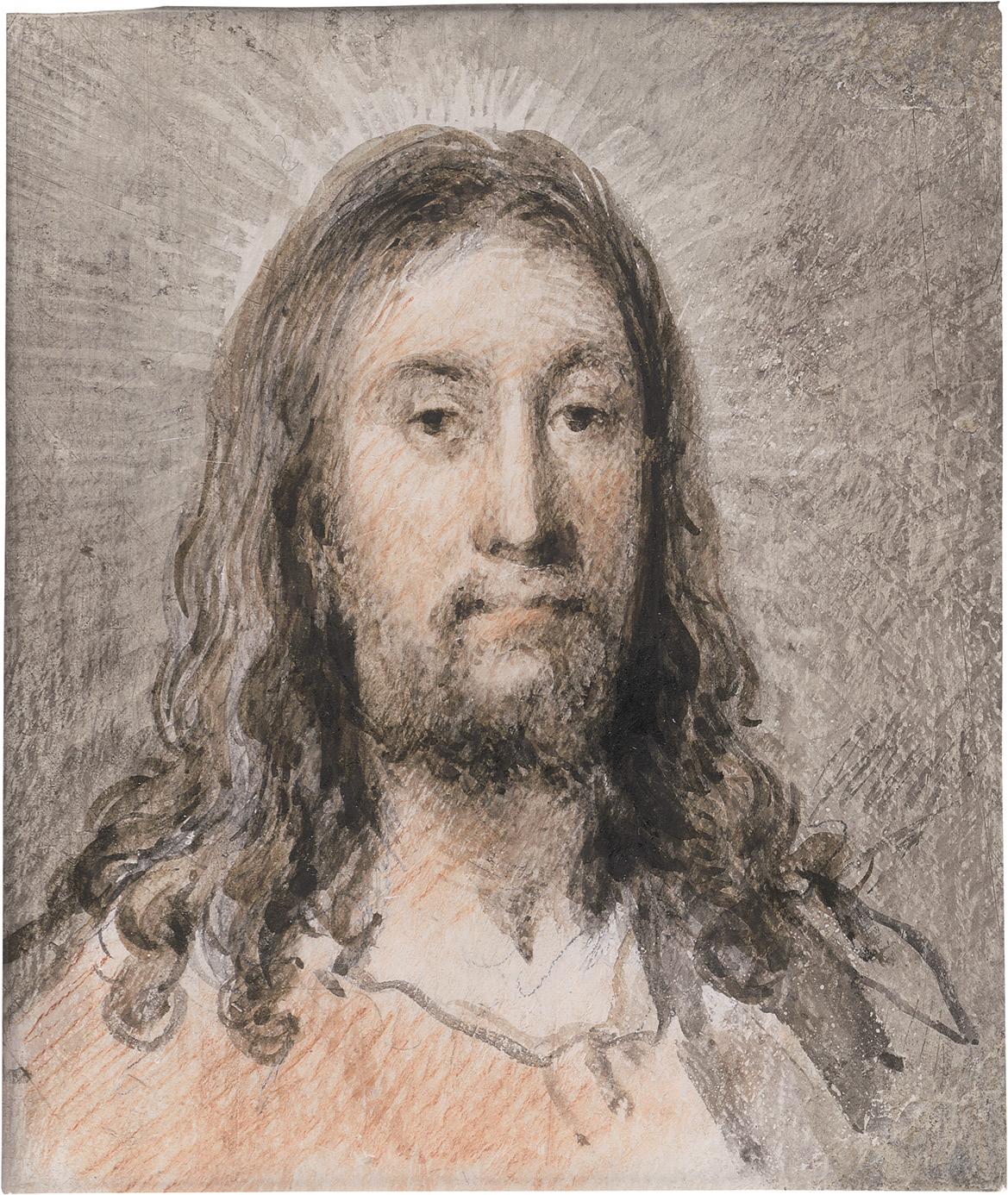



Jacob de Wit (1695–1754, Amsterdam)
6538 Christus; Moses.
2 Zeichnungen (recto und verso), je Graphit, Pinsel in Hellund Dunkelbraun, teils gekratzt, recto zusätzlich Rötel, auf elfenbeinfarben grundiertem Papier. 8,9 x 7,6 cm.
1.200 €
Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 Leiden – 1669 Amsterdam)
6539 Nachfolge. Der Tod Jakobs. Pinsel und Feder in Braun, braun laviert. 22,5 x 35 cm.
1.800 €
Provenienz: Sammlung Helmut Märkt, Reutlingen. Die vorliegende Zeichnung steht in engem Zusammenhang mit einer Pinsel- und Federzeichnung Rembrandts in Bister, die um 1640 datiert wird (vgl. Otto Benesch: The Drawings of Rembrandt, London 1954/57, Bd. III, Nr. 493 mit Tafel 614).
Das eindrucksvolle, wundervoll frisch erhaltene Blatt ist ein bedeutendes Frühwerk des zwanzigjährigen Künstlers. Als Zeichner zeigt es den jungen Dietricy bereits auf der ganzen Höhe seiner Kunst. In seiner anspruchsvollen, mehrfigurigen Kompositionsweise, in seiner feinsinnigen psychologischen Beobachtung, die größte Aufmerksamkeit für das menschliche Detail verrät, sowie in dem Exotismus seiner Protagonisten zeigt Dietrich sich zutiefst seinem bewunderten, großen Vorbild Rembrandt verpflichtet. In der Bildmitte überreicht Maria dem greisen Simon den Neugeborenen, der in dem Säugling den Messias erkennt und in religiöser Verzückung emporblickt. Sehr schön sind die lebhafte Interaktion und die Mimik der orientalisch gekleideten Schriftgelehrten charakterisiert. Ein wahrhaft rembrandteskes Detail sind die beiden kleinen Knaben vorne links, die eng umschlungen ein unschuldiges Zwiegespräch führen. Das bildmäßig komponierte Blatt war zweifellos als autonomes Kunstwerk gedacht. 6540
Christian Wilhelm Ernst Dietrich (gen. Dietricy, 1712 Weimar – 1774 Dresden)
6540 Die Darstellung Christi im Tempel Feder in Schwarz über Kreide, Pinsel in mehreren Grauund Brauntönen; Einfassungslinie in schwarzer Feder. 27,7 x 36 cm. Signiert und datiert „CWEDietrich 1732“.
3.500 €
Provenienz: Aus der Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 555b und 2841a).

Französisch
6541 um 1680. Bildnis einer Edeldame beim Orgelspiel. Gouache. 12,8 x 8,7 cm. Im goldenen Bandelrahmen.
1.200 €
Emmanuel Büchel (1705–1775, Basel)
6542 zugeschrieben. Zwei pittoreske Landschaften mit Jägern und Hirten.
2 Gouachen auf Karton, im Oval. Je ca. 22 x 26 cm. Verso auf der Rückpappe mit dem Klebeetikett des Basler Rahmenmachers Ernest Fay.
800 €



Caspar Netscher
(1639 Heidelberg – 1684 Den Haag)
6543 zugeschrieben. Bildnis der Jane Lane, Lady Fisher, die Königskrone mit einem Schleier verhüllend.
Feder und Pinsel in Braun über Graphit. 23,3 x 19,3 cm.
Verso mit einer zeitgenösischen Inschrift in brauner Feder „mestres [...] Lane“. Um 1655-60.
2.400 €
Provenienz: Sammlung Jean-François Gigoux (Lugt 1164).
Das souverän ausgeführte Frauenbildnis ist eine charakteristische Arbeit des aus Heidelberg stammenden Malers und Zeichners Caspar Netscher, der bei Gerard ter Borch in die Lehre ging. Netscher war seit 1652 in Den Haag als angesehener Porträt- und Genremaler tätig.
Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der dargestellten jungen Frau um die famose Jane Lane, spätere Lady Fisher, die eine heroische Rolle bei der Flucht von König Charles II. nach Frankreich nach der verlorenen Schlacht von Worcester im Jahr 1651 gespielt hatte. Ein authentisches, 1652 datiertes Bildnis von der Hand des Meisters JH (möglicherweise Jerome Hesketh) in der Sammlung von Moseley Old Hall, Staffordshire (National Trust Collection) zeigt unverkennbare Ähnlichkeit mit der eleganten, modisch frisierten Frau auf unserem Blatt, die mit einem Schleier die Königskrone verhüllt, eine Anspielung auf die stattgefundene Flucht des Monarchen. Die gleiche Ikonographie ist auch auf einem anonymen, um 1660 entstanden Bildnis sichtbar, das in der National Portrait Gallery in London (NPG 1798) aufbewahrt wird.

Französisch
6544 18. Jh. Diana und Callisto. Schwarze Kreide, grau laviert. 14,5 x 21,2 cm. Unten mit Feder nummeriert „312“.
800 €
Daniel van den Dyck
(auch Daniel Vandich, 1614 Antwerpen – 1663 Mantua)
6545 Die Verehrung einer Herrscherbüste
Grauer Stift. 34,8 x 24,7 cm. Unten auf einem Steinsockel in brauner Feder signiert „Daniel vanden Dyck“.
1.200 €
Der Maler und Radierer Daniel van den Dyck war um 1631/32 Schüler von Pieter Verhaeght in Antwerpen. Er war lange Zeit in Italien tätig und verstarb 1663 in Mantua. Zeichnungen von seiner Hand sind eminent selten.


Matthias Diesel (1675 Bernried am Starnberger See – 1752 München)
6546 Versailles: Prospect und Perspektiv der königlichen Residenz und Lustgarten Versailles. Feder in Grau und Braun, Pinsel in Grau, grau laviert, gegriffelt. Ca. 20 x 29 cm. Um 1717-1723.
1.800 €
Provenienz: Wohl Johann Gottfried Abel (geb. 1723 in Köthen, Hofgärtner des Herzogs von Anhalt-Dessau).
Durch Erbfolge (an dessen Sohn Gottlieb August Ludwig Abel und anschließend an dessen Enkel Lothar Abel) an den Paläobiologen Othenio Abel (1875-1946, verso auf der Rahmenrückseite mit dessen eigenh. Annotationen zur Provenienz).
Vorzeichnung zu der von Johann August Corvinus gestochenen Tafel in dem Werk „Erlustierende Augenweide in Vorstellung herrlicher Garten und Lustgebäude“, das 1717-1723 in Augsburg erschien.
6547 Grand Trianon in Versailles: „Prospect des königl. Lust und Gartengebäu Trianon nechst Versailles“.
Feder in Grau und Braun, Pinsel in Grau, grau laviert, verso gerötelt. 19,3 x 27,5 cm. Um 1717-1723.
1.800 €
Provenienz: Wohl Johann Gottfried Abel (geb. 1723 in Köthen, Hofgärtner des Herzogs von Anhalt-Dessau).
Durch Erbfolge (an dessen Sohn Gottlieb August Ludwig Abel und anschließend an dessen Enkel Lothar Abel) an den Paläobiologen Othenio Abel (1875-1946).
Vorzeichnung zu der von Carl Remshart gestochenen Tafel in dem Werk „Erlustierende Augenweide in Vorstellung herrlicher Garten und Lustgebäude“, das 1717-1723 in Augsburg erschien. Beigegeben von Matthias Diesel die Vorzeichnung zu der von Johann August Corvinus gestochenen Tafel „Wahrhafter Grundriss des Königl. Lustgarten Trianon nechst Versailles“ (Feder in Grau und Braun, grau laviert, 21,8 x 29 cm), unterhalb der Darstellung eigenh. betitelt und signiert.


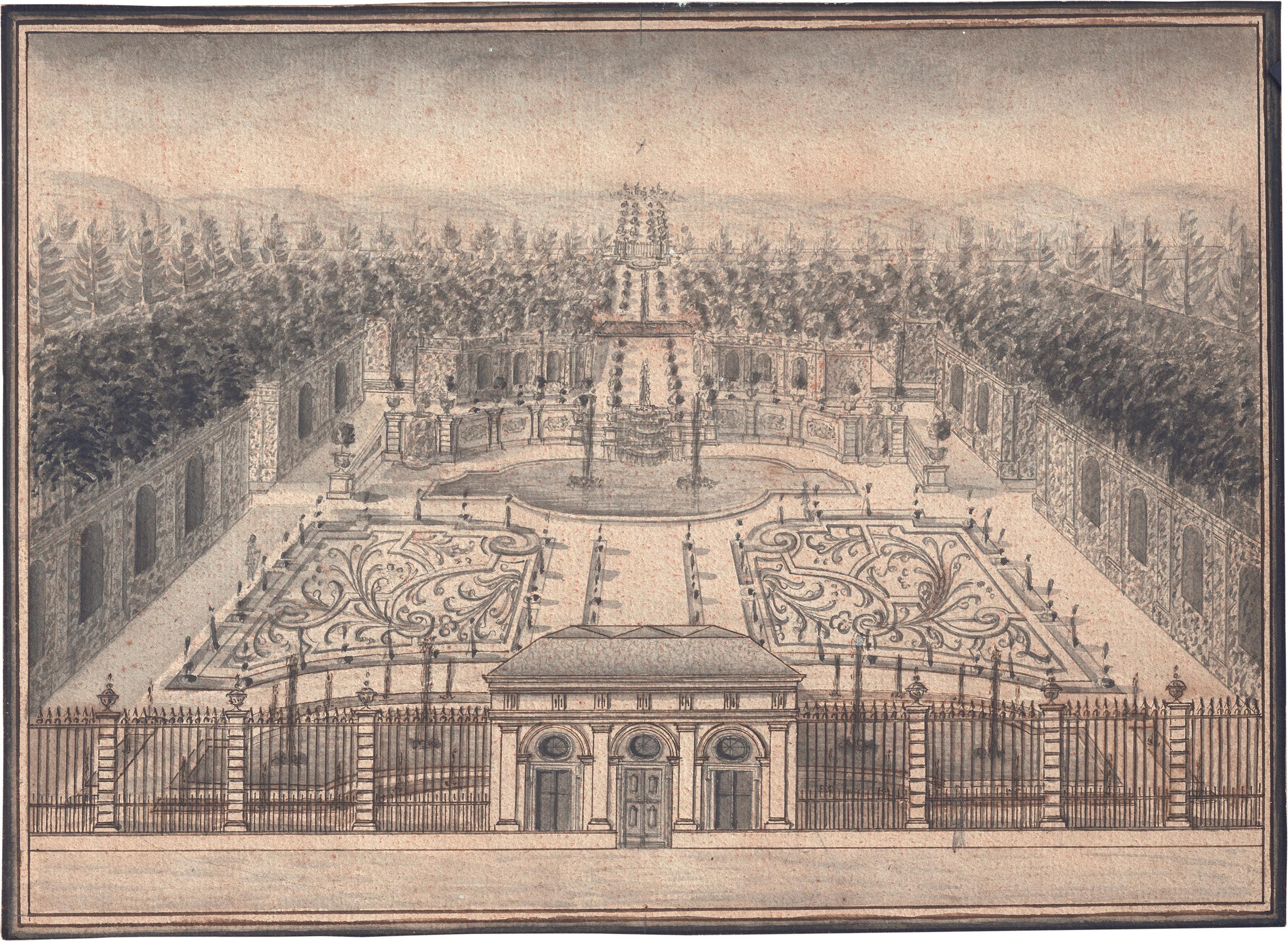
6548 Eglosheim: Prospect und Perspectiv des Graf Königsfeldischen Lust-Garten zu Eglosheim. Feder in Grau und Braun, Pinsel in Grau, grau laviert, verso gerötelt. 21,5 x 30 cm. Um 1717-1723.
1.200 €
Provenienz: Wohl Johann Gottfried Abel (geb. 1723 in Köthen, Hofgärtner des Herzogs von Anhalt-Dessau).
Durch Erbfolge (an dessen Sohn Gottlieb August Ludwig Abel und anschließend an dessen Enkel Lothar Abel) an den Paläobiologen Othenio Abel (1875-1946).
Vorzeichnung zu der von Carl Remshart gestochenen Tafel in dem Werk „Erlustierende Augenweide in Vorstellung herrlicher Garten und Lustgebäude“, das 1717-1723 in Augsburg erschien. Beigegeben von Matthias Diesel die Vorzeichnung zu der von Johann August Corvinus gestochenen Tafel 27 „Prospect und Perspectiv der Gräffl: Fuggerischen Lustgarten zu Hauthaussen (Haidhausen) samt dem Lusthaus...“ (Feder in Grau und Braun, grau laviert, verso gerötelt, 21,8 x 29 cm) unterhalb der Darstellung eigenh. betitelt und signiert.

Niederländisch
6549 18. Jh. Entwurf für eine barocke Deckengestaltung mit Vasen, Girlanden und Atlanten. Pinsel in Schwarz, Grau und Weiß auf grauem Bütten. 40,4 x 32,6 cm. Wz. Buchstaben WP. 1.200 €



6550 um 1800. Entwürfe zu fünf Palazzi und Villen im Stil der italienischen Renaissance.
15 Zeichnungen, je Feder in Braun, braun laviert, teils aquarelliert auf Honig & Zonen-Bütten, alt auf Untersatzpapier montiert. Je ca. 23,5-38 x 23,5-38 cm. Teils mit Maßstabsangaben, unten rechts mit alter Nummerierung.
1.500 €
Die fein ausgeführten Entwürfe projektieren insgesamt fünf prachtvolle Stadthäuser oder Palazzi, wobei für jedes Bauwerk eine Ansicht, ein Durchschnitt und ein Grundriss vorliegt. Es ist nicht klar, ob diese Pläne je realisiert wurden oder ob es sich eher um eine Art Musterbuch eines Architekten handelt.
6551 18. Jh. Entwurf für eine Tischplatte mit Trompel‘œil mit ornamentalem Rand.
Feder in Grau, Rot und Braun, grau laviert. 28,1 x 38 cm. Wz. Bekröntes Lilienwappen.
1.200 €
Literatur: Tankred Borenius: Catalogue of the collection of drawings by the old masters formed by Sir Robert Mond, London 1937, Nr. 135. Provenienz: Sammlung Sir Robert Mond, London (Lugt 2813a).

Oberitalienisch
6552 2. Hälfte 18. Jh. Entwurf für einen Altar in zwei Varianten.
Feder und Pinsel in Grau über Graphit. 53,3 x 37,9 cm. Mit Bezeichnungen in italienischer Sprache. Wz. Buchstaben FV mit drei Sternen (Treviso 1775).
1.800 €
Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Italienisch
6553 18. Jh. Deckenentwurf mit Scheinarchitektur und fliegenden Engeln. Pinsel in Grau über Graphit. 24,7 x 18,9 cm.
750 €
Beigegeben von Gottfried Bernhard Göz eine Federzeichnung „Das alte Paar beim Geldzählen“.
Italienisch
6554 18. Jh. Apotheose eines Heiligen in den Wolken. Schwarze Kreide, montiert. 33,4 x 17,2 cm. Wz. Fleur-delis im Kreis.
800 €
Provenienz: Sammlung Stephan von Licht (Lugt 789b).



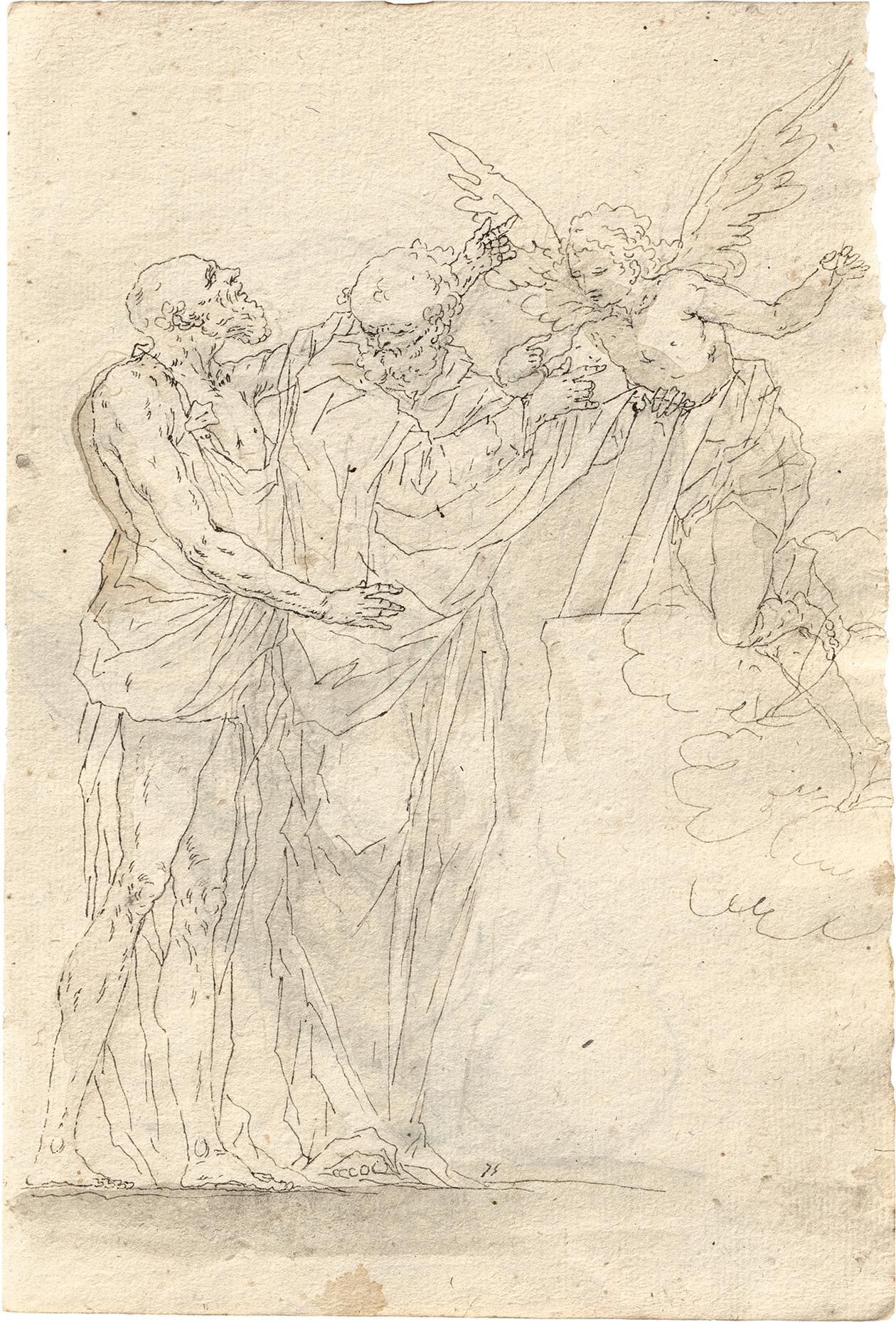
Paolino Caliari (1763–1835, Verona)
6555 Kompositionsstudien zu biblischen Szenen: Gottvater in den Wolken, Engel, Detailstudien zu Händen und Füßen.
18 Zeichnungen auf 9 doppelseitig bezeichneten Blatt, je Feder in Braun oder Graubraun, braun oder graubraun laviert, teils über Graphit. Je ca. 26 x 17,6 cm. (1818).
3.000 €
Literatur: Donatella di Biagi Maino: „Paolo Caliari o dell‘Accademia. Un album di disegni ritrovato“, in: Studi in onore di Stefano Tumide, Bologna 2016, S. 483-491.
Provenienz: Privatsammlung Rom.
Paolo Caliari wurde 1763 in Verona als Sohn von Domenico Caliari, einem Buchhändler und Kupferstecher geboren, durch den er schon früh mit den Techniken des Gravierens vertraut wurde. Er studierte an der örtlichen Kunstakademie bei Prospero Schiavi (1730-1803), einem der Mitbegründer der Akademie und Schüler von Giambettino Cignaroli (1706-1770) und erhielt bereits kurz nach Abschluss seiner Studien im
Jahr 1788 das Diplom für eine Professur. Bereits zu Beginn seiner Karriere gewann er zahlreiche akademische Auszeichnungen für sein Werk, war an mehreren Aufträgen zur Dekoration von Palästen und Häusern seiner Stadt beteiligt, schuf vereinzelt Porträts sowie zahlreiche Altargemälde und Andachtsbilder. Daneben widmete er sich dem Experimentieren mit verschiedenen künstlerischen Techniken und dem Studium und Kopieren von Gemälden alter Meister. Die Blätter gehören zu einem Albums, dessen Titel die eigenh. Bezeichnung „Schizzi a Primi colpi di Penna in otto Giorni 1818“, woraus auch für diese Zeichnungen die Entstehung im Jahr 1818 folgt (s. Bassenge, Auktion 125 im Mai 2025, Los 6769).
Die zehn doppelseitigen Zeichnungen wurden von Donatella Biagi Maino an Paolo Caliari zugeschrieben. Die Zeichnungen stellen verschiedene religiöse und allegorische Sujets sowie Einzelstudien von Händen und Füßen dar. Öfters wird ein einzelnes Thema mit wenigen Variationen und geringfügigen Änderungen wiederholt, um zu einer klaren Fassung des Sujets zu gelangen. Die Blätter könnten entweder eine private Stilübung des Künstlers gewesen oder auch für pädagogische Zwecke zum Unterricht an der Akademie angefertigt worden sein, als dessen Vorstand der Künstler ab 1808 wirkte.


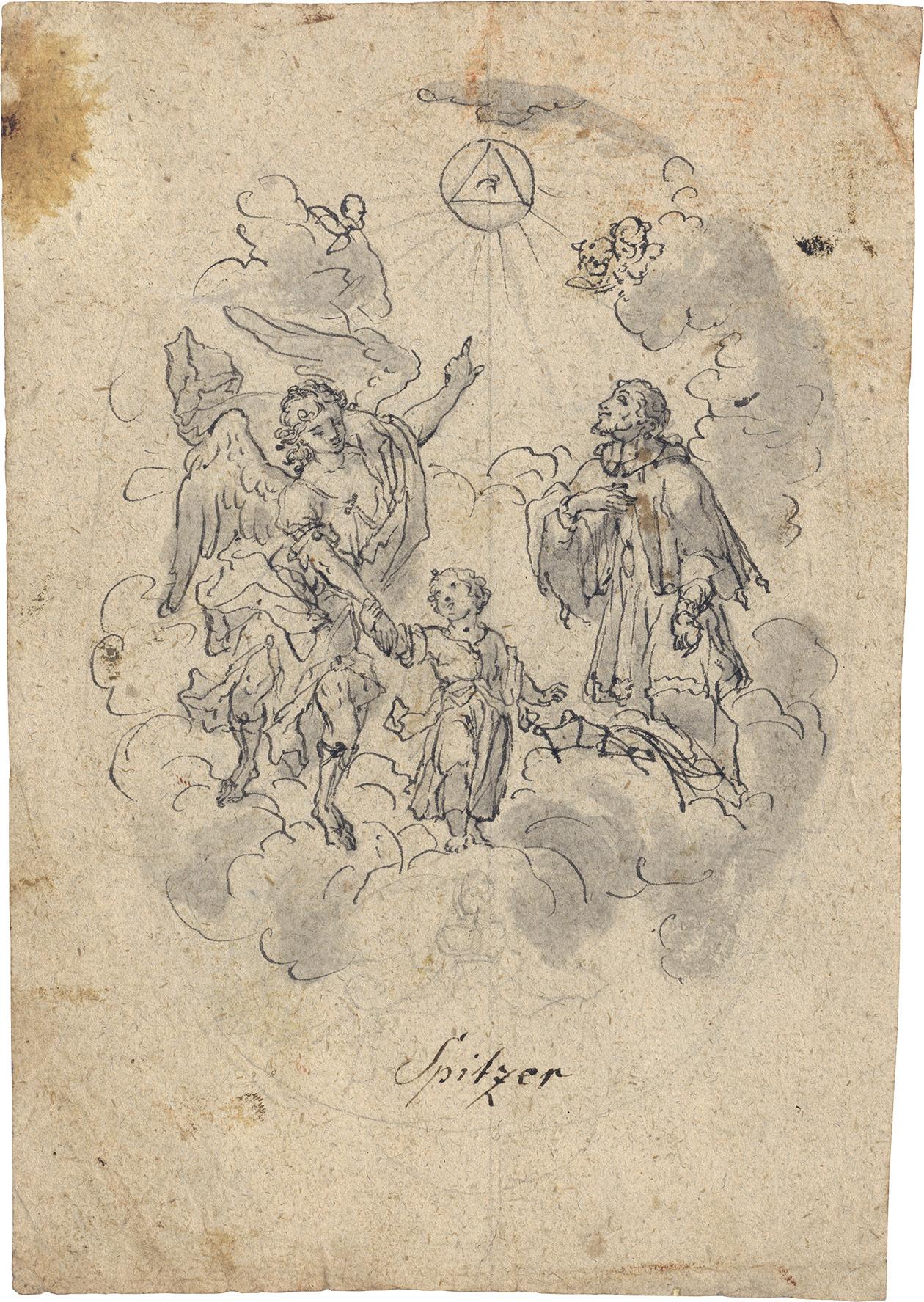

Johann Anton Gumpp (1654 Innsbruck – 1719 München)
6556 zugeschrieben. Entwurf für die Deckendekoration eines Festsaals mit allegorischen Figuren.
Feder in Schwarz, grau und gelb laviert. 11 x 16,9 cm. Verso mit Sammlerparaphe.
800 €
Paul Troger (1698 Welsberg – 1762 Wien)
6557 Umkreis. Pallas Athene und ein Putto auf Wolken. Schwarze und weiße Kreide auf graubraunem Bütten.
28 x 20,4 cm. Unten rechts in Graphit bez. „Troger f.“. Wz. Sonne.
750 €
Johann Wenzel Spitzer (1711–1774, Prag)
6558 Schutzengel mit Knabe: Entwurf für ein Altarbild. Feder in Grau, grau laviert, über Graphit, verso geschwärzt. 20,9 x 14,1 cm. Unterhalb der Darstellung signiert „Spitzer“. Wz. Bekröntes Wappen mit gekreuzten Schwertern.
450 €
Felix Anton Scheffler (1701 München – 1760 Prag)
6559 und Thomas Christian Scheffler (1700 München –1756 Augsburg). Die Götter des Olymp: Entwurf für eine illusionistische Malerei.
Feder und Pinsel in Grau, in Rötel quadriert. 31,3 x 39,3 cm. Wz. Allianzwappen in Kartusche bekrönt von Bischofsinsignien.
2.400 €

Oberitalienisch
6560 um 1730/40. Die Anbetung der Hirten. Feder in Grau, grau laviert, weiß und rosa gehöht, auf hellbraun getöntem Papier. 49,1 x 37 cm. Bekröntes Lilienwappen mit angehängtem „4W“.
1.500 €
Provenienz: Aus einer wohl unbekannten Sammlung (nicht bei Lugt).

Italienisch
6561 18. Jh. Entwurf für eine Deckenmalerei mit allegorischen Figuren, Putten und Motiven aus der Mythologie. Feder in Braun, braun laviert über Bleistift. 34,7 x 47,5 cm. 1.800 €
Provenienz: Süddeutsche Privatsammlung „KL“ (verso, nicht bei Lugt).



6564
Süddeutsch
6562 spätes 18. Jh. Joseph vor dem Pharao. Aquarell über Bleistift, weiß gehöht, auf Velin. 29,2 x 41 cm. Verso eine alte Zuschreibung an „van Loo“.
750 €
Provenienz: Sammlung Anton Schaller, Wien (Lugt 173).
Franz Xaver Wagenschön (1726 Littisch, Böhmen – 1790 Wien)
6563 Bacchuszug mit tanzenden Nymphen. Schwarzer Stift, verso: Merkur und Argus. 16,3 x 22 cm.
600 €
Provenienz: Sammlung Wilhelm Koenig (Lugt 2653b).
Beigegeben eine Karl August Krazeisen zugeschriebene Bleistiftzeichnung „Die Maler Johann Jakob Dorner und Weinberger, der Akademiedirektor Johann Peter von Langer und der Arzt Johann Nepomuk Ringseis“ nach Ludwig Emils Grimms „Künstler Unterhaltung in München“ im Jahr 1812.
Christian Trauschke (1671–1730, Dresden)
6564 Ruinenlandschaft mit Lautenspieler. Feder in Grau, grau laviert, alt montiert. 23,6 x 34,5 cm. Unten links signiert und datiert „C. Trauschke iv. fc. in Dresden 1706“, verso mit montiertem Zettel, dort handschriftl. bez. „No 155“.
800 €
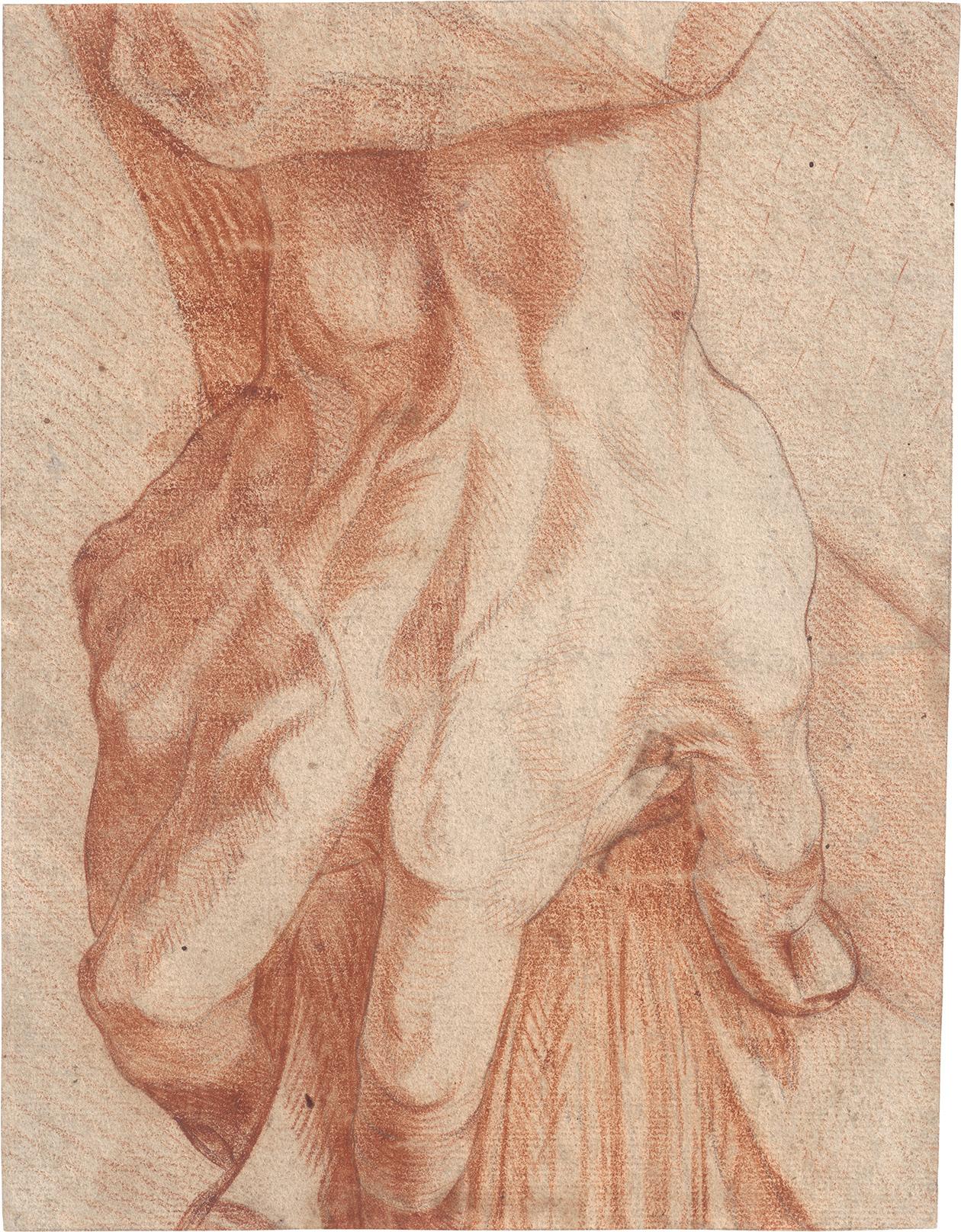
Französisch
6565 18. Jh. Studie einer Hand.
Rötel und grauer Stift auf Bütten. 25,4 x 19,5 cm. Wz. Auvergne[...].
400 €
Christian Bernhard Rode (1725–1797, Berlin)
6566 Jephta und seine Tochter. Rötel auf Bütten, verso: eine weitere alttestamentarische Szene. 43,5 x 59 cm. Wz. Lilienwappen und Schrift „Bloh...“.
600 €
Anton Joseph Graf von Prenner (1683 Wallerstein – 1761 Wien)
6567 Die Anbetung der Hirten.
Rötel. 16,2 x 21,6 cm. Um 1728. Wz. Pro Patria.
800 €
Provenienz: Sammlungen des Cabinet Lamberg, Wien (wohl Anton Franz de Paula Graf Lamberg-Sprinzenstein, nicht bei Lugt).
Sammlung Heinrich Schwarz, Wien (Lugt 1372).
Bei dem Blatt dürfte es sich um die gleichseitige Vorzeichnung zu Nr. 104 im 1728 publizierten Teil des „Theatrum Artis Pictoriae“ handeln; ein großes Galeriewerk, das nach der 1728 erfolgten Neuordnung der kaiserlichen Bildergalerie in der Stallburg begonnen wurde. Von 1728-1733 erschienen vier Bände mit insgesamt 160 Reproduktionen von Gemälden in kaiserlichem Besitz. Prenner war als Stecher an der Herausgabe des ursprünglich wohl auf über zwanzig Bände angelegten Werks beteiligt. Als Vorlage für unsere Darstellung diente ein Gemälde Leandro Bassanos, und nicht wie traditionell angenommen, eine Anbetung von dessen Vater Giacomo Bassano.



Salvatore Colonnelli-Sciarra (tätig 1700–1764, Rom )
6568 Piazza del Popolo in Rom. Tempera auf Pergament, auf Holz aufgezogen. 19,6 x 33,7 cm. Unten rechts signiert und datiert „Salv: Colonnelli F. 1735“.
2.400 €
Venezianisch
6569 um 1690. Allegorie auf die Auftragsmalerei (Ein Maler nimmt von einem vornehmen Herren einen Auftrag entgegen).
Feder in Braun, braun laviert, auf beigem Papier. 34,9 x 26,5 cm. Verso von alter Hand bezeichnet „v: o: d:“. Wz. Tre Lune (undeutlich).
800 €


Venezianisch
6570 18. Jh. Orientale, ein Tablett haltend.
Feder in Braun, Spuren von Rötel. 26 x 18,6 cm. Wz. Anker im Kreis mit angehängtem Stern. 900 €
Gerard de Lairesse (1641 Lüttich – 1711 Amsterdam)
6571 zugeschrieben. Allegorische Szene mit Idolatria und Oratione.
Feder in Braun und Grau, Rötel, grau und braun laviert, weiß gehöht, oben punktuell alt montiert. 16,9 x 10,1 cm. Verso eine alte Zuschreibung an Gerard de Lairesse.
1.200 €
Provenienz: Sammlung Goll van Franckenstein, Amsterdam (mit deren Nummerierung verso, Lugt 6307 und 6308).
Wir danken Jasper Hillgers, Amsterdam, für wertvolle Hinweise.


Giambattista Canal (1745–1825, Venedig)
6572 Rebekka und Elieser am Brunnen vor der Stadt Haran.
Pinsel in Braun, braun laviert, über Bleistift. 28,3 x 40 cm. Um 1800.
1.800 €
Provenienz: Sammlung Richard Herrlinger, Wien (recto, Lugt 5818). Sammlung Anton Schmid, Wien. Sammlung Helmut Märkt, Reutlingen. Galerie Sabrina Förster, Düsseldorf, Herbstkatalog 2006/2007, Nr. 33, mit Abb. (mit Gutachten von George Knox, Vancouver).
Der venezianische Freskenmaler Giambattista Canal war der Sohn des Malers Fabio Canal (1701-1767), langjährigem Mitarbeiter Giovanni Battista Tiepolos. Giambattista Canal war als Freskenmaler in Venedig, Triest und Ferrara tätig. Sein zeichnisches Œuvre ist noch kaum erschlossen, und es sind lediglich etwa zwei Dutzend Zeichnungen von seiner Hand bekannt. Das vorliegende Blatt schildert eine Szene aus Genesis 24, in der Elieser aus Dank für die Versorgung seines Gefolges mit Wasser der Rebekka eine Kette und zwei Armreifen aus schwerem Gold schenkt. Die charmante Darstellung wird nicht zuletzt durch die von rechts herantrabenden Kamele und die grazile Haltung Rebekkas mit einer elegant humorvollen Note aufgelockert. Der neoklassizistische Ansatz der Zeichnung ist sichtbar verwandt mit den Freskendekorationen im Palazzo Filodrammatico in Treviso von 1804. - Mit einem Gutachten von George Knox, Vancouver vom 29. Juni 2006 (in Kopie vorhanden).
Giuseppe Piattoli (um 1743 – nach 1818, Florenz)
6573 Christi auf Wolken umgeben von Engeln, angebetet von vier weiblichen Figuren.
Feder in Braun, über schwarzer Kreide, braun und grau laviert, in schwarzer Feder eingefasst, auf Fensterpassepartout montiert. 36,1 x 21 cm. Verso von späterer Hand in Bleistift bezeichnet. Wz. Bekröntes Wappen mit Schild und Initiale F.
2.500 €
Provenienz: Süddeutsche Privatsammlung „KL“ (verso, nicht bei Lugt).
Piattoli war als Maler, Zeichner und Kupferstecher tätig und lehrte zwischen 1785-1807 als Zeichenmeister an der Akademie in Florenz. Nur wenige seiner Zeichnungen sind bislang publiziert. Unser Blatt zeigt eine Verbindung zu venezianischen Künstlern wie Sebastiano Ricci und Giovanni Battista Tiepolo, besonders deutlich zu erkennen bei den beiden weiblichen allegorischen Halbfiguren am linken Bildrand.

Gaetano Gandolfi

(1734 Matteo della Decima bei Bologna – 1802 Bologna)
6574 Studienblatt mit Frauenköpfen mit Phantasiefrisuren.
Feder in Braun über schwarzer Kreide, braun laviert. 29,2 x 20,2 cm.
1.800 €
Provenienz: Faerber and Maison Ltd., New Bond Street, London. Der Maler, Zeichner und Radierer Gaetano Gandolfi war ein schöpferischer und hochproduktiver Künstler, der in vielen Disziplinen brillierte und der es zu seinen Lebzeiten in Bologna zu höchstem Ansehen brachte. Ganz besonderen Rufes erfreuten sich Gaetanos phantasievolle Kopfstudien in Feder, Bleistift und Pastell. Viele dieser Blätter sind in einer Technik ausgeführt, die in ihrer Virtuosität den sogenannten „Federkunststücken“ ähnelt. Die Anmut der dargestellten jungen Frauen und der Schmelz der Behandlung machten diese Phantasieporträts zu beliebten Sammlerstücken.

6575
Italienisch
6576 um 1790. Aktstudie eines athletischen Mannes. Feder in Schwarzbraun, braun laviert, über Graphit, verso weitere Figurenstudien in Graphit oder dunkelbrauner Feder. 34,8 x 23 cm. Verso Klebeetikett aus einem alten Auktionskatalog, dort als „Johann Heinrich Füssli“ beschrieben. Wz. Fabriano (Fragment).
750 €
Provenienz: Sammlung Benno Moser (Lugt 1828a).
Angelika Kauffmann (1741 Chur – 1807 Rom)
6575 Umkreis. Opfer eines jungen Paares an die Liebe, umgeben von den neun Musen. Feder in Braun und Rötel, verso: Bildnis einer jungen Frau in Bleistift. 28,2 x 22,8 cm. Wohl um 1780/90. Wz. Schriftzeile „Mills...“ (undeutlich).
750 €

6576

Jean Jacques François Lebarbier d. Ä. (1738 Rouen – 1826 Paris)
6577 Das goldene Zeitalter oder Die Schöpfung. Feder in Schwarz und Aquarell. 32 x 43 cm. Signiert und bezeichnet „Lebarbier l‘ainé in.“, auf einem Steinquader links „Lebarbier l‘ainé in 1783“. Jacq-Hergoualc‘h . 2.400 €
Literatur: Michel Jacq-Hergoualc‘h: Jean-Jacques François Le Barbier l’aîné. Catalogue de l‘œuvre dessiné, 2014, Kat. D. 564.
Der Maler, Zeichner und Kunsttheoretiker Jean Jacques François Lebarbier war Schüler von Jean Baptiste Marie Pierre an der Pariser Académie royale. Es folgten der obligate Romaufenthalt und eine Reise in die Schweiz, wo Lebarbier mit Salomon Gessner freundschaftlich verbunden war. 1780 wurde Lebarbier als Agrée, 1785 als Mitglied in die
Akademie aufgenommen. Der Künstler wurde vor allem als Historienmaler und als Zeichner von Illustrationsvorlagen bekannt. Lebarbier arbeitete in einer verfeinerten und verhaltenen klassizistischen Formensprache, die charakteristisch für die Epoche Louis XV. ist. Die vorliegende, detailliert und bildmäßig ausgeführte Zeichnung wurde 1783 auf dem Pariser Salon ausgestellt und diente als Vorlage für eine Farbradierung des Jean-François Janinet (Portalis-Béraldi, S. 481, Nr. 64). Die pastorale Darstellung geht auf eine Passage aus Ovids Metamorphosen (Buch I, 89-150) zurück. In seiner zeichnerischen Präzision und Sorgfalt der Durchführung entspricht das Blatt allen Kriterien einer Stichvorlage. Dazu trägt auch das verfeinerte, verhaltene Kolorit aus sanften Braun-, Grün- und Blautönen wesentlich bei, das ganz der Ästhetik des ausgehenden 18. Jahrhunderts verpflichtet ist und eine für das empfindsame Zeitalter charakteristische poetische Atmosphäre erzeugt.

Giuseppe Cades (1750–1799, Rom)
6578 Johannes der Täufer. Schwarze Kreide, gewischt, auf Fensterpassepartout montiert. 44,6 x 24,7 cm. Unten links signiert und datiert „G. Cades. 1770“. Wz. Bekröntes Lilienwappen.
3.000 €
Provenienz: Sotheby‘s, London, Auktion am 8. Juli 2011, Los 114.

Jacques-Henry-Alexandre Pernet (um 1763 – 1789, Paris)
6579 Zwei Ruinencapriccios.
2 Zeichnungen, je Feder in Schwarz und Aquarell, Einfassungslinie in brauner Feder. Je ca. 42 x 58,5 cm. 12.000 €
Nur wenig ist bekannt über Leben und Wirken des Ruinenmalers und Vedutisten Jacques-Henry-Alexandre Pernet, was verwundert, angesichts der hohen künstlerischen Qualität der beiden hier vorgestellten Aquarelle. Pernet wurde um 1763 als Sohn eines Parfümeurs in Paris geboren und war Schüler des Architekturmalers Pierre Antoine de Machy (1723-1807); 1783 ist er im Schülerverzeichnis der Académie royale de peinture et de sculpture verzeichnet. Neben seiner Teilnahme an dem
Pariser Salon de la Correspondance ist Pernets künstlerische Tätigkeit nur durch wenige überlieferte Werke aus dem Zeitraum 1784-89 dokumentiert. Zweifellos wurde Pernet durch die Ruinenmalerei Hubert Roberts angeregt. Charakteristisch für Pernets Œuvre sind Capriccios mit antiken Ruinen, Treppengeländern, Triumphbögen, Kolonnaden und Statuen, die in einer szenographischen, starken perspektivischen Verkürzung wiedergegeben und in einer üppigen parkähnlichen Landschaft situiert sind. Das zeittypische, sanfte, auf wenige Blau-, Grün- und Brauntöne reduzierte Kolorit erinnert ebenfalls an Zeitgenossen wie Hubert Robert und Louis-Jean Desprez. Als ebenso richtungsweisend für Pernet erwies sich das zeichnerische und druckgraphische Œuvre Giovanni Battista Piranesis, welches eine ganze Generation junger französischer

Künstler - die sogenannten Piranésiens - maßgeblich geprägt hat. Erwähnt sind Künstler wie Charles Michel-Ange Challe, Louis-Jean Desprez, JeanLaurent Legeay, Louis-Joseph Le Lorrain, Ennemond-Alexandre Petitot und Charles de Wailly, um nur einige Beispiele zu nennen (siehe Ausst. Kat. Piranèse et les Français 1740-1790, Académie de France à Rome, 1976). Die beiden vorliegenden, detailliert und souverän ausgeführten Aquarelle bestechen durch ihre raffinierte und aufwendige Bildregie und durch ihre Fülle an reizvollen Einfällen und anekdotischen Details, ein Aspekt, der ebenfalls an Pernets genialen Zeitgenossen Desprez erinnert. Ein stilistisch sehr ähnliches Aquarell von etwa gleich großem Format befindet sich in der Sammlung des Royal Institute of British Architects in London (siehe Piranèse et les Français 1740-1790, Rom 1976, Abb. 130).



6580
Francesco Zuccarelli (1702 Pitigliano, Grosseto – 1788 Florenz)
6580 Südliche Landschaft mit kleinem Kastell und Angler an einem Gebirgsbach.
Feder in Braun, grau und braun laviert, teils weiß gehöht, auf Bütten. 36,8 x 37 cm.
3.500 €
Provenienz: Sammlung Paul Sandby, London (Lugt 2112).
Italienisch
6581 2. Hälfte 18. Jh. Architekturcapricco. Feder und Pinsel in Braun, über Spuren schwarzer Kreide. 16 x 26,6 cm. Wz. Fisch.
750 €
Italienisch
6582 18. Jh. Die Himmelfahrt der hl. Katharina. Pinsel in Braun, braun-schwarz laviert, weiß gehöht auf braunblauem Bütten, auf einen Sammlerkarton aufgezogen. 24,5 x 41 cm. Auf dem Sammlerkarton unten links nummeriert „N°. 12 de [?]35“.
1.200 €
Provenienz: Sammlung Graf Jacob Gustaf de la Gardie (1768-1842), Schloss Löberöd, Schweden (Lugt 2722a).
Durch Erbfolge bis 2020 im Besitz des Gutshofs Borrestad. Privatsammlung, Schweden.
Louis-Jean Desprez (1743 Auxerre – 1804 Stockholm)
6583 Illumination de la Croix de Saint-Pierre. Aquarell, Gouache und Feder in Schwarz, im oberen Bereich eigenhändige Korrekturen auf montierten Papierfragmenten ergänzt, verso: eine Federzeichnung mit einer Darstellung aus der Römischen Schlachtenszene. 68,2 x 46,6 cm. Um 1787. Wz. Bienenkorb mit Nebenmarke „Zoonen“.
9.000 €
Im September 1781 schrieb der Maler Louis Masreliez an seinen schwedischen Kompatriot Adolf Ulrik Wertmüller: „Mr. Desprez se fixe à Rome et s‘est associé avec [Francesco] Piranesi. Ils ont entrepris une suite de Dessins qui ont et méritent d‘avoir le plus grand succès“. Bei dieser Zusammenarbeit handelt sich um eine Suite kolorierter Umrissradierungen mit insgesamt zehn Ansichten aus Rom und Neapel. 1784 als Desprez nach Schweden aufbrach war etwa die Hälfte bereits publiziert. Neben bekannten Orten aus beiden Städten, waren auch zwei religiöse Prozessionen darunter: eine pontifikale Messe in der Capella Paolina im Petersdom (siehe unser Los 5282) sowie die Zeremonie zum erleuchteten Kreuz am Gründonnerstag in der Vierung von Sankt Peter; die Darstellung, zu der vorliegende Entwurfszeichnung gehört.
Desprez, ein Meister der Atmosphäre, wusste wie man dieses außergewöhnliche, spirituelle Ereignis heraufbeschwört. Rund zehn Vorstudien und Entwurfsvarianten (vgl. etwa die Zeichnungen in New York und Warschau) legen dies dar: Desprez fertigte verschiedene Vorzeichnungen an, die die Vierung in Sankt Peter aus unterschiedlichen Blickrichtungen einfängt. Der Louvre verwahrt eine Zeichnung, die wie unsere Zeichnung aus dem südlichen Teil der Vierung auf den Hauptaltar blickt, im Hintergrund rechts erscheint das illuminierte Kreuz. In Zusammenhang mit dieser Zeichnungsgruppe ist auch die Entstehung unserer großformatigen Zeichnung zu sehen.
Die gewählte mise-en-page und die gewählte Perspektive im Vergleich mit den anderen Ideenzeichnungen entspricht bereits der finalen Radierung. Dennoch gibt es im Detail kleine Unterschiede: das Figurenpersonal ist reduzierter, Desprez hat die Figuren noch nicht an ihren finalen Platz gesetzt, die Lichtsituation ist anders ausgeleuchtet und viele architektonische Details sind nur rudimentär angelegt. Auch die montierten Korrekturen im Kumpelbereich sowie links oben verweisen auf die sich im Entwicklungsprozess befindliche Künstlerarbeit. Von diesem unmittelbaren Künstlerschaffen zeugt schließlich auch die rückseitige Federarbeit mit einer kraftvollen Zeichnung einer römischen Schlachtenszene– möglicherweise ein Entwurf für eine (bisher wohl unbekannte) Radierung. Wir danken Prof. Magnus Olausson, Stockholm für die Bestätigung der Autorschaft anhand einer digitalen Abbildung (E-Mail vom 27. August 2025).
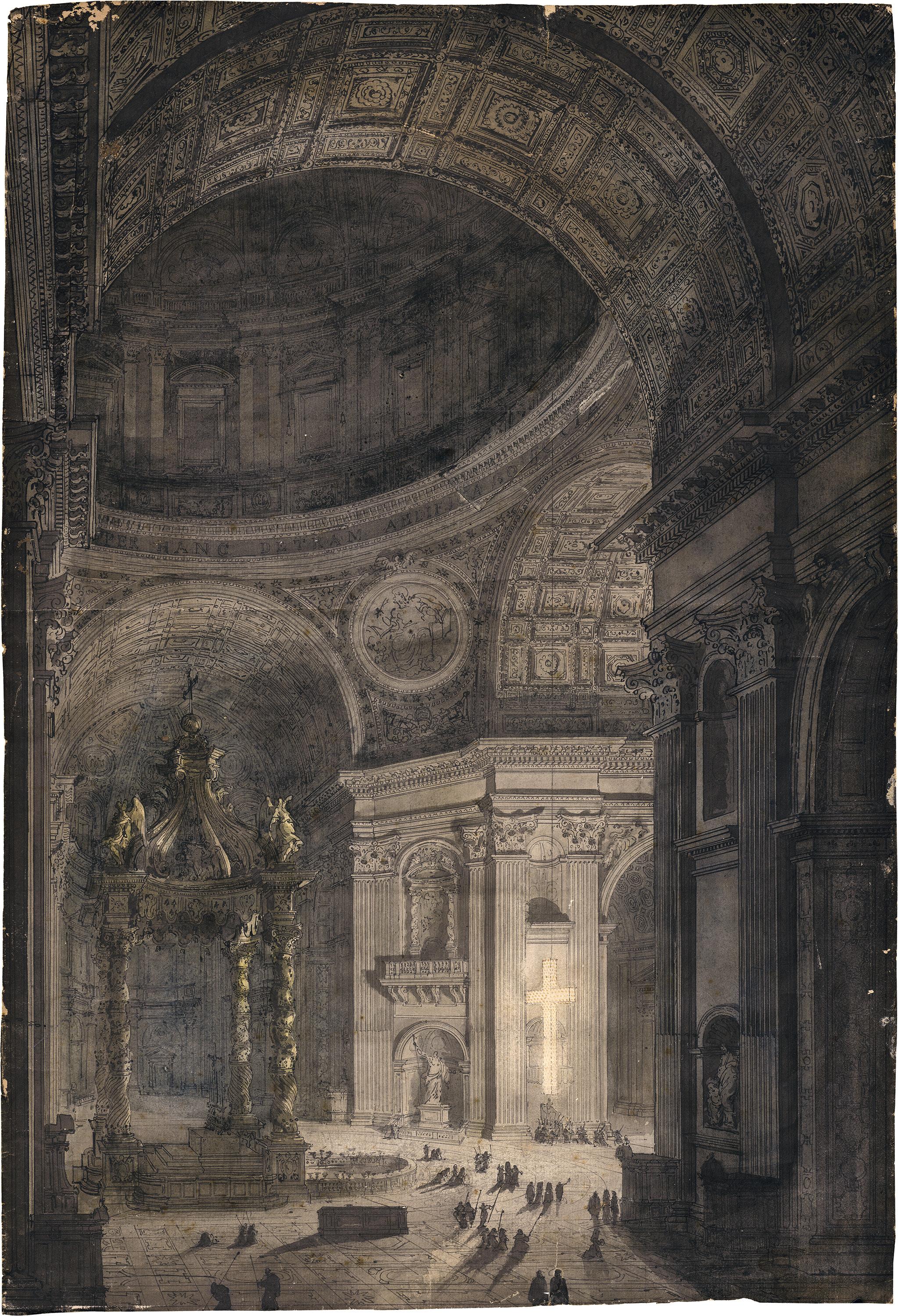
Französisch

6584 spätes 18. Jh. Tableaux mit 6 Ansichten französischer Schlösser und Häfen.
6 Gouachen. 2-3 cm x 3,5-6,2 cm.
600 €
Louis-Nicolas van Blarenberghe (1716 Lille – 1794 Fontainebleau)
6585 Gewitterlandschaft mit Reitern. Gouache, mit teils in Goldfarben gezogener Einfassungslinie. 18,1 x 22,7 cm. Verso mit dem Stempel des Vergolders „N. & F. Pitzer, Frankfurt a.M.“ und einer alten Zuschreibung an Bemmel.
900 €
Louis-Nicolas van Blarenberghe
6586 Umkreis. Kleine Landschaft mit Hirschjagd (Louis XV. auf der Jagd?). Gouache auf Papier. 5,5 x 6,5 cm. Am Unterrand undeutlich datiert „17[...]“.
600 €



Jacob Cats
(1741 Altona – 1799 Amsterdam)
6587 Überwucherter Torbogen mit einer hindurchziehenden Herde mit Hirten.
Feder in Braun, braun laviert, über leichter Bleistiftskizze, mit Feder in Braun eingefasst, auf Velin. 18,7 x 25,8 cm. Rechts unten signiert „J. Cats“, sowie verso abermals signiert „J Cats f“.
1.800 €
Carlo Labruzzi
(1765 Rom – 1818 Perugia)
6588 Ein antiker Torbogen an der Via Appia bei Itri. Aquarell über einer leichten Bleistiftvorzeichnung. 42 x 34,1 cm. Eigenhändig bezeichnet in brauner Feder „Archo antico un miglio e mezzo lontano da Itri per andare a Molo“. Um 1790.
1.800 €
Der in Rom geborene Carlo Labruzzi wurde 1781 in die Congregazione dei Virtuosi und 1796 in die Accademia di San Luca aufgenommen. Labruzzi wurde vor allem als Landschaftsmaler und Kupferstecher bekannt. Zu seinen bevorzugten Sujets zählten gestochene Ansichten von römischen Altertümern und Genredarstellungen. Labruzzis 1794 erschienene Kupferstichfolge Via Appia illustrata ab urbe Roma ad Capuam, zeigt Ansichten der antiken Bauten und Gräber entlang der Via Appia. Das Werk war dem Antiquar Sir Richard Hoare gewidmet, der Labruzzi 1789 dazu eingeladen hatte, ihn auf den Spuren von Horaz von Rom nach Brindisi zu begleiten. Die Unternehmung musste zwar in Benevent abgebrochen werden, doch die auf der Reise entstandenen Zeichnungen dienten dem Künstler als Vorlage für zahlreiche Werke. Das vorliegende Aquarell stammt aus einer losen Folge von Studien, die der Künstler auf einer Wanderung in der Provinz Latina in Latium unternahm. Das stimmungsvolle Motiv ist frei und routiniert vor der Natur erfasst und besitzt einen bildmäßigen Charakter. Anmutige Blätter dieser Art wurden auch bewusst als Andenken für ausländische Reisende der Grand Tour konzipiert.




Georg Philipp Rugendas d.Ä. (1666–1742, Augsburg)
6589 Ein Feldlager vor dem am 8. Dezember 1703 bombardierten Augsburger Klinkertor Feder in Schwarz über Graphit, braun laviert. 15,2 x 22 cm.
1.200 €
Literatur: Anke Charlotte Held: Georg Philipp Rugendas (1666 - 1742). Gemälde und Zeichnungen. München 1996, S. 298, Kat. Nr. Z 26 b. Die Zeichnung gehört zu einer umfangreichen Gruppe in Rugendas‘ Werk, die in ihrer sachlichen Realistik und in ihrem sorgfältigen Zeichenstil einen wertvollen Einblick in die Arbeitsmethodik des Künstlers bieten. Unter der Reinzeichnung in schwarzer Feder liegt eine leichte Vorzeichnung in Graphit, die jedes Detail der Darstellung mit klar definiert. Die Lavierungen sind treffsicher und visuell wirksam über das Blatt verteilt. Diese Reinzeichnungen dienten häufig als Arbeitsvorlagen, jedoch lassen sie sich nicht immer mit ausgeführten Werken in Verbindung bringen. Aus persönlicher Betroffenheit entstand 1703/04 ein größerer Werkkomplex, der die in diesen Jahren stattfindende Belagerung der Stadt Augsburg durch bayerische und französische Truppen darstellt. Im Spanischen Erbfolgekrieg befahl der bayerische Kurfürst Max Emanuel die Reichsstadt zu belagern und im Anschluss zu besetzen. Rugendas wurde zum Chronisten dieser Ereignisse und übertrug seine Entwürfe in Gemälde, Zeichnungen und Radierungen. Eine mit unserem Blatt in der Komposition und der Figurengruppe identische, allerdings hochformatige Umrisszeichnung in Feder befindet sich in den Staatlichen Kunstsammlungen Augsburg (Inv. Nr. G 5595).
Adrian Zingg (1734 St. Gallen – 1816 Leipzig)
6590 Flusslandschaft mit Wirtshaus.
Feder in Grau, schwarzer Stift, grau laviert, mehrfach in schwarzer Feder eingefasst und mit applizierter Goldbordüre. 19,2 x 24,9 cm. Unten links signiert und datiert „Zingg. 1764.“. Wz. Fragment (Rosenkranz?).
900 €
Beigegeben eine Adrian Zingg zugeschriebene Zeichnung „Kirche in Medingen bei Bautzen“, 1772 datiert.
Französisch
6591 18. Jh. Bildnis eines jungen Edelmanns mit Cape und Halsschal. Schwarze und weiße Kreide auf blauem Papier. 21 x 15,8 cm.
450 €
Provenienz: Sammlung Charles Gasc (Lugt 544).
Anton Graff

(1736 Winterthur – 1813 Dresden)
6592 Bildnis Maximilian Maria Josef Prinz von Sachsen. Schwarze und weiße Kreide auf blauem Bütten, verso: „Studie zu einem Brustbild der Maria Amalia Augusta Kurfürstin von Sachsen“ in schwarzer Kreide. 35,5 x 20,7 cm. Vor 1770.
1.800 €
Literatur: Ausst. Kat. Anton Graff, Galerie Arnold, Dresden 1910, Nr. 116. Ausst. Kat. Anton Graff, Sächsischer Kunstverein, Dresden 1913, Nr. 120. Ausst. Kat. 100 Jahre deutsche Zeichenkunst 1750-1850, Chemnitz 1930, Nr. 91, Tafel 6.
Ausst. Kat. Bildnis und Komposition 1750-1850 Zeichnungen und Aquarelle aus der Sammlung Heumann Chemnitz, Leipzig 1934, Nr. 72 mit Abb. Tafel 6.
Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1934, Nr. 59.
Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Adrian Zingg (1734 St. Gallen – 1816 Leipzig)
Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst aus zwei Jahrhunderten, 1760-1960. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung W. B., Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, 1967, Nr. 32.
Ekhart Berckenhagen: Anton Graff. Leben und Werk, Berlin 1967, Nr. 964.
Provenienz: Sammlung Fritz Arndt, Oberwartha.
C.G. Boerner, Leipzig, Auktion 124 am 19. März 1914, Los 29. Sammlung Gustav Engelbrecht, Hamburg (Lugt 1148).
Amsler und Ruthardt, Berlin, Auktion vom 28.-29. Oktober 1924, Los 77.
Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 2841a).
Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert Ketterer, Stuttgart, Auktion 29 am 29. November 1957: Sammlung Heumann, Chemnitz. Kunst des 18. und 19. Jahrhunders. Aquarelle, Zeichnungen, Gemälde, Graphik, Los 111 mit Abb. Taf. 1.
Das Bildnis zeigt Maximilian Maria Josef Prinz von Sachsen (17591838) als etwa 10-jährigen Knaben. Der Sohn des Kurfürsten Friedrich Christian von Sachsen war Oberst und Chef des 2. Linien-Infanterie-Regiments. Seit 1792 war er Ritter des Goldenen Vlieses und heiratete im selben Jahr Caroline Marie Therese Prinzessin von Parma.
6593 Schloss Moritzburg bei Dresden. Feder in Schwarz, braun laviert auf J. Whatman-Velin. 50 x 68,2 cm. Verso zeitgenössisch in brauner Feder betitelt „Moritzburg“ sowie in Bleistift bez. „No 33“. 4.500 €
Provenienz: Sammlung Erhard Kaps, Leipzig (Lugt 3549).
Die repräsentative, bildmäßig ausgeführte Zeichnung zeigt den Blick auf Schloss Moritzburg mit seinen markanten Türmen über den Schlossteich hinweg. Die imposante barocke Schlossanlage liegt auf einer künstlich geschaffenen Insel, die über einen schmalen Damm erreichbar ist. Der Vorläufer des Schlosses war das ehemalige Jagdhaus von Herzog Moritz von Sachsen, von dem sich auch der Name herleitet. Die kleine Jagdgesellschaft im Vordergrund illustriert diesen ursprünglichen Zweck des Schlosses feinsinnig. Von dieser Ansicht existieren kolorierte Umrissradierungen kleineren Formats, die auf die Beliebtheit des Motivs schließen lassen (s. Ausst. Kat. Adrian Zingg. Wegbereiter der Romantik, hg. von Petra Kuhlmann-Hodick, Claudia Schnitzer, Bernhard von Waldkirch, Dresden 2012, S. 208, Nr. 98-99).

Johann Eleazar Schenau (eigentl. Johann Eleazar Zeissig, 1737 Groß-Schönau – 1806 Dresden)
6594 Mädchenkopf mit Bändern im Haar. Schwarze und weiße Kreide, Pinsel in Grau auf hellbraunem Bütten. 38,4 x 26,2 cm. 1.200 €
Provenienz: C.G. Boerner, Leipzig, Auktion 164 „Handzeichnungen alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts aus dem Besitze von Frau Geheimrat Ehlers, Göttingen und andere Beiträge aus Privatbesitz...“ vom 9.-10. Mai 1930, Los 388.
Gerd Rosen, Frankfurt a. Main, 37. Auktion vom 11.-13. Oktober 1961, Los 1286 mit Abb.
Zeichnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts

Augustin de Saint-Aubin (1736–1807, Paris)
6595 Pygmalion and Galatea. Schwarze Kreide. 20,6 x 16,9 cm.
4.000 €
Der Kupferstecher und Zeichner Augustin de Saint-Aubin wurde zuerst von seinen beiden älteren Brüdern angeleitet und lernte anschließend bei Étienne Fessard und Laurent Cars. Im Jahre 1771 wurde er Agrée der Akademie und erhielt nach Fessards Tod den Ehrentitel Graveur de la bibliothèque du Roi. Saint-Aubin schuf ein umfangreiches druckgraphisches Œuvre und tat sich auch als Illustrator hervor. Saint-Aubin zählt zu den versiertesten französischen Bildnisstechern des 18. Jahrhunderts.
Unsere Zeichnung diente als Vorlage für einen Stich Jean-Baptiste Gautiers (tätig ca. 1780-1820 in Paris) mit dem Titel „L‘hommage reciproque“ (Inventaire du Fonds Français 2, Bocher 411). Zusammen mit einem Pendant stellte es die Bildhauerei im Gegensatz zur Malerei dar. Das auf die Pygmalion-Legende anspielende Blatt zeigt einen Bildhauer mit Werkzeugen in den Händen, den rechten Arm gestützt auf einen Bildhauerbock, der eine weibliche Büste trägt. Der Blick des jungen Mannes hängt verträumt an der Marmorskulptur. Wie in Ovids Metamorphosen berichtet, verliebte sich der griechische Bildhauer Pygmalion in eine von ihm selbst geschaffene Skulptur und zeugte mit ihr, nachdem Venus seinen Wunsch erhört und sie zum Leben erweckt hatte, die Tochter Paphos.

Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726 Danzig – 1801 Berlin)
6596 Galante Szene in einem Park. Feder in Grau, grau laviert, auf Bütten. 9 x 11,2 cm. Am Unterrand signiert „Chodowiecki del.“.
2.400 €
Provenienz: Sammlung des Baron von Tümpling. Galerie Gerda Bassenge, Auktion 77, 2001, Los 5506. Privatsammlung Berlin.
Reizende, überaus charmante Federzeichnung ganz im Geiste Watteaus.
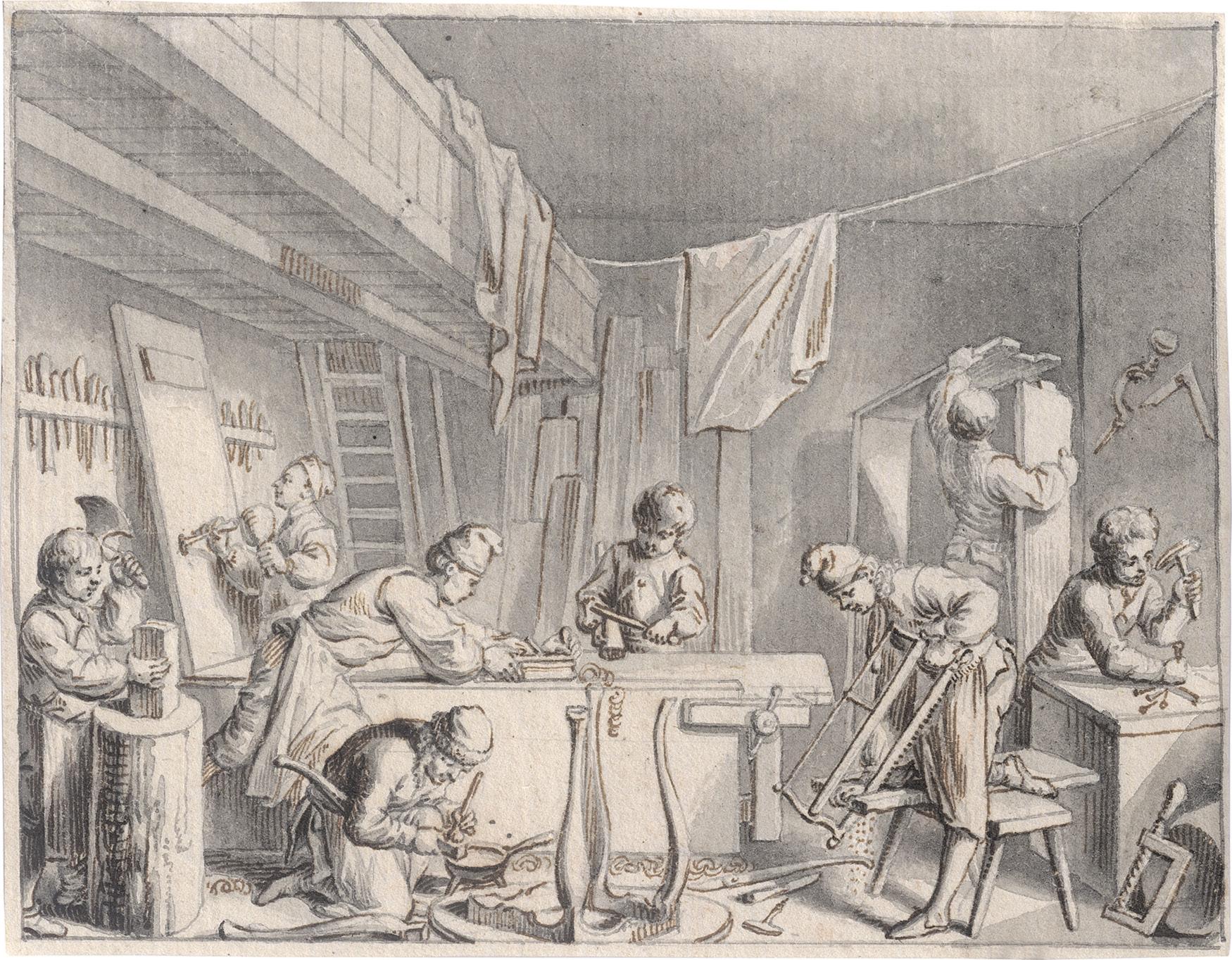
Daniel Nikolaus Chodowiecki
6597 Die Tischlerwerkstatt. Feder in Grau und Braun, grau laviert, auf Bütten. 8,4 x 11,1 cm. Wz. Bekröntes Wappen mit Fleur-de-lis (Fragment).
800 €
Provenienz: Galerie Gerda Bassenge, Auktion 58, 1996, Los 5450. Privatsammlung Berlin.

Daniel Nikolaus Chodowiecki
6598 Dame am Spinnrocken. Bleistift, auf Bütten. 10 x 8,2 cm. Unten links signiert „Chodowiecki“.
1.200 €
Provenienz: Galerie Gerda Bassenge, Berlin, Auktion 91, 2007, Los 6492. Privatsammlung Berlin.

Daniel Nikolaus Chodowiecki
6599 Zwei Kleiderkammern (Entwurfszeichnung zu Basedows Elementarwerk).
Feder in Braun über Graphit. 8,6 x 22,4 cm. Um 1774. 2.400 €
Literatur: Daniel Chodowiecki: 62 bisher unveröffentlichte Handzeichnungen zu dem Elementarwerk von Johann Bernhard Basedow. Mit einem Vorwort von Max von Boehn, Frankfurt a. M. 1922, Nr. 2, Abb. Taf. 2. (Die Veröffentlichung ist dem Los beigegeben).
Äußerst charmante, fein ausgeführte Zeichnung, welche die zeitgemäße, modische und vornehme Bekleidung von Kindern und Jugendlichen
anhand einer voll behängten Garderobe darstellt. Dabei ist die Darstellung in der Mitte zweigeteilt, wobei links die Kleidung und Accessoires der Mädchen und rechts die der Jungen festgehalten sind. Die vorliegende Entwurfszeichnung entstand für die Radierung auf Tafel III des bei Crusius in Leipzig und Dessau 1774 erschienenen Basedowschen, reformerisch geprägtem pädagogischen „Elementarwerk“ Die Darstellung trägt dort den Titel: „Die meisten Kleidungsstücke“ (Taf. III a u. b). Der inhaltliche Zusammenhang ergibt sich in Basedows Werk vor allem auch aus dem humorvollen Vergleich zur folgenden Tafel „Fehler, wodurch Kinder sie verderben“, in der verschiedene Kinder bei allerlei Unfug betrachtet werden können - vom Einpudern über Raufereien bis zum Feuer legen.
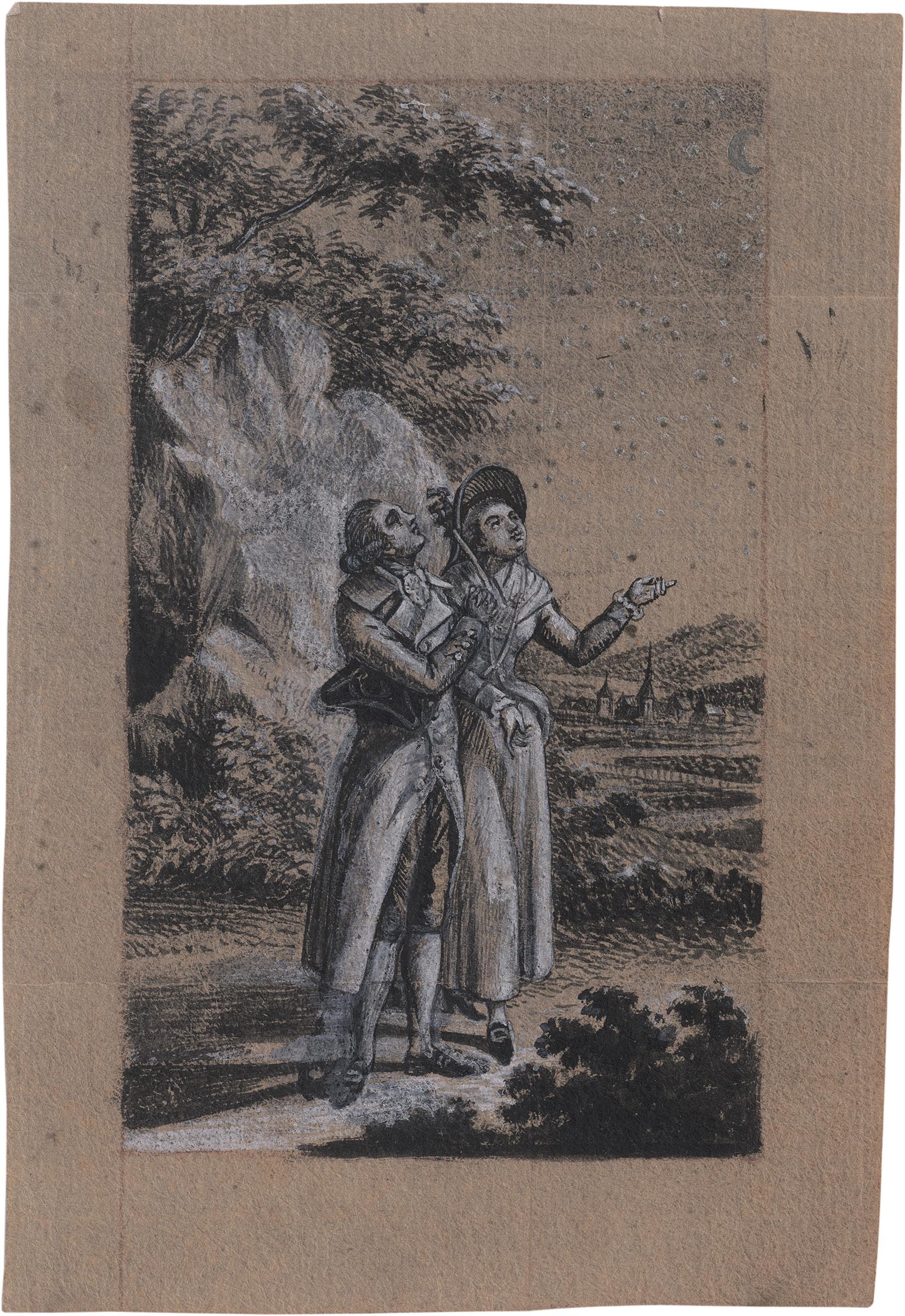
Daniel Nikolaus Chodowiecki
6600 Paar unterm Sternenhimmel. Pinsel in Grauschwarz, teils weißgehöht, auf bräunlichem Bütten. 12,3 x 7,3 cm (Darstellung); 15,2 x 10,1 cm (Blattgröße).
600 €
Provenienz: Galerie Gerda Bassenge, Auktion 70, 1997, Los 6942. Wohl Illustrationsentwurf für einen Almanach.

Daniel Nikolaus Chodowiecki
6601 Der kleine l‘Hombre-Tisch. Bleistift auf Bütten. 11 x 16 cm. Unten links signiert „D. Chodowiecki fecit“ und rechts datiert „den 19 [Oct] obre 1758“.
1.800 €
Provenienz: Sammlung Rudolf Philip Goldschmidt (Lugt 2926). Galerie Jens Heiner Bauer, Hannover (verso auf dem Passepartout Etikett), deren Katalog 48, Nr. 223.
Galerie Gerda Bassenge, Berlin, Auktion 86, 2005, Los 5556.
Fein durchgeführte Entwurfszeichnung, die Chodowiecki etwas abgeändert und mit weniger Figuren in einer Aquatintaradierung (Engelmann 13) umgesetzt hat.


6603
Johann Gottfried Schadow (1764–1850, Berlin)
6602 Sitzende junge Frau mit Strickzeug. Schwarze Kreide auf Velin. 18,9 x 16 cm. Um 1794.
2.400 €
Literatur: Sibylle Badstübner-Gröger, Claudia Czok und Jutta von Simson: Johann Gottfried Schadow. Die Zeichnungen, Berlin 2006, Nr. 380 mit Abb.
Provenienz: Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 2841a).
Karl & Faber, München, Auktion 87, 1963, Los 903.
Die Darstellung der strickenden jungen Frau, die sich in die gerundete Ecke des Sofas schmiegt, erinnert an die Gestalt von Schadows jüngster Schwester Charlotte Schadow in der Zeichnung „Kaffee-Visite“, die 1794 datiert ist (Berlin, Akademie der Bildenden Künste, Badstübner/Czok/ von Simson Nr. 350). Schadow zeigt sich als genauer Beobachter, wobei sein Augenmerk auf den Händen in den fingerlosen Handschuhen liegen, die geschickt mit langen Nadeln die Strickarbeit ausführen.
Berliner Schule
6603 um 1760. Bildnis einer Dame beim Patience-Spiel. Feder in Braun über Spuren von grauem Stift, verso: zwei Studien von eleganten Frauen in Bleistift. 22 x 20,8 cm (Passepartoutausschnitt).
1.500 €
Die ausdrucksvolle Zeichnung dürfte von einem Zeichner aus dem Umkreis von Johann Gottlieb Glume oder Joachim Martin Falbe stammen.

Franz Xaver Apell (tätig um 1795 in Erfurt)
6604 Quodlibet mit Kupferstichen, Notenblatt, Karten, Buchseiten, Stickmustern, Briefen etc. und Widmung an die Familie Apell in Erfurt. Feder in Schwarz, aquarelliert und gouachiert, verso hinter ein Passepartout montiert. 47,8 x 60,1 cm. Rechts unten auf einer gemalten Karte bewidmet und signiert „Einer guten Mutter, Bruder und Schwestern / zum Denkmahl Ihrer erzeigten Liebe und Zärtlichkeit geweiht von dem Verfertiger dieses Blattes / Erfurt im October MDCCXCV [1795] Franz Xaver Apell.“
1.200 €
Provenienz: Sammlung A. Honcamp, Erfurt (nicht bei Lugt). Privatsammlung Hessen.
Sehr reizvolles illusionistisch hervorragendes Quodlibet mit vielen persönlichen Anspielungen auf die Familie, ihre Herkunft, ihre Vorlieben und Tätigkeiten. In der Mitte ist Erfurt als Zentrum einer untergelegten Landkarte zu erkennen, daneben Scherenschnittportraits der Familie, verschiedene Notenblätter, ein Brief, ein Stickmuster mit dem Familiennamen, eine Graphik mit den Uniformen französischer Offiziere, eine Zeichnung mit einem Grabmal von Vater und Bruder, ein Erfurtisches Intelligenzblatt und verschiedenes mehr. Über die Blätter läuft eine kleine, sehr detailliert dargestellte Fliege.
Johann Friedrich Leberecht Reinhold (1744 Neustadt a.d. Orla – 1807 Gera)
6605 Die umworbene Haubenstickerin. Gouache auf Bütten. 47,5 x 38,5 cm.
2.400 €
Der bei dem Zeitzer Maler J. G. Krippendorf ausgebildete Johann Friedrich Reinhold machte sich in Gera vor allem als Maler der Portraits thüringischer Bürgerfamilien und des Adels einen Namen. Bei einem Brand seines Hauses im Jahre 1780 wurde ein Großteil seines Ateliers zerstört, und er war gezwungen, erst nach Schleiz und später nach Neustadt auszuweichen. Erst 1783 kehrte er nach Gera zurück. Er erhielt Aufträge der Fürstenhöfe in Reuß-Gera, sowie aus Thüringen, Franken und Preußen. Seine drei Söhne Friedrich Philipp, Heinrich und Gustav ergriffen ebenfalls das Malerhandwerk.



Jacobus Perkois (1756–1804, Middelburg)
6606 Eine Korbträgerin. Schwarze und farbige Kreiden, Rötel, auf Bütten. 25,3 x 16,8 cm. Wz. Pro Patria.
750 €
Provenienz: Sammlung Richard Holtkott, Bedburg (Lugt 4266).
Jan Christian Sepp (1739–1811, Amsterdam)
6607 „Noct. Cypriaca“: Raupe eines Saatfalters in einer Wurzel.
Feder in Braun, aquarelliert. 27,8 x 21,5 cm. Unten mittig bezeichnet „Noct. Cypriaca“, verso modern in engl. Sprache bezeichnet „Turnip moth caterpillar [...]“.
600 €
Johann Christian Klengel (1751 Kesselsdorf – 1824 Dresden)
6608 Landschaft mit Kühen und schlafendem Hirten. Pinsel in Grau über brauner Feder. 12,9 x 19,9 cm. Unten mittig signiert und datiert „Klengel inv: 1789“. Wz. Pro Patria.
600 €
Johann Friedrich Morgenstern (1777–1844, Frankfurt am Main)
6609 Hügelige Landschaft mit einer Herde und schlafendem Hirten bei einer Ruine.
Pinsel in Braun, braun laviert über Bleistift, auf Velin, an den Ecken auf alten Untersatz montiert. 28 x 31,8 cm. Verso auf dem alten Untersatz bezeichnet „H. Roos“.
1.500 €
Provenienz: Nachlass Carl Morgenstern. Privatsammlung Hessen.


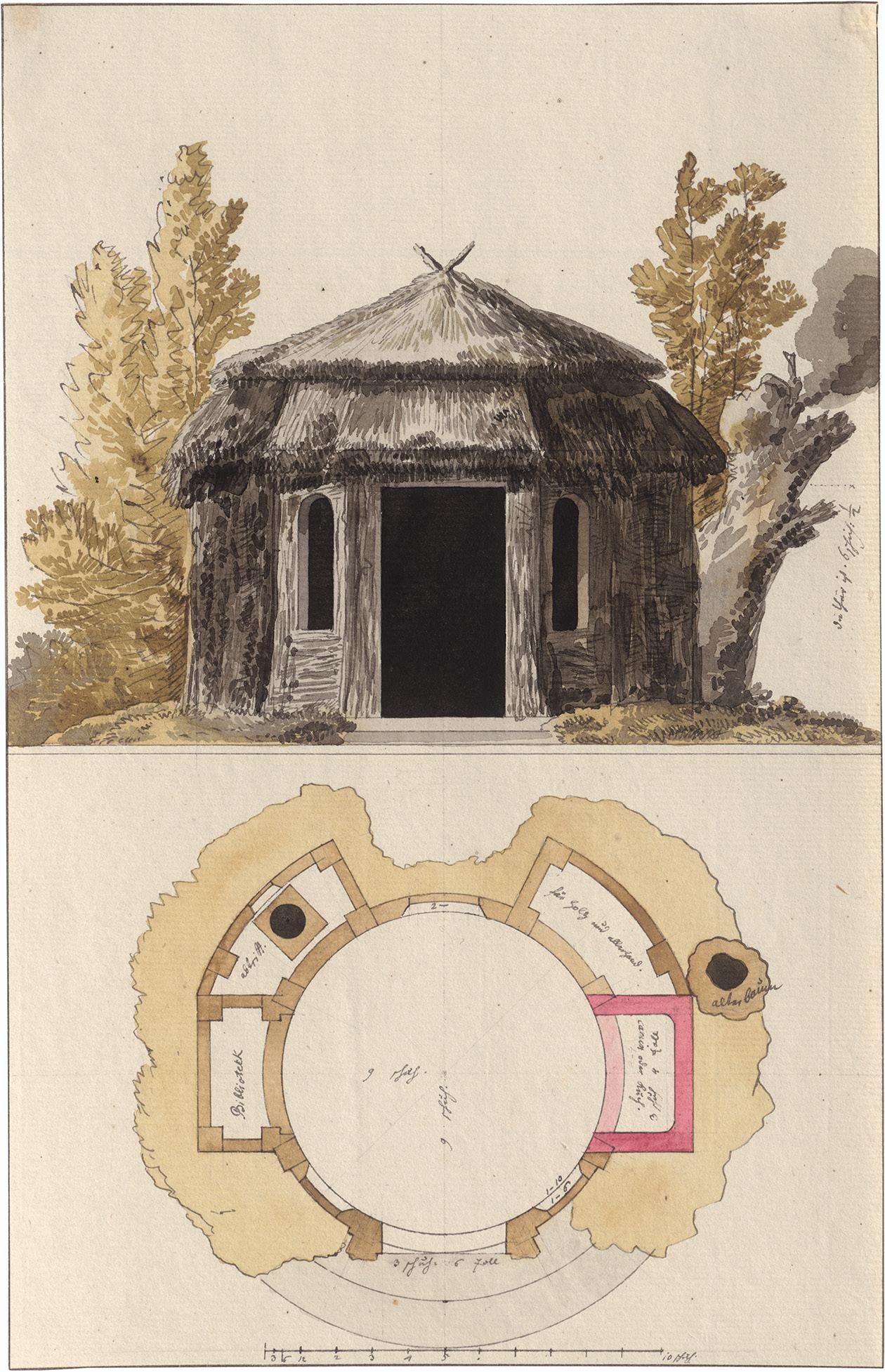

Deutsch
6610 um 1800. Entwürfe zu verschiedenen Gartenarchitekturen: Wurzelhäuschen, Grotte, Italienisches Landhaus und Vogelhaus.
10 Zeichnungen, Feder in Schwarz und Grau, meist aquarelliert. Je ca. 18-38 cm x 18-27 cm, auf 5 Untersatzpapieren montiert. Meist mit Maßangaben und eigenh. Legende.
1.200 €
Jordanus Hoorn (1753–1833, Amersfoort)
6611 Stehender Kavalier in Rückenansicht mit ausgestrecktem Arm.
Schwarze und weiße Kreide auf blauem Papier. 31,9 x 28 cm. Verso mit alter Federnummerierung „4.“.
750 €
Jordanus Hoorn führte eine der in Holland ihrer Zeit sehr beliebten abendlichen Zeichenschulen, in der Laien und Künstler Seite an Seite arbeiteten. Aus der zweiten Hälfte der 1770er Jahre haben sich von seiner Hand zahlreiche Figurenstudien aus diesem Kontext erhalten; darunter zwei in der Technik und den Maßen identische Soldatendarstellungen, von denen eine ebenfalls verso in brauner Feder nummeriert ist (Sotheby‘s, New York, Auktion am 30. Januar 2019, Los 133). Das andere Blatt in der Sammlung der Universität Leyden ist auf den 10. November 1777 datiert (vgl. F. Livestro-Nieuwenhuis: Jordanus Hoorn, Amersfoort 1983, S. 25, Abb. 8).

Deutsch
6612 um 1800. Entwurf zu einem Rundtempel mit Säulenkranz: Ansicht, Durchschnitt und Grundriss. 3 Federzeichnungen in Grau, grau laviert. Je ca. 42,5 x 40 cm. Mit eigenh. Annotationen und Maßangaben.
600 €
Beigegeben drei weitere Entwürfe zu einem Landhaus.


Nicolai Abraham Abildgaard (1743 Kopenhagen – 1809 Frederiksdal)
6613 Amor besucht die schlafende Psyche. Feder in Braun auf Bütten, an den oberen Ecken montiert. 15,8 x 18,6 cm. Wz. Buchstabe R.
600 €
Provenienz: Aus der Sammlung des dänischen Künstlers und Akademieprofessors Einar Utzon-Frank (1888-1955).
Beigegeben von demselben Künstler „Karikatur eines Mannes mit Hut“ mit rückseitigen Skizzen, ebenfalls aus der Sammlung Utzon-Frank.
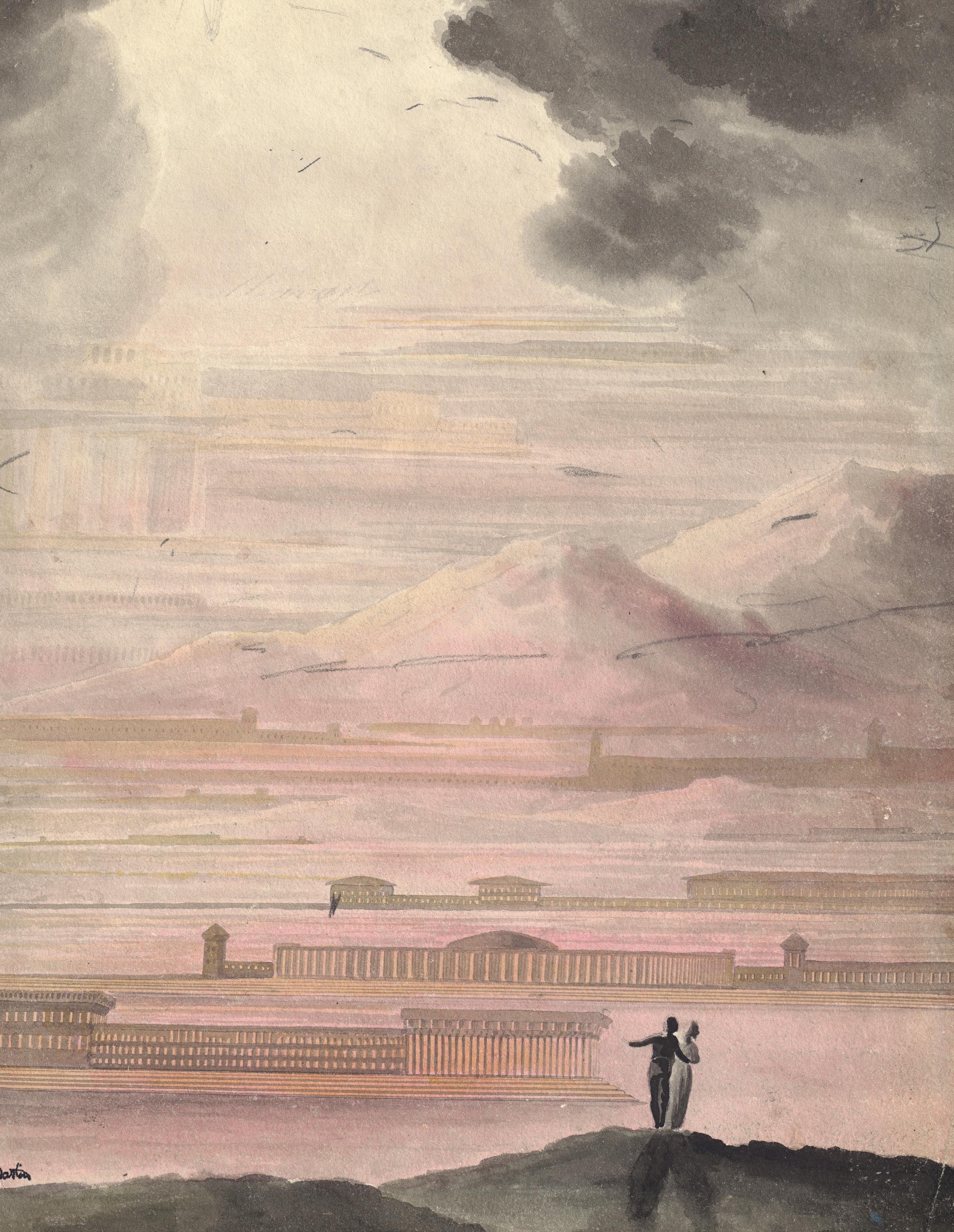

Michelangelo Maestri
(tätig um 1802–1812 in Rom)
6614 Venus und Amor in einer Landschaft. Gouache über einer Umrissradierung auf Bütten, alt montiert. 37,3 x 30,1 cm. Unterhalb der Darstellung bezeichnet, signiert sowie betitelt „Raf. Sanz. Urb. inv. - MichAng. Maestri. fecit in Roma / VENERE FERITA DA CUPIDO“.
3.000 €
Maestri war zu Beginn des 19. Jh. als Kupferstecher, Maler und Verleger in Rom tätig, wo er vor allem mythologische Darstellungen nach Raffael schuf. Die vorliegende Darstellung zeichnet sich durch eine ausgesprochen zarte, zurückgenommene Farbgebung aus. Anders als die Kompositionen vor einem schwarzen Grund, für die Maestri sehr bekannt ist, finden sich Venus und Amor in einer idealisierten Landschaft, die noch ganz dem Klassizismus des ausgehenden 18. Jh. zugeordnet werden darf.
Johann Ludvig Gebhard Lund (1777 Kiel – 1867 Kopenhagen)
6615 Ida Brun als Flora vor einer Landschaft. Feder in Braun, Bleistift, auf Bütten. 19,9 x 12,6 cm. Um 1802. Wz. Kartusche mit Posthorn und Jahreszahl [18]07 (Fragment).
600 €
Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung. Nach seiner Ankunft in Rom im Jahr 1802 wurde Lund in der Villa Malta von der Schriftstellerin Friederike Brun empfangen. Deren Tochter Ida, die Lund im Zeichnen unterweist, hatte von frühestem Kindesalter an in den Salons von Dänemark bis Italien einen Ruf als herausragendes Talent für Tanz und mimische Ausdruckskunst. Ihre Attitüden, inspiriert von jenen der berühmten Lady Hamilton, faszinierten nicht nur Lund, sondern auch unzählige Größen der Kulturwelt wie Goethe, Schlegel, Thorvaldsen und Canova. - Beigegeben eine weitere Zeichnung von Lund „Maria mit Kind“.


6615
Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783 Blåkrog – 1853 Kopenhagen)
6616 Virginia wird von ihrem Vater getötet, um sie vor den Avancen von Appius Claudius zu bewahren. Feder in Grau über Bleistift, grau laviert, verso eine weitere Bleistiftstudie. 27,5 x 21,2 cm. Unten links bezeichnet und nummeriert „C. W. Eckersberg Cat. N°136“.
2.400 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers, dessen Auktion 1854, Los 136. Sammlung Benjamin Wolff (Lugt 420).
Dessen Auktion bei Bruun Rasmussen: The Wolff Collection, 30. Mai 2018, Los 526.
Privatsammlung, Schweden.
Eine ausgearbeitete, signierte Zeichnung des gleichen Motivs befand sich ebenfalls in der Sammlung Wolff. Sie ist auf das Jahr 1804 datiert. Zwischen 1803 und 1810 studierte Eckersberg an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Kopenhagen. Seine erste größere figürliche Komposition, die er im Jahr 1804 an der Akademie ausführte, thematisiert ebenfalls den Tod der Virginia. Es liegt daher nahe, auch unsere Zeichnung in diesen frühen Schaffenszeitraum Eckersbergs zu datieren.

Johann Christian August Schwartz (1756 Hildesheim – 1814 Braunschweig)
6617 Umkreis. Bildnis der Kronprinzessin Luise in weißem Chemisekleid.
Aquarell und Gummiarabikum auf Elfenbein. 5,5 x 4,4 cm. Im vergoldeten Metallrahmen (Nettogewicht 43 Gramm). Um 1796/1800.
4.500 €
Stilistisch steht die Miniatur den Werken des besonders als Pastellist bekannten Künstlers Johann Christian August Schwartz nahe, von dem jedoch bislang keine gesicherte Miniatur bekannt ist. - Das Werk verfügt über eine EU Handelsgenehmigung der zuständigen Artenschutzbehörde (kein Export in Drittländer).
Johann Adam Klein (1792 Nürnberg – 1875 München)
6618 Kostümstudie einer jungen Frau in halber Rückenansicht mit rosengeschmückter Haube und Handschuhen. Feder in Braun, aquarelliert, auf graubraunem Papier aufgezogen. 13,1 x 10,2 cm (Passepartoutausschnitt). (1810).
800 €
Literatur: Ursula Kubach-Reutter: „Ein Blick für Kleider. Einige geschichtliche Überlegungen“, in: Ausst. Kat. Romantische Entdeckungen. Johann Adam Klein. 1792-1875. Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik, Museen der Stadt Nürnberg 2006, S. 82 ff., Abb. 50.
Provenienz: Laut Vorbesitzer aus der Sammlung König Ludwigs I. von Bayern. Privatsammlung Oberpfalz.
Ersten Zeichenunterricht bekommt Klein bereits als Achtjähriger durch den Maler Georg Christoph von Bemmel. Mit zehn besucht er die Nürnberger Zeichenschule des Gustav Philipp Zwinger, 1805 wird er Lehrling im Atelier des Kupferstechers Ambrosius Gabler, bei dem er die Technik des Radierens und Ätzens erlernte. Klein wird in der Folge vor allem als „Thiermaler“ bekannt und geschätzt, daneben schafft er aber zeitlebens auch vorzügliche Arbeiten zum Thema Kleidung, deren präzise zeichnerische Wiedergabe für ihn eine bedeutende Aufgabe darstellen. Vor allem für den Uniformkundler liefert sein Werk eine reichhaltige Fundgrube. Dieses und das folgende reizvolle Aquarell des 17-jährigen entstanden noch vor Kleins Abreise nach Wien, wo er sich ab 1811 mit Empfehlung des Nürnberger Kunsthändlers Johann Friedrich Frauenholz an der Akademie weiter ausbildete. Ein stilistisch eng verwandetes, ebenfalls 1810 datiertes Aquarell von der Hand Johann Adam Kleins findet sich in der Sammlung der Museen der Stadt Wien (Inv.Nr. 108.207).

6618
Johann Adam Klein
6619 Kostümstudie einer jungen Frau in Rückenansicht mit Haube, Schleier und Handschuhen. Feder in Braun, aquarelliert, auf graubraunem Papier aufgezogen. 13,9 x 10,8 cm (Passepartoutausschnitt). Signiert und datiert mittig rechts „J. A. Klein / fec. 1810.“. 800 €
Provenienz: Laut Vorbesitzer aus der Sammlung König Ludwigs I. von Bayern.
Privatsammlung Oberpfalz.

6619

Heinrich Anton Dähling (1773 Hannover – 1850 Potsdam)
6620 Königin Luise von Preußen als Statyra und ihr Schwager Prinz Heinrich von Preußen als Alexander der Große.
Feder in Grau, grau laviert, aquarelliert. 22,5 x 18,6 cm. Auf dem braunen Untersatzpapier oben mittig in Bleistift wohl eigenhändig bezeichnet „Quadrille der Königin“, unten mittig „Königin Luise als Statyra Prinz Heinrich / als Alexander / Prinzessinen und Magier“.
4.500 €
Vorzeichnung zur ersten der insgesamt zehn (davon neun kolorierte) Tafeln enthaltenden Kupferstichwerkes „Der grosse Maskenball in Berlin zur Feyer des Geburtstages Ihrer Majestät der regierenden Königin von
Preußen: am 12ten März 1804 im Königlichen Nationaltheater veranstaltet“. Das mit einer ausführlichen Beschreibung des Festes versehene Werk wurde 1805 in Berlin von Ludwig Wilhelm Wittich veröffentlicht. Die Kupfer wurden von Friedrich Jügel und Johann Friedrich August Clar nach Dählings Vorzeichnungen seitengleich gestochen (Lipperheide Sbb 23. Hiler S. 399. Colas 774). Das erste Blatt dieses Ball en Masque stellt, in Gestalt des Prinzen Heinrich, die Rückkehr Alexanders des Großen aus Indien am Hof von Susa dar. Statyra, die älteste Tochter des Darius und schönste Frau ihrer Zeit, verkörpert durch Königin Luise, war dazu bestimmt seine Gemahlin zu werden.
Dähling studierte an der Kunstakademie Berlin, wurde 1811 deren Mitglied, 1814 Professor und 1818 Professor der Zeichenklasse. An den Ausstellungen der Akademie nahm er von 1798 bis 1850 regelmäßig teil. Seit 1832 war er zudem Mitglied des Berliner Senates. Dähling unterhielt enge Beziehungen zum Königshaus und die aus persönlicher Verehrung entstandenen Bildnisse Königin Luises sind mitverantwortlich für ihren Mythos.

Heinrich Anton Dähling
6621 Ein Schiffskapitain, drei Macedonische Feldherren, ein Herold und der Anführer der Meder.
Feder in Grau, grau laviert, aquarelliert. 22,4 x 18,6 cm.
Auf dem braunen Untersatzpapier unten mittig in Bleistift wohl eigenhändig bezeichnet „Macedonische Feldherren u.s.w.“.
4.500 €
Wie die vorherige Losnummer Vorzeichnung zum Kupferstichwerk „Der grosse Maskenball in Berlin zur Feyer des Geburtstages Ihrer Majestät der regierenden Königin von Preußen: am 12ten März 1804 im Königlichen Nationaltheater veranstaltet“. Die als vierte Tafel veröffentlichte Darstellung wurde von Friedrich Jügel gestochen. In der ausführlichen Beschreibung des Festes ist zu lesen: „Bald nach Erscheinung des Heroldes trat er (Prinz Wilhelm) mit einem Gefolge von vier Schiffshauptleuten (den Herrn von Collong, Jago, Herzberg und Blankensee) und einer Reihe von vornehmen Gefangenen auf; unter ihnen ein indischer Fürst (Prinz Karl von Mecklenburg).“

Nikolaus Lauer
(1753–1824, St. Wendel)
6622 Königin Luise im Chemisekleid mit blauem Kopftuch und Halsbinde; König Friedrich Wilhelm III. in Uniform mit Schwarzem Adlerorden. 2 Pastelle, je wohl auf Pergament. Je ca. 40 x 31 cm. Um 1798/99.
12.000 €
Als die mecklenburgische Prinzessin Luise 1793 als Verlobte des preußischen Kronprinzen in Berlin ankam, war der Grundstein zu ihrer bis heute anhaltenden verklärten Popularität, ja kultischen Verehrung, gelegt. Doch darf über diese Mythisierung nicht vergessen werden, dass sich Luise im Gegensatz zu ihrem zaudernden Ehemann Friedrich Wilhelm III. auch als weitsichtige Politikerin auszeichnete. In den Jahren napoleonischer Expansion und preußischer Zögerlichkeit setzte sie sich entschieden für ein Bündnis mit Russland und Österreich ein, suchte und verhandelte mit Bundesgenossen und förderte nach der schmachvollen Niederlage Preußens maßgeblich fortschrittliche Reformer. Aufgrund ihrer Beliebtheit entbrannte über alle Stände hinweg eine große
Nachfrage nach Porträts der jungen Monarchin. Am Hofe erkannte man, dass sich mittels einer gesteuerten Bildproduktion die Außenwirkung des preußischen Königshauses beeinflussen ließe. Einfache, lebensnahe Inszenierungen und der Verzicht auf Herrschaftszeichen sollten das Bild einer bürgernahen, progressiven Monarchie zeichnen. Diese Nachfrage bediente unter anderem der Künstler Nikolaus Lauer mit Werken von herausragender Qualität. Lauer hatte seit 1791 eine Stellung als Hofmaler beim Pfalzgrafen von Birkenfeld-Zweibrücken inne, doch zwang ihn das Vorrücken der napoleonischen Truppen 1794 zum Umzug nach Leipzig und Dresden. Aus dem Jahr 1799 hat sich eine Zeitungsannonce erhalten, in der Lauer seine Bildnisse des preußischen Königspaares ankündigt. Von den vorliegenden Brustbildnissen sind mehrere eigenhändige Fassungen bekannt (vgl. Thomas Wiercinski: Der Pastellmaler Nikolaus Lauer. 1753-1824. Werkverzeichnis, St. Wedel 2004, Kat. 54-59, 63, 68, 70). Die Urfassung von Luises Porträt, das die Königin modisch gekleidet in einem weißen Chemisekleid mit der ikonischen Halsbinde sowie einem Schal und Kopftuch in tiefem Blau zeigt, hing in Schloss Monbijoux und gilt als kriegsbedingter Verlust. Eine engverwandte Version ist heute im Schloss Pfaueninsel zu sehen (SPSG, GK I 40618).

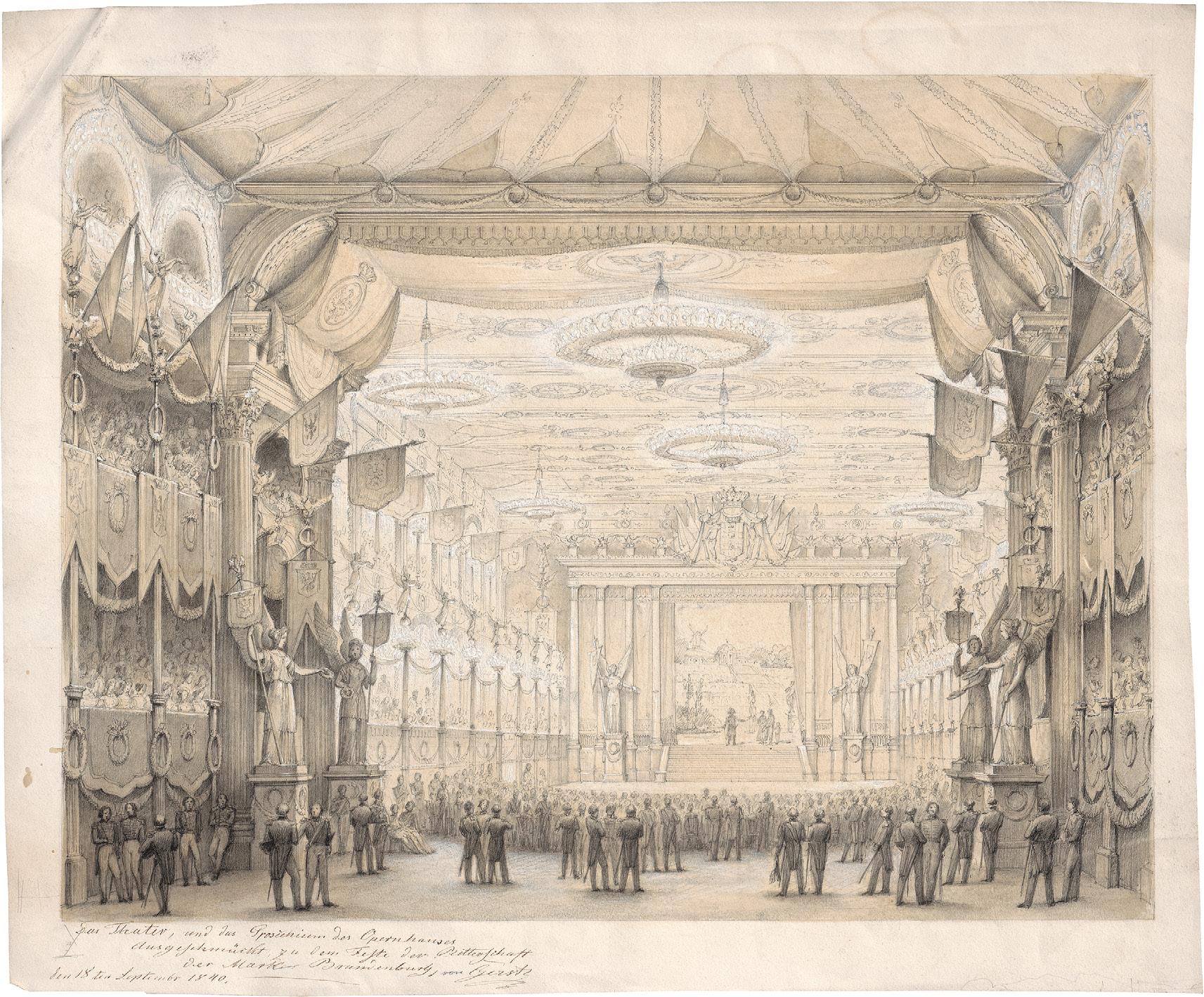
Johann Karl Jacob Gerst (1792–1854, Berlin)
6623 Zwei Entwürfe zum Fest der Ritterschaft der Mark Brandenburg im Berliner Opernhaus 1840. 2 Zeichnungen, je Bleistift, teils gewischt, weiß gehöht, ein Blatt gelb- und hellbraun laviert. Je ca. 42,3 x 50,9 cm. Bezeichnet, signiert und datiert „Das Theater, und das Proscenium des Opernhauses / ausgeschmückt zu dem Feste der Ritterschaft / der Mark Brandenburg von Gerst / den 18ten September 1840.“ bzw. „Schauplatz des Opernhauses den 18 September / 1840 Gerst“.
600 €
Gerst lernte ab 1808 vier Jahre Theatermalerei beim Opernmaler Bartolomeo Verona in Berlin. Von 1818 bis zu seiner Pensionierung 1851 war er Königlicher Dekorationsmaler und führte viele der berühmten Bühnenentwürfe von Karl Friedrich Schinkel aus. Er war auch als Lehrer für Architektur- und Landschaftsmalerei tätig. Zu seinen Schülern gehörten sein Schwiegersohn Carl Graeb, ferner Karl Eduard Biermann, Eduard Pape und Bernhard Fiedler. 6623
Karl Wilhelm Bardou (1774 Berlin – um 1842)
6624 Bildnis eines Mannes im blauen Rock, wahrscheinlich eines russischen Beamten.
Pastell auf Papier, auf Leinwand montiert. 31,3 x 25,5 cm. Verso auf dem Keilrahmen in brauner Feder signiert „C.W. Bardou“.
3.000 €
Karl Wilhelm Bardou war der Sohn des Bildhauers Emanuel Bardou und Neffe von Paul Joseph Bardou, dessen Schüler er wurde. Von 1797 bis 1842 stellte er in der Berliner Akademie Pastellbilder aus. Die Jahre 1804 bis 1827 verbringt er in St. Petersburg, Moskau und Kazan‘.


Franz Krüger (1797 Großbadegast – 1857 Berlin)
6625 Bildnis eines Mädchens mit Haarschleife und weißem Kragen. Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf braunem Papier, alt (wohl original) montiert. 21,4 x 18,3 cm.
750 €
Ausstellung: Kunst und Kunsthandwerk in Preussen, Galerie Pels-Leusden, Berlin, Zürich, Kampen, 20. September - 17. November 1999, Nr. 188. Provenienz: Galerie Pels-Leusden, Berlin u.a. (Katalogausschnitt verso auf der Rahmenabdeckung).
Laut einem maschinenschriftl. Etikett verso war das Pendantbild eines Jungen 1977 in der Ausstellung „Vom kleinen Prinzen zur Berliner Göre. Berliner Kinder- und Jugenddarstellungen aus drei Jahrhunderten“ im Berlin Museum ausgestellt und auf dem Titelbild des von Irmgard Wirth herausgegebenen Kataloges abgebildet.

Friedrich Wilhelm Klose (1804 – nach 1863, Berlin)
6626 Das großbürgerliche Heinrich-Hagemeister-Haus in der Großen Friedrichstraße 170 / Ecke Französische Straße in Berlin.
Aquarell und Gouache auf Velin, alt auf einen mit dünner Goldrahmung verzierten Untersatzkarton aufgezogen. 17,4 x 15,4 cm. Um 1847.
3.000 €
Das Aquarell zeigt das großbürgerliche Eckhaus des Berliner Fabrikanten, Händlers und Hoflieferanten Heinrich Hagemeister, das sich in der
Großen Friedrichstraße 170 an der Ecke zur Französischen Straße befand. Das Aquarell diente im Jahre 1847 auch als Vorlage für die als Holzstich erschienene Werbung der Firma Heinrich Hagemeister, die in ihren Annoncen Metall- und Bronze-Waren aus Großbritannien und Frankreich, sowie aus eigener Produktion anpries und ferner galvanische Vergoldungen und Versilberungen von Gegenständen anbot. Das fein ausgeführte Aquarell lässt die edlen Waren in den Schaufenstern des Ladengeschäfts erkennen. Ein eleganter Herr mit Zylinder ist im Begriff, das Geschäft zu betreten, während einige Passanten die ausgestellten Stücke betrachten. Um sie herum pulsiert das geschäftige Treiben der Friedrichstraße. - Mit einer schriftlichen Bestätigung der Autorschaft von Prof. Helmut Börsch-Supan, Berlin, vom 2. März 2012.
Zeichnungen des 19. Jahrhunderts

Franz Krüger
(1797 Großbadegast – 1857 Berlin)
6627 Der Berliner Bankier A. G. Thiermann im Gehrock mit Zylinder und Gehstock in Rückenansicht.
Grauer Stift, teils aquarelliert auf chamoisfarbenem Karton. 22,8 x 13,8 cm. Unten rechts in grauem Stift bez. „Thiermann“.
1.500 €
Literatur: Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst aus zwei Jahrhunderten, 1760-1960. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung
W. B., Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 1967, Nr. 64.
Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert Ketterer, Stuttgart, Auktion 29 am 29. November 1957: Sammlung Heumann, Chemnitz. Kunst des 18 und 19. Jahrhunders. Aquarelle, Zeichnungen, Gemälde, Graphik, Los 177. Bei der feinen Studie handelt es sich um die Vorzeichnung zur Figur des Berliner Bankiers und Kunstsammlers A. G. Thiermann für das 1844 vollendete Gemälde „Huldigung vor König Friedrich Wilhelm IV. am 15. Oktober 1840 vor dem Schloss zu Berlin“. 6627
Provenienz: Sammlung Hermann Ohse, Berlin (Lugt 1350).
Amsler und Ruthardt, Berlin, Auktion 1913, Los 361 mit Abb. Tafel 3. Sammlung E. und G. Tietz, Berlin.
C.G. Boerner, Leipzig, Auktion 172, 1931, Los 77 mit Abb. Tafel V. Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 2841a).

Johann Heinrich Schmidt (1749 Hildburghausen – 1829 Dresden)
6628 Bildnis des Nicolas-Lazare Boudin de Vesvres, Inspecteur General des Postes. Pastell, wohl auf Pergament. 38,7 x 31,2 cm. Oben rechts signiert und datiert „Schmidt peintre du Roi 1813“. 3.500 €
Literatur: Neil Jeffares: Dictionary of pastellists before 1800. Online Edition, „Johann Heinrich Schmidt“, J. 662.1107.
Provenienz: Swan Fine Art Auctions, Tetsworth, am 5. März 2014, Los 41.
Das lebensnahe Bildnis zeigt Nicolas-Lazare Boudin de Vesvres (17591828), einen hochrangigen Beamten im Dienste Napoléons. Die Signatur Schmidts mit dem Zusatz „peintre du Roi“ bezieht sich auf dessen Stellung als Maler am Dresdener Hof für den König Friedrich August III. von Sachsen. Entsprechend darf man davon ausgehen, dass dieses Pastell 1813 in Dresden entstand, als sich Napoléon dort mit großer Entourage aufhielt. Tatsächlich befand sich auch der Dargestellte Boudin de Vesvre in der Gefolgschaft des Kaisers in Dresden, wo er die Position des „commissaire-general pour le service des Postes“ innehatte. Am 12. März 1813 wurde ihm das Ritterkreuz des Ordens der Reunion verliehen, einem Orden, den Napoléon gerade erst 1811 gegründet hatte. Möglicherweise bot diese Ordensverleihung den Anlass für das Portrait Boudin de Vesvres bei dem hochgeschätzten Pastellmaler Johann Heinrich Schmidt.

Christian Wilhelm von Faber du Faur (1780–1857, Stuttgart)
6629 Aus dem Russlandfeldzug Napoleons 1812: Die Württembergische Artillerie und Jäger vor Smolensk, den 18. August 1812, morgens 6 Uhr. Aquarell. 44,3 x 74,3 cm.
2.400 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Durch Erbfolge an Karin von Faber du Faur, Hamburg. Privatbesitz Hamburg.
Christian Wilhelm von Faber du Faur, seit 1802 als Jurist im Staatsdienst tätig, meldete sich 1809 freiwillig in die württembergische Armee, die 1812 als ein Teil der napoleonischen Armee am Russlandfeldzug des französischen Monarchen teilnahm. Faber du Faur, der auch ein versierter Historien- und Landschaftsmaler war, schuf auf diesem Feldzug täglich
Skizzen, die den Fortgang des tragischen Geschehens festhielten. 1831 wurden diese Skizzen, die den kompletten Feldzug mit dem Rückzug darstellen, zusammen mit den Kommentaren des Major Kausler veröffentlicht. Die bildlichen Darstellungen haben den Charakter eines Augenzeugenberichtes und sichern Faber du Faur die Rolle als bedeutendster Bildchronisten des Russlandfeldzuges. Das Aquarell zeigt die württembergische Armee vor einer kleinen Kapelle am linken Ufer des Dnjepers, als sie den von einem heranreitenden Adjutanten überbrachte Befehl erhalten, vorzurücken. Im Hintergrund erscheinen zwischen den Hügeln die Schwaden russischen Artilleriefeuers. Eine andere, ebenfalls als Aquarell ausgeführte Version dieses Motivs existiert im Bayerischen Armeemuseum (s. Ernst Aichner (Hrsg.): Christian Wilhelm von Faber du Faur: Der Russlandfeldzug Napoleons 1812. Nach den Originalen im Bayerischen Armeemuseum..., Ingolstadt 2003, Tafel 33).

Jean-Antoine Constantin (gen. Constantin d‘Aix, 1756 Bonneveine – 1844 Aix-en-Provence)
6630 Studie einer Felsformation. Rote Kreide über Spuren von Graphit, braun und grau laviert. 28,3 x 27,9 cm.
750 €
Der Maler, Zeichner und Graphiker Jean-Antoine Constantin studierte ab 1771 an der Akademie von Marseille bei Joseph Antoine David. Seit 1777 bildete Constantin sich künstlerisch in Rom weiter, wo er sechs Jahre verbleibt und eine eigenständige, naturverbundene Landschafts-
auffassung entwickeln sollte. In den folgenden Jahren schuf er in Italien eine Reihe von Studien vor der Natur, die zu den frühen Zeugnissen des Pleinairismus zählen. Um 1783 kehrte Constantin aus Krankheitsgründen vorzeitig nach Aix zurück, wo er wenig später eine Berufung als Direktor der dortigen Zeichenschule erhielt. Als Landschafter und Lehrer übte Constantin einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der provenzalischen Landschaftsschule der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus. Offenbar war der Künstler von Felsen fasziniert. Im Ausstellungskatalog des Marseiller Musée des Beaux-Arts von 1986 ist dieser Werkgruppe ein ganzes Kapitel gewidmet (Kat. Jean-Antoine Constantin, Musée des Beaux-Arts de Marseille, Marseille 1986, Kat. Nr. 35 ff.).

Christian Gottlob Hammer (1779–1864, Dresden)
6631 Das Elbtal mit Blick auf die Königsnase in der Sächsischen Schweiz.
Aquarell und Gouache. 55 x 77 cm. Unten rechts signiert und datiert „nach der Natur gez. von CG Hammer in Dresden. 1814“.
4.500 €
Wunderbar malerisch angelegte Ansicht des Elbtals östlich von Pirna mit Blick auf den Felsen der Königsnase in Vogelgesang nordwestlich von Struppen. Hammer wiederholte den gleichen Ausblick, jedoch ohne die rahmenden Bäume und mit variiertem Vordergrund in späteren aquarellierten Radierungen.
Georg Friedrich Kersting (1785 Güstrow – 1847 Meissen)
6632 Interieur mit Fensterausblick. Feder in Schwarz und Pinsel in Grau auf WhatmanVelin. 28,8 x 34,4 cm. Unten rechts monogrammiert „GK“ (ligiert). Wz. „J. Whatman 1838“.
75.000 €
Literatur: Werner Schnell: Georg Friedrich Kersting (1785-1847). Das zeichnerische und malerische Werk mit Œuvrekatalog, Berlin 1994, S. 350, Nr. B 67 („Interieur II“), mit Abb. Sabine Rewald (Hrsg.): Rooms with a View. The Open Window in the 19th Century, Ausst.Kat. New York, New Haven/ London 2011, Kat. 57.
Ausstellung: Rooms with a View. The Open Window in the 19th Century, Metropolitan Museum of Art, New York, 5. April - 4. Juli 2011.
Provenienz: Der Antiquar - Roland A. Exner, Hannover, Auktion 28 am 17. März 1979, Los 123 (mit Abb.). Seither Privatsammlung Hannover.
Georg Friedrich Kerstings schuf mit seinen Interieurs die bekanntesten Innenraumdarstellungen der deutschen Romantik. Wie Caspar David Friedrich, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband, hatte er an der Kunstakademie in Kopenhagen studiert (1805-1808). Die klare Bildsprache und ausgesprochene Sensibilität für Lichtwirkungen dieser Schule prägten sein Werk ganz entschieden. Anschließend ging Kersting nach Dresden. Hier stellte er 1811 erstmals Interieurs aus – zwei Atelieransichten mit den Künstlerfreunden Gerhard von Kügelgen und Friedrich bei der Arbeit. Schon da zeigt sich, dass seine Raumdarstellungen keine anekdotisch schildernden Bilddokumente sind. Entrückt von dem bitteren Alltag während der französischen Okkupation und der Jahre unmittelbar danach, sind sie in sich abgeschlossene Welten, die in ihrer Reduziertheit kaum etwas über die Gewohnheiten und die Persönlichkeit ihrer Bewohner erzählen. Es geht Kersting vielmehr um das Einfangen einer kontemplativen Atmosphäre. Die nüchterne Leere wird dabei zur Echokammer für die friedliche Stille, die in den Bildern spürbar präsent ist.
Vorliegendes Interieur zeigt einen sparsam möblierten Wohnraum im Biedermeierstil: Links eingerichtet ist eine Sitzecke mit Canapé, kleinem Rundtisch und Stuhl vor einem Trumeauspiegel, rechts steht eine Kommode unter einem zweiten Spiegel, daneben ein altmeisterliches Porträt an der Wand. Werner Schnell hob die Bedeutung der Zeichnung aufgrund des deutlich sichtbaren Liniengerüstes hervor, das wertvolle Rückschlüsse auf die präzise Vorgehensweise Kerstings beim Konstruieren seiner Zimmerbilder erlaubt. Das Blatt durchkreuzen je eine waagrechte und senkrechte Zentralachse, die sich im Fenster in der Bildmitte treffen. Entlang dieser Linien verläuft vertikal die Mittelstrebe des Fensterrahmens, während die Horizontale die Fensterwand im Goldenen Schnitt harmonisch teilt. Zahlreiche Einstichpunkte im Papier zeugen davon, dass Kersting von diesem Fluchtpunkt ausgehend das Bild sorgfältig zentralperspektivisch komponierte.
Die Ausrichtung des reduzierten Möbelinventars und der fluchtenden Seitenwände lenken den Blick ganz natürlich auf die Fensteröffnung. Diese Anziehungskraft wird dadurch verstärkt, dass dort die hellste Fläche auf dem Papier ist. Doch unser Blick kann nicht weiter in die Ferne schweifen, versperrt doch eine Häuserfront abrupt den Ausblick. Durch diesen kompositorischen Kunstgriff wirft Kersting den Betrachter wieder in den Raum zurück. Verstärkt wird dieser Innenraumbezug durch die beiden Spiegel, die das Zimmer im Gegensatz zum Fenster nach innen öffnen und die Blickwinkel auf das Interieur multiplizieren. So schafft Kersting ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Außenund Innenwelt, zwischen den Kräften, die den Blick aus dem Fenster lenken, und jenen die ihn innerhalb der Grenzen des Zimmers verankern. Wie in allen seinen Zimmerbildern war für Kersting neben diesen raumperspektivischen Aspekten die Behandlung von Licht die vielleicht zentralste künstlerische Aufgabe. Einzige Beleuchtungsquelle ist hier das große, nach Süden ausgerichtete Fenster; eine Art Bild im Bild mit der Ansicht des oberen Abschlusses einer Häuserfront und des dahinter gelegenen Kirchturms. Von hier strömt heller Sonnenschein in das Zimmer herein und definiert subtil moduliert die Flächenaufteilung des Raumes und das darin befindliche Mobiliar. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass Kersting den Lichteinfall unter Annahme zweier unterschiedlicher Sonnenstände simulierte. So wirft der Stuhl zwei sich überschneidende Schatten auf den Boden. Links überlagern sich diese mit den beiden ovalen Schattenrissen des Tisches, an der Decke zeichnet sich zweifach die Silhouette der Lampe ab, während in der rechten Ecke der Schattenwurf der Kommode einmal kurz und dunkel frühere Tagesstunden und ein weiteres Mal langgezogen und hell die sich neigende Sonne suggeriert.
Das neuentdeckte Wasserzeichen mit der Jahreszahl 1838 legt den Entstehungszeitpunkt der Zeichnung in das letzte Lebensjahrzehnt des Künstlers, der 1847 stirbt. Damit gehört sie anders als bislang angenommen zu Kerstings Spätwerk. Das widerlegt die weit verbreitete Annahme, seine Kunst habe nach Antritt seiner Beamtenposition als Malervorsteher der Meißener Porzellanmanufaktur im Jahr 1818 an Qualität eingebüßt. Wir begegnen auf dem Blatt einem selbstsicheren und nach wie vor neugierig forschenden Zeichner auf dem Höhepunkt seines Könnens. Bei der Wahl und Positionierung des Mobiliars ist das ästhetische Prinzip der Schlichtheit und Reduktion perfektioniert, die Lichtregie ist meisterhaft, die Ausführung von einnehmender Präzision. Gezeichnete Zimmerbilder von der Hand Georg Friedrich Kerstings sind überaus rar. Lediglich dreizehn Blatt sind bekannt, von denen sich acht in musealen Sammlungen befinden und eines als verschollen gilt (vgl. Schnell A 80, A 119, A 120 und B 66-75). Somit ist vorliegendes Blatt eines der letzten in Privatbesitz. Die Zeichnung darf mit ihrem unvergänglichen Spiel von Licht und Stille außerdem als eine der herausragenden in Kerstings zeichnerischem Œuvre und überhaupt als eine Ikone romantischer Interieurbilder gelten. Die Darstellung wird hier erstmals in ihrer Vollständigkeit präsentiert werden, da sie in den bisherigen Publikationen nur ausschnitthaft gemessen und abgebildet wurde.


Christian Friedrich Gille (1805 Ballenstedt – 1899 Wahnsdorf/Dresden)
6633 Wolkenstudie.
Bleistift. 14,7 x 18,9 cm. Oben rechts datiert „1851“ sowie mit eigenh. Farbangaben. Wz. Buchstabe M mit Blätterkranz.
600 €
Provenienz: Kunsthandlung Friedrich Axt, Dresden. Privatsammlung Sachsen (erworben 1937 bei Axt).
Villa Grisebach, Berlin, Auktion am 1. Juni 2022, bei Los 184. Zuletzt Privatsammlung Berlin.
Beigegeben von demselben drei weitere Himmels- bzw. Wolkenstudien, sämtlich mit eigenh. Bezeichnungen, zwei monogrammiert und datiert „16 Mai [18]34 3 Uhr CG.“ bzw. „1/2 8 Uhr den 9 Mai 18[50] CG“.
6634 Himmelstudie mit flammenförmigen Wolken. Bleistift, grau laviert. 14,4 x 18,9 cm. Unten links monogrammiert und datiert „CG 23 May [18]43“.
750 €
Provenienz: Kunsthandlung Friedrich Axt, Dresden. Privatsammlung Sachsen (erworben 1937 bei Axt).
Villa Grisebach, Berlin, Auktion am 1. Juni 2022, bei Los 184. Zuletzt Privatsammlung Berlin.
Beigegeben von demselben vier weitere Himmelstudien: zwei mit Regenbogen, eine mit dichtem Regen und eine bezeichnet „Aurora“.
Ludwig Richter (1803–1884, Dresden)
6635 Junilandschaft mit dem Regenbogen (Landschaft mit Liebespaar).
Bleistift auf Bütten, verso: zwei weitere Varianten der Komposition. 27,1 x 37,8 cm.
1.500 €
Provenienz: C.G. Boerner, Leipzig (1947).
Christie‘s, London, Auktion am 13. Oktober 1994 „German and Austrian Art“, Los 18.
Sammlung Erhard Kaps, Leipzig (Lugt 3549).
Vorstudie für das bedeutende Gemälde Richters von 1859, heute in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
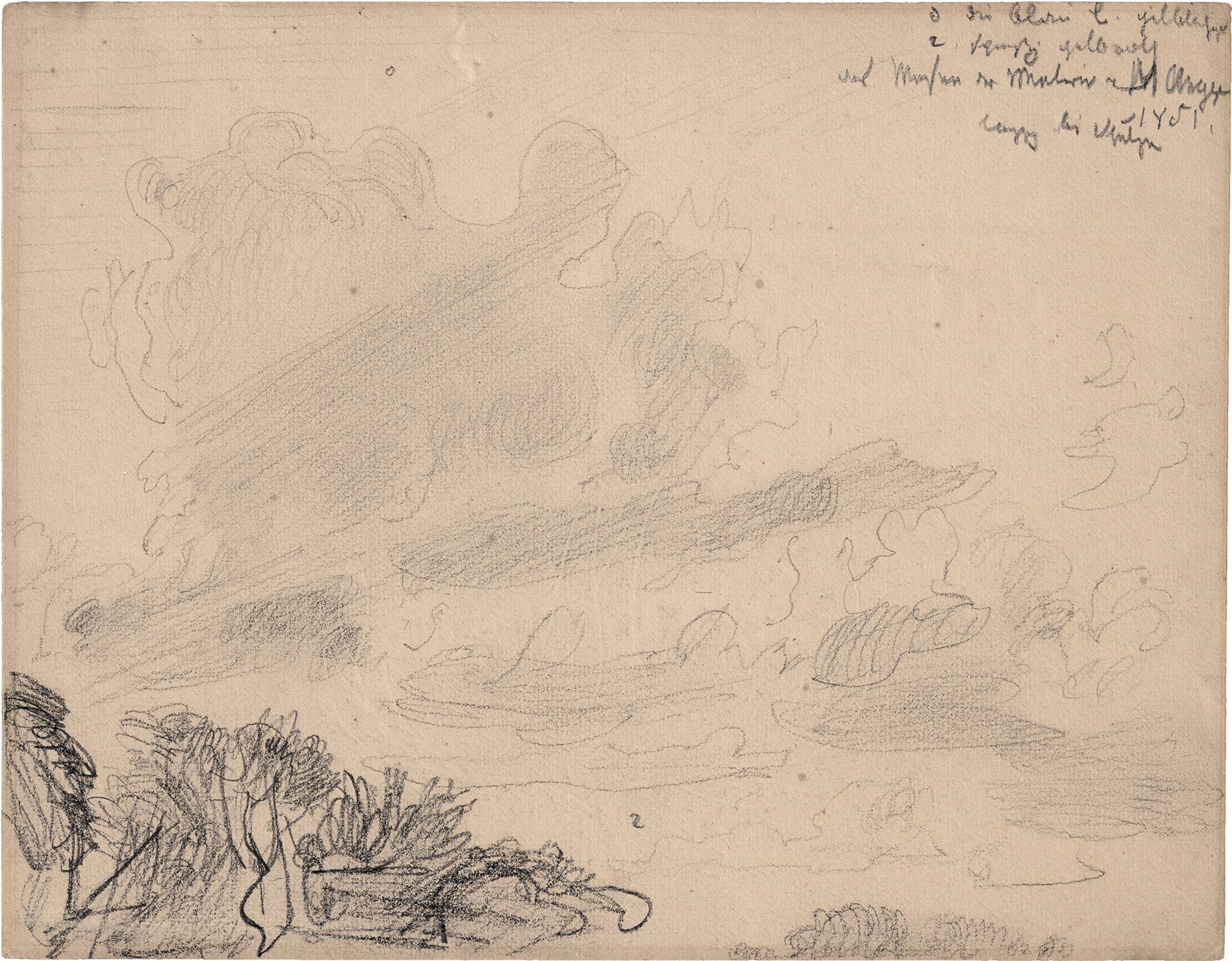



Ludwig Richter
6636 Blick auf eine der Elbinseln bei Pillnitz.
Bleistift auf Velin. 20 x 24,7 cm.
600 €
Provenienz: Aus dem Nachlass der Tochter des Künstlers Helene Richter (verh. Kretzschmar, 1837-1927, Annotation auf dem Passepartout). Bertha Chrambach (Enkelin von Helene Richter, geb. Kretzschmar). Privatbesitz, Leipzig.
Beigegeben drei weitere Bleistiftzeichnungen von und zugeschrieben an Wilhelm Kaulbach, Johann Adam Klein und Carl Robert Kummer.
Zeichnungen des 19. Jahrhunderts
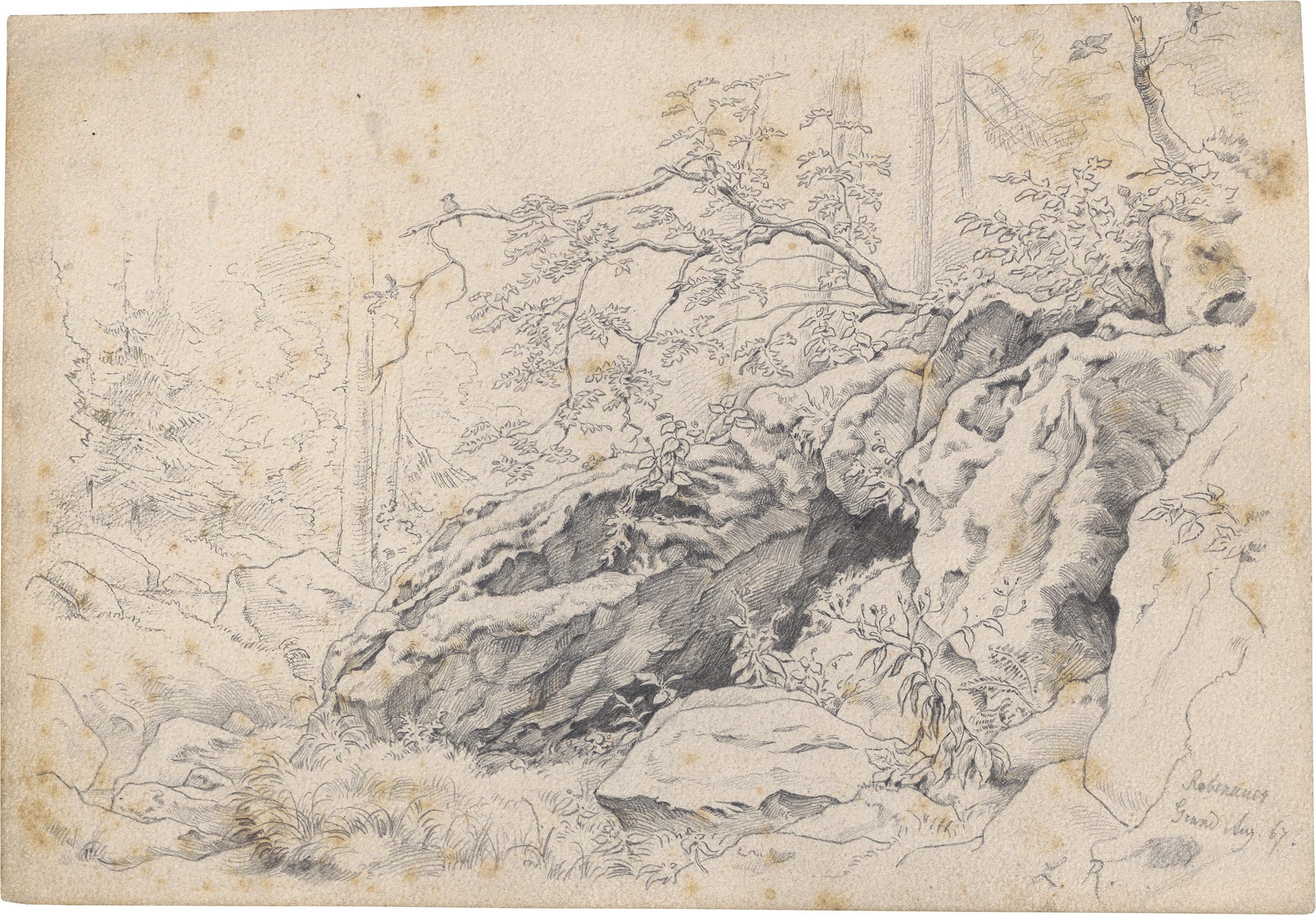
Adrian Ludwig Richter (1803–1884, Dresden)
6637 Junges Mädchen mit Lämmlein; Junge bei Andacht und liegendes Mädchen - Figurenskizzen für das Gemälde „Abendandacht“.
2 Bleistiftzeichnungen (recto und verso) auf chamoisfarbenem Velin, fest in ein Fensterpassepartout montiert. 14,2 x 16,4 cm. Wz. Whatman Turkey Mill.
400 €
Drei Figurenskizzen zu den Kindern in Ludwig Richters berühmtem Gemäde „Abendandacht“ im Museum der Bildenden Künste in Leipzig.
6638 Partie im Rabenauer Grund mit kleiner Felshöhle. Bleistift auf Velin. 14,2 x 20,9 cm. Unten rechts monogrammiert, datiert und bez. „L.R.“ und „Rabenauer Grund Aug. [18]67“.
1.800 €
Literatur: Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst aus zwei Jahrhunderten, 1760-1960. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung W. B., Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 1967, Nr. 112.
Provenienz: Sammlung Eduard Cichorius, Leipzig.
Der südlich von Dresden gelegene Rabenauer Grund inspirierte im 19. Jahrhundert zahlreiche Künstler der Romantik dazu, vor Ort Naturstudien anzufertigen. Der Reiz des waldigen, unberührten Tales, durch das sich die Rote Weißeritz schlängelt, zog bereits um 1822/23 den jungen Ludwig Richter an, der in der Folge immer wieder Zeichnung anfertigte, die dann auch in Gemälde mündeten. Bei vorliegender Zeichnung reizten den Maler ganz offenbar vor allem die von Erosion modellierten bizarren Felsen, die eine kleine Höhle bilden.

Johann Theodor Eusebius Faber (1772 Gottleuba – 1852 Dresden)
6639 Schule. Waldpartie mit Felsformationen, im Mittelgrund ein Wanderer. Feder und Pinsel in Schwarz. 37,8 x 46,2 cm. 750 €
Provenienz: Sammlung Bodemer, Zschopau (verso mit handschrifltichem Etikett).
Philipp Otto Runge (1777 Wolgast – 1810 Hamburg)
6640 Eichenzweig. Scherenschnitt aus Bütten, punktuell auf blauem Untersatz montiert. Ca. 25 x 11 cm (Scherenschnitt); 35,9 x 29,5 cm (Untersatz).
12.000 €
Literatur: Cornelia Richter: Philipp Otto Runge. „Ich weiß eine schöne Blume“. Werkverzeichnis der Scherenschnitte, München 1981, Nr. 177.
Provenienz: Sammlung Otto Speckter, Hamburg. Privatbesitz, Norddeutschland.
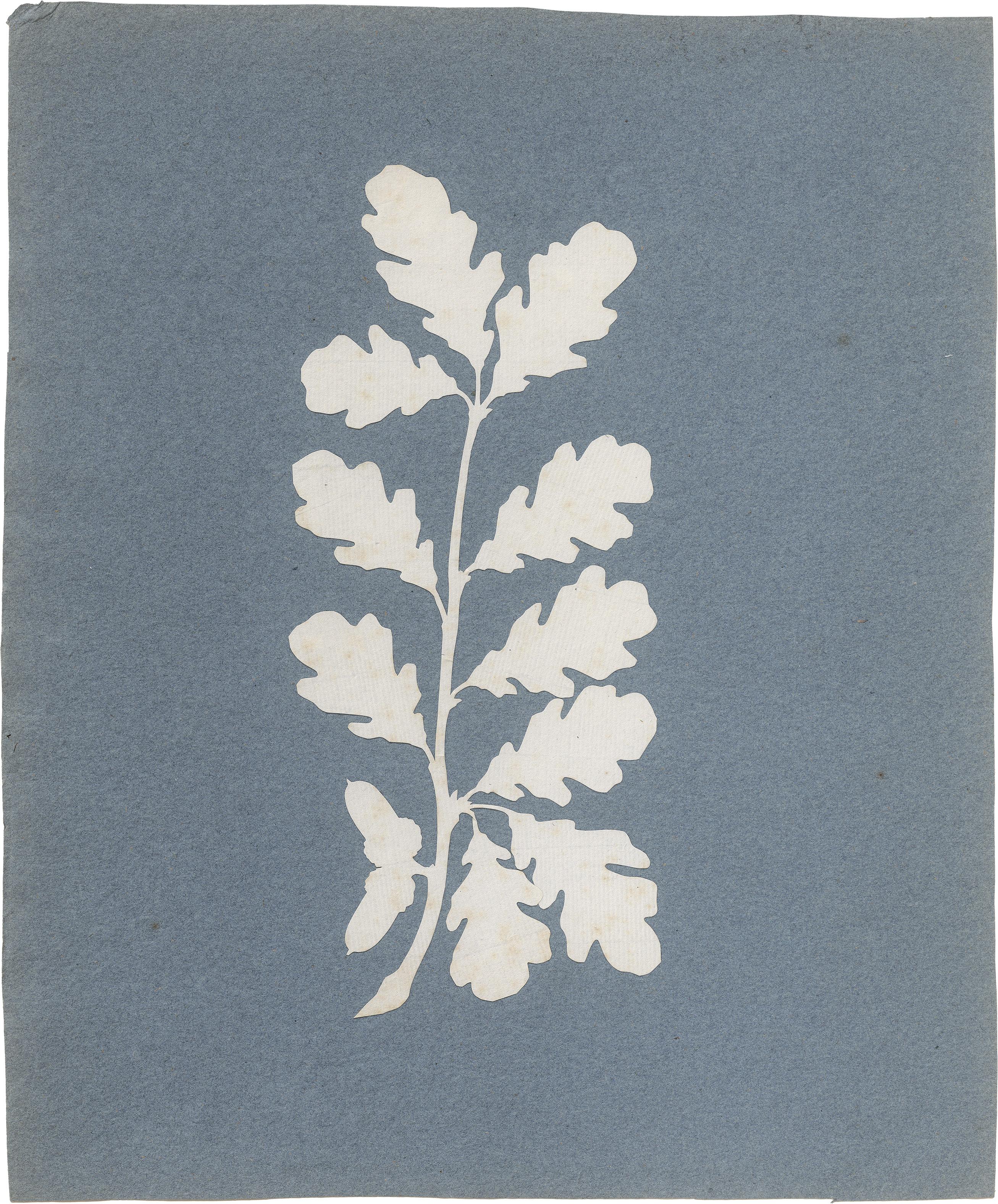

Johann Christian Clausen Dahl (1788 Bergen – 1857 Dresden)
6641 Felsenburg im Gebirge. Feder in Schwarz über Bleistift, braun und grau laviert. 40 x 31,4 cm. Rechts unten signiert und (undeutlich) datiert „CDahl 18[3]5“, links unten nummeriert „85“, verso in Feder alt und mit Bleistift erneut nummeriert „no 13“, sowie mit der leichten Anlage einer Baumlandschaft in Bleistift, dort ebenso mit Bleistift nummeriert „85“.
3.000 €

Johann Christian Clausen Dahl
6642
Norwegische Gebirgslandschaft mit Dorf. Grauer Stift, grau und rotbraun laviert. 16,1 x 20,6 cm. Am linken Rand signiert und datiert „d. 10 Febr. 1845 Dahl“. 2.400 €
Literatur: Ausst. Kat.100 Jahre deutsche Zeichenkunst 1750-1850, Sammlung Konsul Heumann Chemnitz, Chemnitz 1930, Nr. 31. Kurt Zoege von Manteuffel, in: Belvedere 9, 1930/II, S. 39 und Abb. 33,1.
Provenienz: Sammlung Alexander Flinsch, Berlin.
C.G. Boerner, Leipzig, Auktion CXI am 29. und 30. November 1912, Los 207 (dort als „Schweizer Bergpanorama“).
Sammlung Gustav Engelbrecht, Hamburg (Lugt 1148).
Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 2841a).
Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert Ketterer, Stuttgart, Auktion 29 am 29. November 1957: Sammlung Heumann, Chemnitz. Kunst des 18. und 19. Jahrhunders. Aquarelle, Zeichnungen, Gemälde, Graphik, Los 39 mit Abb. Taf. 16.


John Martin (1789 Haydon Bridge beiHexham – 1854 Douglas, Isle of Man)
6643 Umkreis. Vision einer himmlischen Stadt. Aquarell, Spuren von Bleistift. 28,1 x 21,4 cm. Oben zwischen den Wolken bezeichnet „Heaven“, unten links von fremder Hand bezeichnet „JMartin“.
1.200 €
Wilhelm Friedrich Wulff (1808–1882, Hamburg)
6644 Bildnis „C. Conräder aus Kiel“. Bleistift auf feinem Velin. 29,9 x 20 cm. Unten mittig in Bleistift betitelt und weiterhin unten rechts signiert und datiert „W. T. [sic!] Wulff. Dec: 1830“.
600 €

Carl Emil Baagøe (1829 Kopenhagen – 1902 Snekkersten)
6645 Zwei Segelschiffe auf hoher See. Bleistift, weiß gehöht. 15,4 x 22,6 cm. Unten links signiert und datiert „Carl Baagoe [ligiert] [18]82“.
600 €
Dänisch
6646 um 1840. Am Fjord von Præstø auf Seeland. Aquarell über Spuren von Bleistift, alt montiert. 23,1 x 28,8 cm. Auf dem Untersatz von alter Hand bezeichnet „Prostóe Bugt [Bucht von Præstø]“.
750 €
Malerisch im südlichen Seeland zwischen Wiesen und Wäldern gelegen ist die Landschaft um den Fjord von Præstø bereits gegen Ende des sogenannten Goldenen Zeitalters zu einem Anziehungspunkt für dänische Künstler geworden. Treffpunkt war der Herrensitz Nysø, in dem unter anderem Bertel Thorvaldsen nach seiner Rückkehr aus Italien eine Zeit lang lebte und arbeitete, das aber auch Künstlern wie Hans Christian Andersen oder Peter Christian Skovgaard als idyllisches Refugium diente.
Dänisch
6647 um 1860. Die alte Papiermühle Strandmøllen nördlich von Kopenhagen.
Aquarell und Bleistift, alt montiert. 17,2 x 25,6 cm. Auf dem Untersatz von alter Hand bezeichnet „Drevsens Papiirmölle“.
750 €
Die ehemalige Papiermühle Strandmøllen lag am Öresund nördlich von Kopenhagen an der Mündung des kleinen Flusses Mølleåen. Das Unternehmen wurde im frühen 18. Jahrhundert gegründet und gehörte lange zu den wichtigsten Papiermanufakturen Dänemarks. Bis zu deren Aufgabe kurz vor der Jahrhundertwende war sie in der Hand der Gründerfamilie Drewsens, deren unmittelbar neben der Mühle erbautes Haus hier zu sehen ist.
Jacob Gensler (1808–1845, Hamburg)
6648 Steingeröll im Loisachtal.
Aquarellierte Bleistiftzeichnung. 22,2 x 32,5 cm. Rechts unten signiert und mittig datiert und bezeichnet „Sept: [18]31. Loisach.“.
450 €
Provenienz: Aus einer unbekannten Sammlung „[...] G.B.“ (nicht bei Lugt). Sammlung Adolf Glüenstein, Hamburg (Lugt 123).
Seit ca. 1918 Privatsammlung Hamburg. Durch Erbschaft Privatsammlung Berlin.
Abbildung Seite 132




Albert Hertel (1843–1912, Berlin)
6649 Skizzenbuch mit Darstellungen von Kampen auf Sylt und Eutin. 40seitiges Skizzenbuch, Bleistift, teils laviert, teils aquarelliert. Quer-8vo, privater Leinenband mit zwei Schließbändern und Stiftlasche. Auf dem Titel signiert, datiert und bezeichnet „Alb. Hertel. 1908 / Campen / Eutin“.
400 €
Mit meist doppelseitigen Landschafts- bzw. Küstenansichten, alle datiert, beginnend in Kampen, den 5. August bis zum 21. September, fortgesetzt mit Landschaften in und um Eutin (Redderkrug, Fissau) vom 24. September bis zum 8. Oktober 1908.
Siegwald Johannes Dahl (1827–1902, Dresden)
6650 Porträt von Caroline Elisabeth Dahl, der älteren Schwester des Künstlers.
Bleistift, teils gewischt. 28 x 19,9 cm. Unten rechts eigenhändig bezeichnet, datiert und signiert „Kiel / d. 27. August / 1852 / Siegwald Dahl“ sowie unten rechts bezeichnet „Caroline Dahl“.
600 €
Provenienz: Sammlung Prinz Johann Georg von Sachsen (Lugt 1162 c), Inv. Nr. S. I - 567.
Erworben vor Ende der 1980er Jahre im Münchner Kunsthandel. Seitdem in Privatbesitz.
Der Tier-, Genre- und Porträtmaler Siegwald Dahl war das jüngste Kind des norwegischen Landschaftsmalers Johan Christian Clausen Dahl. Die Mutter starb kurz nach seiner Geburt. Im Dresdner Haus an der Elbe

6651
Zeichnungen des 19. Jahrhunderts

6650
Nr. 33 lebte 20 Jahre lang als Nachbar und Freund des Vaters Caspar David Friedrich mit seinen Kindern. Ersten Unterricht erhielt Siegwald durch seinen Vater. 1842 bis 1846 studierte er an der Dresdner Akademie unter Johann Wegener Tiermalerei. Im Anschluss unternahm er Studienreisen nach London, Paris und mehrmals in die väterliche Heimat Norwegen. Dahl wurde am 1864 zum Ehrenmitglied der Königlichen Kunstakademie Dresden ernannt. Seine zum Zeitpunkt des Porträts 30-jährige Schwester Caroline Elisabeth Dahl (1822-1894) war seit 1848 mit dem norwegischen Kabinettsminister Anders Sandøe Ørsted Bull verheiratet.
Johann Heinrich Beck (1788–1875, Dessau)
6651 Bildnis eines Kindes, in der Hand einen Ball haltend.
Bleistift auf Whatman-Velin. 45,7 x 29,3 cm. Unten rechts signiert und datiert „H. Beck fe. 1833“. Wz. Fragment „JW...“.
600 €

Ferdinand Olivier (1785 Dessau – 1841 München)
6652 Waldpartie mit Wassermühle. Bleistift auf Velin, verso:Detailstudie zum Wasserrad in Bleistift. 16,5 x 21,5 cm. Wohl um 1810.
1.200 €
Provenienz: Wohl Kunsthandel Dr. Werner Spielmeyer, Dessau. Privatsammlung Dessau.
Stilistisch, insbesondere bei der Behandlung des Grases, entspricht die Zeichnung Oliviers Studie „Felsklippen am Brocken“ in der Anhaltinischen Gemäldegalerie, Dessau (s. Ludwig Grote: Die Brüder Olivier und die deutsche Romantik, Berlin 1938, Abb. S. 94).
Julius Schnorr von Carolsfeld (1794 Leipzig – 1872 Dresden)
6653 zugeschrieben. Sitzende Frau mit Haube. Bleistift, weiß gehöht, auf bräunlichem Velin, entlang des Oberrandes montiert. 20,5 x 23,3 cm.
750 €
Provenienz: Sammlung Stephan Seeliger, München.
Beigegeben fünf Zeichnungen des frühen 19. Jh.: von Philipp Veith „Madonnenkopf“ in Bleistift (monogrammiert), Adam Eberle zugeschrieben „Die hll. Augustus, Gregor und Johannes d. Täufer“ (aus der Slg. Johann Georg von Sachsen) sowie drei anonyme Zeichnungen des frühen 19. Jh. „Kreuzweg: Jesus trifft seine Mutter“ (unleserlich signiert), „Tobias und der Engel“ und „Bildnis Herr Zeuner“.

Edward Jakob von Steinle (1810 Wien – 1886 Frankfurt a. M.)
6654 Mädchen mit Lilie und weiblicher Akt mit Tuch. Bleistift, weiß gehöht, auf graugrünem Velin. 15,3 x 18,9 cm. Unten rechts unleserlich bezeichnet.
400 €
Provenienz: Alle Blätter Galerie Arnoldi-Livie, München (vor 1988). Seither in Familienbesitz.
Beigegeben: Johann Georg von Dillis, Italienisches Bauernpaar mit Hund, Aquarell über schwarzer Kreide, undeutlich monogrammiert unten links „GvD“, 7,5 x 8,5 cm. Von Eugen Napoleon Neureuther zwei Illustrationen wohl zu Goethes „Götz von Berlichingen“ (Kostümstudie und Ratsstube mit Bittsteller und Detailstudien der Figuren), jeweils Aquarell über Bleistift und Feder, 12,4 x 5,6 cm und 16,8 x 21,5 cm (auf einem Bogen montiert). Laut Etikett der Galerie Arnoldi-Livie ehemals Sammlung Friedrich Winckler, Berlin.

6654
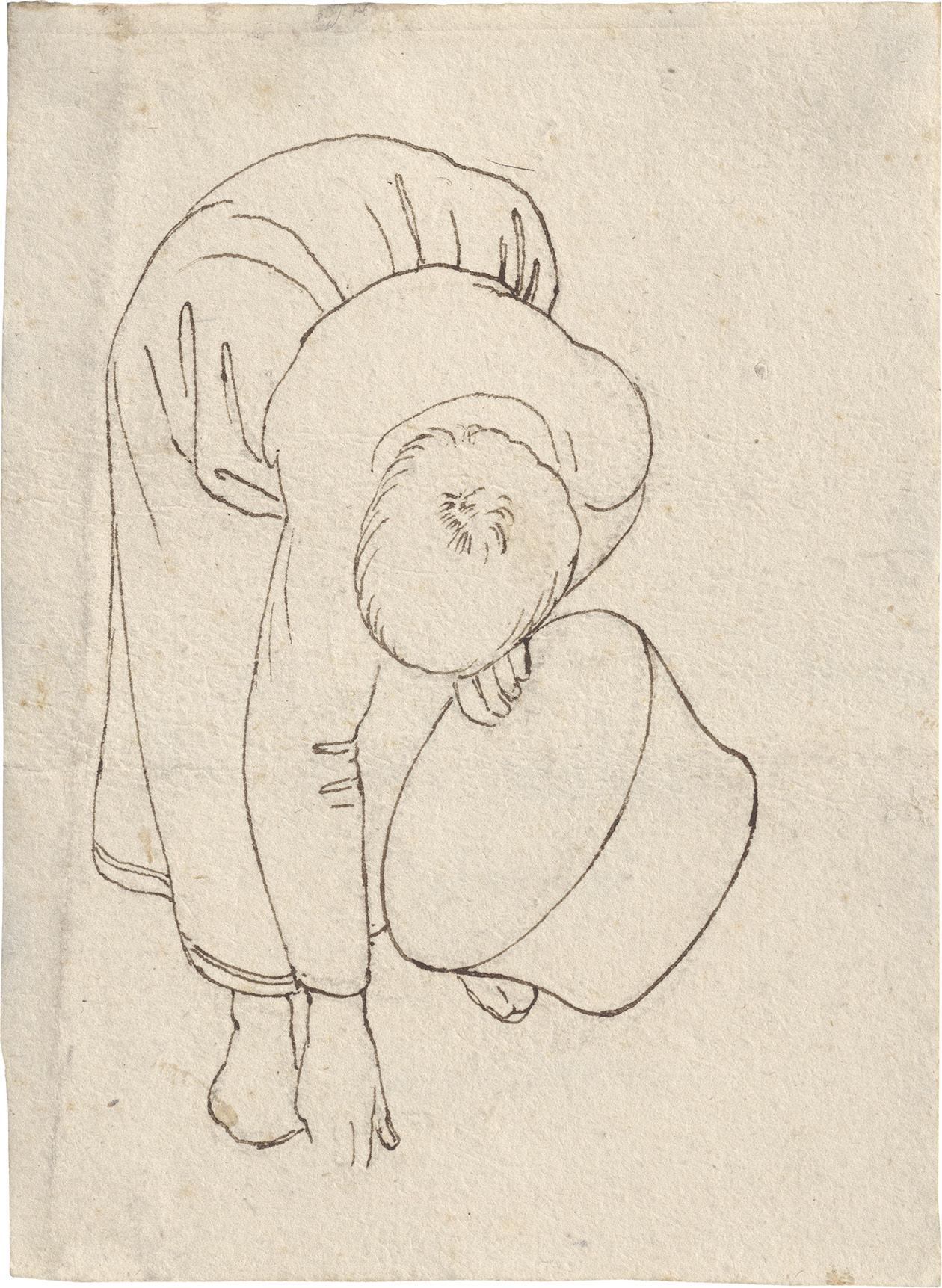

Friedrich Overbeck (1789 Lübeck – 1869 Rom)
6655 Figurenstudie zur Mannalese der Israeliten in der Wüste.
Feder in Braun. 13,3 x 9,7 cm.
800 €
Provenienz: Sammlung Stephan Seeliger, München.
Overbecks Vorzeichnung zur Mannalese, die Johann Karl Koch 1833 lithographierte (Nagler 6), befindet sich im Kupferstichkabinett in Basel (Inv. 1867.31). Vorliegende Detailstudie bereitet seitenverkehrt die gebückte Figur einer Ährenleserin vorne links vor.
Veit Hanns Schnorr von Carolsfeld (1764 Schneeberg –1841 Leipzig)
6656 Der schlechte Traum.
Feder und Pinsel in Braun, braun laviert, über schwarzem Stift, mit schwarzer Feder doppelt umrandet, auf feinem Velin. 10,2 x 7,1 cm. Mittig unterhalb der Darstellung monogrammiert und datiert „S.v.K. 1814“.
600 €
Julius Schnorr von Carolsfeld (1794 Leipzig – 1872 Dresden)
6657 Loth flieht mit seiner Familie aus dem brennenden Sodom.
Feder in Schwarz über Bleistift auf feinem Papier. 13,6 x 14,4 cm.
1.500 €
Provenienz: Sammlung Stephan Seeliger, München. Vorzeichnung zum Holzschnitt in der Cotta-Bibel (1. Mose, 19, 24-26).
Julius Schnorr von Carolsfeld
6658 König Salomon.
Feder in Schwarz über Bleistift auf graugrünem Velin. 17 x 20,2 cm.
1.200 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Bis 1993 im Besitz der Nachfahren. Sammlung Stephan Seeliger, München.




Edward H. Fryer (brit. Künstler, 1834–43 in London nachweisbar)
6659 Turin: Blick über den Po auf den Monte dei Cappuccini.
Aquarell. 24,8 x 35 cm. Unten mittig signiert und datiert „E. Fryer. 1823“.
450 €
Beigegeben eine mechanische Reproduktion nach einem Aquarell „Markusplatz in Venedig“.
Jacques François Joseph Carabain (eigentl. Jacob Franz Josef Carabain, 1834 Amsterdam – 1933 Schaerbeek)
6660 Steiler Weg zum Kastell. Schwarze Kreide, braun laviert, Feder in Dunkelbraun. 17,2 x 26,6 cm. Unten links signiert „J Carabain“. Wz. Bekröntes Wappenschild mit Fleur-de-lis und angehängten Buchstaben ID.
400 €
Provenienz: Karl & Faber, München, Auktion am 5.-6. Dezember 1995, Los 110.

Friedrich Lessing
6661 Bildnis eines jungen Künstlers mit Oberlippenund Kinnbart.
Bleistift, grau laviert, auf festem Velin. 27,8 x 22,9 cm. Rechts datiert „Maerz 1838“.
600 €


Michael Neher (1798–1876, München)
6662 Blick auf Castel Gandolfo. Feder in Schwarz. 17,2 x 23,6 cm. Unten in der Darstellung monogrammiert und datiert „N. 1824“, oben links nochmal signiert (?) „Michael Neher“ sowie oben rechts bez. „Cast. Gandolfo“.
1.200 €
Literatur: C.G. Boerner: Neue Lagerliste XXIV, Düsseldorf 1959, Nr. 391 mit Abb. Taf. LIII.
Zeichnungen des 19. Jahrhunderts

Marie Christine Mouillet
(1802–1885, Courrendlin, Kanton Bern)
6663 Blick aus der Villa Mills auf die Ruinen der Cesarenpaläste in Rom.
Feder in Braun, braun laviert über Vorzeichnung in schwarzem Stift. 14,7 x 20,5 cm. In der Darstellung signiert „Marie Mouillet fecit“, auf dem Untersatzpapier in franz. Sprache betitelt.
450 €
Provenienz: Bassenge, Berlin, Auktion 46 am 6. Dezember 1985, Los 4841.
Beigegeben eine Zeichnung des 19. Jh. „Blick auf Florenz“ (Pinsel in Braun, über Bleistift).
Heinrich Dreber
(gen. Franz Dreber, 1822 Dresden – 1875 Anticoli di Campagna)
6664 Blick von der Sorrentiner Halbinsel auf Capri. Bleistift auf gelblichem Velin, Spuren von Weißhöhung und blauer Aquarellfarbe. 19,7 x 25,3 cm. Unten links signiert „Franz Dreber fec“ und unten rechts bez. und datiert „Rom 1851“.
2.800 €
Literatur: Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst aus zwei Jahrhunderten, 1760-1960. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung W. B., Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 1967, Nr. 19.
Provenienz: Karl & Faber, München, 80. Auktion, 1962, Los 551 mit Abb.

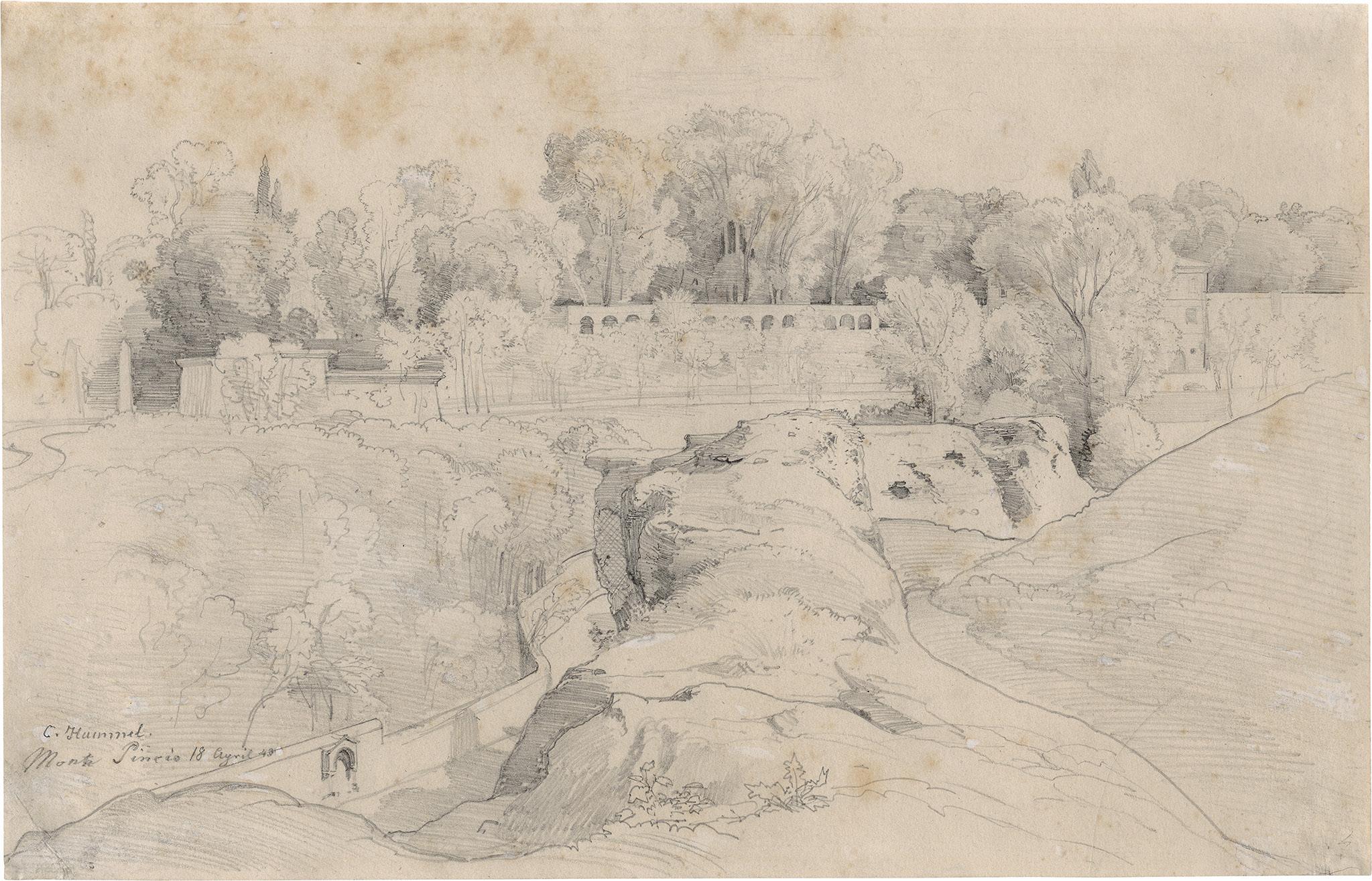

6667
Johann Martin von Rohden (1778 Kassel – 1868 Rom)
6665 Blick auf ein steiles Felsmassiv mit den Ruinen eines Castello, wohl Subiaco.
Bleistift auf graugrünem Velin. 21,4 x 24 cm. Um 1830.
800 €
Carl Maria Nikolaus Hummel (1821–1907, Weimar)
6666 Partie auf dem Monte Pincio in Rom: Blick auf den Muro Torto.
Bleistift auf Velin. 19 x 29,6 cm. Unten links signiert, datiert und eigenh. bez. „C. Hummel Monte Pincio 18. April [18]43“.
750 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
Die spontane, wohl unmittelbar vor der Natur aufgenommene Zeichnung entstand zu Beginn von Carl Hummels Aufenthalt in Italien, der von 1842 bis 1846 dauerte. Hummel zeigt einen Teil des Muro Torto mit dem davor gelegenen gleichnamigen Viale del Muro Torto. Im Vordergrund erkennt man die Reste der aurelianischen Stadtmauer.
Deutsch
6667 um 1830. Blick auf Olevano von Südosten. Bleistift. 15 x 22,1 cm.
600 €

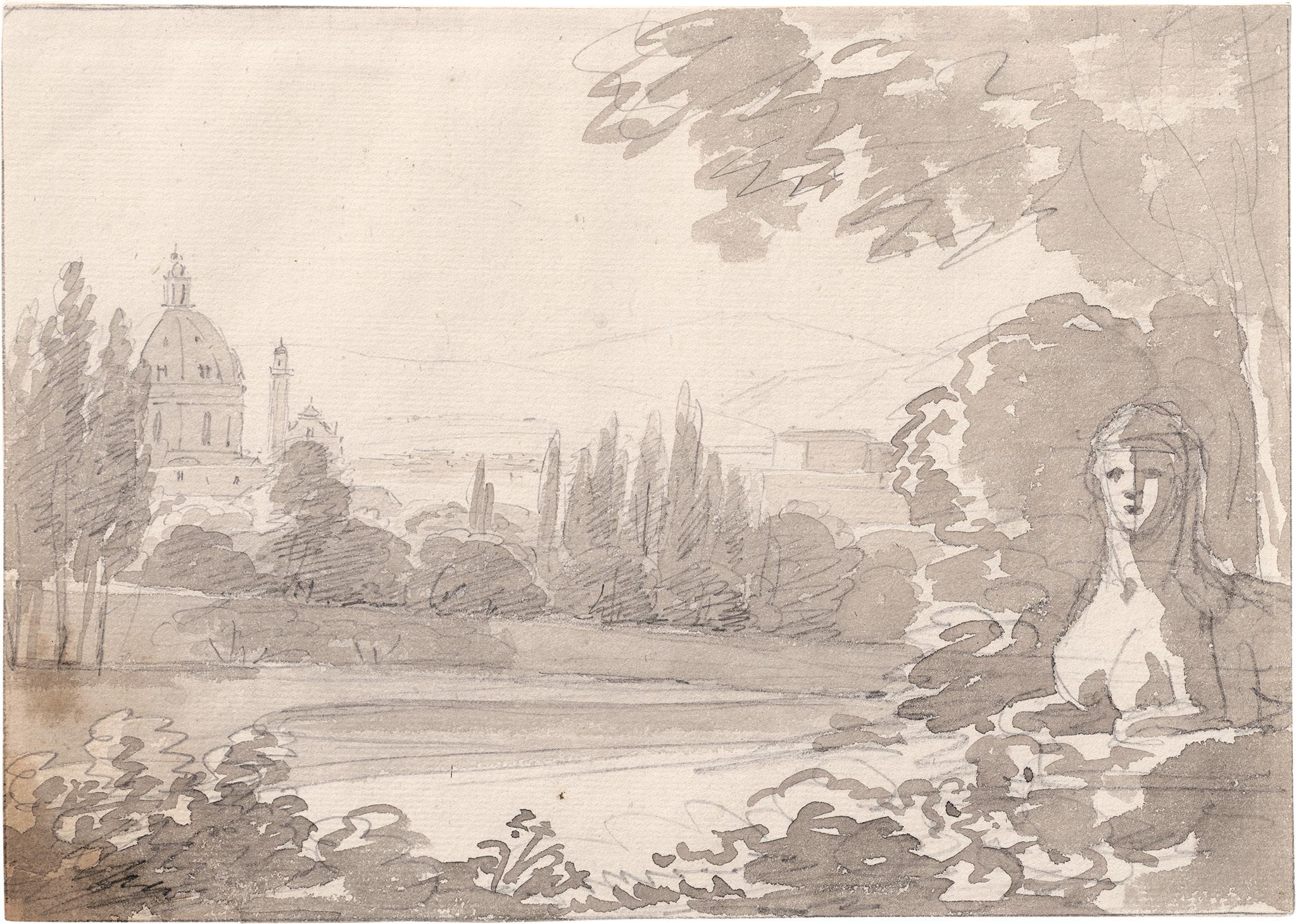

Johann Christian Reinhart (1761 Hof, Bayern – 1847 Rom)
6668 Ideallandschaft mit Hirt und Ziegen. Feder in Braun über Bleistift, braun und graublau laviert, auf der Originalmontierung des Künstlers. 23,9 x 31,4 cm. Signiert „J. C. Reinhart“. Um 1824. 3.500 €
Die bravourös gezeichnete Ideallandschaft entstammt der reifen Schaffenszeit Reinharts und dokumentiert in ihrer kompositorischen Struktur die intensive Auseinandersetzung mit dem Werk seines großen Vorgängers Gaspar Dughet, von dem der Künstler ein Gemälde besaß. Johann Christian Reinhart, der sich 1789 in Rom niedergelassen hatte, gehörte gemeinsam mit Joseph Anton Koch zu den angesehensten Vertretern der deutschen Künstlerschaft in der Heiligen Stadt, wo er bis zu seinem Tode leben und arbeiten sollte. Die vorliegende Zeichnung besitzt in ihrem virtuosen Duktus und Spontaneität der Linienführung alle Merkmale der prima idea. Die Studie diente als Vorbereitung für das 1824 vollendete Gemälde Ideallandschaft mit Hirt und Ziegen, das heute in der Neuen Pinakothek in München aufbewahrt wird (Inv. Nr. WAF 817). Das Werk muss für den Künstler einen hohen Stellenwert besessen haben, denn es sind mehrere sorgfältig komponierte, bildmäßig ausgeführte Zeichnungen überliefert (siehe Ausst. Kat. Johann Christian Reinhart. Ein deutscher Landschaftsmaler in Rom, hrsg. von H. W. Rott, A. Stolzenburg und F. C. Schmid, Hamburg, Kunsthalle, München, Neue Pinakothek, 2013, S. 302-303).
Ferdinand Kobell (1740 Mannheim – 1799 München)
6669 Klassische Landschaft mit Rundtempel. Feder in Grau über Spuren von Graphit, alt aufgezogen. 18,1 x 25,2 cm. Wz. Anker im Kreis.
600 €
Provenienz: Kunsthandlung Julius Böhler, München, (Nr. 51-846, Etikett auf der Rahmenrückseite). Seit 1975 deutsche Privatsammlung.
Johann Georg von Dillis (1769 Grüngiebing – 1841 München)
6670 Südliche Flusslandschaft mit Sphinx. Pinsel in Braun über Bleistift auf Bütten. 15,9 x 22,5 cm. Verso am unteren Rand von alter Hand bez. „G v Dillis“.
900 €



Zeichnungen des 19. Jahrhunderts
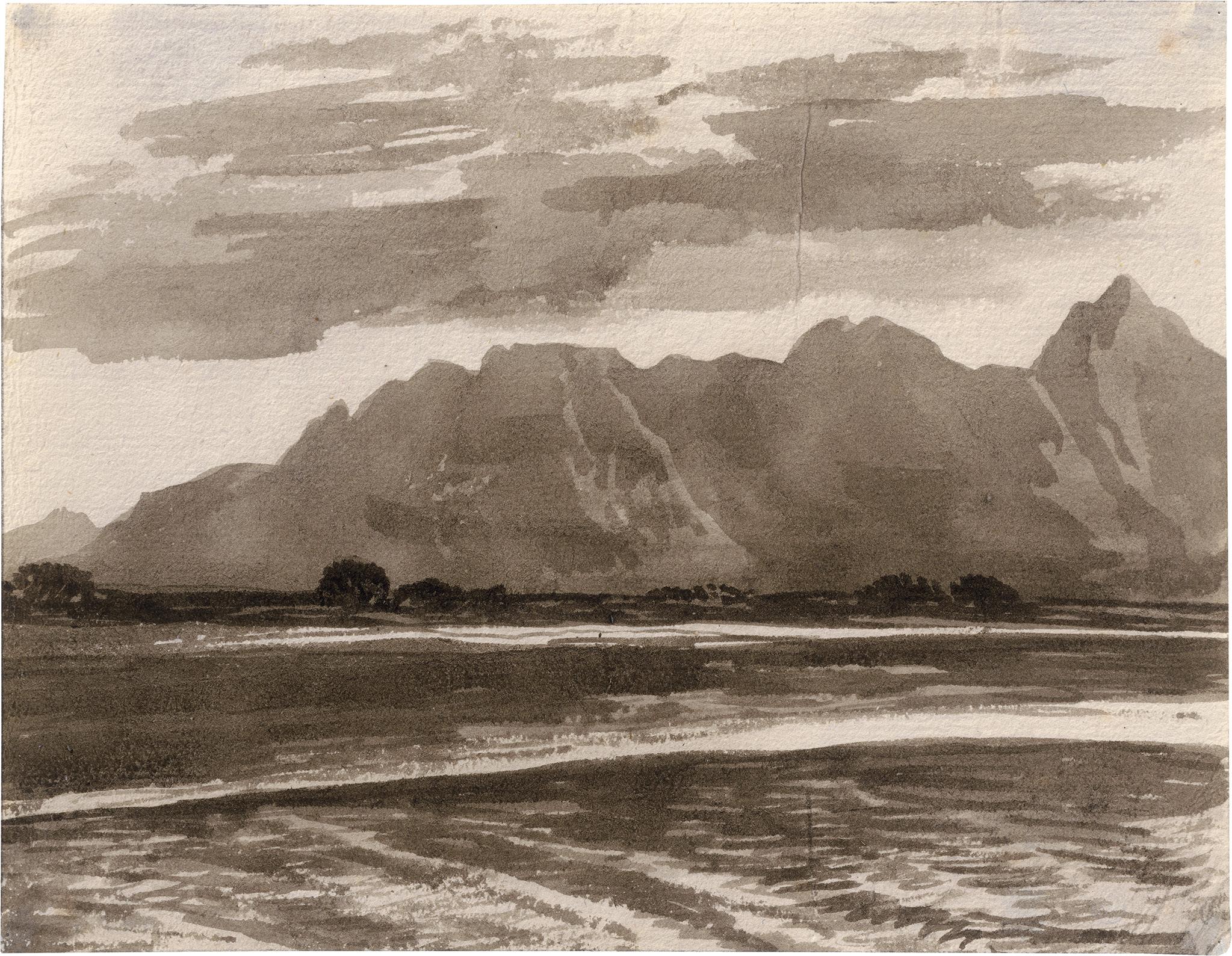
Franz Kobell (1749 Mannheim – 1822 München)
6671 Klassische Landschaft mit badenden Frauen in einem Waldsee.
Feder in Braun, braun und graubraun laviert, auf Bütten. 24,5 x 30,5 cm.
600 €
Provenienz: Bassenge, Berlin, Auktion 25, 1975, Los 495.
Beigegeben fünf weitere Zeichnungen des 19. Jahrhunderts: „Der Bernhardsfelsen bei Carlsbad“ (1829), „Die Trifthütte im Osterbachtal bei Schliersee“, von Dürr und Maria Poll je eine Landschaftszeichnung sowie eine Ernst Polycarp Leyser zugeschriebene Zeichnung „Reiter mit Mädchen“.
6672 Sammleralbum mit Landschaftszeichnungen. 11 Zeichnungen in brauner Feder, je montiert auf blauem Bütten, lose in marmoriertem HLederdeckel des 18. Jh. (berieben, mit kl. Schadspuren) mit ornamentaler Rückenvergoldung und Schild). 8,5 x 9,5 cm - 15,2 x 19,7 cm.
900 €
Provenienz: Aus einer unbekannten Sammlung „A.R“ (Lugt 4401).
6673 Landschaft mit Alpenpanorama. Pinsel in Braun auf Bütten. 14,8 x 19 cm.
1.800 €
Literatur: Ausst. Kat. 100 Jahre deutsche Zeichenkunst 1750-1850, Sammlung Konsul Heumann Chemnitz, Chemnitz 1930, Nr. 118. Ausst. Kat. Deutsche Landschaftskunst 1750-1850, Breslau 1933, Nr. 55.
Provenienz: Sammlung Carl Heumann, Chemnitz (Lugt 555b und 2841a). Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert Ketterer, Stuttgart, Auktion 29 am 29. November 1957: Sammlung Heumann, Chemnitz. Kunst des 18. und 19. Jahrhunders. Aquarelle, Zeichnungen, Gemälde, Graphik, Los 162.

Carl Wagner
(1796 Roßdorf an der Rhön – 1867 Meiningen)
6674 Alpenlandschaft mit Gebirgsbach und schneebedeckten Gipfeln.
Feder in Braun über Bleistift. 29,2 x 35,4 cm. Um 1845.
600 €
Carl Wagner studierte 1817-20 an der Dresdener Akademie, wo er dem Kreis um Johann Christian Clausen Dahl, Carl Gustav Carus, Ernst Ferdinand Oehme und Ludwig Richter angehörte. Ein Aufenthalt in Italien (1822-25) bestärkte den Künstler in seiner Absicht, als Landschaftsmaler tätig zu sein. Interessanterweise war es nicht die südliche Landschaft die Wagner fortan beschäftigen sollte, sondern die sublime Gebirgslandschaft der Schweizer und Tiroler Alpen. Möglicherweise handelt es sich bei der vorliegenden Zeichnung um ein im Zusammenhang mit einer Reise in die französischen Alpen entstandenes Motiv. Eine vergleichbare Zeichnung, ebenfalls in brauner Feder, betitelt „Les Fiz et le Col d‘Anterne“ (Landschaft in den französischen Alpen nördlich des Montblanc-Massivs) ist abgebildet in Oskar Alfred König: Der romantische Landschaftsmaler und Meininger Hofmaler Carl Wagner, Crailsheim 1990, S. 136.
Abbildung Seite 146
Johann Georg von Dillis (1769 Grüngiebing – 1841 München)
6675 Blick über die Isar von der Praterinsel auf München.
Schwarze Kreide, weiß gehöht, auf blau gestrichenem Bütten. 22,2 x 31,3 cm. Am Unterrand datiert „den 28ten Sept. 1824“.
3.500 €
In dem vorliegenden Blatt hat Dillis das Ufer der Isar festgehalten, gesehen von einem Standort auf der Praterinsel, an dem sich heute die Maximiliansbrücke befindet. Im Vordergrund führt eine Brücke über den linken Isararm zum stadtseitigen Westufer, im Hintergrund zeichnet sich die Silhouette der Türme der Peterskirche und der Heiliggeistkirche am Viktualienmarkt ab.

Thomas Ender (1793–1875, Wien)
6676 Partie im Wiener Prater. Pinsel in Braun über Bleistift. 36 x 44,8 cm.
1.800 €
Provenienz: Sammlung Johann Martin Friedrich Geissler, Nürnberg und Paris (Lugt 1072).
Sammlung Benjamin Wolff (Lugt 420).
Die vorliegende bildmäßig komponierte Landschaft zeigt eine malerische Ansicht aus dem Wiener Prater. Das mit souveränen, lockeren Pinselstrichen ausgeführte Blatt ist rückseitig mit der Sammlerbezeichnung „J. M. Frederic Geissler graveur a Nuremberg 1832“ bezeichnet, die somit einen terminus ante quem liefert. Damit ist die Arbeit der frühen Schaffenszeit des Künstlers zuzurechnen, die vor allem durch fein abgestufte Tonwerte und eine subtile Landschaftsauffassung gekennzeichnet ist. Auch diese Momentaufnahme aus dem weitläufigen Wiener Park lebt von Enders lebendiger Erfassung von Licht und Atmosphäre.

Österreichisch
6677 19. Jh. Salon im Palais des Karl Graf Lanckoroñski in Wien.
Aquarell. 29,8 x 39,9 cm (Passepartoutausschnitt). Unten rechts signiert „K. Müller“.
3.500 €
Das Aquarell zeigt den Salon des Kunstsammlers, Mäzen und Denkmalpflegers Karl Graf Lanckoroñski in der Riemergasse 8 im 1. Wiener Gemeindebezirk (Innere Stadt) - und nicht, wie häufig angenommen wird, das spätere Palais des Grafen in der Jacquingasse 16-18 im 3. Bezirk (Landstraße). Während das Palais später die bedeutende Kunstsammlung des Grafen beherbergte und ein gesellschaftlicher Treff-
punkt für Künstler und Adelige war, zeigt dieses Blatt das frühere, noch private Wohnumfeld.
An den Wänden des Salons hängen zahlreiche Gemälde aus der Sammlung Lanckoroñski, die später ins Palais an der Jacquingasse überführt wurden. Darunter befinden sich Werke von Jacob van Ruisdael, Ferdinand Georg Waldmüller und Thomas Gainsborough.
Das größte Gemälde über dem Sofa stammt von Anton von Maron und trägt den Titel „Die Brüder Franciszek und Kazimierz Rzewuski vor römischer Architekturkulisse“. Es befindet sich heute in der LanckoroñskiGalerie im Königsschloss in Warschau. Links im Raum ist außerdem eine Marmorbüste von Friedrich von Schiller zu sehen, geschaffen von Johann Heinrich Dannecker. - Gerahmt beschrieben.
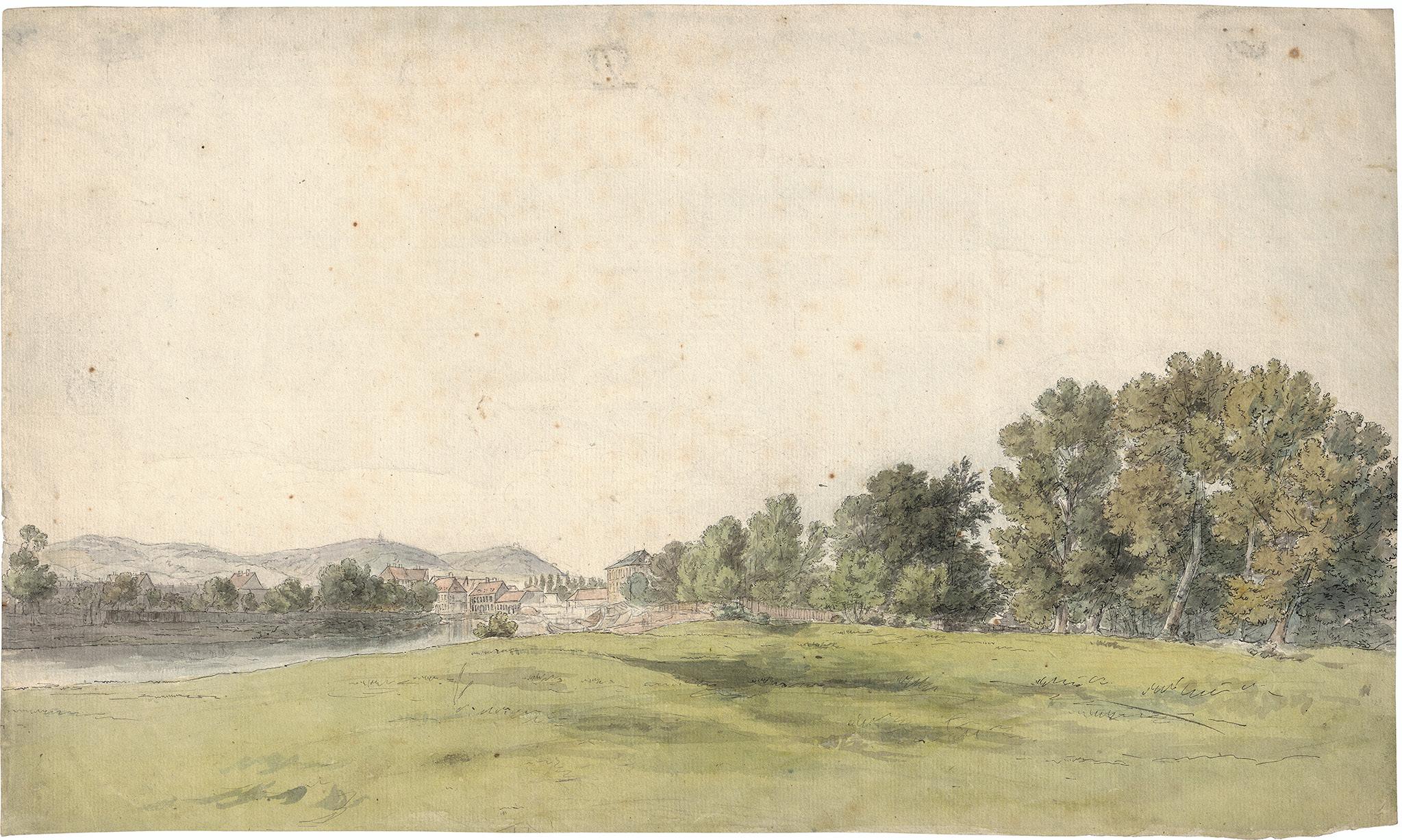
Österreichisch
6678 1825. Der Wiener Prater mit dem Donaukanal unweit des Palais Rasumofsky. Aquarell auf C & I Honig-Bütten, verso Wolkenstudien.
26,6 x 44,8 cm. Verso in Bleistift wohl vom Künstler bez. „im Prater bei Rasumofsky gezeichnet im Jahr 1825 [letzte Ziffer undeutlich]“.
750 €
Das Aquarell zeigt den Blick nach Norden auf die damals noch naturbelassenen Flächen des Praters direkt am Donaukanal. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals lag das Palais Rasumofsky, dessen Gärten sich ebenfalls bis an den Kanal erstreckten. Im Hintergrund erscheint die Silhouette des Wienerwalds mit dem Leopoldsberg und der gleichnamigen Kirche.

Eugen Adam
(1817–1880, München)
6679 Aussicht von der Jägerhöhe zu Aigen über die Salzach nach Salzburg.
Aquarell. 20,6 x 30,5 cm. Verso in Bleistift wohl eigenhändig bezeichnet, signiert und datiert „Salzburg von der Jägerhöhe zu Aigen nach der Natur gezeichnet / von Eugen Adam München 1837.“
6.000 €
Der dritte Sohn des Albrecht Adam war auch, wie seine Brüder, dessen Schüler. Bereits in seiner Jugend vervielfältigte Eugen lithographisch die Bilder des Vaters. 1836 begleitet der Neunzehnjährige seinen Vater nach Hohenschwangau. Von dort reiste er weiter nach Salzburg mit dem Auftrag, einen Prospekt der Stadt in 16 Blättern zu malen. Das vorliegende, bemerkenswert farbfrische Aquarell diente, ohne den RepoussoirBaum links und ohne die Staffage, als Vorlage für eine im Verlag von J. M. Hermann, München 1837, erschienene Kreidelithographie von Theodor Hellmuth aus dem „Album der Stadt Salzburg und ihrer malerischen Umgebungen“ (Nebehay-Wagner 2, 4.).
Deutsch
6680 Anfang 19. Jh. Porträt zweier Brüder, der ältere mit Büchern unter dem Arm, der jüngere mit Vogelnest und Amseleiern.
Pastell. 53 x 42,7 cm. Verso alt bezeichnet „Hans Seyfried / u. der / kleine Bruder / Karl Seyfried“. Gerahmt beschrieben.
800 €


Deutsch
6681 um 1840. Wiesenblumenstrauß mit Schafgarbe und kleinem Habichtskraut.
Aquarell und Gouache auf graublauem Bütten. 36,2 x 25,6 cm.
600 €
Beigegeben wohl von derselben Hand eine Gouache „Studienblatt mit vier rosa-weißen Tulpen“.

Johann Christoph Erhard (1795 Nürnberg – 1822 Rom)
6682 Eingangstor der Ruine Pillenreuth von innen. Feder in Schwarz, Pinsel in Braun, Spuren von Rötel auf der Staffagefigur, mit Einfassungslinie in schwarzer Feder. 17,8 x 27,8 cm. Unten links bezeichnet „Eingang in Pillenreuth von innen.“, unten rechts signiert „Dessinée d apres Nature de J. C. Erhard“, oben mittig mit Bleistift datiert „d 14 September“, unten links außerhalb der Darstellung nummeriert „E. III. 62“.
1.800 €
Literatur: Marleen Gärtner: Johann Christoph Erhard (1795-1822) - Sein Leben und seine Zeichnungen, Marburg 2013, Kat. Nr. 16, S. 213. Provenienz: Wohl Sammlung Dr. Arndt, Dresden. Privatsammlung Oberpfalz.
Auf Anregung seines zweiten Lehrers Ambrosius Gabler unternahm der jugendliche Erhard zahlreiche Wanderungen in der Umgebung von Nürnberg, der Fränkischen Schweiz und der Oberpfalz, oft zusammen mit den befreundeten Gabler-Schülern Klein, Wilder und Wießner. Dabei entstanden zahlreiche Ansichten von Ruinen, die im Nachhinein
einen bedeutenden Beitrag zur romantischen Entdeckung der fränkischen Landschaft leisteten. Das 1345 gestiftete Kloster Pillenreuth, damals wenige Kilometer südlich von Nürnberg gelegen (heute eingemeindet), wurde bereits 1552 von markgräflichen Truppen zerstört. Diese für das frühe zeichnerische Œuvre Johann Christian Erhards typische, bildhaft komponierte Sepiazeichnung ist eng verwandt mit der 1811 datierten „Waldpartie auf dem Weg nach dem Mögeldorfer Steinbruch“ (Museen der Stadt Nürnberg, Inv.Nr. St. N. 13205, ehemals aus dem Besitz von Johann Adam Klein. Vgl. Johann Christoph Erhard (1795-1822) - Der Zeichner, Ausst. Kat. Nürnberg 1996, Nr. 1). Aufschlussreich für die Datierung ist zudem, laut Marleen Gärtner, auch eine Zeichnung Johann Adam Kleins mit einer Ansicht Pillenreuths (in Privatbesitz), die ebenfalls das Datum 14. September trägt. Da Klein am 16. September 1811 nach Wien abreist, entstanden beide Zeichnungen vermutlich auf einem letzten gemeinsamen Ausflug der Freunde vor dessen Abreise. Auf Erhards Zeichnung führt der Weg durch das heute noch existenteTor Richtung Westen. Der einen Rechen geschulterte Bauer geht, den Schlagschatten und den delikaten Rötelhöhungen auf der Körpervorderseite nach zu urteilen, nach getaner Arbeit, dem Sonnenuntergang entgegen.

6683 19. Jh. Blick über Bamberg vom Kleebaumskeller. Aquarell. 19,6 x 26,6 cm.
750 €
Die wunderbare, topographisch exakte Darstellung zeigt den Blick von einer Terrasse des Kleebaumskeller oberhalb des barocken Stadtpalais Concordia über die Regnitz auf die Altstadt mit der Martinskirche. Inmitten der eng stehenden Häuser erkennt man links die Steinbrücke über die Regnitz mit dem berühmten barocken Brückenrathaus.
Carl Kuntz (1770 Mannheim – 1830 Aachen)
6684 Landschaft an der Murg, im Hintergrund Schloss Eberstein.
Aquarell und Pinsel in Grau und Schwarz auf feinem Velin. 20,6 x 26,3 cm. Verso bez. „Carl Kuntz“. 400 €
Abbildung Seite 156



6685
Wilhelm Busch (1832 Wiedensahl – 1908 Mechtshausen)
6685 Selbstportrait mit Schieberkappe und Schnauzbart.
Bleistift auf Velin. 15 x 12,6 cm. Am Oberrand eigenh. bewidmet „Der Vielgeliebten in Ammerland zur freundlichen Erinnerung WBusch“, unten links in rotem Stift „18“, sowie unten links in Bleistift „B“ und in violettem Stift „26“. (1858).
800 €
Literatur: Wilhelm Busch. Gesamtausgabe, München 1943, Bd. I, Abb. S. 51.
Wilhelm Busch. Sämtliche Werke, Gütersloh 1959, Bd. II, Abb. S. 904.
Provenienz: Karl & Faber, München, Auktion 87, 1963, Los 541. Mit 35 Jahren lernte Wilhelm Busch im Haushalt seines Bruders Gustav in Wolfenbüttel die erst 17-jährige Anna Richter kennen. Dieser widmet er das vorliegende Selbstbildnis, das den Künstler in karikierender Weise im Profil mit übergroßer Kappe und scharf gezwirbelten Schnurrbart darstellt. Tränen laufen dem Maler über die Wange ob der Trennung von seiner Angebeteten. Die Verbindung scheiterte jedoch 1862, da der Vater von Anna Richter nicht daran dachte, seine Tochter dem zu der Zeit noch unbekannten Künstler ohne regelmäßiges Einkommen anzuvertrauen.

Fritz Wucherer
(1873 Basel – 1948 Kronberg, Taunus)
6686 Rastender Spaziergänger auf einer Bank, mit Blick von der Taunushöhe auf Burg Kronberg. Aquarell. 27,7 x 45,9 cm. Unten rechts signiert und datiert „F. Wucherer - Paris - Dez. [18]95“.
400 €
Im April 1895 reiste Fritz Wucherer, nach Ende seiner Lehrjahre in Kronberg bei Anton Burger, über Belgien nach Paris. Dort schuf er im Dezember des gleichen Jahres vorliegendes Aquarell in Erinnerung an seine Lehrzeit im Taunus. Wucherer kehrte schließlich nur wenige Jahre später dorthin zurück, um dort sesshaft zu werden.
Abbildung Seite 156
Carl Maria Nikolaus Hummel (1821–1907, Weimar)
6687 Thüringische Landschaft bei Rastenberg mit Fachwerkhaus.
Aquarell auf festem Velin. 35 x 51,3 cm. Unten links signiert, datiert und eigenh. bez. „C. Hummel Rastenberg 28/8 [18]87“.
800 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
Süddeutsch
6688 um 1850. Studie einer verwitterten Tür.
Öl auf Malpappe. 28,4 x 21,4 cm.
750 €


6689
Eugen Bracht (1842 Morges – 1921 Darmstadt)
6689 „Herren Chiemsee“: Schilfbewachsenes Ufer. Aquarell. 28,1 x 23,8 cm. Unten rechts betitelt, datiert und signiert „Herren Chiemsee, den 6 Aug. 1880. E. Bracht“.
1.200 €
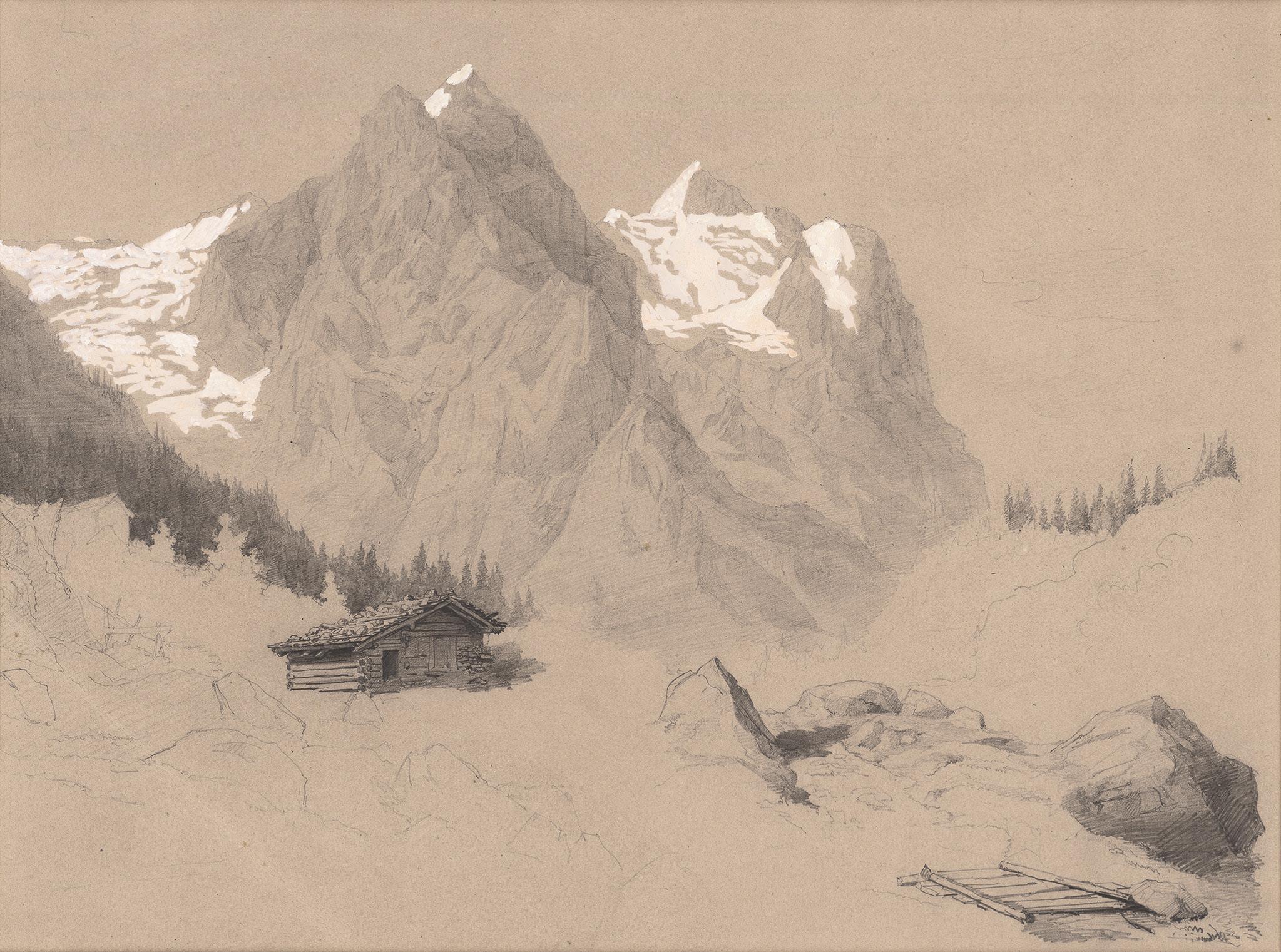

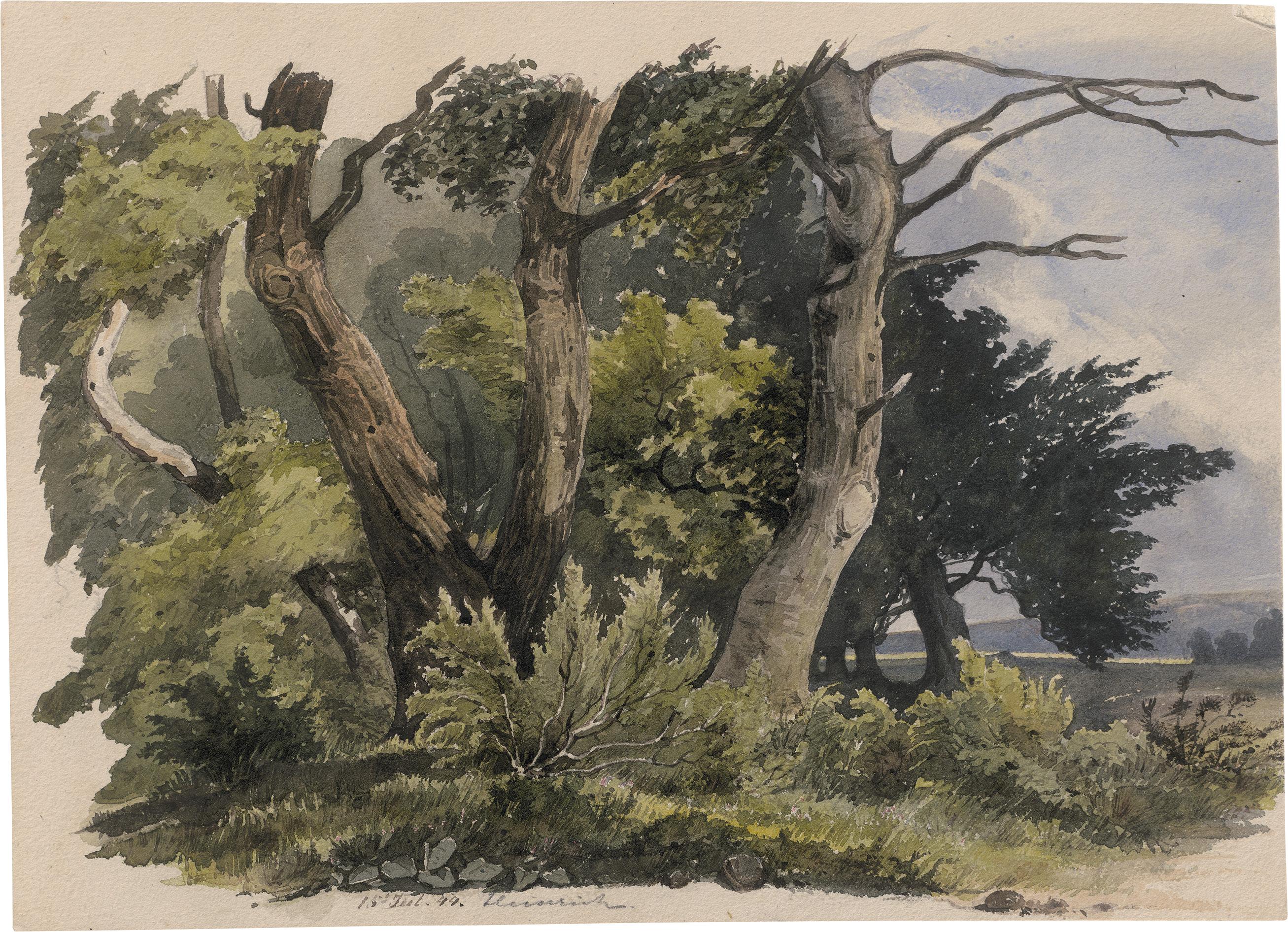
6692
Robert Zünd (1827–1909, Luzern)
6690 Blick auf die Rosenlaui im Berner Oberland. Bleistift mit Deckweißhöhungen auf hellbraunem Velin. 28,5 x 36 cm.
800 €
Provenienz: Hamburger Privatsammlung.
Adolph Kaiser (1804 Geisa – 1861 Weimar)
6691 Die Brücke an der Via Mala. Bleistift. 32,1 x 24 cm. Unten rechts signiert, bezeichnet und datiert „A. Kaiser / il ponte Magiore / October [18]26“.
600 €
Beigegeben Adolph Kaiser zugeschrieben die Bleistiftzeichnung „Ansicht einer südlichen Ortschaft“ sowie zwei weitere anonyme Zeichnungen des 19. Jh. „Eichenbaum“ und „Hügellandschaft (Skizzenbuchblatt)“.
Deutsch
6692 1844. Kleines Waldstück. Aquarell auf festem Velin. 19,8 x 27,3 cm. Am Unterrand in schwarzer Feder datiert „15 Jul [18]44“.
450 €
Provenienz: Bassenge, Berlin, Auktion 43 am 24. Mai 1984, Los 4951. Beigegeben zwei weitere Landschaftszeichnungen des 19. Jh.: „Wanderer in einer Felsschlucht“ und Samuel Rösel zugeschrieben „Bucht bei Sartowic (?)“.
Zeichnungen des 19. Jahrhunderts
Ernst Rietschel (1804 Pulsnitz – 1861 Dresden)
6693 Amalie von Oldenburg, Königin von Griechenland in griechischer Tracht.
Aquarell über Spuren von Bleistift. 24,8 x 19,5 cm (lichtes Maß). Am linken Rand signiert und datiert „E. Rietschel 1853“, verso mit einem in dän. Sprache handschriftl. bez. Etikett des Skandinavisk Antiquariat mit einer Mitteilung an „Hr. Konsul Erichsen“.
1.200 €
Provenienz: Privatsammlung Kopenhagen.
Amalie von Oldenburg (1818-1875), die erste Königin von Griechenland, war als Gemahlin König Ottos I. eine zentrale Figur im jungen griechischen Königreich. Amalie sprach fließend Französisch, die Sprache der Diplomatie, lernte rasch Griechisch und wusste, wie sie durch Kleidung und Auftreten politische Botschaften senden konnte. Im vorliegendem Aquarell aus dem Jahr 1853, nur ein Jahr vor der Veröffentlichung des bekannten lithographierten Doppelporträts mit Otto, trägt Amalie eine eindrucksvolle griechische Tracht. Amalie entwarf für ihre griechischen Hofdamen und sich selbst die sogenannte „Amalia“-Tracht, eine stilisierte Verbindung griechischer Tradition und französischer Mode. Mit der Wahl dieser Kleidung setzte sie ein bewusstes Zeichen: Die reich verzierte Tracht mit goldbestickter Jacke und breitem Pelzkragen sowie langer Schleierhaube und üppigem Schmuck betont nicht nur Amalies Rolle als Integrationsfigur, sondern auch ihre bewusste Aneignung und Repräsentation griechischer Kultur. Dieses Porträt ist nicht nur ein Ausdruck höfischer Repräsentation, sondern auch ein eindrucksvolles Zeugnis einer Herrscherin zwischen den Kulturen.

6694

6693
Pieter Francis Peters (1818 Nijmegen – 1903 Stuttgart)
6694 1856. Schlafgemach der Zarin Alexandra Fjodorowna im Hotel Bellevue in Wildbad. Aquarell und Gouache, auf dem originalen Untersatz aufgezogen. 28,8 x 24,2 cm (im Oval). Unten signiert „P. F. Peter“ sowie bezeichnet und datiert „Wildbad july / 1856“, auf dem Untersatz recto und verso von Großfürstin Olga bezeichnet „chambre a coucher de Maman a Wildbad / oú Micha et ... de Bade furent promis le 29 Juine / 11 Juillet 1856“.
900 €

Provenienz: Aus dem Besitz der Großfürstin Olga Nikolajewna Romanowa (1822-1892), Königin von Württemberg.
Kaiserin Witwe Alexandra Fjodorowna verbrachte im Sommer 1856 mehrere Wochen zur Kur in Wildbad, was den kleinen Schwarzwaldort in Aufruhr versetzte: „kein Plätzchen, wo die Zarin vorüberfuhr blieb im engen Oertchen menschenleer; Triumphpforten, Blumenkränze, Laubgeflechte und Guirlanden ... schmückten ... Häuser und Straßen... Für den Augenblick ist das kleine Wildbad mit vornehmen, reichen und hochgestellten Russen überfüllt, und träufelt ein ausgiebiger und äußerst fruchtbarer Regen moskowitischer Gold-Imperialen auf das bescheidene, wohlgesittete und vom Luxus der Großbäder noch nicht angehauchte Waldstädtchen nieder.“ (Der Beobachter: ein Volksblatt aus Schwaben, Ausgabe vom 8.7.1856, S. 4). Das Zusammenkommen hochrangigen Adels war auch der Heiratspolitik zuträglich: Am 11. Juli wurde die Verlobung des Sohnes der Kaiserin, Großfürst Michael Nikolajewitsch, mit Prinzessin Cäcilie von Baden bekannt gegeben. Vorliegendes Blatt hält die Erinnerung an diesen Moment fest.
Michael van Cuyck (1797–1875, Ostende)
6695 Arbeitszimmer des Arztes Louis Verhaeghe in Ostende.
Aquarell, auf dem originalen Untersatz montiert. 25,1 x 35,6 cm. Unten links signiert „van cuijck“, auf dem Untersatz von Großfürstin Olga bezeichnet „Ostende 1864“.
1.200 €
Provenienz: Aus dem Besitz der Großfürstin Olga Nikolajewna Romanowa (1822-1892), Königin von Württemberg.
Gleich mehrmals hielt sich Olga Romanowa in den 1860er in Ostende auf, wo die berühmten Seekuren vor allem bei Atemwegserkrankungen Linderung versprachen. Zur heilenden Wirkung der Seeluft und des Meerwassers von Ostende forschte unter anderem der Arzt Louis Verhaeghe (1811-1870), der mit seinen Publikationen dazu beitrug, Ostende als Kurort europaweit bekannt zu machen. Auch die Großfürstin zählte zu seinen Patientinnen.

Louis Du Pasquier (1808–1885, Schweiz)
6696 „Vue de la manufacture de Zareva près de Moscou“ (Die Baumwollmanufaktur im Dorf Tsarjowo bei Moskau). Aquarell und Feder in Schwarz. 21,8 x 35,5 cm (Einfassungslinie), 34,5 x 45,6 cm (Blattgröße). Unten rechts signiert „L. Du Pasquier“ sowie unterhalb der Darstellung betitelt und mit dem gezeichneten russischen Adler.
1.200 €
Bei der gepflegten Anlage handelt es sich um die Manufaktur zur Herstellung von feinen Baumwollstoffen im Dorf Tsarjowo (jetzt Krasnoarmeisk) bei Moskau.
Schweizerisch
6697 1862. Salon des Württembergischen Königspaares im Hotel Byron in Villeneuve mit Blick auf den Genfersee.
Aquarell, Goldhöhungen, auf dem originalen Untersatz montiert. 26 x 37,1 cm. Unten rechts unleserlich signiert und datiert, auf dem Untersatz von Großfürstin Olga bezeichnet „Villeneuve, 1862. Hotel Byron“.
1.200 €
Provenienz: Aus dem Besitz der Großfürstin Olga Nikolajewna Romanowa (1822-1892), Königin von Württemberg.
Ernesto Bensa (tätig in Florenz um 1866–1897)
6698 Salon der Großfürstin Olga Nikolajewna in der Villa di Quarto bei Florenz.
Aquarell, auf dem originalen Untersatz montiert. 27 x 38 cm. Unten links signiert und datiert „Ernest Benso / Quarto 1888“, auf dem Untersatz von Großfürstin Olga bezeichnet „Ma Chambre à quarto 1888.“.
1.200 €
Provenienz: Aus dem Besitz der Großfürstin Olga Nikolajewna Romanowa (1822-1892), Königin von Württemberg.
Aufgrund der angeschlagenen Gesundheit von König Karl von Württemberg suchte das Königspaar im Winter und Frühling 1887/88 milderes Klima in der bei Florenz gelegenen Villa di Quarto. Eine beinahe fatale Lungenerkrankung kettete den König für mehrere Wochen ans Bett und auch Olga musste aufgrund einer Verstauchung das Haus hüten. Dennoch nahm das Paar seine königlichen Pflichten wahr und empfing hochrangigen Besuch wie Königin Victoria von England.




R. Heim (tätig im 19. Jh. )
6699 Rom: Blick von einer Terrasse über den Tiber auf die Engelsburg und St. Peter. Bleistift und Aquarell. 21,7 x 30,1 cm. Am Unterrand zweimal in Bleistift signiert (?) „R. Heim“.
400 €
Carl Ehrenberg (1840 Dannau – 1914 Dresden)
6700 Sizilianerin am Spinnrocken. Aquarell, Spuren von Bleistift. 35,2 x 25,2 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „CE [ligiert] 18 13/2 80 [13.2.1880]“.
750 €
Literatur: Ulrich Schulte-Wülwer: Sehnsucht nach Arkadien. SchleswigHolsteinische Künstler in Italien, Heide 2009, S. 288, Abb. 166.

von Alt (1812-1905, Wien)
6701 Der Tempel der Vesta auf dem Forum Boarium in Rom.
Aquarell und vereinzelt Gouache auf Velin. 34,8 x 50,2 cm. Unten links signiert „R Alt“ und unten rechts in brauner Feder datiert und bez. „Rom Jänner (1)865 / T. d Vesta“ (letzte Ziffer undeutlich, vor dem Wort „Jänner“ in Bleistift später hinzugefügt „5t“ und die letzte Ziffer der Jahreszahl mit Bleistift überschrieben „6“), verso in schwarzer Feder bez. „No-130“.
18.000 €
Seit den 1830er Jahren bereiste Rudolf von Alt mehrfach Italien. Den Vestatempel auf dem Forum Boarium, den alten Rindermarkt, wählte der Künstler gleich mehrfach als Motiv für seine Aquarelle und Gemälde. Der im südlichen Licht erstrahlende Tempel vor blauem Himmel erscheint hier an einer verlassenen Straße mit römischem Pflaster. Lediglich an einem Brunnen und auf den Stufen des Tempels verweilen einige Menschen. Hierin unterscheidet sich das vorliegende Aquarell von den gemalten Fassungen im Belvedere in Wien (Inv. 3800) und im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (Gal.-Nr. 2469), die im Vordergrund ein Ochsengespann und auch weiteres Vieh zeigen. Auch in einem undatierten Aquarell (angeboten 2003 im Dorotheum und 2019 im Kinsky) bestimmen Ziegen und Ochsen den Vordergrund. Nicht abgelenkt durch erzählerische Details liegt der Reiz dieses Aquarells in seinem einzigartigen Kolorit und der Schilderung südlicher Atmosphäre.

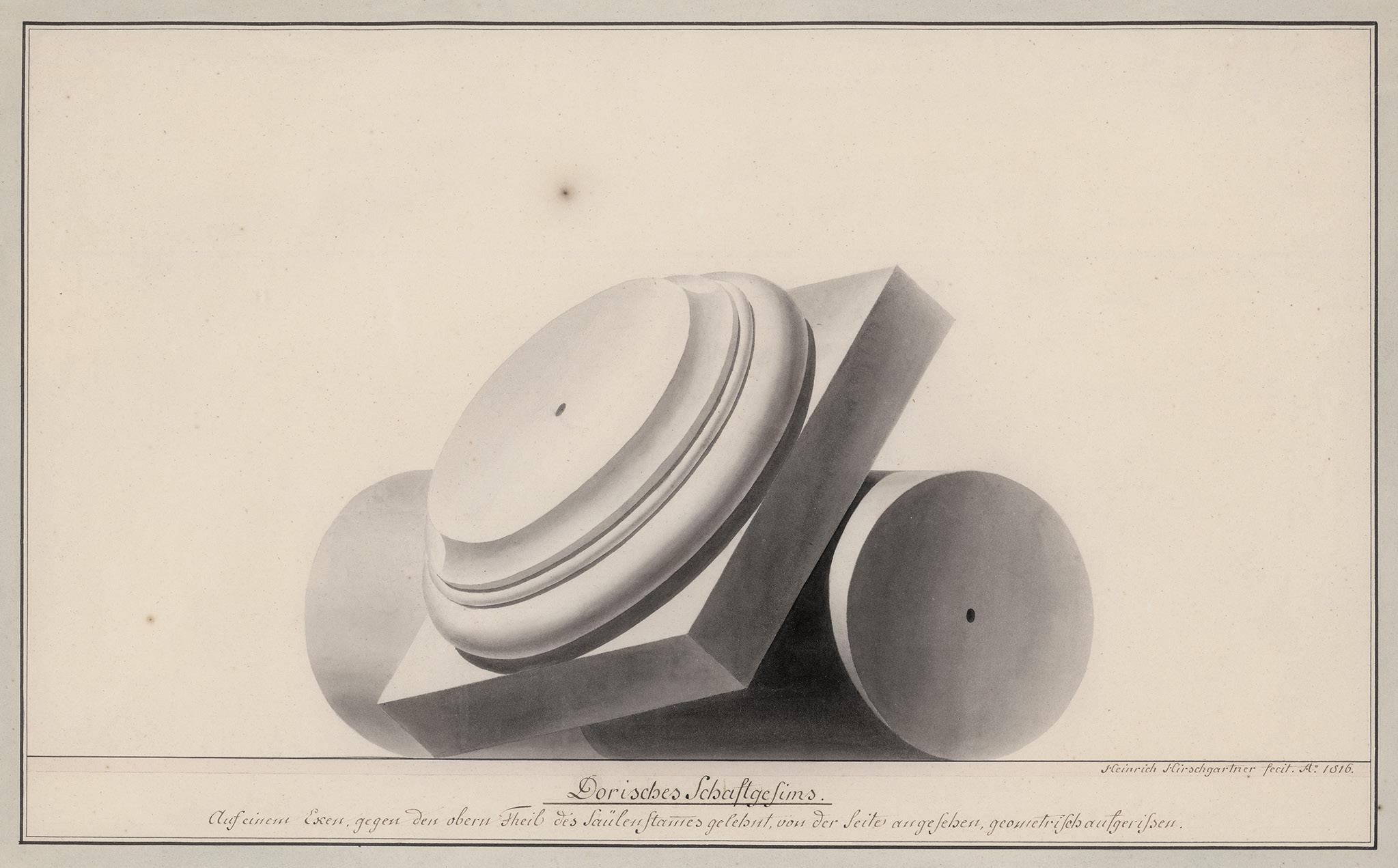

6704
Luigi Garelli
(ca. 1838–1881 tätig in Rom)
6702 Der Reinigungseid Leos III.; Krönung Karls des Großen; Taufe Konstantins: nach den Fresken Raphaels in den Vatikanischen Stanzen.
3 Zeichnungen, je Bleistift, Feder in Grau, grau laviert. 49,7 x 49,1 cm bis 52,2 x 69,2 cm. Der Reinigungseid Leos III. unten links signiert und datiert „Luigi Garelli dis. 1862“.
600 €
Luigi Garelli war in Rom vornehmlich als Zeichner tätig und lieferte unter anderem Stichvorlagen zu der von Pietro de Brognoli 1874 herausgegebenen Serie nach Raffaels Stanzen und Teppichen im Vatikan (vgl. Corinna Höper: Raffael und die Folgen, Stuttgart 2001, F 17.2).
Heinrich Hirschgartner (tätig um 1816)
6703 Architekturfragmente: Dorisches Schaftgesims. Pinsel in Grau. 26 x 40 cm. Unterhalb der Darstellung signiert und datiert „Heinrich Hirschgartner fecit. Ao 1816“ sowie eigenh. annotiert.
400 €
Cesare Provaggi
(tätig in Italien, 2. Hälfte 19. Jh. )
6704 Raffael die Madonna zeichnend in seinem Atelier im Vatikan.
Aquarell, aufgezogen und hinter ein Passepartout montiert. 34,3 x 19,5 cm. Unten links signiert „Provaggi“. 1.200 €



Schweizerisch
6705 um 1870. Der Parthenon auf der Akropolis. Aquarell über Bleistift, auf Aquarellpapier. 50,4 x 71,7 cm.
1.500 €
Ludwig Thiersch (1825–1909, München)
6706 Die Akropolis in Athen. Bleistift auf gelblichem Papier. 22,7 x 43,7 cm. Unten links bezeichnet und datiert „Athen, den 9. Sept. 1852“.
750 €
Amadeo Preziosi (1816 Valletta, Malta – 1882 Istanbul)
6707 Drei osmanische Krieger vor der Kulisse Istanbuls. Aquarell über Bleistift auf Velin. 26,2 x 18,2 cm. Unten signiert „Preziosi“.
1.800 €



Eugène Delacroix (1798 Charenton-Saint-Maurice – 1863 Paris)
6708 Schlafender Mann am Ufer. Grauer Stift. 6,6 x 10,5 cm.
1.200 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (mit dem roten Monogrammstempel Lugt 838a).
Dessen Nachlassauktion im Hôtel Drouot, Paris, 17.-27. Februar 1864. Deutsche Privatsammlung. Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre im Kunsthandel erworben. Seitdem in Familienbesitz.
William Callow (1812 Greenwich – 1908 Great Missenden, Buckinghamshire)
6709 Ankernde Handelsschiffe.
Aquarell und Gouache. 18 x 26 cm. Unten rechts signiert und datiert „W. Callow 1853“.
800 €
Johann August Krafft (1798 Altona – 1829 Rom)
6710 Ivanhoe: Der Schweinehirt Gurth und der Narr Wamba.
Bleistift, Pinsel in Graubraun, auf hellgrau grundiertem Papier, auf fester Pappe kaschiert. 27 x 20,8 cm. Unten mittig signiert „Kraft fecit“, verso auf dem Untersatz (eigenh. ?) in dänischer Sprache bezeichnet „Swinehyrten Gurth og Narren Wamba efter Walter Scotts Roman Ivanhoe / August Krafft fec.“.
600 €
Vermutlich bald nach dem Erscheinen von Walter Scotts Roman im Jahr 1820 entstanden, an dessen Vorlage die Darstellung sich eng hält.

David Cox I (1783 Birmingham – 1859 Harbourne bei Birmingham)
6711 Baumbestandene Gebirgslandschaft mit Reisenden. Aquarell über schwarzer Kreide auf bläulichem Velin. 27 x 23,3 cm.
600 €
Englisch
6712 19. Jh. Mittelalterliche Burgruine an der Küste Schottlands.
Gouache auf dünnem Karton. 24,5 x 40,7 cm.
400 €
John Linnell (1792 Bloomsbury, London – 1882 Redhill)
6713 Angler an einem Fluss. Aquarell über Spuren von schwarzem Stift, auf Velin, auf festen Untersatzkarton kaschiert. 23,6 x 35,4 cm. Unten links in brauner Feder signiert „J. Linnell fct.“.
750 €




Christian Vilhelm Nielsen (1833–1910, Kopenhagen)
6714 Sechs historische Ansichten aus Kopenhagen. 6 Zeichnungen, je Aquarell und Feder in Grau über schwarzem Stift. Je ca. 22 x 36,5 cm bzw. 36,5 x 22 cm. Sämtlich unten rechts monogrammiert „CN“, zwei zusätzlich datiert „1907“ bzw. „[190]7“, und jeweils unten links in Rot nummeriert 1.-6.
1.200 €
Verschiedene Ansichten von Stadtplätzen und historischen Bauwerken in Kopenhagen, oft in dem typischen Klinkerbau-Stil, die Schlussblätter zeigen das Rathaus und den Caritasbrunnen auf dem Gammeltorv.

6715 Seitenansicht von Frederiksborg; Blick auf die Marmorbrücke.
2 Aquarelle mit Feder in Grau über schwarzem Stift.
Je ca. 36,5 x 22 cm.
450 €

Lorenz Ritter (1832–1921, Nürnberg)
6716 Blick in die Bibliothek des Roten Rathauses in Berlin.
Aquarell. 23 x 37 cm. Am Unterrand signiert und datiert „L. Ritter 1870“.
2.400 €
Die Bibliothek für den Magistrat der Stadt Berlin ist nach dem Vorbild des Palazzo Pubblico in Siena gestaltet. Der Charme des Raumes gründet sich insbesondere auf die drei Reihen von Säulen und Pfeilern, die das elegante, farbig fein gestaltete Kreuzgewölbe tragen. Im zweiten Weltkrieg zerstört, verlor der Raum seine ursprüngliche Funktion und wurde im Rahmen des Wiederaufbaus zum sogenannten Säulensaal umgestaltet.
Friedrich Jentzen (1804 Berlin – 1875 Weimar)
6717 Bildnis des Berliner Weinhändlers Louis Drucker (um 1801-1860).
Öl auf Leinwand, auf Karton kaschiert. 15 x 9,5 cm. Verso auf dem Rückdeckel in Bleistift von alter Hand bez. „Louis Drucker von Jentzen gemalt“, ferner mit montiertem Zettel mit handschriftl. Annotation von Dr. Ernst Küttner und einem weiteren Etikett mit Angaben zu dem Werk.
600 €
Provenienz: Sammlung Dr. Ernst Wolfgang Küttner, Berlin. „Louis Drucker war seiner Zeit in Berlin ein stadtbekannter Restaurateur, wie die Gastronomen im 19. Jahrhundert hießen. Er glänzte durch
originelle Veranstaltungen in seinen Etablissements, für die er mit amüsanten Annoncen - offensichtlich nicht ohne Erfolg - warb. Sie waren so spaßig und dabei wortgewaltig, dass sie nicht selten mit entsprechender zeitlicher Verzögerung auch in anderen Zeitungen des deutschen Sprachraumes aufgegriffen wurden, natürlich nun ohne Werbeeffekt, denn die angepriesene Veranstaltung war längst vorbei.“ (Hans-Jürgen Paech: Zum Leben und Wirken des vergnügten Weinhändlers Louis Drucker, Potsdam 2016).
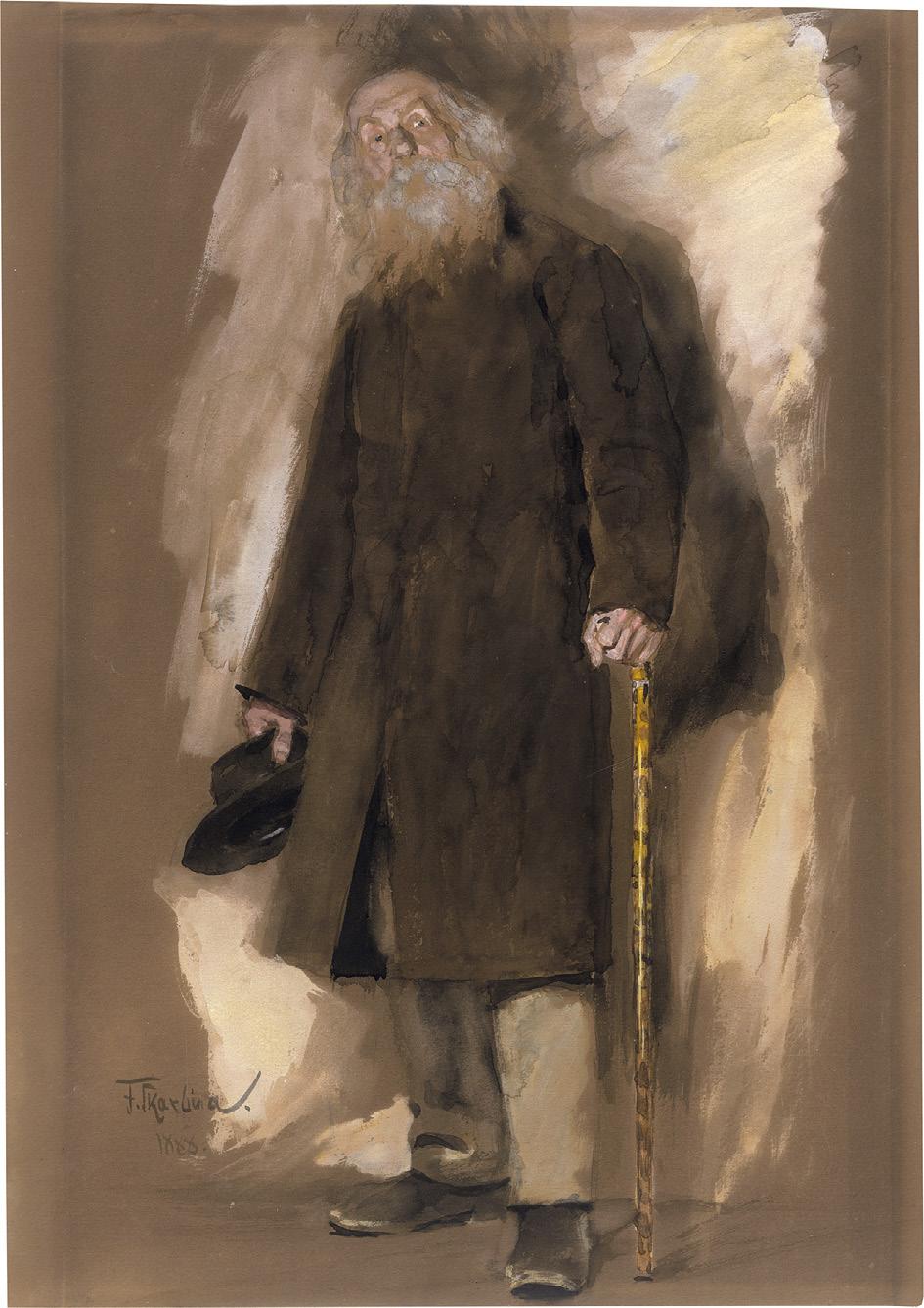

Franz Skarbina (1849–1910, Berlin)
6718 Stehender Mann im Mantel mit Hut und Gehstock.
Aquarell und Deckfarben auf braunem Papier. 40,2 x 28,4 cm. Unten links signiert und datiert „F. Skarbina 1888“.
750 €
Literatur: Margit Bröhan: Franz Skarbina, Ausst.-Kat. Bröhan Museum, Berlin 1995, Abb. S. 124.
Beigegeben von Franz Skarbina eine signierte und datierte Bleistiftzeichnung „Mann, sich einen Mantel anziehend“ (32,5 x 23,5 cm Passepartoutausschnitt) von 1891. 6718

Adolph von Menzel (1815 Breslau – 1905 Berlin)
6719 Frau im Korsett, den Kopf geneigt. Zimmermannsbleistift, gewischt. 18,7 x 12 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „AM [18]96“. 4.000 €
Literatur: Adolph Menzel. Gemälde und Zeichnungen, Ausst. Kat. Erlangen 1971, Kat. 134 (ohne Abb.).
Heidi Ebertshäuser: Adolph von Menzel. Das graphische Werk, München 1976, Bd. 2, S. 1345, mit Abb.
Jens Christian Jensen (Hrsg.): Adolph Menzel. Realist - Historist - Maler des Hofes. Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung Georg Schäfer, Ausst.Kat. Kiel, Bremen u.a., Schweinfurt 1981, Kat. 56, mit Abb. Ders. u.a. (Hrsg.): Von Wilhelm Leibl bis Lovis Corinth. Pastelle, Aquarelle und Zeichnungen 1865-1925 aus der Sammlung Georg Schäfer in Schweinfurt, Ausst. Kat. Schweinfurt, Nürnberg u.a., Schweinfurt 1983, Kat. 38, Abb. S. 88.
Ders. (Hrsg.): Adolph Menzel. Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen im Museum Georg Schäfer, Schweinfurt, München 1998 (2. Aufl. München 2000), Kat. 114.
Ausstellung: Altes Rathaus Erlangen 1971, Adolph Menzel. Gemälde und Zeichnungen
Kunsthalle Kiel, Kunsthalle Bremen u.a. 1981-82, Adolph Menzel. RealistHistorist - Maler des Hofes. Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung Georg Schäfer[...]
Altes Rathaus der Stadt Schweinfurt, Germanisches Nationalmuseum u.a. 1983-84,Von Wilhelm Leibl bis Lovis Corinth. Pastelle, Aquarelle und Zeichnungen 1865-1925 aus der Sammlung Georg Schäfer in Schweinfurt
Provenienz: Sammlung Otto Hermann Claass, Königsberg.
Dessen Auktion bei Hugo Helbing, München / Kunstsalon Paul Cassirer, Berlin, in München am 21. November 1916, Los 226 (mit Abb., „Weiblicher Halbakt. Italienerin“).
Sammlung Dr. Georg Schäfer, Schweinfurt, Inv.-Nr. MGS 145A (erworben bei Karl & Faber, München, außerhalb der Auktion vom 16. Mai 1953).
Privatsammlung München.

6720 Rückenansicht eines Mannes mit Schriftstück. Zimmermannsbleistift, partiell gewischt, aufgezogen. 18,3 x 11,7 cm. Unten rechts mit Bleistift signiert „A. Menzel“.
6.000 €
In einfallsreicher Reduktion zeigt Menzel hier einen Mann in Rückenansicht, der in einer flüchtig wirkenden Geste einige Blätter hinter dem Rücken hält. Die souveräne Linienführung und das virtuose Spiel mit
Licht und Textur sind typisch für Menzels zeichnerische Manier, die selbst alltägliche Momente mit großer Eindringlichkeit erfasst. Die Wahl der Rückenansicht ist ein wiederkehrendes Motiv in seinen Skizzenbüchern - sie schafft eine geheimnisvolle Distanz und macht den Betrachter zum verborgenen Beobachter. Einen besonderen Reiz entfaltet die Komposition durch Menzels Nutzung der gesamten Höhe und Breite des Skizzenbuchblattes: Die Figur scheint aus dem Bildraum herauszuwachsen, als wäre sie nur zufällig vom Blatt eingefangen. Ein Kunstgriff, den Menzel häufig einsetzt, um Spontaneität und Unmittelbarkeit zu erzeugen.

Französisch
6721 19. Jh. Kleiner Salon im Stil Napoléon III. mit Blick in einen Wintergarten. Aquarell. 27,8 x 38,5 cm (Passepartoutausschnitt). Unten rechts signiert „F. Leroy“.
2.400 €
Das detailreiche Interieur gewährt einen Einblick in die Wohnkultur des gehobenen Bürgertums zur Zeit der Restauration. Die Fenster eröffnen den Blick ins Grüne, der Morgenmantel über der Récamière sowie die ungemachte Decke auf dem Sessel, vermitteln eine stille, friedvolle Atmosphäre, in Abwesenheit der Hausbewohner - ein Schauplatz des alltäglichen Lebens. Die persönlichen Gegenstände verdeutlichen dies: Auf den Tischen liegen Papiere verstreut, in einer Vitrine oberhalb des Schreibpults ist eine kleine Sammlung venezianischen Glases ausgestellt und zahlreiche Porträts schmücken die Wand über dem Schreibtisch - neben der Glastür ist ein Bildnis von Isabella Farnese zu erkennen. - Gerahmt beschrieben.
Franz Leo Ruben (1842 Prag – 1920 München)
6722 Die Villa Melzi in Bellagio am Comer See. Aquarell über Bleistift. 24,6 x 33,9 cm. Unten rechts bezeichnet und datiert in Bleistift „Villa Melzi. August 187[?], verso links oben in brauner Tinte bezeichnet „48Franz Ruben / Villa Molzi / Aquarell“ und links unten in Bleistift „Villa Melzi am Como see / von Ruben junior“. 400 €
Provenienz: Karl & Faber, München, Auktion am 8. Juni 1993, Los 385. Nach seiner Ausbildung von 1859 bis 1867 an der Akademie der bildenden Künste in Wien lebte Franz Ruben von 1868 bis 1874 zunächst in Rom, wo er Mitglied des Deutschen Künstlervereins war, und anschließend bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Venedig, wo er zum Ehrenmitglied der Kunstakademie ernannt wurde. Die klassizistische Villa Melzi wurde im Auftrag von Francesco Melzi d’Eril, dem Vizepräsidenten der von Napoleon gegründeten Italienischen Republik (18021805), in den Jahren 1808-1810 vom Architekten Giocondo Albertolli erbaut. Sie liegt inmitten einer beeindruckenden Gartenanlage am Eingang von Bellagio direkt am Comer See. Der Garten wurde von Luigi Canonica und Luigi Villoresi gestaltet. Stendhal hat viele Seiten über die Villa geschrieben und Franz Liszt war dort komponierender Gast.

6723 Umkreis. Elegante Dame im Lehnsessel. Graphit und Rötel, aufgezogen. 71 x 59,5 cm. Unten rechts in Graphit bez. „John S. Sargent“.


Jules Chéret
(1836 Paris – 1932 Nizza)
6724 „Cherette“ (Junge Frau im Korsagenkleid). Rötel, weiß gehöht, auf grünem Papier. 29,6 x 18,2 cm. Mittig rechts signiert „JCheret“.
800 €
Der Maler und Lithograf Jules Chéret gilt als Vater des modernen Plakats der Belle Époque. Im Alter von dreizehn Jahren begann er eine dreijährige Lehre bei einem Lithografen, von 1859 bis 1866 schloss er diese Ausbildung in London ab. Zurück in Frankreich schuf Chéret lebendige Plakatwerbung für Kabaretts, Musikhallen und Theater wie das Eldorado, das Olympia, die Folies Bergère, das Théâtre de l‘Opéra, das Alcazar d‘Été und das Moulin Rouge, außerdem arbeitete er für die satirische Wochenzeitung Le Courrier français. Aufgrund seiner freizügig dargestellten Frauen galt er manchen Kritikern auch als „Vater der Frauenbewegung“. Bis dahin waren Frauen in der Kunst meistens entweder als Prostituierte oder als puritanisch dargestellt worden. Die Frauen auf Chérets Plakaten, fröhlich, elegant und lebhaft - im Volksmund nach ihm „Cherettes“ genannt - waren weder das eine noch das andere. Das war befreiend und läutete eine deutlich offenere Atmosphäre in Paris ein, in der Frauen sich zuvor tabuisierten Aktivitäten wie dem Tragen tief ausgeschnittener Mieder und dem Rauchen in der Öffentlichkeit hingeben konnten.
Französisch
6725 19. Jh. Tanzende Vestalin. Feder in Braun auf festem Velin. 17,7 x 12,4 cm.
600 €

6725

Henri Joseph Harpignies (1819 Valenciennes – 1916 Saint-Privé)
6726 Kleines Dickicht. Pinsel in Grau auf festem Velin. 15,2 x 22,8 cm. Unten rechts signiert „H. Harpignies“ sowie mit eigenh. Widmung „au bon Albert Gauthereau“.
450 €
Beigegeben von demselben eine signierte Landschaftszeichnung in schwarzer Kreide auf blauem Papier bezeichnet „Ariccia 1857“ (29,3 x 44,5 cm).

Max Klinger
(1857 Leipzig – 1920 Großjena b. Naumburg)
6727 Der Gondoliere und das Mädchen.
Feder in Schwarz, grau laviert. 19,4 x 11,2 cm. Unten links auf der Seitenwand des Bootes signiert „Max Klinger“. Anfang 1880er Jahre.
2.400 €
Literatur: Ausst. Kat. Deutsche Zeichenkunst aus zwei Jahrhunderten, 1760-1960. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus der Sammlung W. B., Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 1967, Nr. 54.
Provenienz: Karl & Faber, München, Auktion 87, 1963, Los 706.
Ein Gondoliere mit von der Sonne gegerbter Haut und eine in ein schwarzes Cape gehüllte Frau mit Spitzenschleier im Haar stehen, einander zugewandt, auf einem Steg. Hinter ihnen liegt das Meer mit spiegelglatter Oberfläche, über dem messerscharf gezogenen Horizont spannt sich ein vollkommen gleichförmiger, wolkenloser Himmel. Direkt am Steg liegt die Gondel. Es ist eine der rätselhaften Zeichnungen Klingers, deren Inhalt sich dem Betrachter nicht so recht erschließen mag. Man darf vermuten, dass sich hinter der Begegnung der beiden Protagonisten mehr verbirgt. Gerade das Unergründliche macht den Reiz dieser mit filigranem Strich ausgeführten Komposition aus. Sie berührt den Bereich des Traumhaften, wo die Übergänge des Realen zum Imaginierten
fließend sind. Thematisch steht die Zeichnung in Verbindung mit Klingers Gemälde „Spanischer Gondelführer“ aus dem Jahr 1881, das sich im Museum der bildenden Künste in Leipzig befindet. Obwohl Klinger erst im Jahr 1907 nach Madrid reiste, so dokumentiert dieses Werk doch das Interesse des Künstlers an Spanien, womit er einem allgemeinen Trend in Mitteleuropa folgt. Obwohl man um 1880 von spanischer Kunst noch wenig wußte, so gehörte Goya und dessen graphisches Werk zum festen Bildrepertoire europäischer Künstler. Für Klinger war Goya eines seiner wichtigsten Vorbilder, und dessen Caprichos lieferten ihm wichtige Impulse für seine eigenen graphischen Folgen. Auch die vorliegende Zeichnung ist ohne die ikonische Radierfolge Goyas nicht denkbar.
6728 zugeschrieben. Uhu im Sturzflug.
Bleistift auf festem strukturiertem Papier. 10,5 x 6,6 cm. Unten links bez. (signiert?) „KLINGER“.
900 €
Expressive Zeichnung, die in ihrem kraftvollen Ausdruck den Raubvogel mit seinem weichem Gefieder detailreich erfasst.



6729, Beigabe
Walter Julius Hammer
(1873 Dresden – 1922 Leipzig)
6729 Bildnis Max Klinger. Rote und weiße Kreide, rot laviert, in Bleistift quadriert, auf Bütten, verso: Sitzender Frauenakt in schwarzer Kreide. 63 x 47 cm. Verso signiert „WHammer“. Um 1913. 750 €
Die Zeichnung entstand in Vorbereitung zu einer der vier humorigen Radierungen, die Hammer nach 1913 von Max Klinger herstellte. Beigegeben von demselben die Vorzeichnung in Rötel zur Radierung „Max Klinger, blinzelnd“ (vgl. Bassenge Auktion A123 am 3. Juni 2024, Los 6436), bezeichnet, signiert und datiert „Klinger 1913 / W Hammer“, verso mit einer signierten Aktstudie in schwarzer Kreide.

6730
Max Seliger (1865 Bublitz/Pommern – 1920 Leipzig)
6731 „ΗΔΙΟΣ ΠΑΝΤΟΦΥΗΣ“: Der überall gewachsene, alles Hervorbringende. Feder in Schwarz über Bleistift, weiß gehöht, aufgezogen. 29,3 x 17,2 cm. In der Darstellung oben monogrammiert und datiert „18MS05“ und unten in griechischen Buchstaben bezeichnet „ΗΔΙΟΣ ΠΑΝΤΟΦΥΗΣ“.
400 €
Zeichnungen des 19. Jahrhunderts
Sascha Schneider (eigentlich Alexander, 1870 St. Petersburg – 1927 Swinemünde)
6730 Stehender männlicher Akt. Bleistift und schwarze Kreide, weiß gehöht auf grünlichem Velin. 45,6 x 31 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „S.S.[19]03“.
800 €
Die Zeichnung ist eine Vorstudie zu der ausgearbeiteten Zeichnung „Der Außergewöhnliche“ von 1903 (Staatliche Klassik Stiftung Weimar, Inv. KK11617; siehe Christiane Starck: Sascha Schneider: ein Künstler des deutschen Symbolismus, Marburg 2016, S. 227ff., vgl. Z074). Wir danken Frau Dr. Christiane Starck für ihren Hinweis.

6731

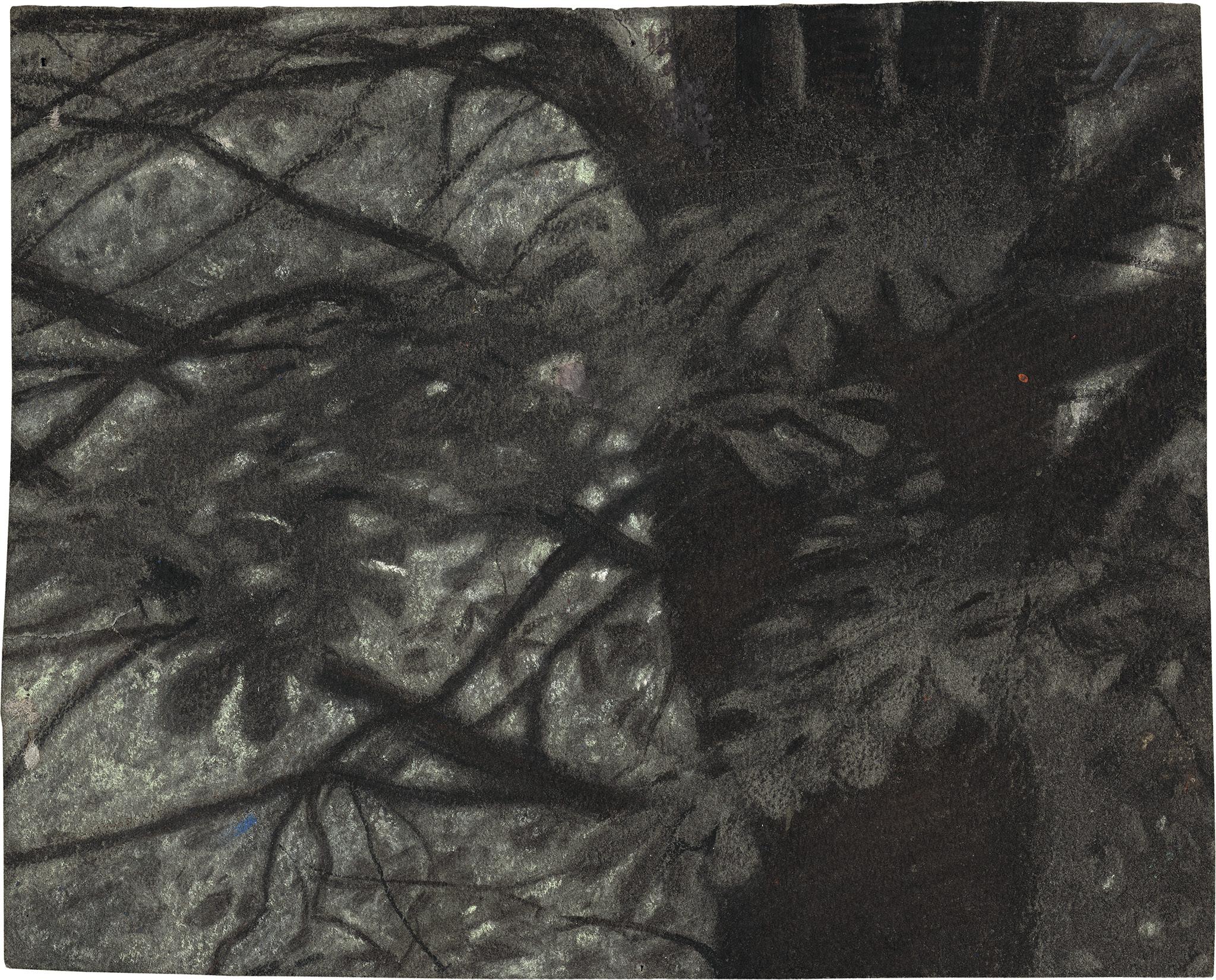
Paul Grabwinkler (1880–1946, Wien)
6732 Junge Frau mit goldgewirkter Haube und Korallenkette.
Aquarell und Gouache. 32,5 x 23,9 cm. Oben links monogrammiert „P. G“, verso Nummernetikette.
1.500 €
Walter Julius Hammer (1873 Dresden – 1922 Leipzig)
6733 Kastanienbaum. Schwarze und weiße Kreide auf blaugrünem Papier. 11,5 x 14,5 cm.
400 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (mit dem Nachlassstempel verso).

Italienisch

6734 1928. Politeama Rossetti: Entwurf für die malerische Dekoration des Atriums des Theaters in Triest. Aquarell und Gouache über brauner Feder auf FabrianoVelin. 50 x 67 cm. Eigenh. bez. und unten undeutlich signiert „Prof. Arch. U Nani“ (?), in Bleistift bez. „1928“. Wz. „PM Fabriano“.
900 €
Eugen Pflaumer (geb. 1876)
6735 Entwürfe für einen filigranen Anhänger mit herzförmigen Blättern und Blüten, aus Silber und Halbedelsteinen (Malachit).
Schwarze Feder und farbige Stifte auf kariertem Papier. 16,9 x 10 cm. Monogrammiert und datiert „1914“.
350 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Privatbesitz Wien.
Beigegeben ein weiterer Schmuckentwurf des Künstlers mit quadratischen Broschen im Stil der Wiener Werkstätte.
Deutsch
6736 um 1900. Elegie. Pinsel in Braun, weiß gehöht, über Spuren von schwarzer Kreide, auf grün-grauem Velin. 51 x 32 cm.
450 €
Abbildung Seite 191
Deutsch
6737 um 1910. An der Küste von Nervi. Aquarell und Gouache über Bleistift auf dünnem Karton. 54,8 x 35 cm. Unten links bezeichnet „Nervi“.
600 €
Beigegeben von demselben Künstler eine Illustration zur Oper „Marino Falieri“ sowie von einem Monogrammisten CW eine „Hafenszene“, verso mit einer Zuschreibung an William Callow.
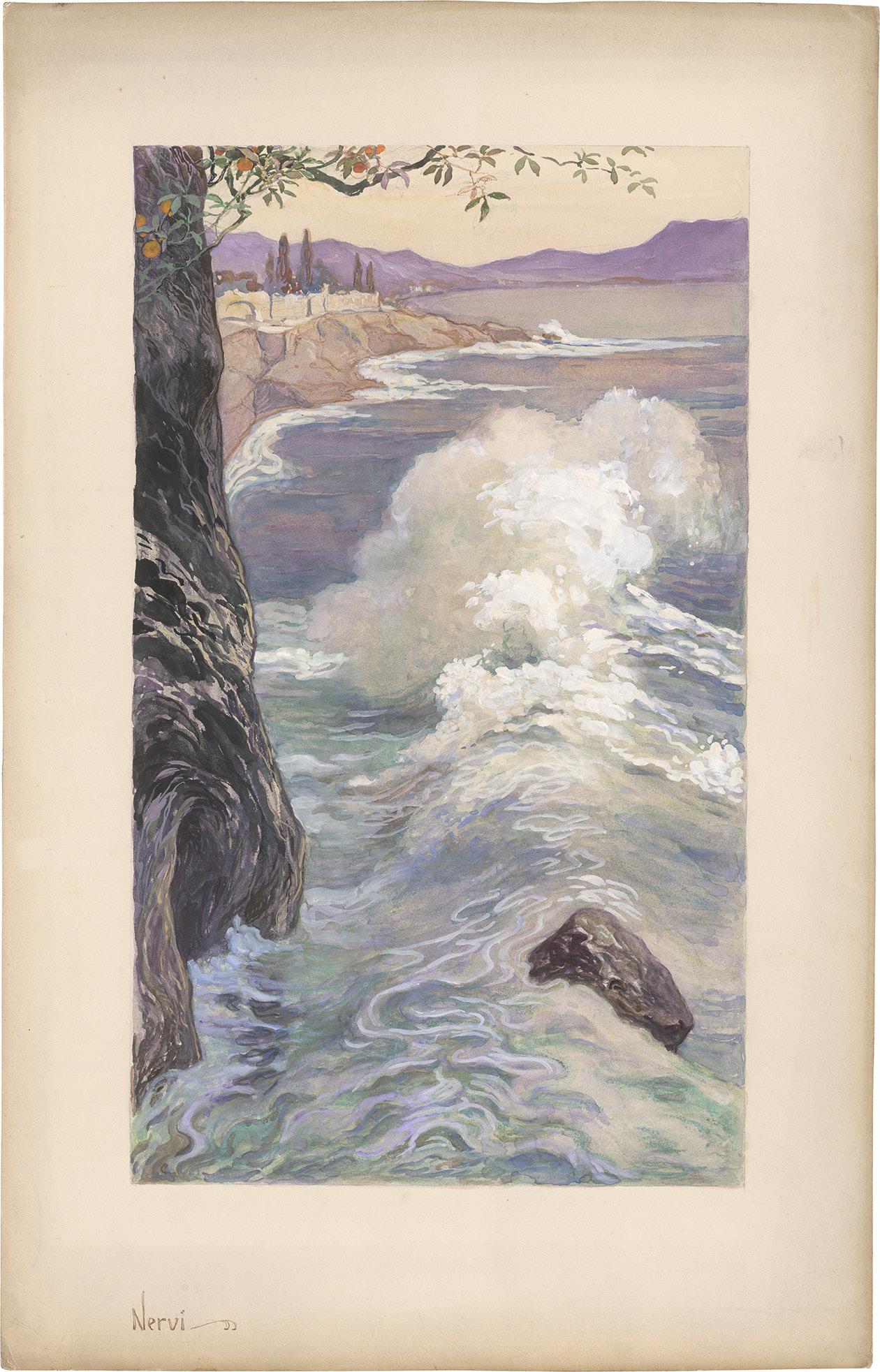



Alexander Otto Stichart (1838 Werdau bei Zwickau – 1896 Jöhstadt)
6738 Die Geschichte vom Einsiedler und dem Satyrknaben.
7 Aquarelle auf festem Velin. 26,6-29,6 x 18,7-28,4 cm. Ein Blatt signiert „Al. Stichart“. Um 1893.
1.800 €
In sieben Blättern illustriert Stichart die Geschichte eines Einsiedlers, der sich eines verwaisten Satyrknaben annimmt, ihn aufzieht, unterrichtet und anschließend wieder verstößt, als sich der herangewachsene Satyr in eine Satyrdame verliebt. Im letzten Bild der Folge kehrt der Satyr nun mit seiner Familie zurück und dankt dem Einsiedler mit Geschenken. Offenbar waren die Blätter Vorzeichnungen für Graphiken. Das Kupferstichkabinett Dresden besitzt eine Gouache mit der Darstellung, bei der der Mönch dem Knaben das Beten lehren möchte. Dieses Motiv erschien auch als Graphik bei den Sächsischen Kunstvereinsblättern mit dem Titel „Frommer Wunsch“.

Alexander Rothaug (1870–1946, Wien)
6739 Skizzen und Kompositionsentwürfe zu Mythologien und Historien.
6 doppelseitig bezeichnete Seiten aus einem Skizzenbuch, Bleistift, Feder in Braun und Aquarell. 22 x 31,5 cm (Maße einer Doppelseite). Mit zahlreichen eigenh. Annotationen.
750 €
Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.
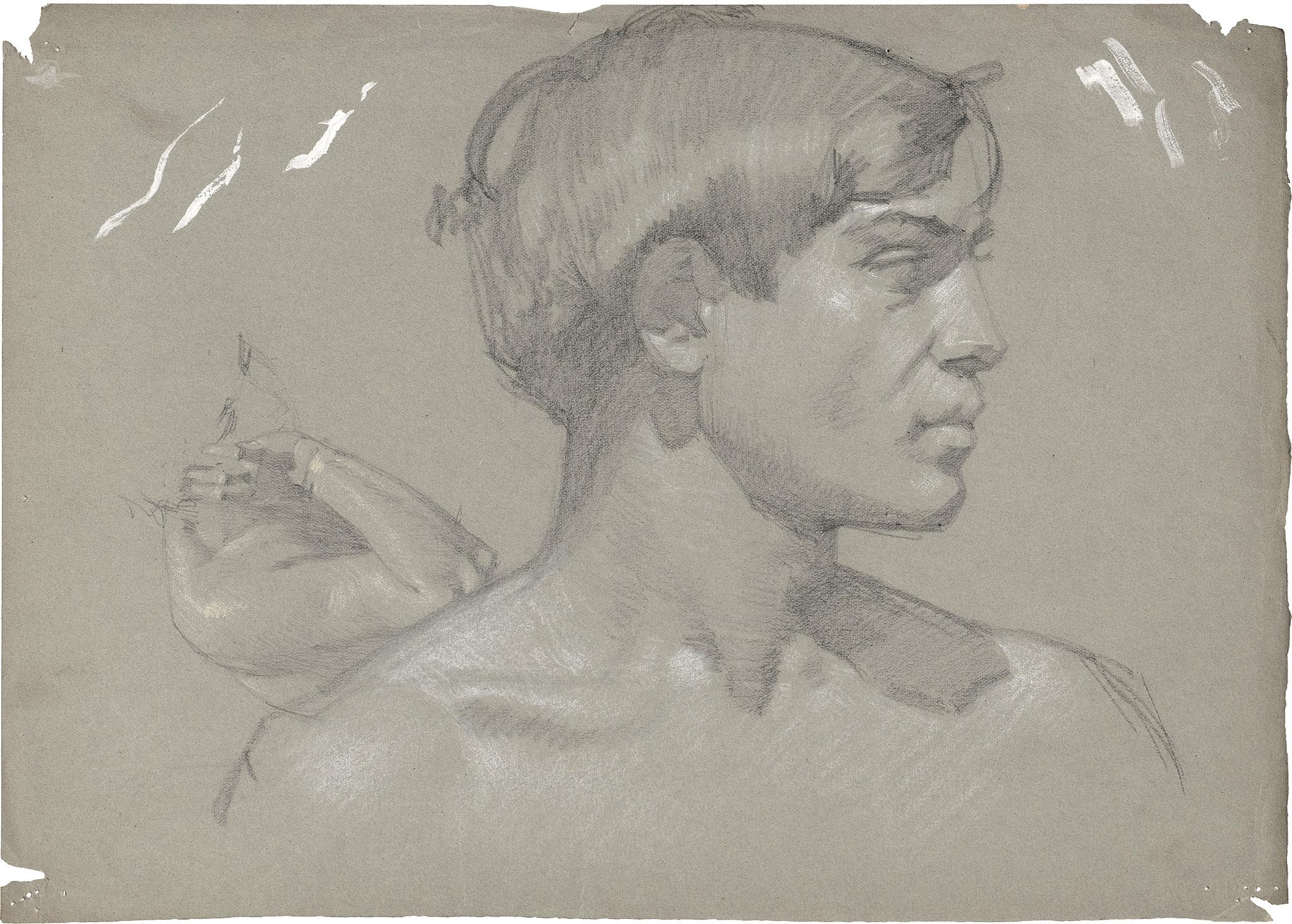


Alexander Rothaug
6740 Bildnis eines Jünglings im Profil. Schwarze und weiße Kreide auf grau-grünem Velin. 23,4 x 32,7 cm. Mit eigenh. Farbproben.
600 €
Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.
Beigegeben zwei weitere Studienblätter des Künstlers.
6741 Studienblatt mit Kinderköpfen. Schwarze und weiße Kreide auf grau-grünem Velin.
32,4 x 25,3 cm.
600 €
Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.
Beigegeben zwei weitere Zeichnungen des Künstlers „Studienblatt mit tanzendem Knaben“ und „Studienblatt mit Armen“.
Alexander Rothaug
6742 Pan mit Flöte im Seerosenteich. Feder in Schwarz, Bleistift und farbige Kreiden, verso: Fragment einer weiteren Zeichnung und Annotationen des Künstlers. 9,5 x 16,5 cm.
1.200 €
Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien. Auf einem Steinblock inmitten des von Schilf umstandenen Teiches sitzt der Hirtengott, in drei Rohrstücke blasend. Die haarscharfen Linien der spitz geschnittenen Feder verleihen der Zeichnung einen luftigen, flirrenden Charakter und lassen das Klingen der Flötentöne im Schilfgras und in den zitternden Reflexen auf dem Wasser nahezu sichtbar werden. Ovids Metamorphosen zufolge weist die Najade Syrinx, keusche Anhängerin der jungfräulichen Artemis, die Liebe des Hirtengottes Pan zurück und wird auf der Flucht vor seinen Nachstellungen auf ihr Bitten hin am Fluss Ladon in Schilfrohr verwandelt. Als der Atem des verschmähten Gottes durch das Schilf streicht, entsteht ein ergreifender Klang. Pan schneidet daraufhin Schilfrohr, verklebt die Stücke mit Wachs und baut so die Syrinx genannte Hirtenflöte (Panflöte), um darauf seine Lieder zu spielen.
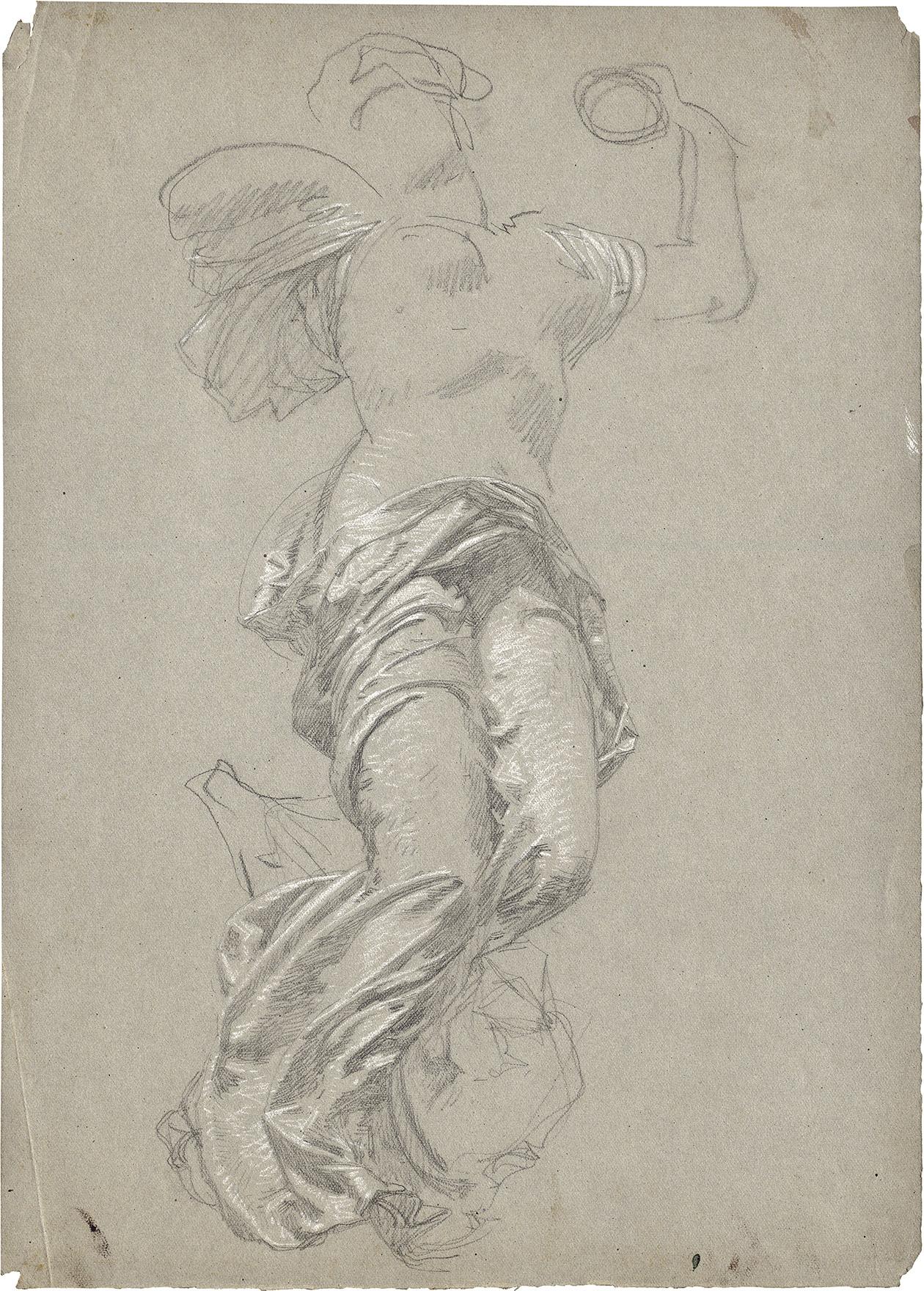

Alexander Rothaug
6743 Tanzende mit Zimbal.
Graue und weiße Kreide auf grau-grünem Velin.
32,6 x 23,4 cm.
750 €
Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.
Beigegeben zwei weitere Studien des Künstlers „Weiblicher Akt“ (mit eigenh. Farbproben) und „Draperiestudien“.
6744 Studienblatt mit weiblicher Figur im antiken
Gewand und Armstudie.
Graue und weiße Kreide, Feder in Schwarz und Spuren von Rötel auf grau-grünem Velin. 32,5 x 23,5 cm. Mit vereinzelten Farbproben.
750 €
Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.
Beigegeben zwei weitere Studien des Künstlers „Stehender männlicher Akt mit Schurz“ und „Studienblatt mit fünf männlichen Akten“.
6745 Felsige Küste im Sonnenlicht.
Tempera auf Karton. 19,5 x 26,2 cm.
600 €
Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.
Heitere, sonnendurchflutete Landschaftsszenerie, mit großzügigem Duktus zügig und sicher gestaltet. In harmonischem, reduziertem Kolorit von Gelbbraun- und Grüntönen lasiert Rothaug die Felsformationen und verleiht ihnen Kontur mit den sparsam eingesetzten Farbakzenten der Vegetation. Souverän erfasst der Künstler die unterschiedlichen Texturen, die Rauheit des Steinmassivs und das schimmernde Wasser. Geschlossenheit erhält die Komposition durch die dunkle, gezeichnete Einfassungslinie. Diese ist charakteristisch für Rothaugs Temperazeichnungen, die er oft auf ebensolchen bereits farbig vorgrundierten festen Malpappen anfertigt.
Leopold Rothaug (1868–1959, Wien)
6746 Spätsommer im Wienerwald.
Aquarell und Gouache, Feder in Braun über Spuren von Graphit. 31,4 x 38,4 cm. Unten rechts signiert und datiert „Leop. Rothaug Sept. 1948“.
400 €
Provenienz: Sammlung Prof. Ernst Fuchs, Wien.
Beigegeben von demselben ein weiteres Aquarell „Kleine Kapelle im Wald mit Reh“ (signiert und datiert „Leop. Rothaug 1. December 1927“).



Emil Pirchan (1884 Brno – 1957 Wien)
6747 Komposition in Violett, Rot, Grün und Gelb. Wasserfarben aufgebracht im Tunkpapierverfahren (Marmoriertechnik) auf Bütten. 29,1 x 21,2 cm. Um 1906/07.
2.400 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Privatsammlung Wien.

6748 Komposition in Blassblau, Lila und Korallenrot. Wasserfarben aufgebracht im Tunkpapierverfahren (Marmoriertechnik) auf Bütten. 15,7 x 27,3 cm. Um 1906/07.
3.000 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Privatsammlung Wien.
Der Maler, Gebrauchsgraphiker, Architekt, Bühnenbildner und Schriftsteller Emil Pirchan wurde 2019 im Museum Folkwang, Essen durch eine Ausstellung wiederentdeckt, die anschließend im Leopold Museum in Wien zu sehen war. Als besondere Überraschung der Ausstellung galten die Tunkpapiere des Künstlers. Sie sind eng mit „Wien um 1900“ verbunden, wo der aus Brünn gebürtige Künstler ab 1903 Meisterschüler des berühmten Architekten Otto Wagner wird. Mit der pulsierenden Künstlerszene im Herzen der österreichisch-ungarischen Monarchie ist er auch durch seinen Großcousin Josef Hoffmann aufs Engste verbunden, der 1903 als einer der Mitbegründer der Wiener Werkstätte Berühmtheit erlangt. Ohne die Wiener Secession und deren Experimentierfreudigkeit sind die Tunkpapiere Pirchans nicht denkbar.

Edmund Steppes
(1873 Burghausen – 1968 Deggendorf)
6750 „Das Urwaldauge“: Waldweiher in einem Gehölz. Tempera auf Papier, eigenhändig auf Platte aufgezogen. 19,6 x 29,5 cm. Unten rechts signiert „E. Steppes“, verso eigenhändig betitelt „Das Urwaldauge“, nochmals signiert „Edmund Steppes“, sowie mit seinem Künstlersignet und weiteren eigenhändigen, schwer leserlichen Annotationen in Bleistift.
600 €
Französisch
6751 um 1880. Selbstbildnis eines Künstlers mit zugekniffenem Auge.
Feder in Braun auf Bütten. 27,6 x 18,4 cm. Wz. Glocke mit Liliengriff.
1.800 €


Erich Lindenau (1889 Bischofswerda – 1955 Dresden)
6752 Sommerblumen mit Rittersporn. Aquarell auf Aquarellpapier. 62 x 45,5 cm (Passepartoutausschnitt). Um 1930.
750 €
Das fein arrangierte Aquarell zeigt neben dem blühenden Rittersporn auch die bereits vertrockneten Stiele anderer Blühpflanzen und Blattgewächse mit roter und gelber Laubfärbung. Die an botanische Darstellungen erinnernde Zeichnung zeigt die fragile Schönheit der Pflanzen, die nur allzu schnell der Vergänglichkeit anheim fallen. In ein Passepartout montiert.
Fidus
(eigentl. Hugo Höppener, 1868 Lübeck – 1948 Berlin)
6753 Mädchenbildnis (Portrait der Emly Kofahl, spätere Wilhelmi).
Feder in Schwarz auf dünnem Karton. 30 x 24,4 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „F. 23.VII.14“, sowie unten links in Bleistift eigenh. bez. „Emly“, verso von anderer Hand in Bleistift bez. „Emly Kofahl 1914. 25 Jahre alt“.
1.500 €
Literatur: Ausst. Kat. Erste Gesamtausstellung der Werke von Fidus zu seinem 60. Geburtstage am 8. Gilbhart (X.), Berlin und Hamburg 1928, S. 27, Nr. 382 mit Abb. S. 45 (ohne Seitenzahl).
Ausstellung: Erste Gesamtausstellung der Werke von Fidus zu seinem 60. Geburtstage..., Aula Handelsoberschule, Woltersdorf b. Erkner / Altonaer Museum, Hamburg 1928.
Provenienz: Sammlung Emly Wilhelmi (geb. Kofahl), Hannover.
Ingeborg und Artur Nebel, Hannover. Seither in Familienbesitz.
Anliegend ein handschriftl. Brief aus dem Jahr 1968 von Emly Kofahl an den Schwiegersohn Artur Nebel, in dem die Verfasserin das Portrait dem Adressaten schenkt.


6754
6754 Bildnis Ingeborg Nebel en face. Bleistift auf Karton. 31,5 x 24,4 cm. Unten rechts eigenh. bewidmet und signiert „Inge zum 4. März 41 Fidus“, verso von Emly Wilhelmi die Übereignung der Zeichnung an ihren Schwiegersohn Artur Nebel zu Weihnachten 1956 handschriftlich in blauer Tinte.
800 €
Provenienz: Sammlung Emly Wilhelmi (geb. Kofahl), Hannover. Artur Nebel und Ingeborg Nebel (geb. Wilhelmi), Hannover. Seither in Familienbesitz.
6755 Lichtgebet.

Aquarell über Spuren von Graphit auf dünnem Karton. 66,4 x 43,8 cm. Unten links signiert und datiert „Fidus13“ sowie unten rechts betitelt „Lichtgebet“, unterhalb der Darstellung mit eigenh. Widmung von Fidus „Emly! Franz und Fidus grüssen Dich zu Weihnacht 1915“.
7.500 €
Provenienz: Sammlung Emly Wilhelmi (geb. Kofahl), Hannover. Ingeborg und Artur Nebel, Hannover. Seither in Familienbesitz.
Das Lichtgebet, von dem Fidus ab 1908 immer wieder neue Variationen gestaltete, war die Ikone der Lebensreformbewegung. Voller Inbrunst reckt sich der nackte, reine Jüngling dem segenspendenden Licht entgegen - eins mit dem Kosmos. Vor weitem Horizont empfängt er die Kraft der Sonne. Er wendet sich dem Leben zu und verkörpert damit unmittelbar ein neues Lebensgefühl, das sowohl die lebensreformerische Bewegung wie auch die Jugend im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik ersehnte.
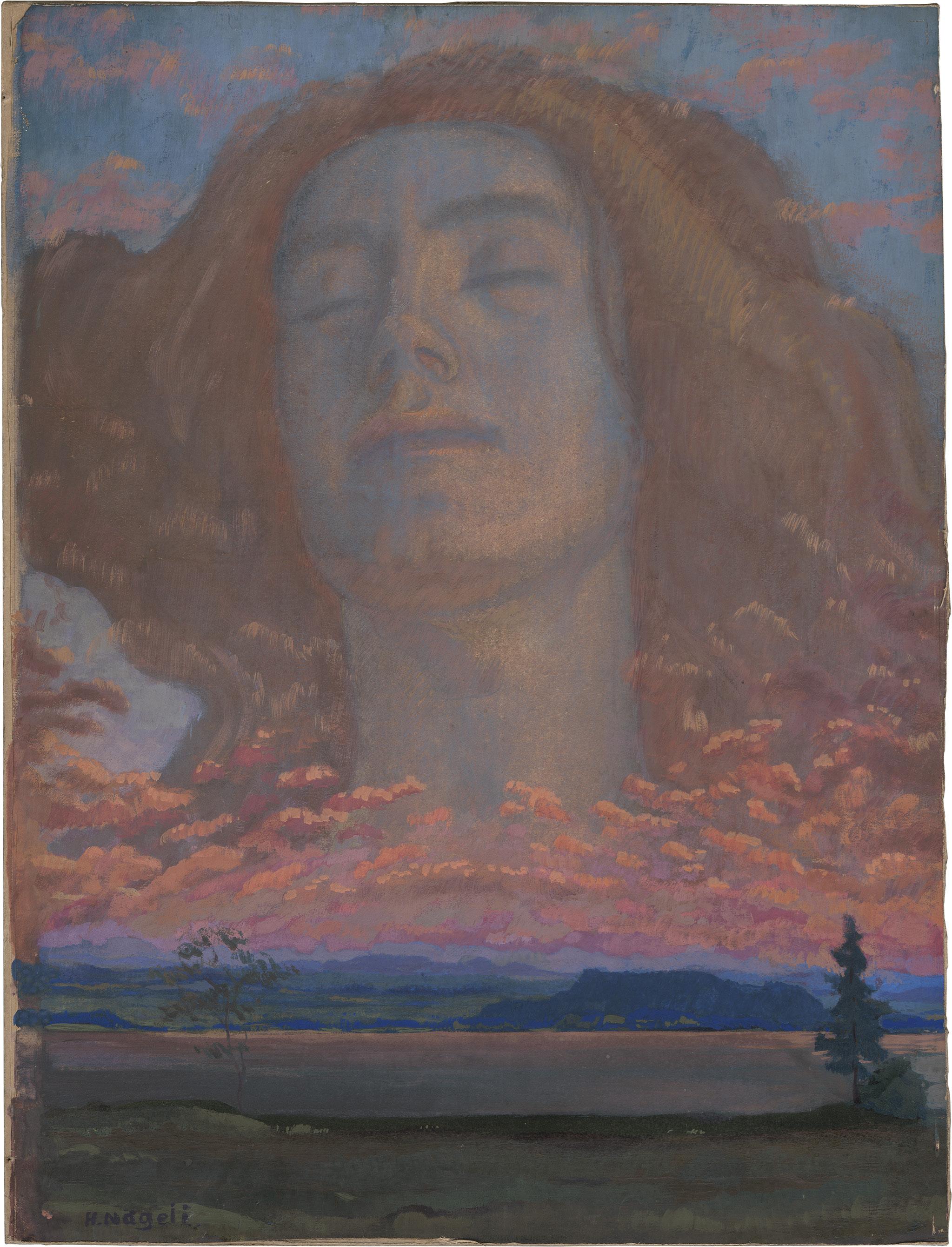
Hans Nägeli
(tätig um 1900 wohl in Bern)
6756 Wolkenerscheinung. Gouache auf Papier, auf Malkarton kaschiert. 57,7 x 44,2 cm. Unten links signiert „H. Nägeli“, verso ein Etikett „Hans Nägeli / Spitelackerstr. 65 [...] Kunstkommission Bern“.
1.200 €



Heinrich Nüsslein
(1879 Nürnberg – 1947 Ruhpolding)
6757 Einstellung: Aegäische Küste. Öl auf Papier. 50,1 x 65 cm. Verso mit Feder signiert „H. Nuesslein“ sowie auf einem Klebeetikett maschinenschriftl. betitelt „Einstellung: Aegäische Küste“. 800 €
Heinrich Nüsslein stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Eine von ihm angestrebte Ausbildung zum Maler scheiterte an seiner von Geburt an beschränkten Sehkraft. Durch den Handel mit Kunst und Antiquitäten in seiner Heimatstadt Nürnberg konnte sich Nüsslein in den Jahren nach dem I. Weltkrieg ein beachtliches Vermögen erarbeiten. 1923 kaufte er Schloss Kornburg und führte dort umfangreiche Renovierungsmaßnahmen durch. 1924 kam er mit spiritistischen Zirkeln in Kontakt und entdeckte seine Fähigkeiten zur Medial- bzw. Trancemalerei, durch die er während der 20er und 30er Jahre zu internationaler Berühmtheit gelangte. Er pflegte meist in völliger Dunkelheit mit Fingern, Watte und Lappen zu malen und vollendete ein Werk in wenigen Minuten. Nüsslein erhielt eine Ehrenprofessur an der technischen Hochschule Paris und die Ehrendoktorwürde der Universität Brüssel, und hatte zahlreiche
Ausstellungen im In- und Ausland, u. a. in Paris, London und New York. Er betätigte sich auch als spiritistischer Schriftsteller. Während der Zeit der Naziherrschaft erfuhr Nüsslein zunehmende Repressalien. Er starb am 12. November 1947, den er als seinen Todestag selbst vorhergesagt hatte. Ein Großteil seines auf Schloss Kornburg gelagerten Werkes wurde 1945 vernichtet.
6758 Phantastische Küstenlandschaft. Öl auf Papier. 32,3 x 49,2 cm. Verso mit einem Adressstempel.
600 €
6759 Metaphysische Landschaft in Blau („Bremer“). Öl auf Papier. 32,2 x 48,5 cm. Verso eigenhändig betitelt sowie mit einem Adressstempel.
800 €

Wilhelm Schulz (1865 Lüneburg – 1952 München)
6760 Serenissimus.
Aquarell, Tusche (Pinsel, Feder, Spritztechnik) und Deckweiß auf Papier, eigenhändig auf Pappe aufgezogen. 34,1 x 29,9 cm (Papiergröße). Links unten signiert „Schulz“, mit der Nummer „3348“ in Blau im linken unteren Rand außerhalb der Darstellung, sowie zahlreichen Annotation in Bleistift recto und verso.
1.200 €
Zu Beginn der 1890er Jahre trifft Wilhelm Schulz an der Akademie der Bildenden Künste in München eine Reihe gleichgesinnter, die wie er ab 1896 zu den Mitarbeitern der Zeitschriften Jugend und Simplicissimus zählen werden. Obgleich München zur zweiten Heimat des norddeutschen Zeichners wird, zieht es ihn immer wieder in seine Geburtsstadt Lüneburg. Dort findet er jene pittoresken Motive, die über mehr als vier Jahrzehnte hinweg im Simplicissimus erscheinen, oftmals zusammen mit selbstverfassten Texten bzw. Gedichten. In Wilhelm Schulz‘ 1901 im Simplicissimus (Jg. 6, H. 21, S. 161) veröffentlichten Zeichnung „Serenissimus“ begegnet der fiktive Charakter Serenissimus, bei dem es sich um das vertrottelte Staatsoberhaupt eines imaginären Kleinfürstentums handelt, einem seiner Untertanen, der folgende Anweisungen entgegenzunehmen hat: „Er ist dem Collegio attachieret? Sage er den Leuten, Wir intentionieren, Unseren Leibjäger als Burgermeister Unserer Residenzstadt zu präponieren, da Wir Uns versehen, daß selbiger am besten Unsere Intentiones der Kanaille deklarieret.“ Mutet die gestelzte und veraltete Sprache des Serenissimus von Anfang an komisch an, so wird der Sinn seiner umständlichen Rede erst nach und nach verständlich. Die Idee der Mitwirkung oder gar Selbstbestimmung des Bürgers im Staate ist dem absolutistischen Selbstverständnis des Landesfürsten gänzlich fremd. Er sieht in ihm nichts weiter als gemeines Pack, das nur durch die strenge Hand eines Jägermeisters zu bändigen ist. Während sich Vertreter des Hochadels sowie obrigkeitshörige Monarchisten durch Schulz‘ Zeichnung provoziert gefühlt haben dürften, werden sich liberalere Zeitgenossen darüber amüsiert haben. Tatsächlich entsprechen die realen Verhältnisse um 1900 kaum der ironischen Schilderung des Künstlers. Umso mehr ist die Karikatur ein Seitenhieb auf das anachronistische Selbstverständnis der politischen Eliten im wilhelminischen Kaiserreich, bleibt jedoch glücklicherweise aufgrund ihrer geschickt camouflierten Kritik ohne Nachspiel für den Künstler.

Wilhelm Kuhnert (1865 Oppeln – 1926 Flims, Graubünden)
6761 Schmutzgeier vor einem nordafrikanischen Stadttor.
Schwarze Kreide, grau laviert, weiß gehöht, auf dünnem Zeichenkarton. 14,5 x 19,9 cm. Monogrammiert unten links „W.K“.
400 €
Um die Jahrhundertwende war es für die meisten Tiermaler eher üblich tropische Tiere in zoologischen Gärten zu studieren. Kuhnert, der als bedeutendster deutscher Tiermaler seiner Zeit gilt, unternahm hingegen von seinem Wohnsitz in Berlin aus Reisen nach Nord- und Ostafrika,
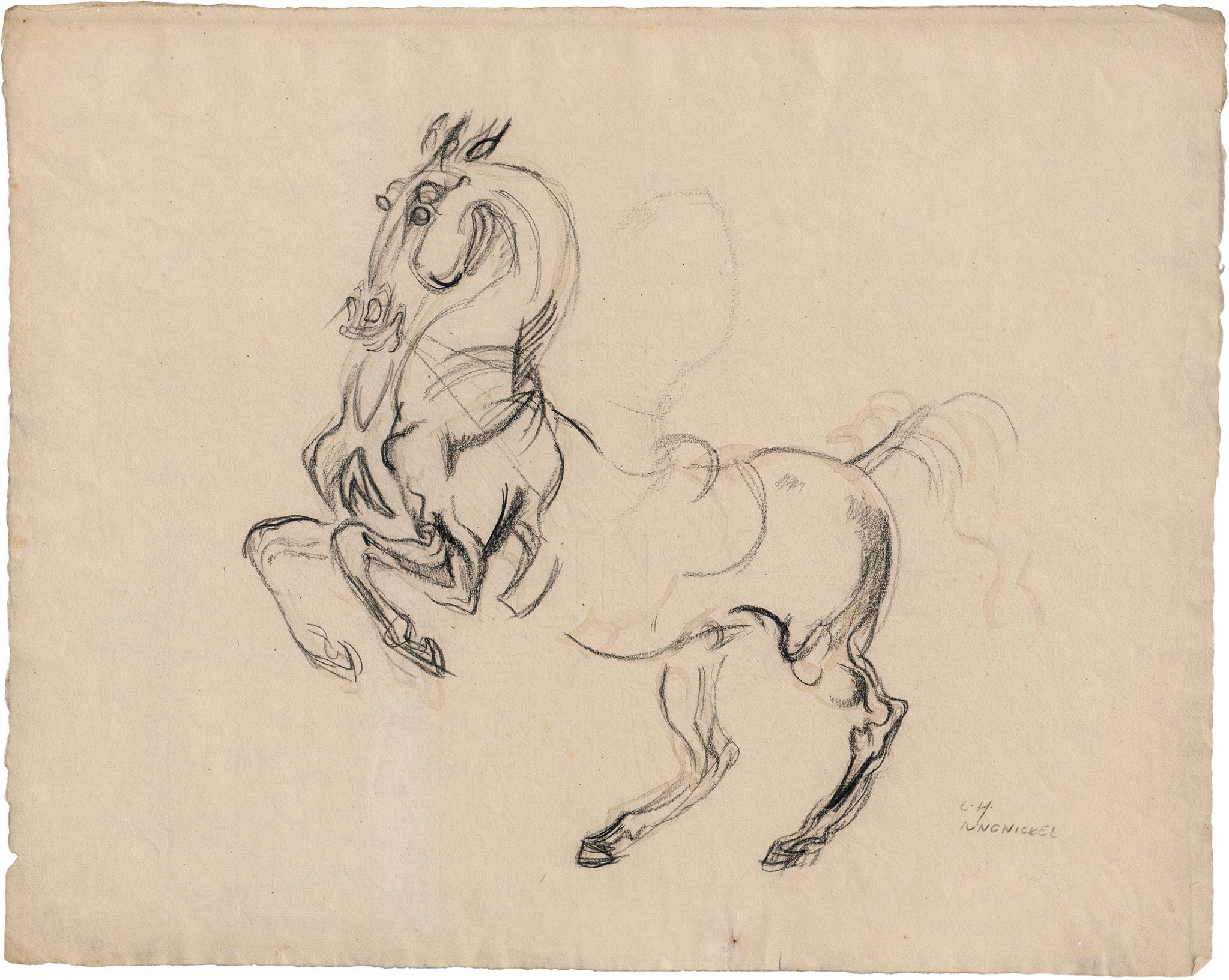
6762
ebenso Indien, fuhr aber auch in den Norden, um die Landschaften und ihre Tierwelt vor Ort zu beschreiben, zu zeichnen und zu malen. - Der inzwischen stark gefährdete Schmutzgeier (Neophron percnopterus) frisst, wie seine Artgenossen, das Fleisch toter Tiere, scheut aber auch vor Exkrementen nicht zurück - was ihm zu seinem Namen verhalf. Zudem ist er aber auch ein bemerkenswertes Beispiel für den Gebrauch von Werkzeugen: mit Hilfe von bis zu 500g schweren Steinen ist er in der Lage, Straußeneier zu öffnen. Aufgrund ihres Aasfresserverhaltens werden Geier durchaus auch mit reinigenden Eigenschaften in Verbindung gebracht. Sie verhindern durch den Verzehr toten Fleisches die Ausbreitung von Krankheiten.
Ludwig Heinrich Jungnickel (1881 Wunsiedel/Oberfranken – 1965 Wien)
6762 Tanzende, Pferde, Tiger und Baumstudien. Ca. 47 Zeichnungen, je schwarze Kreide, teils aquarelliert. 4to - Folio. Teils signiert, teils mit dem Nachlassstempel verso.
750 €
Provenienz: Nachlass Robert Seitschek (akad. Maler, 1910 Wien –1990 Kufstein).

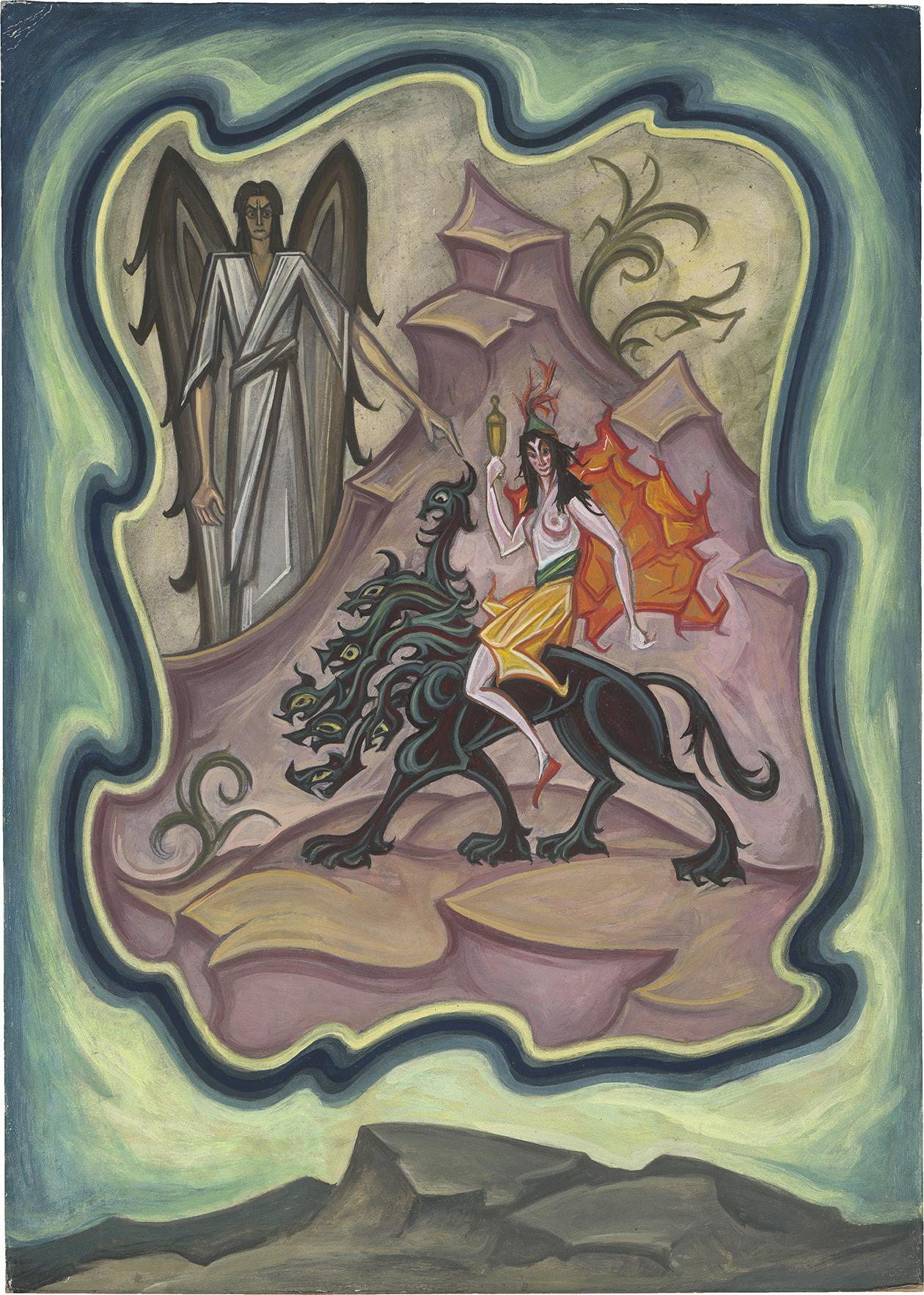
Alexey Krassowsky (1884 Charkow – 1961 Wien)
6763 Sieben Bilder zur Apokalypse. 7 Gouachen auf Malpappe. Je ca. 69,5 x 50 cm.
600 €
Provenienz: Nachlass Robert Seitschek (akad. Maler, 1910 Wien1990 Kufstein).
Alexey Krassowsky hatte sich nach der russischen Revolution im Jahr 1917 in Wien niedergelassen. Er schuf dort in den 1920er Jahren u.a. zeittypische Werke im Stil des Art Déco, darunter viele Entwürfe für Gebrauchswerke. Er zählte zur Gruppe der Maler der russischen Volkskunst und schuf unter anderem Werke für die Pfarrkirche Hennersdorf im Wienerwald. Möglicherweise waren die expressiven Szenen der Apokalypse ebenfalls für einen Kirchenraum in der Diözese Wien bestimmt.
Hermann Wöhler (1897–1961, Hannover)
6764 „Märchenbilder für Margarethe“ (Landschaft im Mondlicht).
Tempera auf Velin, original auf Untersatz montiert. 35 x 20 cm. Unten mittig monogrammiert „HW“ und auf dem Passepartout mit der Werknummer „I,3“ versehen. Um 1942.
1.800 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
Galerie J.H. Bauer, Hannover, Lagerliste 39. Privatsammlung Rheinland. Inmitten der bedrohlichen Atmosphäre der Bombennächte des Kriegsjahres 1942 zog sich Hermann Wöhler in die stille Privatheit seines „Sternenhauses“ zurück und begann dort einen von insgesamt drei Märchenzyklen, die er allesamt seiner Ehefrau Margarete widmete. Die allein für den privaten Kontext entstandenen Temperaarbeiten sind dabei durchdrungen von seiner von der Anthroposophie geprägten Weltsicht und offenbaren nicht selten ganz persönliche Seelenwelten. Das vorliegende Blatt ist dabei als Widmungsblatt des ersten Zyklus das Blatt 3 der Folge (nach den Titelblättern). Die Folgen wurde in Teilen im Jahre 1987 im Historischen Museum Hannover präsentiert (vgl. Greffrath, Bettina: Hermann Wöhler, Märchenbilder Beiträge und Katalog zur Ausstellung, Hannover 1987). Weitere Stücke befinden sich heute in der Sammlung des Deutsches Märchen- und Wesersagenmuseums in Bad Oeynhausen.


Hermann Wöhler
6765 Blumenbild (Sonnenblumen und Wicken). Tempera auf Velin, original auf Untersatz montiert. 30 x 19 cm. Unten rechts monogrammiert „HW“ und auf dem Passepartout mit der Werknummer „II, 26“ versehen. Um 1942.
1.500 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers. Galerie J.H. Bauer, Hannover, (wohl) Lagerliste 92. Privatsammlung Rheinland.
Zeichnungen
6766 Ca. 24 Blatt des 17.-19. Jh.
900 €
Darunter von und zugeschrieben an: Andreas Achenbach, Friedrich Bollmann, Friedrich Bolt, Asmus Jacob Carstens, Karl Fohr, Johann David Alexander Friedrich, Ernst Erwin Oehme, Theodor Rombouts, Martin Johann Schmidt, Albert Venus, Anthonie Waterloo.
6767 Ca. 20 Blatt des 17.-20. Jh.
400 €
Darunter von und zugeschrieben an: Ivanovitch-Kowalskii, Johann Christian Klengel, Carl Wilhelm Kolbe d. J., Johann Jakob Müller, Johann Esaias Nilson, Simon Warnberger.
6768 Ca. 38 Blatt des 17.-20. Jh.
600 €
Darunter von und zugeschrieben an: Arthur Blaschnik, Theodor Böhm, Karl Böse, Samuel Bottschild, Wilhelm Busch, Wilhelm Claudius, Daniel van den Dyck, Friedrich Geselschap, Gabriel Christophe Guérin, Wilhelm Kaulbach, Charles Le Brun, Eugen Napoleon Neureuther, Jean
Baptiste Marie Pierre, Johann Christian Reinhart, Carl Rottmann, Julius Thaeter, Hans Thoma (signiert), Paolo Toschi. Teils erworben bei dem Kunstantiquariat Franz Meyer, Dresden und teils mit Franz Meyers handschriftlichen Zuschreibungen verso.
6769 Ca. 40 Blatt des 17.-20. Jh.
600 €
Darunter von und zugeschrieben an: Edme Bouchardon, Mateo Cereso, Adolf Fischer-Gurig, Johann Jacob Frey, William Hogarth, Eduard Ille, Wilhelm Kaulbach, Eduard Meyerheim, Friedrich Preller, Johann Heinrich Ramberg, Moritz Retzsch, Albert Christoph Reindel, Moritz von Schwind, Wilhelm Steinhauser, David Teniers, Wilhelm Tischbein, Ernst Erwin Oehme, Eugen Urban, Arthur Volkmann. Teils erworben bei dem Kunstantiquariat Franz Meyer, Dresden (teils mit dessen handschriftlichen Zuschreibungen verso).
6770 Ca. 27 Blatt des 18.-20. Jh.
400 €
Darunter: Carl Fahringer, Heinrich Krause, Alexander Rothaug, Karl Sterrer (?). Beigegeben zwei Skizzenbücher wohl österreichischer Künstler des 20. Jh., sämtlich aus dem Nachlass des Wiener Malers Robert Seitschek.

A
Abildgaard, Nicolai A. 6613
Adam, Eugen 6679
Alt, Rudolf von 6701
Apell, Franz Xaver 6604
B
Baagøe, Carl Emil 6645
Bardou, Karl Wilhelm 6624
Beck, Johann Heinrich 6651
Bensa, Ernesto 6698
Berchem, Nicolaes 6530
Blarenberghe, Louis-Nicolas van 6585-6586
Bracht, Eugen 6689
Büchel, Emmanuel 6542
Busch, Wilhelm 6685
C
Cades, Giuseppe 6578
Caliari, Paolino 6555
Callow, William 6709
Canal, Giambattista 6572
Carabain, Jacques Fr. J. 6660
Carpi, Carlo Giuseppe 6519
Cats, Jacob 6587
Chéret, Jules 6724
Chodowiecki, Daniel Nikolaus 6596-6601
Colonnelli-Sciarra, Salvatore 6568
Constantin, Jean-Antoine 6630
Cox I, David 6711
Cuyck, Michael van 6695
D
Dahl, Johann Chr. C. 6641-6642
Dahl, Siegwald Johannes 6650
Dähling, Heinrich A. 6620-6621
Dandini, Pietro 6523
Delacroix, Eugène 6708
Desprez, Louis-Jean 6583
Diesel, Matthias 6546-6548
Dietrich, Christian W. E 6540
E
Dillis, Johann G. von 6670, 6675
Dreber, Heinrich 6664
Du Pasquier, Louis 6696
Dyck, Daniel van den 6545
Eckersberg, Christoffer W. 6616
Ehrenberg, Carl 6700
Ender, Thomas 6676
Erhard, Johann Christoph 6682
F
Faber, Johann Theodor E. 6639
Faber du Faur, Chr. W. von 6629
Fezant, P. 6537
Fidus 6753-6755
Fryer, Edward H. 6659
G
Gandolfi, Gaetano 6574
Garelli, Luigi 6702
Gensler, Jacob 6648
Gerst, Johann Karl Jacob 6623
Gille, Christian Fr. 6633-6634
Grabwinkler, Paul 6732
Graff, Anton 6592
Grimaldi, Giovanni Fr. 6518a
Gumpp, Johann Anton 6556
H
Hammer, Christian Gottlob 6631
Hammer, Walter J. 6729, 6733
Harpignies, Henri Joseph 6726
Harrich, Jobst 6504
Heim, R. 6699
Helleu, Paul César 6723
Hertel, Albert 6649
Hirschgartner, Heinrich 6703
Hoorn, Jordanus 6611
Hummel, Carl M. N. 6666, 6687
J
Jentzen, Friedrich 6717
Jungnickel, Ludwig H. 6762
K
Kaiser, Adolph 6691
Kauffmann, Angelika 6575
Kersting, Georg Friedrich 6632
Klein, Johann Adam 6618-6619
Klengel, Johann Christian 6608
Klinger, Max 6727-6728
Klose, Friedrich Wilhelm 6626
Kobell, Ferdinand 6669
Kobell, Franz 6671-6673
Krafft, Johann August 6710
Krassowsky, Alexey 6763
Krüger, Franz 6625, 6627
Kuhnert, Wilhelm 6761
Kuntz, Carl 6684
L
Labruzzi, Carlo 6588
Lairesse, Gerard de 6571
Lauer, Nikolaus 6622
Lebarbier d. Ä., Jean J. Fr. 6577
Lessing, Carl Friedrich 6661
Lindenau, Erich 6752
Linnell, John 6713
Lund, Johann Ludvig G. 6615
M
Maestri, Michelangelo 6614
Marcola, Marco 6526
Martin, John 6643
Mazzucchelli, Pier Francesco 6521
Menzel, Adolph von 6719-6720
Morgenstern, Johann Fr. 6609
Mouillet, Marie Christine 6663
N
Nägeli, Hans 6756
Neher, Michael 6662
Netscher, Caspar 6543
Nielsen, Christian V. 6714-6715
Nüsslein, Heinrich 6757-6759
O
Olivier, Ferdinand 6652
Overbeck, Friedrich 6655
P
Paggi, Giovanni Battista 6510
Perkois, Jacobus 6606
Pernet, Jacques-Henry-A. 6579
Peters, Pieter Francis 6694
Pflaumer, Eugen 6735
Piattoli, Giuseppe 6573
Piola, Domenico 6514
Pirchan, Emil 6747-6748
Prenner, Anton J. Graf von 6567
Preziosi, Amadeo 6707
Provaggi, Cesare 6704
R
Reinhart, Johann Christian 6668
Reinhold, Johann Fr. L. 6605
Rembrandt Harmensz. van Rijn 6539
Richter, Adrian L. 6637-6638
Richter, Ludwig 6635-6636
Rietschel, Ernst 6693
Ritter, Lorenz 6716
Rode, Christian Bernhard 6566
Rohden, Johann Martin von 6665
Rothaug, Alexander 6739-6745
Rothaug, Leopold 6746
Rottenhammer, Johann 6506-6507
Ruben, Franz Leo 6722
Rugendas d.Ä., Georg Ph. 6589
Runge, Philipp Otto 6640
Ruysdael, Salomon van 6534
S
Saint-Aubin, Augustin de 6595
Schadow, Johann Gottfried 6602
Scheffler, Felix Anton 6559
Schenau, Johann Eleazar 6594
Schmidt, Johann Heinrich 6628
Schneider, Sascha 6730
Schnorr von Carolsfeld, Julius 6653, 6657-6658
Schnorr von Carolsfeld, Veit
Hanns 6656
Schramman, Burkhard 6505
Schulz, Wilhelm 6760
Schwartz, Johann Chr. A. 6617
Seliger, Max 6731
Sepp, Jan Christian 6607
Skarbina, Franz 6718
Spitzer, Johann Wenzel 6558
Steinle, Edward Jakob von 6654
Steppes, Edmund 6750
Stichart, Alexander Otto 6738
T
Thiersch, Ludwig 6706
Trauschke, Christian 6564
Troger, Paul 6557
U
Ulft, Jacob van der 6527
V
Verwer, Johan 6532
W
Wagenschön, Franz Xaver 6563
Wagner, Carl 6674
Wit, Jacob de 6538
Wöhler, Hermann 6764-6765
Wucherer, Fritz 6686
Wulff, Wilhelm Friedrich 6644
Z
Zingg, Adrian 6590, 6593
Zuccarelli, Francesco 6580
Zünd, Robert 6690

Druckgraphik des 15. bis 19. Jahrhunderts Auktion 26. November 2025
GALERIE BASSENGE · ERDENER STRASSE 5A · 14193 BERLIN
Telefon: (030) 893 80 29-0 Fax: (030) 891 80 25 E-Mail: art@bassenge.com Kataloge online: www.bassenge.com

Moderne und Zeitgenössische Kunst Auktion 28. und 29. November 2025
GALERIE BASSENGE · ERDENER STRASSE 5A · 14193 BERLIN
Telefon: (030) 893 80 29-0 Fax: (030) 891 80 25 E-Mail: art@bassenge.com Kataloge online: www.bassenge.com

photography auction november 29, 2025
gallery & previews | Rankestr. 24, 10789 Berlin
auctions | Erdener Straße 5a, 14193 Berlin photoauktionen gbr
1. Die Galerie Gerda Bassenge KG, nachfolgend Versteigerer genannt, versteigert als Kommissionärin im eigenen Namen und für Rechnung ihrer Auftraggeber (Kommittenten), die unbenannt bleiben. Die Versteigerung ist freiwillig und öffentlich im Sinne des § 383 III BGB.
2. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Nummern des Kataloges zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge anzubieten oder zurückzuziehen.
3. Sämtliche zur Versteigerung kommenden Gegenstände können vor der Ver steigerung besichtigt und geprüft werden. Die Sachen sind gebraucht. Erhaltungszustände der einzelnen angebotenen Arbeiten bleiben im Katalog in der Regel unerwähnt. Die Katalogbeschreibungen sind keine Garantien im Rechtssinne und keine vertraglich vereinbarten Beschaffenheitsangaben. Gleiches gilt für individuell angeforderte Zustandsberichte. Sie bringen nur die subjektive Einschätzung des Versteigerers zum Ausdruck und dienen lediglich der unverbindlichen Orientierung. Alle Gegenstände werden in dem Erhaltungszustand veräußert, in dem sie sich bei Erteilung des Zuschlages befinden. Soweit nicht in der Katalogbeschreibung explizit erwähnt, sind Rahmungen nicht bindender Bestandteil des Angebots. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen Sachmängeln in Anspruch nehmen, wenn dieser seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch, wegen rechtzeitig vorgetragener, begründeter Mängelrügen innerhalb der Verjährungsfrist von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des Zuschlags seine Ansprüche gegenüber dem Einlieferer (Auftraggeber) geltend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer dem Erwerber den Kaufpreis samt Aufgeld. Die Haftung des Versteigerers auf Schadensersatz für Vermögensschäden – gleich aus welchem Grund – ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Versteigerer fiele Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt unberührt.
4. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Wenn mehrere Personen dasselbe Gebot abgeben und nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. Der Versteigerer kann den Zuschlag zurücknehmen und die Sachen erneut ausbieten, wenn irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
5. Im Falle eines schriftlichen Gebotes beauftragt der Interessent den Versteigerer für ihn während der Versteigerung Gebote abzugeben. In schriftlichen Aufträgen ist bei Differenzen zwischen Nummer und Kennwort das Kennwort maßgebend.
6. Telefonische Gebote und Online-Direkt-Gebote über das Internet bedürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zustimmung. Für die Bearbeitung übernimmt der
Versteigerer jedoch keine Gewähr. Telefonische und OnlineGebote werden nur akzeptiert, wenn der Bieter bereit ist, den ihm zuvor mitgeteilten Mindestpreis des jeweiligen Loses zu bieten. Auch bei Nichtzustandekommen einer Verbindung gilt, dass für den Auktionator dieses Gebot in Höhe des Mindestpreises verbindlich ist. Für das Zustandekommen einer entsprechenden Telefon- oder Onlineverbindung übernimmt der Versteigerer keine Gewähr. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf solche Gebote keine Anwendung (§ 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB).
7. Mit der Erteilung des Zuschlages geht die Gefahr für nicht zu vertretende Verluste und Beschädigung auf den Ersteigerer über. Das Eigentum an den ersteigerten Sachen geht erst mit vollständigem Zahlungseingang an den Erwerber über.
8. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 30% zu entrichten, in dem die Umsatzsteuer ohne separaten Ausweis enthalten ist (Differenzbesteuerung) oder ein Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer (Regelbesteuerung) von z.Zt. 7% (Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Graphiken, Bücher etc.) bzw. 19% (Handschriften, Autographen, Kunstgewerbliche Gegenstände, Siebdrucke, Offsets, Fotografien, etc.). Die im Katalog mit einem * gekennzeichneten Objekte unterliegen in jedem Fall der Regelbesteuerung (Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer von z.Zt. 7% bzw. 19%). Bei den im Katalog mit einem ^ gekennzeichneten Objekten ist Einfuhrumsatz steuer angefallen. In diesen Fällen wird zusätzlich zu einem Aufgeld von 27% (Differenzbesteuerung) die verauslagte Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.Zt. 7% auf den Zuschlag erhoben. Für bundesdeutsche Kunsthändler und Antiquare, die zum Vor steuer abzug berechtigt sind, kann die Gesamt rech nung auf Wunsch, wie bisher nach der Regelbesteuerung ausgestellt werden. Von der Umsatzsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (außerhalb der EU) und – bei Angabe ihrer USt.-Identifikations-Nr. bei Auftragserteilung als Nachweis der Berechtigung zum Bezug steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferungen –auch an Unternehmen in anderen EU-Mitgliedsstaaten, unter der Voraussetzung, dass sie für gewerblichen Gebrauch einkaufen. Eine Korrektur nach Rechnungsstellung ist nicht möglich. Alle anderen Käufe aus EU-Ländern unterliegen der Umsatzsteuer. Ausländischen Käufern außerhalb der Europäischen Union wird die Umsatzsteuer erstattet, wenn binnen 4 Wochen nach der Auktion der deutsche zollamtliche Ausfuhrnachweis und der zollamtliche Einfuhrnachweis des entsprechenden Importlandes erbracht werden. Bei Versand durch uns gilt der Ausfuhrnachweis als gegeben. Bei Online-Live-Geboten über Internetplattformen erhöht sich das Aufgeld um die dort anfallende Transaktionsgebühr (i. d. R. 3-5%). Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedür fen einer besonderen Nachprüfung und eventueller Berichtigung; Irrtum vorbehalten. Katalog- und Zusatzabbildungen dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Reproduktionsrechte und digitale Dateien der Abbildungen können gegen Gebühr erworben werden. Gegebenen-
falls noch bestehende Urheberrechte Dritter bleiben davon unberührt und müssen u.U. gesondert eingeholt werden.
9. Die Auslieferung der ersteigerten Stücke erfolgt in unseren Geschäftsräumen gegen Bezahlung. Kreditkarten (Mastercard, VISA, American Express), Schecks sowie andere unbare Zahlungen werden nur erfüllungshalber angenommen. Bankspesen/ Transaktionsgebühren bzw. Kursverluste können zu Lasten des Käufers gehen. Die Auf bewahrung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Versand wird gegen Vorabrechnung des Rechnungsbetrages ausgeführt. Die Versandspesen sowie die Kosten für Versicherung gegen Verlust und Beschädigung gehen zu Lasten des Käufers. Übersteigen die tatsäch lichen Versandkosten die vorab berechnete Pauschale, so wird die Differenz dem Käufer nachträglich in Rechnung gestellt.
10. Bei der Ausfuhr von Kulturgütern ist gem. der EG-Verordnung Nr. 116/2009 bzw. § 24 KGSG abhängig von Kategorie und Wert des Objekts ggf. eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Aus Gründen des Artenschutzes können Objekte aus bestimmten, geschützten Materialien (u.a. Elfenbein, Schildpatt, Perlmutt und einige Korallenarten) besonderen Im- und Exportbeschränkungen unterliegen. Zum Zwecke des Exports (insbesondere außerhalb der Europäischen Union) kann hierfür eine spezielle Ausfuhrgenehmigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 338/97 erforderlich sein. Entsprechende Ausfuhrgenehmigungen können nur unter strengen Bedingungen erteilt und ggf. auch gar nicht erlangt werden, auch kann der Import dieser Gegenstände in manche Staaten eingeschränkt oder untersagt sein. Der Käufer ist selbst dafür verantwortlich, sich über etwaige Im- und Exportbeschränkungen zu informieren. Export und Import entsprechender Objekte erfolgen allein auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
11. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Der Versteigerer ist berechtigt, falls nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Versteigerung Zahlung geleistet ist, den durch den Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrag ohne weitere Fristsetzung zu annullieren, Verzugszinsen in
banküblicher Höhe – mindestens jedoch 1 % auf den Bruttopreis je angebrochenen Monat – zu berechnen und von dem Ersteigerer wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. Der Schadenersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache in einer neuen Auktion nochmals versteigert wird und der säumige Käufer für einen Mindererlös gegenüber der vorangegangenen Versteigerung einschließlich der Gebühren des Auktionshauses aufzukommen hat. Zu einem Gebot wird er nicht zugelassen, auf einen etwaigen Mehrerlös hat er keinen Anspruch.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand im vollkaufmännischen Verkehr ist Berlin. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UNAbkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
13. Die im Katalog aufgeführten Preise sind Schätzpreise, keine Limite.
14. Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung, bei der der Interessent entweder telefonisch oder schriftlich (im Sinne der Ziffern 5 und 6) den Auftrag zur Gebotsabgabe mit einem bestimmten Betrag erteilt. Entsprechende Gebote behalten ihre Gültigkeit für 4 Wochen nach Abgabe.
15. Die Abgabe eines Gebotes in jeglicher Form bedeutet die Anerkennung dieser Versteigerungsbedingungen. Der Versteigerer nimmt Gebote nur aufgrund der vorstehenden Versteigerungsbedingungen entgegen und erteilt dementsprechend Zuschläge. Kommissionäre haften für die Käufe ihrer Auftraggeber.
16. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt.
David Bassenge, Geschäftsführer und Auktionator
Dr. Markus Brandis, öffentlich bestellter u. vereidigter Auktionator

Stand: November 2025
1. The Galerie Gerda Bassenge KG, subsequently called “the auctioneer” carries on business as commission-agent in its own name on behalf of its voluntary consignors. This auction sale is a public one in the sense of § 383 III BGB.
2. The auctioneer reserves the right to combine, to split, to change or to withdraw lots before the actual final sale.
3. All objects put up for auction can be viewed and examined prior to the sale at the times made known in the catalogue. The items are used and sold as is. As long as not explicitly mentioned in the catalogue description, framing is not an inherent part of the offer. As a rule, the condition of the individual work is not given in the catalogue. Catalogue descriptions are made with as much care as possible, but the descriptions do not fall under the statutory paragraph for guaranteed legal characteristics. The same applies for individually requested condition reports. These also offer no legal guarantee and only represent the subjective assessment of the auctioneer while serv ing as a non-binding orientation. The liability for damage to life, body or health shall remain unaffected. In case of a justified claim, however, he will accept the responsibility to make a claim for restitution on behalf of the buyer against the consignor within a period of 12 months, running from the fall of the hammer. In the event of a successful claim the auctioneer will refund the hammerprice plus premium.
4. The highest bidder acknowledged by the auctioneer shall be deemed the buyer. In case of identical bids the buyer will be determined by drawing lots. In the event of a dispute the auctioneer has the absolute discretion to reoffer and resell the lot in dispute. He may also knock down lots conditionally.
5. In the case of a written bid the bidder commissions the auctioneer to place bids on his behalf during the auction. In cases where there is a discrepancy between number and title in a written bid the title shall prevail.
6. Telephone and direct online bidding via the internet must be approved in advance by the auctioneer. The auctioneer cannot be held liable for faulty connections or transmission failure. In such a case the bidder agrees to bid the reserve price of the corresponding lot. For such bidding the regulations of long distance contracts do not apply (Fernabsatzverträge) [cf § 312g II,10 BGB].
7. On the fall of the auctioneer’s hammer title to the offered lot will pass to the acknowledged bidder. The successful buyer is obliged to accept and pay for the lot. Ownership only passes to the buyer when full payment has been received. The buyer, however, immediately assumes all risks when the goods are knocked down to him.
8. A premium of 30% of the hammer price will be levied in which the VAT is included (marginal tax scheme) or a premium of 25% of the hammer price plus the VAT of 7% (paintings, drawings, sculptures, prints, books, etc.) or 19% (manuscripts, autographs letters, applied arts, screen prints, offset prints, photographs, etc.) of the invoice sum will be levied (regular tax scheme). Buyers from countries of the European Union are subject to German VAT. Items marked with an * are subject to the regular tax scheme (premium of 25% of the hammer price plus the current VAT of 19%). Items marked with an ^ are subject to import duty. In these cases in addition to a premium of 27% (marginal tax scheme), the charged import tax of currently 7% will be added to the hammer price.
Exempted from these rules are only dealers from EU-countries, who are entitled, under their notification of their VAT ID-Number, to buy on the basis of VAT-free delivery within the European Union. Notification of VAT ID-Numbers must be given to the auctioneer before the sale.
For buyers from non EU-countries a premium of 25% will be levied. VAT will be exempted or refunded on production of evidence of exportation within 4 weeks of the auction, or, if appropriate, importation to another country. This is taken as given when the dispatch is effected by us.
Live bidding through online platforms entails a transaction fee stipulated by the platform and will be added to the premium (usually 3-5% of the hammer price).
Due to the work overload of the accounting department during auctions, invoices generated during or directly after an auction require careful revision and possible correction; errors excepted. Catalogue images may not be used without permission. Reproduction rights and digital files can be acquired for a fee. Any copyrights of third parties that may still exist remain unaffected by this and may have to be obtained separately.
9. Auction lots will, without exception, only be handed over after pay ment has been made. Credit cards (VISA, Mastercard, American Express), checks and any other form of non-cash payment are accepted only on account of performance. Exchange rate risk and bank charges may be applicable. Storage and dispatch are at the expense and risk of the buyer. If the shipping costs exceed the lump sum on the invoice the outstanding amount will be billed separately.
10. According to regulation (EC) No. 116/2009 resp. § 24 KGSG, export license may be necessary when exporting cultural goods depending on the type or value of the object in question. For the purposes of wildlife conservation, it is necessary to obtain an export license according to regulation (EC) No. 338/97 when exporting objects made from certain protected materials (incl. ivory, tortoiseshell, mother-of-pearl and certain corals) out of the territory of the European Community. Export licenses for objects made of protected
materials are only granted under strict conditions or may not be granted at all. The import of such objects may be restricted or prohibited by certain countries. It is the buyer’s responsibility to inform himself, whether an object is subject to such restrictions. Export and import of such objects are at the expense and risk of the buyer.
11. The buyer is liable for acceptance of the goods and for payment. The purchase price shall be due for payment upon the lot being knocked down to the buyer. In case of a delayed payment (two weeks after the sale) the purchaser will be held responsible for all resultant damages, in particular interest and exchange losses. In case of payment default the auctioneer will charge interest on the outstanding amount at a rate of 1% to the gross price per month or part of month. In such an event the auctioneer reserves the right to annul the purchase contract without further notice, and to claim damages from the buyer for non-fulfilment, accordingly he can reauction the goods at the buyer’s expense. In this case the buyer is liable for any loss incurred, the buyer shall have no claim if a higher price has been achieved. He will not be permitted to bid.
12. The place of fulfillment and jurisdiction is Berlin. German law applies exclusively; the UN-Treaty (CISG) is explicitly excluded.
13. The prices quoted after each lot are estimates, not reserves.
14. The after-sales is part of the auction in which the bidder places either by telephone or in written form (as stated in number 5 and 6) the order to bid a set amount. Corresponding bids are binding for 4 weeks after submission.
15. By making a bid, either verbally in the auction, by telephone, written by letter, by fax, or through the internet the bidder confirms that he has taken notice of these terms of sale by auction and accepts them. Agents who act on behalf of a third party are jointly and separately liable for the fulfillment of contract on behalf of their principals.
16. Should one or the other of the above terms of sale become wholly or partly ineffective, the validity of the remainder is not affected. In the event of a dispute the German version of the above conditions of sale is valid.
David
Bassenge, auctioneer Dr. Markus Brandis, attested public auctioneer
As of November 2025

Dr. Ruth Baljöhr
David Bassenge
Eva Dalvai
Reproduktionen
Ana Briceño
Philipp Dörrie
Torben Höke
Stefanie Löhr
Clara Schmiedek

Lea Kellhuber
Nadine Keul
Harald Weinhold
Gestaltung & Satz
Stefanie Löhr

GALERIE BASSENGE
ERDENER STRASSE 5A 14193 BERLIN