BASSENGE

MODERNE UND ZEITGENÖSSISCHE KUNST




28. November 2025
Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin
Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: modernart@bassenge.com . www.bassenge.com


Barbara Bögner Leitung
Telefon: +49 (0)30-88 62 43 13
E-Mail: b.boegner@bassenge.com

Simone Herrmann
Telefon: +49 (0)30-88 91 07 93
E-Mail: s.herrmann@bassenge.com
Sonja von Oertzen
Telefon: +49 (0)30-88 91 07 91
E-Mail: s.v.oertzen@bassenge.com

Laetitia Weisser
Telefon: +49 (0)30-88 91 07 94
E-Mail: l.weisser@bassenge.com

Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind. Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.
MITTWOCH, 26. November 2025
Vormittag 10.00 Uhr
Nachmittag 15.00 Uhr
Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5261
Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5262-5347
Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5348-5475
Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5476-5714
DONNERSTAG, 27. November 2025
Vormittag 11.00 Uhr
FREITAG, 28. November 2025
Vormittag 11.00 Uhr
Nachmittag 16.00 Uhr
SONNABEND, 29. November 2025
Vormittag 11.00 Uhr
Nachmittag 16.00 Uhr
Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6231 Rahmen Nr. 6232-6256
Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6500-6770
Moderne und Zeitgenössische Kunst I Nr. 7000-7284
Moderne und Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8315
Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4101
Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4102-4252
VORBESICHTIGUNGEN
Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts
Erdener Straße 5A, 14193 Berlin
Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 25. November 10.00–17.00 Uhr
Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II
Rankestraße 24, 10789 Berlin
Donnerstag, 20. November bis Donnerstag, 27. November, 10.00–18.00 Uhr
Fotografie und Fotokunst des 19. bis 21. Jahrhunderts
Rankestraße 24, 10789 Berlin
Montag, 17. November bis Freitag, 21. November, 10.00–18.00 Uhr, Samstag 22. November, 10.00–16.00 Uhr, Sonntag geschlossen, Montag, 24. November bis Donnerstag 27. November, 10.00–18.00 Uhr, Freitag, 28. November 10.00–15.00 Uhr
Schutzgebühr Katalog: 20 €
Umschlag: Los 7024, Lesser Ury, Innenseite links Los 7140, Fritz Klimsch, Innenseite rechts Los 7281, Alex Katz. Seite 6 und 7: Los 7283, Martin Eder, © courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn 2025
Geschäftsführung | Management
Graphik, Zeichnungen und Gemälde des 15.–19. Jahrhunderts
David Bassenge
Dr. Ruth Baljöhr – Leitung
+49 (0)30-893 80 29-17 david@bassenge.com
+49 (0)30-893 80 29-22 15th to 19th Century Prints, Drawings and Paintings r.baljoehr@bassenge.com
David Bassenge
Eva Dalvai
Moderne und Zeitgenössische Kunst
+49 (0)30-893 80 29-17 david@bassenge.com
+49 (0)30-893 80 29-80 e.dalvai@bassenge.com
Lea Kellhuber +49 (0)30-893 80 29-20 l.kellhuber@bassenge.com
Nadine Keul +49 (0)30-893 80 29-21 n.keul@bassenge.com
Harald Weinhold +49 (0)30-893 80 29-13 h.weinhold@bassenge.com
Barbara Bögner – Leitung +49 (0)30-88 62 43 13
Modern and Contemporary Art b.boegner@bassenge.com
Katharina Fünfgeld +49 (0)30-88 91 07 90 k.fuenfgeld@bassenge.com
Simone Herrmann +49 (0)30-88 91 07 93 s.herrmann@bassenge.com
Sonja von Oertzen +49 (0)30-88 91 07 91 s.v.oertzen@bassenge.com
Laetitia Weisser +49 (0)30-88 91 07 94 l.weisser@bassenge.com
Photographie
Jennifer Augustyniak – Leitung +49 (0)30-21 99 72 77 Photography jennifer@bassenge.com
Giovanni Teeuwisse +49-(0)30-88 91 08 55 giovanni@bassenge.com
Wertvolle Bücher und Handschriften
Dr. Markus Brandis – Leitung
+49 (0)30-893 80 29-27
Rare Books and Manuscripts m.brandis@bassenge.com
Harald Damaschke +49 (0)30-893 80 29-24 h.damaschke@bassenge.com
Selma Elsayed +49 (0)30-893 80 29-24
s.sayed@bassenge.com
Josephine Faroqhi +49 (0)30-893 80 29-48 j.faroqhi@bassenge.com
Stephan Schurr +49 (0)30-893 80 29-15 s.schurr@bassenge.com
Naomi Schneider +49 (0)30-893 80 29-48 n.schneider@bassenge.com
Autographen | Autograph Letters
Verwaltung | Office
Logistik Management | Logistics
Repräsentanzen | Representatives
München
Rheinland
Dr. Rainer Theobald +49 (0)30-4 06 17 42 r.theobald@bassenge.com
Jenny Neuendorf
+49 (0)30-893 80 29-33
j.neuendorf@bassenge.com
Ralph Schulz +49 (0)30-893 80 29-16 r.schulz@bassenge.com
Harald Weinhold
+49 (0)151-1202 2201 muenchen@bassenge.com
Dr. Mayme Francis Neher +49 (0)175-204 63 23 info@mayme-neher.de
Erdener Straße 5a, 14193 Berlin
Vorbesichtigung Rankestraße 24, 10789 Berlin
Donnerstag, 20. November bis Donnerstag, 27. November 2025
Vorbesichtigung ausgewählter Werke in München
11. bis 14. November 2025
täglich von 11 bis 18 Uhr
Galeriestraße 2B (2. Etage), 80539 München
Der Katalog Moderne und Zeitgenössische Kunst II erscheint nur online, die Auktion findet als Präsenzveranstaltung statt


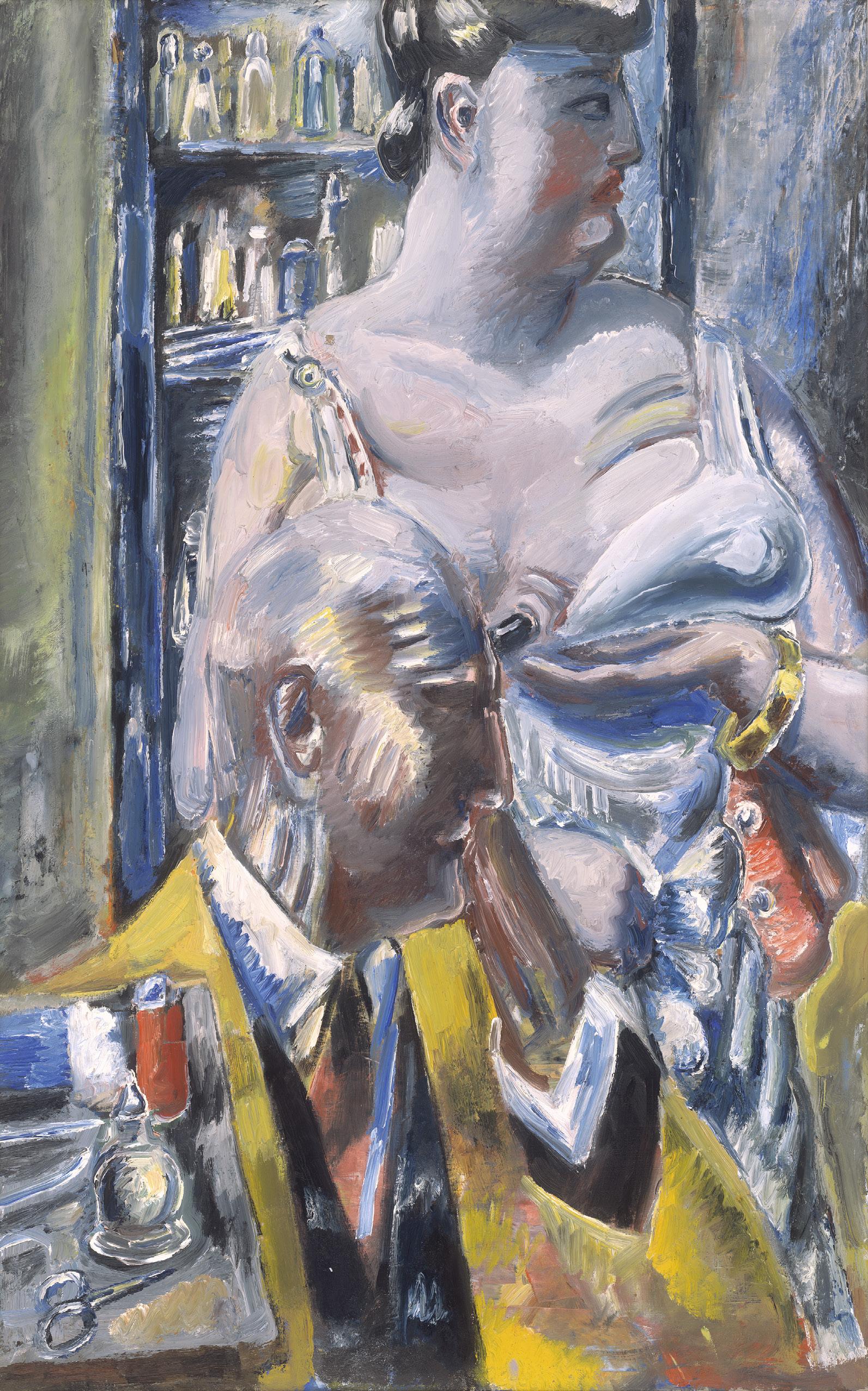
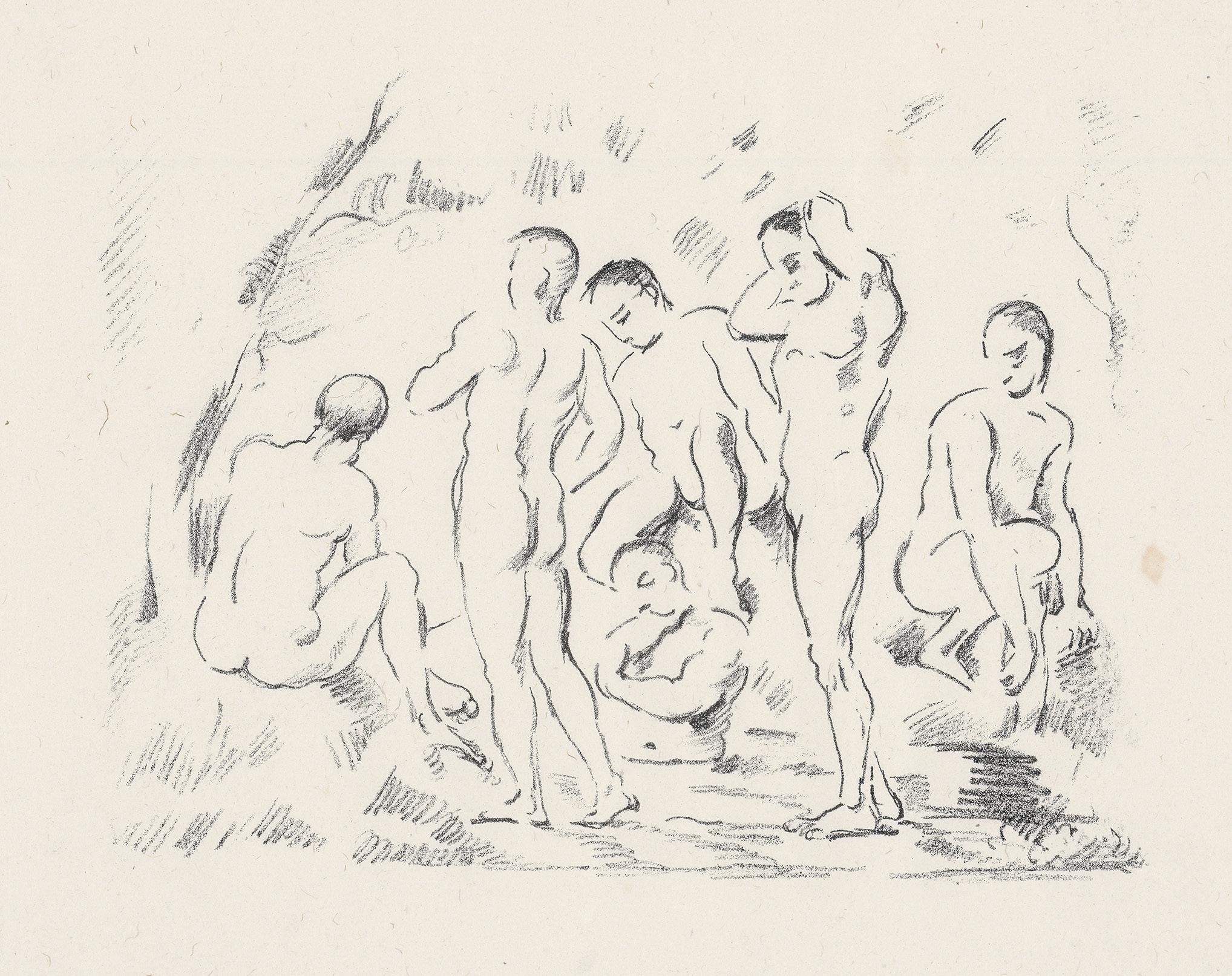
paul cézanne (1839–1906, Aix-en-Provence)
7000 Les Baigneurs (petite planche)
Lithographie auf dünnem Chine volant. 1897. 21,8 x 28,5 cm (35 x 43,2 cm).
Cherpin 6 I (von II), Venturi 1156.
3.500 €
Seit seiner ersten Darstellung des Themas in den 1870er Jahren griff der Künstler das Motiv der Badenden immer wieder auf. Da er selten mit lebenden Modellen arbeitete, entwarf er seine Aktszenen in Landschaften meist aus der Phantasie oder orientierte sich an kunsthistorischen Traditionen. Cézanne verleiht
seinen silhouettenhaft erscheinenden Badenden in der klaren, puren Version des ersten Zustandes, noch vor den Farben, eine zeitlose Qualität. Cherpin notiert für diesen Zustand vor der lithographier ten Signatur eine kleine Auflage von wohl lediglich 10 Exemplaren; die farbige Version erschien in "L‘Album d‘estampes originales de la Galerie Vollard“, 1897, in einer Auflage von 100 Exemplaren. Insgesamt schuf Cézanne nur drei lithographische Arbeiten. Ebenso wie die beiden weiteren Blätter verlegte Ambroise Vollard auch die „Petits baigneurs“ und regte vermutlich damit Cézanne entscheidend in seinem graphischen Schaffen an. Prachtvoller, klarer Druck mit sehr breitem Rand, unten mit dem Schöpfrand. Äußerst selten 7000
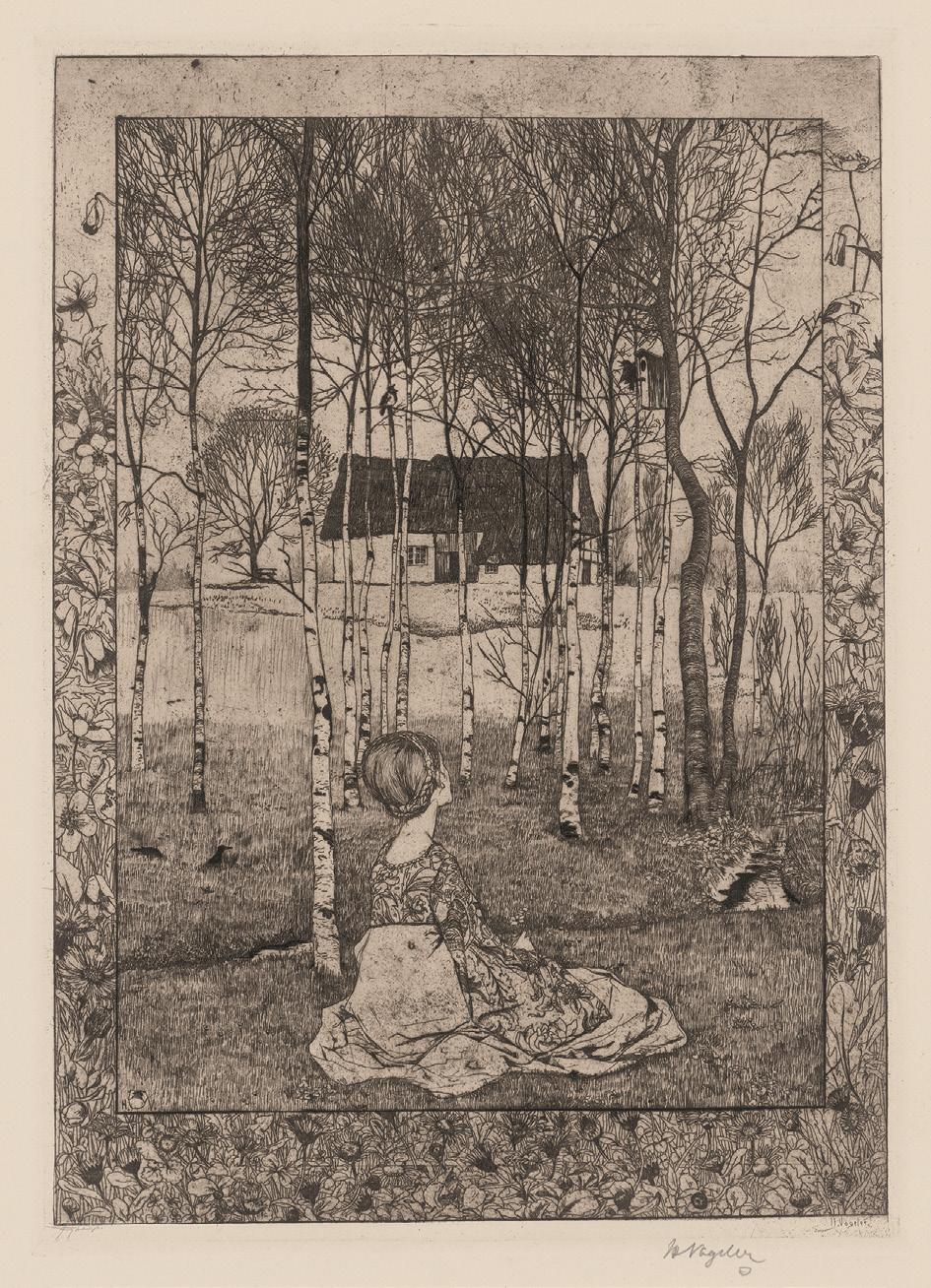
7001
heinrich vogeler
7002 Im Mai
Radierung und Aquatinta in Braun auf Japan. 1897.
34,3 x 24,9 cm (40,8 x 31 cm).
Signiert „HVogeler“ sowie signiert vom Drucker Otto Felsing. Auflage 50 Ex. Rief 16 II b (von d).
800 €
Mit der Remarque im unteren Plattenrand, von der noch unverstählten Platte. Rief notiert unter 16 II c Drucke in Braun, jedoch auf Bütten und wohl bereits ohne Remarque. Prachtvoller, wunderbar nuancierter Druck mit breitem Rand.
heinrich vogeler (1872 Bremen – 1942 Karaganda)
7001 Frühling
Radierung in Braun auf Japan. 1896.
34,5 x 23,8 cm (44,3 x 33 cm).
Signiert „HVogeler“ sowie signiert vom Drucker Otto Felsing. Auflage 50 Ex. Rief 14 II b (von e).
1.200 €
Vor der Ausgabe auf Bütten, gedruckt bei Otto Felsing. Prachtvoller, wunderbar kräftiger Druck in Dunkelbraun mit breitem Rand, unten mit dem Schöpfrand.


paula modersohn-becker (1876 Dresden – 1907 Worpswede)
7003 Die Gänsemagd Radierung mit Aquatinta auf Velin. Wohl 1899/1921-23. 26,2 x 20,9 cm (44,3 x 36,5 cm).
Signiert von Otto Modersohn „O. Modersohn“ und bezeichnet „f. P. Modersohn-Becker“. Werner 7 II nach b. 3.000 €
Lediglich 13 Radierungen schuf Paula ModersohnBecker in den wenigen Jahren als Künstlerin; sie alle entstanden wohl 1899. Der vorliegende postume Abzug wurde von der Worpsweder Künstlerpresse zwischen Mai 1921 und Oktober 1923 im Auftrag von Otto Modersohn gedruckt. Zuweilen trägt die atmosphärische Darstellung auch den Untertitel „Das Märchen von der verlorenen Gans“, der die vorwurfsvolle Haltung der Gänseschar und das Weinen der Magd und des kleinen Mädchens erklärt. Ausgezeichneter Druck mit durchgehendem, zartem Aquatintaton und breitem Rand.
walter leistikow
(1865 Bromberg – 1908 Berlin)
7004 Hügeliges Ufer mit Baumgruppen vor einem Kiefernwald, Abendlicht Öl auf Leinwand. Um 1900. 61 x 71,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „W.Leistikow.“.
40.000 €
Die märkischen Seenlandschaften mit Kiefernbäumen, angestrahlt vom abendlichen Sonnenschein, haben ihn berühmt gemacht. Walter Leistikow gilt als einer der bedeutendsten Vertreter des Deutschen Impressionismus. Er war Künstler, Ausstellungsmacher und Schriftsteller zugleich. Zusammen mit Berliner Künstlerfreunden gründete er die Vereinigung der XI, war Gründungsmitglied der Berliner Sezession und des Deutschen Künstlerbundes in Weimar. Unser Bild zeigt eine seiner typischen Naturansichten, schlicht, ausschnitthaft und mit streng horizontalen Dominanten, belebend rhythmisiert durch die aufstrebenden Baumstämme, die sich im Vordergrund sanft im Wasser spiegeln. Der Blick gelangt
über diesen schmalen Wasserlauf auf eine ansteigende, sonnenbeschienene Wiese mit vereinzelten Baumgruppen im Mittelgrund, hin zu einem breiten Streifen dichten Kiefernwaldes, der sich links bis nahe an das Ufer schiebt und der Komposition rundum einen Abschluss gibt. Das feste Gerüst der Bildkomposition steht dabei noch im engen Zusammenhang der 1890er Jahre, während sich der freier werdende Pinselduktus und die lebendigeren Formen in Annäherung an das Naturvorbild bei Leistikow erst um 1900 durchsetzen. Eine ähnliche Komposition „Abendlicht, Landschaft mit zwei Eichen“, ebenfalls um 1900 datiert, befindet sich in der Berlinischen Galerie. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Dr. Margrit Bröhan, Berlin, vom 11.11.2005. Wohl im Originalrahmen.
Provenienz:
Leo Spik, Berlin, Auktion 23.03.2000, Lot 211 Hampel, München, Auktion 23.09.2005, Lot 116 Kunsthandel Volker Westphal, Berlin (dort erworben 2005) Privatbesitz Berlin


otto antoine
(1865 Koblenz – 1951 Unteruhldingen)
7005 „An der Schlossbrücke“ Öl auf Leinwand. Um 1900.
73 x 95,5 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „Otto Antoine“, verso auf dem Keilrahmen mit Bleistift betitelt.
1.800 €
Nach seiner Ausbildung an der Berliner Akademie bei Franz Skarbina schuf Otto Antoine neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit im Postministerium zunächst vor allem Landschafts und Genreszenen. Bald widmete er sich jedoch der Darstellung belebter Stadtansichten und Straßenszenen, in welchen er seinen eigenen, impressionistischen Stil zu voller Wirkkraft entfaltete und das pulsierende Großstadtleben stimmungsvoll einfing.
Provenienz: Ehemals Sammlung des Museums für Post und Telekommunikation, Frankfurt/Main
otto antoine
7006 Bahnhof Alexanderplatz, Berlin Öl auf Malpappe. Wohl 1914. 23,7 x 30,5 cm.
Unten links mit Pinsel in Braun signiert „Otto Antoine", verso (von fremder Hand) betitelt „Alexanderplatz“ (gestrichen) sowie „Friedrichstraße“.
1.500 €
Treffend erfasst der lebhafte, schwungvolle Pinselduktus des Künstlers das turbulente Treiben am Berliner Bahnhof Alexanderplatz mit der Königsstraße (heute Rathausstraße). Die prominente Stadtansicht im Zentrum der jungen, pulsierenden Metropole malte Antoine mehrfach in ganz ähnlichem Ausschnitt.
Provenienz: Nachlass des Künstlers, Berlin

otto antoine
7007 Brandenburger Tor bei Nacht Öl auf Leinwand, auf Karton kaschiert. Wohl 1914. 23,2 x 31 cm.
Verso (von fremder Hand) betitelt.
1.500 €
Die stimmungsvolle, in der nächtlichen Beleuchtung festlich wirkende Komposition fängt die turbulente Atmosphäre in Antoines Wahlheimat Berlin treffend ein. Dicht gedrängt bewegt sich die Menschenmenge am Pariser Platz rund um das Brandenburger Tor, vom Künstler pastos mit lockerem, sicherem Duktus in den charakteristischen länglichen Tupfen und kurzen, breiten Pinselstrichen in harmonischen Nuancen von Dunkelblau und Orangerot festgehalten.
Provenienz: Nachlass des Künstlers, Berlin


heinrich richter-berlin (1884–1981, Berlin)
7008 Frau am Kornfeld Öl auf Leinwand, doubliert. 1910. 120 x 67 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Blau signiert „Richter-Berlin“, datiert und bezeichnet „Worpswede“, verso am Rahmen mit Hängeetikett, dort von fremder Hand betitelt und mit Künstleradresse.
1.800 €
Nachdem Heinrich Richter sein Studium an der Hochschule der Künste in Berlin (1902/03) vorzeitig beenden musste, weil er ohne Genehmigung bei der Berliner Sezession ausgestellt hatte, setzte er seine Ausbildung in der Kunstschule von Lothar von Kunowski in Berlin fort, die er nach dessen Weggang im Jahr 1909 selbst
übernahm. Richter war Mitbegründer der Künstlergruppe Neue Sezession, sowie mit Künstlern wie Max Pechstein, Georg Tappert und César Klein der legendären Novembergruppe. Für die Zeitschrift Der Sturm entwarf er zahlreiche Holzschnitte und wirkte auch an Franz Pfemferts Die Aktion mit. In vorliegendem Gemälde stellt er eine selbstbewusst vor einem sommerlichen Kornfeld stehende junge Frau dar, die der Künstlerin Clara RilkeWesthoff ähnelt. Die Ortsbezeichnung und Datierung „Worpswede 1910“ lässt vermuten, dass Richter seine Kollegin dort getroffen und gemalt haben könnte. Clara RilkeWesthoff war mit ihrem Mann RainerMaria Rilke über die Jahre viele Male nach Worpswede gereist, wo sie bis zu deren Tod auch eng mit Paula ModersohnBecker befreundet war. Verso mit verblasster weiterer Skizze.
Provenienz: Dannenberg, Berlin, Auktion 20.06.2009, Lot 1438 Privatsammlung Berlin

theo von brockhusen
(1882 Markgrabowa, Ostpr. – 1919 Berlin)
7009 Segelboote auf dem Schwielowsee bei Baumgartenbrück
Öl auf Leinwand. Um 1909. 65 x 80 cm.
Am linken umgeschlagenen Rand mittig mit Pinsel in Blau signiert „Theo von Brockhusen“, verso mit Pinsel in Schwarz (teils verblasst) signiert „Theo von Brockhusen“. Böckel 43.
15.000 €
Ein helles Licht erfüllt die von changierendem Blau, Weiß und Grün bestimmte märkische Seenlandschaft. Den Schwielowsee im Abendlicht, bei Geltow, wo südwestlich von Potsdam die Havel mündet und nach Norden weiterfließt, malt Brockhusen mit stellenweise reliefhaft pastosem Farbauftrag in lebendig variierendem Duktus. Regelmäßig fand der Künstler in Baumgartenbrück Inspirationen für seine stimmungsvollen Landschaftsstücke, die das dortige Havelufer zu verschiedenen Jahres und Tageszeiten,
in immer neuen Lichtverhältnissen und Stimmungen zeigen. Theo von Brockhusen studierte zunächst in Königsberg, u.a. bei Ludwig Dettmann, 1904 siedelte er nach Berlin über, wo er 190613 Mitglied der Sezession war; durch seine jährlichen Malaufenthalte in der Gaststätte Baumgartenbrück am Schwielowsee wurde er einer der bedeutendsten Künstler der Havelländischen Malerkolonie. In dieser Zeit entstand eine enge Zusammenarbeit mit Paul Cassirer. Bekanntheit erlangte von Brockhusen insbesondere durch seine Landschaftsdarstellungen, die stark durch seinen Lehrer Dettmann, später dann durch Max Liebermann in Malweise und Sujet beeinflusst wurden. Ab 1909/10 setzte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk van Goghs ein, dessen Einfluss in dem vorliegenden Gemälde unverkennbar ist. In Pinselduktus und Komposition souverän ausgeführte Arbeit von großer farblicher Leuchtkraft. Bis März 2026 findet im Potsdam Museum eine Ausstellung des Künstlers statt.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 47, 25.11.1995, Lot 160 Privatbesitz Berlin

hans baluschek
(1870 Breslau – 1935 Berlin)
7010 „Kuss“
Ölkreide, Gouache und farbige Kreiden auf dicker Malpappe. 1900.
97,5 x 65,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „HBALUSCHEK“ (teils ligiert) und datiert, verso nochmals mit Pinsel in Schwarz signiert „HBALUSCHEK - BERLIN“ und betitelt. Nicht bei Meißner.
15.000 €
Ein umschlungenes Liebespaar. Ein sanfter Kuss. Noch vor seinem Wiener Künstlerkollegen Gustav Klimt malt der Berliner Sezessionist Hans Baluschek ein sich küssendes Paar vor hügeliger, leicht bewaldeter Landschaftskulisse, rechts mit Ausblick auf den Rand der Stadt. Ausschnitthaft, aber wuchtig und groß, platziert er seine beiden Protagonisten auf einer Malpappe im schmalen, schwarz umrandeten Hochformat. Ein junger Mann in preußischer Uniform, der sein Mädchen küsst. Er noch leicht unbeholfen mit gespitzten Lippen, sie hingebungsvoll in seinen Armen. Ein Abschied? Sofort bekommt die Szene neben dem romantischen auch einen unbehaglichen Aspekt. Der düstere Grundton tut sein Übriges. Die äußerlich glanzvolle Kaiserzeit hatte Makel, die es aufzuzeigen galt. Baluschek gehörte 1898 zu den Mitbegründern der Berliner Sezession und befand sich zu dieser Zeit als junger Künstler in der Findungsphase seines künstlerischen Stils und seiner Position in der Kunstszene Berlins. In Opposition zur traditionellen akademischen Malerei umgab sich Baluschek vor allem mit Gleichgesinnten und zählte mit Heinrich Zille und Käthe Kollwitz zu den Hauptvertretern des Berliner Realismus um 1900. Anders als die Kollegen in Wien um Gustav Klimt, hatte die Malerei in Berlin, neben impressionistischen und symbolistischen Tendenzen, auch von Anfang an eine ausgeprägte Affinität zum Realismus und zur politischsozialkritischen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Um der düsteren Atmosphäre mehr Gewicht zu verleihen, verzichtet Baluschek bewusst auf den Einsatz von glänzenden Ölfarben und bearbeitet seinen Bildträger in einer eigens erfundenen Maltechnik derart mit Ölstiftkreide, dass ihm ein stumpfer, matter Gesamteindruck zu Grunde liegt. Darüber setzt er farbige Flächen in Gouache oder Aquarell und arbeitet zuletzt alle Details, die Binnenzeichnung oder auch die Physiognomie der Gesichter, mit spitzem Kreidestift heraus. Diese Kombination der einzelnen Maltechniken verleiht dem Werk einen unverwechselbaren Charakter. Das Bild entstand zwei Jahre vor der Heirat Baluscheks mit der Theaterschauspielerin Charlotte von PaztkaLipinski. Beide kannten sich schon im Jahr 1900, und so bekommt die bedeutende Zeichnung des Künstlers, aus der Hauptzeit seines Schaffens, noch eine ganz persönliche Note.
Provenienz:
Privatbesitz Berlin
Bassenge, Berlin, Auktion 63, 04.06.1994, Lot 6000 Privatsammlung Berlin

hans neumann
(1873 Kassel – 1957 München)
7011 Vampyr
Farbholzschnitt auf feinem Japan. Um 1902. 34,9 x 28 cm (42 x 30 cm).
1.800 €
Gemeinsam mit seinem Bruder Ernst gehörte Hans Neumann zum Mitarbeiterkreis der Zeitschrift „Jugend“, wo Otto Eckmann die Beschäftigung mit dem Farbholzschnitt angeregt hatte. Hans Neumann widmete sich daraufhin intensiv diesem Medium und schuf einige der eindrucksvollsten Farbholzschnitte des Münchner Jugendstils, von denen „Vampyr“ sicherlich die rätselhafteste Komposition ist. Prachtvoller Druck mit feinen Farbabstufungen, mit Rand bzw. kleinem Rand.

leopold löwy
7013 Phantasiewesen frontal Öl und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-20.
14,3 x 9,3 cm.
Oben mittig mit Feder in Schwarz bezeichnet „699“.
800 €
Löwys zeichnerisches Talent fand Ausdruck in pointierten Karikaturen bekannter Persönlichkeiten seiner Zeit, die in verschiedenen Wiener Illustrierten publiziert wurden. 1920 illustrierte er außerdem eine Sammlung selbst verfasster Tierfabeln, in denen er menschliche Schwächen in scharfzüngigen, bisweilen düsteren Geschichten spiegelte. Das Tier als Sinnbild des menschlichen Wesens wurde auch in seinen Zeichnungen immer wieder aufgegriffen.
Provenienz:
Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien
Privatbesitz Wien
Galerie bei der Oper, Wien
Privatbesitz Wien
leopold löwy (1871–1940, Wien)
7012 Phantasiewesen mit Knollennase Öl, Bleistift und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-20.
14,7 x 9,7 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „LL“ (ligiert) und bezeichnet „1173“.
800 €
Seitlich blickt das seltsame Wesen aus dem Bild heraus, auf dem Kopf ein geradlinig drapiertes Haarbüschel. Mit unglaublich feiner Linienführung und stimmiger Hintergrundbelichtung beweist Löwy auch in diesem Miniaturportrait sein ganzes Können.
Provenienz:
Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien
Privatbesitz Wien
Galerie bei der Oper, Wien
Privatbesitz Wien
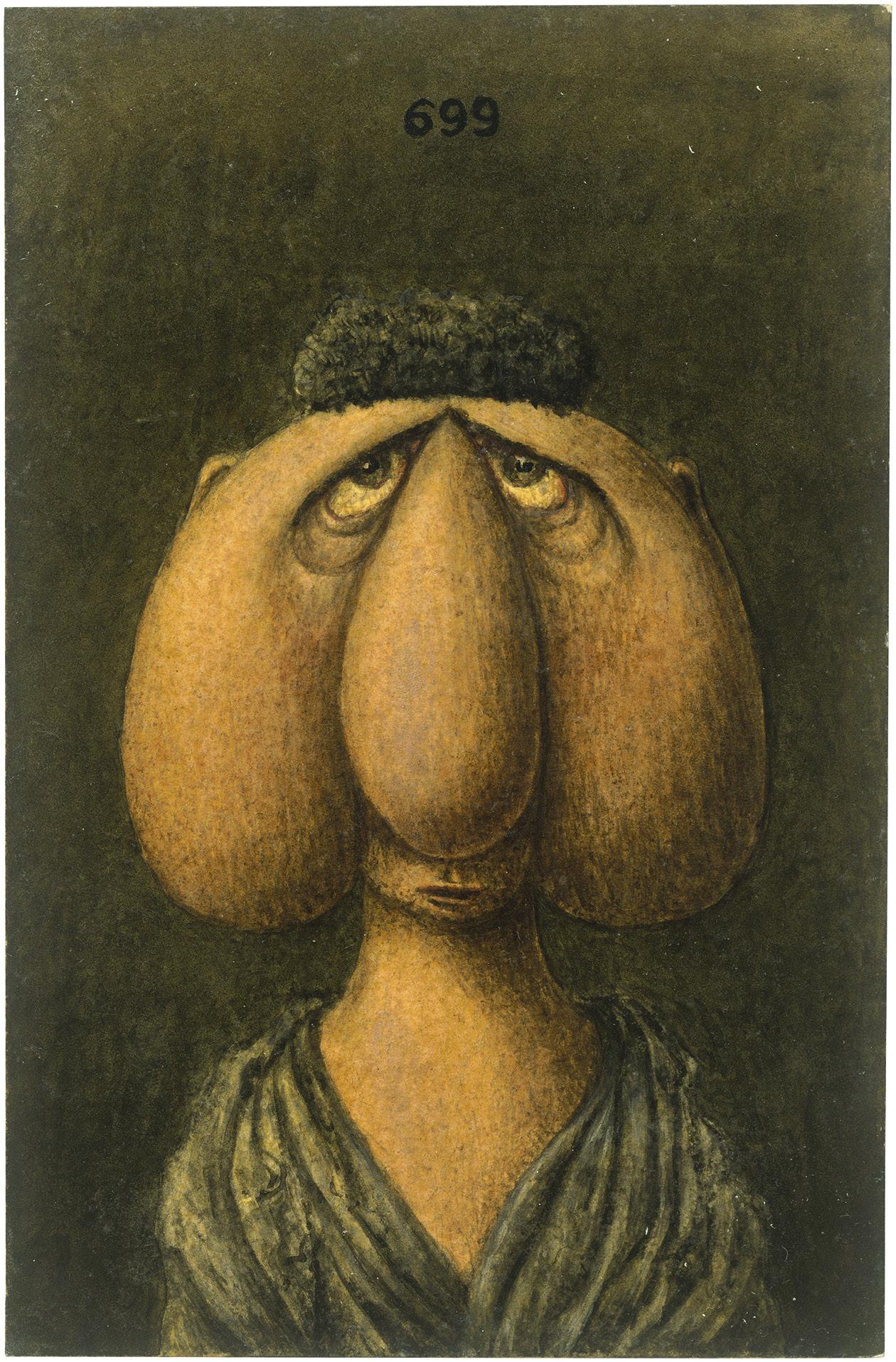

leopold löwy
7015 Phantasiewesen mit langem Hals
Öl, Bleistift und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-20.
13,4 x 9 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „LL“ (ligiert) und mit Pinsel in Braun bezeichnet „264“.
800 €
Aus dem schwarzen Hintergrund schaut uns ein Kopf auf zwei Beinen mit merkwürdig verschobenen Gesichtszügen entgegen; von Löwy feinsinnig gezeichnet und mit subtilen Schattierungen plastisch durchgestaltet.
Provenienz:
Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien
Privatbesitz Wien
Galerie bei der Oper, Wien
Privatbesitz Wien
leopold löwy
7014 Kopf mit Raubtierzähnen
Öl auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-20.
13,9 x 9 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz bezeichnet „977“.
800 €
Die Stirn in Falten gelegt und mit zugekniffenenen Augen neigt sich der Kopf des Fabelwesens in den Bildraum hinein und wirkt dabei fast amüsiert. Dominiert wird der Kopf von zwei großen geschwungenen Ohren, einer knolligen Nase und zwei scharfen Zähnen.
Provenienz:
Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien
Privatbesitz Wien
Galerie bei der Oper, Wien
Privatbesitz Wien

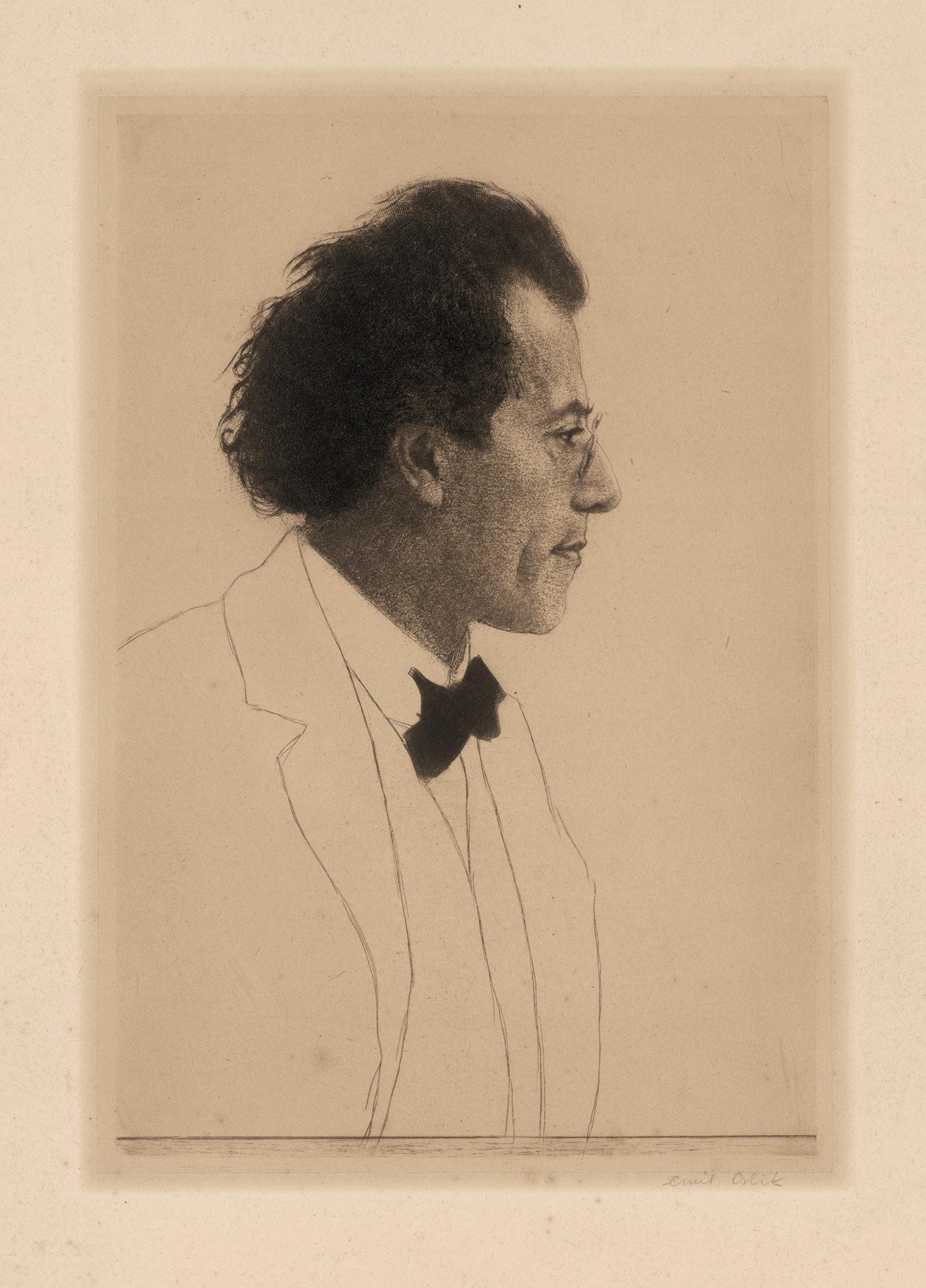

emil orlik
(1870 Prag – 1932 Berlin)
7016 Portrait Gustav Mahler (Brustbild im Profil nach rechts)
Kaltnadel, Roulette und Vernis mou in Dunkelbraun auf festem Velin. 1902.
29,2 x 20,1 cm (48 x 30,5 cm).
Signiert „emil Orlik“.
Voss-Andreae R 127.
4.000 €
Eines der bedeutendsten Portraits von Emil Orlik zeigt Gustav Mahler auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Das Bildnis wurde zwischen 1902 und 1904 nur in einzelnen Exemplaren auf verschiedenen Papieren gedruckt; eine Auflage existiert nicht. Schöner, klarer Druck mit deutlich zeichnender Plattenkante und breitem Rand, rechts und oben mit dem Schöpfrand.
7017 NihonBashi, Tokio (RemarqueAbdruck)
Farblithographie auf Velin. 1900.
19,2 x 18,3 cm (36,9 x 27 cm).
Signiert „Emil Orlik“ und mit dem Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.
Voss-Andreae L 73 a.
1.200 €
Erschienen als Blatt 1 der Mappe „Aus Japan“. Die Mappe enthielt insgesamt 16 Graphiken, die während Orliks erster Japanreise im Februar 1900 entstanden und die er 1904 in einer Mappe zusammenfasste. Die geplante Auflage von 50 Exemplaren wurde jedoch laut der Galerie Glöckner nicht ausgedruckt oder teils zerstört.
Farblich sehr schön nuancierter Druck mit den Remarquen in Blau. Selten
7018 Straßenszene
Pastell auf grauem Velin. 1913.
24,8 x 32 cm.
Unten rechts mit Kreide in Schwarz signiert „Orlik“ und datiert sowie (schwer lesbar) bezeichnet.
1.200 €
Die lebendige Straßenszene fängt in heller Tonalität die turbulente Menschenmenge und die heitere Stimmung des Ortes ein. Wohl auf einer seiner Reisen zeichnete Orlik die fernöstlich wirkende Szenerie.
Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

emil orlik
7019 Sitzender weiblicher Akt
Farbige Kreiden und Pinsel in Schwarz auf grauer Malpappe. 1908.
56,3 x 47 cm.
Seitlich links mit Bleistift signiert „Orlik“ und datiert.
1.500 €
Nach dem Bade sitzt die junge Frau, sich die Füße abtrocknend, ein Handtuch zum Turban um den Kopf gebunden, vor unbestimmtem dunklem Hintergrund. Orlik zeichnet den sehr präsenten, zusammengekauerten Körper des Modells mit weichen Konturen und sanften Schattierungen in harmonischer Tonalität. Im Jahr 1908 wurde Orlik Mitglied der Berliner Sezession.
Provenienz:
Grisebach, Berlin, Auktion 119, 04.06.2005, Lot 625
Privatbesitz Süddeutschland
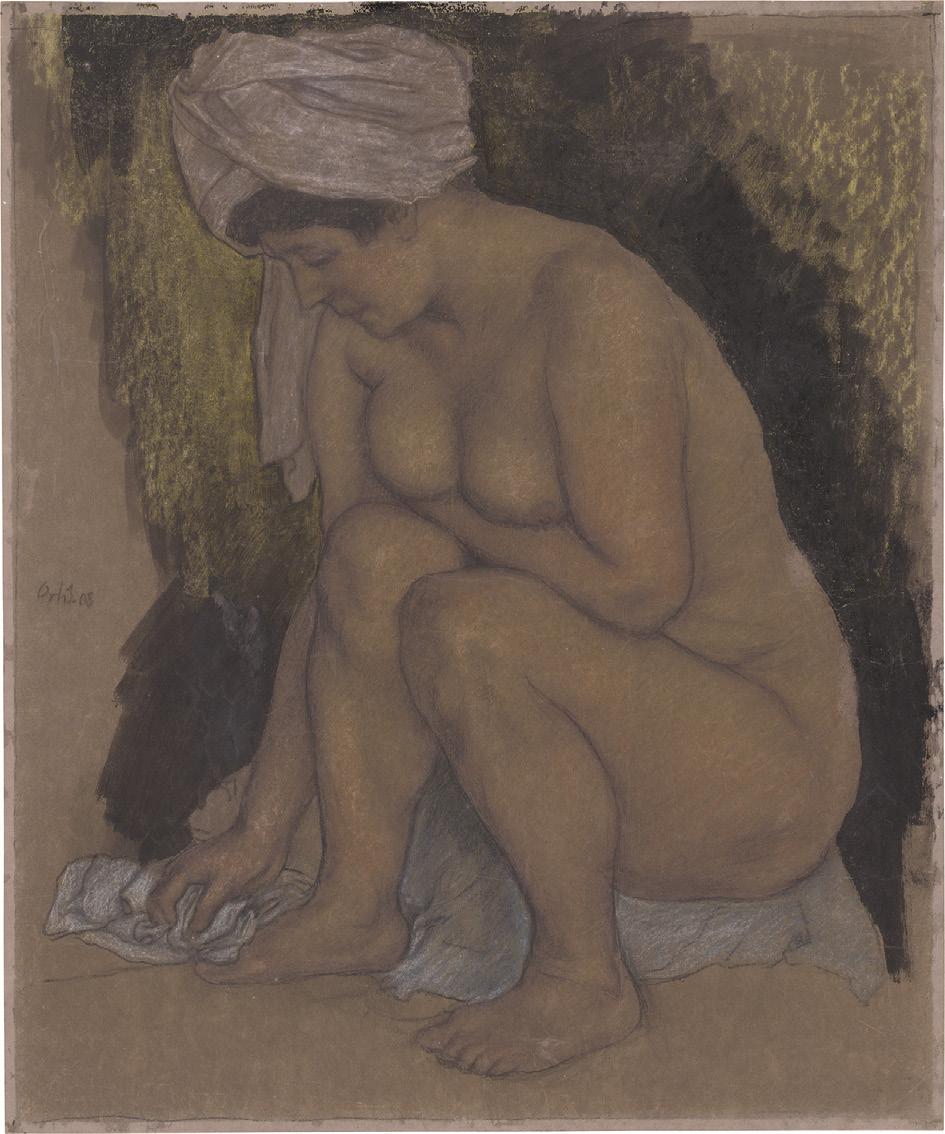


curt herrmann (1854 Merseburg – 1929 Erlangen)
7020 Waldlandschaft
Öl auf dicker Malpappe, kaschiert auf Hartfaser.
48,2 x 35,3 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „CH“ (im Kreis, ligiert).
7.000 €
Wie nebeneinandergesetzte Mosaiksteine tupft Curt Herrmann die leuchtend grünen, bauchig runden Pinselstriche locker auf den Bildträger. Im sanften Licht des Sonnenaufgangs stehen die teils roten oder blauen, linearen Baumstämme deutlich im Kontrast zu Buschwerk und Baumkronen. Fast schon abstrakt wirkt die spontane, in sich schlüssige Komposition mit der schräg angedeuteten Lichtung im Vordergrund. Es wird wohl eine spätere Arbeit Herrmanns sein, der als einer der deutschen Neoimpressionisten gilt. Den Landschaftsausschnitt wählte er vermutlich in Pretzfeld, nördlich von Forchheim in der fränkischen Schweiz, wo die Familie seiner Frau ein Schloss besaß und er ab 1919 bis zu seinem Tod lebte und arbeitete.
Provenienz: Privatsammlung Berlin
albert marquet
(1875 Bordeaux – 1947 Paris)
7021 Paysage près de Cannes
Rohrfeder in Schwarz auf dünnem Velin, ganzflächig auf festes Velin kaschiert. Um 1905. 26 x 33,5 cm.
Unten links mit Feder in Schwarz signiert „Marquet“. 3.000 €
Schöne Landschaftszeichnung der FauvesZeit. Nach einer ersten gemeinsamen Ausstellung mit Matisse in der Pariser Galerie Berthe Weill 1902 zeigte Marquet seine Arbeiten 1905 im Pariser Salon d’Automne gemeinsam mit seinem engen Freund Henri Matisse, Maurice de Vlaminck, André Derain und anderen Künstlern. Diese Ausstellung führte zu einem Skandal, der den Kunstkritiker Louis Vauxcelles zur Prägung des Begriffs „Fauvismus“ inspirierte.
Provenienz: Privatsammlung Berlin
Ausstellung: Die Graphiksammlung Richard Bühler, Kunstmuseum Winterthur 1962, Nr. 1345

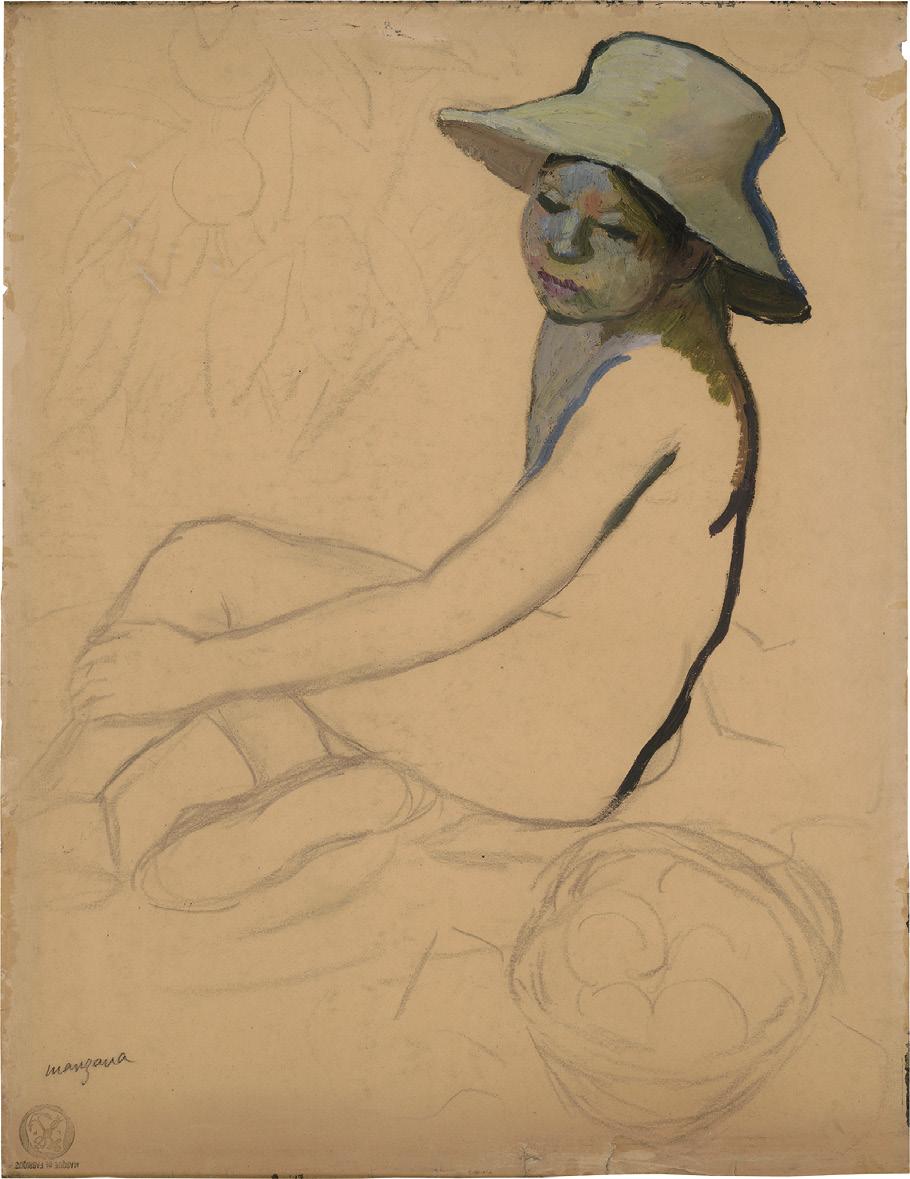
pablo picasso (1881 Málaga – 1973 Mougins)
7022 Le Repas Frugal
Radierung auf Van Gelder Zonen-Velin. 1904/13. 46,5 x 37,5 cm (60 x 50 cm).
Geiser/Baer 2 II c, Bloch 1.
15.000 €
Die frühe, zweite Radierung des erst 23jährigen Picasso und zugleich seine einzige Druckgraphik der Blauen Periode. Stilistisch zeigt sich diese Phase in einer melancholischen Grundstimmung des Blattes, dem Sujet der Armut und einer manieristisch erscheinenden Darstellung der Körper, Hände und Gestik. Feine Linien und Schraffuren schildern die Nuancen von Licht und Schatten und betonen die eingefallenen Gesichter und hageren Körper des Paares. Der Künstler nutzte hier eine alte Zinkplatte seines Mitbewohners im Atelier Bateau Lavoir in Paris, Joan Gonzáles. Dafür schliff Picasso dessen frühere Landschaftskomposition ab, doch sind noch immer im Hintergrund, vor allem hinter Kopf und Schulter der Frau, Reste der vorigen Radierung in Form einiger schwebender Grasbüschel sichtbar. Aus der Suite der Saltimbanques, dieser Abzug gedruckt 1913 bei Louis Fort, Paris, von der gestrichenen verzinkten Platte, mit der spiegelverkehrten Datierung „31. Oct. 1913“ in der Platte. Ganz ausgezeichneter Druck mit breitem Rand.
Provenienz:
Ehemals Sammlung Ferdinando Salamon, Turin (mit dessen Sammlerstempel verso, Lugt 3406)
georges manzana-pissarro (1871 Louveciennes – 1961 Menton)
7023 Kleiner Junge mit Hut Öl und Bleistift auf braunem Velin.
64,8 x 50,2 cm. Unten links mit Kohlestift signiert „manzana“. 1.200 €
Georges Henri Pissarro, besser bekannt unter dem Künstlernamen ManzanaPissarro, war ein bedeutender französischer Maler und Graphiker, der in der Tradition des Impressionismus und Neoimpressionismus arbeitete. Als zweiter Sohn von Camille Pissarro wuchs er in einem künstlerisch geprägten Umfeld auf und kam früh mit Größen wie Monet, Renoir, Cézanne und Gauguin in Kontakt Einflüsse, die seine eigene künstlerische Entwicklung entscheidend prägten. Seine frühen Arbeiten stehen stilistisch in enger Verbindung mit dem Werk seines Vaters.
Provenienz:
Thierry de Maigret, Paris, Auktion 07.07.2023, Lot 113 Privatbesitz Berlin
lesser ury (1861 Birnbaum – 1931 Berlin)
7024 Burg am Fluss, Abendstimmung, Burg Saaleck (Der Fuchsturm bei Jena) Öl auf Leinwand. 1904/05.
69,9 x 100 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Orangegelb signiert „L. Ury“, verso auf der Leinwand rundes Nachlassetikett (verblasst), dort numeriert „124“.
50.000 €
Schwefelgelb leuchten die letzten Strahlen der untergehenden Sonne, während eine ganz eigentümliche Stille das Bild erfüllt. Ury erfasst die Landschaft im Gegenlicht in meisterlicher, beinahe silhouettenhafter Weise und erzielt durch diese Lichtführung einen beeindruckenden Abstraktionsgrad und Kontrastreichtum. Das warme, weiche Strahlen lässt Burg und Berg nur im Umriss als flächenhafte dunkle Formen erkennbar werden. Hoch über der breit in den Vordergrund dahinfließenden Saale erhebt sich die Burgruine, vermutlich nicht, wie seit 1931 angenommen, der Fuchsturm bei Jena, sondern Sibylle Groß zufolge möglicherweise die Burg Saaleck. Nach Thüringen und in die angrenzenden Regionen reiste Ury seit den 1890er Jahren mehrfach, und zur Entstehungszeit des Gemäldes, 1904/05, hielt er sich sicher dort auf. Die subtilen Veränderungen in der Szenerie durch die Nuancierungen und Brechungen des allmählich schwindenden Lichts faszinierten Ury immer wieder und regten ihn zu einigen seiner markantesten, eigenwilligsten Kompositionen an. „Die Landschaften Ury’s sind so außerinhaltlich, so visionär, dass sie sich nur sehen und fühlen, kaum besprechen lassen“, schrieb der Philosoph Martin Buber 1903 (Martin Buber, Lesser Ury, in: Jüdische Künstler, Berlin 1903,
S. 50). Das Gemälde mit der ungewöhnlichen Lichtstimmung befand sich bei Urys unerwartetem Tod 1931 in seinem Nachlass und wurde zunächst mit der Gesamtheit des Bestandes aus der Atelierwohnung am Nollendorfplatz in die Berliner Nationalgalerie gebracht. Von dort gelangten zahlreiche besonders wertvolle Arbeiten, darunter 129 Gemälde und viele Papierarbeiten, in die Berliner Galerie von Paul Cassirer, wo sie 1932 erst ausgestellt und anschließend zur Versteigerung angeboten wurden. Unter dem Titel „Der Fuchsturm bei Jena, Abendstimmung“ erhielt das vorliegende Gemälde dort die Losnummer 47. Die Echtheit dieser Arbeit wurde von Dr. Sibylle Groß, Berlin, am 06.12.2021 bestätigt. Das Gemälde wird in das in Vorbereitung befindliche Verzeichnis der Gemälde und Pastelle Lesser Urys aufgenommen. Eine Kopie ihrer Expertise liegt der Arbeit bei.
Provenienz:
Nachlass Lesser Ury, Inventarliste des künstlerischen Nachlasses vom 21.11.1931, Nr. 124
Galerie Paul Cassirer, Berlin, Auktion 21.10.1932, Nr. 47 (dort betitelt: Der Fuchsturm bei Jena, Abendstimmung; unverkauft)
Max und Amalia Intrator, Zürich/New York (spätestens 1939 erworben)
Privatbesitz USA (durch Erbschaft)
William Doyle, New York, Auktion 11.05.2022, Lot 25
Privatsammlung Niedersachsen
Ausstellung:
Lesser Ury, GedenkAusstellung, Nationalgalerie Berlin 1931, Nr. 104 (dort betitelt: Der Fuchsturm bei Jena)


lesser ury
7025 Rauchender Herr im Café III
Lithographie auf Bütten. 1919.
27,1 x 19 cm (30,8 x 22,2 cm).
Signiert „L. Ury“. Auflage 30 num. Ex. Rosenbach 72.
1.800 €
Erschienen im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin. Brillanter, tiefschwarzer Druck mit kleinem Rand.
lesser ury
7026 Herr mit Zylinder vor einem Kaffeehausfenster –in Rückenansicht
Radierung auf Bütten. 1923.
23,8 x 18 cm (32,5 x 27,8 cm).
Signiert „L. Ury“. Auflage 100 Ex. Rosenbach 91.
2.500 €
Besonders stimmungsvolles Blatt, in einer Gesamtauflage von 110 numerierten Exemplaren, hier eines der 100 Exemplare auf Bütten, jedoch ohne die Numerierung. Erschienen im PropyläenVerlag, Berlin, als Beitrag zu der Sammelmappe „Acht OriginalRadierungen“. Prachtvoller, kräftiger und nuancierter Druck mit Rand.
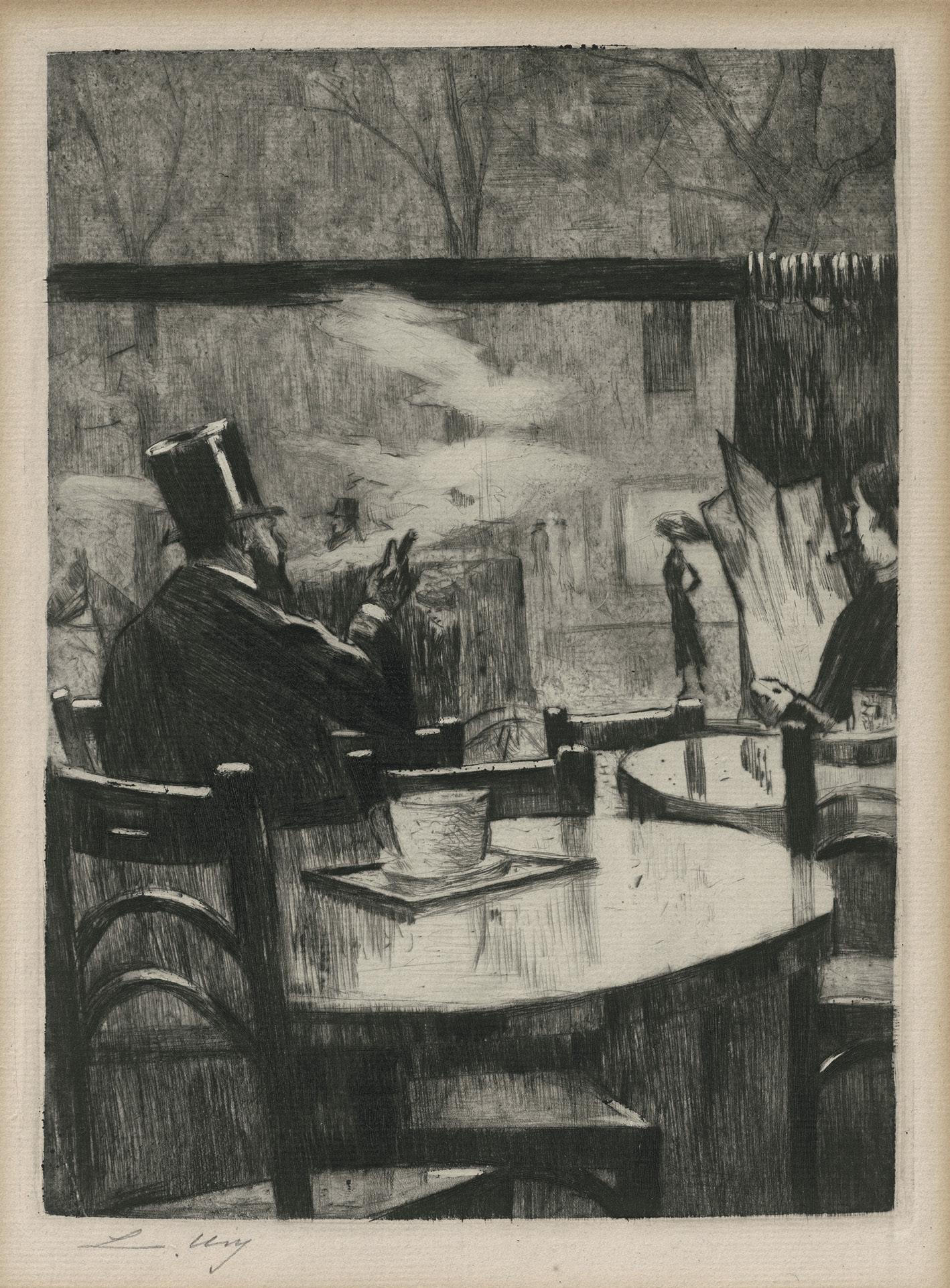
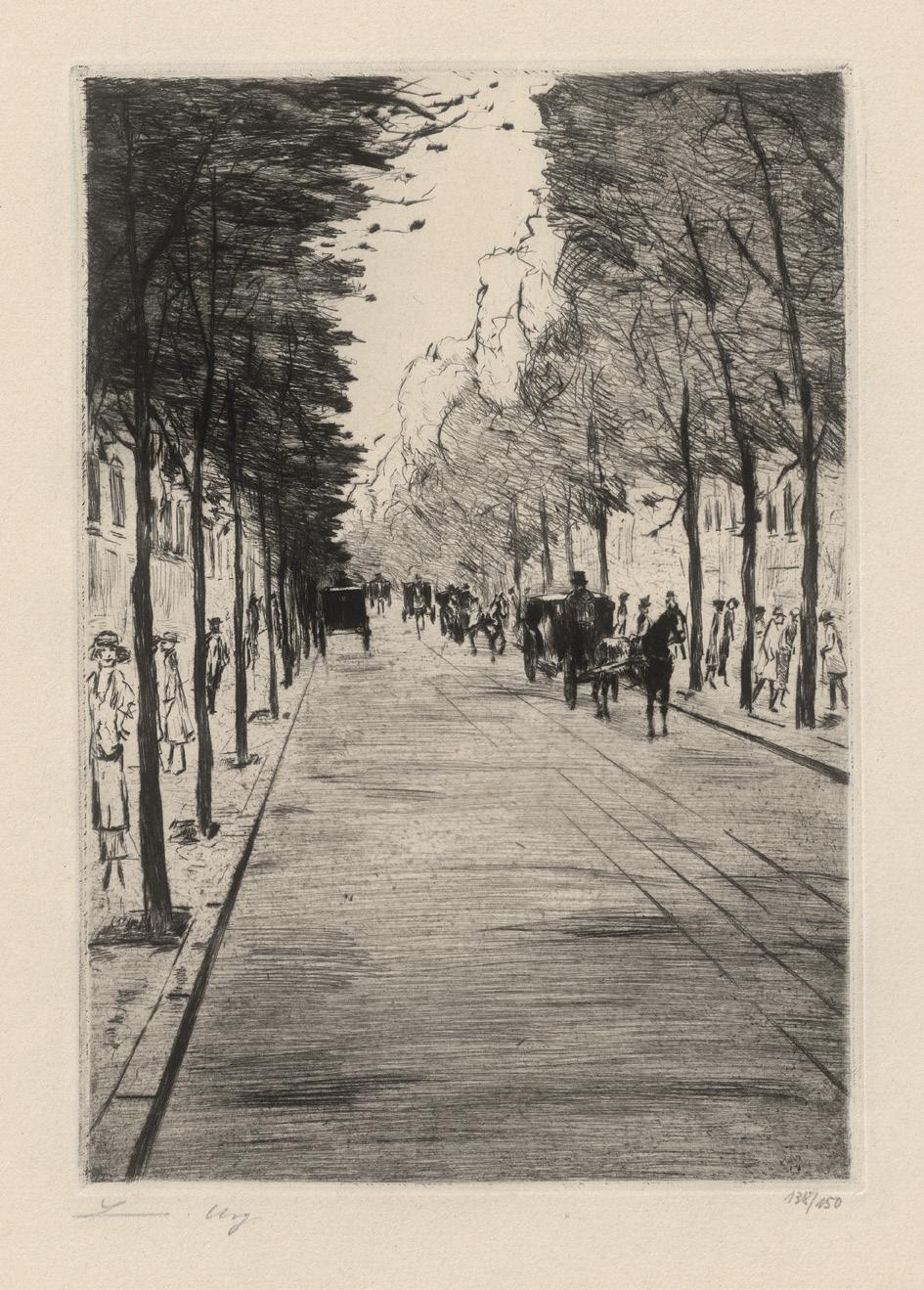
lesser ury
7027 Berliner Droschke rechts wartend im Tiergarten Radierung auf Bütten. Um 1920. 22,3 x 15,6 cm (36,5 x 26,2 cm).
Signiert „L. Ury“. Auflage 150 num. Ex. Rosenbach 45.
1.500 €
Prachtvoller Druck mit Rand.
lesser ury
7028 Regennasse Tiergartenallee mit Pferdedroschken: Dame mit Schirm überquert die Straße Radierung auf Bergisch Gladbach-Bütten. 1921. 19,6 x 14 cm (28,4 x 22,3 cm).
Signiert „L Ury.“. Auflage 110 Ex. Rosenbach 49.
1.200 €
Aus der Werkgruppe III Berliner Straßenszenen. Eines von 110 Exemplaren der Auflage ursprünglich eingebunden in die Vorzugsausgabe der Monographie von Adolph Donath, „Lesser Ury. Seine Stellung in der modernen deutschen Malerei“, erschienen im Verlag Max Perl, Berlin. Prachtvoller Abzug mit feinem Grat und breitem Rand.

lesser ury
7029 Hochbahnhof Nollendorfplatz von der Bülowstraße aus gesehen, Berlin Öl auf Leinwand. Anfang 1920er Jahre.
52 x 35 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „L. Ury“, verso auf dem Keilrahmen Stempel „LEOPOL(D HESS)/ Kunstmaterial(ien)/Berlin W., Genthiner-(...)“.
130.000 €
Er steht mitten auf dem Trottoir der belebten Bülowstraße und blickt zum Nollendorfplatz. Um diesen Blick einzufangen, verließ Ury die Isolation des Dachgeschosses direkt am Nollendorfplatz 1, die er zunehmend der menschlichen Gesellschaft vorzog, und wo er aus seinem Fenster in der vierten Etage einen guten Blick hatte. Rund um das (im Zweiten Weltkrieg zerstörte) Haus, in dem Ury von 1901 bis zu seinem Tod Wohnung und Atelier besaß, hielt er im Laufe von drei Jahrzehnten den Platz und die Umgebung in vielen Varianten, zu verschiedenen Jahres und Tageszeiten künstlerisch fest. Heute erinnert am Bahnhof Nollendorfplatz, Nordausgang Kleiststraße, eine Gedenktafel an den Künstler. Das Spiel von Licht und Schatten auf der regennassen Straße belebt die urbane Szene der jungen Metropole ebenso wie die eleganten Passanten. Die vorbeiflanierenden Großstadtgeschöpfe, zarte und doch anonym bleibende schlanke Gestalten, dienen Ury in erster Linie als koloristische Objekte. Ein Vergleich ihrer Kleidung mit der Damenmode der Zeit legt Sibylle Groß zufolge eine Datierung des Gemäldes in die frühen 1920er Jahre nahe. Die Autos und die architektonische Kulisse des Bahnhofsgebäudes, ein glanzvoller Kuppelbau, wirken wie Insignien des pulsierenden Stadtverkehrs, den man im Bild bei
nahe als Geräuschkulisse wahrzunehmen scheint. Zunächst hatte sich Ury davor gescheut, Autos zu malen und blieb lange lieber bei den altvertrauten Pferdedroschken. Erst um 1920 tauchten regelmäßiger Autos in seinen Gemälden auf. Insgesamt jedoch dominieren weniger die konkreten Bildgegenstände das Gemälde, sondern vielmehr das Atmosphärische: Das Dämmerlicht, die Wolken und eine geradezu spürbare Luftfeuchtigkeit stehen im Vordergrund, festgehalten in feinsten wolkigweich aufgetragenen Zwischentönen, den charakteristischen blaubräunlichen Nuancen. „Er malt den Übergangszustand von Energie in Materie, überhaupt, nicht den Gegenstand, sondern einen Zustand.“ (Joachim Seyppel, Lesser Ury. Der Maler der alten City, Berlin 1987, S. 131). Die Echtheit dieser Arbeit wurde von Dr. Sibylle Groß, Berlin, am 10.05.2021 bestätigt. Das Gemälde wird in das in Vorbereitung befindliche Verzeichnis der Gemälde und Pastelle Lesser Urys aufgenommen. Eine Kopie ihrer Expertise liegt der Arbeit bei.
Provenienz:
Sammlung S. (bis 1935) Internationales Kunst und Auktionshaus Berlin, Auktion 2333, 12.03.1935, Lot 105 (dort betitelt „Untergrundbahnhof Nollendorfplatz in Berlin“)
Privatsammlung Rheinland/Süddeutschland (seit den 1950er/1960er Jahren)
Lempertz, Köln, Auktion 17.06.2021, Lot 100
Privatsammlung SchleswigHolstein
Literatur:
Preisberichte, Internationales Kunst und Auktionshaus, Berlin, 12. März 1935, in: Weltkunst, 17.03.1935, Nr. 11, S. 4


7030
ulrich hübner
(1872 Berlin – 1932 Neubabelsberg)
7030 Griebnitzsee mit Blick in Richtung Kaiserstraße Öl auf Leinwand. 1918.
66 x 93 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „Ulrich Hübner“ und datiert.
Westerhausen 225.
1.800 €
Den wunderbar stimmungsvollen Blick über den Griebnitzsee erfasst Hübner in den ruhigen Abendstunden, in denen sich die Landschaft schon rot einzufärben beginnt. Der Künstler begann seine akademische Ausbildung in Karlsruhe, kehrte dann nach Berlin zurück und beendete sein Studium an der privaten Malschule von Conrad Fehrs. Mitglied der Berliner Sezession wurde Hübner 1899 und gehörte schon 1906 und 1907 deren Vorstand an. Ab 1914 lebte der Künstler in PotsdamBabelsberg.
Provenienz:
Auktionshaus Quentin, Berlin, 20.10.2012, Lot 44
Privatbesitz Berlin
max liebermann (1847–1935, Berlin)
7031 Das Konzert Kaltnadel, mit Kreide in Schwarz überarbeitet, auf Kupferdruckkarton. 1922.
23,5 x 31 cm (35,6 x 47 cm).
Signiert „MLiebermann“ und bezeichnet „I/2 überarbeitet“. Schiefler 344 I a (von III d).
3.000 €
Einer von nur zwei bei Schiefler erwähnten Abzügen des ersten Zustandes, mit der noch ziemlich hellen Zeichnung, vor den Schattenpartien in den Vordergrundfiguren und der deutlich sichtbaren Figur des Dirigenten. Prachtvoller, samtiger Abzug mit stark ausgeprägter Plattenkante und mit breitem Rand, einige Partien mit Kreide überarbeitet. Der Arbeitsprozess des Künstlers wird hier sichtbar: Mit seinen Überarbeitungen bereitet Liebermann bereits die Entwicklung zum zweiten Druckzustand vor, indem er im Vordergrund Dunkelheiten hinzufügt, die er locker mit schwarzen Kreideschwüngen in den Druck zeichnet. Sehr selten.
Provenienz: Ehemals Sammlung Stinnes & Klipstein (verso mit deren Sammlerstempel, Lugt 2373 A)

7031
max liebermann
7032 Badende Jungen
Kaltnadel auf festem Van Gelder Zonen-Velin. 1914. 19 x 23,5 cm (32,5 x 44 cm).
Signiert „MLiebermann“. Auflage 30 num. Ex. Schiefler 167 V c.
900 €
Exemplar des endgültigen Zustandes, nach den Überarbeitungen der Figuren im Vordergrund. Erschienen in kleiner Auflage im Verlag von Paul Cassirer, Berlin 1914/15. Ganz prachtvoller, gratiger Druck mit dem vollen Rand, rechts und unten mit dem Schöpfrand. Selten
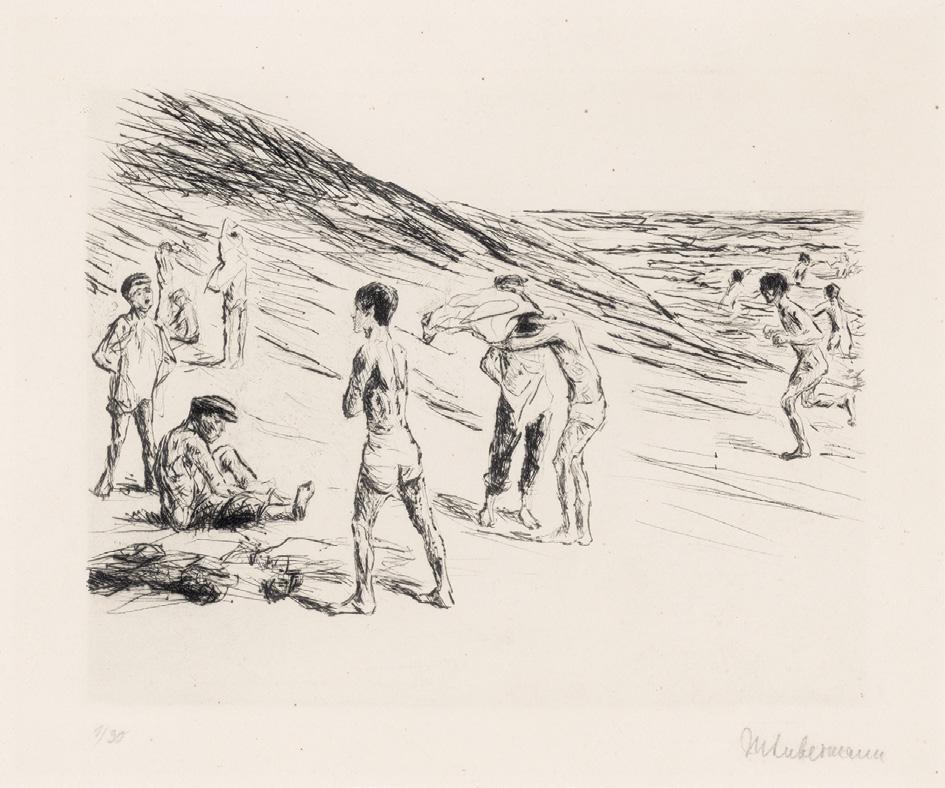
7032

lovis corinth (1858 Tapiau – 1925 Zandvoort)
7033 „Hochzeit in der Kirche“ Farbige Kreiden auf Velin. 1920. 24,8 x 32,3 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“, unten links betitelt.
2.400 €
Großzügig und mit schneller, leichter Hand umreißt der Künstler die figurenreiche Szenerie mit breiten Kreidestrichen und Schraffuren, die, charakteristisch für Corinths Zeichentechnik, meist schräg von links unten nach rechts oben verlaufen. Die skizzenhafte
Auffassung der Zeichnung übernimmt Corinth in seiner Lithographie „Hochzeit in der Kirche“, entstanden für den Zyklus „Turnier aus der Zeit Heinrichs des Achten“, erschienen 1920 im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin (Schwarz L 430 XV).
Provenienz:
Karl & Faber, München, Auktion 205, 09.12.2003, Lot 275 Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2008/5 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet) Sammlung Henning Lohner, Berlin

lovis corinth
7034 „Volksgruppe mit Stadt“
Graphit, schwarze und farbige Kreiden auf Velin. 1920. 24,8 x 32,4 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“ sowie mit Kreide in Schwarz betitelt.
2.400 €
Breite, locker geführte und geschwungene Linien der breiten
Kreide schildern die Szenerie, deren Motiv im Umfeld des Zyklus „Turnier aus der Zeit Heinrichs des Achten“, erschienen 1920 im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin (Schwarz L 430 XV), anzusiedeln ist, jedoch nicht lithographisch umgesetzt wurde. In skizzenhafter
Reduktion und mit leichter Hand lässt Corinth die Szenerie mit einem Reiter im Vordergrund entstehen und zeigt souverän, wie er gedanklich die vielfigurige Komposition erfasst und ordnet, ihre Idee mit wenigen Strichen notiert und dadurch für seine bedeutenden Zyklen aus einem schier unendlichen Reservoir an künstlerischen Einfällen schöpfen kann.
Provenienz:
Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2012/1 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet)
Sammlung Henning Lohner, Berlin

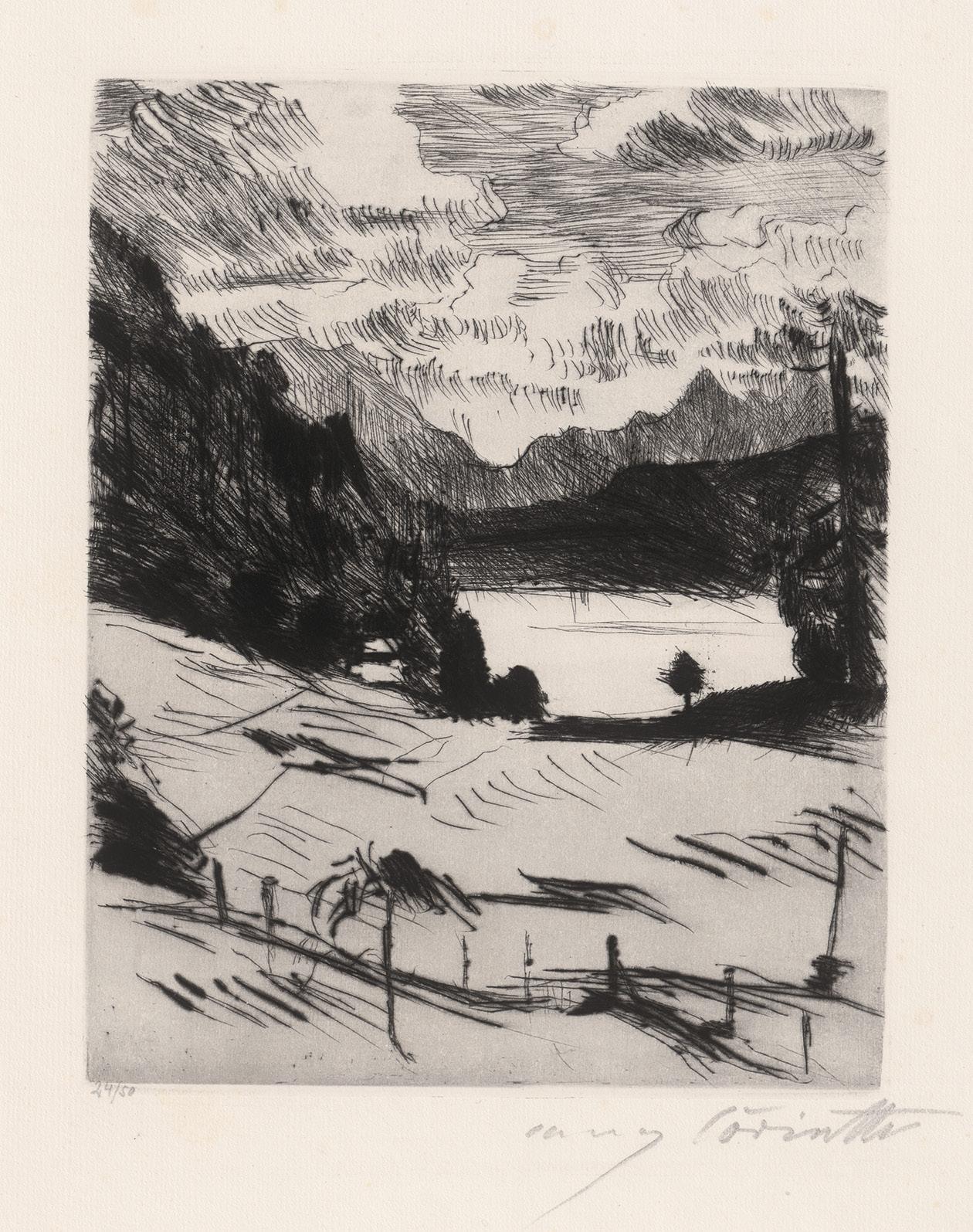
lovis corinth 7035* Sanssouci Lithographie auf Bütten. 1916. 24,8 x 39,3 cm (36,3 x 44,4 cm).
Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 75 Ex. Schwarz 284.
2.500 €
Hauptblatt im graphischen Schaffen des Künstlers. Neben der Auflage von 75 Exemplaren auf Bütten wurden noch weitere 40 Exemplare auf Japan gedruckt, erschienen im Verlag von Fritz Gurlitt, Berlin. Prachtvoller Druck mit dem vollen Schöpfrand.
Provenienz: Ehemals Sammlung Sigbert H. Marzynski, verso mit dessen Sammlerstempel (nicht bei Lugt)
7036 Der Walchensee Kaltnadel auf Van Gelder Zonen-Velin. 1920. 25 x 19,7 cm (38 x 26,8 cm).
Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 50 num. Ex. Schwarz 432 II B.
900 €
Blatt 2 der Ausgabe B der Mappe von neun Radierungen Corinths, „Am Walchensee“, erschienen im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin, in einer Gesamtauflage von 115 Exemplaren. Abweichend von den Angaben bei Schwarz betrug die Höhe der Auflage B 50 Exemplare. Prachtvoller, gratiger und tiefdunkler, in den Schwärzen samtiger Druck mit feinem Plattenton und mit Rand.
lovis corinth
7037 Blick auf den Walchensee Kaltnadel auf Van Gelder Zonen-Velin. 1920. 19,8 x 24,9 cm (31,4 x 39 cm).
Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 50 num. Ex. Schwarz 432 IV B. 900 €
Blatt 4 der Ausgabe B der Mappe von neun Radierungen Corinths, „Am Walchensee“, erschienen im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin, in einer Gesamtauflage von 115 Exemplaren. Abweichend von den Angaben bei Schwarz betrug die Höhe der Auflage B 50 Exemplare Ganz prachtvoller, gratiger Druck mit feinem Plattenton und dem vollen Rand, oben und links mit dem Schöpfrand.
7038 Walchensee im Nebel Lithographie auf Bütten. 1920. 32 x 37 cm (37,2 x 42 cm).
Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 75 Ex. Schwarz L 441.
1.500 €
Erschienen in einer Gesamtauflage von 115 Exemplaren im Verlag Fritz Gurlitt, Berlin 1920. Ganz prachtvoller, kreidiger Druck mit deutlich zeichnender, partiell eingefärbter Steinkante und mit dem wohl vollen Rand, oben und links mit dem Schöpfrand.
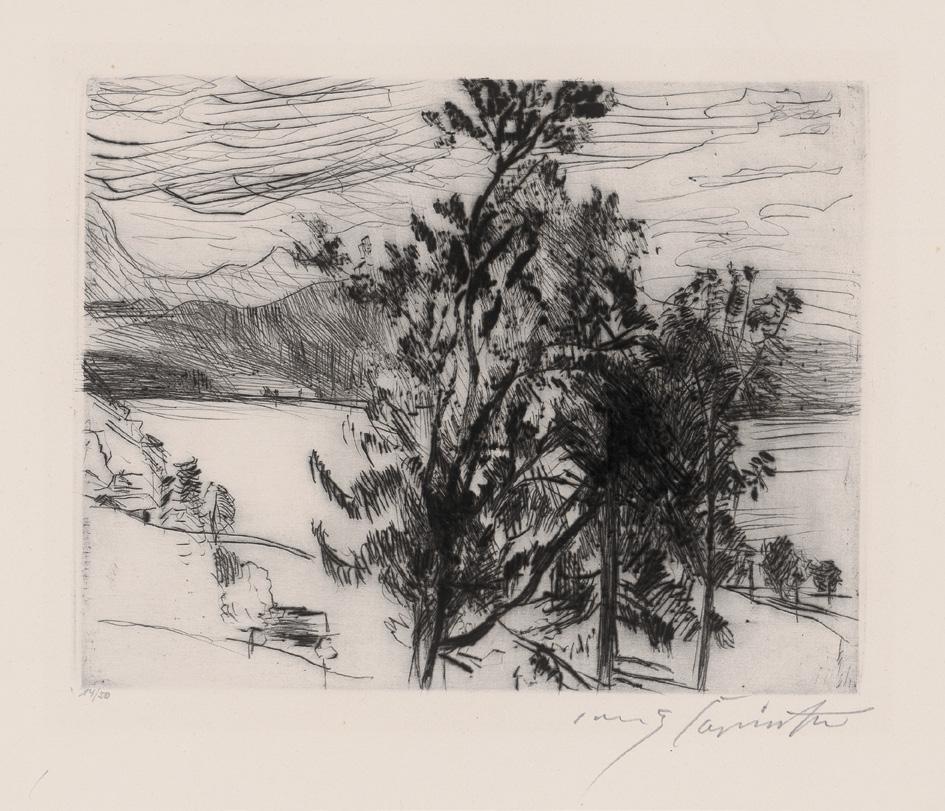


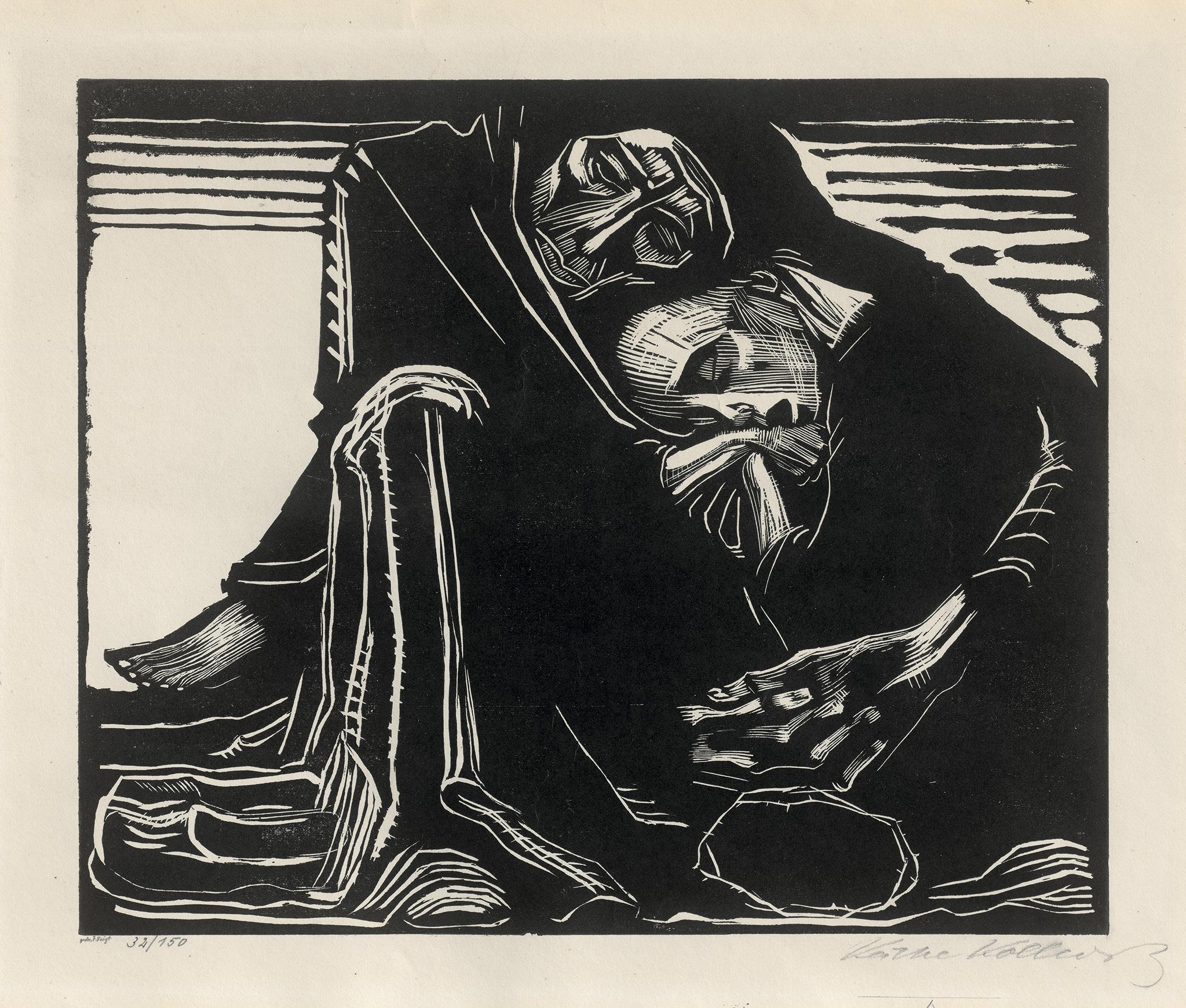
käthe kollwitz
(1867 Königsberg – 1945 Moritzburg)
7039 Frau, das Kinn in die rechte Hand gestützt Kreide- und Pinsellithographie, Schabeisen in Braun auf blaugrauem PL BAS-Bütten. Um 1905.
Ca. 38 x 26,1 cm (47,5 x 31 cm).
Signiert „Kollwitz“ und am Oberrand von fremder Hand bezeichnet „Voigt“. Knesebeck 89.
10.000 €
Umdrucklithographie von einer unbekannten Zeichnung auf geripptem „Ingres“Bütten mit Wasserzeichen „A.L.“ im Oval. Das frühe und äußerst seltene Blatt ist in keiner Auflage erschienen. Lediglich zehn Exemplare auf unterschiedlichen Papieren werden im Werkverzeichnis aufgeführt, unseres war Knesebeck bisher unbekannt geblieben. Besonders in den Jahren 1903 05 begann Kollwitz ihren Blick auf Arbeiterfrauen aus ihrem direkten Umfeld im Prenzlauer Berg zu richten, deren Schicksal ihr besonders am Herzen lag. Modelle fand sie immer wieder in der Nachbarschaft oder in der Arztpraxis ihres Mannes. Dabei stellte sie die Frauen stets isoliert und fast schon monumentalisiert, oftmals sogar formatfüllend dar, um jene sichtbar zu machen, die in der damaligen Gesellschaft allzu oft unsichtbar waren. Kollwitz griff dabei nie auf Klischees zurück, sondern blieb bei einer ehrlichen Darstellung, um den Frauen mit Würde zu begegnen. Prachtvoller, kräftiger Druck mit dem vollen Schöpfrand.
7040 Tod mit Frau im Schoß Holzschnitt auf JWZanders-Velin. 1920/21. 23,8 x 28,6 cm (30 x 50 cm).
Signiert „Käthe Kollwitz“, zudem vom Drucker Fritz Voigt signiert. Auflage 150 num. Ex. Knesebeck 165 VII b (von c).
3.500 €
Eines von 35 Exemplaren der Ausgabe B, erschienen in der Mappe „Jahrbuch der Originalgraphik“, III. Jg., hrsg. von Hans W. Singer, Wohlgemut und Lissner, Berlin 1921. Neben 15 numerierten Exemplaren der Ausgabe A auf Japan und 100 Exemplaren der Ausgabe C. Nach dem Suizid ihrer Cousine Else Rautenberg 1920 setzte sich Kollwitz intensiv mit diesem Thema auseinander: Wie eine Mutter ihr Kind schließt der Tod die Frau behutsam in seine Arme und umhüllt sie schützend mit seinem schwarzen Mantel. Die Dornenkrone am vorderen Bildrand darf als das abgelegte Leid des Lebens gelesen werden. „Das hab ich mir so gedacht, dass der Tod die Frau sanft zu sich nimmt. Dabei bleibt der Dornenkranz unten liegen. Oder auch, er legt sie sanft hin, immer aber trägt sie nicht mehr die Dornen“ (Käthe Kollwitz, zit. nach: Beate Bonus Jeep, Sechzig Jahre Freundschaft mit Käthe Kollwitz, Berlin 1948, S. 222) Prachtvoller Reiberdruck, wohl mit dem vollen Rand.

käthe kollwitz
7041 Die Klage (Zum Gedenken Ernst Barlachs/ Selbstbildnis)
Bronze mit rötlich-brauner Patina. 1938-41. 26,6 x 25,5 x 9,6 cm.
Seitlich links signiert „KOLLWITZ“, an der unteren Seitenfläche rechts mit dem zweiteiligen Gießerstempel „H. NOACK BERLIN“.
Seeler 38 II.B, Online-Katalog Stand 2019, Timm 59. 25.000 €
Kollwitz‘ bekannteste Plastik bezieht ihre besondere Wirkung aus einer immensen Vielschichtigkeit und Prägnanz. In dem kompakten, engen Ausschnitt tritt ein Antlitz zutage, das selbstbildnishafte Züge trägt. Die linke Hand liegt über der linken Gesichtshälfte, und die rechte Hand bedeckt knapp die Lippen, der Daumen liegt vertikal am Kiefer. Das geschlossene rechte Auge verstärkt den Eindruck einer Abgrenzung nach außen. Diese korrespondiert zugleich mit einem regen Innenleben. Geradezu beispielhaft nimmt hier eine Konzentration auf das Innerste Gestalt an. Die über den Mund gelegte Hand verdeutlicht, dass nichts von innen nach außen gelangen soll, das Sprechen scheint untersagt und das kreative Arbeiten unmöglich. Zugleich zeigt die an die Wange gelegte linke Hand einen seit der Antike überlieferten Trauergestus. „Die Klage“ ist also zum einen eine beeindruckende Stellungnahme zu ihrer eigenen Situation als Künstlerin zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Stellvertretend für alle, die unter der Diktatur leiden mussten, zeigt Kollwitz vielsagend anhand ihres Gesichts, was es bedeutet, zum Schweigen verurteilt zu sein und die Augen verschließen zu müs
sen vor einem Unrecht, das man doch nicht aus dem Sinn verbannen kann. Zum anderen ist die Bronze ein Denkmal für ihren Künstlerkollegen Barlach, entstanden unter dem Eindruck seines Todes und des furchtbaren Unrechts, das er unter der Herrschaft der Nationalsozialisten erleiden musste. Das Modell II wurde 1960/61 von der im Bestand von Hans Kollwitz befindlichen Bronze (Seeler 38 I.B.3) abgeformt; heute befindet es sich im Käthe Kollwitz Museum, Köln. Das ursprüngliche, seit 1945 genutzte Modell I (Seeler 38 I.A.) war zu dieser Zeit nicht mehr nutzbar und existiert nicht mehr. Unser Relief, in einem hervorragenden, von Hans Kollwitz in den 1960er Jahren autorisierten Guss mit wunderbar gleichmäßiger, rötlichbrauner Patina, wurde bereits zu Kollwitz‘ Lebzeiten unter der Hand mittels Fotografien sowie Gipsabformungen und Metallgüssen verbreitet. Es ist das bei Institutionen und Sammlern bis heute begehrteste plastische Werk der Künstlerin.
Provenienz:
Otto Nagel, 1963 (Schenkung von Hans Kollwitz) Nachlass Otto Nagel, Berlin Privatsammlung Deutschland Kornfeld, Bern, Auktion 16.06.2022, Lot 355 Privatsammlung Berlin
Ausstellung:
Güstrow 2007, Ernst Barlach Stiftung, Käthe Kollwitz. Zeichnungen, Lithographien, Holzschnitte, Radierungen, Plastiken. Zum 140. Geburtstag von Käthe Kollwitz, Kat. Nr. 59
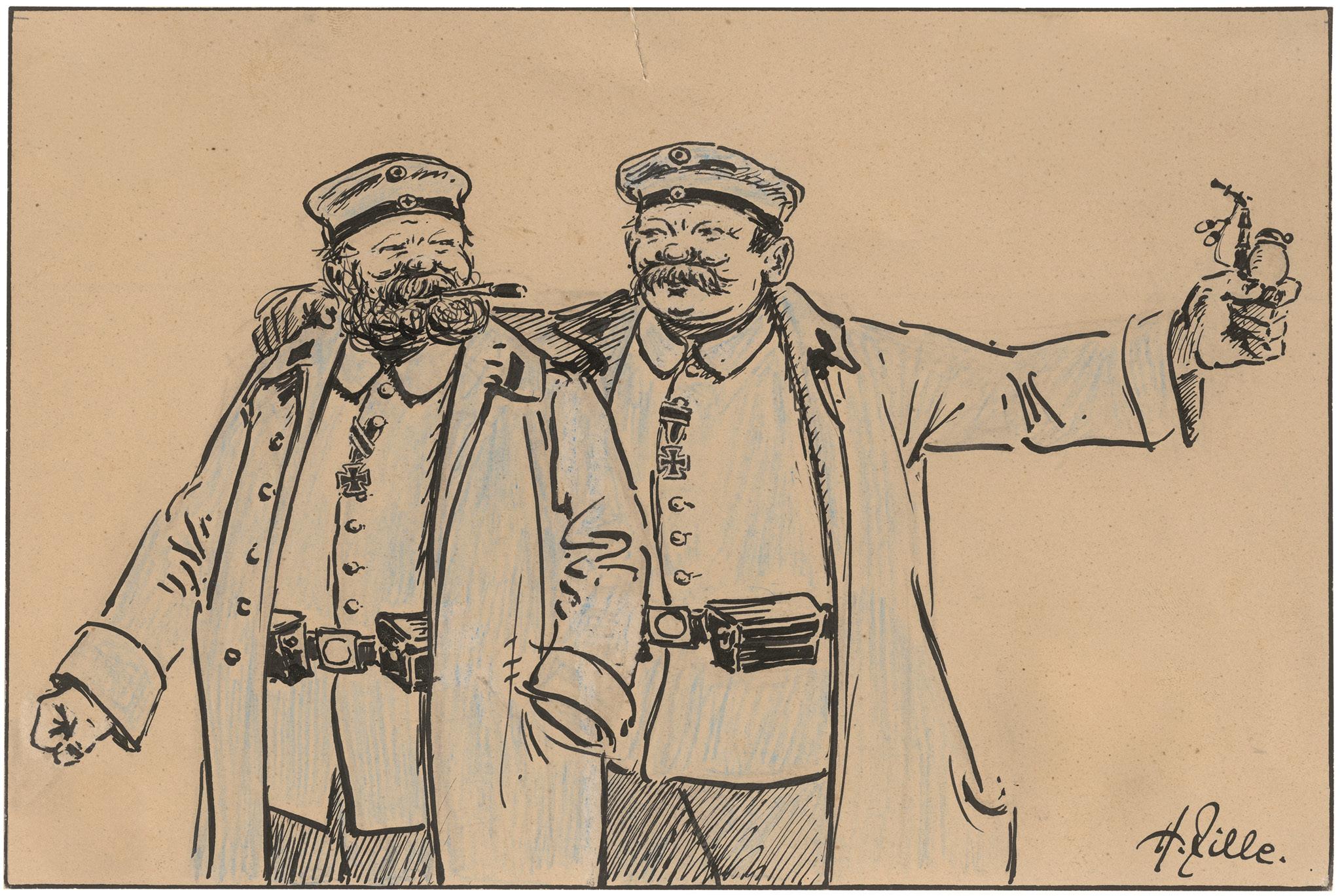
heinrich zille
(1858 Radeburg bei Dresden – 1929 Berlin)
7042 Vadding in Frankreich: Korl und Vadding Feder in Schwarz und Farbstift auf festem Velin. Um 1916. 15 x 22,5 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „H. Zille“.
1.800 €
Während des Ersten Weltkrieges, in den Jahren 1915 und 1916, zeichnete Zille Folgen von episodischen Soldatenbildern, überwiegend satirischen Charakters. In seiner freien Zeit verarbeitete er in zahlreichen Notizen und Skizzen seine eigenen, zumeist unliebsamen Erlebnisse während seines früheren Militärdienstes in den Jahren 1880 bis 1882. Sie erschienen unter den Titeln „Vadding in Frankreich I und II“ und „Vadding in Ost und West“. Noch während des Ersten Weltkrieges, um 1917, hatte sich Zille indes zum entschiedenen Kriegsgegner gewandelt. Seine sorgsam ausgeführte Komposition zeigt die beiden Figuren Korl und Vadding, die er damals häufig für die Zeitschrift „Ulk“ zeichnete und die sich großer Popularität erfreuten. Das Blatt entstand als Druckvorlage für den Band „Vadding in Frankreich 1916“ (Folge 2), erschienen im Verlag der Lustigen Blätter, Berlin 1916, Seite 59. Die Zeichnung ist Prof. Matthias Flügge, Berlin, bekannt.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
heinrich zille
7043 Alte Dame in pelzbesetztem Mantel, an einem Tisch sitzend
Kreide in Schwarz und Rot auf bräunlichem Velin. 19,3 x 10 cm.
Unten mittig mit dem roten Nachlaßstempel „Heinrich Zille“ (Rosenbach 1, Lugt 2676b).
1.200 €
Mit energischem Strich skizziert Zille eine alte Dame am Tisch sitzend, mit üppigem Pelzkragen, der das faltige aber wohl zurecht gemachte Gesicht dahinter nur erahnen lässt.
Provenienz:
Venator & Hanstein, Köln, Auktion 26.03.2011, Lot 2344
Privatbesitz Berlin
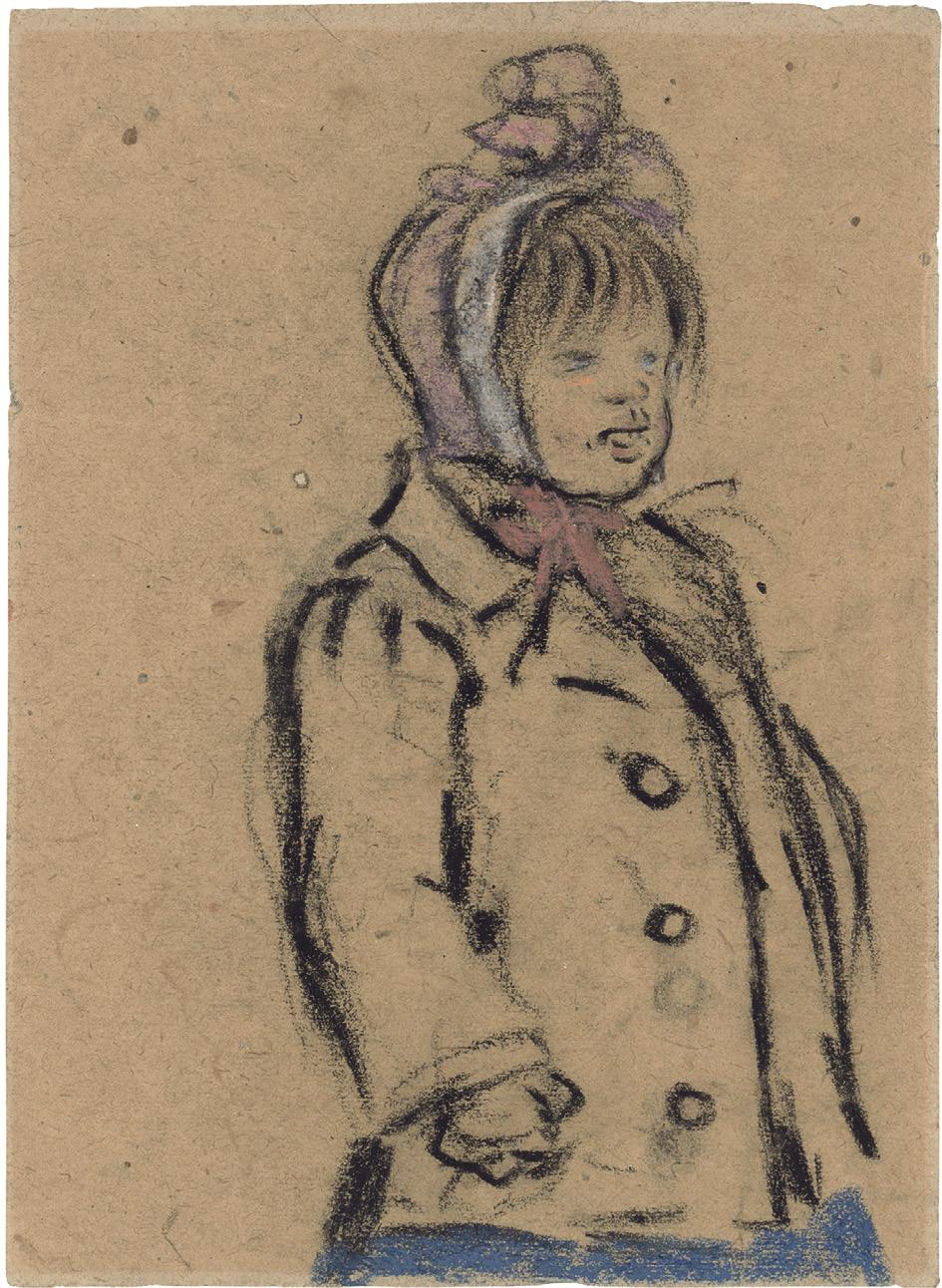
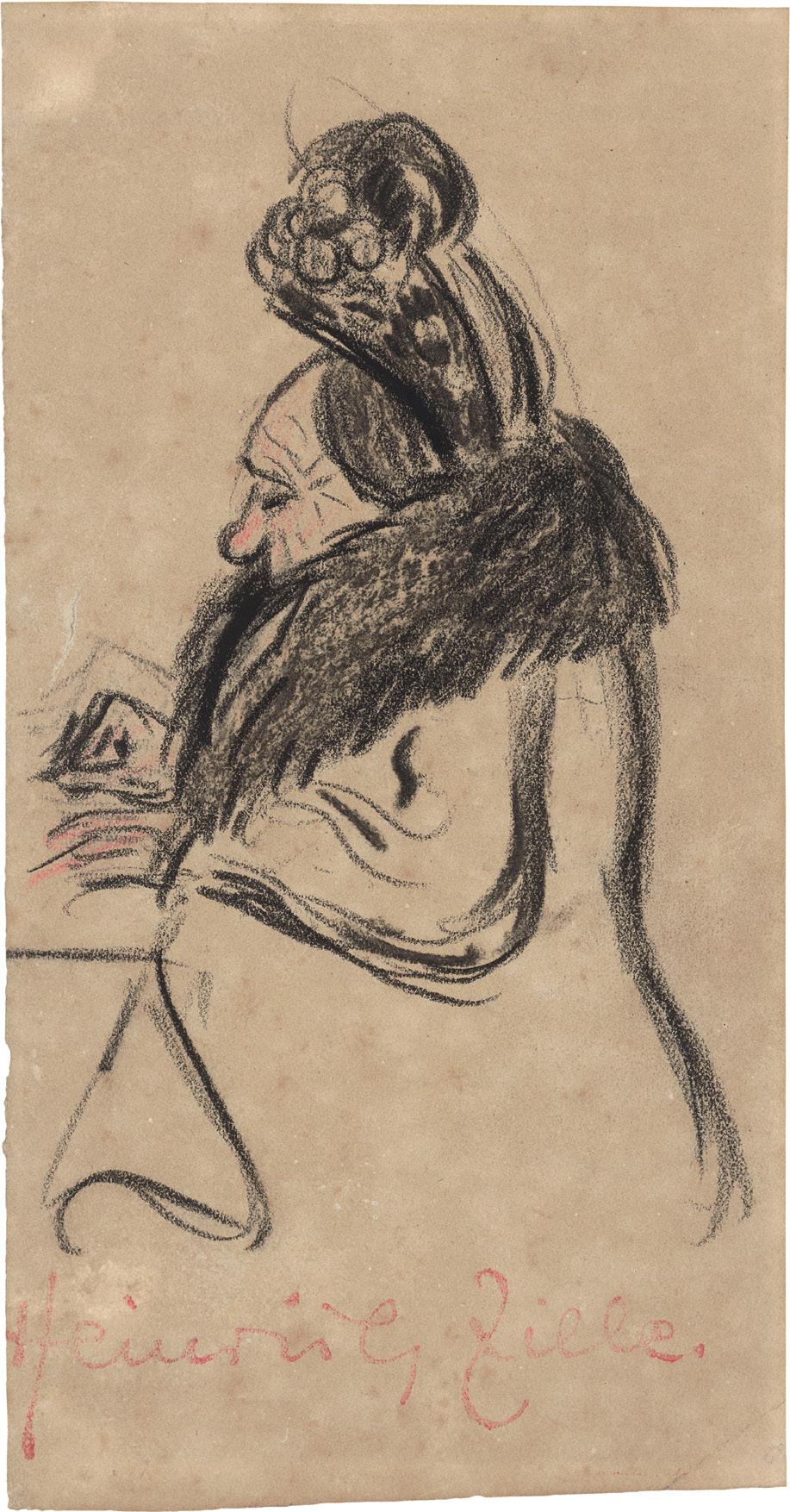
heinrich zille
7044 Kind im Mantel Farbige Kreiden auf dünnem, faserhaltigem Velin. 12,7 x 9,3 cm.
Schräg links mit dem (stark verblassten) roten Nachlaßstempel (Rosenbach 1, Lugt 2676b).
900 €
Charmante Skizze eines zeittypisch gekleideten Mädchens, mit farbigen Akzenten.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 221, 30.11.2013, Lot 1230
Privatbesitz Berlin

wilhelm morgner
(1891 Soest – 1917 Langemarck/Flandern)
7045* Kartoffelernte
Kreidelithographie auf Japanbütten. 1912. 24,2 x 43,2 cm (39,4 x 52,4 cm).
Signiert „W. Morgner“, datiert und bezeichnet „Orig. Lithographie Handdruck“.
Witte L 3. 7.500 €
Rarität von beeindruckender Präsenz. In archaischer, fast schroffer Vereinfachung gestaltet Morgner die Gestalt der Erntenden in einer weiten Feldlandschaft. Er fragmentiert den Bildraum in helle und dunkle Flächen, so dass Figur und Natur miteinander zu verschmelzen scheinen. Um 1912 findet der Künstler von der Abstraktion zurück zur Gegenständlichkeit. Durch Morgners Einberufung
zum Militär 1913 und den Kriegsdienst bis zu seinem frühen Tod entstanden keine weiteren druckgraphischen Arbeiten. „Morgners graphische Arbeiten zeugen von seiner eigenwilligen und eigenständigen künstlerischen Persönlichkeit (...). Daß Morgner trotz seiner Jugend bereits zu den bekannten Künstlern der Zeit gehörte, wird durch die Ausstellungsbeteiligungen, sowie, für die Druckgraphik besonders aufschlußreich, durch die zahlreichen Veröffentlichungen seiner Holz und Linolschnitte in den Zeitschriften ‚Der Sturm‘ und ‚Die Aktion‘ belegt.“ (Andrea Witte, in: Wilhelm Morgner. Graphik (Werkverzeichnis), Soest 1991, S. 15). Prachtvoller und kräftiger, dennoch sehr schön nuancierter Handabzug mit Rand. Es handelt sich hier um eine von nur vier bekannten Lithographien Morgners. Eine Auflagenhöhe ist nicht bekannt. Von allergrößter Seltenheit

wilhelm lehmbruck
(1891 Duisburg-Meiderich – 1919 Berlin) 7046* „Kreuzigung“
Kaltnadel auf festem Velin. 1912. 23,9 x 17,8 cm (31,9 x 24,3 cm).
Signiert „W. Lehmbruck“ und betitelt. Petermann 34 II.
2.500 € 7046
Mit der eigenhändigen Signatur Lehmbrucks. Exemplar des endgültigen Zustandes mit dem Auge im Gesicht der liegenden Frau. Der herrlich differenzierte Plattenton fleckig und zum Rand hin dunkel gewischt, so dass die spiegelverkehrte Signatur in der Platte unten rechts nur noch schwer zu erkennen ist. Petermann nennt 20 Exemplare auf Japan. Ausgezeichneter Druck mit ungereinigter Facette, mit Rand.

thomas theodor heine (1867 Leipzig – 1948 Stockholm) 7047 „Der Schutzmann“ Gouache, Kreide und Deckweiß auf Karton. 1910. 29,4 x 24,5 cm.
Unten links mit Bleistift signiert „Th. Th. Heine“, innerhalb der Zeichnung links mit Feder in Schwarz mit dem Künstlersignet „TTH“ und auf dem Karton unten mittig betitelt, verso mit Bleistift nochmals signiert, mehrfach betitelt, bezeichnet „No. 75“ sowie „28“ (gestrichen) und mit dem Etikett des Simplicissimus-Verlags, dort (von fremder Hand) betitelt und bezeichnet.
1.200 €
Ironisch karikiert Thomas Theodor Heine Kaiser Wilhelm als überlebensgroßen „Schutzmann“ in einer engen Straße. Über allem thronend, tritt dieser das Volk mit Füßen, während die Untertanen schreiend vor ihm fliehen. Wunderbar satirische Zeichnung, welche die Titelillustration der politischsatirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus darstellt, entsprechend dem Klebeetikett des Simplicissimus Verlags verso veröffentlicht in: Jahrgang XIV, No. 50, erschienen am 14.03.1910. Heine war seit 1896 an der Konzeption der Zeitschrift beteiligt und prägte sie mit seinem markanten Zeichenstil bis 1933 entscheidend mit. Aus seiner Feder stammt auch das berühmte Wappentier der Zeitschrift: die rote Bulldogge.
Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden
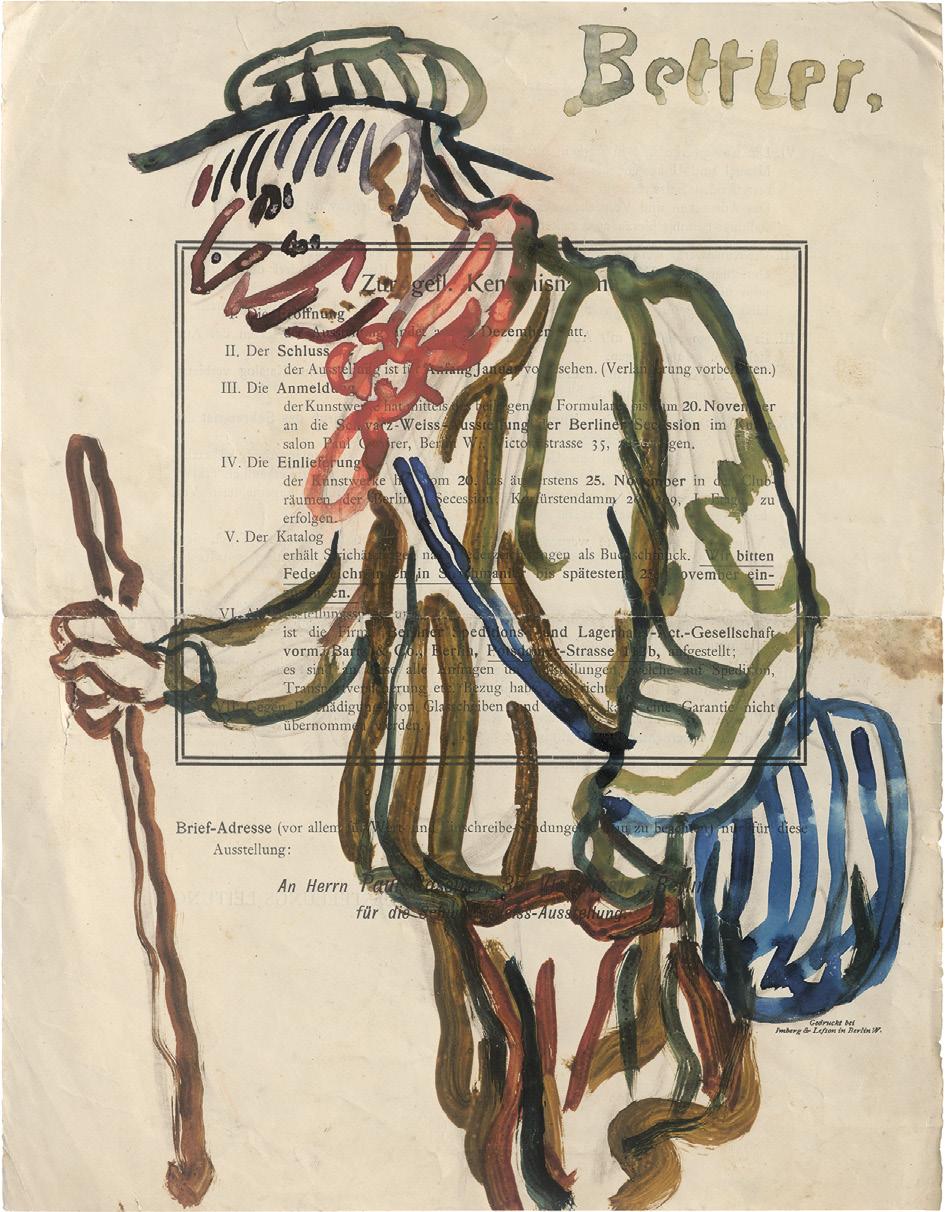
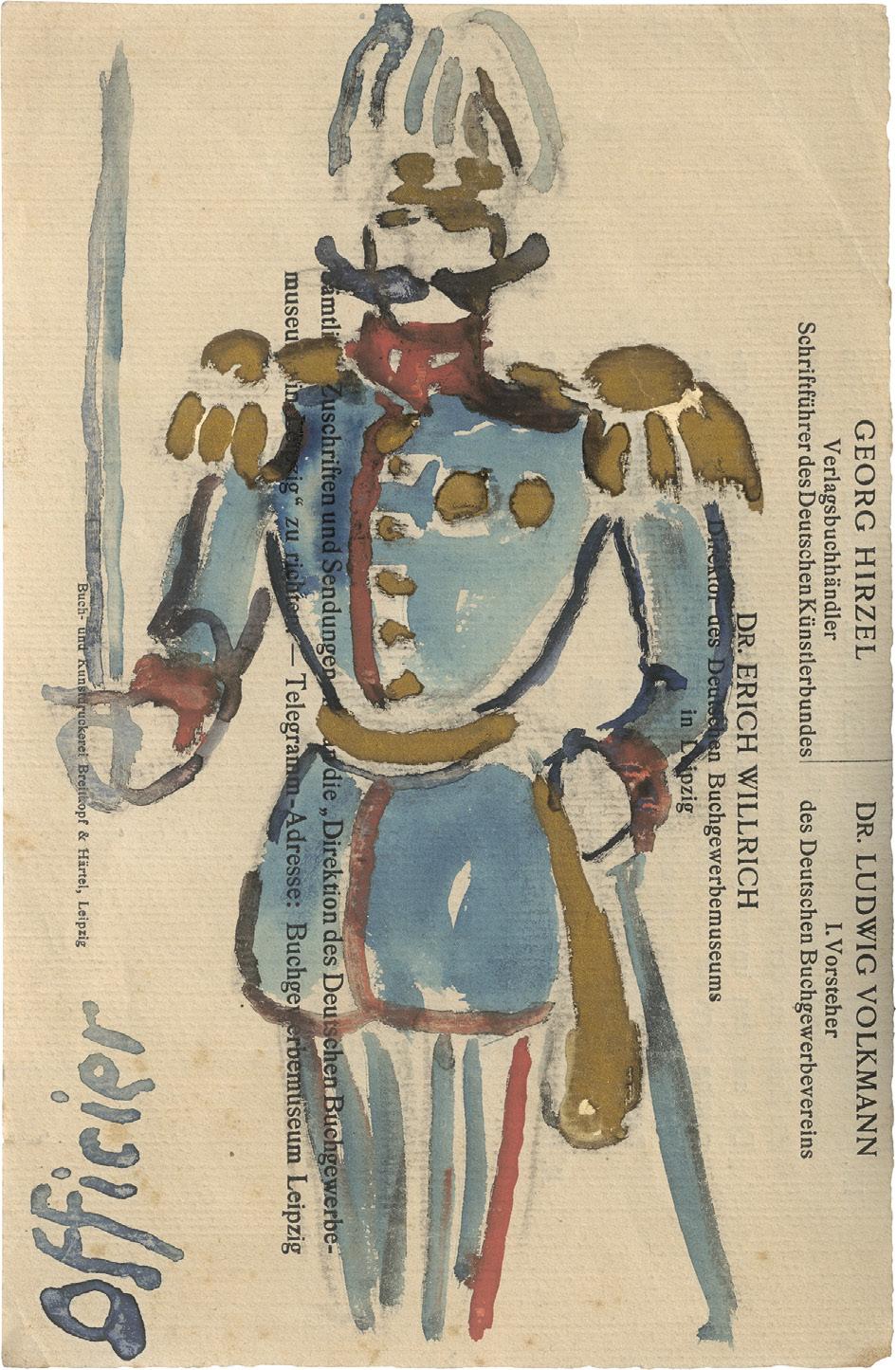
christian rohlfs
7048 Sieben Zeichnungen und Aquarelle
7 Bl. Aquarell, Gouache und Kohle auf verschiedenen Papieren. Um 1907. Bis 29,5 x 23 cm.
2 Bl. betitelt „Officier“ bzw. „Bettler“, teils verso Notizen, wohl von Karl Ernst Osthaus.
4.000 €
Archetypische Figuren, zeitlose und universelle Motive zeichnet Rohlfs für die fünf Kinder seines Mäzens. Auf Einladung seines Förderers Karl Ernst Osthaus lebte und arbeitete der Künstler seit 1901 in Hagen, wo er, befreit von wirtschaftlicher Not, Atelierräume im neu gegründeten Hagener Museum bezog und eine Malschule des FolkwangMuseums leitete. Fortan gehörte er fast zur Familie
Osthaus; besonders zu den Kindern Eberhard, Waldemar, Manfred, Helga und Immogen hatte er ein inniges, liebevolles Verhältnis und fertigte für sie zur Freude und Unterhaltung spontan kleine Bilder an. Auf vorgefundenen unterschiedlichen Papieren, teils auf Resten, Briefumschlägen oder Werbezetteln zeichnet Rohlfs einfache, kindliche Motive: ein reitender König, Offizier und Bettler, zwei Hähne, Löwe und Krokodil, festgehalten mit kräftigen, breiten Konturen und klaren, vereinfachten Formen.
Provenienz:
Sammlung Karl Ernst Osthaus, Hagen (18741921)
Sammlung Eberhard Osthaus, Worpswede Familienbesitz der Erben
Schloss Ahlden, Auktion 09.09.2023, Lot 2041, 2042
Privatbesitz Süddeutschland
christian rohlfs
(1849 Niendorf/Holstein – 1938 Hagen/Westfalen)
7049 Nach einer PeruTerracotta I Wassertempera auf genarbtem Velinkarton. 1935. 77,5 x 57,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun monogrammiert „CR“ und datiert, verso (von fremder Hand) betitelt und bezeichnet „Nr. 40“. Vogt 1935/92.
15.000 €
Eine charakteristische, schimmernde Farbigkeit mit feinen Strukturen und Glanzlichtern erzeugt Rohlfs, indem er das Papier nach dem Farbauftrag in einer raffinierten Technik mit Wasserstrahl und Bürsten manuell bearbeitet. Die Spuren dieser Verfeinerung und Wandlung zeigen sich in meist horizontal geführten Kratzern und Auswaschungen. Damit rückt der Künstler die Farberscheinung in den Mittelpunkt seines Interesses. Zugleich dominiert die zeitlose Erscheinung der archetypischen Terracottafigur mit ihrer Ruhe und würdevollen Haltung, die für den Betrachter intensiv wahrnehmbar ist, die Ausstrahlung der Zeichnung. Die stark vereinfachte Form erhöht zudem die Präsenz der Darstellung. Vogt verzeichnet das Blatt mit den Maßen 77 x 65 cm und mit der Provenienz „Privatbesitz Neuss“. Mit einer Fotoexpertise vom Christian Rohlfs Archiv, Hagen, vom 30.05.2011 (in Kopie). Das Werk wurde unter der Nummer CRA 9/11 in das Christian Rohlfs Archiv aufgenommen.
Provenienz:
Ehem. Sammlung Johannes Geller, Neuss (gemäß seiner handschriftlichen Notiz verso erworben von Christian Rohlfs am 06.05.1936)
Galerie Decker, BadenBaden (dort erworben 2011)
Privatbesitz Rheinland
Literatur:
Verzeichnis der Sammlung des Rechtsanwalts Johannes Geller in Neuss. Mit einem Nachwort von August Hoff, Privatdruck, München 1943, S. 13, Nr. 102

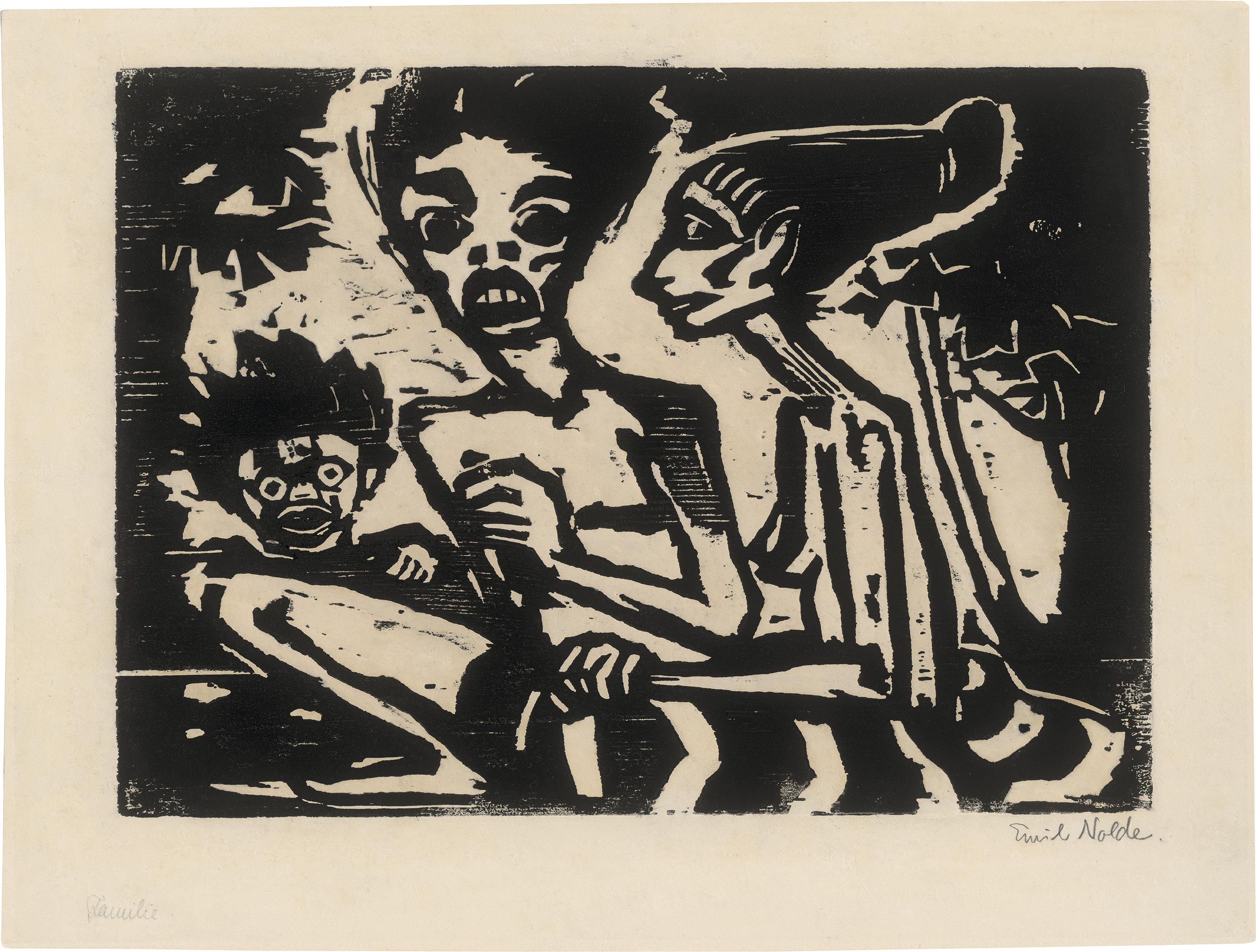
emil nolde
(1867 Nolde/Schleswig – 1956 Seebüll)
7050 Familie
Holzschnitt auf leichtem Kupferdruckkarton. 1917.
23,4 x 32,3 cm (29,5 x 39,2 cm).
Signiert „Emil Nolde“ und von Ada Nolde betitelt. Schiefler/Mosel H 128 II.
12.000 €
Das Eigenleben des Holzes und die lebendige Struktur der Maserung wird bei Nolde zum Teil des Bildes, und auch die Spuren des Arbeitsprozesses sind mit einbezogen: Die Holzfasern und knoten sollten sichtbar bleiben, die Farbe so üppig auf den Druckstock aufgerollt werden, dass sie auch zum Teil in die Vertiefungen laufen konnte und gelegentlich mitdrucken konnte, sobald Nolde das Papier vehement auf den Stock presste. Genau dieses Zufällige, Unvorhersehbare, die Zusammenarbeit mit der Naturwüchsigkeit des Holzes suchte Nolde in dieser Drucktechnik, um sich selber im experimentellen Schaffensprozess als Teil der Natur fühlen zu können.
Der Künstler schuf insgesamt 205 Holzschnitte, vielfach figürliche Darstellungen und erfundene Szenen, mit einem der Schwerpunkte in den Jahren 1917/18. Auch das Motiv der „Familie“ geht auf ein Gemälde des Künstlers zurück, nämlich „Zwei Frauen (Akte)“, 1915 (Urban 748). Die kraftvoll vereinfachten Linien und der archaisch wirkende Ausdruck zeigen Einflüsse von afrikanischer und asiatischer indigener Kunst, die auf Noldes Reise in die Südsee zurückgehen. Exemplar des zweiten, endgültigen Zustandes, mit den ausgestalteten Fingern an der Hand des Kindes. Von diesem Zustand druckte Nolde seinen eigenen Aufzeichnungen zufolge lediglich 16 Exemplare, neben den zwei bei Schiefler/Mosel erwähnten Drucken des ersten Zustandes. Prachtvoller und gegensatzreicher, partiell differenziert aufgelichteter Druck mit schöner Reliefwirkung und leichten Reibespuren verso, mit Rand. Die in den Schwarzflächen leicht mitdruckende Langholzmaserung und die Spuren des Stockgrundes in den Weißflächen verleihen dem Abzug ein zusätzliches expressives Moment. Rarissimum
Provenienz: Privatsammlung Berlin

emil nolde
7051 „Lis“ (Lis Vilstrup) Farblithographie in Schwarz-Blau auf Velin. 1907. 26,4 x 19,5 cm (53,6 x 41,8 cm).
Signiert „Emil Nolde“ und datiert sowie von Ada Nolde betitelt. Auflage 100 Ex. Schiefler/Mosel L 13.
1.500 €
Die bei Genthe in Hamburg gedruckte Lithographie zeigt das Portrait von Emil Noldes Schwägerin, Lis Vilstrup. In der Zeit um 1907 entstehen mehrere Lithographien, die Lis und ihren Mann Bolling Vilstrup darstellen. Ganz ausgezeichneter, kreidiger Druck mit breitem Rand.
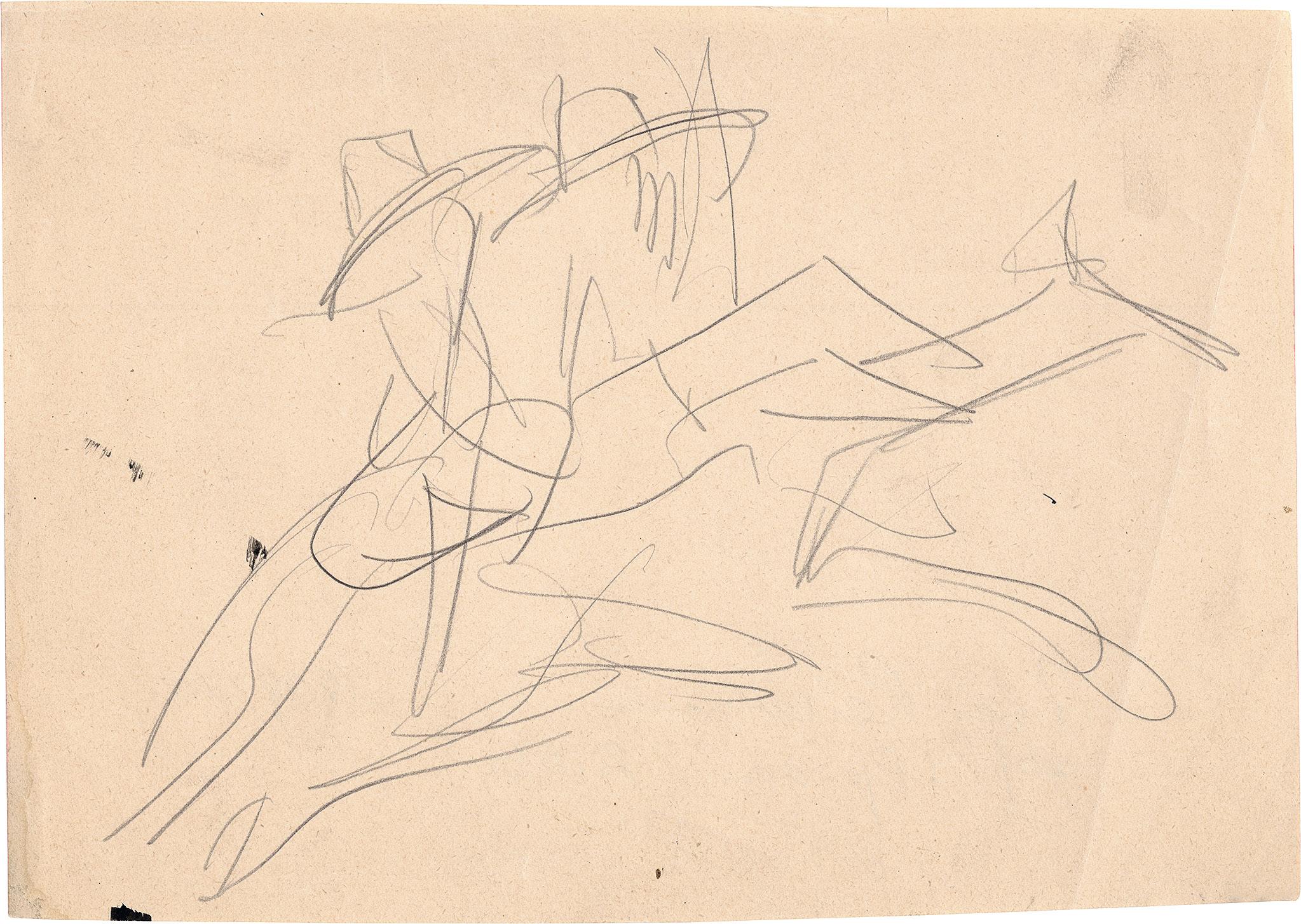
ernst ludwig kirchner
(1880 Aschaffenburg – 1938 Frauenkirch bei Davos)
7052 Zwei Reiterinnen auf 3 Pferden (Zirkus)
Bleistift auf Skizzenbuchpapier. Um 1909-10.
15,32-15,5 x 21,9 cm.
Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „C 2“.
1.200 €
Den Schwung und die Eleganz der zum Sprung ansetzenden Pferde mit ihren Reiterinnen, von denen vor allem die großen Hüte ins Auge fallen, erfasst Kirchner mit nur wenigen zügigen, sicher und sparsam gesetzten Linien. Ernst Ludwig Kirchner hinterließ 181 Skizzenbücher mit ca. 12.000 Zeichnungen. Schon früh wurden diesen Skizzenbüchern und heften Blätter entnommen, wohl um die 1.000 2.000. Was er im Skizzenbuch niederlegte, war gekennzeichnet von der „Ekstase des ersten Sehens“, einer schöpferischen 7052
Energie, die bei ihm so nur hier zu finden ist. In vorliegenden Skizzenbuchblättern (vgl. auch Kat.Nrn. 7053 und 7054) ging es Kirchner um Bewegung, die er nirgends intensiver erlebte als im Zirkus. Das Geschehen der Pferdedressur verdichtet er hier bis an den Rand der Abstraktion. Der Künstler gibt nicht wieder, was er sieht; er verdichtet, was er fühlt. Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch des Künstlers entnommen; in den Skizzenbüchern 6,15,17,43 finden sich thematische Parallelen (vgl. Gerd Presler, Ernst Ludwig Kirchner, Die Skizzenbücher, „Ekstase des ersten Sehens“, Karlsruhe 1996). Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 09.10.2025.
Provenienz:
Lise Gujer, Davos Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336 Privatbesitz Berlin

ernst ludwig kirchner
7053 Fakir mit Schlange Bleistift auf Skizzenbuchpapier. Um 1911-12.
20,2 x 15,9 cm.
Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „B 61“.
1.200 €
Gewundene, einander überschneidende und sich durchdringende Kurven und Linien des Bleistifts spiegeln technisch die Eigenheiten des Schlangenmotivs wider. Ihn interessierte, wie auf diesem Blatt, das Anschwellen, der Höhepunkt und das Abschwellen einer
Bewegung; ihn interessierte der „Vorgang in der Zeit.“ Dafür musste er neue Zeichen finden und diese nannte er „Hieroglyphen“. Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch des Künstlers entnommen, rechts mit dessen gerundeten Ecken. In den Skizzenbüchern 5,6,15,19 finden sich thematische Parallelen. Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 09.10.2025.
Provenienz: Lise Gujer, Davos Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336 Privatbesitz Berlin
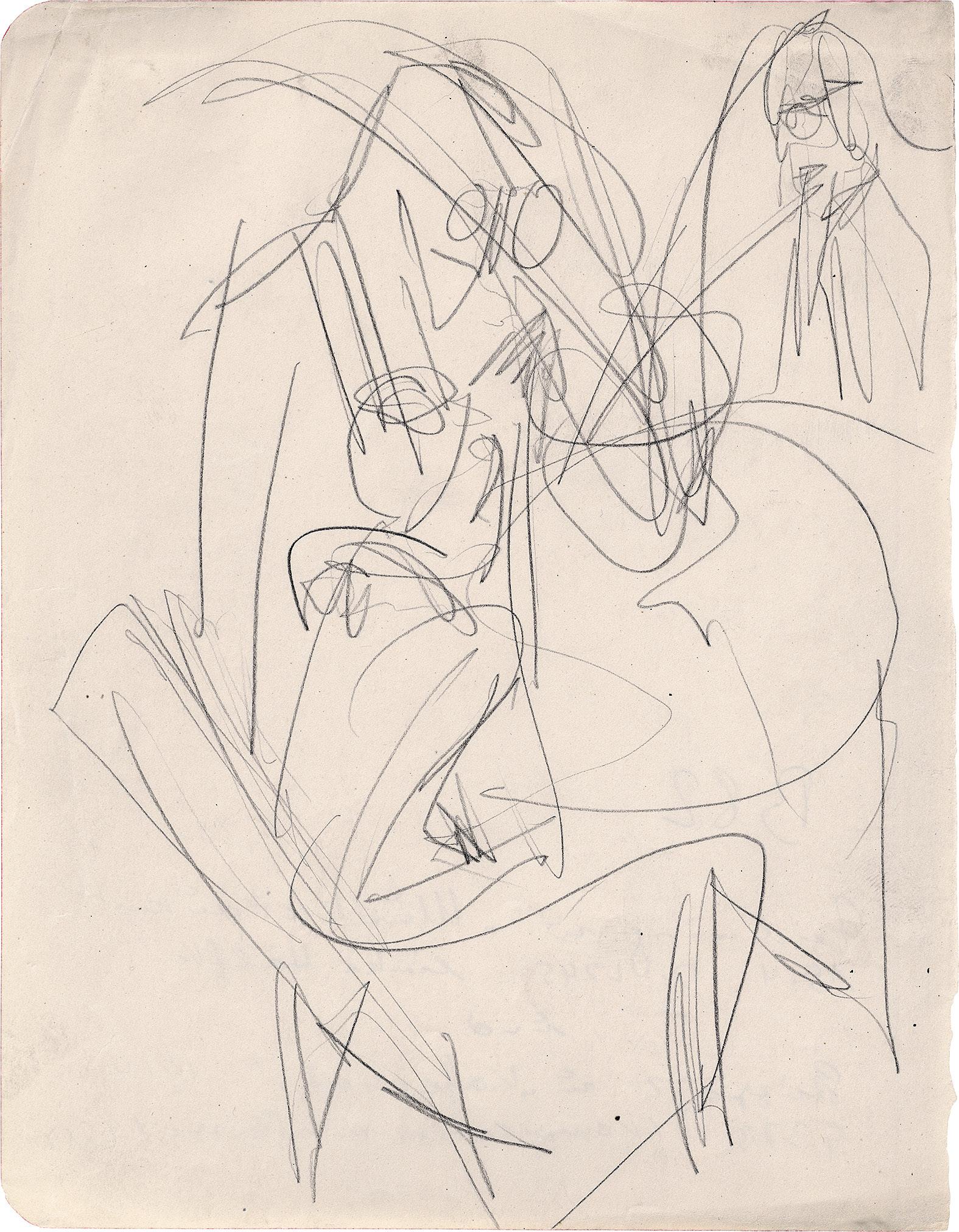
ernst ludwig kirchner
7054 Kaffeehaus (Musikrestaurant)
Bleistift auf Skizzenbuchpapier. Um 1914. 21 x 16,2 cm.
Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „B 82“ sowie „332“ und „10766“.
1.200 €
Kirchners 1914 entstandene Lithographie „Musikrestaurant“ (Gercken 666) zeigt im linken Bildteil eine weitgehend der vorliegenden Skizze ähnelnde Figurengruppe um den runden Tisch gruppiert. Verso bezeichnet „Zeichnung zu ‚Musikrestaurant‘ 1914 D. L 245 linke Hälfte und Skizze 2 zu ‚Kaffeehaus‘ 1914 G 373 (Kompilation mit Skizze 1 (81)“. Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch des Künstlers entnommen, links mit dessen gerundeten Ecken. Es
stammt, wie auch die Kat.Nrn. 7052 und 7053, aus dem Besitz der Schweizer Textilkünstlerin Lise Gujer, die mit Kirchner eng zusammenarbeitete. In den Skizzenbüchern 3,10,15,16,18,1920, finden sich thematische Parallelen. Im „Davoser Tagebuch“ schreibt Kirchner über die „feinste erste Empfindung“, die das Skizzenbuchgeschehen verdichtet: Am „wertvollsten, wenn auch am schwerverständlichsten sind die kleinen Skizzen, die auf der Straße, im Café, Theater usw. entstanden sind.“. Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 09.10.2025.
Provenienz: Lise Gujer, Davos Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336 Privatbesitz Berlin

ernst ludwig kirchner
7055 Alte und junge Frau Holzschnitt auf Bütten. 1921. 33,3 x 24,2 cm (41 x 31/31,9 cm).
Mit dem Signaturstempel „ELKirchner“ (verblasst).
Auflage 100 Ex. Gercken 1224 III B, Dube 463 III B.
1.000 €
Ohne den Trockenstempel „Fritz Gurlitt Verlag“, aber verso mit dem violetten Stempel „Für HolzMappe“. Das Blatt erschien in der Mappe „Deutsche Graphiker Arno Holz zum 60. Geburtstag“. Kräftiger, teils differenzierter Druck mit breitem Rand.

karl schmidt-rottluff
(1884 Rottluff bei Chemnitz – 1976 Berlin)
7056 Bucht an der Nehrung Holzschnitt auf Bütten. 1913. 27,5 x 34,2 cm (36,8 x 41,2 cm). Signiert „S. Rottluff“ und datiert. Schapire H 121.
6.000 €
In einem Fischerhaus in Nidden auf der Kurischen Nehrung Ostpreußens verbrachte SchmidtRottluff, nachdem sich Ende Mai 1913 die Künstlergemeinschaft „Brücke“ aufgelöst hatte, einen intensiven Arbeitssommer. Hier schuf er Holzschnitte zwischen „Abstraktion und Einfühlung“ (Worringer) von elementarer Unmittelbarkeit. „Als Edvard Munch 1907 Holzschnitte von Karl SchmidtRottluff sah, seufzte er auf: ‚Gott soll uns schützen. Wir gehen schweren Zeiten entgegen.‘ Was immer der stille Norweger damit
gemeint hat, er spürte die Kraft, die in dem jungen Künstler wohnte, sah, wie er dem sperrigen Holz unerhörte Gestaltungsmöglichkeiten entriss. Der bedeutende Kunsthistoriker Dr. Wilhelm Niemeyer fand später für das, was Munch erschreckte, das zutreffende Wort: ‚Flächenwucht‘. Sichtbar, spürbar die Härte, mit der SchmidtRottluff seine Sprache vortrug (...). Schon bald gelangte er zu einer souveränen Beherrschung der graphischen Mittel. Letztlich prägte ein monumentales, vom Holzschnitt inspiriertes, architekturales Wissen das gesamte Schaffen SchmidtRottluffs. Was immer sich im Werk des Künstlers entwickelte, die ersten Spuren hinterließ es im Holzschnitt. Ausgehend von den hier gemachten kompositorischen Erfahrungen entfalteten sich Grundzüge der Gestaltung im Gemälde, im Aquarell, in der Zeichnung, der Lithographie und in den Radierungen.“ (Gerd Presler, in: Karl SchmidtRottluff, Ausgewählte Druckgraphik aus der Sammlung Niemeyer, Ausst.Kat. Berlin 2008). Prachtvoller, tiefschwarzer und satter Druck mit breitem Rand. Von großer Seltenheit

karl schmidt-rottluff
7057 Kleine Landschaft mit Leuchtturm
Holzschnitt auf Velin. 1914. 26,5 x 18,2 cm (46,7 x 36 cm).
Signiert „S.Rottluff“ und datiert. Schapire H 135.
6.000 €
In keinem anderen Medium verwirklicht SchmidtRottluff seine expressionistischen Ideen so konsequent wie im Holzschnitt, und er gilt als der wohl ursprünglichste Künstler der Brücke Gruppe. Die vorliegende „Kleine Landschaft mit Leuchtturm“ zeigt bereits die etwas wuchtigmonumentale, stilisierte Formensprache, die
er nach der Auflösung der Künstlergemeinschaft „Die Brücke“ im Jahr 1913 entwickelte. Die Küstenlandschaft zeigt im Hintergrund den Leuchtturm aus Nidden, den SchmidtRottluff wiederholt gemalt und in Holz geschnitten hat. Hier ist es Schapire zufolge ein Stück des relativ weichen Fichtenholzes, dessen großzügige Maserung stellenweise ausdrucksvoll aus den Schwärzen hervortritt. Ganz prachtvoller, kräftiger und satter Druck mit dem wohl vollen Rand. Von größter Seltenheit
Provenienz: Sammlung Wilhelm Niemeyer Privatsammlung Berlin
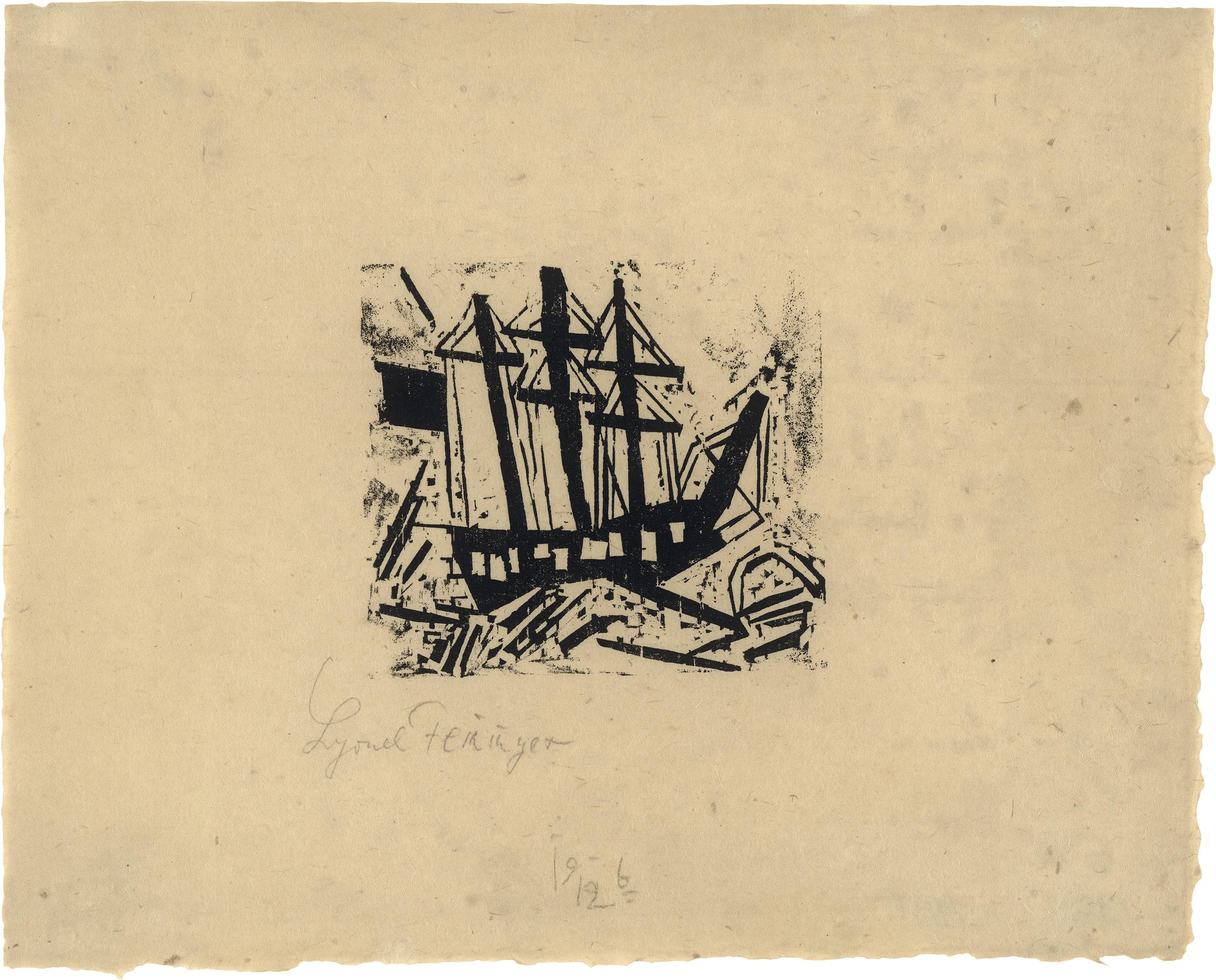
lyonel feininger (1871–1956, New York)
7058* Dreimaster mit Flagge, 3 und Sonnenuntergang Holzschnitt auf dünnem gelblichen Japanbütten. 1919. 8 x 9 cm (18,5 x 23,5 cm).
Signiert „Lyonel Feininger“ und mit der Werknummer „1912 b“.
Prasse W 302.
3.000 €
Der Holzschnitt in reizvollem kleinen Format entstand im Jahr 1919, als Walter Gropius Lyonel Feininger zum Leiter der graphischen Werkstatt ans Staatliche Bauhaus in Weimar berief. Feininger nutzte den Holzschnitt auch als Briefkopf. Prachtvoller, tiefschwarzer Druck mit breitem Rand. Sehr selten, Prasse kennt nur vier Probedrucke.
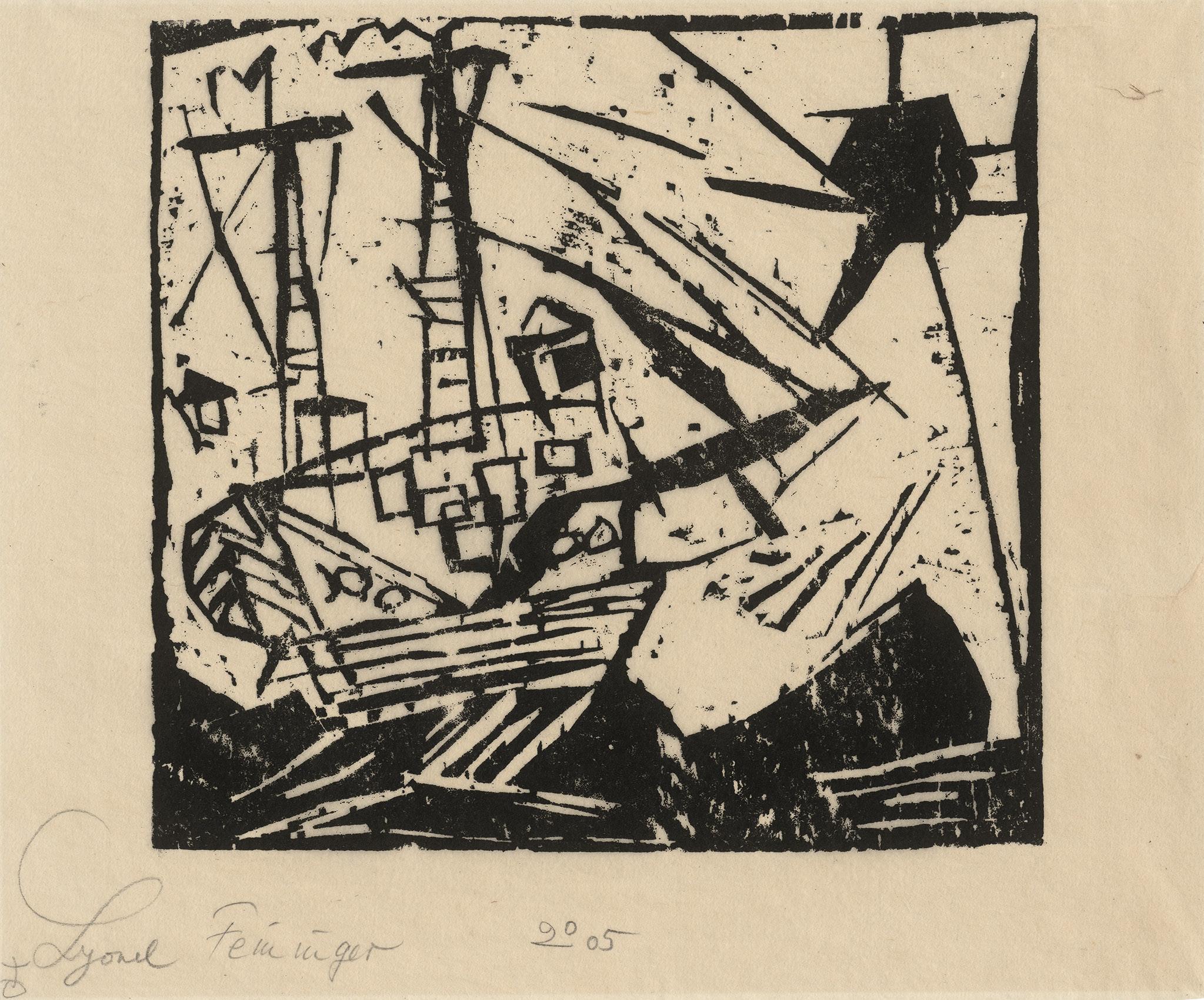
lyonel feininger
7059* Das Schiff (mit Sonne) Holzschnitt auf hauchdünnem Japan. 1920. 16,1 x 17,1 cm (20 x 24,5 cm).
Signiert „Lyonel Feininger“ und mit seinem eigenen Sammlerzeichen Kreis und Kreuz sowie mit der Werknummer „2005“. Prasse W 198.
3.000 €
Frühdruck vor der Auflage als Blatt 6 für das Mappenwerk „10 Holzschnitte von Lyonel Feininger“, herausgegeben vom Euphorion Verlag, Berlin, um 1926. Die sorgfältig ausgesparten weißen Flächen spiegeln in Kombination mit dem hauchdünnen Papier in besonderer Weise den Wunsch des Künstlers nach Transparenz, Licht und atmosphärischer Wirkung wider. Das Motiv wurde von Feininger auch betitelt „Schiff der Entdeckung“ oder „Das Wrack“. Es handelt sich hier um Feiningers eigenes Exemplar, von ihm unten links mit seiner Sammlermarke gekennzeichnet. Prachtvoller Druck mit der wunderbar sichtbaren Struktur des Holzstockes und mit Rand.
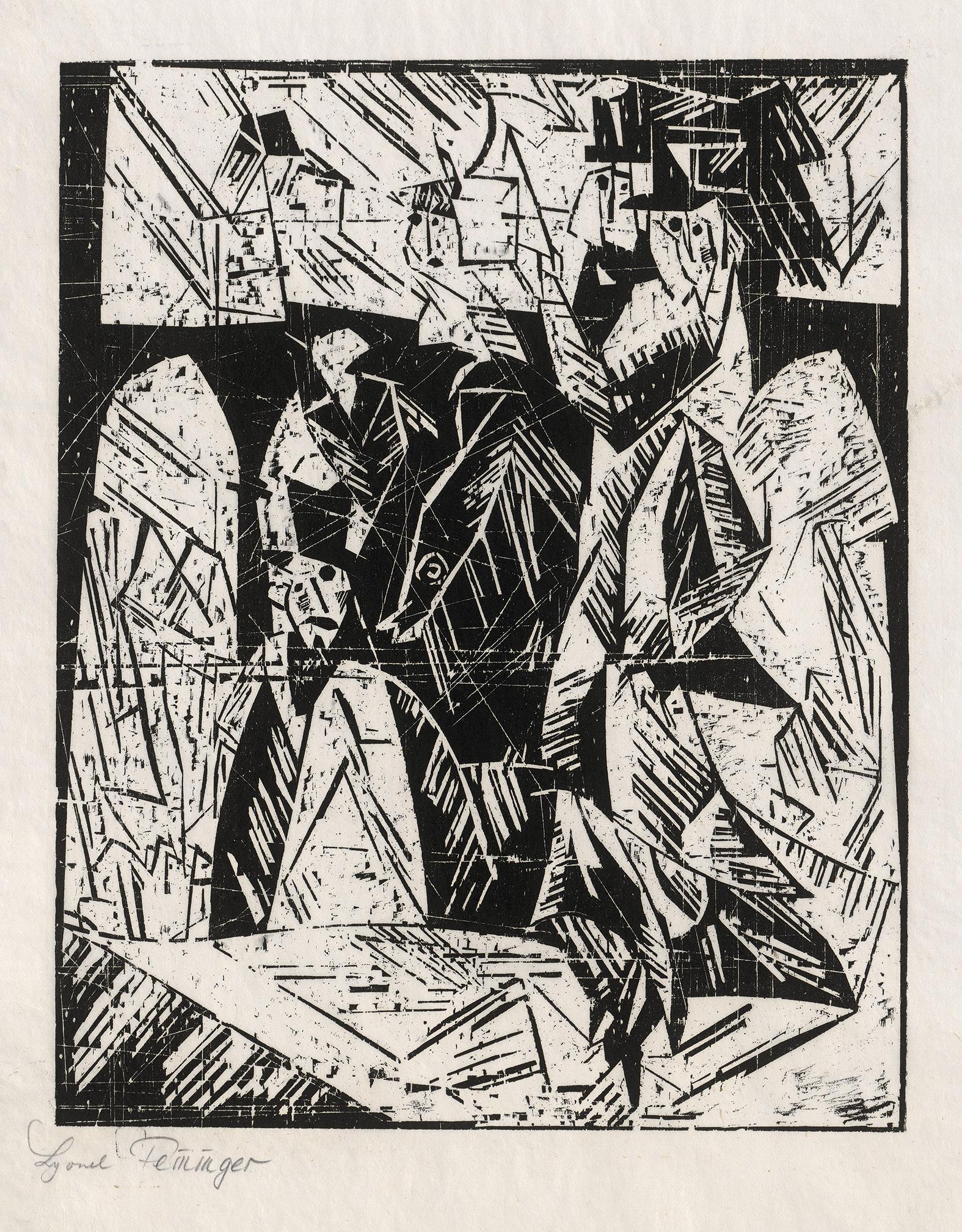
7060
lyonel feininger
7060 Spaziergänger
Holzschnitt auf hauchdünnem Japanbütten. 1918. 37 x 29,5 cm (48,3 x 34 cm).
Signiert „Lyonel Feininger“. Auflage 100 Ex. Prasse W 113, Söhn HdO 101-2.
5.000 €
Blatt 2 der Ersten Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Erste Mappe. Meister des Staatlichen Bauhauses in Weimar, Verlag Müller & Co., Potsdam 1921. Unten links mit dem Blindstempel des Bauhauses (Lugt 2558b). Schemenhaft wie Gespenster erscheinen die Figuren in der kristallinen, in kleine Splitter zerfallenden und kontrastreichen Komposition, die auf Feiningers Anfänge als Karikaturist verweist. Gedruckt in der Druckerei des Staatlichen Bauhauses. Die Gesamtauflage betrug 130 Exemplare. Prachtvoller, tiefdunkler Handdruck mit der wunderbar sichtbaren Struktur des Holzstockes und mit Rand.
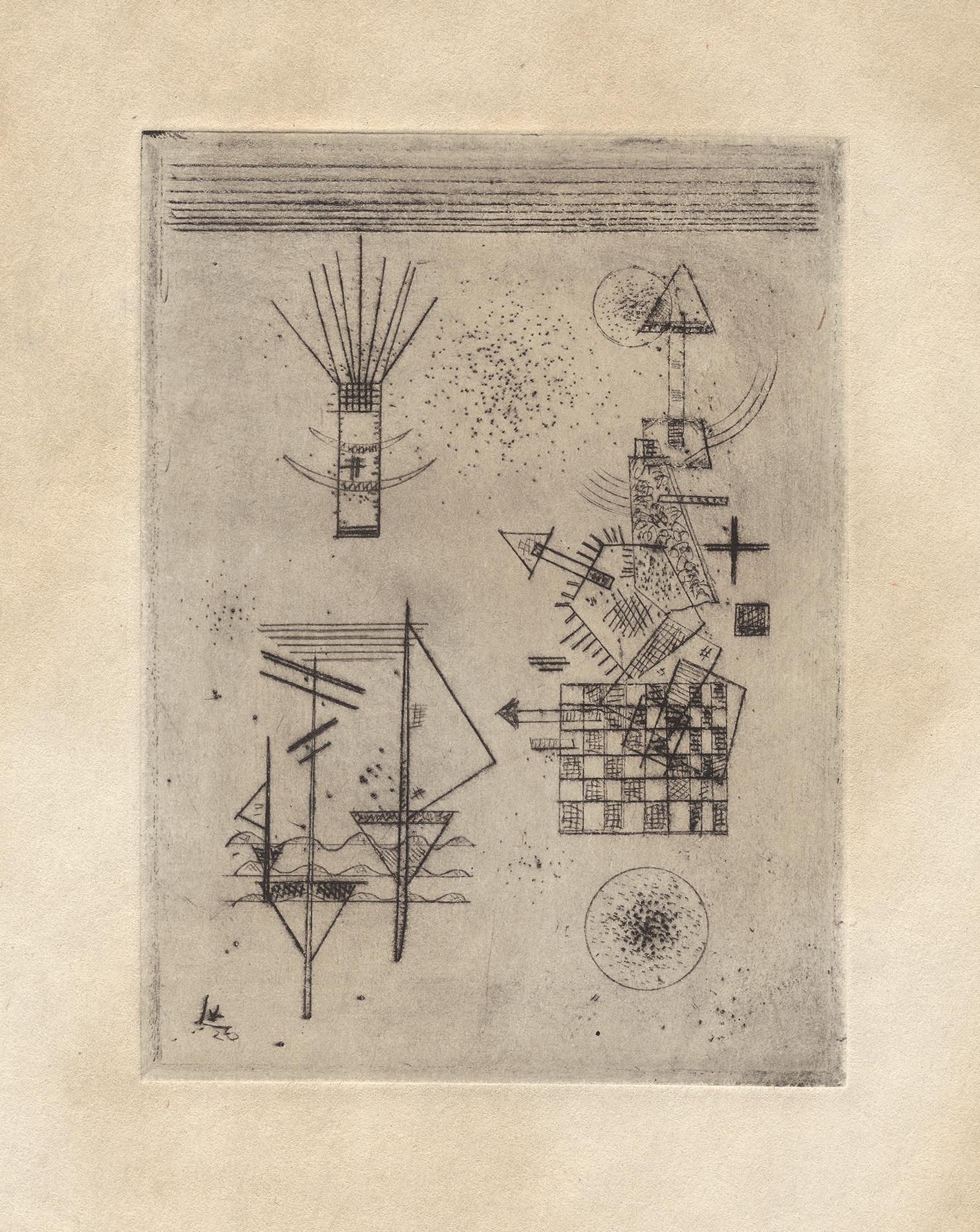
wassily kandinsky (1866 Moskau – 1944 Neuilly-sur-Seine)
7061 Zweite Jahresgabe für die Kandinsky Gesellschaft Kaltnadel auf Similijapan. 1926.
12,1 x 8,9 cm (26,7 x 18,7 cm). Roethel 189.
4.000 €
Roethel erwähnt eine Auflage von 10 Exemplaren auf Kupferdruckpapier mit eigenhändiger Widmung an die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft. Unser Exemplar auf Similijapan wurde wohl neben der Auflage gedruckt. Die filigrane Kaltnadelarbeit in einem feinen Abzug mit leichtem Plattenton und breitem Rand.
paul klee
(1879 Münchenbuchsee/Bern – 1940 Muralto bei Locarno)
7062 „Schwestern vom Stamme der Gorgo“ Feder in Schwarz auf Ingres-Bütten, auf Unterlagekarton montiert. 1930.
28,8 x 51,5 cm.
Unten links mit Feder in Schwarz signiert „Klee“, auf dem Unterlagekarton unten mittig datiert und betitelt sowie mit der Werknummer „V. 8“. Catalogue raisonné, Bern 2001, Bd. 5 (1927-1930), Nr. 5234. 25.000 €
Schlangenhaare schwingen rhythmisch um die Köpfe der beiden Schwestern. Hinterfangen sind sie von nebelhaften Elementen mit feinsten Netzwerken einander überschneidender und durchdringender paralleler Lineaturen. Ein paar Punkte als Augen, schon werden daraus Physiognomien menschenähnlicher und doch geisterhafter Geschöpfe. Symbiotisch vereinigen sich nach unten hin ihre beiden Körper in einer einzigen, nicht absetzenden Linie zu einer weich geschwungenen horizontal liegenden Form. Jeder der reizenden Schwestern aber zeichnet Klee spielerisch und mit einem tiefgründigen Humor ein Herz symbolträchtig weit oben in Halsoder Mundbereich. Die vom Künstler erdachten Figuren einer mythologischarchaischen Welt scheinen in einer prozesshaften
Bewegtheit und Wandelbarkeit begriffen, die luftige Komposition eine Äußerung teils unbewusster Bilder von charakteristischer Vieldeutigkeit und kosmischer Symbolik.
Provenienz:
Lily Klee, Bern (1940 1946)
Klee Gesellschaft, Bern (1946 1950)
Galerie Buchholz (Curt Valentin), Berlin und New York (1950)
Christie’s, New York, Auktion 14.11.1996, Lot 292 Privatbesitz
Christie‘s, New York, Auktion 1996, 07.05.2008, Lot 139 Privatbesitz Rheinland
Ausstellung:
Buchholz Gallery (Curt Valentin), New York 1950, Nr. 56 (mit Abb.)
Literatur:
W. Grohmann, Paul Klee. Handzeichnungen 19211930, Berlin 1934, Nr. 50
W. Grohmann, Paul Klee. Handzeichnungen, Wiesbaden 1951, Nr. 31 (mit Abb.)
C. Kröll, Die Bildtitel Paul Klees. Eine Studie zur Beziehung von Bild und Sprache in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, Bonn 1968, S. 33

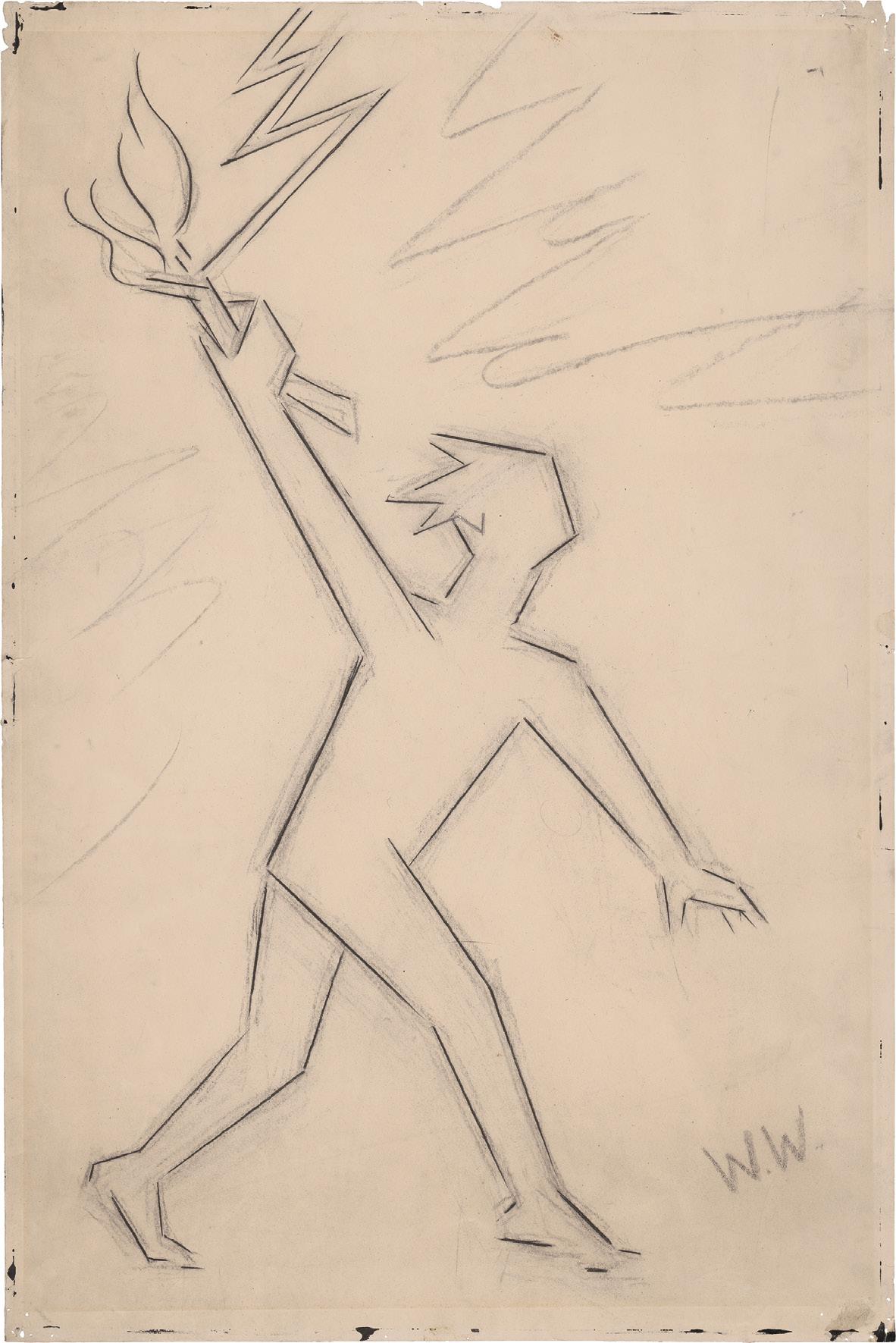
william wauer (1866 Oberwiesenthal – 1962 Berlin)
7063 Fackelträger
Kohle und Zimmermannsbleistift auf Velin. Um 1923. 75 x 50 cm.
Unten rechts mit Zimmermannsbleistift monogrammier t „W.W.“.
2.500 €
Dynamik, Führung, Inspiration Wauers großformatige Zeichnung bringt in seiner Figur des Fackelträgers Bedeutungsinhalt und Zeichenstil in Einklang. Ausschließlich mit Geraden konstruiert er
die vorwärtsstürmende Gestalt und beschränkt sich auf die bloßen, hart abstrahierten und geometrisierten Konturen, verzichtet also auf jegliche Binnengestaltung. Wenige lockere Bleistiftschwünge deuten sowohl die expressive Bewegtheit der Szene als auch den nicht näher bestimmten Umraum an.
Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin
Ausstellung: Galerie Brockstedt, Hamburg/Berlin 2019, Kat.Nr. 34 (mit Abb.)
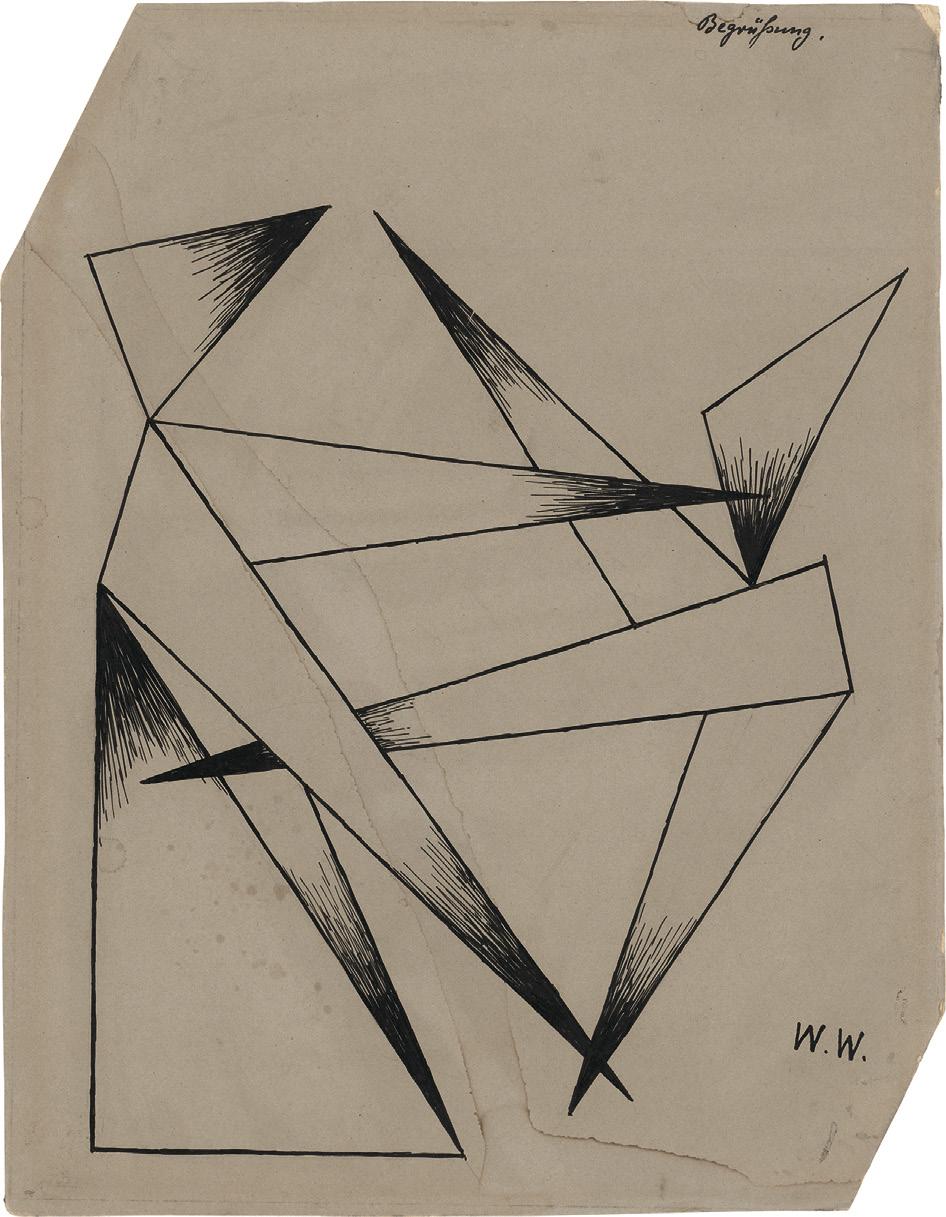
william wauer
7064 „Begrüßung“
Feder in Schwarz auf festem grauen Karton. 1916. 27 x 21 cm (Ecken oben links und unten rechts angeschrägt). Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „W.W.“, oben rechts betitelt, verso unten links bezeichnet „3.“. Laszlo S. 82.
1.500 €
In raumgreifender Dynamik lässt Wauer aus schmalen Dreiecksformen die Begrüßung zweier Figuren entstehen. Die kontrastreiche Wirkung der Federschraffuren in den spitzen Ecken unterstreicht die Räumlichkeit und Bewegtheit der Darstellung. William Wauer, bereits seit 1912 Mitglied der Künstlergruppe „Der Sturm“ in Berlin und dort einer der engsten Mitarbeiter Herwarth Waldens, zeichnet die spitzwinklig abstrahierte Komposition noch vor seiner Zeit am Bauhaus. Beigegeben: Ein Siebdruck desselben Motivs von William Wauer, unten rechts mit der Stempelsignatur.
Provenienz:
Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin
Ausstellung: Galerie Brockstedt, Hamburg/Berlin 2019, Kat.Nr. 3 (mit Abb.)
william wauer
7065 Ohne Titel
Bleistift und Farbstift in Blau auf Makulaturpapier. Wohl um 1924.
27 x 20,8 cm.
Verso mit Bleistift signiert „WWauer“.
1.200 €
Ein Spiel mit konvexen und konkaven Formen, mit Schwüngen und Kurven fordert den Betrachter zur Interpretation auf: Überall scheinen sich im Wirbel der Formen Anklänge an menschliche Körper zu finden, ohne dass die lineare Komposition sich eindeutig entschlüsseln ließe. Die Signatur Wauers verso zeigt sich mit ebenso kurvig schwingenden Formen wie die Darstellung.
Provenienz:
Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin
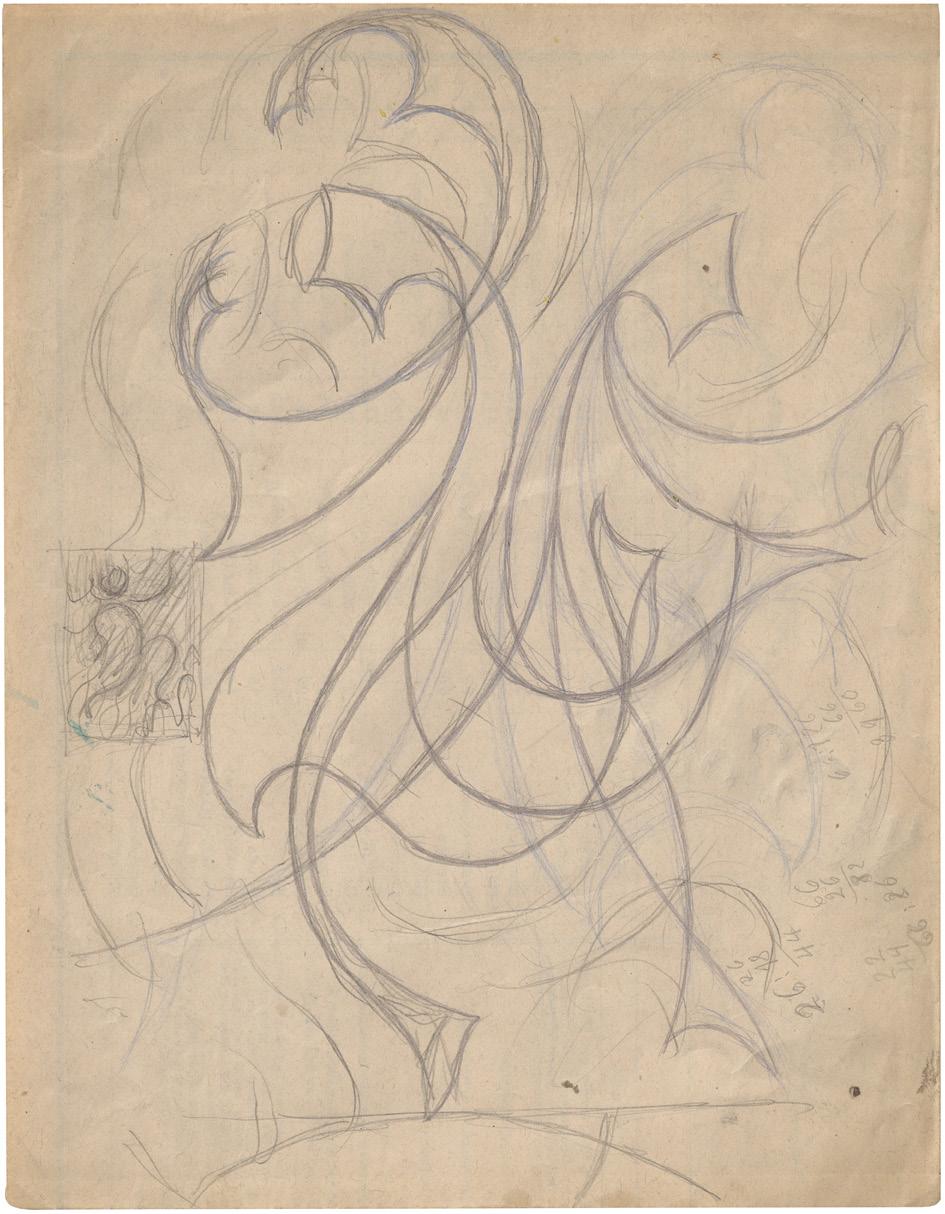
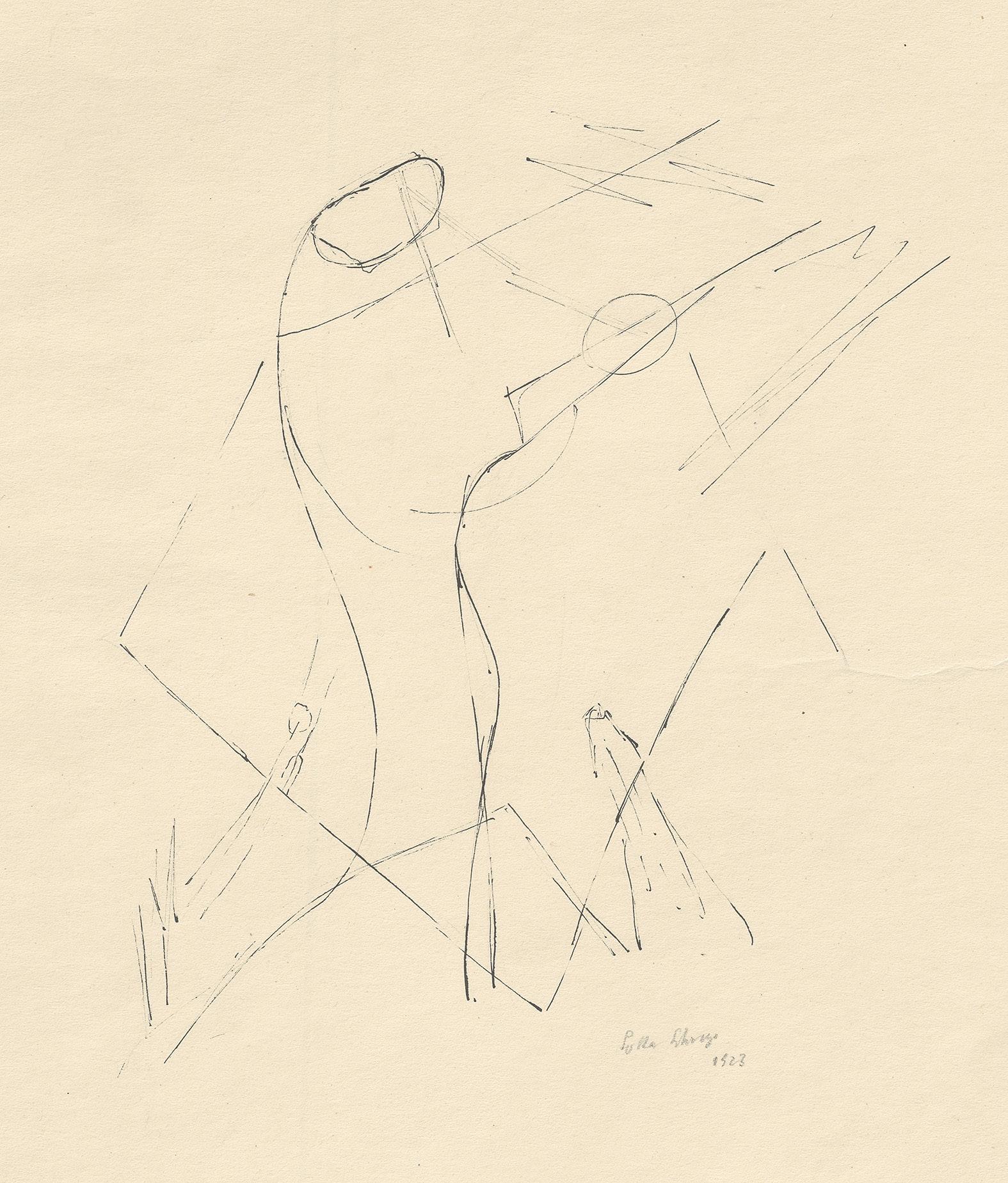
lothar schreyer (1886 Berlin – 1966 Hamburg)
7066 Ohne Titel
Feder in Schwarz auf Velin. 1923. 37,4 x 25,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Lothar Schreyer“ und datiert.
1.200 €
Nach seiner juristischen Promotion in Leipzig arbeitete Lothar Schreyer als Dramaturg am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, seit 1919 leitete er zunächst die Kampfbühne in Hamburg, später 7066
war er an der SturmBühne in Berlin tätig. Walter Gropius holte Schreyer 1921 für die Bühnenwerkstatt und die Maskenspiele ans Bauhaus. Bis 1926 arbeitete Schreyer an Herwarth Waldens Zeitschrift Der Sturm als Redakteur und Schriftleiter; zu dieser Zeit entstand die vorliegende dynamische, kristalline Federzeichnung. Beigegeben: Eine Farbstiftzeichnung auf Transparentpapier, möglicherweise von Lothar Schreyer.
Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin

lothar schreyer
7067 „Farbklang 29“
Aquarell auf Bütten. 1923. 37,8 x 27,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Lothar Schreyer“ und datiert, verso (von fremder Hand?) betitelt.
1.500 €
Um das kleine schwarze Quadrat im Zentrum bewegt sich die konstruktivgeometrische, in reduziertem Farbklang von Rot, Blau
und Schwarz gehaltene Komposition. Am Bauhaus führte Schreyer 1923, im Entstehungsjahr der vorliegenden Zeichnung, Regie bei dem Stück „Mondspiel“, ging jedoch, nachdem die Aufführung erfolglos blieb, nach Berlin.
Provenienz: Nachlass Werner Kunze, Berlin Privatbesitz Berlin
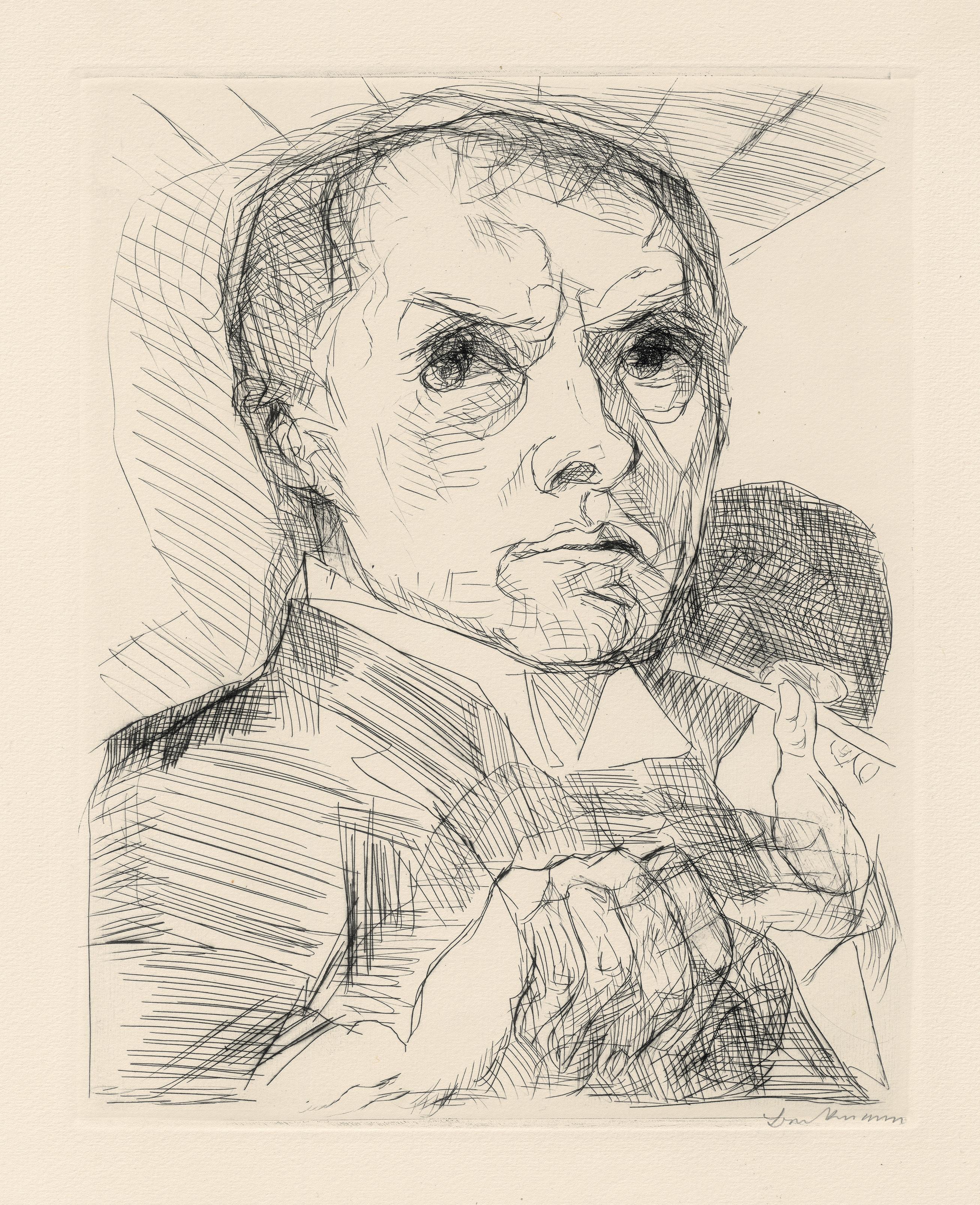
max beckmann (1884 Leipzig – 1950 New York)
7068 Selbstbildnis mit Griffel Kaltnadel auf Bütten. Um 1916. 29,6 x 23,6 cm (44,8 x 37,2 cm). Signiert „Beckmann“. Auflage 60 Ex. Hofmaier 105 II B b. 7.500 €
Blatt 19 der Folge „Gesichter“, erschienen im Verlag der MaréesGesellschaft, R. Piper & Co., München 1919, in einer Gesamtauflage von 100 Exemplaren mit dem Trockenstempel in der linken unteren Ecke. Neben 60 Exemplaren auf Bütten wurden zunächst 40 Drucke von der noch unverstählten Platte für die Luxusausgabe der Mappe auf Japan abgezogen. Der Prospekt der MaréesDrucke, der das Erscheinen ankündigte, warb mit dem „Selbstbildnis mit Griffel“, verkleinert abgebildet. Anfangs plante Beckmann die Veröffentlichung zwei getrennter Portfolios: eines ausschließlich mit Kriegsbildern und das andere mit Eindrücken des Großstadtlebens, das Beckmann „Welttheater“ nennen wollte. Durch Julius Meier Graefes Anregung erschienen die Arbeiten dann aber zusammengefasst in einer Mappe unter dem Titel „Gesichter“.
Die 19 Blätter der Folge bilden keine narrative Sequenz, sondern Momentaufnahmen des Lebens. Beckmanns eigenes Gesicht erscheint darin leitmotivisch in mehreren Portraits, eines zu Beginn, mit dem er in den Zyklus einführt, und das hier vorliegende als Schlussbild; „geläutert geht er aus diesen Szenen hervor, erstarkt und in höchster Spannung wachsam. Er ist nicht mehr der abweisende Beckmann in gedrückter Haltung des ersten Selbstbildnisses: der Zyklus ist geschlossen, ein neuer Anfang ist offen“ (B. Haldner, in: Gesichter von Tag und Traum: aus dem graphischen Werk von Max Beckmann, Ausst.Kat. ETH Zürich 1984, S. 40). Max Beckmann zeichnete, malte, radierte und lithographierte so zahlreiche Selbstportraits wie kaum ein anderer Künstler der Moderne. Das „Selbstbildnis mit Griffel“ ist ein herausragendes Beispiel für seine künstlerische Selbstbefragung, für die energische Auseinandersetzung mit dem eigenen Angesicht, seine Suche nach dem „wahren“ Selbst hinter der äußeren Erscheinung, und zugleich zeigt es den Künstler im Zusammenhang der „Gesichter“ hellsichtig gegenüber den alptraumhaften Verwerfungen des Ersten Weltkrieges. Druck des endgültigen Zustandes von der verstählten Platte, in einem prachtvollen, klaren Abzug mit dem vollen Rand.
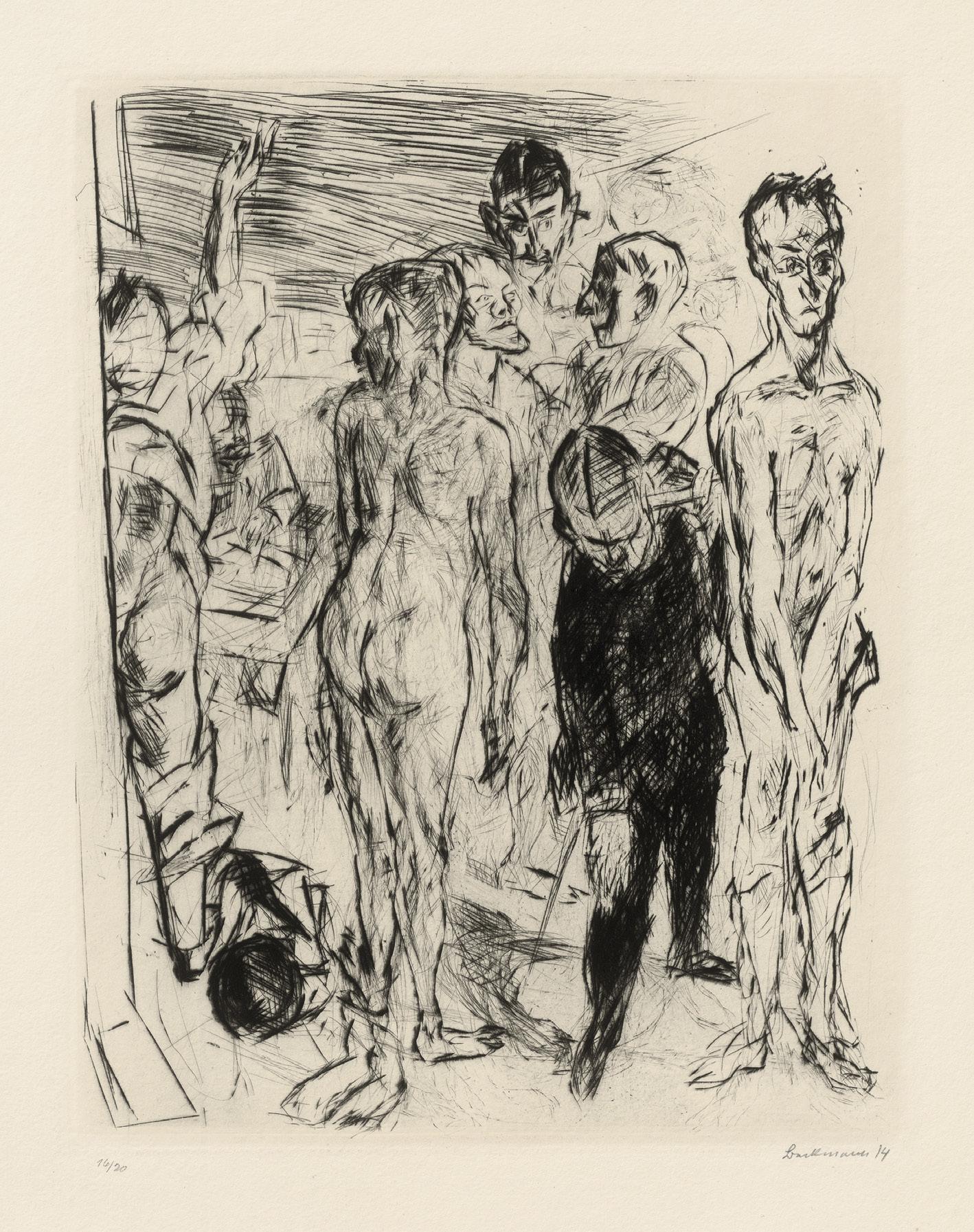
max beckmann
7069 Musterung
Kaltnadel auf Bütten. 1914. 29,5 x 23,5 cm (54,9 x 38,4 cm).
Signiert „Beckmann“ und datiert. Auflage 20 num. Ex. Hofmaier 79 II B.
4.500 €
In der Profilfigur der Personengruppe im Hintergrund erkennt Hofmaier ein Selbstportrait des Künstlers. Beckmann, der im
Ersten Weltkrieg als freiwilliger Sanitätshelfer diente, musste sich, da er kein Soldat war, damals nicht selber einer militärischen Musterung unterziehen. Die vielfigurige Szene schildert er mit einem großen Variantenreichtum in den Linien und Kontrasten, so dass die Diskrepanz zwischen den unbekleideten Rekruten und dem streng gescheitelten Militärarzt besonders ins Auge springt. Herausgegeben von Paul Cassirer, Berlin, im September 1918. Prachtvoller, gratiger Druck mit dem vollen Rand. Selten
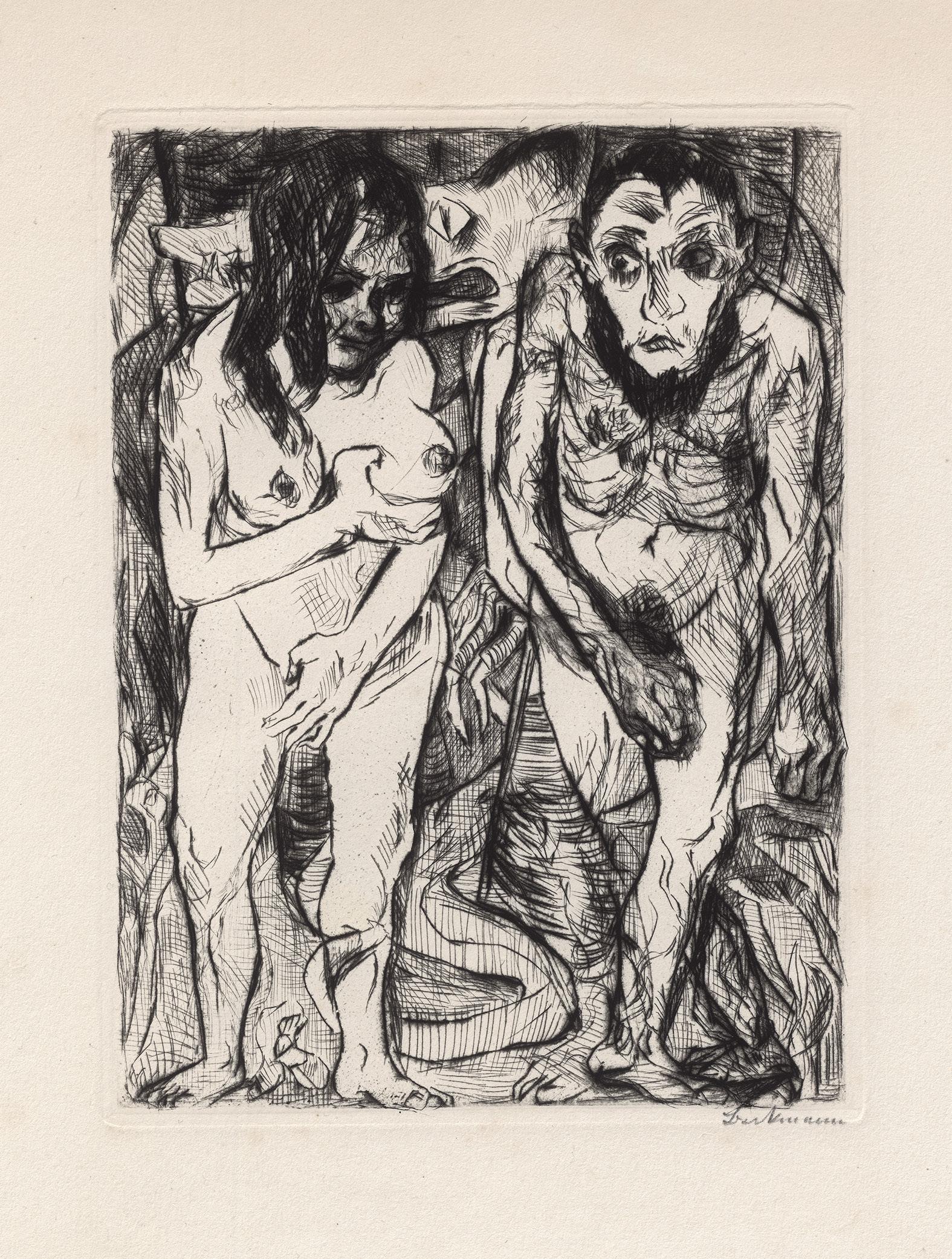
max beckmann
7070 Adam und Eva Kaltnadel auf Van Gelder Zonen-Velin. 1917. 24 x 17,5 cm (46 x 32 cm).
Signiert „Beckmann“. Hofmaier 110 III B b (von c).
5.000 €
Nach dem Sündenfall. Adam und Eva, knochige Gestalten, werden aus dem Paradies vertrieben. Ihre Figuren füllen die dichte Kompo
sition beinahe vollständig aus, während die Schraffuren im Hintergrund jeden Blick auf das verlorene Paradies verwehren. Lediglich das riesenhafte Maul und die Klauen der drachenartigen Schlange scheinen zwischen den Protagonisten hindurch. Aus der Auflage von 50 Exemplaren auf unterschiedlichen Papieren. Neben dieser Auflage nennt Hofmaier 4 Probedrucke (II und III A). Kräftiger, in den Schwärzen samtiger Druck mit sehr breitem Rand.

max beckmann
7071 Die Pelzmütze Kaltnadel auf Japan. 1923. 33 x 22 cm (47,7 x 32,1 cm).
Signiert „Beckmann“. Hofmaier 259 B a (von c).
2.000 €
Bei den Dargestellten handelt es sich laut Hofmaier um das mit Beckmann befreundete Ehepaar Fridel und Ugi Battenberg, bei denen er zwischenzeitlich wohnen und arbeiten durfte, sowie den Pelzmütze tragenden Bruder von Fridel Battenberg, Walter Carl. Aus der kleinen Auflage von 50 Exemplaren auf unterschiedlichen Papieren. Erschienen bei I.B. Neumann, Berlin. Prachtvoller, kräftiger, gratiger Druck mit dem wohl vollen Rand, links und unten mit dem Schöpfrand.
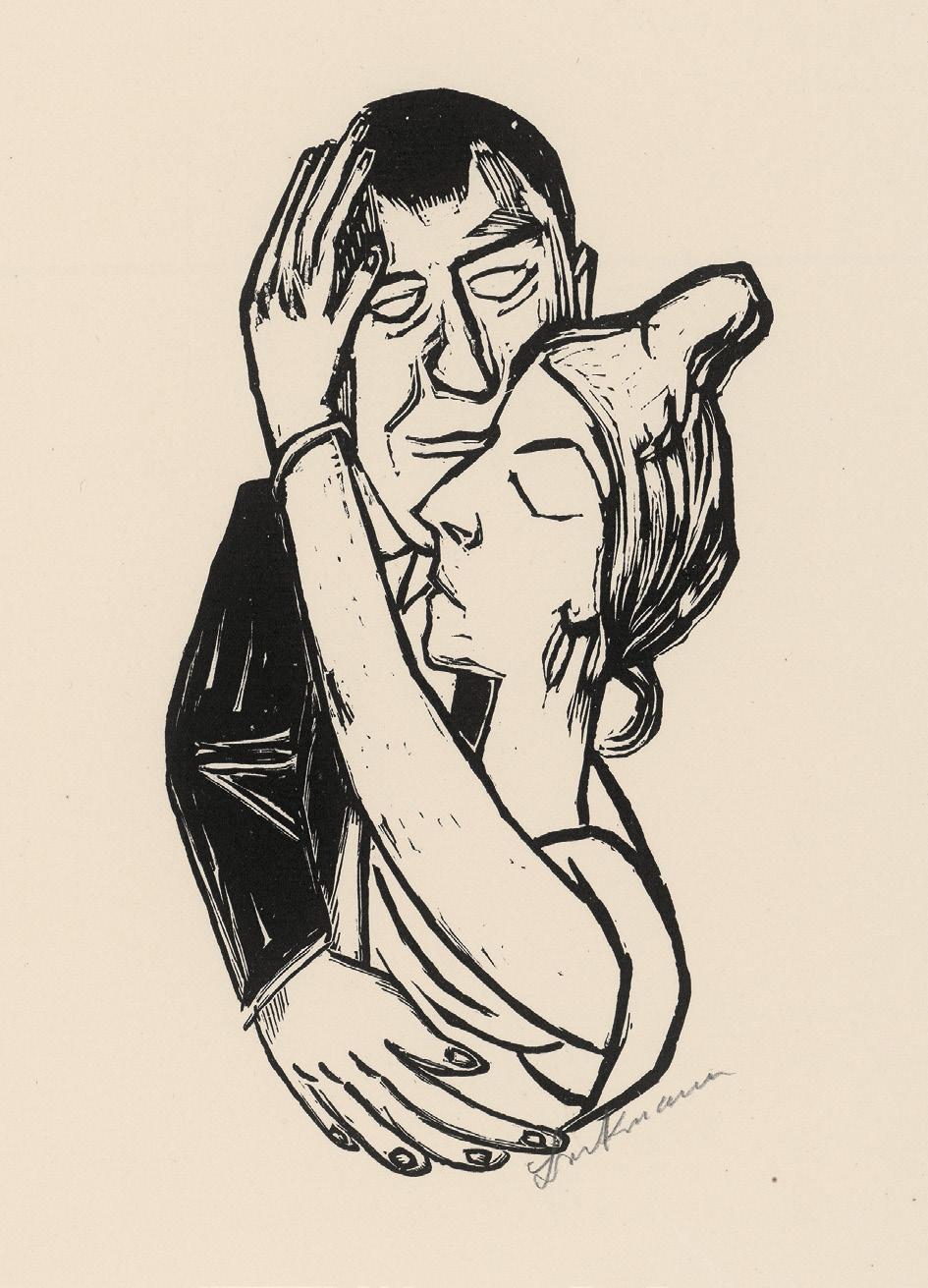

mappenwerke
7072 Zweite GanymedMappe 12 Druckgraphiken auf verschiedenen Papieren, in Orig.Passepartouts, und Titelbl. Lose in Orig.-Halbleinenmappe 1922.
Sämtlich signiert, 2 Bl. datiert. Auflage 300 röm. num. Ex. Söhn HdO 117-1 bis -12. 2.400 €
Die vollständige Mappe, herausgegeben von Julius Meier Graefe, erschienen in einer Gesamtauflage von 2370 Exemplaren bei R. Piper, München 1922. Exemplar der Vorzugsausgabe des Vierten
Jahrbuches der Marées Gesellschaft. Enthält folgende Graphiken: Max Beckmann „Tanzende“, Holzschnitt (Hofmaier 228 B a), Heinrich Campendonk „Die Bettler“, Holzschnitt (Engels 62), Rudolf Grossmann „Zigeunerwagen“, Radierung, Franz Hecht „Aus dem Leben des Hl. Franz“, Holzschnitt, Karl Hofer „Novize“, Lithographie (Rathenau L 30), Paul Kleinschmidt „Bei der Kartenschlägerin“, Radierung, Felix Meseck „Landschaft mit Ziegen“, Radierung, Karl Rössing „Der eingebildete Kranke“, Holzschnitt, Richard Seewald „Aus dem Camposanto“, Holzschnitt (Jentsch H 116), Peter Trumm „Coriolan und seine Mutter“, Holzschnitt und Max Unold „In Memoriam René Beeh“, Holzschnitt. Prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand.

7073
egon schiele
(1890 Tulln a.d. Donau – 1918 Wien)
7073* Bildnis Franz Hauer Kaltnadel auf festem Velin. 1914/21. 12,8 x 10,9 cm (19,5 x 17,8 cm).
Auflage 80 Ex. Kallir 5 c.
1.500 €
Druck von der verstählten Platte für die Auflage der Mappe „Das graphische Werk von Egon Schiele“, erschienen im RikolaVerlag, Wien u.a. 1922, hier ohne den Signaturstempel. Prachtvoller Druck mit feinem Plattenton, mit dem nahezu vollen Rand.


werner schramm
(1898 Duisburg – 1970 Düsseldorf)
7074* Begegnungen
12 Lithographien auf Drei-König-Bütten mit Wasserzeichen „GF“ sowie 3 Bl. Titel, Widmungsblatt und Gedicht von Kurt Heynicke. Lose in lithographisch illustr. Orig.-Kartonmappe. 1921/22.
47 x 39 cm.
Im Druckvermerk signiert, die Lithographien jeweils signiert „Werner Schramm“, datiert und bezeichnet „Begegnungen Druck 37“, das Gedichtblatt signiert „Kurt Heynicke“. Auflage 70 num. Ex.
2.000 €
Die komplette Mappe der ausdrucksvollen Lithographien, erschienen als XVIII. Werk im Verlag der Galerie Alfred Flechtheim, Düsseldorf, Berlin und Frankfurt am Main. Werner Schramm wurde nach seiner Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Düsseldorf und an der Münchner Kunstakademie Mitglied der Künstlervereinigung „Das Junge Rheinland“. 1937 wurde sein Schaffen und insbesondere die Mappe „Begegnungen“ als „entartet“ diffamiert. Prachtvolle, klare Drucke mit dem vollen Rand. Werke von Werner Schramm sind auf dem Kunstmarkt selten

max kaus (1891–1977, Berlin)
7075* Mitleiden
Lithographie auf Velin. 1919. 27,2 x 38,1 cm (31,4 x 42,5 cm).
Signiert „Max Kaus“ und datiert. Krause L 1919/2.
1.800 €
Max Kaus, der zur zweiten Generation Deutscher Expressionisten gehörte, war Schüler von Erich Heckel und Ernst Ludwig Kirchner. Viele der besten Drucke des hochbegabten Künstlers entstanden zwischen 1918 und 1930, zu einer Zeit, in der sich Kaus von seinen Lehrern löste und zu seinem individuellen und charakteristischen Stil fand. Prachtvoller Druck mit kleinem Rand. Selten, eines von nur acht bekannten Exemplaren.
eddy smith
(1895 Hannover – 1957 Berlin)
7076 Sammlung, verschiedene Motive
14 Holzschnitte, 1 Lithographie, 7 Zeichnungen und 3 Aquarelle, teils mit Deckfarbe, auf verschiedenen Papieren. Meist wohl um 1914-20.
Bis 65 x 49,5 cm.
Teils signiert „Eddy Smith“, teils monogrammiert „ES“, teils datiert.
4.000 €
Die Sammlung vielfältiger Arbeiten aus dem künstlerischen Nachlass Eddy Smiths, darunter einige Selbstbildnisse, bildet einen beeindruckenden Überblick über sein Schaffen An wenigen Eckpunkten lässt sich Smiths Werdegang nachvollziehen. So war er unter anderem als Bühnenausstatter für Hanz Poelzig tätig und portraitierte unter anderem Bruno Cassirer, Edwin Redslob, Alfred Flechtheim, Hans Poelzig, Gertrude Eysoldt und Ernst Reuter. Der begabte Zeichner entwarf Briefmarken und Münzen, illustrierte zusammen mit Paul Zech und stach für Edwin Redslob. Nach seinen Studien an der Hochschule der Künste Berlin fand er bereits vor dem Ersten Weltkrieg zu seiner ganz eigenen, expressiven Formensprache. 1921 entstand seine skurrile „Schwarze Mappe“, bis heute ein begehrtes Sammlerstück. Johannes Wüsten hielt „zuengst gesprochen, Smith für die wesentliche Erscheinung (…), wenigstens unter den Stechern. Von eigenartigstem Reiz, so unwirklich als nur möglich und doch eben gerade durch den Stich zur Wirklichkeit und zwar zur eigenartigsten gezwungen.“ (Johannes Wüsten, zit. nach Klaus Märtens, Ausst.Heft Eddy Smith, ein vergessener Kupferstecher und Maler, Galerie Taube, Berlin 2001, o.S.). Die Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre und bald darauf die NSDiktatur beeinträchtigten seinen Werdegang immens. Der lange Zeit in Vergessenheit geratene Künstler wurde erst kürzlich wiederentdeckt und verdient eine entsprechende Würdigung.
Provenienz: Ehemals Nachlass des Künstlers, Berlin
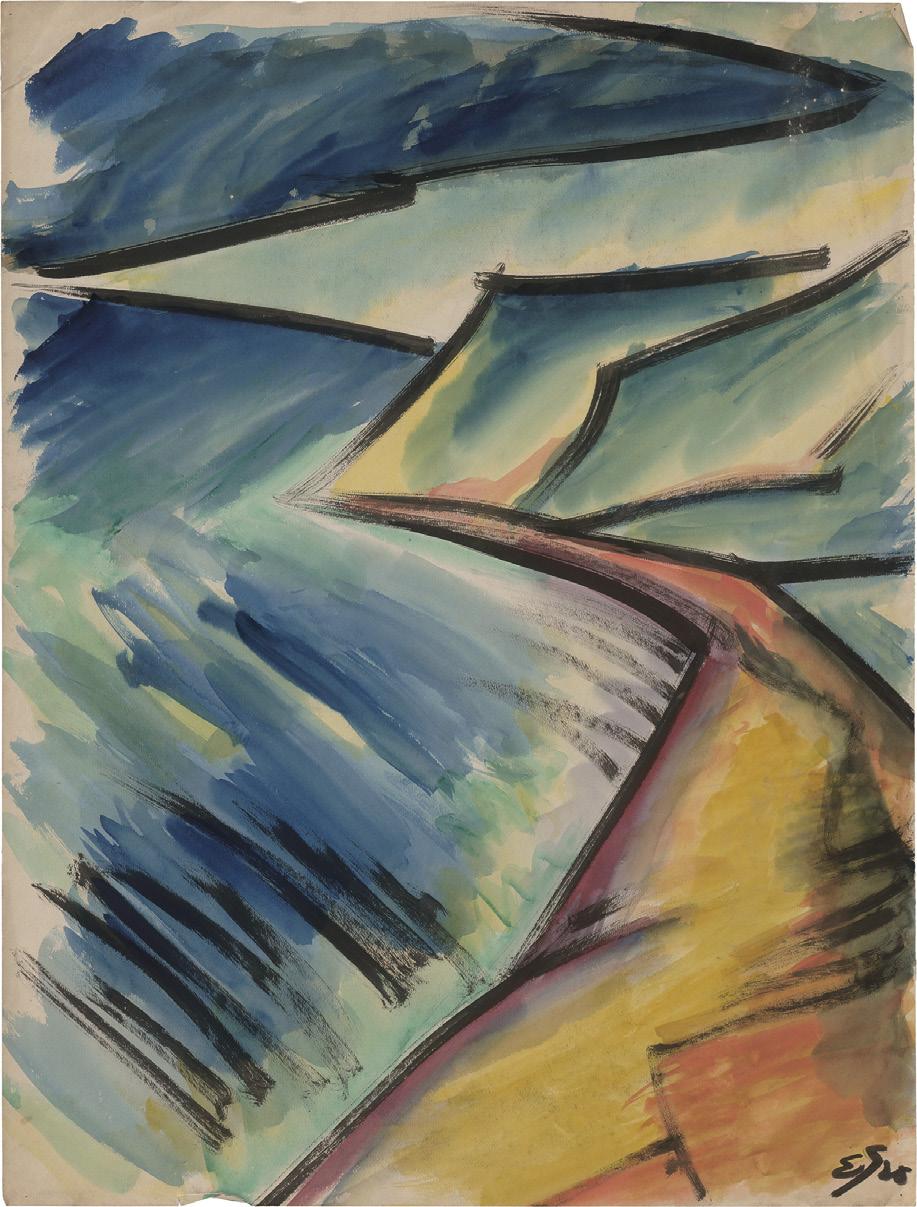




dorothea maetzel-johannsen (1886 Lehnsahn – 1930 Hamburg)
7077 „Mutter und Kind“
Kaltnadel in Schwarzbraun auf festem Kupferdruckpapier. 1919.
18,8 x 12,1 cm (30,1 x 24,9 cm).
Signiert „D. Maetzel-Johannsen“, datiert und betitelt. Nicht bei Hans.
800 €
Dorothea MaetzelJohannsen war zusammen mit ihrem Mann Emil Maetzel Mitbegründerin der Hamburgischen Sezession und entwickelte zwischen 1919 und 1921 eine eigene expressive Bildsprache. Inspiration zog sie dabei unter anderem aus dem Kubismus, der Künstlergemeinschaft Brücke und der afrikanischen Skulptur. Prachtvoller, toniger Druck mit tief eingeprägter Plattenkante und mit Rand.
dorothea maetzel-johannsen
7078 „Liebespaar“
Kaltnadel in Schwarzbraun auf festem Kupferdruckpapier. Um 1919.
18,8 x 12,1 cm (30,2 x 24,9 cm).
Signiert „D. Maetzel-Johannsen“, betitelt und bezeichnet „Nº 9“.
Hans S. 73.
800 €
Typische Graphik aus der expressiven Schaffensphase der Künstlerin in einem prachtvollen, leicht verwischten und bewusst tonigen Druck mit Rand.
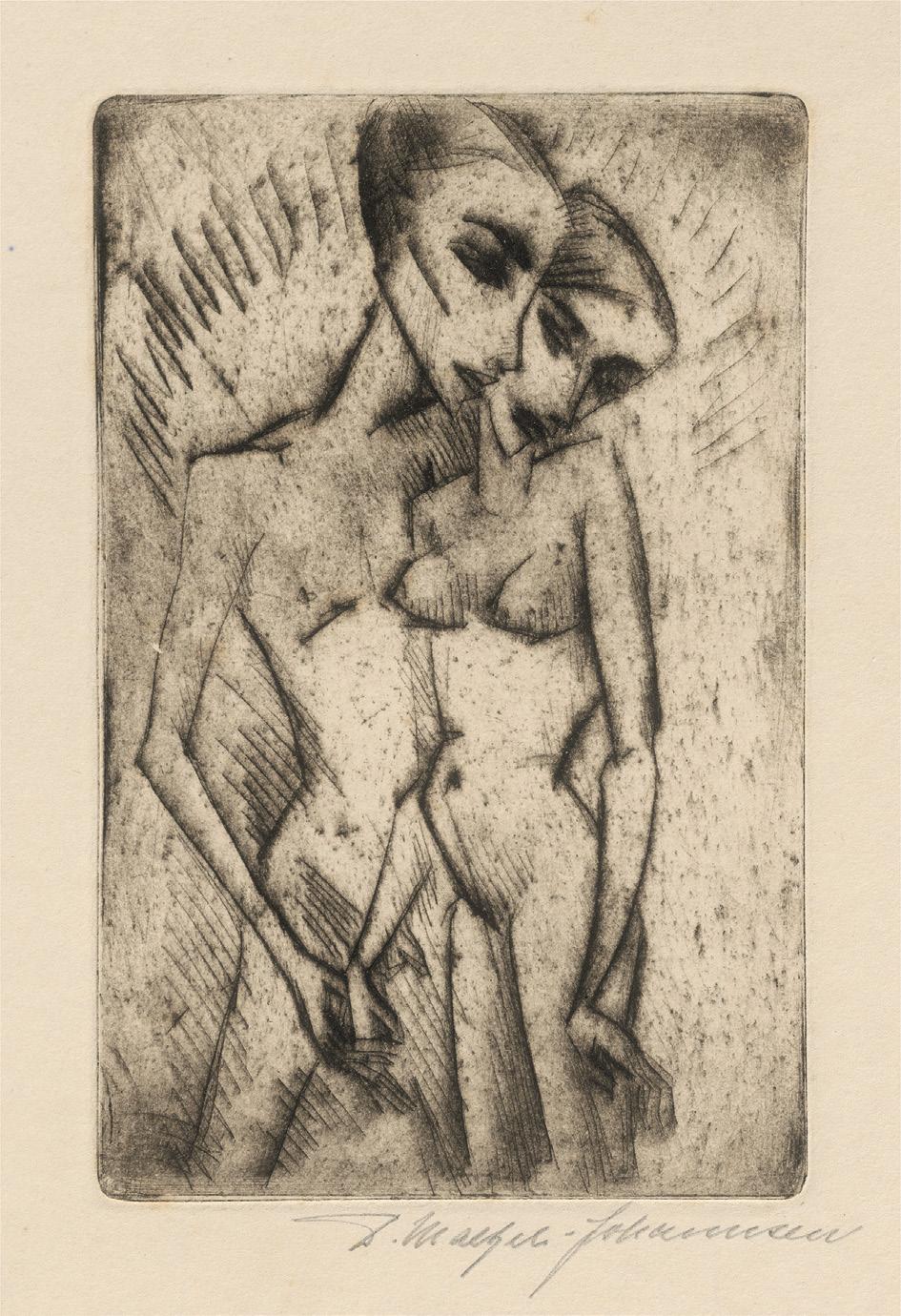
dorothea maetzel-johannsen
7079 Frau mit Katze in Lehnstuhl Kaltnadel auf Velin. 1920. 23 x 17,5 cm (50 x 38,5 cm).
Signiert „D. Maetzel-Johannsen“, datiert und bezeichnet „N° 12“. Nicht bei Hans.
900 €
Kräftiger Druck, in den Rändern mit bewusst dunkel gehaltenem Plattenton und dem wohl vollen Rand.
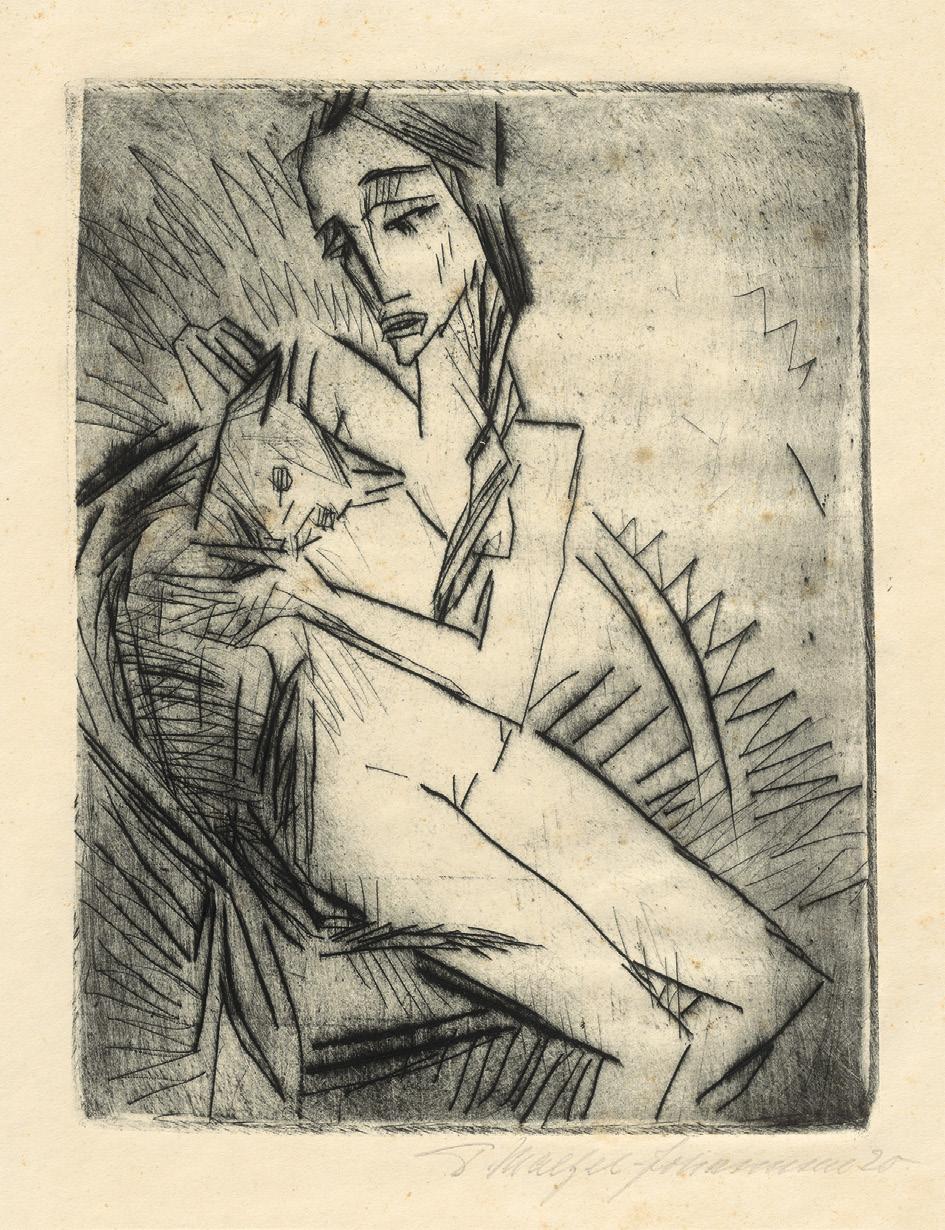
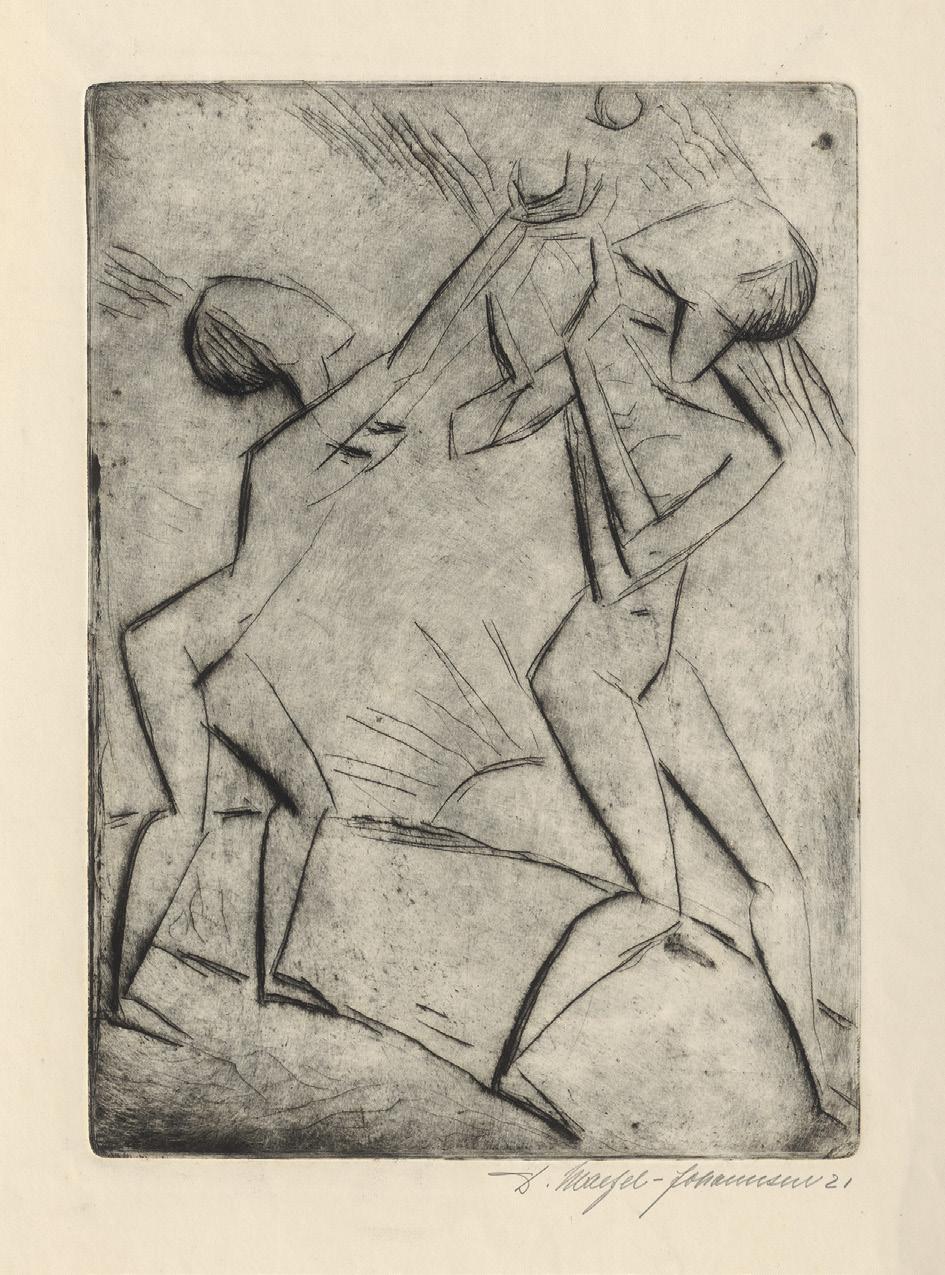
dorothea maetzel-johannsen
7080 Ballspiel am Strand Kaltnadel auf Velin. 1920.
32,8 x 23,4 cm (50 x 35,2 cm).
Signiert „D. Maetzel-Johannsen“ und datiert. Hans S. 75.
1.200 €
Kräftiger, toniger Druck mit breitem Rand.
conrad felixmüller (1897 Dresden – 1977 Berlin)
7081 „Im Kohlenrevier“ (Heimkehr der Kohlenarbeiter) Lithographie auf bräunlichem Maschinenpapier. 1920. 64 x 48 cm (69 x 52,2 cm).
Signiert „Felixmüller“, betitelt und bezeichnet „Lithographie“. Auflage 75 num. Ex. Söhn 221.
10.000 €
Anstatt in Italien den Rompreis entgegenzunehmen, reist Felixmüller im Jahr 1920 lieber ins Ruhrrevier eine Reise, deren Eindrücke ihn geradezu überwältigen und die in ihm mitfühlende Bewunderung für die Bergarbeiter wecken. Hier findet er die Motive für einen zentralen Teil seines Lebensschaffens. „Ich war mehr von den Menschen in dieser Landschaft der Groß und Schwerindustrie ergriffen als von den ‚Giganten der Technik‘. Dabei waren alle formalistischen Probleme mir gleichgültig geworden.“ (Conrad Felixmüller, Legenden, Tübingen 1977). Felixmüllers frühes Schaffen ist von einem sozialkritisch intendierten Expressionismus bestimmt, den er bald zu einem individuell geprägten, expressiven Realismus transformiert. Im Zentrum dieser wichtigsten Werkgruppe des Künstlers steht das Blatt „Im Kohlenrevier“. Die dunklen Flächen löst Felixmüller mit schrägen Schraffuren und Lineaturen auf und lässt eine differenzierte Formenvielfalt entstehen, die charakteristisch für seine Bildauffassung seit dieser Reise ins Ruhrgebiet 1920 ist. Eines der Hauptblätter des Künstlers in einem ganz prachtvollen, tiefschwarzen Druck mit Rand. Von größter Seltenheit, denn Felixmüller selbst vermerkte die Vernichtung eines Großteils der Auflage, von der heute nur noch ca. zehn Exemplare existieren.
Provenienz: Privatsammlung Berlin
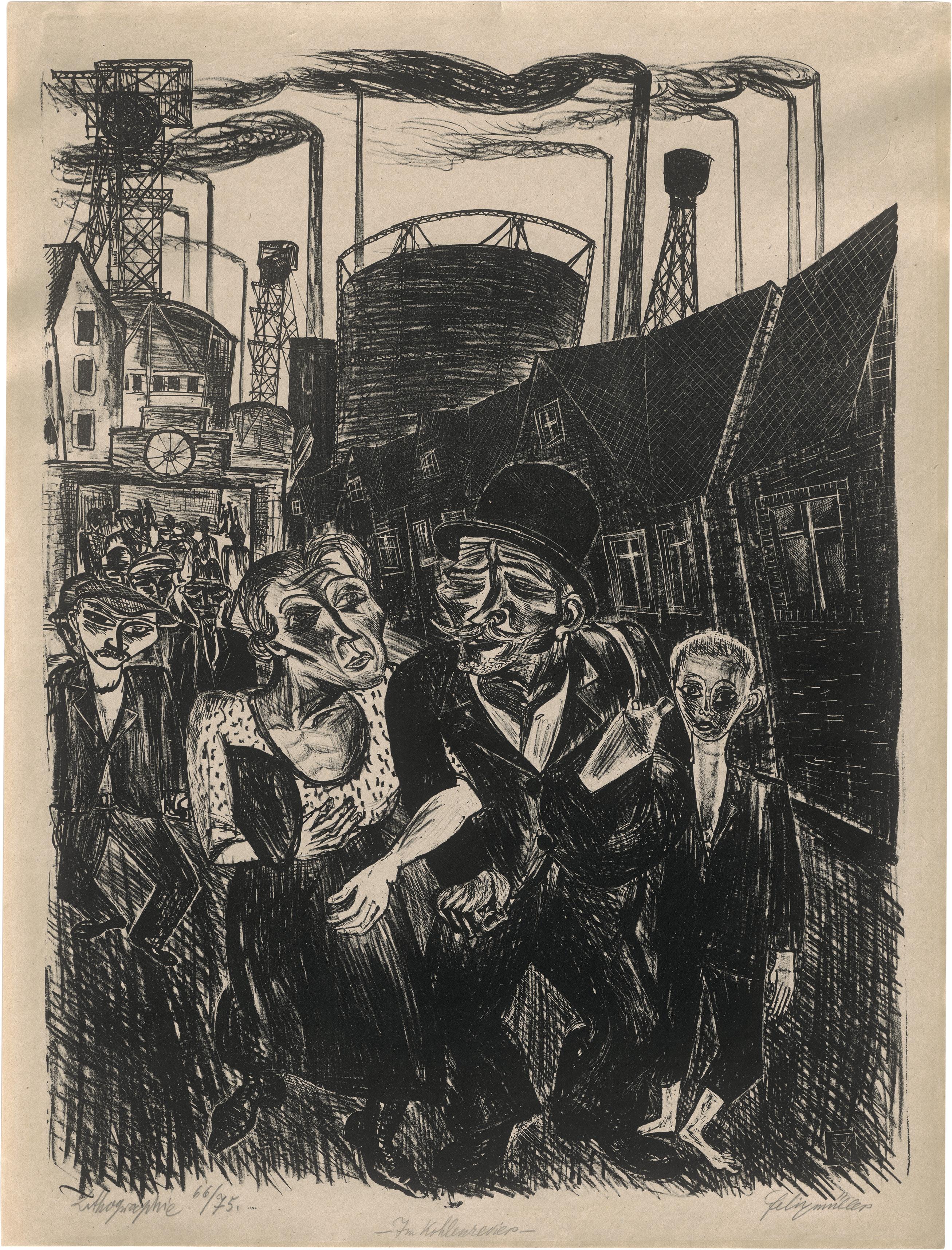
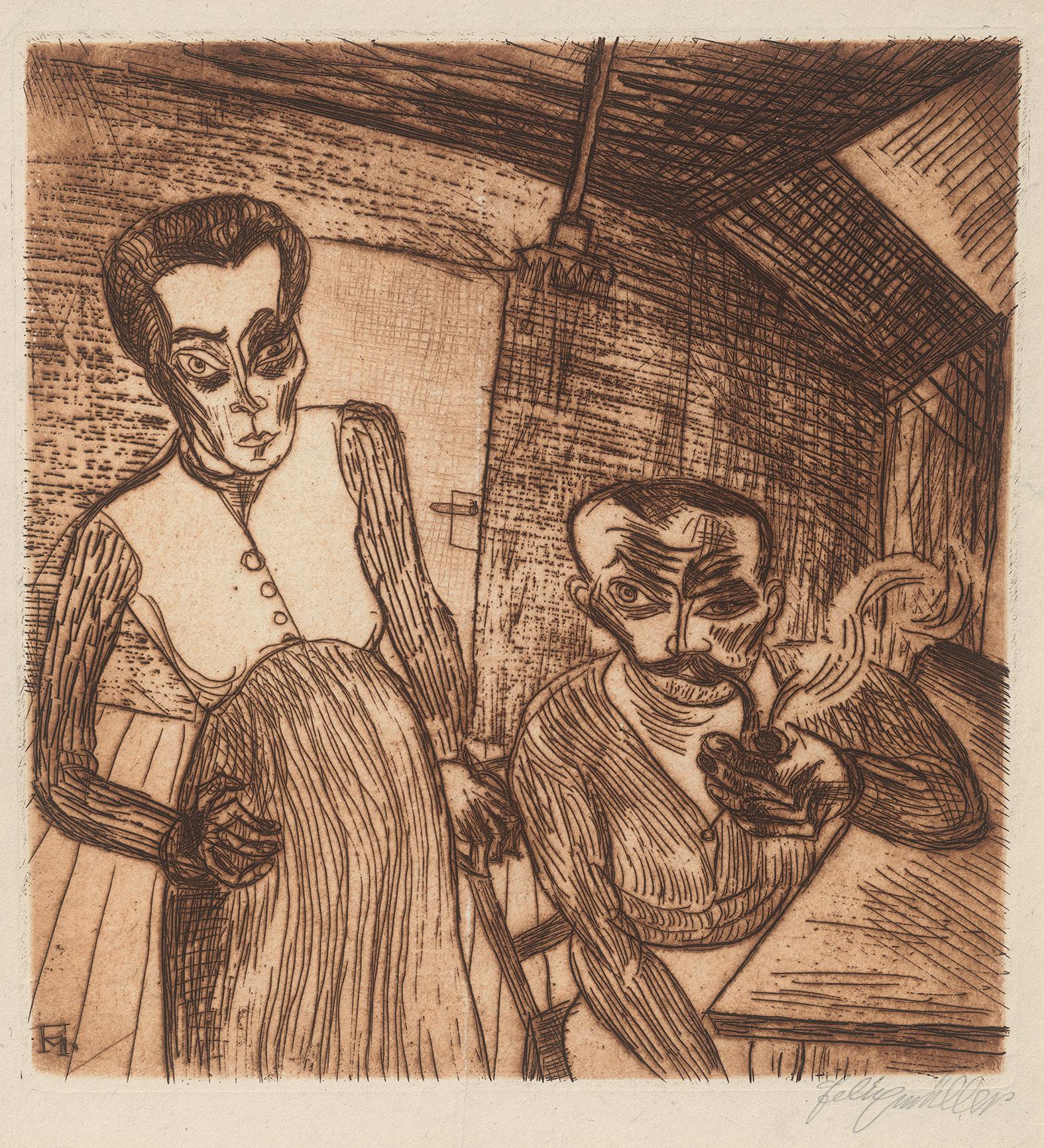
conrad felixmüller
7082 Arbeiterpaar
Radierung in Rotbraun auf Japan. 1920. 28,6 x 27,2 cm (39,7 x 29,3 cm).
Signiert „Felixmüller“. Auflage 25 Ex.
Söhn 220 b, Söhn HdO 72710-10.
1.500 €
Auch betitelt „Ehepaar Schnabel“. Erschienen in „Die Schaffenden“, 2. Mappe, 3. Jahrgang, 1922, in einer Gesamtauflage b von 125 Exemplaren, neben der Auflage a von 30 Exemplaren auf Kupferdruckkarton. Mit dem Trockenstempel in der linken unteren Ecke. Prachtvoller, gratiger Druck mit schönem Plattenton und breitem, an den Seiten mit kleinem Rand.

conrad felixmüller
7083 „Der alte Kohlenbergarbeiter“ (Der alte Kohlenarbeiter)
Stahlstich auf festem Velin. 1921. 21,5 x 15 cm (27,8 x 20,8 cm).
Signiert „Felixmüller“, datiert, betitelt und bezeichnet „Stahlstich Probedruck“.
Söhn 257 a (von b).
3.000 €
Söhn nennt ca. zehn Handabzüge auf unterschiedlichen Papieren, neben der Auflage von 100 Exemplaren auf Kupferdruckpapier, gedruckt bei Walter Künzel für das „Jahrbuch der Jungen Kunst“, Dresden 1921. Der seltene Probeabzug hier bereits mit dem Monogramm, in einem prachtvollen, kräftigen und ausgewogenen Druck mit tiefen Schwärzen, deutlichem Grat und tief eingeprägter Plattenkante sowie mit breitem Rand.

otto altenkirch
(1875 Ziesar – 1945 Siebenlehn)
7084 „Waldweiher“ Öl auf Leinwand. 1920.
97 x 121 cm.
Unten rechts signiert (in die feuchte Farbe geritzt) „Otto Altenkirch.“, verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert, betitelt und bezeichnet „Dresden“.
Petrasch wohl 1920-36-S (ohne Abb.).
12.000 €
Der vibrierende Pinselduktus mit einem reliefhaftpastosen Farbauftrag zeigt beispielhaft Altenkirchs Orientierung am Impressionismus. In der wunderbar harmonischen Farbabstimmung der einzelnen Blau und Grüntöne gelangt der Künstler zu einer überzeugenden Darstellung des schimmernden Waldweihers – es handelt sich Petrasch zufolge um den Steyermühlenwehrteich, in der
sich sowohl seine intensive Auseinandersetzung mit der Natur und den Jahreszeiten als auch sein Können auf dem Gebiet der Dekorationsmalerei widerspiegelt. „Lebendiger Quell malerischer Inspiration wurde ihm der Steyermühlteich (...). In beinahe meditativer Arbeit vertiefte er sich jedes Jahr aufs Neue in das Wechselspiel atmosphärischer Erscheinungen“ (Maria Petrasch, Otto Altenkirch, Ausst.Kat. Schloss Nossen 2005, S. 69). Seine Ausbildung erfuhr Altenkirch an der Berliner Hochschule für Bildende Künste und an der Kunstakademie in Dresden, u.a. bei Paul Vorgang und Eugen Bracht. Um 1920 begann mit dem Umzug nach Siebenlehn nahe bei Dresden die Hauptschaffenszeit des Künstlers.
Provenienz:
Kunsthandlung Oskar Kamprath, Chemnitz (August 1920) Kunstsalon Louis Bock & Sohn, Hamburg (Dezember 1921) Bolland & Marotz, Bremen, Auktion 64, 27.10.1990, Lot 736
Privatbesitz Hannover

otto altenkirch
7085 „Altes Weingut Neu Dobra Liebenwerda“ Öl auf Leinwand. 1934. 66 x 96 cm.
Unten links (in die feuchte Farbe geritzt) signiert „Otto Altenkirch.“ und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Feder in Schwarz nochmals signiert, datiert und betitelt sowie bezeichnet „Siebenlehn Dresden“. Petrasch wohl 1934-31-L (ohne Abb.).
8.000 €
Die frühlingshafte, zartgrüne Landschaft mit dem alten Weingut liegt unter grauem, bewölktem Himmel, links im Bild flattert Wäsche im Wind. Rechts über dem Wäldchen ist schemenhaft der
Lubwardturm, letzter verbliebener Rest des Schlosses Liebenwerda, erkennbar. Seine Heimatlandschaft hielt der Dresdner Künstler immer wieder zu verschiedenen Jahreszeiten fest. Hier verleiht er den mit weichem Pinsel flächig gestalteten Partien durch plastische, pastos aufgebrachte Tupfen und Linien Struktur. Dobra liegt östlich von Bad Liebenwerda im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft. Noch heute wird in der Niederlausitz um Bad Liebenwerda Wein angebaut.
Provenienz: Meerbuscher Kunstauktionshaus, Meerbusch, Auktion 20.03.1992, Lot 2001
Privatbesitz Hannover

otto altenkirch
7086 Die Tonnenbrücke im Schnee (Siebbachenbrücke) Öl auf Leinwand. 1923.
58,5 x 78,5 cm.
Unten rechts (in die feuchte Farbe geritzt) signiert „Otto Altenkirch.“, verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert, datiert und bezeichnet „Dresden“.
Petrasch wohl 1923-10-A (ohne Abb.).
7.000 €
Stimmungsvoll und mit subtil nuancierter Farbgebung erfasst Altenkirch die Winterlandschaft. Als freischaffender Künstler ließ er sich zunächst in Dresden nieder und schloss sich der Dresdner Künstlergruppe „Die Elbier“ an, die sich um Gotthardt Kuehl gebildet hatte und sich dem Impressionismus verschrieb. Wenig später war er an der Gründung der Künstlervereinigung Dresden beteiligt. Von den rund 2000 Gemälden, die Altenkirch schuf, blieben aufgrund von Kriegsverlusten wohl nur etwa 200 übrig.
Provenienz: Privatbesitz Hannover

otto altenkirch
7087 „Feldteich im Schnee“ Öl auf Leinwand. 1923.
67 x 80 cm.
Unten rechts (in die feuchte Farbe geritzt) signiert „Otto Altenkirch.“, verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert, datiert und betitelt. Petrasch 1923-8-S.
7.000 €
In schimmernder Helligkeit lässt Altenkirch, einer der Hauptvertreter spätimpressionistischer Landschaftsmalerei in Sachsen, die schneebedeckte Landschaft leuchten. Lediglich ein paar schwarze,
kahle Kopfweiden am Seeufer links und die mageren Schilfreste durchbrechen das Weiß der in vielfältigen, subtil nuancierten Farbvaleurs und mit pastosem Farbauftrag gestalteten Winterlandschaft. Die sanft gerundete Kurve der vereisten Wasserfläche betont die Eleganz der Komposition. Der passionierte Freiluftmaler Altenkirch fand seine Motive vielfach im Dresdner Heller und im Muldental bei Siebenlehn. Petrasch betitelt das Gemälde „Vereister Feldteich (Zills Teich)“.
Provenienz: Exner, Hannover, Auktion 04.12.1982, Lot 3 Privatbesitz Hannover

george grosz (1892–1959, Berlin)
7088 Vignette, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon
Feder in Schwarz auf Velinkarton. Ca. 1921.
16,2 x 19,4 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Grosz“, verso (von fremder Hand?) mit Bleistift bezeichnet „13“.
1.200 €
Grosz‘ Entwurf zur Vignette eines Kannibalen entstand für die deutsche Ausgabe von Alphonse Daudets „Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon“, die 1921 im Erich Reiss Verlag erschien (vgl. Dückers BA I). Hierzu lieferte Grosz zahlreiche Vollbilder, Initialen und Vignetten wie die Vorliegende. Sie stand am Schluss des vierten Kapitels, S. 26. Die Buchgestaltung, einschließlich Satz und Buchschmuck, stammt von John Heartfield. Die Zeichnung wurde unverändert abgedruckt. Das Original ist zudem signiert. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Ralph Jentsch, Berlin, vom 14.10.2025. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.
Provenienz:
Atelier des Künstlers, Berlin, 1920 Nachlass Frank Jülich, Unkel Privatbesitz Rheinland
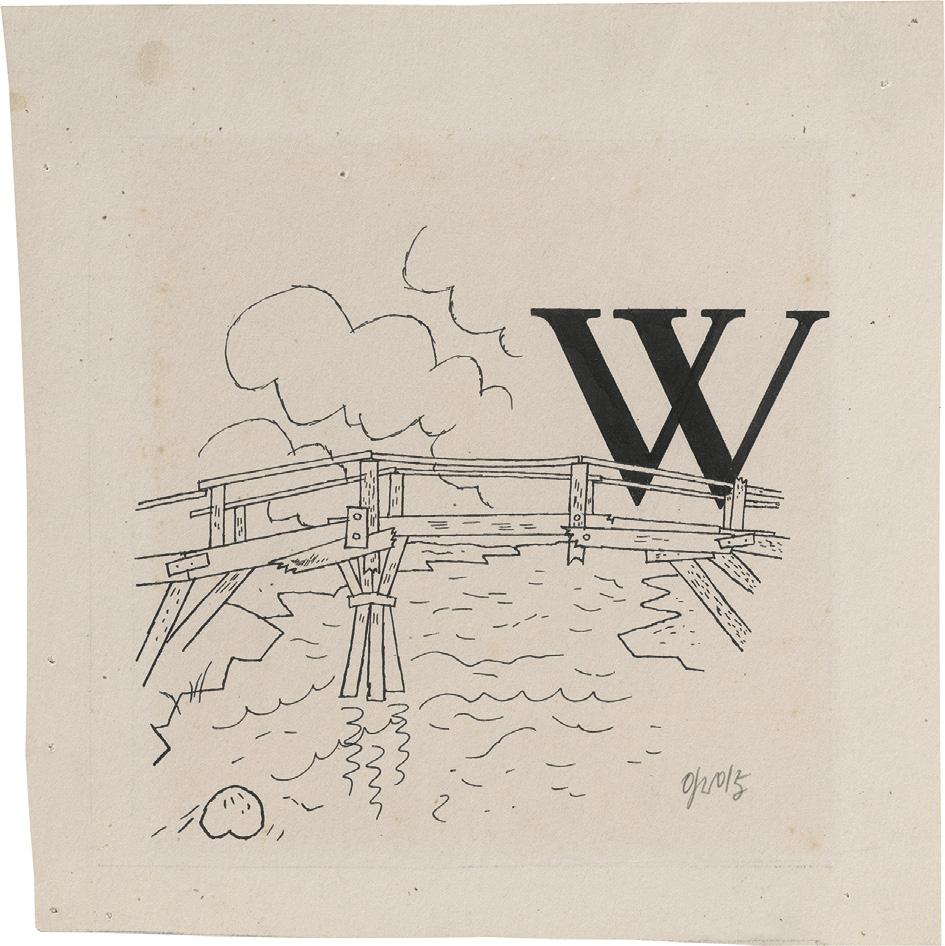
7089 Initiale W, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon Feder in Schwarz auf Velinkarton. Ca. 1921. 16 x 15,7 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Grosz“, verso (von fremder Hand?) mit Bleistift bezeichnet „2“.
1.200 €
Grosz‘ Entwurf zur Initiale „W“, verdeutlicht durch das Wasser eines Flusses, der unter einer baufälligen Holzbrücke hindurchfließt, entstand für die deutsche Ausgabe von Alphonse Daudets „Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon“, die 1921 im Erich Reiss Verlag erschien (vgl. Dückers BA I). Hierzu lieferte Grosz zahlreiche Vollbilder, Vignetten und Initialen wie die vorliegende zum Buchstaben „W“. Dieser stand am Anfang des sechsten Kapitels, S. 32, „Die beiden Tartarins“, das mit dem Satz „Wie, zum Teufel, war es nur möglich, dass bei dieser Sucht nach Abenteuern ...“ beginnt. Die Zeichnung wurde unverändert abgedruckt. Das Original ist zudem signiert. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Ralph Jentsch, Berlin, vom 14.10.2025. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.
Provenienz:
Atelier des Künstlers, Berlin, 1920 Nachlass Frank Jülich, Unkel
Privatbesitz Rheinland
george grosz
7090 Initiale W, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon Feder in Schwarz, Bleistift und Deckweiß auf Velinkarton. Ca. 1921.
13 x 15,2 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Grosz“, verso (von fremder Hand?) mit Bleistift bezeichnet „18“. 1.200 €
Für die deutsche Ausgabe von Alphonse Daudets „Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon“, die 1921 im Erich Reiss Verlag erschien (vgl. Dückers BA I), lieferte Grosz zahlreiche Vollbilder, Vignetten und Initialen wie die vorliegende zum Buchstaben „W“. Dieser stand am Anfang des zehnten Kapitels, S. 47, „Vor der Abreise“, das mit dem Satz „Während Tartarin sich so mit allen möglichen heroischen Mitteln trainierte ...“ beginnt. Grosz‘ Entwurf zur Initiale „W“ wurde dort unverändert abgedruckt. Im Original finden sich zudem die Signatur sowie kleine Korrekturen mit Deckweiß. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Ralph Jentsch, Berlin, vom 14.10.2025. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.
Provenienz:
Atelier des Künstlers, Berlin, 1920 Nachlass Frank Jülich, Unkel Privatbesitz Rheinland
7091 Initiale H, zu Daudet, Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon Feder in Schwarz auf Velin. Ca. 1921. 13 x 11 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Grosz“, verso (von fremder Hand?) mit Bleistift bezeichnet „7“. 1.200 €
Grosz‘ Entwurf zur Initiale „H“, wie „Hirn“, das der satirisch gezeichneten Figur fehlt, entstand für die deutsche Ausgabe von Alphonse Daudets „Die Abenteuer des Herrn Tartarin aus Tarascon“, die 1921 im Erich Reiss Verlag erschien (vgl. Dückers BA I). Hierfür lieferte Grosz zahlreiche Vollbilder, Vignetten und Initialen wie die vorliegende zum Buchstaben „H“. Dieser stand am Anfang des elften Kapitels, S. 49, „Degenstiche, meine Herren, Degenstiche, aber keine Nadelstiche!“, das mit dem Satz „Hatte er wirklich die Absicht, zu reisen?“ beginnt. Die Zeichnung wurde unverändert abgedruckt. Das Original ist zudem signiert. Mit einer schriftlichen Bestätigung von Ralph Jentsch, Berlin, vom 14.10.2025. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.
Provenienz:
Atelier des Künstlers, Berlin, 1920 Nachlass Frank Jülich, Unkel Privatbesitz Rheinland


george grosz
7092 Hauptmann (zu George Shaw, Androklus und der Löwe)
Aquarell, Rohrfeder und Feder in Schwarz auf festem genarbten Velinkarton. 1924.
48,4 x 23 cm.
Unten rechts mit Bleistift und Feder in Schwarz (teils unleserlich) bezeichnet „hauptmann/Hub. von Meyerink“ (...), verso mit dem Nachlaßstempel, dort numeriert „UC409-12“.
24.000 €
Die faszinierende Welt des Theaters und des Kabaretts zog im brodelnden Berlin der 1920er Jahre viele Künstler in ihren Bann –so auch George Grosz. Mit nahezu allen Theaterregisseuren jener Zeit war er bekannt oder pflegte enge Freundschaften. Es ist also naheliegend, dass sich Grosz auch mit großer Hingabe dem Entwurf von Bühnenbildern, Kostümen und Figurinen zuwandte und seine Ideen mit größtmöglicher Fantasie umsetzte. 1924 stattete er die Komödie „Androklus und der Löwe“ aus, die George Bernard Shaw 1912 als Nacherzählung des antiken Sklavenmärchens schrieb Fotos von der Aufführung im ResidenzTheater belegen eine detailgenaue Übernahme der Grosz‘schen Entwürfe. Unser Blatt zeigt
die Figur des Hauptmanns, dessen Rolle im Stück der Schauspieler Hubert von Meyerinck (1896 1971) übernahm. Grosz zeichnet ihn bewusst überspitzt als eigenständigen Typen und nicht als römischen Soldaten. Er kleidet ihn in einer Mischung aus traditioneller schottischer Tracht und militärischer Uniform, ergänzt durch römische Schnürsandalen, einen viel zu großen Stahlhelm und ein zeittypisches Monokel am rechten Auge. Nicht zuletzt wegen der grotesken Gesichtszüge des Mannes, die fast schon einer Fratze gleichen, gelingt dem großen Satiriker Grosz statt einem reinen Kostümentwurf ein beispielhaftes Typenportrait. Verso mit einer weiteren Bleistiftzeichnung. Wir danken Ralph Jentsch, Berlin, für freundliche Hinweise. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.
Provenienz: Nachlass George Grosz, Berlin
Ausstellung:
George Grosz, Alltag und Bühne Berlin 19141931, Zentrum für verfolgte Künste im Kunstmuseum Solingen u.a. 2015 (Kat.Abb. S. 102)
Das kleine Grosz Museum, Berlin 13.05.2022–25.11.2024


george grosz
7093 Passanten Berlin
Rohrfeder und Feder in Schwarz auf dünnem, pergamentartigem UNITY BOND-Papier. Um 1926.
43,5 x 56,2 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Grosz“, rückseitig mit dem Nachlaßstempel, dort numeriert „3-110-1“.
4.500 €
Er ist einer der scharfsinnigsten Beobachter der sozialen Wirklichkeit in der Weimarer Republik. Mit gewohnt sicherem Federstrich skizziert George Grosz in der hier vorliegenden Zeichnung drei zeittypische Figuren der 1920er Jahre und platziert sie kaum zufällig, sondern wohlkomponiert auf dem Papier. Berliner Straßenszenen zählen zu einem der wichtigsten Werkkomplexe in seinem
gesamten Œuvre und entstanden hauptsächlich in den Jahren 1925 bis 1932. Dabei nimmt Grosz die gesamte Bandbreite der unterschiedlichsten Großstadttypen ins Visier, wie er sie vor allem an der belebten Friedrichstraße, auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße findet. Liebespaare, willkürliche Passanten oder zufällige Begegnungen von Jung und Alt, aber auch Militärs, Geistliche oder Richter alle stets treffend charakterisiert und oft als Gegensatzpaar miteinander im Kontrast stehend. Wir danken Ralph Jentsch, Berlin, für freundliche Hinweise. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.
Provenienz: Nachlass George Grosz, Berlin

george grosz
7094* Street Scene, New York
Tuschpinsel, Rohrfeder und Feder in Schwarz auf MBM Ingres d‘Arches-Bütten. 1935. 48,1 x 63,2 cm.
Unten rechts mit der Stempelsignatur „Grosz“, verso mit dem Nachlaßstempel, dort numeriert „4-62-5“.
7.500 €
Eine zufällige Begegnung auf der Straße arrangiert Grosz so, dass in den zügig konturierten Figuren die Gegensätze von Arm und Reich aufeinandertreffen. Der genaue Titel dieser Zeichnung ist nicht bekannt, aber ohne Zweifel spielt die Szene in New York, wo Grosz sich 1932 anlässlich seines Lehrauftrags an der renommierten Art Students League zum ersten Mal aufgehalten hatte, ehe er 1933 endgültig dorthin übersiedelte. Grosz, von Anfang an von
dieser Stadt begeistert, liebte New York und durchstreifte die City immer wieder, was seinen Niederschlag in unzähligen Skizzen, in großformatigen Zeichnungen und Aquarellen fand. Verso eine Federskizze des Künstlers, „Passant mit Hut“. Die Zeichnung ist Ralph Jentsch, Berlin, bekannt. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Arbeiten auf Papier aufgenommen.
Provenienz: Atelier des Künstlers, Douglaston, Long Island, 1939 Ehemals Nachlass George Grosz, Berlin
Literatur:
Uwe M. Schneede (Hrsg.), George Grosz. Leben und Werk, Stuttgart 1975, S. 120, Abb. 206

ferdinand dorsch
(1875 Fünfkirchen – 1938 Dresden)
7095 „Modell und Gliederpuppe“ Öl auf Leinwand. 1925.
52 x 42 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Braun signiert „F. Dorsch“, datiert und bezeichnet „Dresden“, verso auf dem Keilrahmen mit Kreide in Rot nochmals signiert und betitelt.
3.000 €
Im Jahre 1926 fand die Internationale Kunstausstellung in Dresden statt. Die künstlerische Avantgarde wollte damit wieder an die von Gotthart Kuehl begründete und durch den Krieg unterbrochene Dresdner Ausstellungstradition anknüpfen. Neben Fritz Beckert, Ernst Richard Dietze und Josef Hegenbarth war auch Kuehls Meisterschüler Ferdinand Dorsch mit vier Werken in der Dresdner Abteilung vertreten, wovon eines das vorliegende Gemälde war (Jahresschau der Arbeit, Amtlicher Führer und Katalog durch die Ausstellung Dresden 1926, S. 99, Nr. 678). Wie bereits der eigenhändige Titel des Gemäldes preisgibt, handelt es sich bei der Darstellung um ein weibliches Modell mit einer Gliederpuppe. In virtuosen und flächig aufgetragenen Pinselstrichen beschreibt Dorsch schemenhaft sein Modell: Nur mit langen Strümpfen und hohen Schuhen bekleidet, präsentiert es sich dem Betrachter in
ganzer Pracht. Die als Attribute zugeordnete schwarze Augenmaske und der schwarze Federfächer verleihen der schönen Unbekannten eine mysteriöse Aura. Dorsch inszeniert ein Spiel der Kontraste, mittels welchem er das Modell mit erotischem Charakter, das in seiner Schaffensphase der 1920er Jahre einen wesentlichen Schwerpunkt bildete, effektvoll hervorhebt: Neben der lebendig stehenden Nackten sitzt eine steife Gliederpuppe, die auf den ersten Blick in dem schwarzen Frack und mit Chapeau Claque wie ein eleganter Herr der bürgerlichen Welt wirkt. Dorschs Werk zeigt sich deutlich vom französischen Impressionismus beeinflusst: Er gestaltet den Hintergrund der Szenerie in herrlich pastosen Farbflächen mit kurzem und starkem Pinselduktus. Dabei lässt er offen, wo die ausschnitthaft wiedergegebene Szenerie stattfindet.
Provenienz: Sammlung Hermann Naumann Privatbesitz Berlin Bassenge, Berlin, Auktion 89, 09.06.2007, Lot 6722 Privatbesitz Brandenburg
Literatur:
Jahresschau der Arbeit, Amtlicher Führer und Katalog durch die Ausstellung, Dresden 1926, S. 99, Nr. 678
bernhard kretzschmar (1889 Döbeln – 1972 Dresden)
7096 Straßenszene mit Passanten Kaltnadel mit Aquatinta auf Velin. 1920. 26,3 x 30,3 cm (45,3 x 52 cm).
Signiert „Bernh. Kretzschmar“ und datiert. Nicht bei Schmidt.
1.200 €
Expressionistisches Blatt von großer Erzählfreudigkeit: Gesellschaftskritisch und durchaus humorvoll schildert Kretzschmar die belebte Straßenszene. Entstanden ist die Kaltnadel 1920, in dem Jahr, in dem der Künstler nach Ausflügen zum Linol und Holzschnitt wie auch zur Lithographie sich wieder der Radierung zuwandte, die in den folgenden Jahren im Mittelpunkt seines Schaffens stehen sollte. Brillanter, wunderbar gratiger Druck mit schön differenziertem Aquatintaton und dem vollen Rand.

walter gramatté
(1897–1929, Berlin)
7097 Lächelnder Kopf (Selbstportrait)
Radierung in Grün auf feinem Japanbütten. 1923. 25,7 x 17,5 cm (44,5 x 28,2 cm).
Signiert „Walter Gramatté“ und datiert. Auflage 10 röm. num. Ex. Eckhardt 156.
800 €
Blatt II aus dem Mappenwerk „Das Gesicht, neun Radierungen“, erschienen in einer Gesamtauflage von 75 numerierten Exemplaren im Euphorion Verlag, Berlin, mit dessen Trockenstempel in der rechten unteren Blattecke. „Es ist immer wieder, Zeit seines Lebens, das eigene Ich, das er darstellt. Daher die vielen Selbstporträts. Sie zeigen, weit über das Formale und Technische hinaus, die außerordentliche Entwicklung seines Inneren, die Entwicklung einer Seele, die vom Chaos zum Kosmos, die vom zerrissenen zum geläuterten Selbst führt (...)“ (Hermann Kasack, zit. nach: Walter Gramatté, Ausst.Kat. Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf 2005 , S. 20). Brillanter Druck mit dem vollen Rand, an drei Seiten mit dem Schöpfrand.
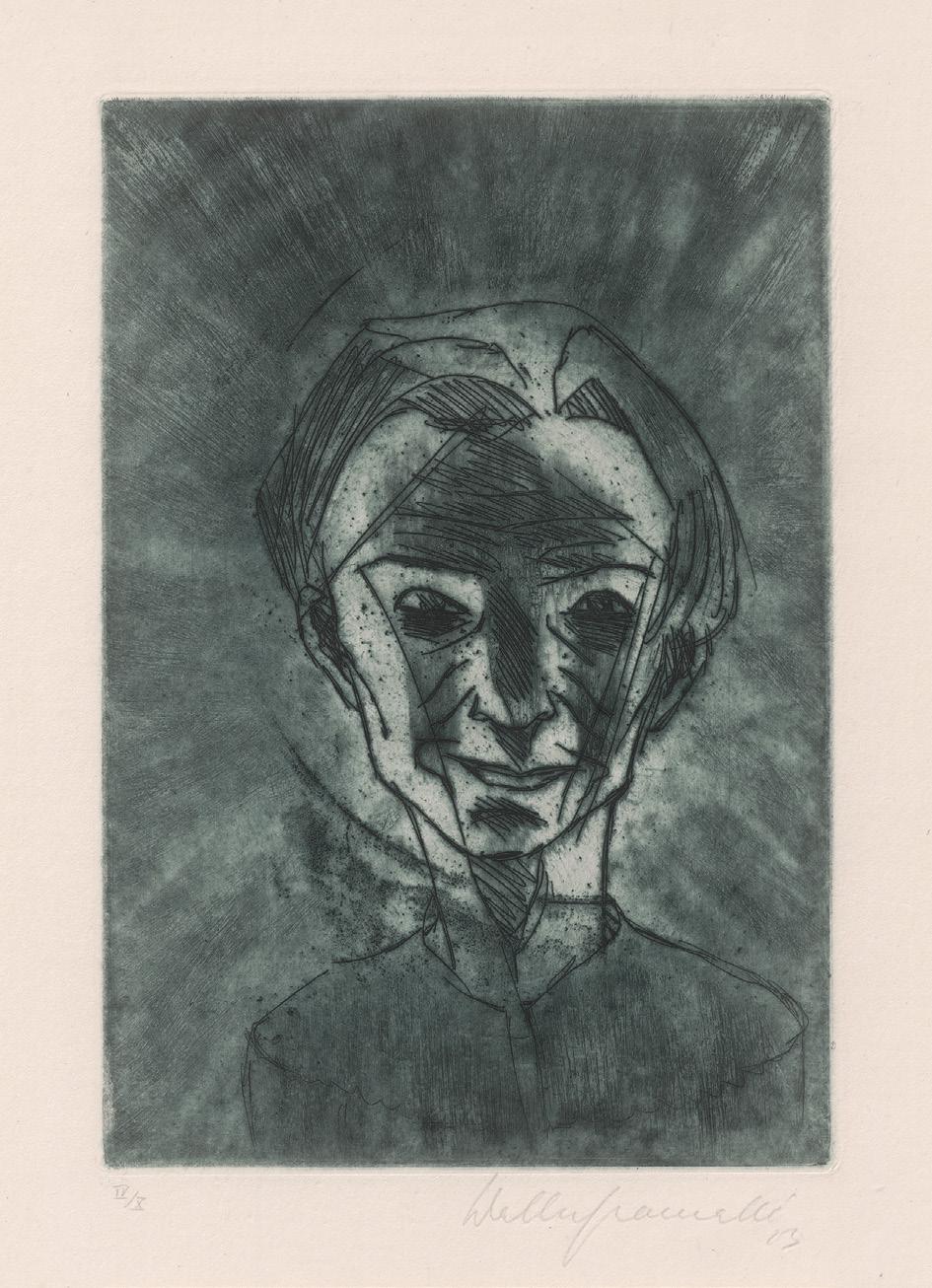
alfred kubin
(1877 Leitmeritz/Böhmen – 1959 Wernstein)
7098 „Die Flucht“; Ohne Titel
2 Bl. Bleistift auf Velin. Vor 1928.
29,8 x 23,3 bzw. 29 x 22,8 cm.
1 Bl. unten rechts mit Bleistift monogrammiert (ligiert) „AK“, unten links (von fremder Hand?) betitelt.
1.500 €
„Die Flucht“ diente wohl als Vorzeichnung zur Lithographie gleichen Titels, 1928 (Hoberg 104). Jeweils verso eine weitere Bleistiftzeichnung des Künstlers. Die skizzenhaften Figuren fängt Kubin mit den charakteristischen lockeren, leicht nervösen Linien ein, und stets haftet ihnen auch etwas Phantastisches an.
Provenienz:
Grisebach, Berlin, Auktion 228, 31.05.2014, Lot 1166
Privatbesitz Rheinland
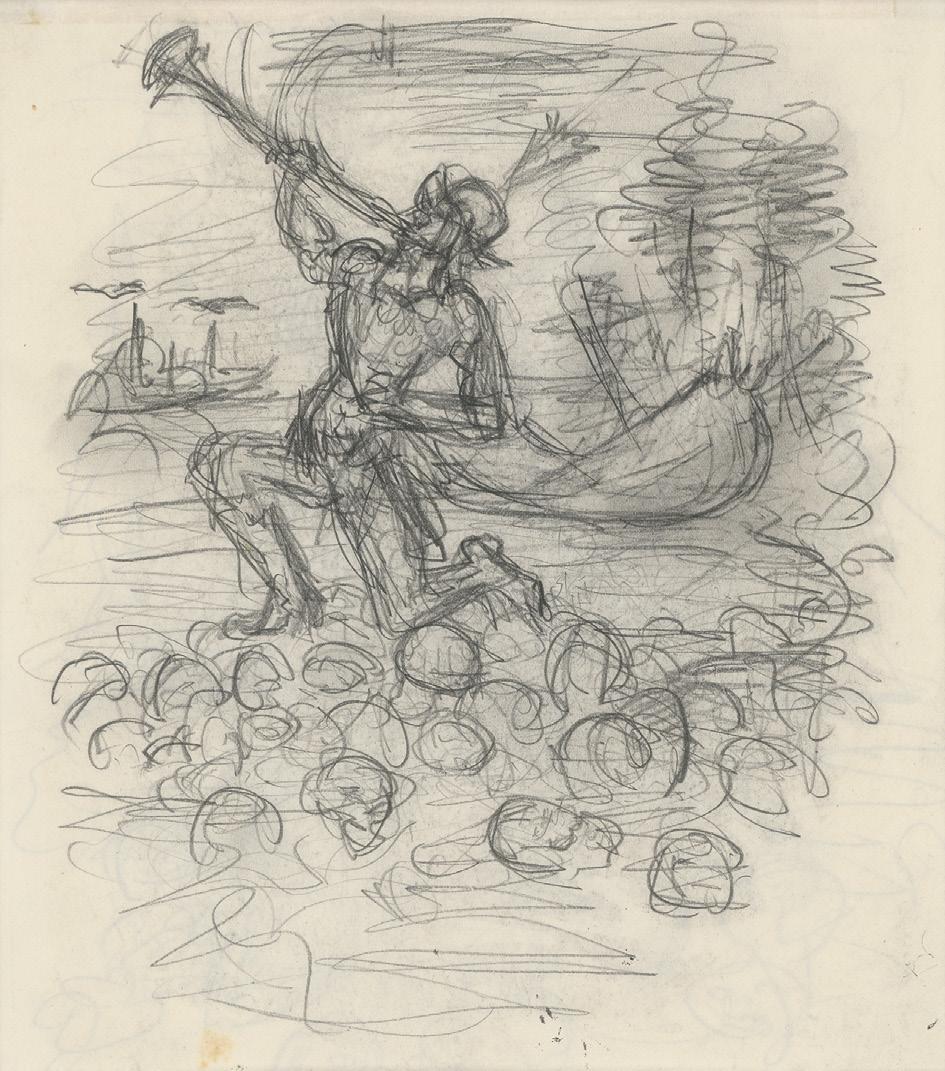
7098

7099
alfred kubin
7099 Pflegerin mit Kind Tuschfeder auf JWZanders-Bütten. 1941.
39,5 x 28,1 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „AK“ und datiert, unten links (von fremder Hand?) mit Bleistift betitelt.
1.500 €
Innig und ganz eng hält die Pflegerin das Kleine an sich gedrückt, beide blicken gleichermaßen ernsthaft zum Betrachter. Ausdrucksvoll bringt Kubin die japanische Tusche mit feiner, dazu auch ganz breiter Feder aufs Papier und lässt daraus die Halbfigur der stehenden Kinderfrau mit einem Baby im Arm entstehen.
Provenienz:
Grisebach, Berlin, Auktion 228, 31.05.2014, Lot 1167
Privatbesitz Rheinland

alfred kubin
7100 Madonna mit Kind Feder in Schwarz, laviert, und Kugelschreiber in Schwarz auf Velin. Um 1950.
32,5 x 26,7 cm.
Unten rechts in der Darstellung mit Feder in Schwarz signiert „AKubin“.
6.000 €
Ein liebevoller Kubin, anders als der von Alpträumen heimgesuchte Künstler, zeigt sich in dieser Zeichnung: Feinsinnig erfasst er in vielfachen kurzen Linien, Schwüngen und Kringeln die beiden Figuren von Madonna und Kind unter dem Manteltuch, umgeben
und plastisch ausgestaltet mit weichen Lavierungen. Immer wieder in seinem vielfältigen Werk zeichnet Kubin seine tiefsten Ängste in Gestalt von phantastischen Gestalten, grotesken Fratzen und bedrohlichen Momenten, setzt aber hier sein zeichnerisches Können und das charakteristische Vokabular ein, um den Inbegriff von Unschuld und Liebe ins Bild zu setzen.
Provenienz: Roland Graf von Faber Castell, Stein Europäischer Adelsbesitz 1978 (durch Erbschaft erhalten) Sotheby‘s, London, Auktion 20.06.2019, Lot 318 Privatbesitz Rheinland

werner peiner
(1897 Düsseldorf – 1984 Leichlingen)
7101 Callas
Tempera auf Holz. Um 1920. 53,6 x 39,1 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „PEINER“.
2.500 €
Vor dunklem Grund setzen sich die farbigen Blütenblätter der Callas detailreich vom reduzierten, klar strukturierten Hintergrund ab. Ganz im Stil der Neuen Sachlichkeit erfasst der Maler das Dar
gestellte. In den 1920er Jahren war er ein erfolgreicher neusachlicher Künstler, wandelte den Stil und Inhalt seiner Arbeiten ab etwa 1930 jedoch ins VölkischNationalistische. Seine Arbeiten der 1920er Jahre wurden kürzlich im Rahmen der Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit Ein Jahrhundertjubiläum“ in der Kunsthalle Mannheim präsentiert.
Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden

karl friedrich brust
(1897 Frankfurt am Main – 1960 München) 7102 Frühlingsblumenstrauß Öl auf Leinwand. 1923. 63,5 x 48,5 cm.
Unten links mit Pinsel in Blaugrün signiert „Brust“ und datiert.
1.500 €
Frühe Arbeit des Künstlers, vor seiner abstrakten Schaffensphase, die nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Bald nach seiner ersten Einzelausstellung in der Galerie Schames Frankfurt 1922 wurde Karl Friedrich Brust Mitglied im Frankfurter Künstlerbund (1923). Im selben Jahr entstand das mit weichen Linien und sensibel abgestufter Palette gestaltete, frühlingshafte Stilleben.
Provenienz: Privatbesitz München
kasimir malewitsch (1878 Kiew –1935 Leningrad)
7103 Compositions avec plans et dissolution
Bleistift auf Velin. Nach 1919. 12,5 x 21,5 cm. Nakov S-554.
30.000 €
Malewitsch, in seiner Innovationskraft bahnbrechender Vertreter des Kubofuturismus und Suprematismus, zeichnet die Kombination dreier geometrischer Kompositionen vollkommen gegenstandslos: Die um 1916 1917 entwickelten Motive sind mit ihrer abstrakten Formsprache in einer völlig abgelösten, rein geistigen Bildwelt angesiedelt. Erst kurz zuvor, im Winter 191516, fand in St. Petersburg die legendäre Ausstellung der russischen Avantgarde statt, auf der Kasimir Malewitsch erstmals sein Schwarzes Quadrat, eine der Ikonen der abstrakten Kunst, präsentierte. Nakov erfasst das Blatt in der Rubrik „Weißer Suprematismus und kosmische Visionen“, kreuzförmige Elemente in den Kompositionen deuten jedoch bereits die darauf folgende Schaffensphase des Künstlers an.
Die Zeichnung stammt aus dem ehemaligen Besitz von Anna Leporskaya, Schülerin und Assistentin des Künstlers. Mit einer Fotoexpertise von Miroslav Lamac, Prag, vom 14.01.1975.
Provenienz:
Anna Aleksandrovna Leporskaya, Leningrad Galerie Gmurzynska, Köln 1974, Nr. 22 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet sowie handschriftlich „38“)
Galerie Aronowitsch, Stockholm 1976, Kat.Nr. 43 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort bezeichnet)
Sammlung Jan Hellner, Stockholm (mit dessen Klebeetikett auf der Rahmenrückseite)
Göteborgs Auktionsverk, Auktion 02.06.2025, Lot 4252367 Privatbesitz Schweden
Ausstellung:
Von der Fläche zum Raum. Russland 1916 24, Galerie Gmurzynska, Köln 1974, Nr. 22, Abb. S. 106

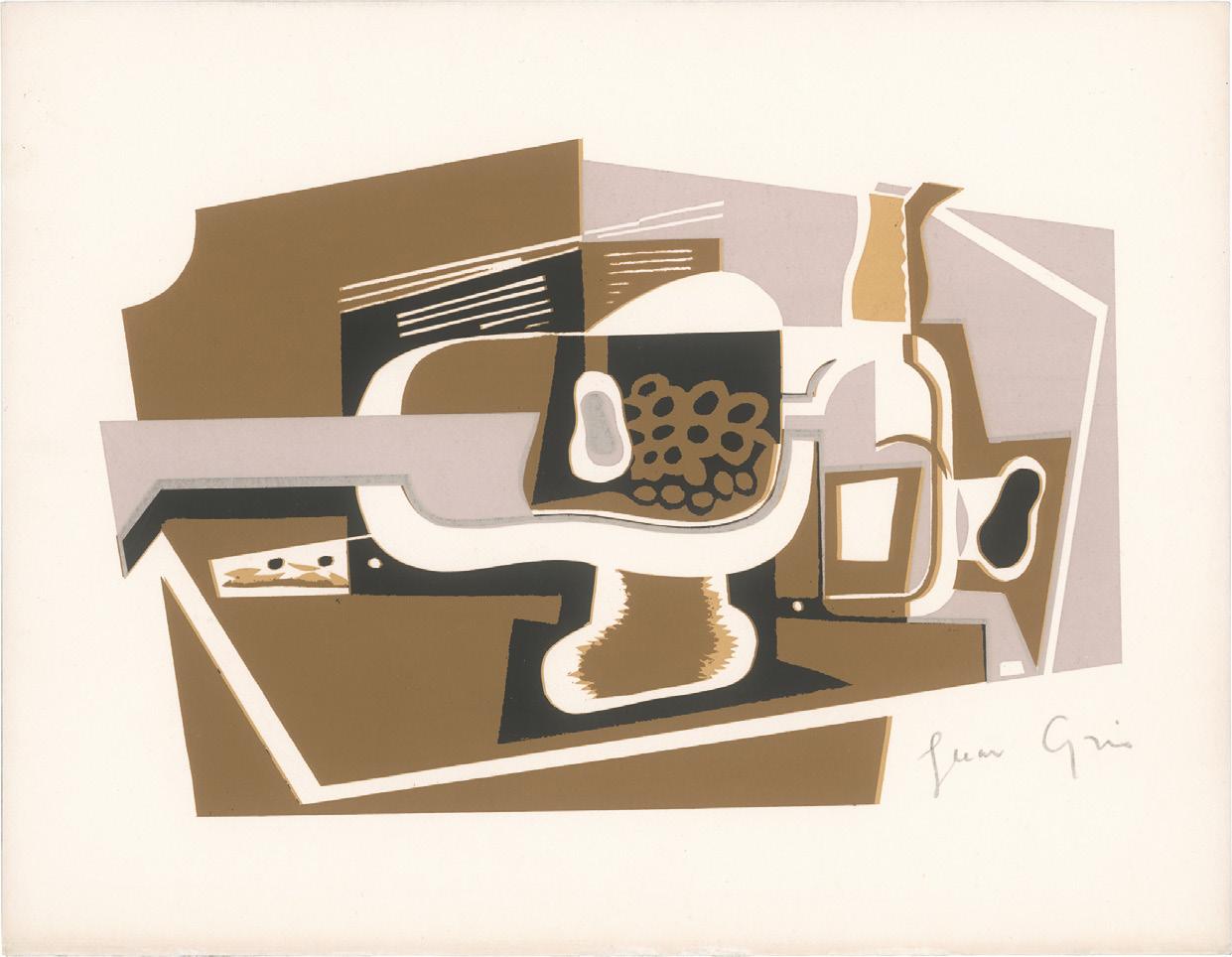
juan gris (1887 Madrid – 1927 Boulogne-sur-Seine)
7104 Nature Morte
Pochoir auf Velin. 1922.
16,5 x 24,9 cm (23,5 x 30,5 cm).
Signiert „Juan Gris“.
Kahnweiler 34.
1.200 €
Juan Gris zählte, neben Pablo Picasso und Georges Braque, zu den wichtigsten Vertretern des synthetischen Kubismus. Dabei stand die Zusammensetzung eines Gegenstandes aus geometrischen Einzelteilen im Zentrum der Bildkomposition, was in der vorliegenden Arbeit klar ersichtlich ist. Gris bedient sich hier der klassischen Formensprache des Kubismus: Er wählt das Stilleben als Genre und platziert mittig die Gitarre, um die sich die restlichen Formen aufzuteilen scheinen. Plastizität wird in einer Bildebene suggeriert, die Perspektive und eine interpretative Illusion negiert. Herausgegeben von L‘Esprit Nouveau, Paris, wohl als Neujahrsgabe 1923, in einer unbekannten Auflagenhöhe. Ausgezeichneter, malerische Werte umsetzender Druck, der in die reife Schaffensphase des Künstlers fällt, mit Rand.
florence henri (1893 New York – 1982 Compiègne)
7105* Poster for Hanover Gallery Farblithographie auf festem Velin. 1923. 24,3 x 20,3 cm (50,3 x 34,8 cm).
Signiert „Florence Henri“ und datiert.
1.800 €
Geometrisch abstrahierte Komposition der avantgardistischen Künstlerin und Fotografin. Henri begann als Pianistin, nach dem Studium der Musik wandte sie sich der Malerei zu. In Berlin besuchte sie die Kunstakademie und war 1922/23 Schülerin von Johannes WalterKurau. In Paris lernte sie an der Académie Moderne bei Fernand Léger und Amédée Ozenfant, um dann 1927 für einen Sommerkurs an das Bauhaus in Dessau zu gehen. Hier war Josef Albers einer ihrer Lehrer. Bei László MoholyNagy studierte sie schließlich Fotografie. Prachtvoller Druck mit breitem Rand.
7106* Südliches Dorf mit zwei Männern
Bleistift auf gräulichem Velin. Um 1925.
29,6 x 44,6 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Florence Henri“.
1.800 €
Frühe, noch deutlich vom späten Kubismus beeinflusste Arbeit der Künstlerin. Im Jahr 1925 ging sie nach Paris zu Fernand Léger und Amedée Ozenfant an die Académie Moderne, wo Léger und der „Esprit nouveau“ Spuren in ihrem Werk hinterließen. Große Bedeutung erlangte Florence Henri dann als Fotografin am Bauhaus.
Provenienz:
Privatbesitz Norddeutschland
Bassenge, Berlin, Auktion 103, 02.06.2014, Lot 7180
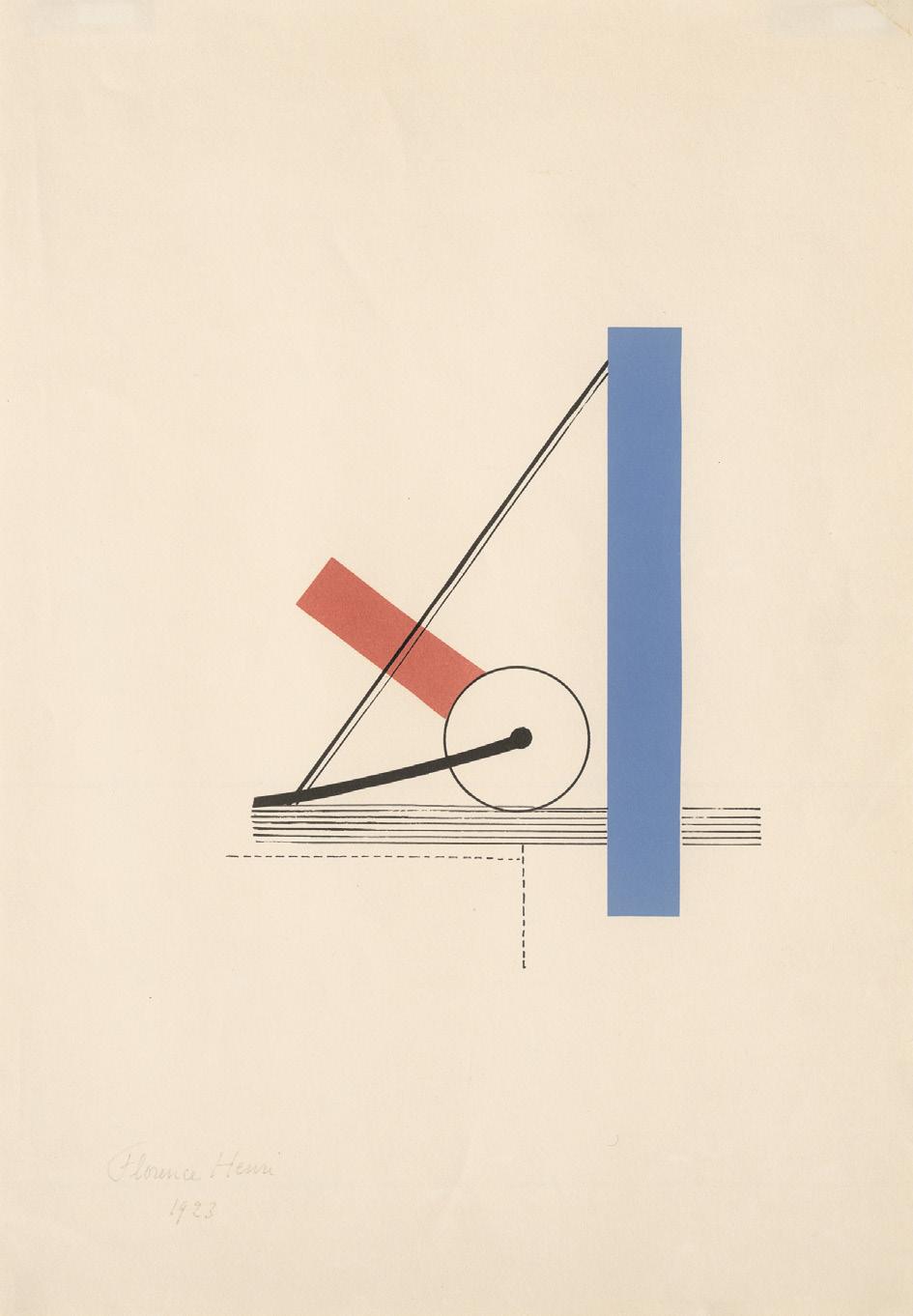


natalja gontscharowa (1881 Ladyschino – 1962 Paris)
7107 Grand bal de nuit, Salle Bullier grand bal des artistes Farblithographie auf Affichenpapier. 1926. 108,5 x 71,5 cm (119,5 x 79,5 cm).
6.000 €
Emblematischer Plakatentwurf Gontscharowas für den Großen Künstlerball, der am 23. Februar 1923 in der Pariser Salle Bullier stattfand. Ihr farbensprühendes Plakat zeigt sich mit seiner fragmentierten Raumkomposition vor einem flachen Hintergrund mit
scharfkantigen, figurenartigen Silhouetten vom Kubismus beeinflusst. Die kleinen Zwischenräume zwischen den einzelnen Farbformen lassen den hellen Untergrund durchschimmern. Zustand vor der Schrift. Dem Vorbesitzer Gerhard Matzat hatte Gontscharowa zeitweilig, während ihrer Zusammenarbeit, ihr Pariser Atelier zur Verfügung gestellt. Gedruckt bei Joseph Charles, Paris, mit dessen Druckvermerk im Unterrand. Prachtvoller, farbintensiver Druck der großformatigen Komposition, mit Rand.
Provenienz: Sammlung Gerhard Matzat, Hattersheim Privatbesitz Süddeutschland
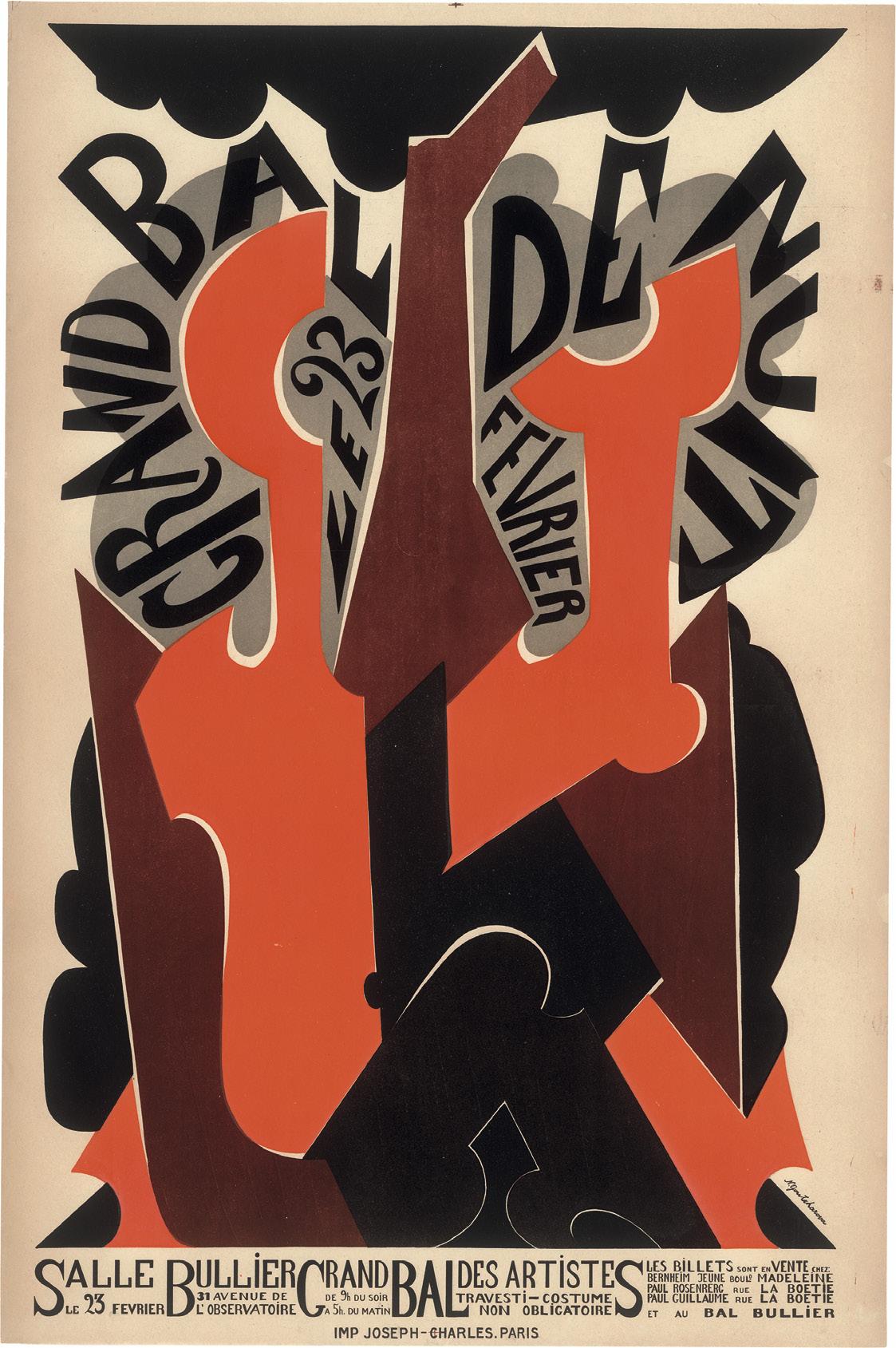
natalja gontscharowa
7108 Grand bal de nuit, Salle Bullier grand bal des artistes Farblithographie auf Affichenpapier. 1926. 108,5 x 71,5 cm (119,5 x 79,2 cm).
6.000 €
Die vibrierende Energie des Pariser Nachtlebens und auch die Vitalität der dortigen Künstlergemeinschaft finden ihren Ausdruck in Gontscharowas Plakat für den Grand bal des artistes in der Pariser Salle Bullier 1923. Ihr farbensprühendes Plakat nutzt leuchtende Farben und kräftige, ganz im Sinne der russischen Avantgarde stilisierte Formen, um das für einen Ball charakteristische Gefühl von Bewegung und flirrender Lebendigkeit zu vermitteln. Zustand mit der Schrift. 1962 arbeitete Gerhard Matzat 7108
in Paris für Larionov und Gontscharowa, die ihm ihre Mansardenwohnung und Gontscharowas Atelier in der Rue Visconti zur Verfügung stellten. Gedruckt bei Joseph Charles, Paris, mit dessen Druckvermerk im Unterrand. Prachtvoller, farbintensiver Druck der großformatigen Komposition, mit Rand.
Provenienz: Sammlung Gerhard Matzat, Hattersheim Privatbesitz Süddeutschland
Literatur: Natalia Goncharova. A Woman of the Avantgarde with Gauguin, Matisse and Picasso, Ausst.Kat. Fondazione Palazzo Strozzi, Florenz und Tate Modern, London 2019, S. 6 (mit ganzs. Abb.)
leonid m. brailovsky und rimma n. brailovskaya (1867 Charkiw – 1937 Rom und 1877 Tartu – 1959 Rom)
7109 Die vier Jahreszeiten
4 Kompositionen. Aquarell, Gouache und Goldbronze über Bleistift auf Velin. Wohl späte 1920er Jahre. Je 30,4 x 20,8 cm.
Alle unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „L. R. Braïlowsky“.
10.000 €
Die ornamentalen, dekorativen Kompositionen im russischen Jugendstil zeigen Frühling, Sommer, Herbst und Winter und sind ein gemeinsames Werk des Künstlerpaares Rimma und Leonid Brailovsky, die ein gemeinschaftliches Studio betrieben. Sie heirateten 1898, emigrierten 1919 nach Lettland, lebten in Konstantinopel und Belgrad und übersiedelten 1925 nach Rom, wo sie auch für den Vatikan tätig waren. Leonid wirkte als Architekt, Bühnenbildner und Designer und lehrte in Moskau ab 1898 Architektur an der Lehranstalt für Malerei, Bildhauerei und Baukunst sowie an der Moskauer StroganovSchule. Ab 1909 war er überwiegend als Bühnenbildner tätig, bevor er nach der Oktoberrevolution mit seiner Frau das Land verließ. Rimma war Künstlerin, Textilgestalterin und Designerin und lehrte um 1900 ebenfalls an der StroganovSchule. Die vier kleinen Papierarbeiten können sicher als Entwürfe für Gemälde oder EmailArbeiten gewertet werden. Sie sind der Expertin für russische Graphik des 19. und 20. Jahrhundert, Olga Glebova, bekannt.
Provenienz:
Nikitsky Moskau, Auktion 28, 29.05.2014, Lot 29
Privatbesitz Berlin

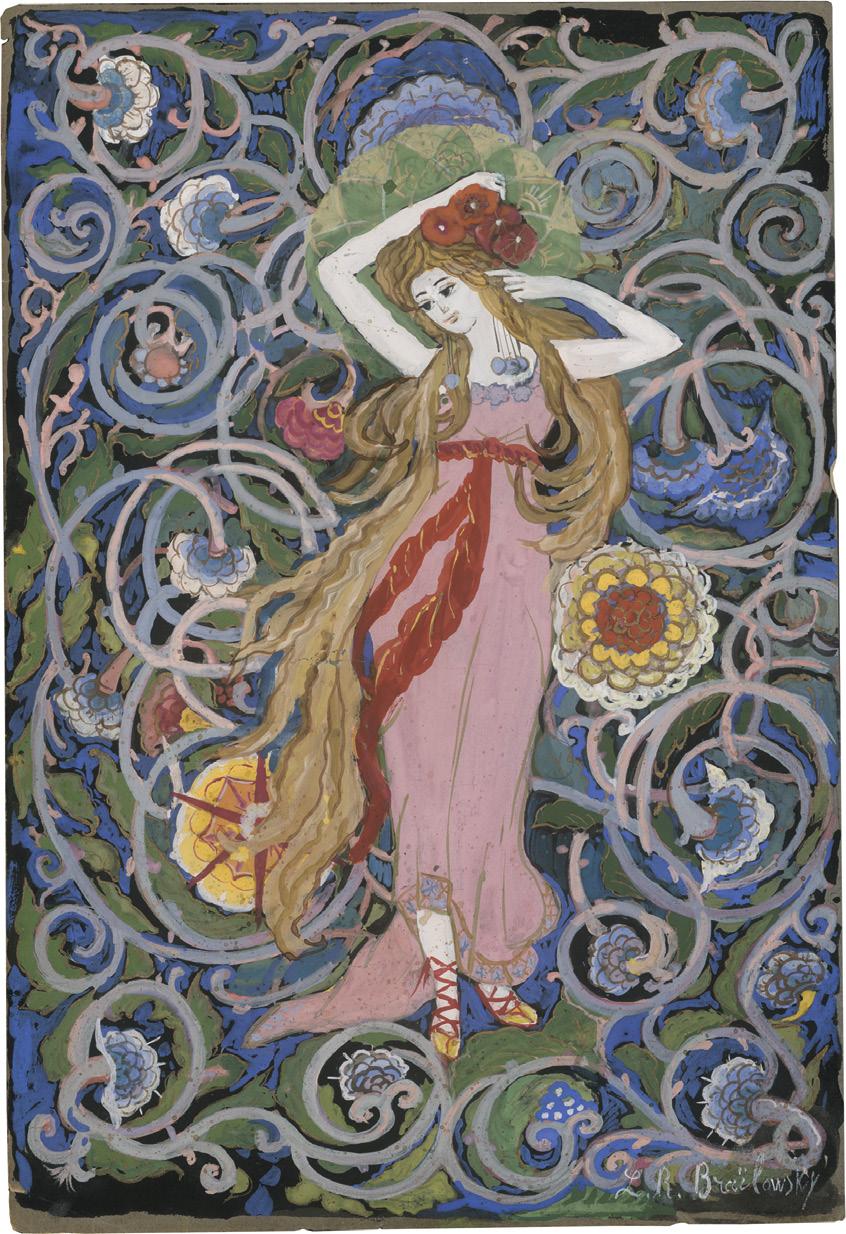
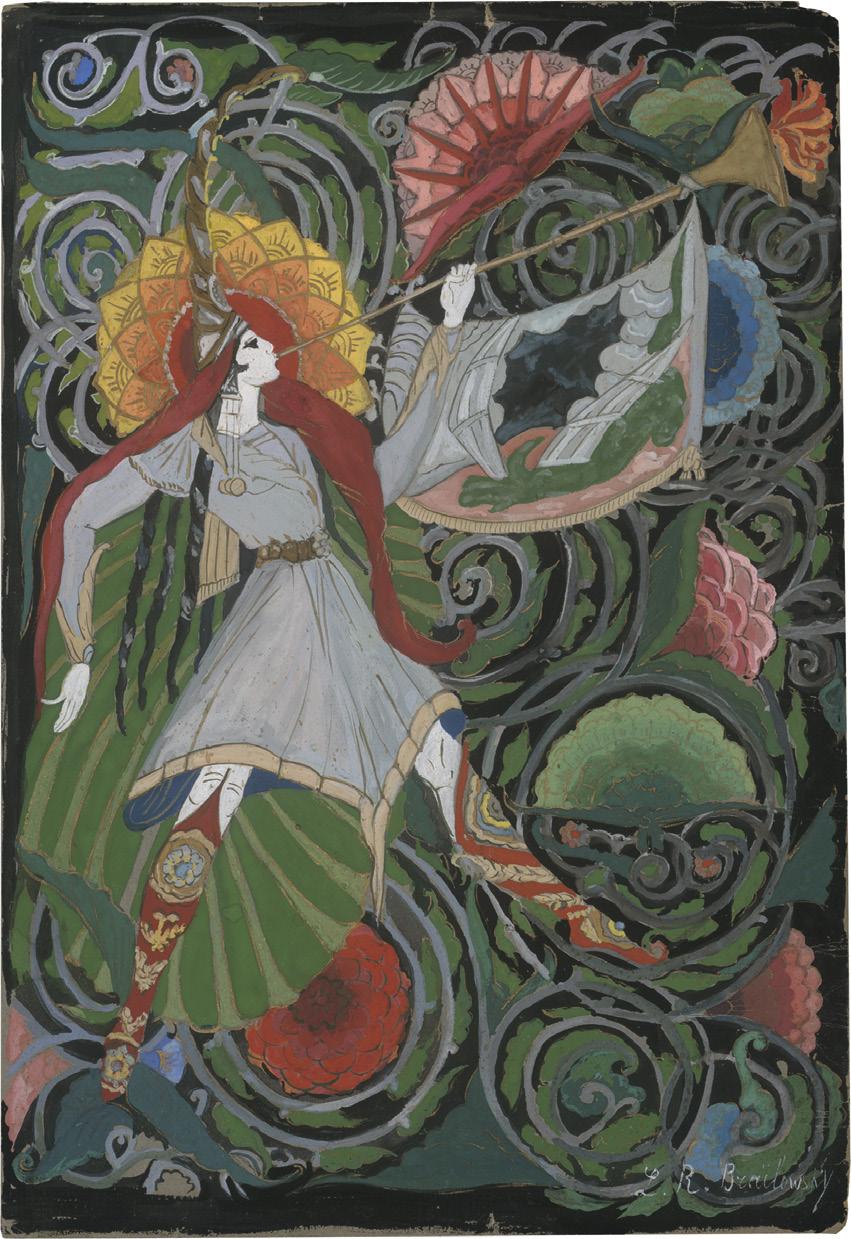
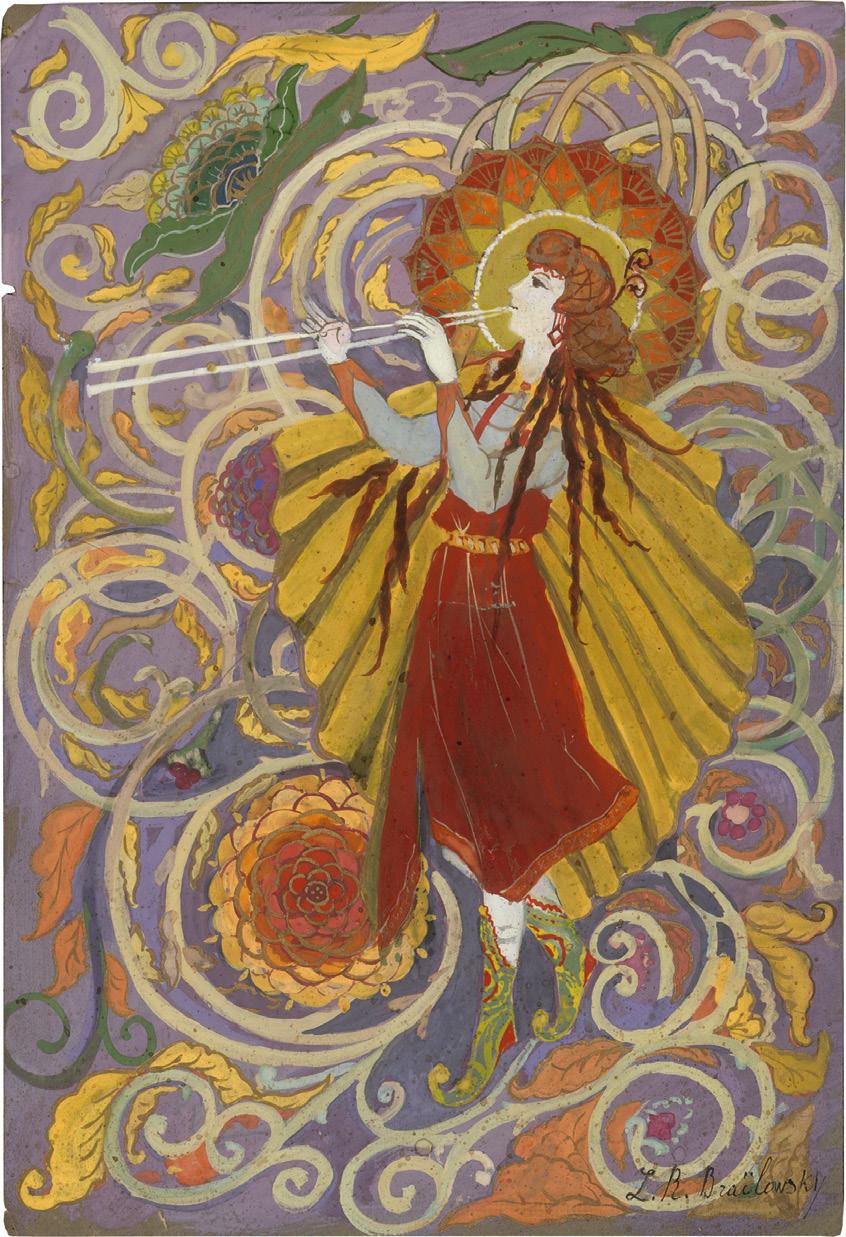
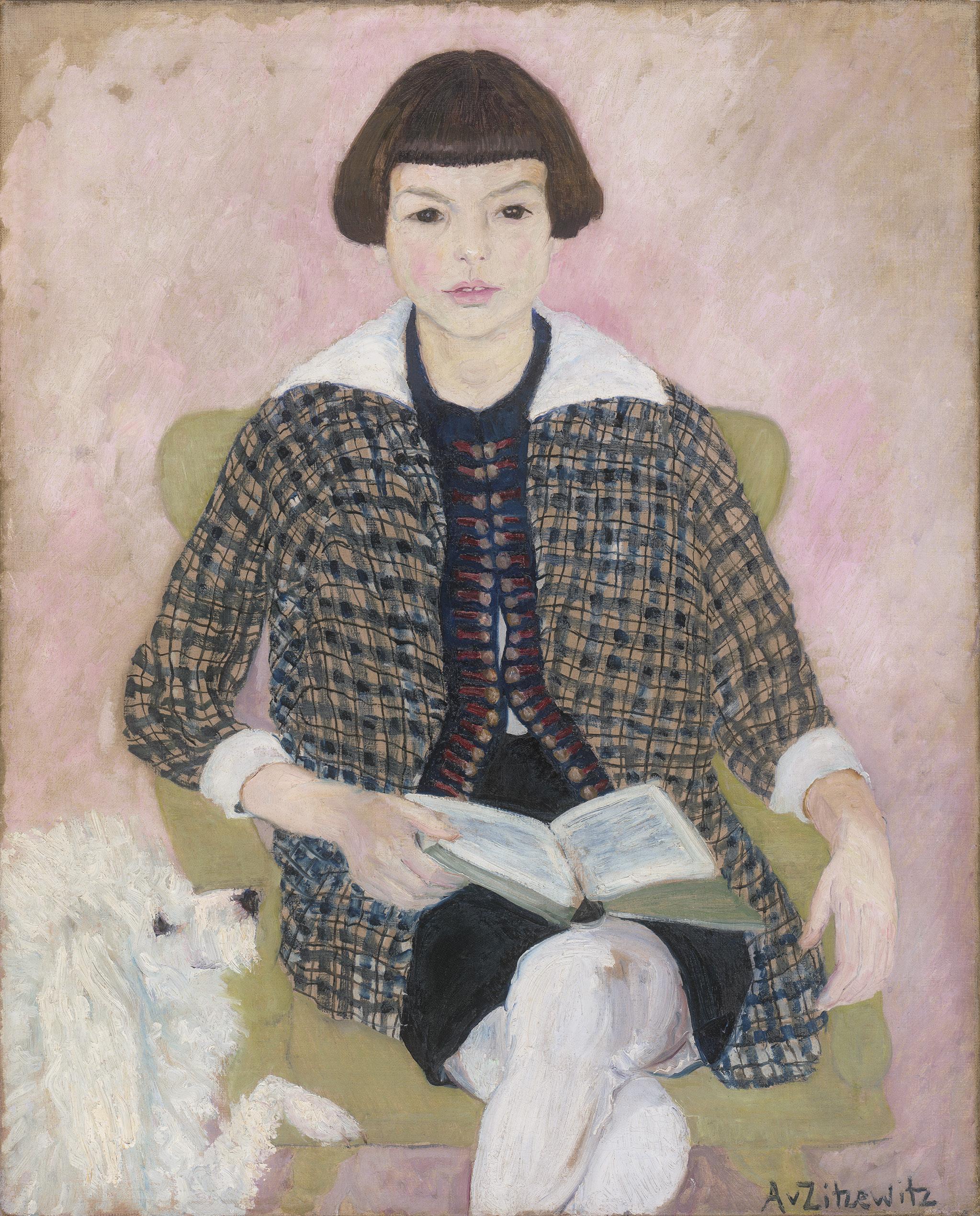
augusta von zitzewitz (1880–1960, Berlin)
7110 Mädchen mit Pudel Öl auf Leinwand, randdoubliert. Um 1925. 80 x 65,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „AvZitzewitz“.
1.500 €
Im Stil der Neuen Sachlichkeit malt die Künstlerin das junge Mädchen frontal zum Betrachter sitzend, unberührt von den Aufforderungen des Pudels zum Spielen. Möglicherweise handelt es sich um die von ihr vielfach portraitierte Tochter IlseMarie. 1907 begann
Augusta von Zitzewitz eine Ausbildung bei George Mosson im Verein Berliner Künstlerinnen, da Frauen zu dieser Zeit der Besuch von Kunstakademien noch verwehrt war. Nachdem sie auf Empfehlung von Käthe Kollwitz in Paris u.a. an der Académie Julian studierte und moderne Kunst und Künstler kennenlernte, wurde sie 1914 Mitglied der Berliner Freien Sezession, später auch im Hiddenseer Künstlerinnenbund. Im Berlin der 1920er Jahre galt sie als gefragte Portrait und Stillebenmalerin, ihr Atelier war Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden ihre Werke als „entartet“ verfemt.
Provenienz: Privatbesitz Rheinland

augusta von zitzewitz
7111 Portrait einer Dame
Öl auf Malpappe. 1946 (?). 78 x 54 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „vZitzewitz“ und (schwer lesbar) datiert.
1.500 €
Nachdem sie nach der Machtergreifung ins Visier der Nationalsozialisten geriet und schon bald Zitzewitz‘ Werke als „entartet“ bezeichnet wurden, sie zudem ein Mal und Ausstellungsverbot erhielt, konnte die Künstlerin erst nach Beendigung des Krieges
ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Portraitierte im aufwendigen Kleid, elegant frisiert, geschmückt und geschminkt, blickt doch, mit einer skeptisch hochgezogenen Braue, melancholisch vor sich hin. Der dunkelbraune Hintergrund bringt ihre helle, mit lebendigem Duktus ausgeführte Gestalt zum Leuchten. Hochgeschätzt als Portraitistin war Zitzewitz bereits im Berlin der Weimarer Republik.
Provenienz: Schlosser, Bamberg, Auktion 26.11.2016, Lot 559 Privatbesitz Brandenburg

philipp franck
(1860 Frankfurt a. M. – 1944 Berlin)
7113 Selbstbildnis
Aquarell über Kohle auf genarbtem Velin. 1927.
61,8 x 43,6 cm (Passepartoutausschnitt).
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „PHILIPP FRANCK“ und datiert.
Immenhausen/von Tresckow 67.
1.500 €
Großzügig, in hellen, transparenten Farben gearbeitetes Aquarell. Die lebendigen Strukturen im Hintergrund in klaren, differenzierten und kräftigeren Blau und Violetttönen bilden einen schönen Kontrast zum ernsthaften Ausdruck des Künstlers. Philipp Franck ließ sich an der Städelschule in Frankfurt, in der Malerkolonie Kronberg im Taunus und an der Düsseldorfer Kunstakademie ausbilden. Von 1892 bis zu seiner Pensionierung 1930 war er Pädagoge und zeitweise Direktor der Staatlichen Kunstschule Berlin. Er war der Berliner Kunstszene eng verbunden, gehörte zu den Mitbegründern der Berliner Sezession und war auf deren Ausstellungen regelmäßig vertreten.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
Ausstellung:
Philipp Franck, Museumsgesellschaft Kronberg 1981, Abb. S. 80
eduard bargheer (1901–1979, Hamburg)
7112 Winterlandschaft
Aquarell und Kreide in Schwarz auf genarbtem Velin. 1925.
50,8 x 35,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Bargheer“ und datiert.
1.800 €
1924 fasst Bargheer den Entschluss, freier Künstler zu werden, nachdem er eine Lehrerausbildung abgeschlossen hatte. In dieser schwungvollen frühen Komposition des Künstlers erfasst er die schneebedeckten Bäume mit lockerem Pinselstrich und ergänzt sie mit dynamischen Kreidestrichen.
Provenienz: Privatbesitz Brandenburg
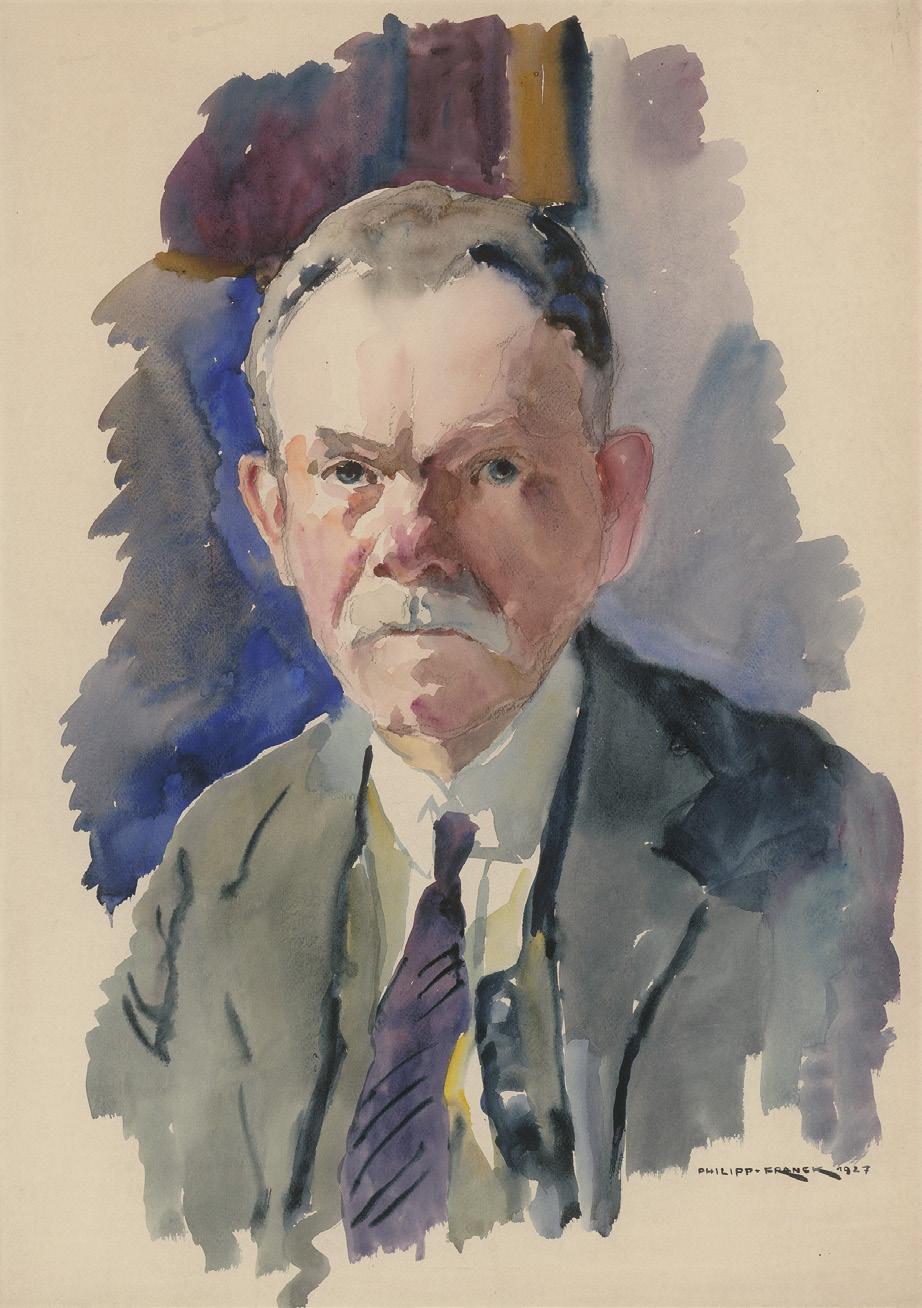

philipp franck
7114 Ohne Titel
Aquarell auf Velin. 1924.
48,5 x 61,2 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Blau signiert „PHILIPPFRANCK“ und datiert.
Nicht bei Immenhausen/von Tresckow.
3.000 €
Das in sommerlich warme Töne getauchte Aquarell entstand vermutlich auf einer Italienreise des Künstlers. „Seit den 1924 einsetzenden Italienreisen trat das Aquarell in seine Rechte. Von Lugano, wo ich Morcote malte, zog der Wille meiner Frau mich nach Bellagio und im nächsten Jahre nach Cadenabbia an den Comersee. Und dieselben Berge, die in Lugano hart und langweilig in den Schweizer See fielen, hatten auf der italienischen Seite ein malerisches Gepräge.“ (Philipp Franck: Ein Leben für die Kunst. Nachwort von Bruno Kroll, Berlin 1944, S.62.).
Provenienz:
Grisebach, Berlin, Auktion 277, 03.06.2017, Lot 1079
Privatbesitz Berlin

willi geiger (1878 Schönbrunn – 1971 München)
7115 Cádiz, Plaza de Isabel Öl auf Leinwand. 1927.
73,5 x 110,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Geiger“ und datiert.
5.000 €
Über die Plaza de Isabel in Cádiz fällt der Blick hinaus aufs offene Meer. Der sichere Duktus, die spitzwinklige Formensprache, charakteristisch für die Zwanziger Jahre, und die heiter leuchtende, helle Palette entsprechen dem Sujet vortrefflich. Seine große Begeisterung für Spanien, dessen Kultur und Naturschönheit hielt Geiger in zahlreichen Gemälden und Graphiken fest, auch noch nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1925. 1928 wurde er an die
Staatliche Akademie nach Leipzig berufen, jedoch 1933 aufgrund seiner Opposition zum Nationalsozialismus gekündigt und seine Arbeiten als „entartet“ diffamiert. Willi Geiger hatte bereits nach seinen Studien in München, unter anderem bei Franz von Stuck und Peter Halm, schon früh erste Erfolge als Künstler erzielen können. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs lebte er in Berlin, zog euphorisch wie viele in den Krieg, wurde aber von der grausamen Realität schnell eingeholt und psychisch schwer belastet. Nach Kriegsende nahm er ab 1920 eine Professur an der Münchner Kunstgewerbeschule an. Die Malerei brachte ihm allmählich wieder Ruhe, und sein Stil wandelte sich verstärkt hin zum Expressionismus. Preise und Stipendien ermöglichten ihm längere Aufenthalte in Italien und Spanien, wohin er immer wieder zurückkehren sollte.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
eugen spiro

(1874 Breslau – 1972 New York) 7116 Landschaft Öl auf Hartfaser. 1925. 31,5 x 23,3 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Eugen Spiro“ und datiert.
Nicht bei von Abercron.
1.500 €
Mit flockigem, impressionistisch gelöstem Pinselduktus erfasst Spiro die pittoreske Szenerie. In den Jahren 1918 bis 1935 unternahm der Künstler zahlreiche Reisen in den Süden Europas, so hielt er sich 1925 unter anderem am Lago Maggiore, an der Atlantikküste und in Südfrankreich auf, wo wahrscheinlich die sommerliche Landschaftsdarstellung entstand.
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

eugen spiro
7117 Die Altstadt Tossa Öl auf Leinwand, doubliert. 1934. 84,3 x 102 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Eugen Spiro“ und datiert.
Von Abercron A-34-6.
8.000 €
Eugen Spiro entstammte einer jüdischen, deutschsprachigen Familie in Breslau. Sein künstlerischer Werdegang war beeindrukkend: Nach einem Studium an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau ging Spiro 1894 an die Akademie der Bildenden Künste in München. Er wurde Meisterschüler von Franz von Stuck und verfügte über ein eigenes Atelier in der Villa Stuck. 1904 zog es ihn nach Berlin, und er wurde zwei Jahre später Mitglied der Berliner Sezession. Kurz danach siedelte er nach Paris über, wo
er im Malerkreis des „Café du Dôme“ verkehrte und mit Hans Purrmann eine jahrelang andauernde Freundschaft schloss. Die Deutschenfeindlichkeit bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges zwang Spiro, nach Berlin zurückzukehren. Hier erfuhr er bis zu dem Aufstieg der Nationalsozialisten im Beruflichen wie Privaten eine Blütezeit. Er wurde in den Vorstand der Berliner Sezession gewählt und zum Professor an der Staatlichen Kunstschule ernannt. Mit seiner zweiten Ehefrau Elisabeth SaengerSethe unternahm er in den Jahren 1918 bis 1935 viele Reisen in den Süden Europas, u.a. auch nach Tossa del Mar in Spanien. Unser Gemälde ist auf ihrer Reise 1934 dorthin entstanden und zeigt die pittoreske Ansicht der alten Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert mit den Wehrtürmen. Das klare, leuchtende Blau und die sommerliche Frische der malerischen Bucht hält Spiro mit herrlich flockigem Pinselduktus fest.
Provenienz: Privatbesitz Rheinland
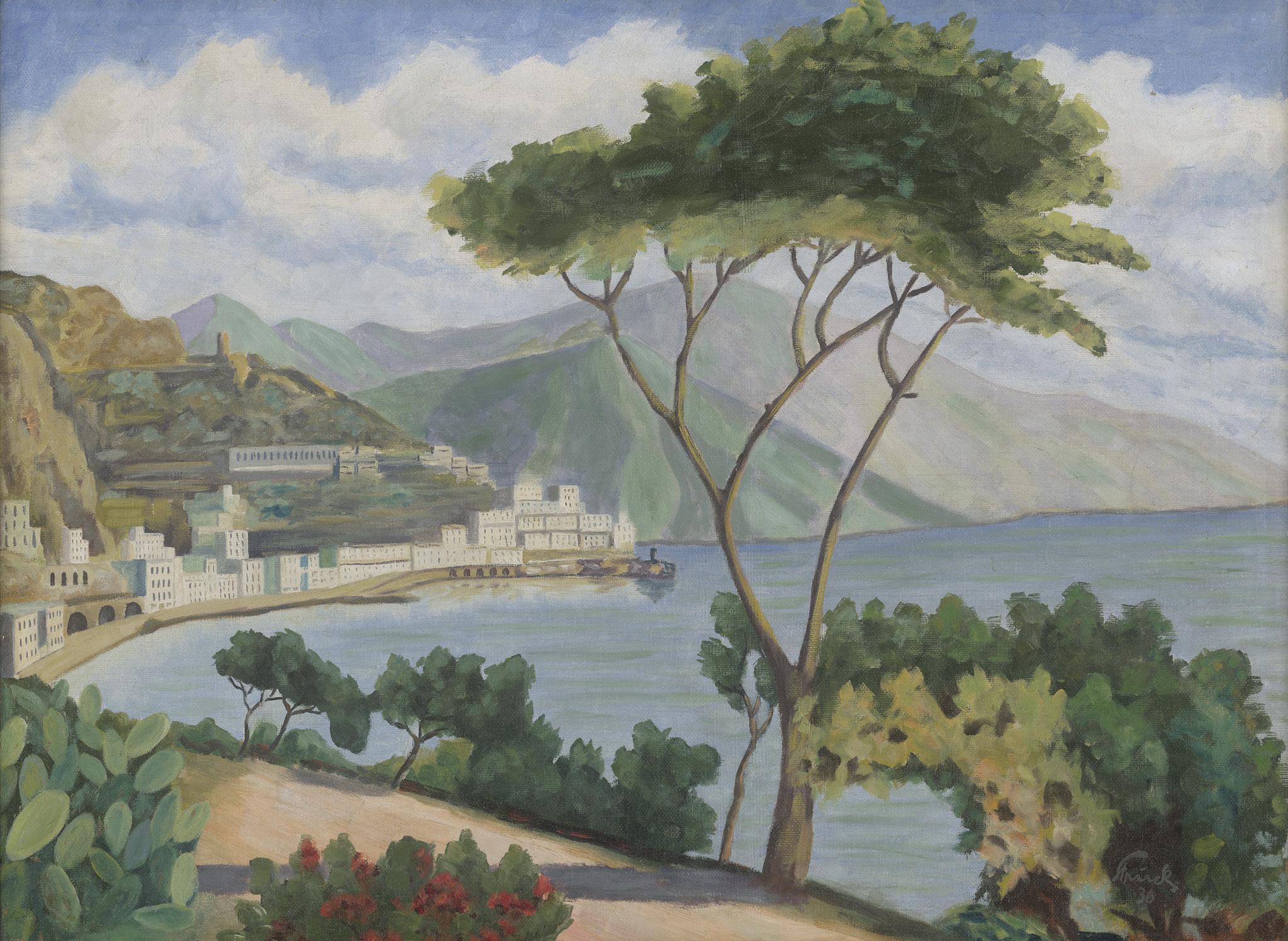
hermann struck (1876 Berlin – 1944 Haifa)
7118 Landschaft in Palästina Öl auf Leinwand. 1936. 60 x 80 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Grau signiert „Struck“ und datiert.
1.800 €
Nicht Kargheit, sondern üppiges Grün beherrscht die frühlingshafte, duftig gemalte Küstenszenerie, die Struck wohl in Palästina festhielt. Am Toten Meer und in der Umgebung von Haifa entstanden einige Landschaftsdarstellungen des Künstlers. Auch wenn er
sich selber stets als Maler begriff, blieb dennoch die Werkgruppe der Gemälde vergleichsweise klein. Der Antisemitismus in der Weimarer Republik brachte ihn 1923 zur Emigration nach Palästina. Dort errichtete er bald ein Haus in Haifa, in dem heute das HermannStruckMuseum zu finden ist. Sein großer Einsatz für das kulturelle Leben und die Kunst in Israel, die neben der Gründung des Museums in Tel Aviv und einer Kunstschule in Jerusalem auch den Aufbau einer Künstlerkolonie in Haifa umfasste, brachte dem orthodoxen Juden Struck eine breite Verehrung ein.
Provenienz: Neumeister, München, Auktion 24.05.2007, Lot 845
Privatbesitz SachsenAnhalt
ernst barlach

(1870 Wedel – 1938 Rostock)
7119 Christusmaske I
Bronze mit dunkelbrauner Patina, lose in Holzrahmen montiert. 1931/nach 1938.
15,3 x 9,6 x 6,3 cm.
Unter dem Kinn signiert „E Barlach“, darüber mit dem Gießerstempel „H Noack Berlin“. Laur 476, Schult 375.
3.500 €
Portraithafte Züge des Künstlers selbst kennzeichnen diese erste von sechs Varianten der Christusmaske. Alle diese Arbeiten ähneln sich in der klaren Reduktion und Stilisierung des Antlitzes, die den
Zügen des älteren Mannes eine archaische, prophetisch erscheinende Ausstrahlung verleiht. Barlach schuf das Tonmodell für diese erste Fassung der Christusmaske im Jahr 1931. Zu Lebzeiten des Künstlers entstanden keine Güsse; nach 1938 wurden die ersten drei Güsse und etwas später weitere zwölf Exemplare von Barlachs Nachlaßverwalter Friedrich Schult in Auftrag gegeben. Laur sind davon fünf Exemplare in öffentlichem Besitz bekannt, Schult nennt wiederum lediglich drei Stück in privater Hand. Das Ernst Barlach Haus, Hamburg, datiert die späteren Güsse inzwischen um 1950 bzw. nach 1960. Prachtvoller Guss mit homogener, partiell golden schimmernder Patina und Holzrahmen für die Aufhängung.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
renée sintenis
(1888 Glatz – 1965 Berlin)
7120 Selbstbildnis
Bronze mit dunkelbrauner Patina auf grauem Marmorsockel. 1933.
27 x 14 x 13 cm.
Am Hals unten links seitlich monogrammiert „RS“, rückseitig unten über dem Stand mit dem Gießerstempel „H. NOACK BERLIN“.
Berger/Ladwig/Wenzel-Lent 137, Buhlmann 7.
7.500 €

Schönheit und Ernsthaftigkeit strahlt die Bildnismaske von Sintenis‘ schlankem feingezeichneten Gesicht von 1933 aus. „Im Selbstbildnis von 1933 fließen Wunsch und Wirklichkeit zusammen. Die klassische Prägung der Physiognomie wird durch die Aussparung der Haarpartie akzentuiert und zum eigentlichen Bildinhalt aufgewertet.“ (Britta E. Buhlmann, Renée Sintenis. Werkmonographie der Skulpturen, S. 24). Schöner, präziser Guss mit dunkler, nuanciert schimmernder Patina. Gesamthöhe mit Sockel: 29,4 cm.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

bruno voigt
(1912 Gotha – 1988 Berlin)
7121 „Herr, bleibe bei uns“ Aquarell und Feder in Schwarz auf Velin. 1931.
51 x 36 cm.
Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „-V-“ und datiert.
1.500 €
Mit leerem Blick empfängt ihn seine Braut. Im Frack, vollbekleidet, nähert sich der kahlköpfige alte Bräutigam der nackten, lediglich mit Kranz und Schleier angetanen jungen Frau auf dem Bett in enger Stube, rechts an der Wand die berühmte Zeile der Bachkantate. Der junge Künstler, ausgebildet ab 1929 bei Walther Klemm an der Akademie der Bildenden Künste in Weimar, wurde bereits 1931 Mitglied beim Kampfbund „Rote Einheit“ und arbeitete für die kommunistische Agitprop Truppe „Rote Raketen“. In demselben Jahr entstand die vorliegende satirische, pointierte Zeichnung, in der Voigt in Grosz‘scher und Dix‘scher Manier das Aufeinandertreffen der Gegensätze schildert.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
bruno voigt
7122 Mann und Frau
Feder und Kreide in Schwarz auf Skizzenblockpapier. 1931.
30 x 24,3 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „-V-“ und datiert.
1.500 €
Ein nächtliches Ringen. Ob aber Liebe oder Drama, das bleibt offen. Die Frau ist bis auf die Unterwäsche entkleidet, der bullige Mann hält sie in enger Umarmung und drängt sie zum Bett, das ein Paravent vom Rest der Stube abtrennt. Bereits während seiner Akademiezeit in Weimar entdeckte Bruno Voigt seine Liebe zur Milieuzeichnung. Die Enge und Einrichtung des Raumes verdeutlicht, dass es sich bei der frühen Zeichnung wohl um eine Szene im Arbeiter oder Kleinbürgermilieu handelt, die der Künstler mit lebendigen Federstrichen und sparsamen Schraffierungen der schwarzen Kreide erfasst.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
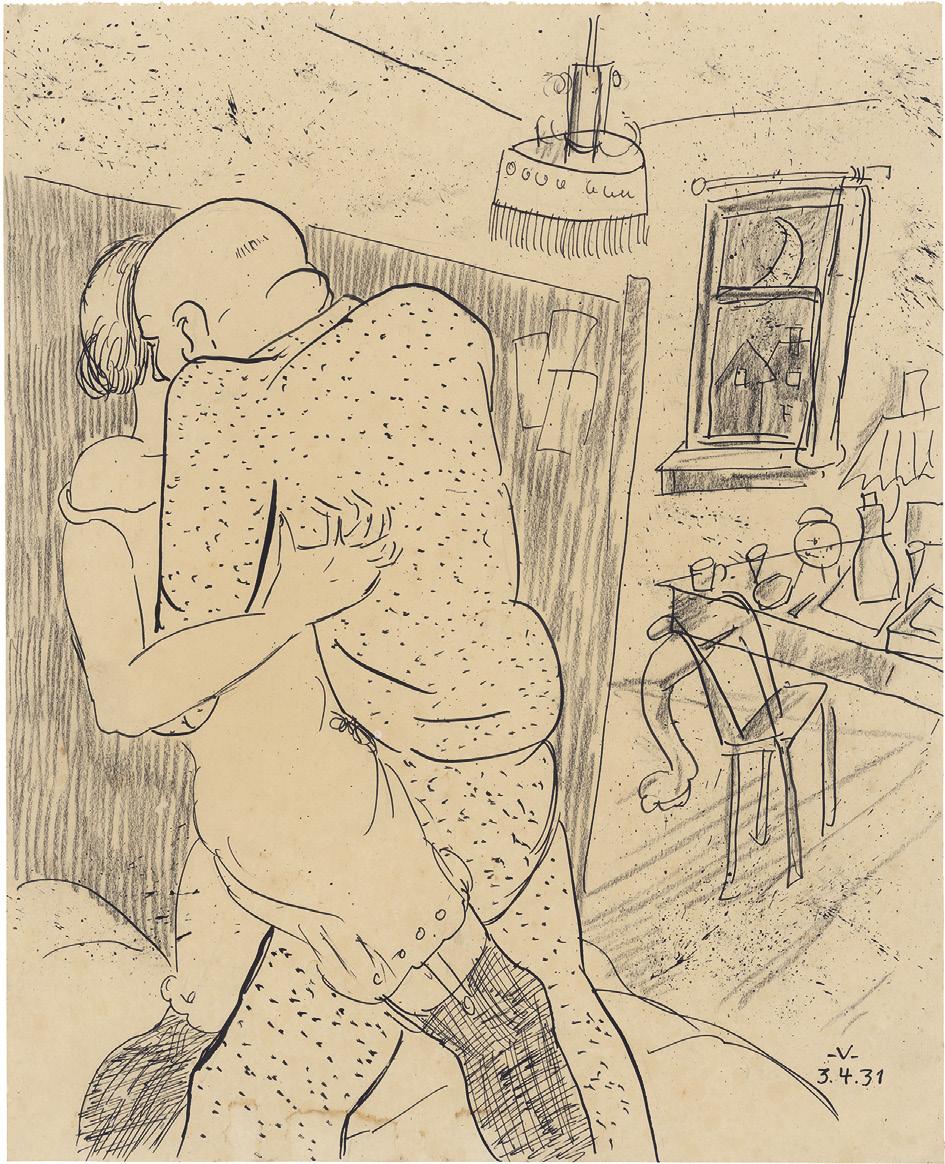

bruno voigt
7123 „Fasching“
Aquarell und Feder in Schwarz und Pink auf festem genarbten Velin. 1934.
47,8 x 36 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „-V-“ und datiert, verso (wohl von fremder Hand) mit Bleistift nochmals datiert und betitelt sowie bezeichnet.
1.200 €
Pinkviolette unruhige Konturen und Details verleihen der dicht gedrängten Komposition einen irritierenden, fast flirrenden Charakter. Phantasievolle, bunte Kopfbedeckungen aus Orient und Okzident schmücken die Feiernden, die wie für ein Gruppenbild zusammengerückt erscheinen. Der stilistische Einfluss von Dix, Grosz und Schlichter ist deutlich erkennbar in Voigts frühen Arbeiten. Auch die vorliegende Zeichnung, exemplarisch für seinen scharfen Blick auf die Gesellschaft, entstand während seiner frühen Weimarer oder Gothaer Zeit. Auf die Machtergreifung im Jahr zuvor reagierte Voigt umgehend und alarmiert, indem er bereits im Januar 1933 in seinem Atelier das sozialdemokratisch ausgerichtete „Linkskartell der Geistesschaffenden“ zur Verhinderung des „Dritten Reiches“ gründete.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
bruno voigt
7124 Ekstase
Aquarell, Deckweiß und Feder in Schwarz und Rot auf Velin. 1936.
38 x 51 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „-V-“ und datiert.
900 €
Die immense gesellschaftliche Freizügigkeit der Weimarer Republik findet einen Nachklang in Voigts erotischer Zeichnung einer jungen Frau in schwarzen Dessous. Mit geschlossenen Augen, ganz in ihrer Körperlichkeit versunken, zeichnet der Künstler sie inmitten einer phantastischen Masse kleinteiliger floraler Strukturen und Federkringel.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
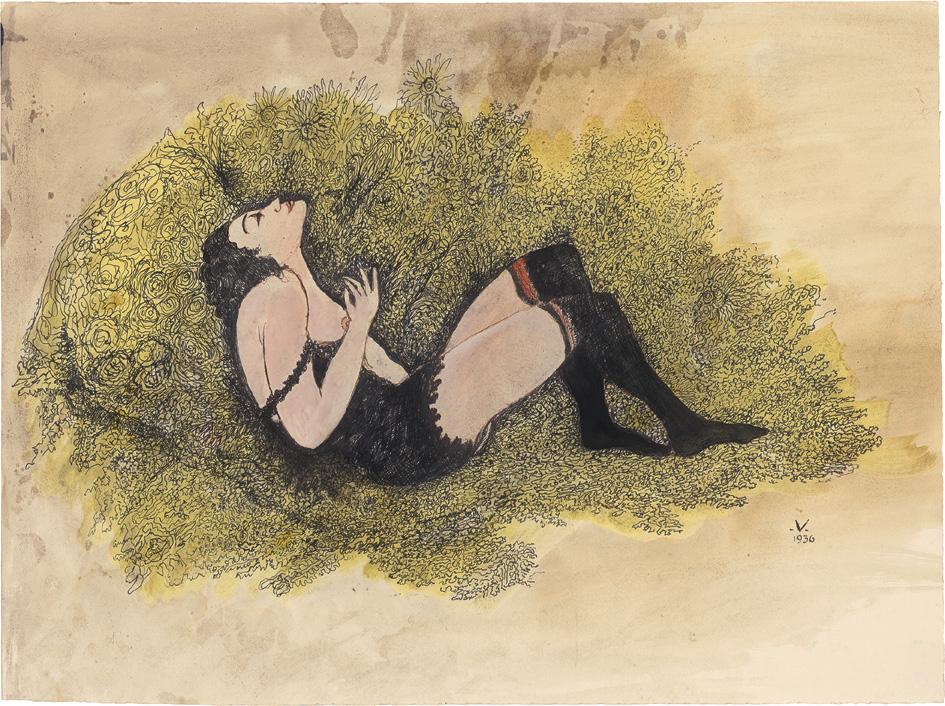
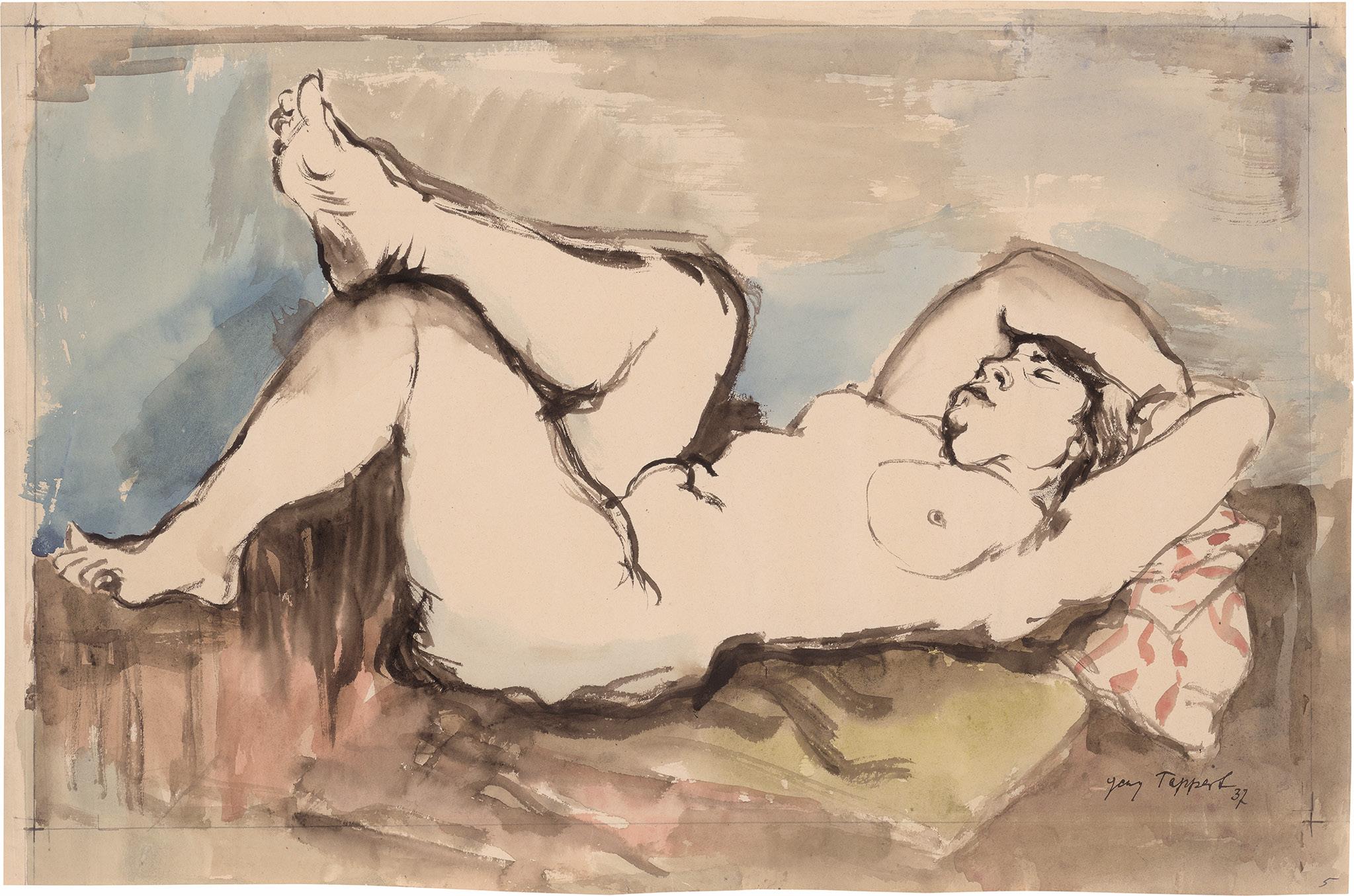
georg tappert (1880–1957, Berlin)
7125 Liegender weiblicher Akt Aquarell und Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1937. 31,7 x 47,8 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Georg Tappert“ und datiert.
2.800 €
Mit breitem Pinselstrich konturiert Tappert den liegenden Frauenkörper treffsicher, ungeschönt und unmittelbar. Sein lebendiger, spontaner Duktus spiegelt die Impulsivität, mit der sich der Künstler seinem Motiv nähert und mit der er schonungslos auch die in der Verkürzung unförmig erscheinenden Partien schildert. Zugleich verleiht die Zartheit und Sensibilität der Aquarellierung im Umraum mit seinen differenzierten, nuancenreichen Zwischentönen der hellen Frauenfigur trotz ihrer üppigen Körperlich
keit etwas Durchscheinendes, Verletzliches. Nach der Gründung der „Novembergruppe“ 1918 unterrichtete Tappert seit 1919 an der Schöneberger Kunstschule und der ReimannSchule. In den 1920er/30er Jahren malte er oft Frauen aus den Berliner Nachtbars, Varietés, Cafés und der Zirkus sowie Theaterwelt. Tapperts große Leidenschaft für die Zeichnung als künstlerisches Ausdrucksmittel zeigt sich auch darin, dass er insgesamt 4500 Blätter in zahlreichen Techniken, von Bleistift bis hin zum Aquarell, hinterließ.
Provenienz: Geschenk des Künstlers an Karl Hofer zu dessen 70. Geburtstag Nachlass Karl Hofer Lempertz, Köln, Auktion 30.11.2012, Lot 403 Privatsammlung Berlin

georg netzband
(1900 Berlin – 1984 Lindenberg)
7126 Fleischabteilung im KaDeWe Öl auf Leinwand. 1926.
50 x 58 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun monogrammiert „n“ und datiert, verso mit Pinsel in Schwarz signiert „GEORG NETZBAND“ und bezeichnet „BERLIN“ sowie „3“.
1.800 €
Propere, adrette Verkäuferinnen mit blitzweißen Schürzen und Hauben schneiden und wiegen Wurst und Schinken in Berlins renommiertestem Kaufhaus der Zeit, während die Kundinnen sich an der Theke drängen. Mit lockeren Pinselschwüngen und in einer hellen, von rosarot dominierten Tonalität unterstreicht
Netzband die Üppigkeit der Szenerie. Netzband, ausgebildet bei Bernhard Hasler, Georg Walter Rösner und Georg Tappert, nahm 1919 als Mitglied der Novembergruppe an der Großen Berliner Kunstausstellung teil. Bis zu dem 1936 verhängten Malverbot stellte er regelmäßig in Berlin bei Gurlitt, in der Akademie der Künste und in der Juryfreien Kunstschau aus, 1937 fand die letzte Einzelausstellung zur NSZeit bei Gurlitt statt, danach vergrub Netzband eine Reihe seiner Arbeiten in Blechbehältern, insbesondere jene, die sich kritisch mit dem NSStaat auseinandersetzten. Diese Arbeiten überstanden den Krieg, der größte Schaffensteil der Vorkriegsjahre ging jedoch verloren, so dass Werke aus dieser Zeit selten sind.
Provenienz: Privatbesitz Brandenburg
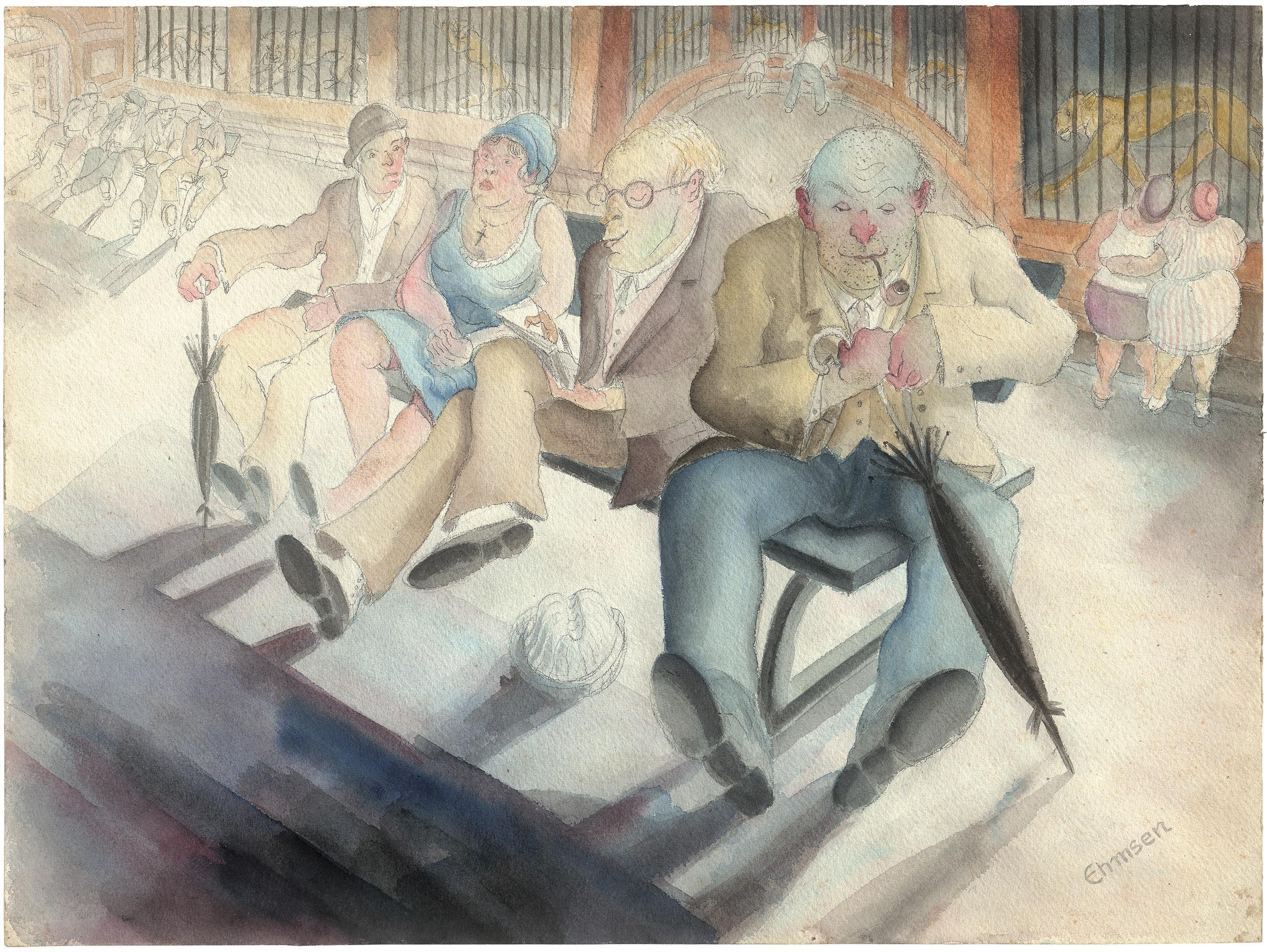
heinrich ehmsen (1886 Kiel – 1964 Berlin)
7127 „Zoobesucher im Löwenhaus“ Aquarell und Bleistift auf genarbtem Velin. 1930. 45,7 x 60,8 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Ehmsen“, verso mit Bleistift datiert, betitelt und mit der Werknummer „43“. 5.000 €
Schattenhaft drehen Raubkatzen ihre unendlichen Runden hinter den Gittern des Berliner Zoos, nur wenige Besucher stehen davor. All das bleibt aber im Hintergrund: Im Fokus stehen die vier Gestalten vorne, die Plätze auf einer Bank ergattert haben und eine Pause in der raubtiergeschwängerten Luft des Löwenhauses genießen. Sie entsprechen ganz Ehmsens charakteristischem Repertoire skurriler, prägnant und doch mit liebevollem Blick gezeichneter Figuren. Nach seinen Studien 1906 09 an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf, u.a. bei Peter Behrens, studierte er an der Académie Colarossi, Paris, und siedelte 1911 nach München, wo er Einflüsse durch den Blauen Reiter erhielt. Im Jahr 1929 ließ er sich in Berlin nieder, wo er bald die Kommunistische Partei bei den Reichstags
wahlen unterstützte. Seine prägenden Erfahrungen in und nach dem Ersten Weltkrieg sowie Studien aus der Nervenheilanstalt dominierten sein Physiognomie und Figurenrepertoire. Ehmsens aufrechte Haltung spiegelt sich auch in dem aufmerksamen Blick für die einfachen Menschen, der seinen Ausdruck in der vorliegenden Zeichnung findet.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 307, 31.05.2019, Lot 562 Privatbesitz Rheinland
Ausstellung: Heinrich Ehmsen, Kunstkammer Martin Wasservogel, Berlin 1930, Kat.Nr. 21
Literatur:
Adolf Behne, Heinrich Ehmsen, Potsdam 1946, Abb. 41 Lothar Lang, Heinrich Ehmsen, Dresden 1962, Tafel 49 Lothar Lang, Heinrich Ehmsen, in: Wegbereiter. 25 Künstler der DDR, Dresden 1976, Abb. S. 34

renée sintenis (1888 Glatz – 1965 Berlin)
7128 Sich kratzender Hund Bronze mit goldbrauner Patina. Vor 1935. 7,5 x 8,5 x 4 cm.
Hinten über dem Stand monogrammiert „RS“, unter dem Stand mit dem Gießerstempel „H.NOACK BERLIN“. Berger/Ladwig/Wenzel-Lent 150, Buhlmann 107. 6.000 €
Zu Sintenis‘ bevorzugten Tiermotiven gehört der Terrier, den sie in zahlreichen Plastiken in den unterschiedlichsten Positionen festhält. In unserer hübschen Kleinbronze zeigt sie den sitzenden, sich kratzenden Airedaleterrier. Die Kopfpartie und das zottelige Fell sind schön detailliert herausgearbeitet. „Ein ebenso inniges Verhältnis wie zu Pferden entwickelte Renée Sintenis zu Hunden. Zahlreiche Graphiken und Plastiken, die besondere Situationen oder typische Bewegungen der Tiere festhalten, sind Zeugnis ihrer intensiven Beobachtungen (...). Die munteren Terrier stehen der Künstlerin besonders nahe; ihre Darstellung bildet einen Schwerpunkt im Rahmen der Hundeplastiken.“ (Britta E. Buhlmann, Renée Sintenis. Werkmonographie der Skulpturen, S. 73). Prachtvoller, differenzierter Guss mit lebendiger Oberfläche und warmer, goldbraun changierender Patina.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
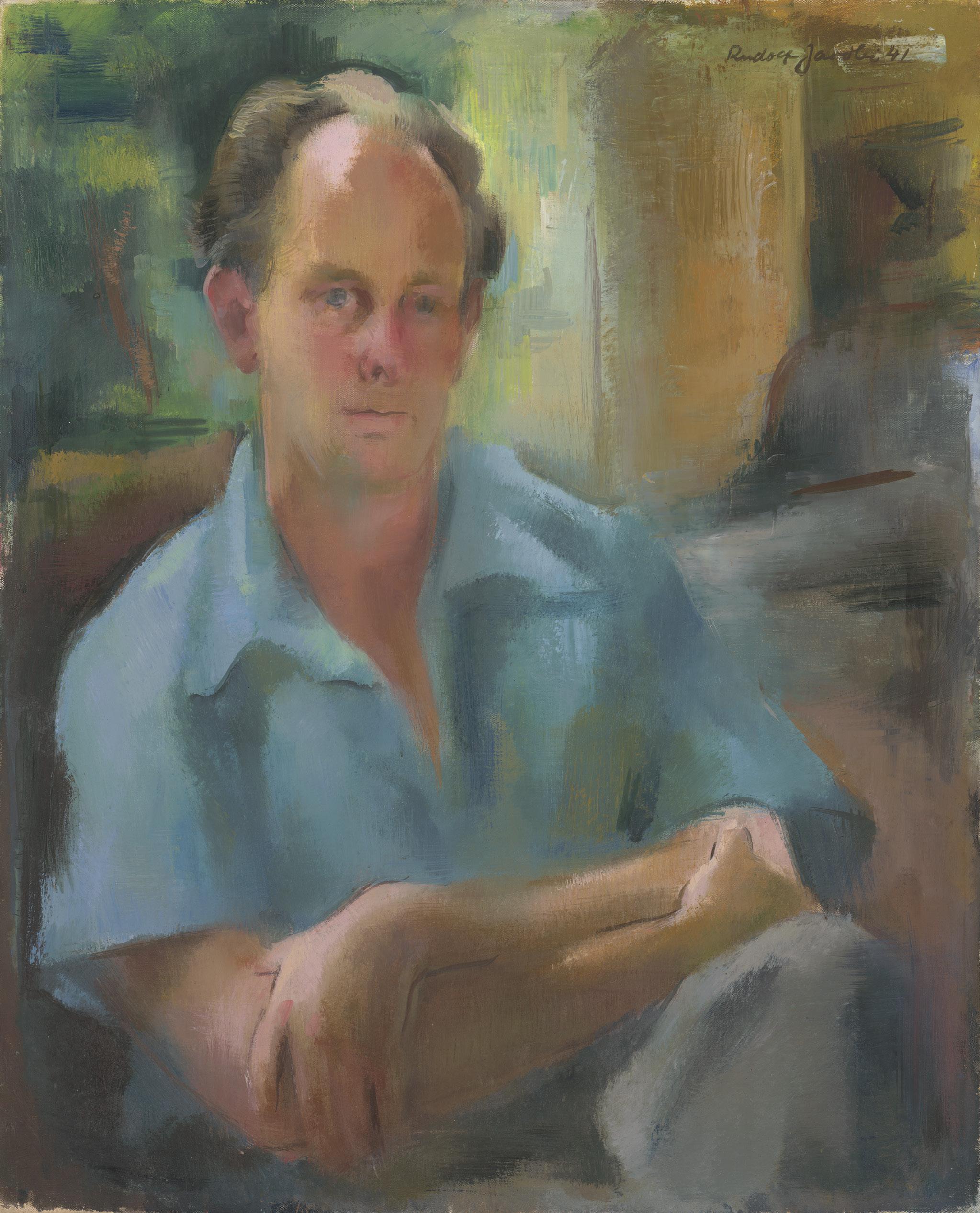
rudolf jacobi (1889 Mühlhausen – 1972 München)
7129 Selbstportrait im Exil Öl auf Leinwand. 1941.
81 x 65 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Braun signiert „Rudolf Jacobi“ und datiert, verso auf dem Spannrahmen mit Farbstift in Blau bezeichnet „18“ und mit den Maßangaben sowie mit Transportaufklebern.
1.200 €
In gelassener, selbstbewusster Haltung, ernsthaft und ruhig blickt der Künstler uns entgegen, die Gesichtsfarbe frisch, die
Kleidung ebenso sommerlich wie das Kolorit. Zugleich erscheinen die Konturen weich, ein wenig unbestimmt und von einer fast irritierenden Unschärfe. 1928 hatten Rudolf und Annot Jacobi am Lützowplatz die „Malschule Annot“ eröffnet, die jedoch 1933 geschlossen wurde, da sie sich weigerten, jüdische Schülerinnen zu entlassen. Nach ihrer Emigration in die USA gründeten sie die „Annot Art School“ neu im New Yorker Rockefeller Center. Rudolf Jacobi war einer der wenigen Künstler, die auch in der Emigration berufliche Erfolge feiern konnten: Zwischen 1942 und 1944 fanden mehrere Einzelausstellungen seiner Arbeiten statt. Selbstportraits des Künstlers sind selten
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

marc eemans
(1907 Termonde – 1998 Brüssel)
7130 „De goede herder / Le bon Berger“ Öl auf Leinwand. 1936.
100 x 81 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Marc“, verso mit Faserstift in Braun (von fremder Hand?) datiert, betitelt und bezeichnet.
3.000 €
Der Gute Hirte in Begleitung eines skurrilen Mischwesens, ähnlich einem Greif, das Fell durchsetzt mit menschlichen Augen einem zentralen Motiv des Surrealismus. Am tiefblauen Himmel kreist
darüber ein Vogel. Marc Eemans, einer der bedeutendsten Vertreter des belgischen Surrealismus, war auch Dichter und Kunstkritiker. Er galt anfangs noch als Pionier des abstrakten Konstruktivismus, bevor er sich um 1925 dem Surrealismus zuwandte. Bereits damals stellte er zusammen mit René Magritte und Salvador Dalí in der Pariser Galerie von Camille Goemans aus, wandte sich jedoch bald dem Magischen Realismus zu.
Provenienz: Privatsammlung Brüssel Bassenge, Berlin, Auktion 108, 28.05.2016, Lot 8048 Privatbesitz Süddeutschland
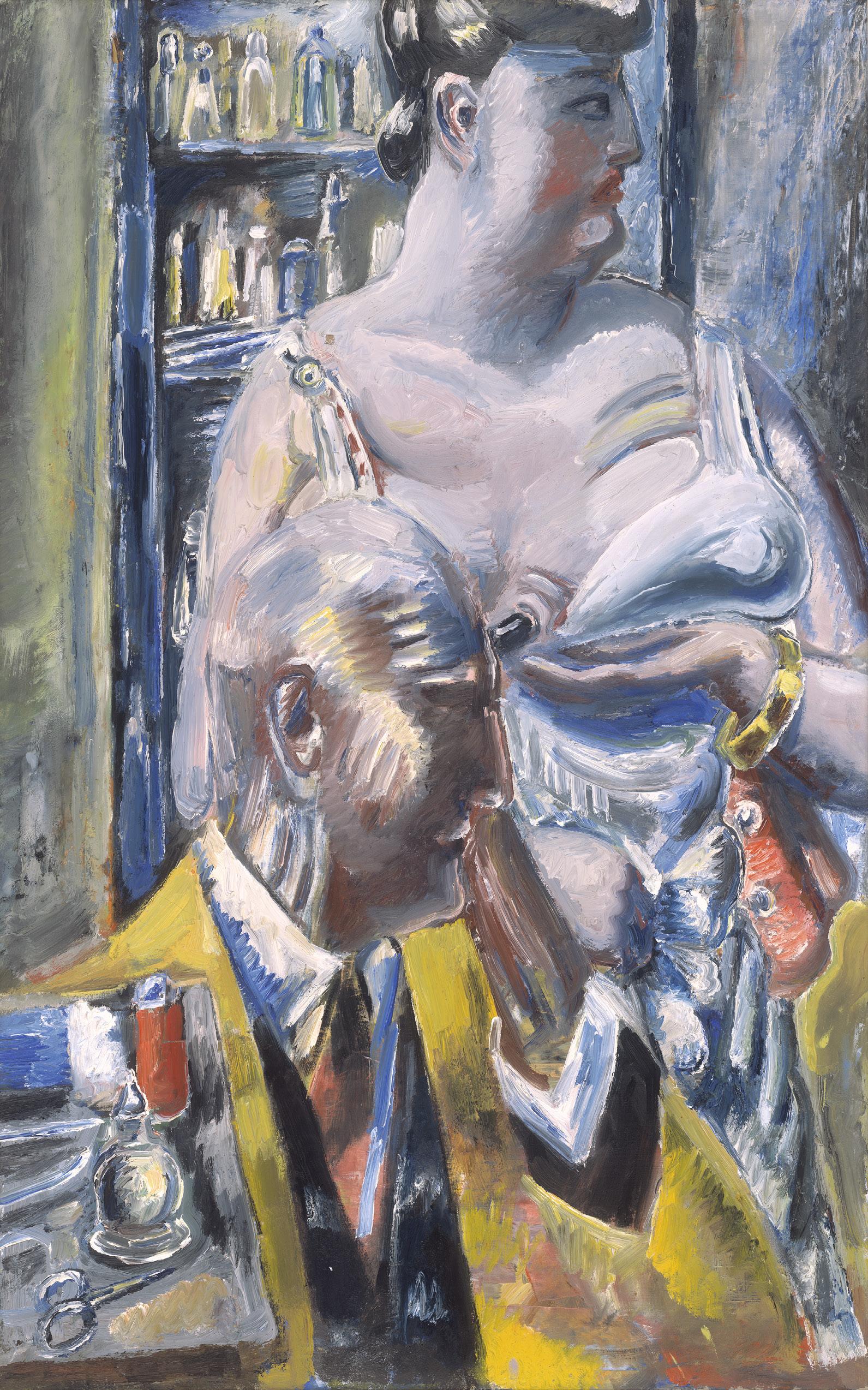
paul kleinschmidt
(1883 Bublitz – 1949 Bensheim)
7131 „Dame beim Arzt I“ Öl auf Leinwand. 1948.
116 x 73 cm.
Verso auf dem Keilrahmen mit Kreide in Schwarz datiert, betitelt und bezeichnet „No. 28“.
30.000 €
Üppige, vitale Frauenkörper faszinierten den Künstler, den Julius Meier Graefe, sein Entdecker und Förderer, 1932 einen „proletarischen Rubens“ nannte (J. Meier Graefe in: Frankfurter Zeitung, 06.11.1932, Nr. 83133, S. 14). Die Sinnlichkeit der Patientin in ihrer opulenten Erscheinung dominiert gegenüber dem dünnen, nach unten abgedrängten Arzt in der beinahe überlebensgroß gemalten Darstellung. Der hier festgehaltene Moment des Abhörens bestimmt Kleinschmidts künstlerische Auseinandersetzung mit den Thema „Frau beim Arzt“, die in einer Folge von Gemälden und Zeichnungen ihren Niederschlag fand. Charakteristisch ist auch die ausschnitthafte Komposition und eine komprimierte, dicht gedrängte Darstellungsweise. Geprägt durch seinen familiären Hintergrund, die Welt des Schauspiels und Theaters, inszeniert Kleinschmidt seine Gemälde wie eine Theaterbühne. Seine Hauptfarbe Weiß ist auch im kühl ausgeleuchteten Interieur der Arztpraxis dominant. Eine Generation nach Corinth, den Kleinschmidt sehr verehrte, und zwischen Expressionismus, Realismus und Neuer Sachlichkeit stehend, nahm Kleinschmidt unter seinen Zeitgenossen Beckmann, Dix und Grosz stets eine Außenseiterposition ein. Die Arbeit ist Frau Dr. Barbara LippsKant, Tübingen bekannt.
Provenienz:
Dr. Tebruegge, BensheimAlsbach (Arzt des Künstlers)
Ernst Schonnefeld, Auerbach
Privatsammlung, Deutschland (durch Erbfolge vom Vorbesitzer, bis 2001)
Lempertz, Köln, Auktion 29.11.2006, Lot 200
Privatbesitz
Christie‘s, New York, Auktion 04.11.2009, Lot 333
Privatbesitz Rheinland

horst strempel
(1904 Beuthen – 1975 Berlin)
7132 Alte Frau mit Gießkanne
Öl auf Leinwand. 1955.
103 x 79 cm.
Unten links mit Pinsel in Weiß signiert „Strempel.“. Saure 356.
1.500 €
Kraftvolle Helldunkelkontraste und eine effektvolle Stilisierung bestimmen die großformatige, charakteristische Komposition. In der Figur der alten Frau scheint Strempel den emotionalen Zustand der Melancholie zu personifizieren. Es findet in der intimen Szene ein Rückzug in die Privatsphäre statt, unterstrichen von der im Fensterausschnitt nur schemenhaft erkennbaren, verschwommen gezeichneten Außenwelt. Das Gemälde entstand bald nach Strempels Übersiedlung nach Westberlin.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
lotte laserstein

(1898 Preußisch-Holland – 1993 Kalmar/Schweden)
7133 Blumenstilleben
Pastellkreiden, teils gewischt, auf blassgrauem faserigen Bütten.
58 x 43,5 cm.
Unten links mit Bleistift signiert „Lotte Laserstein“.
4.500 €
Zurückhaltende Pastelltöne und ein duftiglockerer Duktus der stellenweise mit dem Finger gewischten weichen Kreiden dominieren das anmutige Blumenstilleben aus dem späteren, in Schweden entstandenen Werk der Künstlerin. Ihre frühe, steile Karriere wurde abrupt unterbrochen, da die Nationalsozialisten
Laserstein, die jüdischer Abstammung war, ein Mal und Ausstellungsverbot erteilten, und so ging die junge talentierte Künstlerin 1937 ins Exil nach Schweden, wo sie bis zu ihrem Lebensende tätig war. „Sie wird geschildert als modern und weltoffen, couragiert und unsentimental, leidenschaftlich und widerspenstig, klug und humorvoll dabei hochsensibel, warmherzig und feinfühlig, mit subtiler Beobachtungsgabe. Unerwähnt bleiben ihre tiefe Ernsthaftigkeit und stille Melancholie von denen ihre Werke zeugen.“ (Christa Matenaar, 2022, zit. nach fembio.org, Zugriff 19.08.2025).
Provenienz: Bukowskis, Stockholm, Auktion 20.11.2024, Lot 595
Privatbesitz Süddeutschland
karl hofer
(1878 Karlsruhe – 1955 Berlin)
7134 Mädchen mit erhobenen Armen Öl auf Hartfaser. 1951.
77 x 49,7 cm.
Verso von Elisabeth Hofer, der Witwe des Künstlers, mit Feder in Blau signiert, datiert, betitelt und am 15.12.1979 bestätigt. Wohlert 2047.
10.000 €
In einer hochspannenden, dynamischrhythmisch gestalteten Spachteltechnik schafft Hofer mit dem eigenartig entrückten Mädchenbildnis ein eindringliches Werk. Die Beseeltheit des Menschen ist der entscheidende Ausdruck, den Hofer in seinen Bildnissen einzufangen versucht. Seine Figuren sind nicht in erster Linie Individuen; über seine Modelle gibt der Künstler kaum verbindliche Auskunft. Auch im vorliegenden Werk gelingt es Hofer, Distanz zu schaffen: Er dreht das Mädchen ins Profil und verdeckt
dazu noch die Hälfte der Gesichtspartie mit dem erhobenen Arm. Zugleich umrahmen beide Arme das Antlitz des Modells und betonen das zarte Profil im Zentrum des Bildes. Summarisch behandelt Hofer die Figur, aus den abstrahierten Formen und rhythmisch unterbrochenen Farbflächen artikuliert sich ein überzeugend plastischräumlich erscheinendes Bildnis. Unser Gemälde besticht mit dem feinsinnig abgestimmten, in delikaten Kontrasten gestalteten Kolorit von Antlitz, Kleidung und Hintergrund. 1931 schrieb der Dichter Alfred Mombert in einem Brief an Hans Reinhart: „Er ist selbstverständlich kein ‚Portrait‘Maler. Es kommt ihm ja nicht darauf an, ein Stück Welt (in diesem Falle einen bestimmten homo) festzulegen, sondern Alles ist ihm Ausdrucksmittel zur Erkenntnis seiner Psyche.“ (zit. nach: Jürgen Schilling, Karl Hofer, Unna 1991, S. 23).
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 27.11.1999, Lot 262 Privatbesitz Rheinland

hannah höch
(1889 Gotha – 1978 Berlin)
7135 Frauenbildnis (Selbstportrait?)
Aquarell und Gouache auf Aquarellpapier. 1929.
26 x 18,7 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „H.H.“ und datiert.
900 €
In kräftigen Aquarellfarben angelegtes Frauenportrait, womöglich ein Selbstportrait, aus den 1920er Jahren. Die OrlikSchülerin Hannah Höch wusste sich im „Männerclub“ der Berliner Dadaisten zu behaupten. Sie war nicht nur Muse und kooperative Freundin von Arp, Schwitters und van Doesburg, sondern vor allem höchst produktiv in ihrem eigenen vielseitigen Schaffen.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
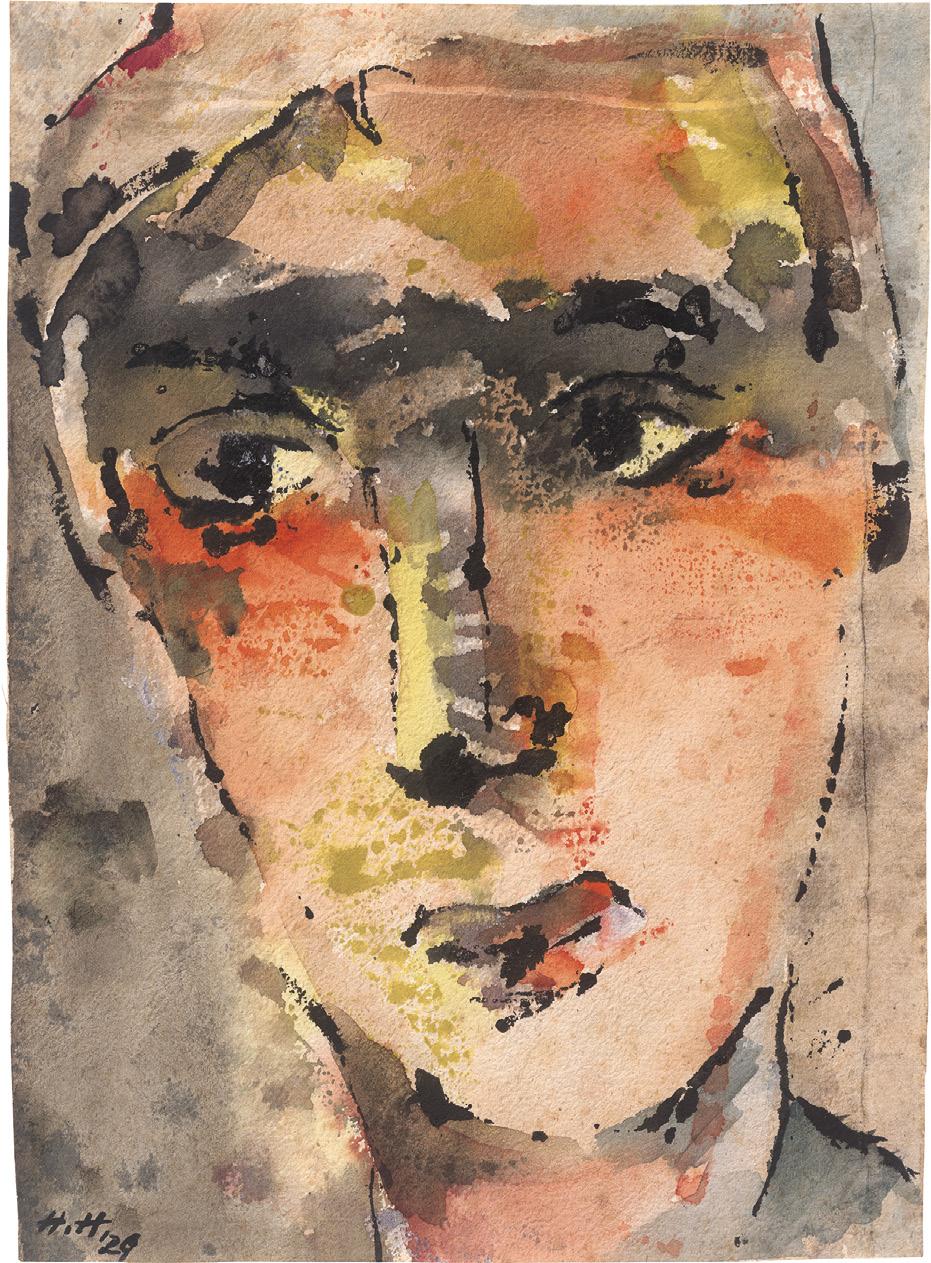
7135
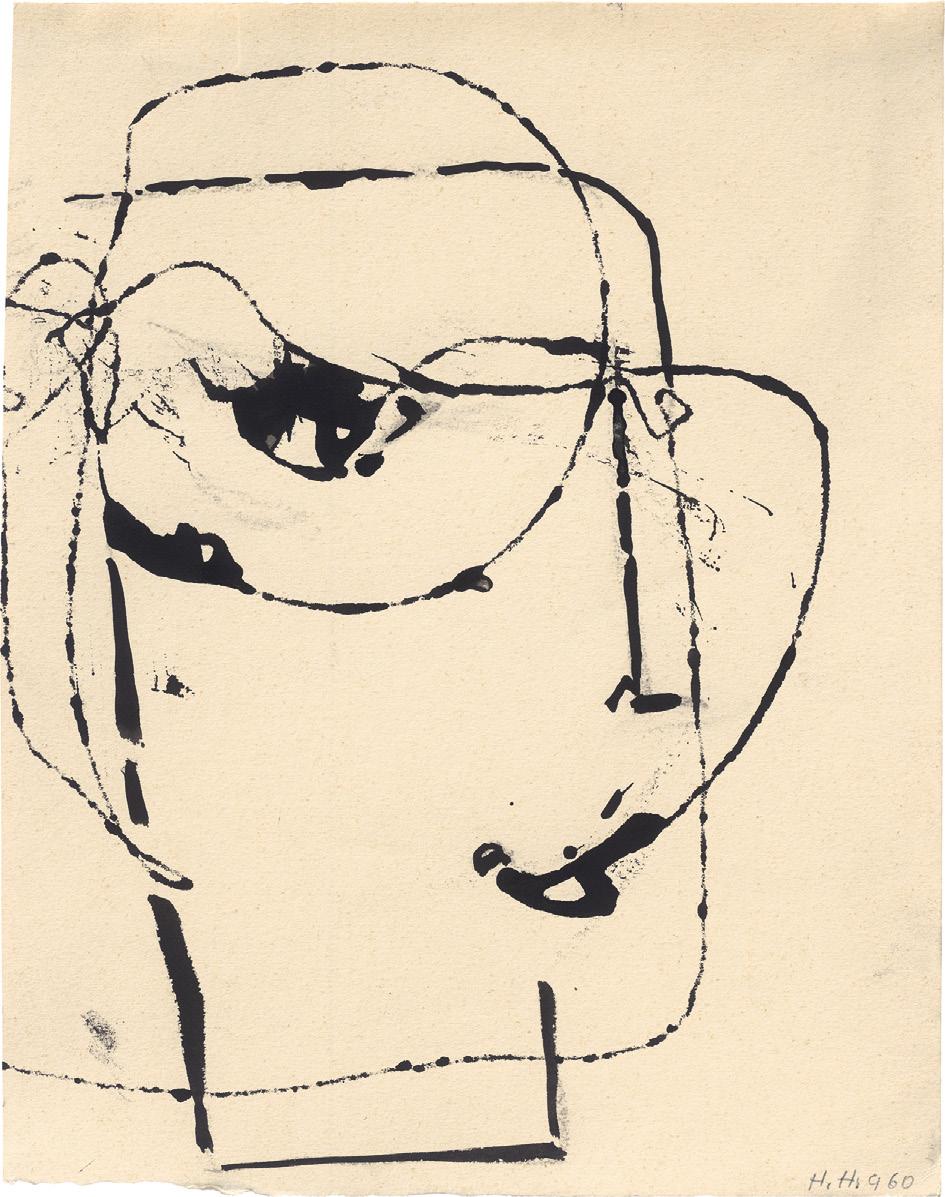
7136
hannah höch
7136 Abstrakter Kopf
Pinsel in Schwarz auf Velin. 1960.
27 x 21,2 cm.
Unten rechts mit Kugelschreiber in Blau monogrammiert „H.H.“ und datiert.
700 €
In schwungvollen Linien umreißt Höch das abstrakte Portrait und setzt dabei Kontraste in den schwarzen Partien von Mund und Auge. Eine schöne Studie aus dem Spätwerk der Künstlerin.
Provenienz: Privatbesitz Hamburg Bassenge, Berlin, Auktion 38, 01./02.12.1981, Lot 5956
Privatbesitz Berlin

hannah höch
7137 Abstrakte Komposition
Aquarell und Pastell auf CM Fabriano-Bütten. 1959. 10,8 x 17 cm.
Verso mit Kugelschreiber in Schwarz signiert „Hannah Höch“ und gewidmet.
1.200 €
Feinsinnig gezeichneter Neujahrsgruß der Künstlerin für das Jahr 1960 in Form einer abstraktgeometrischen Darstellung, die besondere Lebendigkeit durch die grüngelben Strahlen der Sternform und die darunterliegende kleinteilige Komposition entwickelt.
Provenienz:
Privatbesitz Norddeutschland Bassenge, Berlin, Auktion 103, 02.06.2014, Lot 8116
Privatbesitz Rheinland
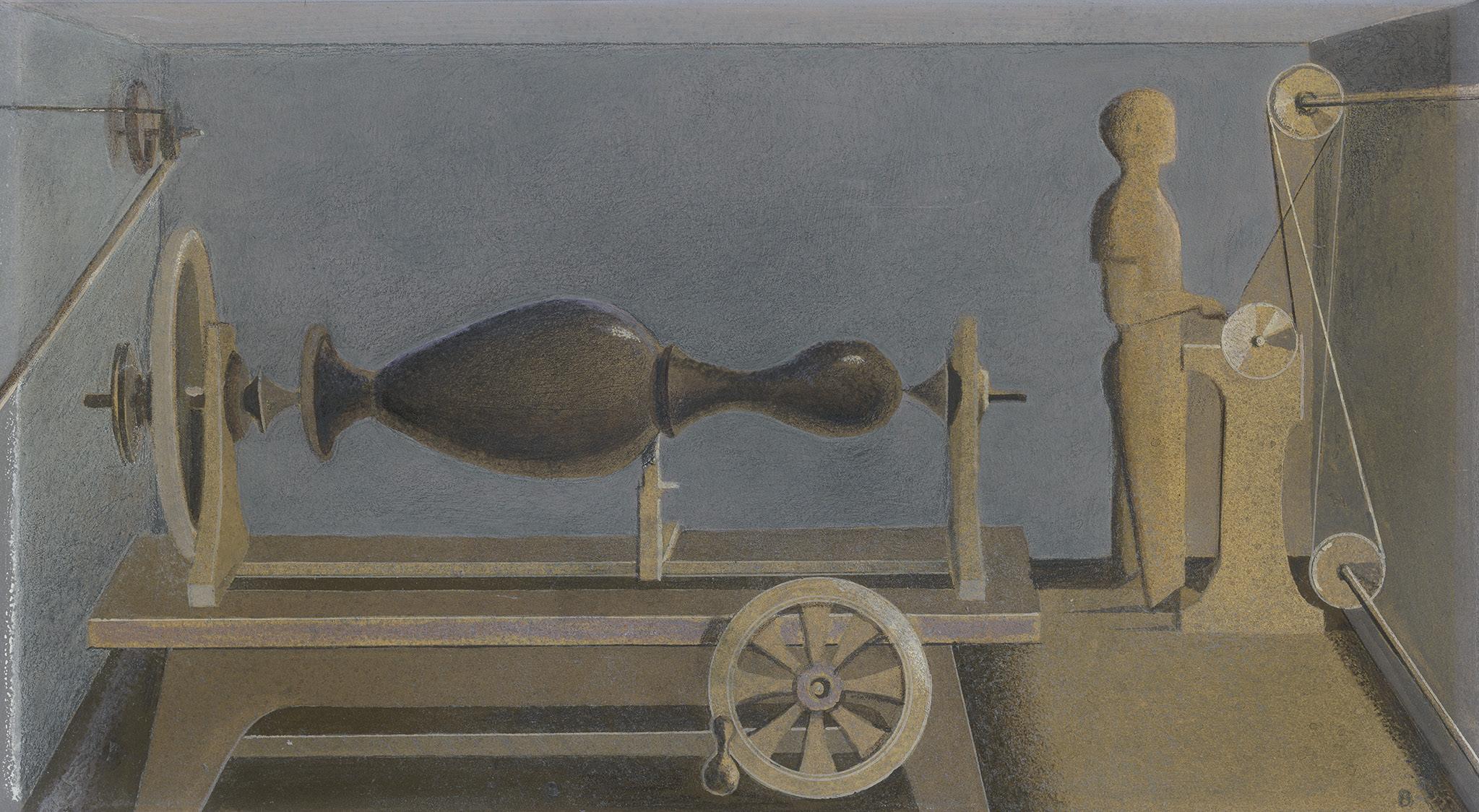
gottfried brockmann
(1903 Köln – 1983 Kiel)
7138 „Drehbank“
Tempera und Bleistift auf grauem Velin, auf Karton montiert. 1957.
30 x 54,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „B“, verso mit Faserstift in Schwarz signiert „Gottfried Brockmann“, datiert, betitelt und bezeichnet „(Farbige Fassung nach Zeichnung aus dem Jahre 1925)“.
1.500 €
Stilisiert wie eine Schneiderpuppe steht der Dreher an seiner Arbeit, die Maschine fertigt inmitten des souverän konstruierten Bildgerüstes ein figurengroßes, weichkurviges Objekt. Eine stilistische Verwandtschaft zu Oskar Schlemmers Bildideen lässt sich nicht von der Hand weisen. Formalästhetisch lässt sich Brockmanns Schaffen vielfach einem rheinischen Magischen Realismus zuordnen, während er zugleich aufgrund seiner Nähe zu der Gruppe der Kölner Progressiven als politisch engagierter Künstler gelten muss.
Provenienz:
Nachlass des Künstlers
Privatbesitz Berlin

franz lenk
(1898 Langenbernsdorf – 1968 Schwäbisch Hall)
7139 „Nebel am Niederrhein“ Aquarell und Bleistift auf Karton. 1959. 49,7 x 71 cm.
Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „F.L.“ (ligiert) und datiert, verso betitelt und bezeichnet „9.“. Von Abercron E-59-1. 2.000 €
Eine bewegungslose Stille und melancholische Grundstimmung erfüllt die menschenleere Landschaft. Meisterlich nutzt Lenk die fein differenzierte Bleistifttechnik dazu, auf der rauen, graublau
grundierten Bildfläche den Nebel mit verschwimmenden, undeutlichen Konturen darzustellen. Dabei nimmt der Himmel den größten Teil der Komposition ein. Romantische Elemente und Neue Sachlichkeit zeigen eine gelungene Verbindung in der völlig realitätsbezogenen, unsentimentalen bildnerischen Auffassung des Künstlers. In den Außenmaßen leicht von den Angaben bei Abercron abweichend.
Provenienz:
Privatbesitz Düsseldorf
Irene Lehr, Berlin, Auktion 26, 26.04.2008, Lot 363
Privatbesitz Berlin

fritz klimsch
(1870 Frankfurt/Main – 1960 Freiburg i.Br.)
7140 Träumende
Bronze mit dunkelbrauner Patina. Um 1947.
39 x 27 x 36 cm.
An der linken Fußsohle monogrammiert „FK“ (ligiert), dort mit dem Gießerstempel „H.NOACK BERLIN“. Braun 226.
12.000 €
In sich versunken sitzt die Träumende am Boden, die anmutige Haltung entspannt, die Arme um das angezogene rechte Bein geschlungen. Die bewegte Oberflächengestaltung der Kopfpartie und der Haare erzeugen eine besondere Lebendigkeit des Ausdrucks Bereits 1935 schuf Klimsch eine große Version der „Träumenden“. Sein bedeutendes Vorbild und Freund war Auguste Rodin, dessen Lebensnähe Klimsch eine nüchterne Statik und ausgewogene Tektonik entgegensetzte. So erzielte er die charakteristische Ausgewogenheit, die sein Werk kennzeichnet. Mit den befreundeten Künstlern Walter Leistikow und Max Liebermann gründete Fritz Klimsch die Berliner Sezession. 1912 wurde er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Prachtvoller, sorgfältiger Guss mit schöner, stellenweise ins Grünliche changierender Patina.
Provenienz: Privatbesitz Hessen

rolf nesch
(1893 Oberesslingen – 1975 Oslo)
7141 Felsen am Weg („Fjeld“)
Metallprägedruck auf schwerem, handgeschöpftem Van Gelder Zonen-Velin. 1934.
43 x 57,7 cm (51 x 65,2 cm).
Signiert „Nesch“, betitelt und bezeichnet „Selvtrykk“. Helliesen/Sørensen 480.
5.000 €
Blatt 12 der 20 Blatt umfassenden Serie „Schnee“. Rolf Nesch lernte u.a. bei Oskar Kokoschka in Dresden, war Freund Ernst Ludwig Kirchners und Bewunderer Edvard Munchs. Als die Nazis 1933 seine Bilder aus einer Ausstellung entfernten, emigrierte er nach Norwegen und wurde dort neben Munch zum wichtigsten Künstler der Klassischen Moderne Skandinaviens. Bekannt ist er für seine oft farbenfrohen, einzigartigen Metallprägedrucke, die er nach
seiner Übersiedlung nach Hamburg 1929 erfand und Zeit seines Lebens weiterentwickelte. Die reliefartigen Strukturen auf dickem Papier, die sich 1925 durch zufälliges Durchätzen seiner Radierplatten ergaben, führte er fortan weiter, indem er ganze Drähte, Lochplatten oder Gitter auf große Druckplatten lötete und so seine außergewöhnlichen, fast haptischen Reliefdrucke schuf. Die Serie „Schnee“ entstand kurz nach seiner Ankunft in Norwegen in Slependen, einem Vorort Oslos, und markiert einen ersten Höhepunkt in Neschs Materialdrucktechnik. Noch bleiben die kräftigen Farben aus und Nesch druckt mit viel Weißfläche nur in Schwarz. Wenige markante Drahtprägungen durchziehen die Komposition. Das Formenvokabular bleibt reduziert. Unser Exemplar in einem prächtigen Handdruck mit kräftigem Relief und dem vollen Schöpfrand. Selten, Helliesen/Sørensen vermuten mindestens elf Abzüge, auf dem internationalen Auktionsmarkt ist in den letzten 25 Jahren kein Exemplar nachweisbar.

7142
rolf nesch
7142 Hommage à Dürer
Farbiger Metallprägedruck auf schwerem Velin. 1971. 57,5 x 44 cm (64,7 x 50 cm).
Signiert „Rolf Nesch“, datiert und bezeichnet „Tiré par l‘artiste“.
Helliesen/Sørensen 840.
3.000 €
In dem vielseitigen und hochproduktiven graphischen Gesamtwerk Rolf Neschs gehört unser Blatt in die späte Serie „Hommage à Dürer“, die nur wenige Jahre vor seinem Tod entstand. Zum 500. Geburtstag von Albrecht Dürer lud der Kunstverein Nürnberg ver
schiedene Künstler ein, ein Werk zu Ehren des Meisters anzufertigen. Nesch lieferte insgesamt vier Arbeiten zum Thema, wovon nur eine in Nürnberg Verwendung fand. Die restlichen, darunter unseres, waren wohl als Triptychon geplant. Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre beschäftigte sich Nesch viel mit humorvollen Vogel und Fischformen, die er in seinen Materialbildern zum Teil mit Industrieschrott formte und jeden einzelnen Abdruck in der Zusammensetzung von Form und Farbe veränderte. Unser Exemplar in einem brillanten Druck mit kräftigem Rotorange im Hintergrund. Die weiteren Farben pointiert, fein nuanciert und insgesamt mit prachtvollem, teils ornamentalen Relief und mit kleinem, aber wohl dem vollen Rand. Selten, Helliesen/Sørensen vermuten ein Minimum von neun Abzügen.

fritz winter (1905 Altenböge – 1976 Herrsching/Ammersee)
7143 Vor Dunkelrot Öl auf Velin. 1932. 28,2 x 22,2 cm.
Unten rechts mit Bleistift monogrammiert „FW“ und datiert.
2.400 €
Wie durch ein Fenster schaut man durch den dunklen Rahmen tief ins Bild hinein. Das Rot liegt als diffuser, wohl mit Spritztechnik aufgebrachter hauchfeiner Schimmer in den Rändern der rechtekkigen Grundform. Durchsetzt ist es mit goldenen Einsprengseln, die den Effekt verstärken. Rot blitzt auch zauberisch aus den in die dunkle Farbe gekratzten Linien hervor. Diese nuancierten, in kristalliner Geradlinigkeit gestalteten Farbelemente verleihen dem Dunkel eine komplexe Räumlichkeit und Transparenz. Die plasti
schen, erhaben auf der Bildfläche liegenden Farbstrukturen schweben auf dem durch den breiten schwarzen Rahmen gesicherten Untergrund und scheinen eine meditative Schwingung in dieser nächtlichen Dunkelheit zu erzeugen.
Provenienz:
Sammlung Karl Ströher, Darmstadt (1956 direkt vom Künstler erworben)
Nachlass der Sammlung Dr. Erika PohlStröher Schuler, Zürich, Auktion 13.12.2019, Lot 3352
Privatbesitz Sachsen
Literatur:
Erika Pohl, Ursula Streuer und Gerhard Pohl, Karl Ströher, Sammler und Sammlung. Stuttgart 1982, S. 246, Nr. 634 (m. Abb.)
fritz winter
7144 Ohne Titel

Öl und Goldbronze auf Velin, auf Leinwand und Karton aufgezogen. 1934.
28,4 x 22,6 cm.
Unten rechts mit Kreide in Schwarz monogrammiert „FW“ und datiert.
4.000 €
Aus der Tiefe des nachtblauen Untergrundes entwickelt sich die ovallängliche, weitgehend in sich geschlossene Form kristalliner
Strukturen. In die pastos dicken Farbstrukturen kratzt Winter labyrinthartig verschachtelte, teils winkliggerade, teils kurvige Furchen, und dann wieder legt er die Farbe reliefhaft in linearen dicken Schwüngen auf den Malgrund. Ein ganz feines Schimmern der Goldbronze akzentuiert die Kanten und verleiht der Zeichnung die stille, entrückte Anmutung eines nächtlichen Himmels. Mit einer Expertise von Gabriele Lohberg, Trier, Oktober 2019.
Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 316, 20.11.2019, Lot 1240
Privatbesitz Sachsen

fritz winter
7145 Ohne Titel
Mischtechnik auf Velin. 1960. 17,1 x 22,6 cm (Passepartoutausschnitt).
Unten rechts mit Bleistift signiert „FWinter“ und datiert.
2.000 €
Im Jahr 1960 finden sich häufiger dynamische Schwünge in Winters Kompositionen. Auch hier setzt er die Farben mit energischen, heftigen Bewegungen des Spachtels und der Pinsel auf die helle Bildfläche, mit diagonal gerichtetem Gestus in intensiven, zumeist dunkeltonigen Farben. Bei Winters kleinformatigen Ölbildern auf Papier, die um 1960 entstanden, wird das „AntiFormalistische (...) zum primären Prinzip. Bei ihnen kommt die Beschleunigung der Ausführung und ein weit gespanntes Farbspektrum zum Tragen.“ (Gabriele Lohberg, Fritz Winter. Leben und Werk, München 1986, S. 85). In diesen kleineren Blättern spielt er souverän und voller Experimentierfreude mit den Möglichkeiten des assoziativen Komponierens.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
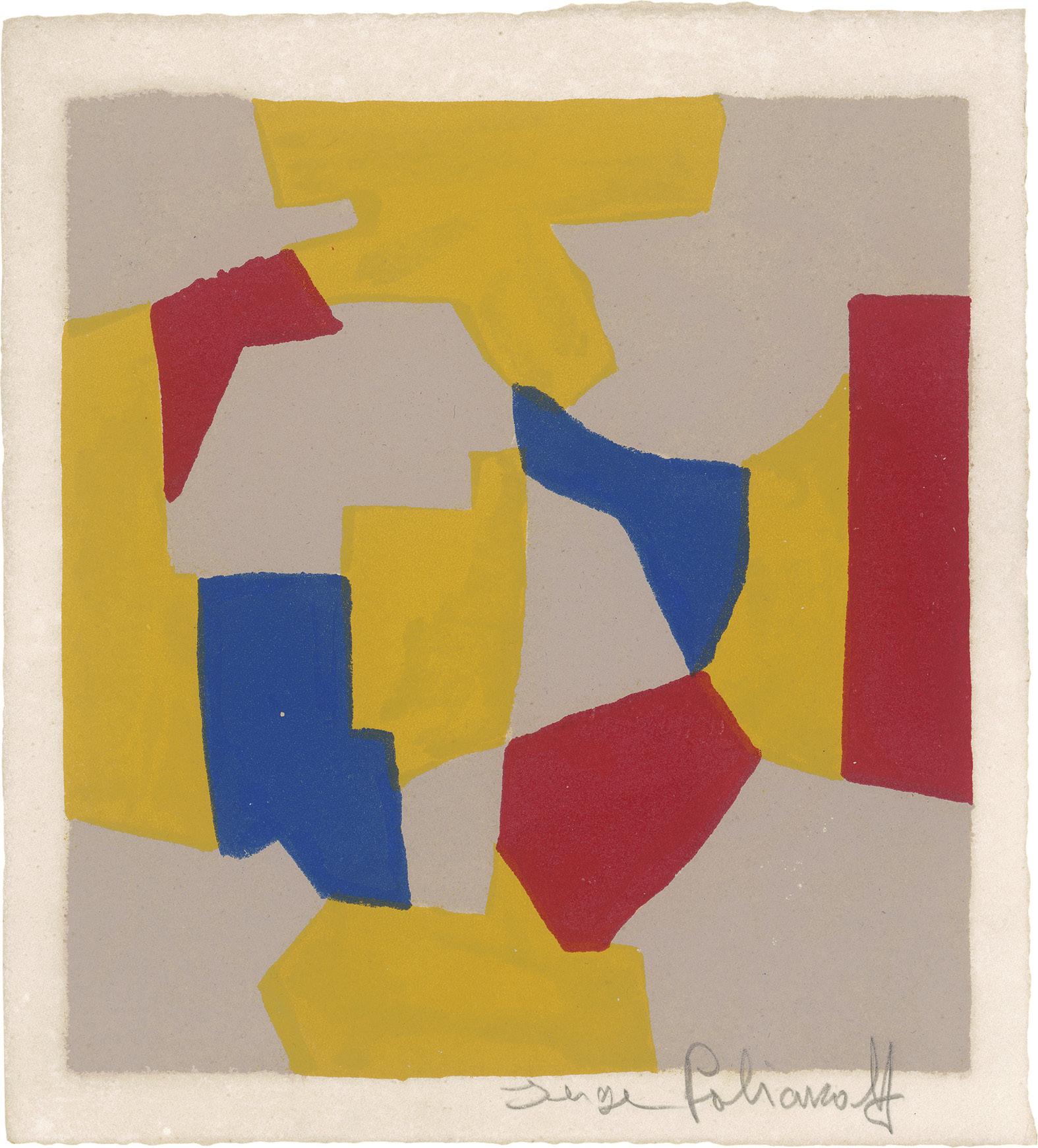
7146
serge poliakoff
(1906 Moskau – 1969 Paris)
7146 Composition grise, jaune, rouge et bleue Farblithographie auf festem Velin. 1959.
19 x 17,5 cm (22 x 20 cm).
Signiert „Serge Poliakoff“. Rivière 26.
1.500 €
Eines von den nur wenigen bei Rivière erwähnten signierten Exemplaren außerhalb der Auflage von 200 Drucken, die Verwendung als Glückwunschkarte fanden. Druck Pons, Paris. Prachtvoller Druck mit dem vollen, kleinen Rand.

theodor werner
(1886 Jettenburg b. Tübingen – 1969 Berlin) 7147 Im Schnee Tempera, gefirnist, auf Karton, auf festen Karton aufgespannt. 1952. 62 x 87,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Theodor Werner“ und datiert.
Lohkamp 322, Inventarnr. G.W. 2163. 4.000 €
Ein rhythmisches Schwingen erfüllt die Bildfläche, die abstrakten und zugleich organisch erscheinenden Formen im komplex geschichteten Bildraum zeugen von der metaphysischen Durchdringung des Künstlers. „Er gehört zu jenen ‚denkenden Malern‘, die ihre schöpferische Produktivität aus der Spannung von Intuition und Überlegung entwickeln (...)“ (Hans Kinkel, Begegnung mit Theodor Werner, 1961, zit. nach: Ausst.Kat. Theodor Werner. Miniaturen auf Papier 19441968, Karl & Faber, München 1990, S. 3). 1950 55 gehörte Theodor Werner der Künstlergruppe „ZEN“ in Berlin an. Zu dieser Zeit entstand die vorliegende großformatige Komposition. In den 1930er Jahren hielt Christian Zervos, der große
französische Kunstkritiker, Herausgeber der „Cahiers d‘Art“ und des Picasso Werkverzeichnisses, Theodor Werner für einen der größten zeitgenössischen deutschen Maler, und dank seiner Wertschätzung war Werner auch mit drei Bildern auf der Pariser Weltausstellung von 1937 vertreten. In Deutschland hingegen erlangte der Künstler erst 1947 durch eine Ausstellung der Galerie Gerd Rosen in Berlin Bekanntheit.
Provenienz:
Arnold, Frankfurt, Auktion 25.11.2023, Lot 323
Karbstein, Düsseldorf, Auktion 16.03.2024, Lot 197
Privatbesitz Rheinland
Ausstellung:
XXVI. Biennale Venedig, 1952, Kat.Nr. 101
Theodor Werner, Arbeiten aus den Jahren 1947 bis 1952, Galerie Ferdinand Möller, Köln 1952, Kat.Nr. 33
Hans Uhlmann, Theodor Werner, Woty Werner, Kestner Gesellschaft, Hannover 1953, Kat.Nr. 33
Theodor Werner. Ausgewähte Arbeiten 1939 1966, Karl & Faber, München 1992, Kat.Nr. 8

theodor werner
7148 128/59
Tempera, Öl und Graphitstift sowie Zeitungsabdruck auf Schoellershammer-Velin. 1959. 51,2 x 72,8 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Theodor Werner“ und datiert, verso bezeichnet „Nr. 128/59“. Lohkamp 1053.
2.000 €
Vehemente, wie Flammen lodernde Farbigkeit erfüllt die geschwungenen Formen der expressiven Komposition, dazu schwingen feine Linien und Binnenstrukturen, die Werner in die frischen Farbschichten kratzt. In den 1930er Jahren lebte Werner in Paris
und war dort Mitglied der Künstlergruppe Abstraction Création um Naum Gabo und Theo van Doesburg. Nachdem bei einem Bombenangriff 1945 ein Großteil seines Werks in Deutschland zerstört wurde, begann 1947 mit einem Neubeginn seine wichtigste Schaffensperiode, in der er ein bedeutender Vertreter der abstrakten Malerei wurde. Von 1946 bis 1959 lebte und arbeitete er in Berlin und wurde 1950 Mitglied des nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergegründeten Deutschen Künstlerbundes. Während dieser Zeit entstand die vorliegende Komposition.
Provenienz: Doebele, DettelbachEffeldorf, Auktion 23.11.2013, Lot 411 Privatbesitz Berlin
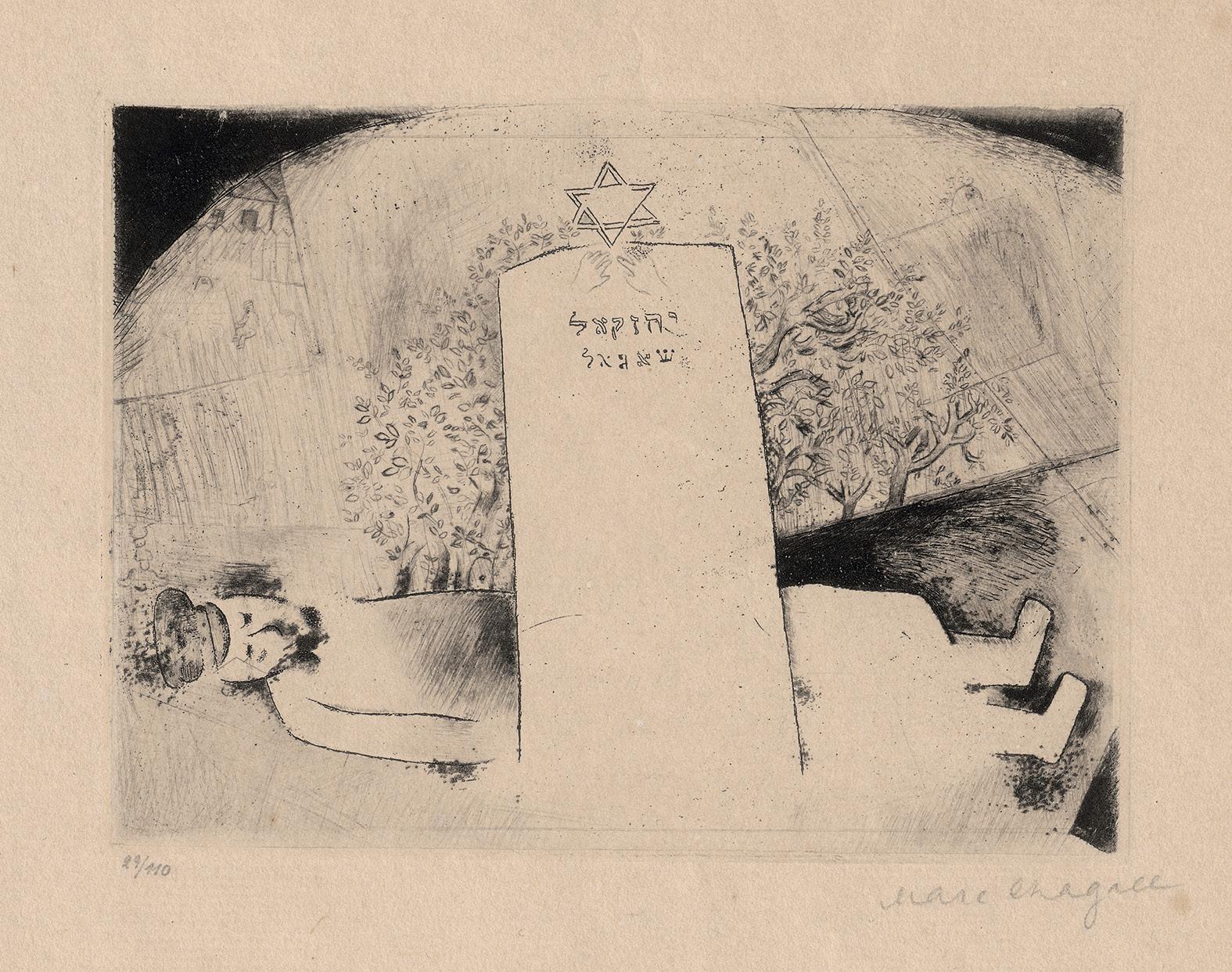

marc chagall (1887 Witebsk – 1985 St. Paul-de-Vence)
7149 Grab des Vaters Radierung mit Kaltnadel auf Bütten. 1922/23. 10,8 x 14,9 cm (26,8 x 35 cm).
Signiert „Marc Chagall“. Auflage 110 num. Ex. Kornfeld 20 IV c.
1.200 €
Blatt 20 aus der Folge „Mein Leben“, erschienen bei Paul Cassirer, Berlin 1923. Ausgezeichneter Druck mit dem wohl vollen Rand, rechts mit dem Schöpfrand.
7150 Aus: Louis Aragon, Celui qui dit les choses sans rien dire Radierung und Farbaquatinta auf Velin. 1976.
39,3 x 30 cm (47 x 36 cm).
Signiert „Marc Chagall“ und bezeichnet „H.(ors) C.(ommerce)“. Cramer 99.
2.400 €
Aus der Folge von 25 Radierungen Chagalls zu Louis Aragon, herausgegeben von Maeght, Paris 1976, in einer Gesamtauflage von 225 Exemplaren, hier eines der 20 „H.C.“Exemplare. Druck Lacourière et Frélaut, Paris. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, oben und unten mit dem Schöpfrand.
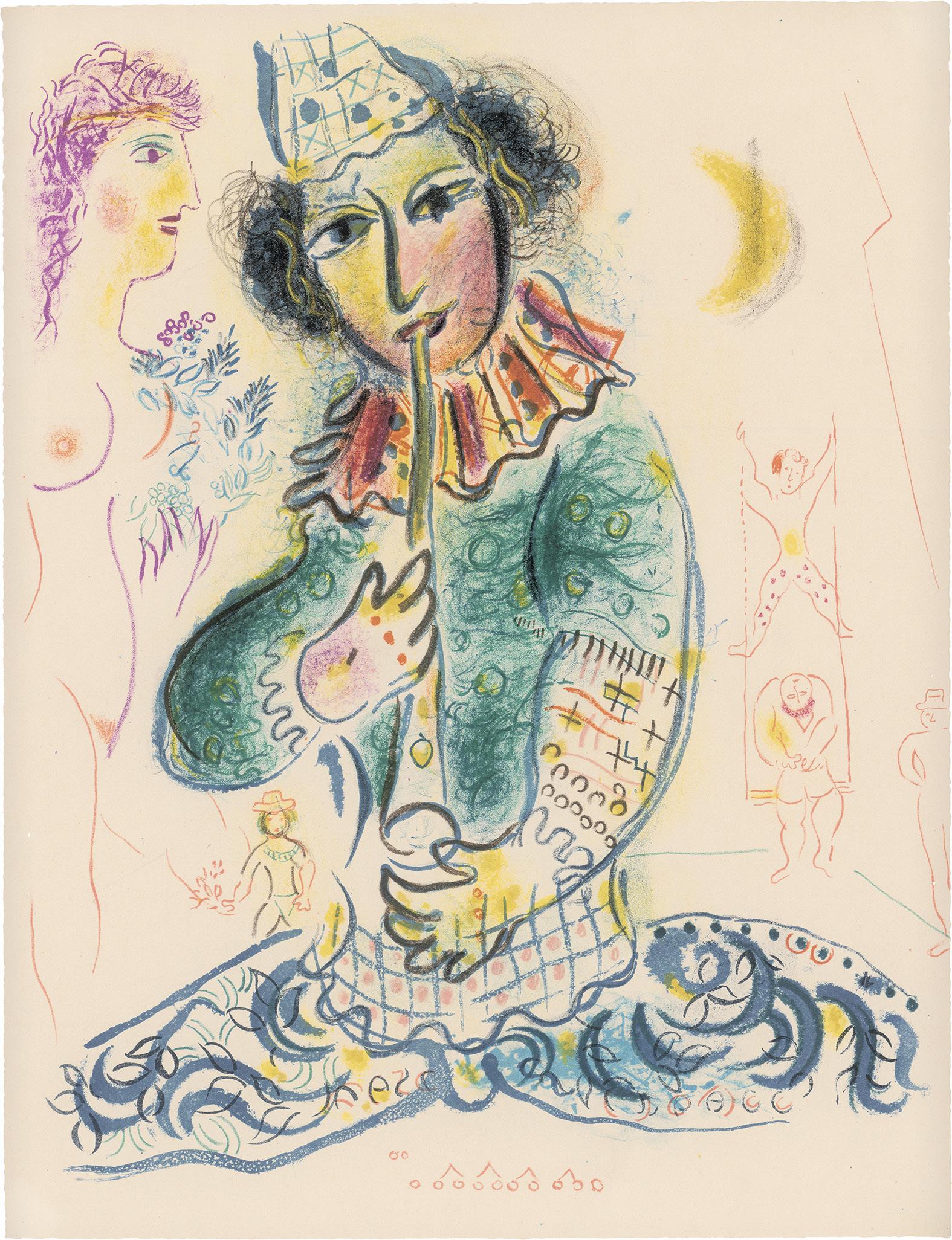
7151 Aus: Le Cirque
Farblithographie auf Velin. 1967.
40,5 x 31,5 cm (42,5 x 32,5 cm).
Auflage 250 Ex. Mourlot 527.
3.000 €
Blatt 23 aus der 23 Farblithographien und 15 Lithographien umfassenden Folge Le Cirque. Herausgegeben von Tériade, Paris 1967, in einer Gesamtauflage von 270 Exemplaren. Prachtvoller Druck, an drei Seiten mit dem vollen, kleinen Rändchen.

georges braque (1882 Argenteuil – 1963 Paris)
7152 Vol de nuit (Oiseau XII)
Farblithographie auf Arches-Velin. 1957.
38,5 x 68,5 cm (54 x 76 cm).
Signiert „G Braque“. Auflage 75 num. Ex. Vallier 111.
8.000 €
Erschienen bei Maeght, Paris, in einer Gesamtauflage von 75 Exemplaren, zudem einige Künstlerexemplare; Druck Mourlot, Paris. Ganz prachtvoller, farbintensiver Druck des charakteristischen Motivs, mit dem vollen Rand, unten mit dem Schöpfrand.
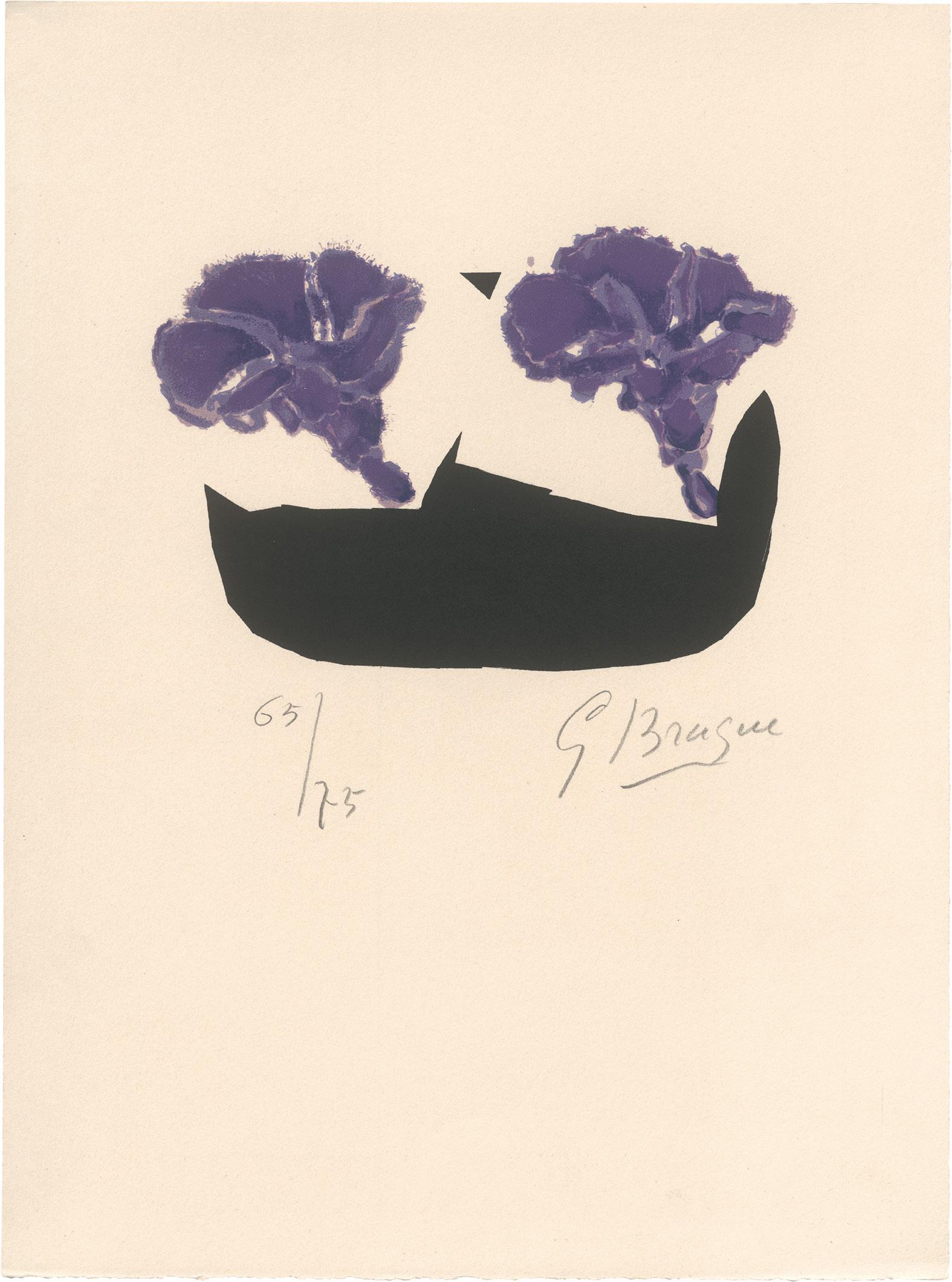
georges braque
7153 Les Volubilis
Farblithographie auf Arches-Velin. 1963. 13,2 x 19,3 cm (38 x 28 cm).
Signiert „G Braque“. Auflage 75 num. Ex. Vallier 181, Mourlot 134.
1.200 €
Aus der Folge von 27 Farblithographien des Künstlers zu „Lettera Amorosa“ von René Char, einem der herausragenden Künstlerbücher von Georges Braque. Herausgegeben von der Edition Edwin Engelberts, Genf. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.
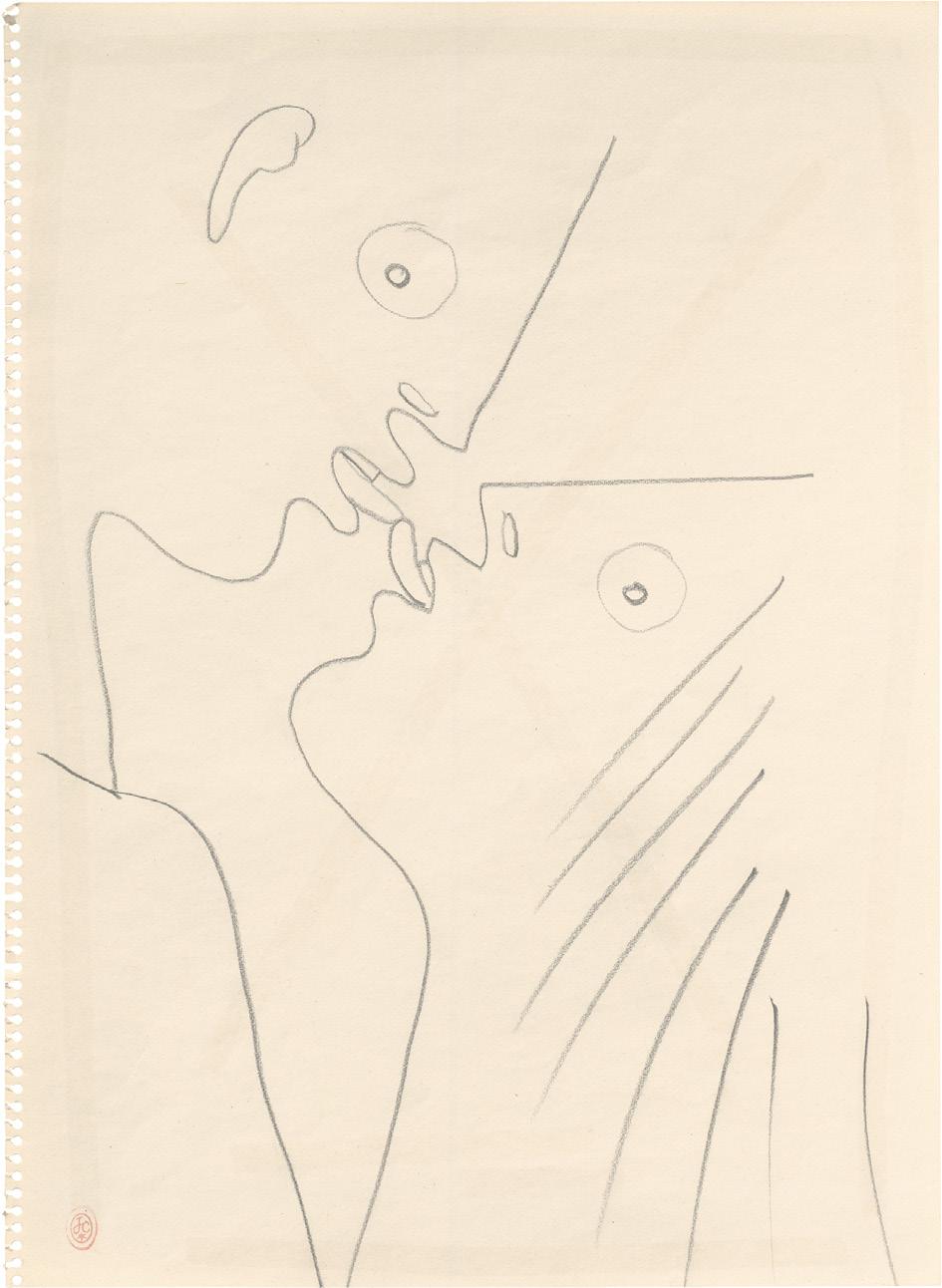
jean cocteau
7155 Les amoureux
Zimmermannsbleistift auf Skizzenblockpapier. Um 1955. 37 x 27 cm.
Unten links mit dem roten Monogrammstempel „JC“. 2.000 €
Mit fließenden Konturlinien, ganz ohne Binnenstrukturen erfasst Cocteau das küssende Liebespaar im Profil, mit leichter Hand und in geradezu schlafwandlerischer Sicherheit hingeworfen. Kurvige Formen und Geraden spiegeln sich im Zusammenspiel der beiden Figuren und stehen in spannungsvollem Kontrast zueinander. Zum Motiv der zwei Liebenden entstanden zahlreiche Zeichnungen und Lithographien des Künstlers. Wir danken Annie Guedras, Périgeux, für freundliche Hinweise vom 21.09.2025.
Provenienz: Privatbesitz Rheinland
jean cocteau
(1892 Maison-Laffitte – 1963 Paris)
7154 HommeToro chantant le flamenco
Bleistift und Farbstifte auf Skizzenbuchpapier. Um 1953. 21 x 16,3 cm (Passepartoutausschnitt).
Unten links mit Bleistift signiert „Jean“ und mit dem Sternchen-Signet.
1.200 €
Den Juli 1953 verbrachte Cocteau mit Freunden in Spanien, wo der Künstler an zahlreichen Stierkämpfen teilnahm und den Flamenco für sich entdeckte. Vermutlich im Zusammenhang mit dieser Reise entstand die elegante kleine Zeichnung eines seiner charakteristischen „HommeToro“. Der Universalkünstler Cocteau Dichter, Schriftsteller, Filmregisseur und Maler zeichnet die charakteristische Profildarstellung mit fließenden Konturlinien und sparsamen farbigen Schraffuren. Zu seinem Freundeskreis zählten Igor Strawinsky, Edith Piaf, André Gide, Marcel Proust und Edmond Rostand, er stand in Kontakt mit berühmten Künstlern wie Pablo Picasso und Charlie Chaplin. Wir danken Annie Guedras, Périgeux, für freundliche Hinweise vom 02.04.2025.
Provenienz: Privatbesitz Hessen
7155 7154
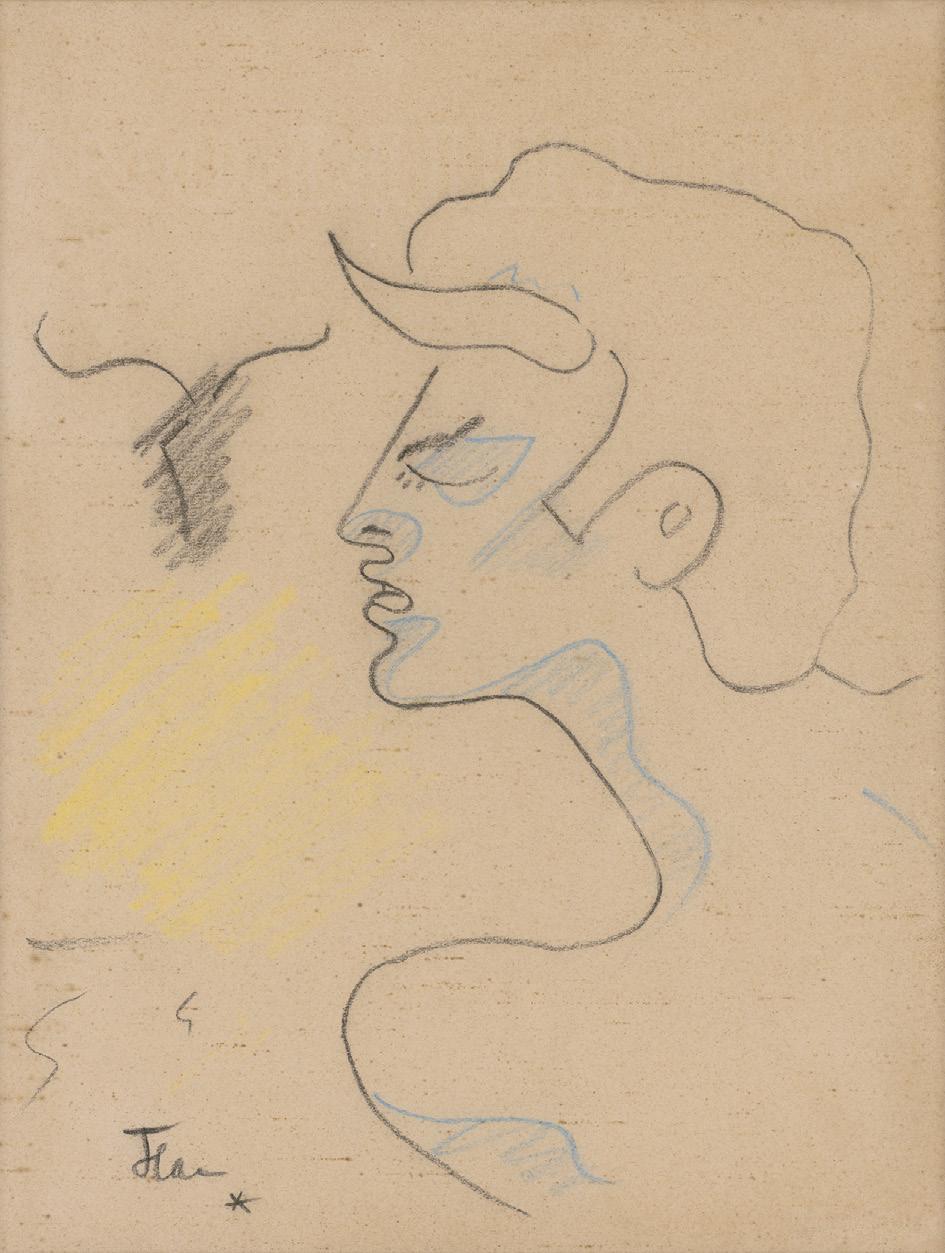
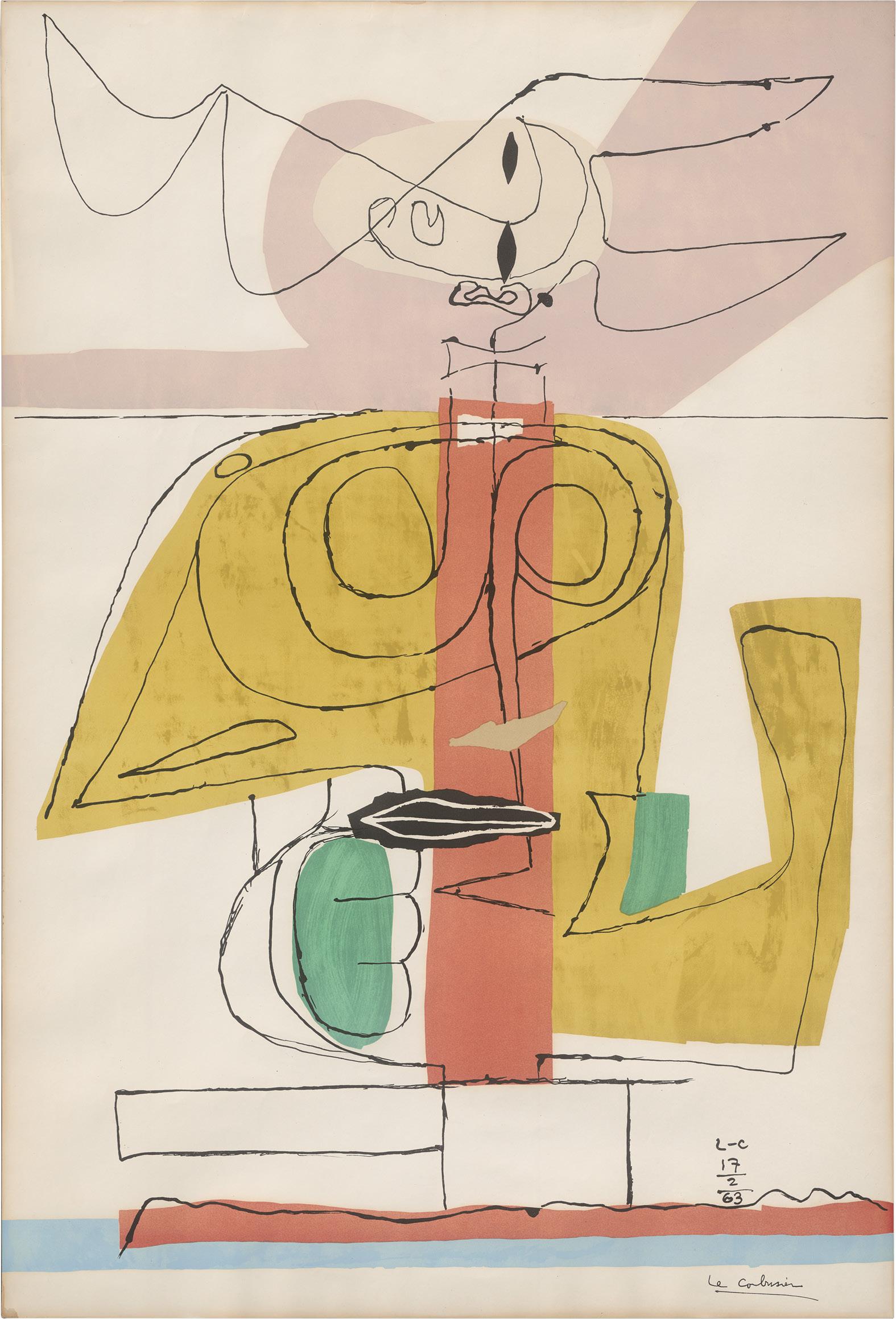
le corbusier
(d.i. Charles-Edouard Jeanneret-Gris, 1887 La Chaux-de-Fonds – 1965 Roque Brune)
7156 Taureau
Farblithographie auf festem Velin. 1963. 110,1 x 74,8 cm.
Weber 72. 900 €
Großformatige Lithographie in limitierter Auflage herausgegeben von der Galerie Heidi Weber, Zürich, und gedruckt bei Mourlot, Paris. Schöner Druck der formatfüllenden Komposition.
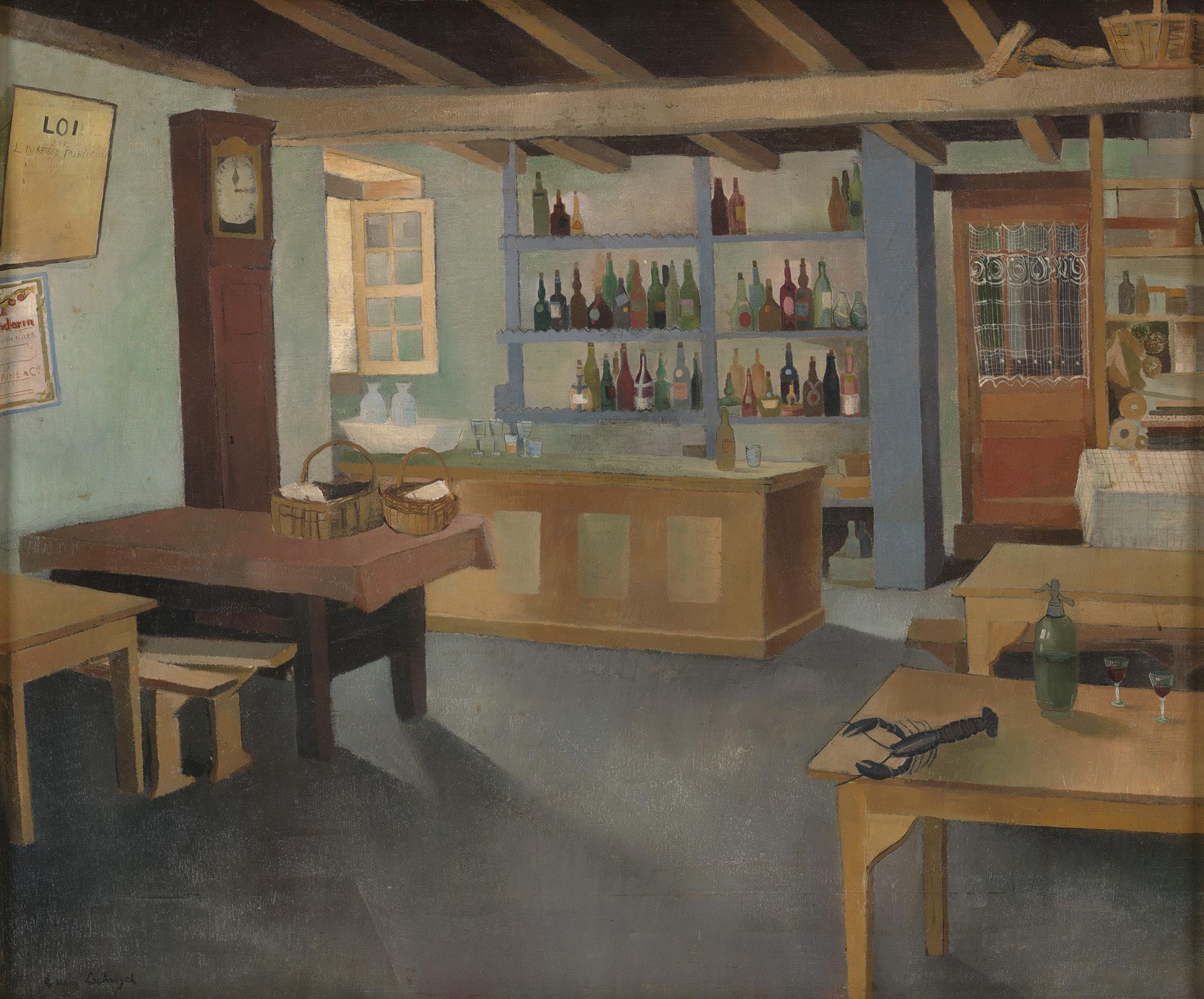
edith van leckwyck-campendonk (1899 Antwerpen – 1987 Amsterdam)
7157 La Buvette Öl auf Sperrholz.
60 x 50,5 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „E van Leckwyck“, verso auf der Platte (von fremder Hand?) mit Bleistift betitelt und mit Faserstift in Schwarz bezeichnet „Nr. 1509“ und „FAM 2994“.
1.200 €
In der menschleeren Gaststätte scheint die Zeit stehen geblieben. Die vollen Rotweingläser ruhen auf dem Tisch und ein regloser Hummer wartet auf seine Verwertung. In sachlicher Manier zeigt die belgische Malerin Edith van Leckwyck Campendonk, Ehefrau des Künstlers Heinrich Campendonk, diese Interieurszene. 1929 begegnete sie auf der Ausstellung Kunst van Heden in Antwerpen Heinrich Campendonk und Wassily Kandinsky. 1935 heirateten Edith und Heinrich Campendonk. Nach der Heirat stellte die Künstlerin das Malen ein und widmete sich erst wieder 1962, nach dem Tod ihres Mannes, ihrer Kunst.

vlastimil benes (1919–1981, Prag)
7158 Stadtansicht
Aquarell auf genarbtem Aquarellkarton. 1953. 11,3 x 6,4 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „Benes“, verso mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert „Benes“ und datiert.
1.200 €
Durch eine auf beiden Seiten angeschnittene Häuserwand blickt der Betrachter auf eine weite Landschaft, die sich in der Ferne des Hintergrundes erstreckt. Die charakteristische menschenleere kleine Stadtansicht des Künstlers ist in seinen typischen gedeckten Farbtönen gehalten, die von Grau und Blautönen dominiert werden.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen


vlastimil benes
7159 „Strom vohrade“ Öl auf Malpappe, im Künstlerrahmen. 1967. 21 x 15,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Weiß signiert „Benes“, verso mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert „VL. BENES“. datiert und betitelt, auf der Rahmenrückseite auf Klebeetiketten bezeichnet „2“ und „19“. 6.000 €
„Der Baum des Gartens“ lautet Benes‘ Titel übersetzt. Dunkel und winterlich kahl ragt das Geäst des Baumes von links ins Bild und überwölbt die menschenleere, geometrisch verschachtelte Industrielandschaft. Die zu eckigen Farbflächen stilisierten Gebäude schiebt Benes zusammen, so dass sie bauklotzartig aneinander stehen. Unregelmäßig grob liegen die vom Künstler selber angerührten Farben auf der Bildoberfläche und verleihen ihr einen körnigen, unruhigen Charakter. Die Stille und Einsamkeit der akribisch gemalten Szenerien lassen die einprägsamen Gemälde des Künstlers so einzigartig in ihrer Ausstrahlung erscheinen. Nach der Schließung der tschechischen Universitäten durch die Nazis verdingte sich Benes als Hilfsarbeiter auf den Prager Werften und konzentrierte sich zugleich ganz auf sein künstlerisches Schaffen.
1943 wurde er zur Zwangsarbeit in Deutschland einberufen. Nach seiner Rückkehr trat er dem Verein Stursa bei. Seine erste Einzelausstellung hatte er 1956 im Prager Theater D 34, ein Jahr später wurde er Mitglied der Gruppe Máj 57.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
7160 Friedhof mit Bäumen Öl auf Hartfaser, vermutlich im Künstlerrahmen. 1968. 15,2 x 20,5 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „Benes“ und datiert, verso mit Pinsel in Schwarz nochmals datiert. 2.800 €
Mitten im Sommer malt Benes kahle Bäume als ein Sinnbild des Todes inmitten der kleinen, ummauerten Ruhestätte, umgeben von menschenleerer Landschaft. Außerhalb der kleinen Friedhofsinsel verzichtet der Künstler auf jedes Detail und gliedert die Umgebung in klar voneinander getrennte Farbflächen.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen



vlastimil benes
7161 Kleines Dorf
Öl auf Malpappe. 1968.
10 x 14,3 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Benes“, verso mit Pinsel in Schwarz zweifach datiert.
2.400 €
In den charakteristischen Braun und Grautönen setzt Benes auch in diesem Werk, wie aus einem Baukasten stammend, ein kleines Dorf zusammen. Die so typische Kargheit wird besonders durch die fast fensterlosen Fronten der Gebäude unterstrichen. Der Künstler arbeitete an diesem Werk von Mai bis Juli 1968.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
7162 Bahnstation
Öl auf Malpappe, im Künstlerrahmen. 1968-70.
8,5 x 13,8 cm.
Verso mit Bleistift signiert „V. Benes“, mehrfach datiert und gewidmet, auf der Rahmenrückseite auf Klebeetikett bezeichnet „17“.
2.200 €
Ein leeres Bahnhofsgebäude in karger Landschaft, vermutlich lokalisiert in der Prager Peripherie, malt Benes in seinem charakteristi
schen reduzierten Flächenstil, für den er bekannt wurde. Verso vermerkt er mit seinen handschriftlichen Notizen zur Entstehung des Gemäldes mehrere Tage zwischen 1968 und 1970 für die Arbeit an dem kleinformatigen Gemälde. Anknüpfend an den sozialen Realismus und an die Poetik der konstruktivistischen Avantgarde, steht Benes‘ Malerei für einen geometrisierenden poetischen Realismus Charakteristisch ist auch die körnige, etwas grobe Struktur der stets von ihm selber angerührten Farben.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
7163 Haus am Fluss Öl auf Malpappe.
22 x 31 cm.
Unten links signiert (in die feuchte Farbe geritzt) „Benes“.
3.500 €
Verlassen ruht ein kleines buntes Häuschen neben dem grauen Fluss, der sich durch die asphaltierte Stadtlandschaft zieht und flankiert wird von einer mit Bäumen gesäumten Straße. Das rote Dach setzt einen reizvollen farbigen Kontrast zu den gedeckten Tönen der Umgebung. Umgekippte und zurückgelassene Boote erinnern an menschliche Aktivität, doch wird die Szene durch den flächigen Farbauftrag anonymisiert und abstrahiert.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
holmead

(d.i. Clifford Holmead Phillips, 1889 Shippensburg/Pennsylvania – 1975 Brüssel)
7164 „The Mower“ Öl auf Leinwand. 1954.
101 x 81 cm.
Unten links mit Pinsel in Rot signiert „Holmead“, oben rechts mit Pinsel in Blaugrün bezeichnet „HP“ und datiert sowie verso auf der Leinwand mit Kreide in Schwarz nochmals signiert, datiert, betitelt und bezeichnet „HPinx.“.
2.800 €
Aus dem tiefdunklen Vordergrund entwickelt die ländliche Szene eine kontrastreiche, kostbar leuchtende Farbigkeit. In vielen Schich
ten übermalt Holmead seine Striche und Spachtelstrukturen, so dass alle Konturen weich erscheinen, die Oberfläche eine raue, pastose Struktur gewinnt und die Farbpartikel in ein diffuses Schimmern geraten. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt Holmead seinen malerischen Expressionismus, seinen „crude expressionism“, der sich von allem Dekorativen und ManieriertGlatten unterscheiden sollte und bis ins Informelle reicht. Die Arbeit wird von Birgid und Christoph Groscurth, Frankfurt, in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis mit der ArchivNr. „Im 54/1013“ aufgenommen.
Provenienz: Privatbesitz Brüssel
holmead

7165 Männerkopf Öl auf Leinwand, ganzflächig vom Künstler auf Holz kaschiert. 1970. 20,3 x 15 cm.
Unten mittig rechts mit Pinsel in Rot signiert „Holmead“, verso mit Kreide in Schwarz nochmals signiert, datiert und bezeichnet „HPinx“, „toile sur triplex hydrofugé“ sowie „B“ und (von fremder Hand?) „Foto 376“, zudem mit Faserschreiber in Schwarz „N 70/46“ und mit den Maßangaben.
2.000 €
Der charakteristische reliefhafte Charakter des kleinen Gemäldes, entstanden durch den dynamischpastosen Farbauftrag, stilisiert
und unterstreicht die physiognomischen Züge des Dargestellten. Um 1970 72 malt Holmead kaum anderes als Köpfe, imaginäre oder „visionäre“ Portraits, entstanden aufgrund von Eindrücken und in Abwesenheit der Dargestellten: „Die Wirklichkeit seiner ‚Köpfe‘ liegt nicht in der Ähnlichkeit zu einer bestimmten Porträtperson, sondern in der Überzeugungskraft einer erlebten und in die Anschaulichkeit gehobenen individuellen, charakteristischen Existenz – mit all ihren unheimlichen und banalen, tragischen und lächerlichen Zügen. Nichts war Holmead mehr zuwider als täuschende Beschönigungen. (...) So sind alle seine ‚Köpfe‘ anschauliche Enthüllungen der menschlichen Natur.“ (Rainer Zimmermann, in: Holmead – Leben und Werk, Stuttgart 1987, S. 143).
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

horst janssen (1929–1995, Hamburg)
7166 Eisenbahn
Farbholzschnitt auf Velinkarton. 1957.
47,5 x 63 cm (52,5 x 72,5 cm).
Signiert „Janssen“ und datiert. Auflage 25 num. Ex. Brockstedt 31.
2.400 €
Druck in fünf Farben, Schwarz, Braungrau, Blaugrün, Rot und Weiß, die helleren Farben jeweils auf die schwarze Grundplatte gedruckt. Seit 1956/57 stellte Janssen erstmalig seine Farbholzschnitte in den eigenen Atelierräumen in der Warburgstraße in Hamburg aus, ebenso wie auch in der Galerie von Hans Brockstedt in Hannover. Prachtvoller Druck dieses frühen, großformatigen Motivs, mit dem wohl vollen Rand, rechts mit dem Schöpfrand. Selten
hans bellmer
(1901 Kattowitz – 1975 Paris)
7167 Madame Edwarda
12 Radierungen mit Text auf 10 Doppelbl. BFK Rives-Velin. Lose in Orig.-Leinenumschlag in Orig.-Schuber. 1955.
40 x 26 cm (Schuber).
Sämtlich signiert „Bellmer“. Auflage 150 num. Ex. Denoël 51-56.
1.500 €
Illustrationen zu den Texten von Pierre Angélique (Pseudonym für Georges Bataille). Aus einer Gesamtauflage von 167 Exemplaren, herausgegeben von Georges Visat, Paris. Sämtlich prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand.


hans bellmer
7168 Petit Traité de Morale
10 Farbradierungen auf Doppelbl. Arches-Velin, 2 Doppelbl. Titel und Druckvermerk. Lose in Umschlag, in Orig.-Seidenportfolio und Seidenschuber. 1968.
37,7 x 28,5 cm (Schuber).
Die Radierungen jeweils signiert „Bellmer“. Auflage 150 Ex. Denoël 78-87.
2.200 €
Die Folge von Radierungen Bellmers erschien bei Georges Visat, Paris. Hans Bellmer ließ sich von den Titeln des Marquis de Sade zu diesen Radierungen inspirieren, die zwischen 1966 und 1968 entstanden. Prachtvolle, kräftige Drucke, jeweils auf Doppelbogen, mit dem vollen Rand.

werner tübke
(1929 Schönebeck a. d. Elbe – 2004 Leipzig)
7169 Selbstbildnis
Feder und Pinsel in Schwarz auf Skizzenblockpapier. 1957. Ca. 37,4 x 27,2 cm.
Unten links mit Bleistift signiert „Tübke“ und mit Feder in Schwarz datiert, verso mit Bleistift mit der Werknummer „Z-20/57“.
14.000 €
Das frühe Selbstbildnis Tübkes zeigt den Künstler in leichtem Dreiviertelprofil als Halbfigur vor neutralem Hintergrund und besticht durch eine fast majestätische Wirkung. Selbstbewusst blickt er mit einem konzentrierten, durchdringenden Blick aus dem Bildraum, den er mit einem dünnen gezeichneten Rahmen sicher abgrenzt. Tübke zeichnet sich im Alter von 28 Jahren, und vieles erinnert an Dürers „Selbstportrait im Alter von 26 Jahren“ von 1498, das heute im Prado hängt. Wie der junge RenaissanceKünstler, legt auch Tübke seinen Arm locker auf eine Brüstung und schafft so einen klaren Übergang zwischen Bildraum und Betrachterraum – eine typische Pose autonomer Selbstportraits, die ab ca. 1500 von zahlreichen Künstlern wie Raphael und Rembrandt adaptiert wurde. Der Ausdruck von künstlerischem Selbstbewusstsein scheint auch bei Tübke maßgeblich zu sein. In intensiver Selbstbeobachtung betrachtet er sich vor dem Spiegel und betont beim Zeichnen vor allem die kraftvollen Konturen, während er die Plastizität vor allem im Gesicht mit feinen, teils expressiv nervösen Linien modelliert. Ein Auge bleibt dabei nahezu komplett verschattet. Der Umraum wird durch Kratzspuren auf der Papieroberfläche und Verwischungen, die wie Korrekturen wirken, diffus angedeutet. Die Hände, etwas unbeholfen verschränkt und in verzerrter Anatomie wieder
gegeben, unterstreichen die Expressivität der Zeichnung und betonen die psychologische Tiefe des Portraits. Selbstbildnisse bilden einen großen Bestandteil im Œuvre des Künstlers. Insgesamt schuf er annähernd 200 in verschiedenen Techniken, von seiner Jugend bis ins hohe Alter. Unsere Zeichnung ist ein wunderbares Beispiel für die Verbindung von Tübkes akademisch geschulter Zeichenfertigkeit mit einem tiefen persönlichen Ausdruck.
Provenienz:
Galerie PelsLeusden, Berlin (vom Künstler erworben) Sammlung Bernd Schulz, Berlin Grisebach Berlin, Auktion 296, 26.10.2018, Lot 299 Privatsammlung Berlin
Ausstellung:
Werner Tübke. Zeichnungen 19531981, Graphisches Kabinett der Galerie PelsLeusden, Berlin 1981, Kat.Nr. 30, mit Abb. (und falscher Maßangabe)
Zeichnung heute. Meister der Zeichnung. Denes, Gäfgen, Tübke, UFan, Kunsthalle Nürnberg und Musée Cantonal des Beaux Arts, Lausanne 1982/83, Kat.Nr. 2, Abb. S. 84
Zeitspiegel II 19451986, Galerie PelsLeusden und Villa Grisebach, Berlin 1986, S. 46/47, mit Abb. Musen, Maler und Modelle, Galerie PelsLeusden, Kampen 1996, Kat.Nr. 115, S. 78 Kunst Handel Leidenschaft. 50 Jahre Galerie PelsLeusden, Berlin u.a. 2000, S. 116/169, Abb. S. 117/169 Werner Tübke. Meisterblätter, Stiftung SchleswigHolsteinische Landesmuseen Schloss Gottdorf u.a., 2004/05, Taf. 1, Abb. S. 31

günter richter
(1933 Meißen, lebt in Leipzig)
7170 Zitronenstilleben
Öl auf Hartfaser. 1968.
40 x 52,5 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Weiß monogrammiert „R.“.
2.000 €
Charakteristische frühe Arbeit Richters. In der zeichnerisch linearen Wiedergabe von Richters Gegenstandswelt nutzt er in seinem frühen Schaffen bewusst die Tradition der Neuen Sachlichkeit der Leipziger Schule, nimmt aber auch formale Elemente des Surrealismus auf, später auch des Fotorealismus zur Verdichtung der Bildaussage. Der Künstler, ausgebildet als Porzellangestalter in Meißen, studierte 195358 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und ist einer der Mitbegründer der Leipziger Schule. Seine Werke sind in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten, u.a. in den Staatlichen und Städtischen Museen von Altenburg, Gera, Erfurt, Halle, Meinigen, Cottbus, Dresden, Leipzig und der Nationalgalerie Berlin.
Provenienz: Privatbesitz Sachsen
jörg immendorff
(1945 Bleckede – 2007 Düsseldorf)
7171 „Für dunkle Tage“
Bronze mit brauner Patina, auf Granitsockel montiert. 1968/2003.
38,5 x 14 x 6,7 cm.
Verso am Sockel unten signiert (gestempelt) „Immendorff“ sowie mit dem Gießerstempel „Schmäke Düsseldorf“, am Sockel vorne betitelt. Auflage 65 num. Ex.
3.000 €

Die Raupe als Sinnbild der Metamorphose, des Übergangs zum Schmetterling und damit ein Zeichen der Hoffnung wandert den Stiel empor zur Blüte, die wiederum mit symbolhaften Zeichen geschmückt ist. Den Entwurf für die Bronze schuf Jörg Immendorff 1968 in einer Phase tiefer Depression, die Auflage wurde 2003 zugunsten der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ gegossen. Prachtvoller Guss mit schöner, gleichmäßiger Patina. Gesamthöhe mit Sockel: 43 cm.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

7172
hans platschek (1923–2000, Berlin)
7172 „JORGE“ Öl auf Leinwand. Wohl um 1950-53. 95,5 x 59 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Platschek“, oben rechts betitelt.
4.000 €
Mit unruhigem, pastosem Duktus modelliert Platschek lebendig differenzierte, vielfach plastisch ausformulierte Strukturen auf dem Malgrund, die er dann mit dem Pinselstiel einritzt, übermalt und gestaltet. Hans Platschek, einer der Protagonisten des Informel, Maler, Kunstkritiker und Schriftsteller, war 1939 mit seinen Eltern nach Uruguay emigriert und hatte dort an der Kunsthoch
schule von Montevideo studiert. Er entwickelte hier seine abstrakte, frühe Bildsprache mit schwarzen Lineamenten auf malerischem Grund. 1953 kehrte er zurück nach Europa und lebte hier u.a. in Rom, London, München, Paris; hier lernte Platschek Max Ernst, Raoul Hausmann, Tristan Tzara, Hans Arp und Asger Jorn kennen. In der Münchner Galerie van de Loo hatte er 1957 die erste Einzelausstellung. Seine Stilvielfalt sah er selber nur als einen scheinbaren Widerspruch und war wie Francis Picabia der Meinung, ein Künstler müsse Stile durchqueren wie der Nomade Länder und Städte.
Provenienz: Castells & Castells, Montevideo, Auktion 12.01.2012, Lot 73 Privatbesitz Süddeutschland

reinhold koehler (1919 Dortmund –1970 Siegen)
7173 Figur im Feld (Contre Collage) Glasbruchstücke, Papier und Zeitungsausschnitte, teils mit schwarzer Farbe unterlaufen, montiert auf Leinwand. 1965. 19,1 x 17,5 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz unleserlich signiert und datiert, verso auf der Leinwand mit dem schwarzen Nachlaßstempel, auf dem Keilrahmen mit Bleistift bezeichnet „CONTRE COLLAGE“ sowie mit zwei typographisch bezeichneten Klebeetiketten.
2.000 €
Reizvolle, mit der schneckenförmig aufgebrochenen Glasscheibe bewusst komponierte Arbeit aus der Serie der Contre Collagen. Koehler nutzt eine rückseitig mit weißem Papier und Zeitungsfetzen beklebte Fensterglasscheibe, die er bewusst zertrümmert und in das Netz aus Rissen schwarze Farbe fließen lässt. In Dortmund geboren, bildete sich Koehler während des Zweiten Weltkrieges autodidaktisch im Malen und Schreiben und gilt heute als experimenteller Maler, Graphiker, Objektkünstler und Lyriker mit Schwerpunkt auf Materialbildern, die stets eine haptische Komponente haben und ertastbar sind.
franz radziwill (1895 Strohausen – 1983 Wilhelmshaven)
7174 Bildnis des Schauspielers Aubin (Alain Toubas) Öl auf Leinwand, kaschiert auf Malpappe. 1969. 62 x 53 cm.
Unten links mit Pinsel in Rotbraun signiert „Franz Radziwill“, verso mit Pinsel in Rotbraun bezeichnet „603“. Schulze 807.
15.000 €
Ein junger Mann mit dunklem Haar, rotem Jackett und gestreifter Krawatte blickt den Betrachter mit ernster Miene frontal an. Auf dem Fensterbrett links hinter ihm liegen zwei Bücher – oder schweben sie vielmehr? Der Blick aus dem Fenster wird durch ein südländisches Wohnhaus unter einem vom Vollmond erhellten Nachthimmel aufgefangen. Franz Radziwills Frühwerk war, angelehnt an den Stil der BrückeKünstler, noch sehr vom Expressionismus geprägt. Doch bekannt wurde er mit seinen sachlichen Industrielandschaften und Endzeitszenarien des Magischen Realismus, einer Form der Neuen Sachlichkeit mit surrealistischen Anklängen, inspiriert durch Giorgio de Chirico und die Pittura Metafisica. Die meisten seiner Bildnisse hatte er sehr früh, bereits in den 1920er Jahren, beeinflusst durch Portraits der Renaissance, gemalt. Bei unserem Portrait handelt es sich um ein spätes Auftragswerk des Jahres 1969, wie Recherchen hierzu anlässlich der Ausstellung „Familie. Freunde. Fremde.“ im FranzRadziwillHaus im Herbst 2022 ergaben. Der italienische Galerist Emilio Bertonati, der sich
sehr um Radziwills Werk bemühte, vermittelte den Kontakt zu dem bedeutenden Mailänder Schriftsteller, Kunstkritiker und Dramatiker Giovanni Testori. Dieser beauftragte Radziwill mit mehreren Portraits zu derselben Person: seinem französischen Lebensgefährten Alain Toubas (19382021), der nach Italien gezogen war und dort Schauspieler wurde. Beeinflusst von Testoris Arbeit als Kunstkritiker, eröffnete Toubas in Mailand eine eigene Galerie und beide bauten eine große Kunstsammlung auf. Das formatfüllende Portrait wurde sorgsam, mit akribischfeinem Pinselstrich gemalt. Nüchtern, in neusachlicher Malweise sind die Farben akkurat und in gedeckter Farbpalette sorgfältig ausgewählt und nebeneinandergesetzt. Da der Dargestellte nicht Portrait sitzen konnte, verwendete Radziwill mehrere Fotos als Vorlage. Dies lässt sich an dem unterschiedlichen Blickwinkel auf Nase und Mund erkennen. (Vgl. radziwill.de, Zugriff 14.10.2025).
Provenienz: Privatbesitz Mailand Privatbesitz Bremen Grisebach, Berlin, Auktion 41, 26.11.1994, Lot 207 (verso mit dem Auktionsetikett) Privatsammlung Berlin
Ausstellung: Familie. Freunde. Fremde. Bilder vom Menschen, FranzRadziwillHaus, Dangast 202223
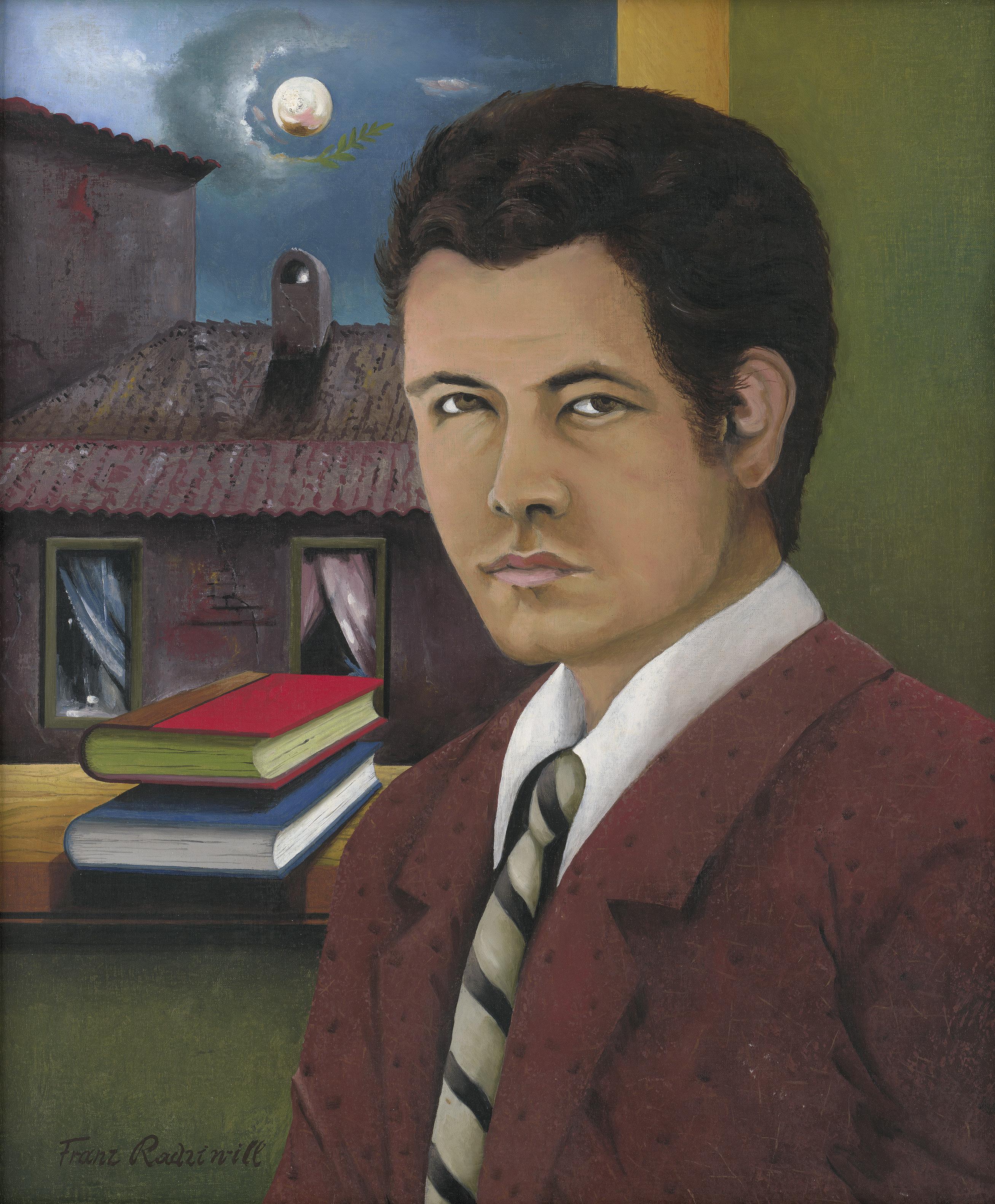
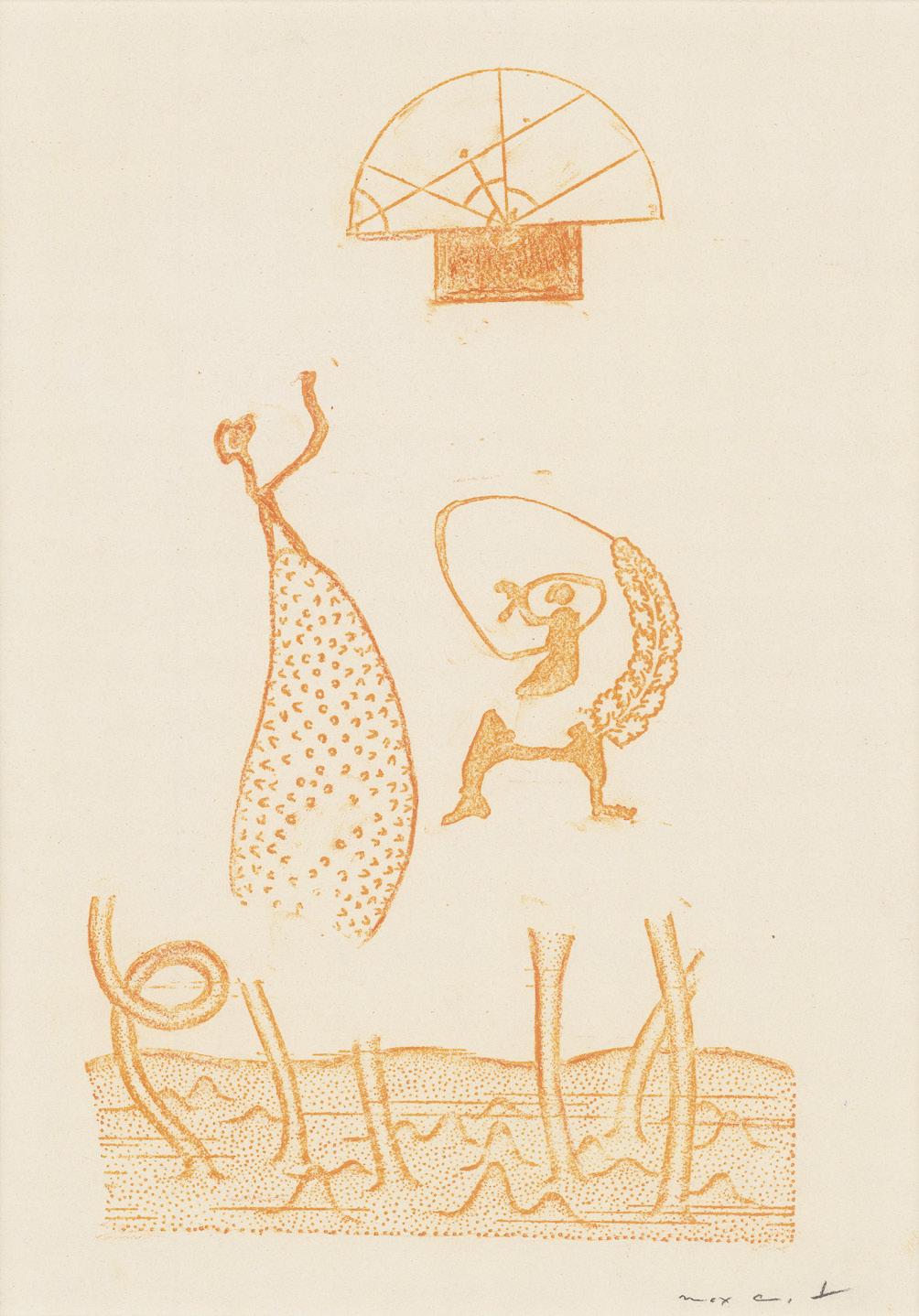
max ernst (1891 Brühl bei Bonn – 1976 Paris)
7175 Zu: Lewis Carrolls Wunderhorn III Farbige Frottage, Farbstift in Orange auf Arches-Velin. 1969.
33,6 x 24,8 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „max ernst“. Spies/Metken/Pech 4530.
9.000 €
Lewis Carrolls surreale, märchenhafte Erzählungen inspirierten immer wieder die surrealistischen Künstler und übten einen großen Einfluss auf Max Ernst aus. Seine bizarre, charakteristische Frottage ist eine vorbereitende Studie zu Blatt III, Seite 9 der Illustrationen zu Lewis Carrolls Wunderhorn; etwas früher als die Lithographie entstanden, zeigt sie das komplette Motiv in Gelborange. Die endgültige Lithographie wurde 1970 schließlich in Blau, Rot und Gelb gedruckt, das Buch mit 36 Farblithographien und Texten von Max Ernst und Werner Spies erschien bei der Manus Presse, Stuttgart. Die ebenso ironischhumorvollen wie poetischen Lithographien stellen eine Hommage an die Logik des Mathematikers und Schriftstellers Carroll dar. Ganz in seinem Sinne lassen Max Ernsts
Ausstellung: Max Ernst, Frottages, lithographies, originaux pour Wunderhorn de Lewis Carroll, Galerie Alphonse Chave, Vence 1970 7175
Zeichen und Symbole keine unmittelbare Erkenntnis zu, sondern müssen erst entschlüsselt werden. Das Motiv griff Max Ernst etwas später, 1972, nochmals auf, vgl. Blatt 14 aus der Serie „Lithographie surimprimée, Max Ernst sur Max Ernst“ von 1972, SpiesLeppien 240. Diese Lithographie stimmt außer im oberen Viertel mit der Darstellung der Frottage überein und wurde damals von Pierre Chave nur als Einzelexemplar gedruckt.
Provenienz: Alphonse Chave, Vence Galerie Arditti, Paris Galleria Tega, Mailand Calmels Cohen, Paris, Auktion 22.06.2006, Lot 183 Privatsammlung Frankreich Sotheby‘s, London, Auktion 06.02.2008, Lot 146 Privatsammlung Rheinland
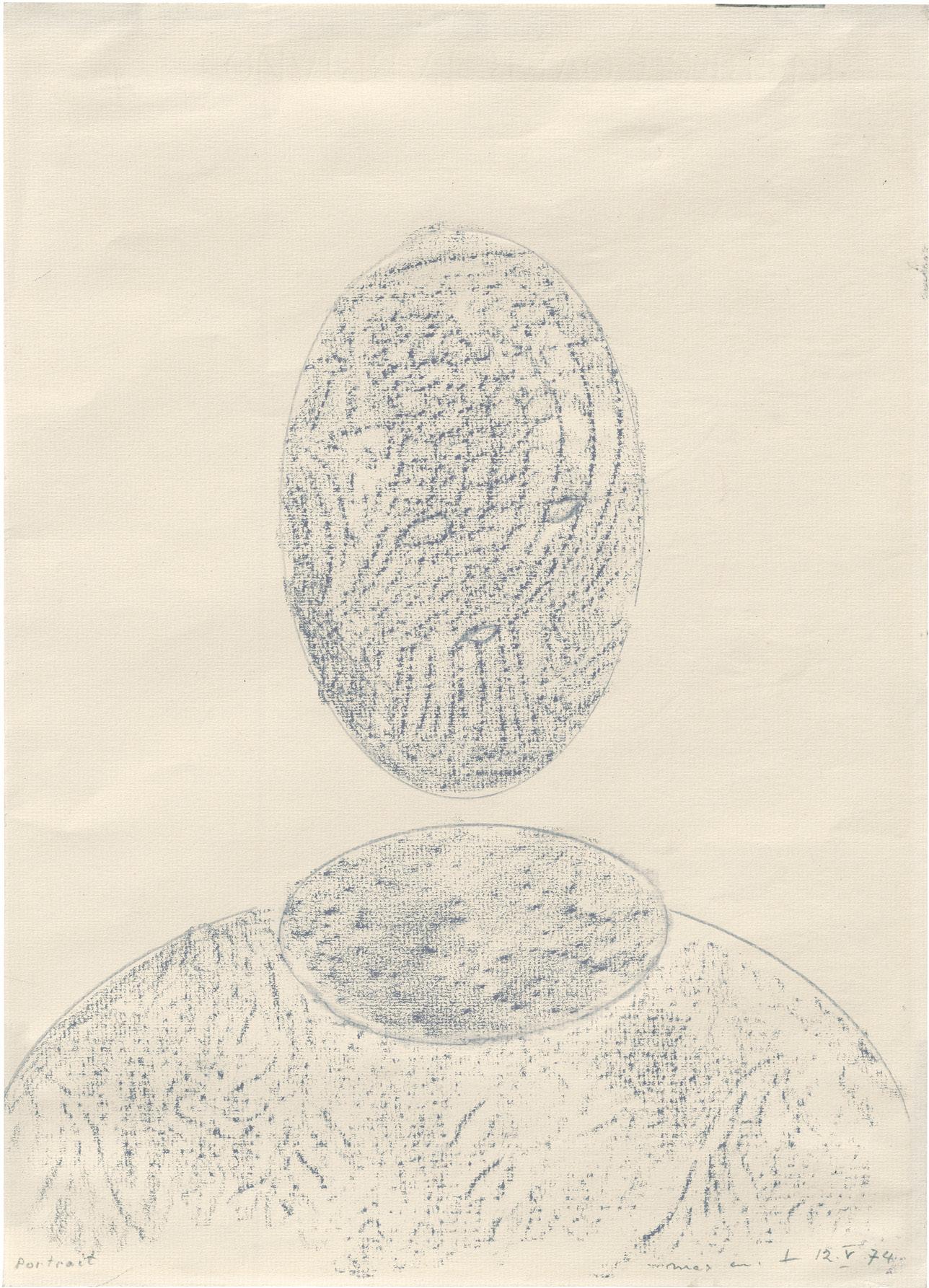
7176
max ernst
7176 „Portrait“
Frottage und Bleistift auf Bütten. 1974. 32 x 22,9 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „max ernst“ und datiert, unten links betitelt.
12.000 €
Innerhalb der Klarheit der elegant und sicher geschwungenen Konturlinien entfaltet sich eine feinsinnig gestaltete phantastische Welt verborgener Strukturen und lediglich zu ahnender Materialien. Innerhalb der schwebenden Kopfform lässt der Zufall
tatsächlich ein angedeutetes Gesicht entstehen. Als bildnerisches Äquivalent zur Écriture automatique erfand Ernst ab 1925 neue Techniken in der Malerei und Graphik, darunter die Frottage, die eine vorhandene Struktur mittels Durchpausens mit Bleistift oder farbigen Kreiden auf Papier überträgt. So integriert er das Element des Zufalls in seinen Schaffensprozess. Das Blatt ist Werner Spies, Paris, bekannt.
Provenienz: Galeria Trece, Barcelona Sotheby‘s, London, Auktion 09.02.2005, Lot 360 Privatbesitz Rheinland
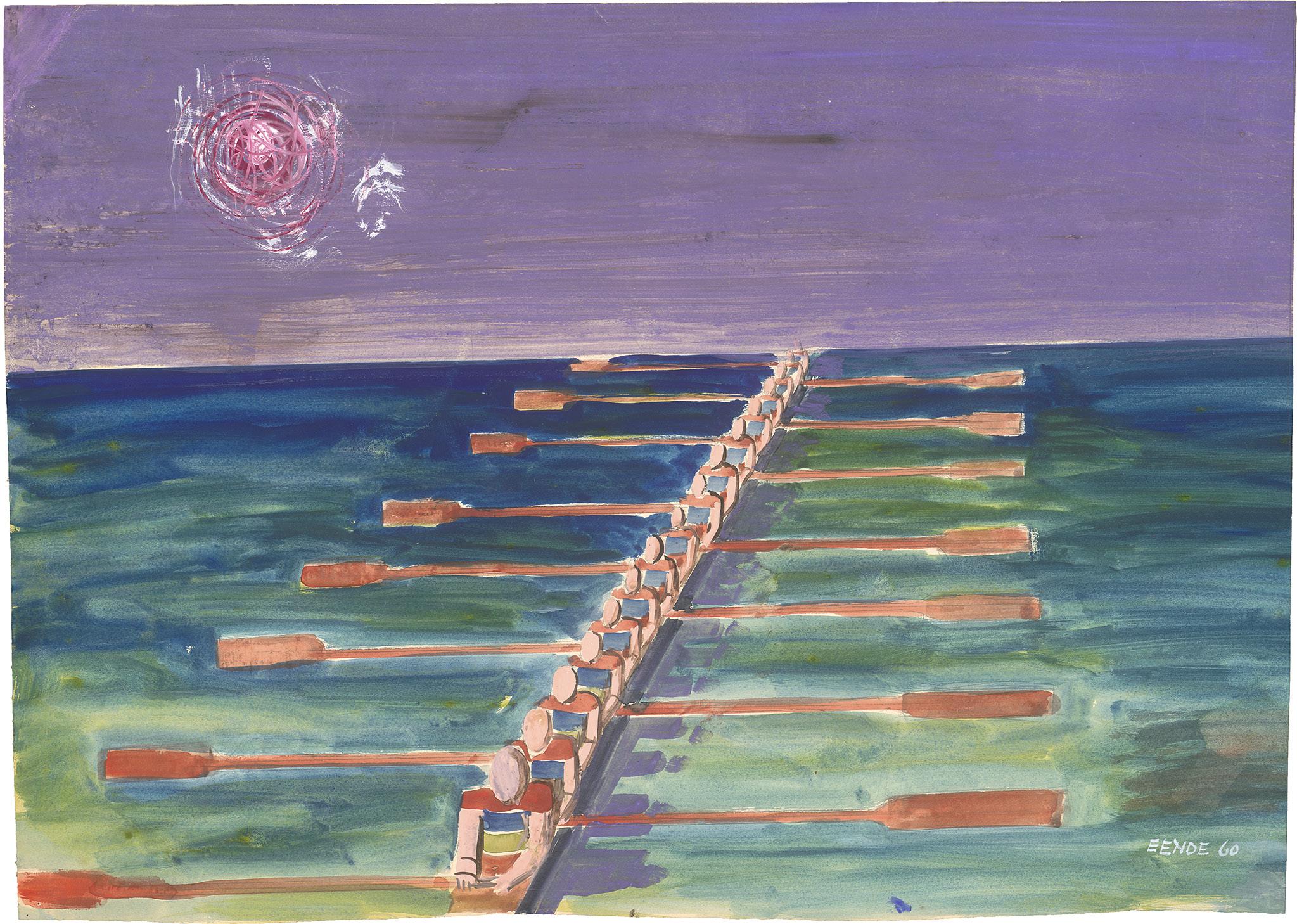
7177
edgar ende (1901 Hamburg – 1965 München)
7177 Die Ruderer Gouache auf Aquarellpapier. 1960. 49,5 x 68,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Weiß signiert „EENDE“ und datiert, verso (von fremder Hand / Lotte Schlegel?) mit Kugelschreiber in Schwarz betitelt und bezeichnet „Schlegel 9“. Murken GO 115.
1.500 €
Wie das Ergebnis einer inneren Vision scheint die dicht komponierte, phantastische und farbintensive Gouache. Sie ist, wie das
Werk des Künstlers insgesamt, der visionären Kunst zuzuordnen, mit einer Nähe zum Magischen Realismus und zur Neuen Sachlichkeit. „Für Edgar Ende waren seine Bilder ‚prälogisch‘, wie er es selbst nannte. Sie stammten für ihn aus einer Schicht des Bewußtseins, das vor dem Gedanken existiert: Edgar Endes Malerei stellt keine Auseinandersetzung mit der realen Welt und ihren kulturellen, sozialen oder historisch bedingten Strukturen dar, sondern ein Eindringen in den Kosmos geistiger Welten.“ (edgarende.de, Zugriff 15.09.2025).
Provenienz: Privatsammlung Ulm Privatbesitz NordrheinWestfalen

georges spiro (1909 Warschau – 1994 Nizza)
7178 Complainte lointaine Öl auf Leinwand. Um 1968. 61 x 50 cm.
Unten links mit Pinsel in Hellgrau signiert „Spiro“, verso auf dem Keilrahmen mit Faserschreiber in Rot (von fremder Hand?) betitelt und bezeichnet „S20“ sowie „12 F“. 1.200 €
Schlank erhebt sich die monumentale Frauenbüste aus spitzen Felsbrocken inmitten der endlos weiten Ebene. Surrealistische Elemente umgeben die phantastische Gestalt in der blautonigen Landschaft. Mit subtilen Farbabstufungen, plastischer Delikatesse und akribischer Feinheit umgesetzt, entfaltet die Szenerie einen für Spiro charakteristischen skurrilen Reiz. Der an der Wie
ner Kunstgewerbeschule ausgebildete Künstler war zunächst Journalist, Autor und Spielzeughersteller, widmete sich jedoch nach seiner Flucht aus dem besetzten Österreich nach Frankreich zunehmend der Malerei. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg verkaufte Spiro auf seiner ersten, äußerst erfolgreichen Ausstellung in der L’Arcade Gallery, London, fast alle Werke und lebte nun ausschließlich von seiner Malerei. Georges Spiro verband eine langjährige Freundschaft mit Jean Cocteau.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
Literatur: Axel Hinrich Murken, Phantastische Welten. Vom Surrealismus zum Neosymbolismus, Ausst.Kat. Kunsthalle Jesuitenkirche, Aschaffenburg u.a. 2009, S. 122, Nr. 10

august wilhelm dressler
(1886 Bergesgrün/Böhmen – 1970 Berlin)
7179 „Der Traum der Tänzerin“ Öl auf Leinwand. Um 1965.
50 x 60 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz mit dem Künstlersignet, unten links mit Pinsel in Braun betitelt, verso mit Pinsel in Schwarz signiert „August Wilhelm Dreßler“, nochmals betitelt, bezeichnet „gewachst“ und mit Pinsel in Rot „129“.
3.000 €
Auf weiche weiße Kissen gebettet, träumt sich die Tänzerin in eine phantastischsurreale Welt, in der hinter ihr Land und Wasser ineinander verschwimmen. Das blühende, rosa überhauchte Inkarnat steht in spannungsreichem Gegensatz zu der makellosen Plastizität, die die junge Frau starr wie eine Schaufensterpuppe
wirken lässt, wie es charakteristisch für Dresslers Bildfiguren ist. In seinem Spätwerk finden sich zunehmend Sujets aus vielfach artistischen Randgruppen der Gesellschaft, wie Revuegirls, Gaukler, Balletteusen und Artisten. Dressler, einer der stilprägenden Vertreter der Neuen Sachlichkeit, studierte 1906 13 an den Akademien in Dresden und Leipzig. Anschließend zog er als freischaffender Künstler nach Berlin und schloss sich der Novembergruppe an. 1924 wurde Dressler Mitglied der Berliner Sezession.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
Ausstellung: Deutscher Künstlerbund, 14. Ausstellung, Essen 1966 (mit deren Klebeetikett auf der Keilrahmenrückseite, dort bezeichnet und betitelt)

7180
marwan
(d.i. Marwan Kassab Bashi, 1934 Damaskus – 2016 Berlin)
7180 Umarmung
Aquarell über Bleistift auf festem Velin. 1967. 69,5 x 55,8 cm.
Unten rechts mit Kugelschreiber in Blau signiert „MARWAN“ und datiert.
4.000 €
Mit schonungsloser Direktheit und expressivvirtuosen Pinselstrichen schildert Marwan ein sich umarmendes Paar. Die Farbgebung ist Ton in Ton gehalten, der Umraum wirkt seltsam leer. Die schlanke Frau reicht gerade bis zur Brust des frontal gezeigten Mannes und wirkt in der Umarmung lieblos eingequetscht, während ihr Kopf surreal verformt erscheint. Im selben Jahr verarbeitet Marwan das rätselhafte Motiv nahezu identisch auch in einer seiner frühesten Druckgraphiken (vgl. Merkert 95). Die Darstellung gehört zu einem frühen Werkkomplex, der zahlreiche Figuren und Paarbilder umfasst und den Marwan Mitte der 1960er
Jahre begann. Sie sind geprägt von surrealen Verstörungen und bündeln, so Jörn Merkert, „wie in einem Fokus den Seelenzustand einer Gesellschaft, für den in ironischer Brechung als Darstellungsmittel genau die Absurdität und scheinbare Irrealität eingesetzt werden, die eben dieser Gesellschaft selbst zu eigen sind“ (Jörn Merkert, in: Pathetische Figuration, Marwan in der Galerie Springer 1967, Ausst.Kat. „Marwan. Ein syrischer Maler in Berlin. Werke in der Sammlung der Berlinischen Galerie“, Berlin 2001, S. 32 ). Erst wenige Jahre zuvor war der junge Syrer nach Berlin gekommen, wo er ab 1957 an der Hochschule für bildende Künste in der Klasse von Hann Trier studierte und bald zum Kreis um Georg Baselitz und Eugen Schönebeck gehörte. Gemeinsam lösten sie sich von der Abstraktion und fanden zurück zur menschlichen Figur, wofür der Kunsthistoriker Eberhard Roters den Begriff der „pathetischen Figuration“ prägte (Eberhard Roters, ebd., S. 20 f.).
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
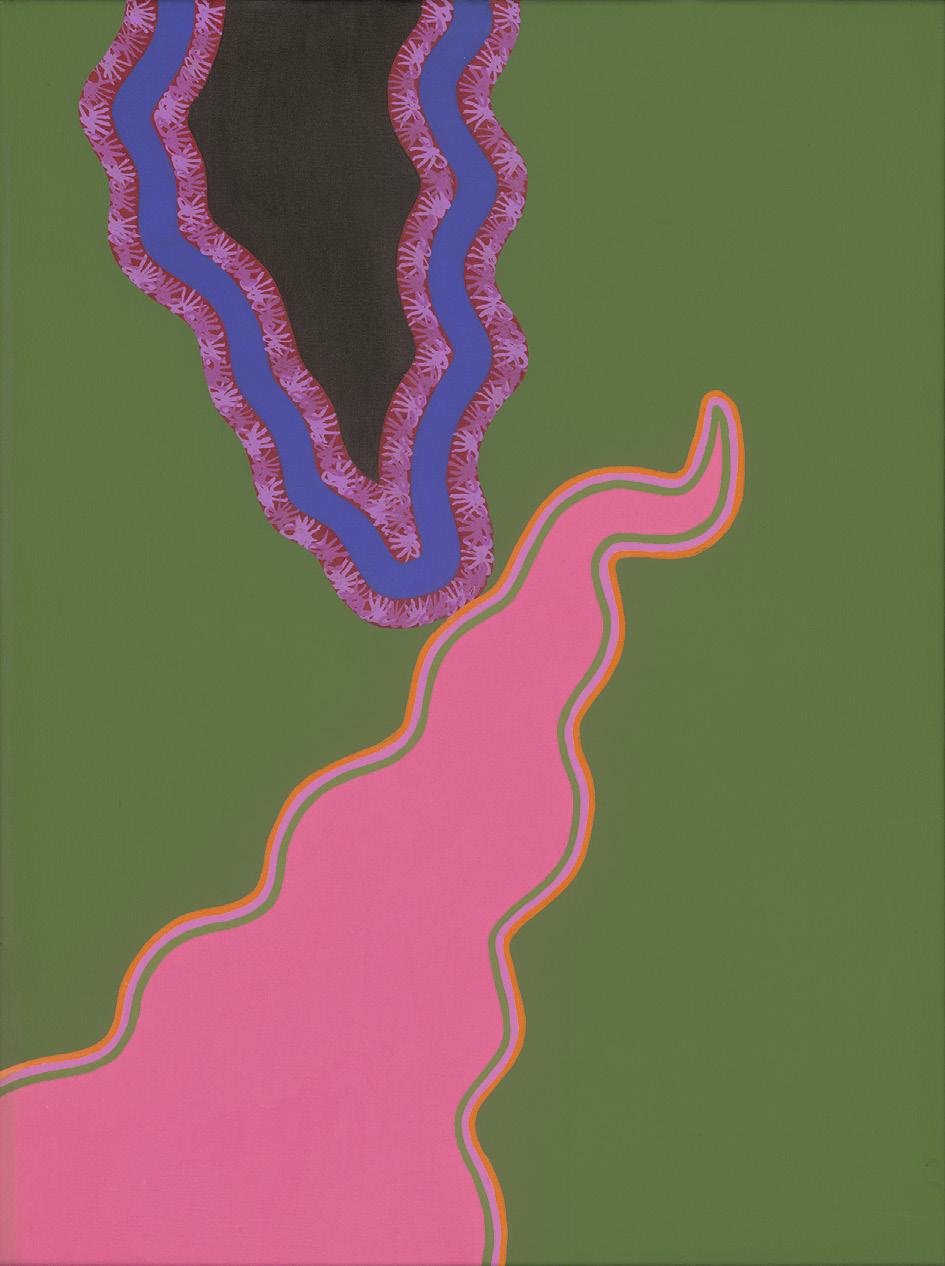
7181
rolf hans
(1938 Frankfurt a.M. – 1996 Basel)
7182 „weißrot“ Öl auf Leinwand. 1962. 69 x 58,3 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz (schwer lesbar) signier t „R Hans“ und datiert, verso mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert, datiert und betitelt.
1.500 €
Als Autodidakt beginnt Rolf Hans erst 1958 mit seiner malerischen Tätigkeit. In Anlehnung an den Tachismus entstehen bald die Werke seiner ersten Schaffensphase. Bis 1965 entwickelt er die sogenannte Werkgruppe der Fleckenbilder. Darin erforscht Hans die Ausdruckskraft von Farbe, Form und Material mittels organisch geformter Farbflächen („Flecken“). Die Stilmittel des Informel und seiner bekannten Vertreter beeinflussen diese Werkphase ebenso wie die Farbtheorien von Johann Wolfgang von Goethe, Philipp Otto Runge, Johannes Itten und Heinz Kreutz.
Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden
rolf-gunter dienst
(1942 Kiel – 2016 Baden-Baden)
7181 „Momentetagebuch 19.4.67 – Natascha S. not at 44 W 17, New York City, 34“ Acryl auf Leinwand. 1967.
120 x 90 cm.
Verso mit Pinsel in Rot signiert „R. G. Dienst“ und betitelt sowie mit Richtungspfeil.
900 €
Pulsierende amorphe Formen in leuchtender Tonalität auf intensiv grünem Grund setzen die Vitalität der Farbe als bestimmendes Element ins Zentrum der Komposition, während die vom Künstler erfundenen skripturalen Kürzel nur wie Ornamente am Rand der oberen Farbform auftreten. Das Gemälde entstand während Diensts Gastdozentur an der New York University, New York. Er lebte, malte und schrieb damals im legendären Chelsea Hotel, welches in jenen Jahren als Künstlerresidenz bekannt war. Vor allem aber besuchte er die Ateliers der New Yorker Pop ArtKünstler (vgl. Rolf Gunter Dienst. Mein Gedicht heißt Farbe, Köln 2016, S. 163).
Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 16.05.2020, Lot 395 Privatbesitz Süddeutschland

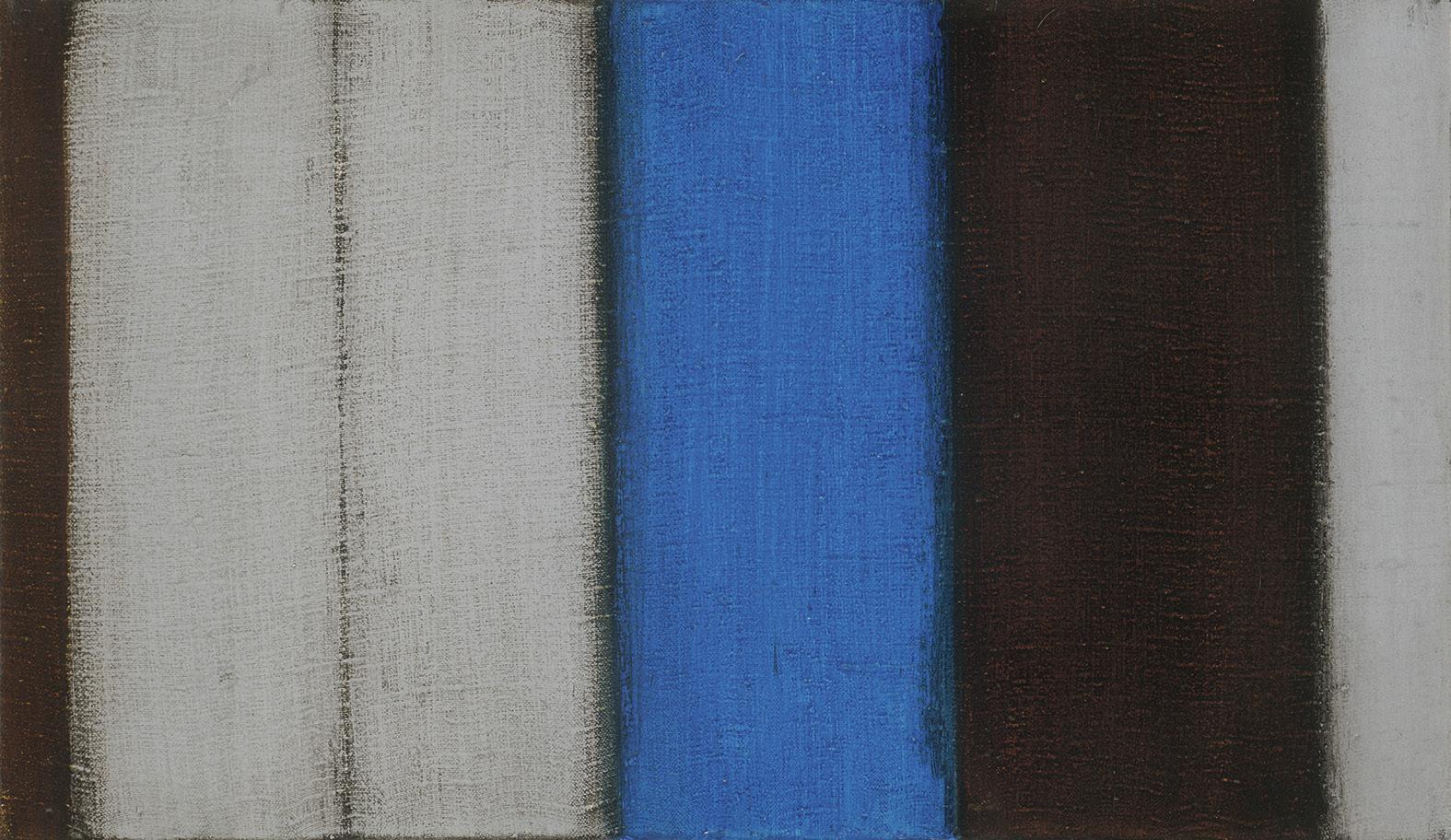
rolf hans
7183 „blaubraun grau“
Öl auf Leinwand. 1967.
33 x 56,3 cm.
Verso mit Pinsel in Schwarz signiert „R.Hans“, datiert und betitelt.
1.200 €
Durch die „Colourfield Paintings“ der amerikanischen Abstrakten Expressionisten wie Barnett Newman und Mark Rothko angeregt, wandte sich der Jazzmusiker, Maler, Fotograf, Objekt und Collagekünstler Rolf Hans ab 1966 von seinen vorherigen Fleckenfigurationen ab und schuf in den Jahren 1966 und 1967 seine abstrakten Streifenbilder, in dem Bestreben seine Bildsprache weiter auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Kraft der Farbe, zu einfachen Farbfeldern komprimiert, steht dabei im Vordergrund der Kompositionen.
Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden
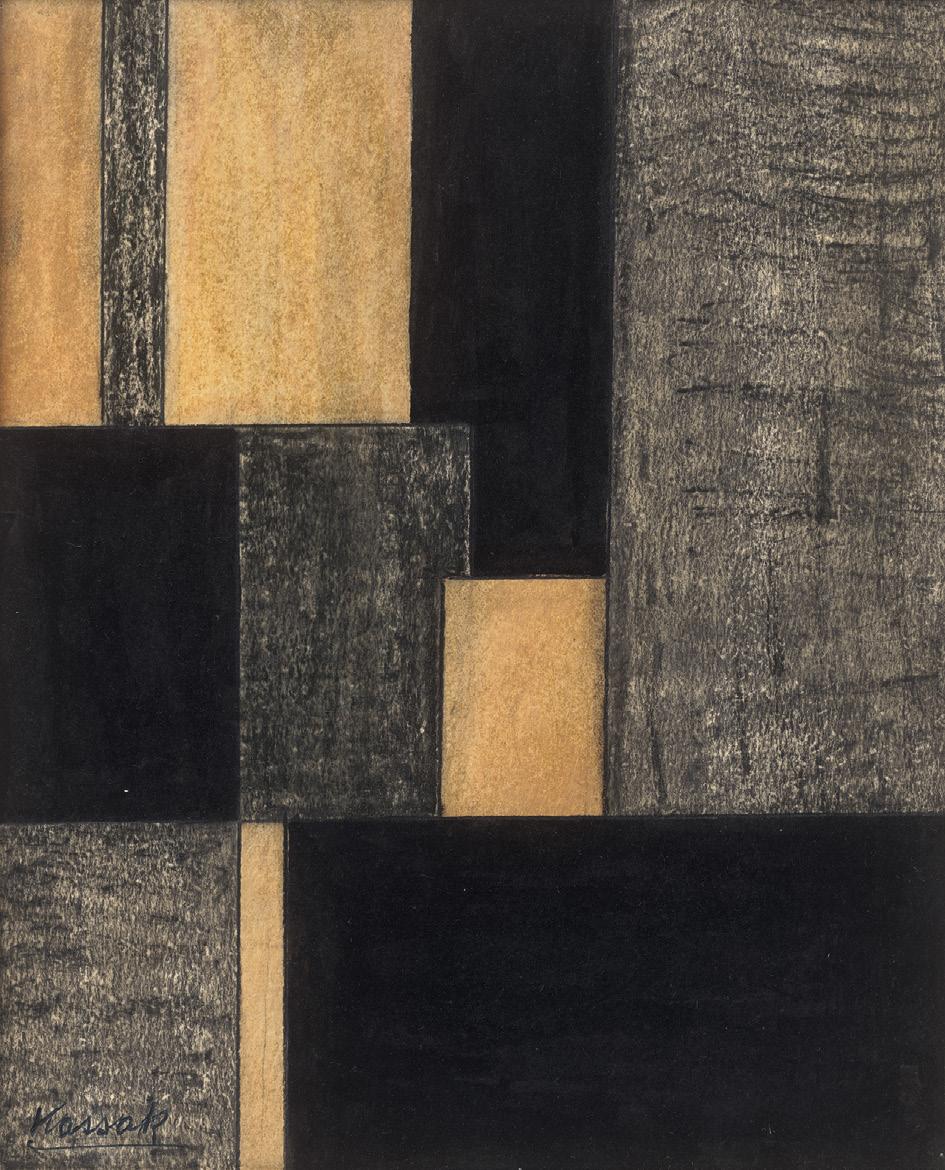
lajos kassák (1887 Érsekújvár – 1967 Budapest)
7184 Konstruktive Komposition
Kohle, Aquarell und Bleistift auf Velin, fest im Rahmen montiert. 1963.
Ca. 26 x 21,5 (Rahmenausschnitt).
Unten links mit Feder in Schwarz über Bleistift signiert „Kassak“.
2.000 €
Lajos Kassák gilt als wichtiger Vertreter der ungarischen Avantgarde. Geboren 1887 im heutigen Nové Zámky in der Slowakei, wuchs er in einfachen Verhältnissen auf und erlernte zunächst den Beruf des Schlossers. Früh jedoch wandte er sich als Autodidakt der Kunst zu. 1915 gründete er mit Emil Szittya die Zeitschrift „A Tett“ (Die Tat), die aufgrund ihrer politischen Ausrichtung verboten wurde. Schon 1916 setzte Kassák seine Tätigkeiten mit der Zeitschrift „Ma“ (Heute) fort, die sich zu einer zentralen Plattform für avantgardistische Strömungen wie Dadaismus, Expressionismus, Futurismus, Konstruktivismus und Kubismus entwickelte. Nach dem Zusammenbruch der Ungarischen Räterepublik emigrierte Kassák nach Wien, wo er unter dem Einfluss von László MoholyNagy seine konstruktivistische Phase einleitete. 1921 formulierte er in „Ma“ die theoretischen Grundlagen des ungarischen Konstruktivismus und prägte damit entscheidend dessen Entwicklung.
Provenienz:
Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 222, 02./04.06.1977, Lot 724
Privatbesitz Norddeutschland
Privatbesitz Hessen

nejad melih devrim
(1923 Istanbul – 1995 Nowy Sacz, Polen)
7185 Ohne Titel
Öl auf Leinwand. 1961.
27 x 35 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz signiert „nejad.“ und datiert, verso mit Pinsel in Lila nochmals signiert, datiert und unleserlich bezeichnet.
4.500 €
Nejad Melih Devrim, Sohn der Malerin Fahrelnissa Zeid, wurde 1923 auf der Insel Büyükada geboren. Zwischen 1941 und 1945 studierte er an der Istanbuler Akademie der Schönen Künste bei Léopold Lévy. 1946 ging er nach Paris. Er gilt als international anerkannter Maler des lyrischen Abstraktionismus. In der Pariser Kunstszene nach 1945 konnte er sich einen Platz innerhalb der sogenannten „Pariser Schule“ sichern. Devrim entwickelte einen eigenen Stil, der auf seiner Auseinandersetzung mit der osmanischen Kunst und Kalligraphie sowie mit byzantinischen Mosaiken und Symbolen in der Hagia Sophia und im ChoraMuseum in Istanbul beruhte. Durch eine lineare Rhythmik und den gezielten Einsatz von Farbwerten suchte er nach Lösungen für die bildnerischen Herausforderungen in der Malerei.
Provenienz: Privatbesitz Kopenhagen
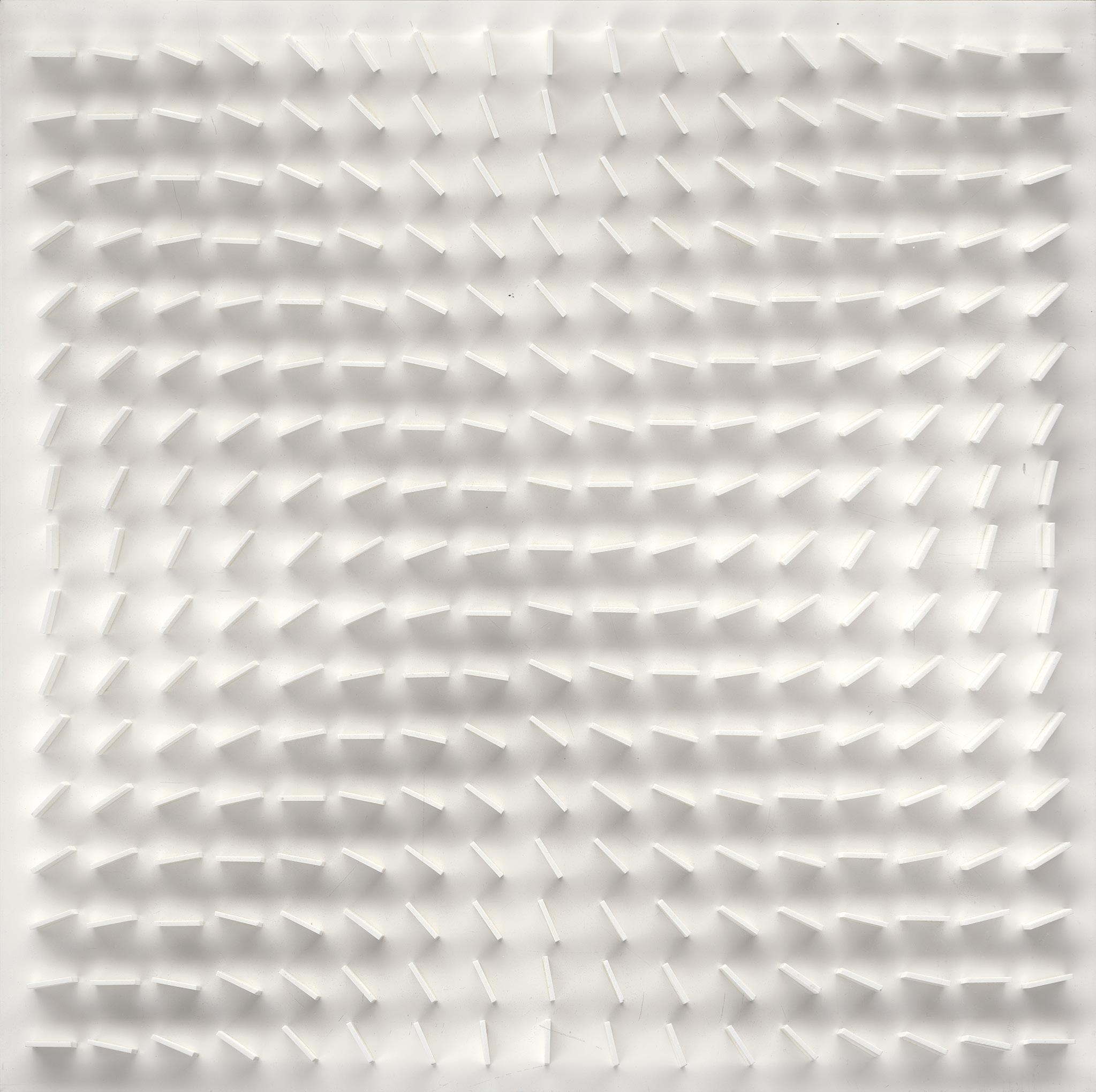
hartmut böhm
(1938 Kassel – 2021 Berlin)
7186 Quadratrelief 11,25° Schrägkreuz (Aus: Visuell veränderliche Struktur)
Plexiglasrelief in Orig.-Plexiglaskasten. 1966/68. 45 x 45 x 4 cm.
Rückseitig auf dem Plexiglaskasten auf Klebeetikett signiert, dort mit typographischen Editionsangaben. Auflage 30 num. Ex. 4.000 €
Mathematischgeometrische Grundprinzipien bestimmen Böhms konstruktive Arbeiten. Die Strenge des weißen Plexiglases bereichert er um eine geradezu poetische Bewegtheit, die durch das Relief zieht. So steht die rationale Klarheit einer ausgeprägten sinnlichen Anmutung und ästhetischen Wirkung gegenüber. Sehr schönes Exemplar im originalen Objektkasten des Künstlers.

otto piene
(1928 Laasphe/Westfalen – 2014 Berlin)
7187 Ohne Titel
Gouache, Mischtechnik und Feuerspuren auf Velin. 1966.
50 x 70 cm.
Oben rechts mit Bleistift signiert „OPiene“ (ligiert) und datiert.
6.000 €
Charakteristische Feuergouache von wunderbar intensiver Farbigkeit. Piene verwendete für diese besondere Technik unterschiedlichste Materialien wie Papier, Leinwand oder Metallplatten, die er mit einer speziellen Mischung aus Pigmenten und Bindemitteln präparierte. Anschließend entzündete er das Material, um
den gewünschten Effekt von Feuer und Rauch zu erzielen. Die Farben und Texturen, die durch das Verbrennen der Pigmente entstanden, waren unvorhersehbar, der Entstehungsprozess damit immer zu einem guten Teil unberechenbar. Das Feuer als Element der Transformation und des Wandels faszinierte Piene, der seine Feuergouachen als eine Art Performance ansah, bei der das Feuer als kreativer Partner fungierte.
Provenienz:
Sammlung Marisa PerretRezzonico, Genf Sotheby‘s, OnlineAuktion Swiss Fine Art, 05.12.12.2023, Lot 80 Privatbesitz Süddeutschland
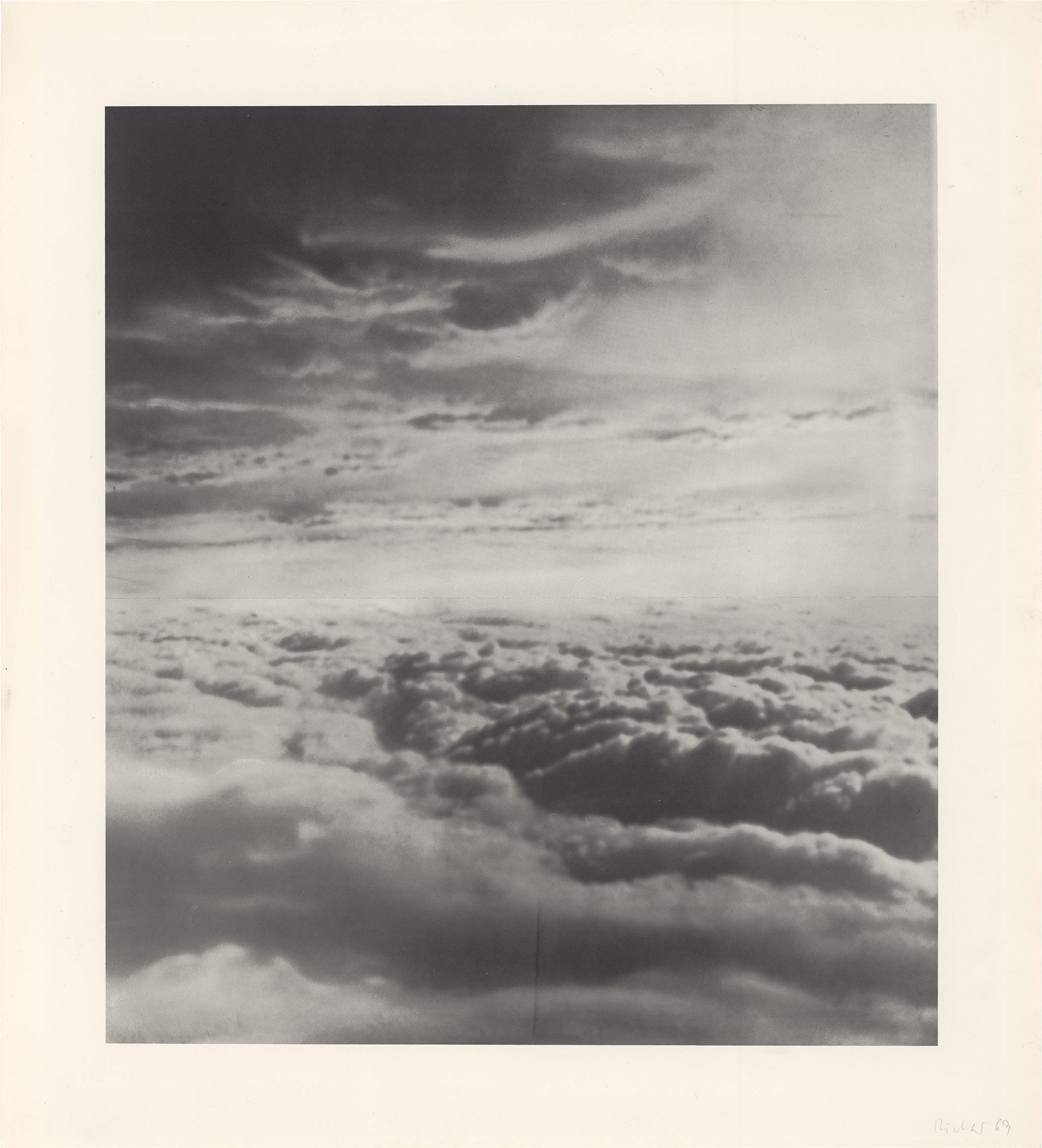
gerhard richter (1932 Dresden, lebt in Köln)
7188 Wolken
Offset auf weißem Halbkarton. 1969. 44,9 x 40 cm (55 x 50 cm).
Signiert „Richter“ und datiert. Butin 24.
6.000 €
Nach einer Montage von eigenen Fotografien, die Richter auf einer Flugreise aus dem Fenster aufgenommen hatte. Das obere Himmelsmotiv wurde um 180° gedreht. Die Arbeit war Richters Beitrag zur 1970 herausgegebenen Mappe der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, die Arbeiten von allen damaligen Dozenten der Hochschule enthält. Herausgegeben von der GriffelkunstVereinigung, Hamburg, ohne den Stempel verso. Die Blattmaße wie häufig abweichend von den Angaben bei Butin. Prachtvoller Druck mit Rand.

leo erb
(1923 St. Ingbert – 2012 Kaiserslautern)
7189 Linienbild
Papierschnitt in Holzkasten unter Glas. 1974.
32,2 x 3,2, x 6 cm.
An der Unterkante rechts sowie verso auf der Kastenrückseite oben rechts mit Bleistift signiert „erb“, dort zudem datiert und links gewidmet, nochmals signiert und (später) datiert „1980“.
1.200 €
Die Stege im Papierblock verleihen dem Linienbild mit ihrer samtigwattigen Erscheinung einen intensiv stofflichen Charakter. Leo Erbs Gesamtwerk ist von zwei Elementen bestimmt, die zu seiner „Handschrift“ wurden und ihm zu internationalem Erfolg verhalfen: die Farbe Weiß und die Linie. Seit 1947 fertigte der saarländische Künstler seine ersten linearen Papierschnitte und Linienzeichnungen. In Saarbrücken studierte er bei Boris Kleint, einem Vertreter der Bauhauslehre, mit dem er später die „neue gruppe saar“ gründete. Sein künstlerisches Schaffen umfasst mehr als sechs Jahrzehnte, und viele seiner Arbeiten sind in nationalen und internationalen Museen und Galerien ausgestellt. 1977 nahm er an der 6. documenta in Kassel teil.
Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen
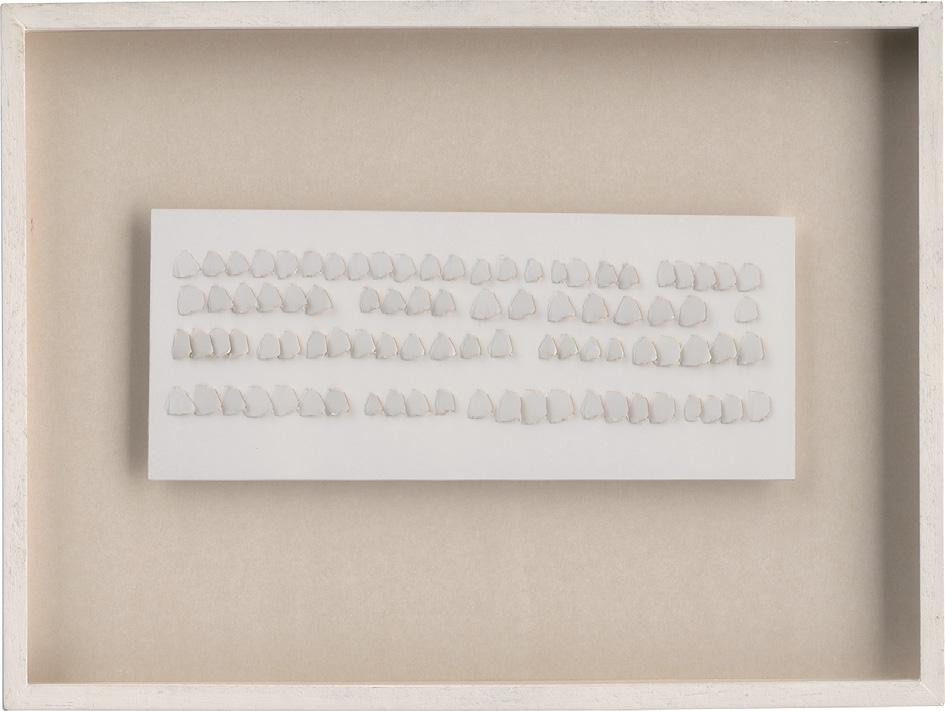
leo erb
7190 Ohne Titel
Kartonschnitt, in Holzkasten unter Glas montiert. 1983.
38,5 x 53,5 x 3 cm.
Unten rechts auf dem Unterlagekarton mit Bleistift signiert „erb“, unten links datiert.
900 €
Die Farbe Weiß bestimmt das Schaffen Erbs. „Dass Leo Erb bei der bewussten Reduzierung seiner Bildmittel ein solch beachtlicher Reichtum an schöpferischen Erfindungen gelang, beweist den hohen Rang seines Œuvres. (...) Seine durchdachte Entscheidung zur Genügsamkeit und Konzentration der Bildmittel, sein Verzicht auf unnötige, überflüssige Elemente schafft die bildliche Basis für eine innere Ausgeglichenheit, für Offenheit und Freiheit. So sind Erbs Werke über ihren ästhetischen Wert hinaus immer auch Anreiz zur Reflexion, nicht zuletzt über sich selbst.“ (Petra Wilhelmy, institut-aktuelle-kunst.de, Zugriff 01.09.2025).
Provenienz: Privatbesitz Nordrhein-Westfalen
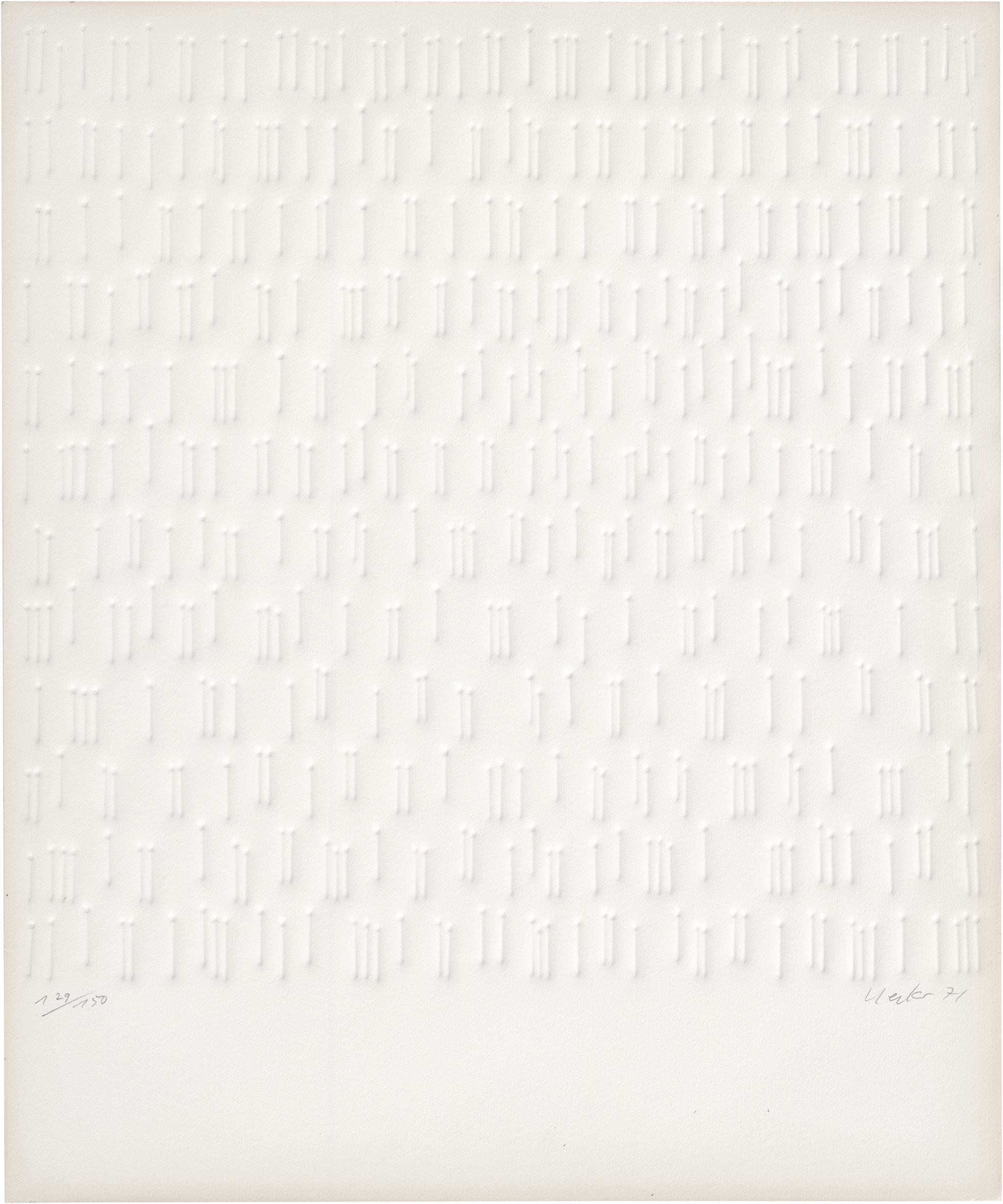
günther uecker
(1930 Wendorf/Mecklenburg – 2025 Düsseldorf)
7191 Ohne Titel
Prägedruck auf festem Velin. 1971.
48 x 48 cm (59,8 x 50 cm).
Signiert „Uecker“ und datiert. Auflage 150 num. Ex.
3.000 €
Prachtvoller, schön prägnanter Prägedruck dieser leicht bewegten Nagelreihung mit kleinem Rand
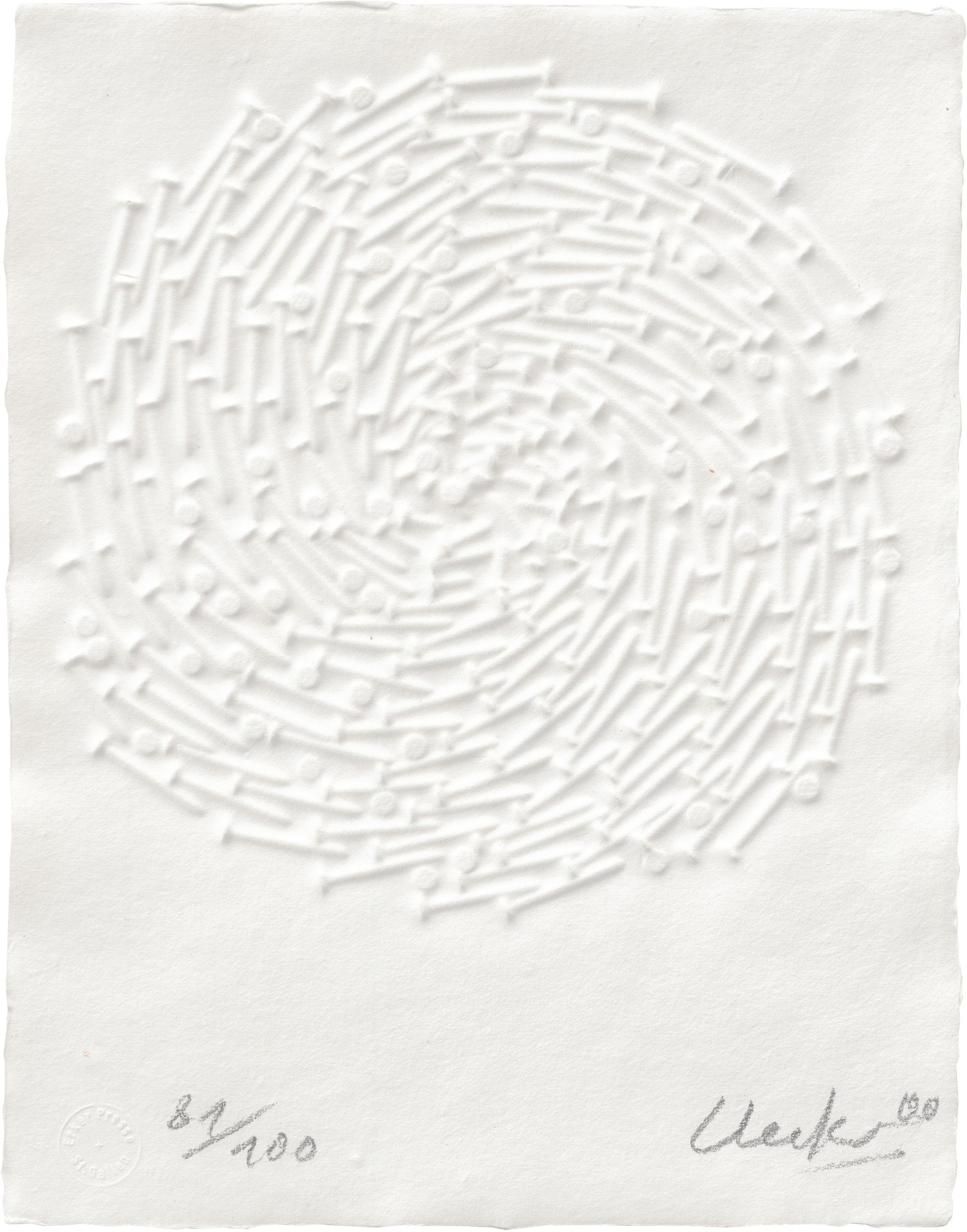
günther uecker
7192 Ohne Titel
Prägedruck auf handgeschöpftem Velin. 2000. 20,5 cm (Durchmesser) (29,3 x 23 cm).
Signiert „Uecker“ und datiert. Auflage 100 num. Ex. 5.000 €
Herausgegeben von der Erker Presse, St. Gallen, mit deren Blindstempel unten links. Prachtvoller, klarer Druck der kreisförmigen, als Spirale angelegten Komposition, mit dem vollen Schöpfrand.
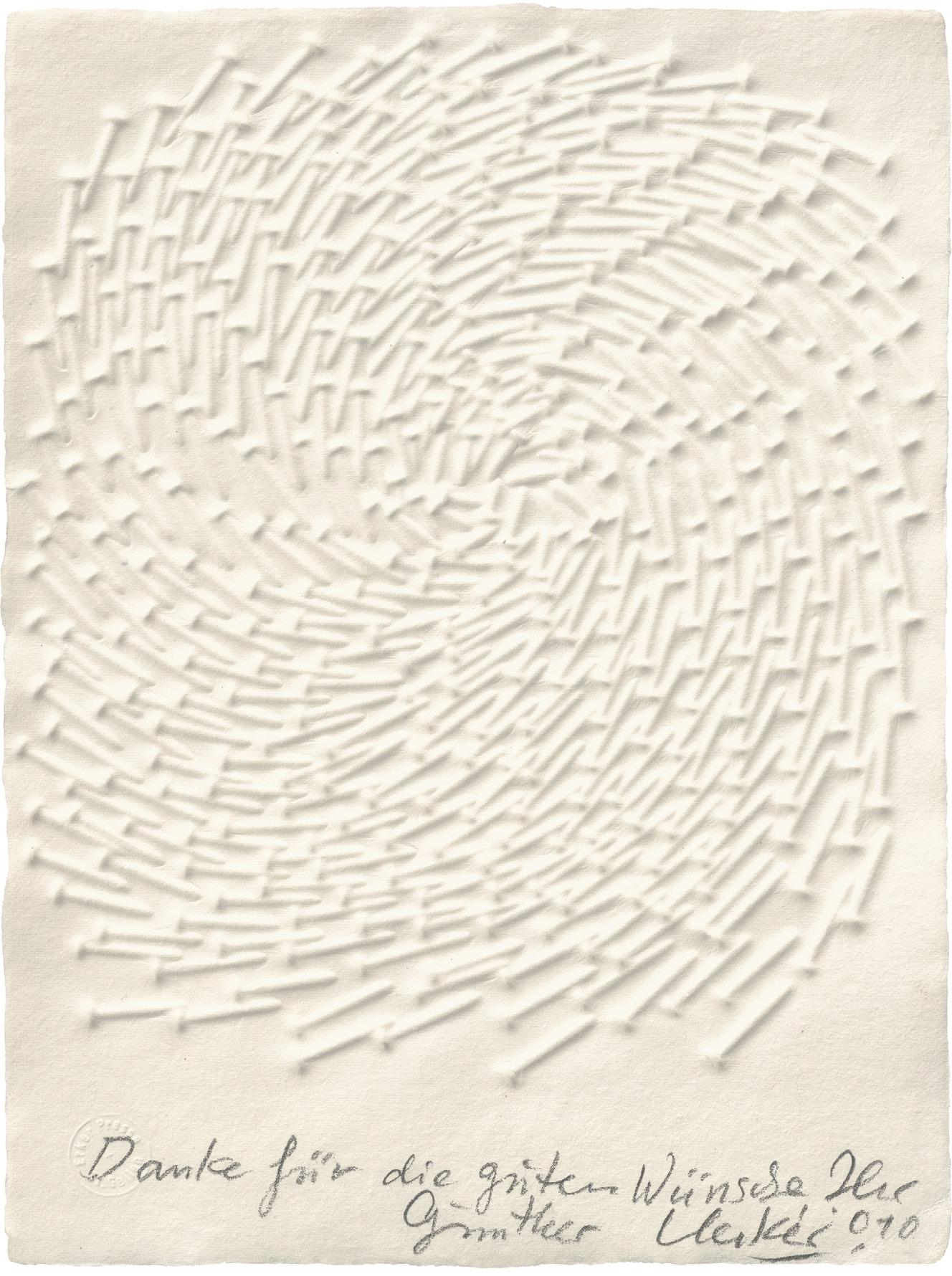
günther uecker
7193 Ohne Titel
Prägedruck auf festem Velin. 2010. 25,7 x 22,4 cm (30,7 x 23 cm).
Signiert „Günther Uecker“, datiert sowie gewidmet.
4.000 €
Herausgegeben von der Erker Presse, St. Gallen, mit deren Blindstempel unten links. Prachtvoller, klarer Druck der spiralförmigen Komposition, mit dem vollen Schöpfrand.

7194
nam june paik
(1932 Seoul – 2006 Miami)
7194 Ohne Titel
Acryl auf Baumwolltuch. Wohl 1977.
86,5 x 64,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „PAIK“.
1.500 €
Dynamische Gelegenheitszeichnung. Entstanden als Dank an Knut Schäfer, der 1977 Nam June Paik als videotechnischer Leiter bei der Umsetzung der Video Installation „TV garden / VideoJungle“ auf der documenta 6 in Kassel unterstützte. Beigegeben: Ein handschriftlicher Dankesbrief von Nam June Paik an Knut Schäfer, sieben dokumentarische Fotografien der Videoinstallation von Nam June Paik, zwei Arbeitszeugnisse für Knut Schäfer, ausgestellt von der documenta 6, eines von Manfred Schneckenburger, sowie ein Gutachten für Knut Schäfer von Manfred Schneckenburger.
Provenienz: Nachlass Knut Schäfer, Hamburg
mappenwerke
7195 Hommage à Arthur Köpcke
18 Bl. Verschiedene Techniken von diversen Künstlern auf unterschiedlichen Papieren sowie 1 Bl. Inhaltsverzeichnis. Lose in Orig.-Halbleinenkassette. 1979. Verschiedene Blattmaße, bis 48,5 x 38 cm. Sämtlich signiert, teils datiert und betitelt. Auflage 30 röm. num. Ex.
1.200 €
Herausgegeben von Den Danske Radeerforeining af 1853, Kopenhagen 1979, in einer Gesamtauflage von 130 numerierten Exemplaren. Die Mappe enthält Arbeiten in unterschiedlichen Drucktechniken, meist jedoch Offsetdrucke (14), drei weitere druckgraphische Arbeiten (u.a. Siebdruck, Radierung und Lithographie) sowie ein Puzzle. Enthalten sind Arbeiten von: Eric Andersen, Joseph Beuys, George Brecht, Henning Christiansen (2), Robert Filliou, Ludwig Gosewitz, Al Hansen, Per Kirkeby, Bengt at Klingberg , Alison Knowles, Björn Norgaard, Nam June Paik , Tomas Schmit, Daniel Spoerri, Ben Vautier, Wolf Vostell und Bob Watts
joseph beuys und charles wilp (1921 Kleve – 1986 Düsseldorf; 1932 Witten – 2005 Düsseldorf)
7196 Sandzeichnungen
Multiple. 18 Bl. Offsetdrucke, 11 von Joseph Beuys und 7 von Charles Wilp, auf Offsetpapier sowie 4 Bl. Titel, Impressum und Einleitung. Mit Orig.-Halbleinenmappe, zudem 1 Reagenzglas mit Kenia-Korallenkalksand in Orig.-Karton. 1974/78.
49,5 x 69,5 cm (Blattgröße); 8 x 21 x 5 cm (Karton). 11 Bl. signiert „Joseph Beuys“, datiert und mit dem Stempel „Hauptstrom“, 7 Bl. signiert „Charles Wilp“, der Karton ebenfalls signiert und gestempelt „Hauptstrom“. Auflage 250 im Impressum num. Ex. Schellmann 272-283.
1.800 €
Sandzeichnungen als Inbegriff der Vergänglichkeit, fotografisch festgehalten und dann sogleich vom Meer wieder weggespült. Die elf Zeichnungen Beuys‘ und sieben Fotografien von Charles Wilp entstanden zum Jahreswechsel 1974/75 in Diani an der Küste Kenias. Erschienen in einer Gesamtauflage von 265 Exemplaren im Fey Verlag, Stuttgart 1978. Ausgezeichnete Drucke mit dem vollen Rand.

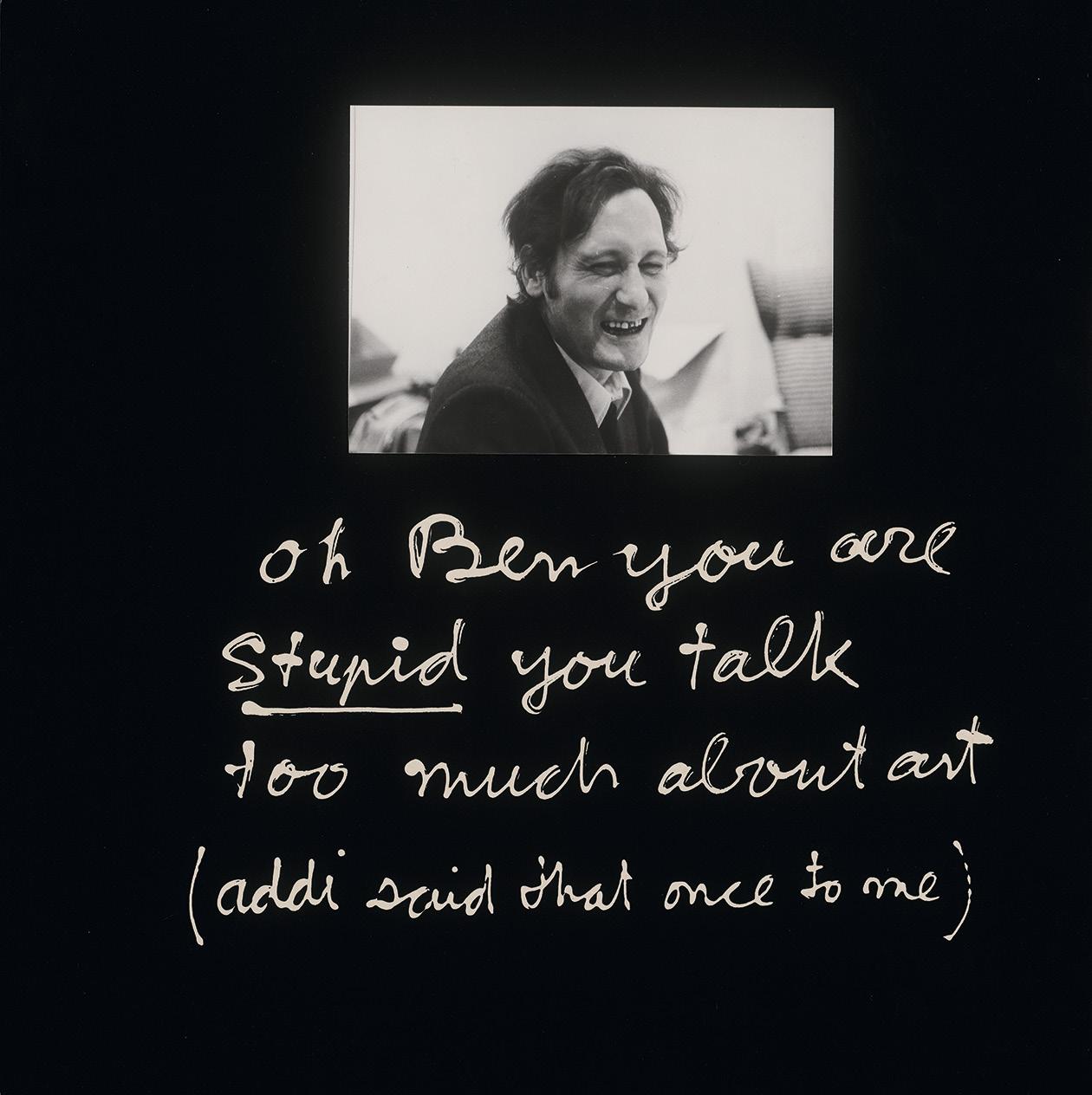

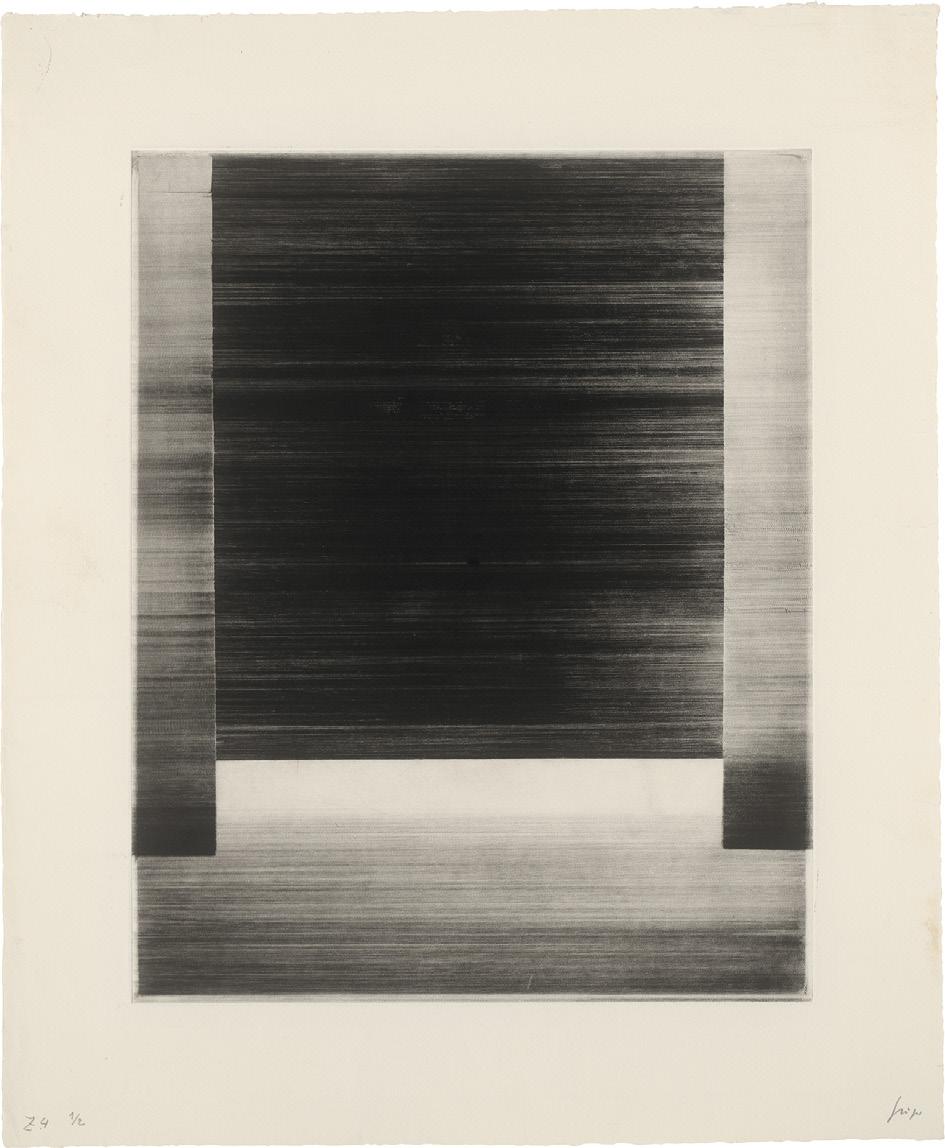
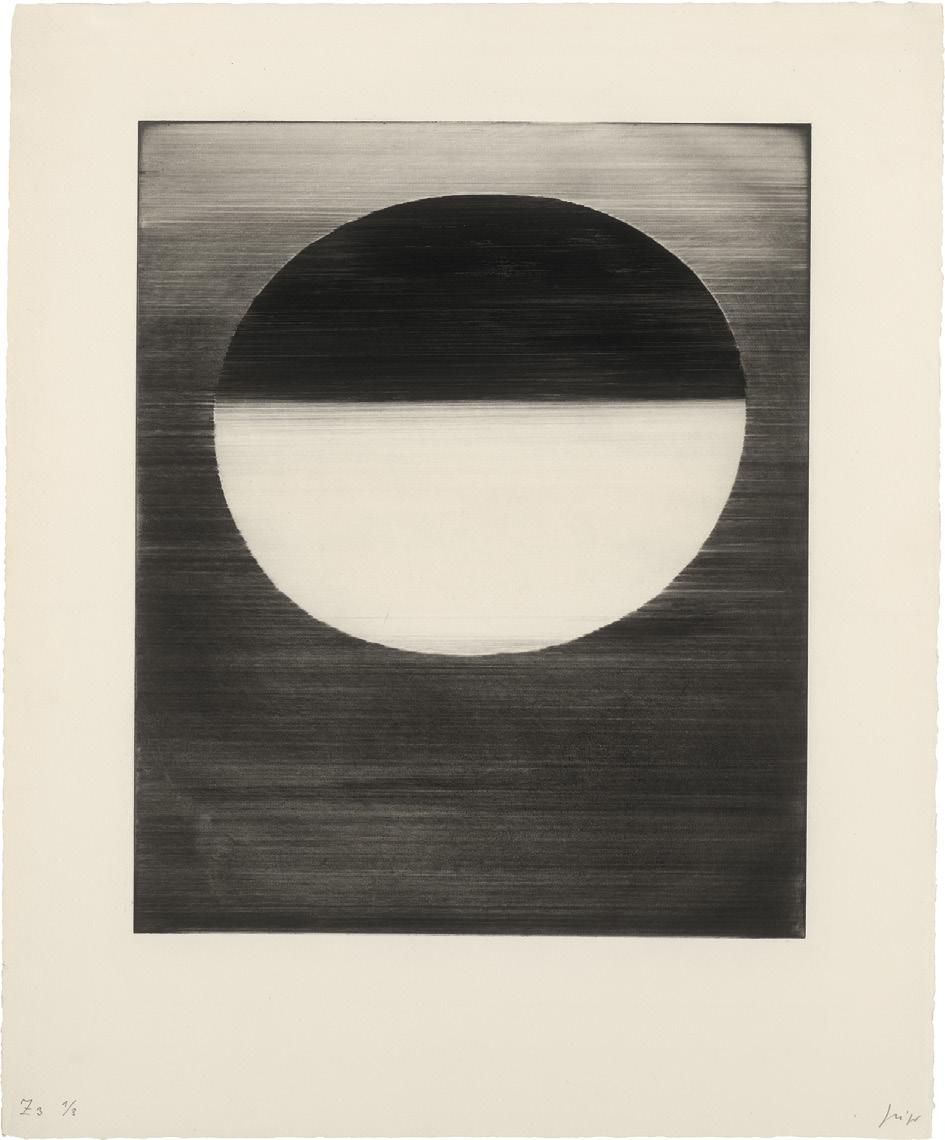
rupprecht geiger (1908–2009, München)
7197* Ohne Titel
4 Bl. Kaltnadel und Roulette auf Velin. 1965/87. Je ca. 47 x 38 cm (65 x 53 cm).
Alle signiert „Geiger“ sowie numeriert „Z3 1/3“, „Z3 3/3“, „Z3 3/4“ und „Z4 1/2“. Geiger WVG 84/1-4.
1.800 €
Folge von vier Kaltnadelarbeiten, alles Exemplare außerhalb des in einer Auflage von 22 numerierten, signierten Exemplaren erschienenen Mappenwerks „Rupprecht Geiger Vier Radierungen“. „In den 60er Jahren tritt die Form und ihre kompositionelle Verknüpfung zunehmend hinter der Dominanz der Farbe zurück. (...) Die Radierungen, denen Geiger mit Roulette und Lineal die differenziertesten Grauschattierungen abgewinnt, erlauben die Konzentration auf ein wesentliches, durch den Lichtcharakter bedingtes Farbmoment: Die HellDunkel Wirkung.“ (Heinz Schütz, aus dem Text zur Mappe). Sämtlich prachtvolle, nuancenreiche Drucke mit dem vollen Rand. Sehr selten
Provenienz: Ehemals Sammlung Carl Vogel, Hamburg (verso mit dem Sammlerstempel)
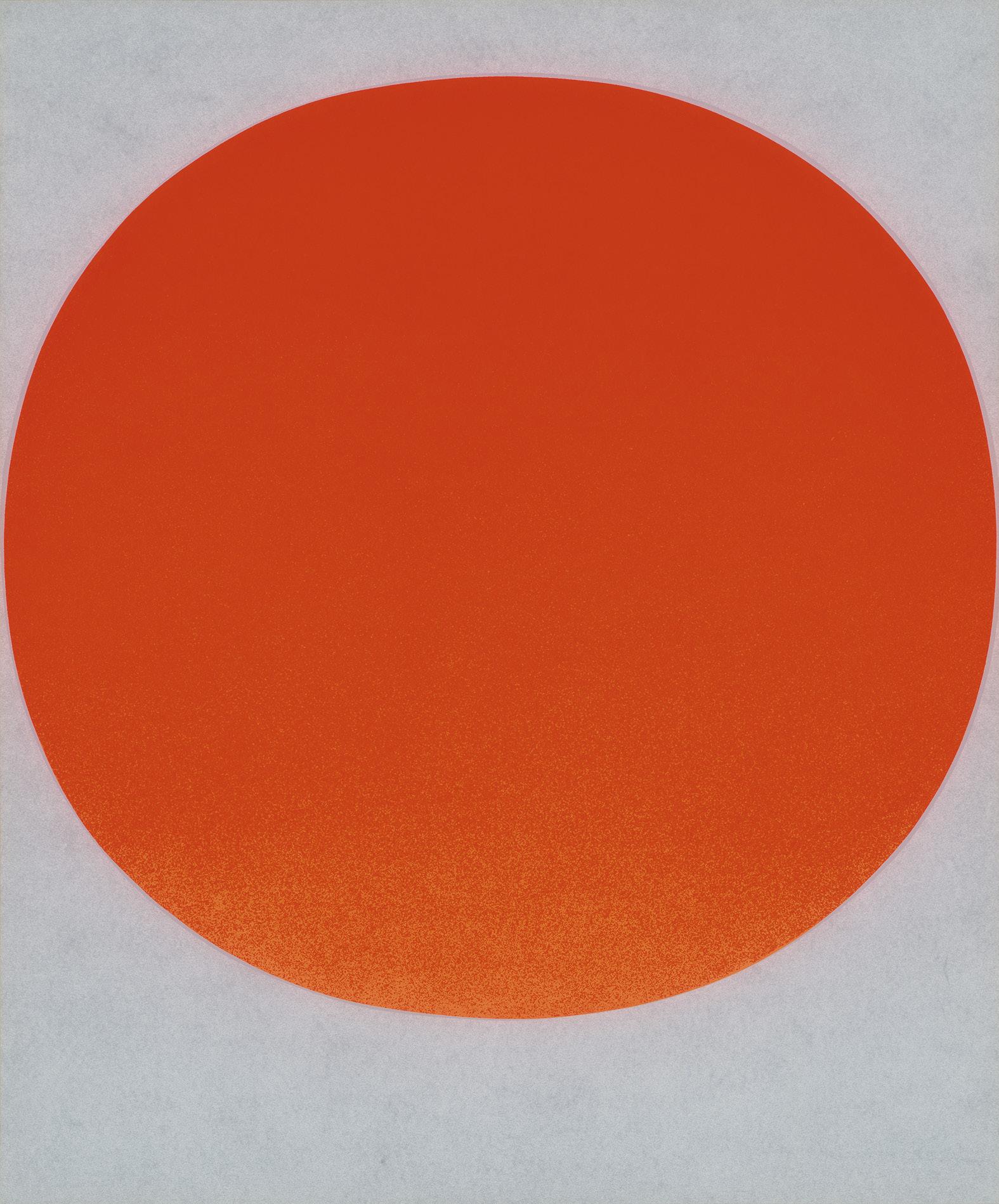
rupprecht geiger
7198 orangeroter Kreis auf silber Farbserigraphie auf festem Velin. 1969.
61 x 51 cm.
Verso signiert „Geiger“. Auflage 159 num. Ex. Geiger WVG 123-2.
1.200 €
Erschienen in einer Gesamtauflage von 160 numerierten Exemplaren beim Kölnischen Kunstverein, Köln; Druck Laube, München. Prachtvoller Druck der formatfüllenden Darstellung.

hermann glöckner
(1889 Cotta – 1987 Berlin)
7199 Rote Aufgipfelung vor weißem Grund
Tempera und Faltung auf Japan. 1977.
20,8 x 29,7 cm.
Verso mit Bleistift mit dem Künstlersignet „HG“ und datiert sowie bezeichnet „57“ und „H65“.
3.000 €
Durch die messerscharfen Faltungen erzeugt Glöckner Teilflächen, die er mit Hilfe der Falzkanten exakt einfärbt. Die samtigintensive Farbe weist somit eine betonte, klare Kante gegenüber dem weißen Grund auf. Hierfür nutzt er ein schmiegsames, knicksicheres und

reißfestes Japanpapier. Das Falten selbst als dreidimensionaler Vorgang bleibt auch im geglätteten, „entfalteten“ Zustand des Endergebnisses spürbar. Glöckner dazu: „An sich ist das eine ganz einfache Sache, aber ich muss es doch als eine Erfindung von mir bezeichnen.“ (zit. nach: Hermann Glöckner. Werke 1909 1985, Ausst.Kat. ifa Berlin, 1993, S. 26).
Provenienz: Privatbesitz Wien
hermann glöckner
7200 Ohne Titel (Variante zur Folge 10 Handdrucke) Farbige Monotypie auf Japan. 1963/64.
36 x 50 cm.
Verso zweifach mit dem Künstlersignet „HG“, zweifach datiert und (schwer lesbar) bezeichnet
700 €
Glöckner schreibt zum Entstehen dieser Werkgruppe, sie umfasse „Abdrucke von einer Linolfläche, die kurvig zerschnitten und teilweise auseinandergezogen war, so daß die Schnittspuren selbst grafische Formen bildeten. Auch diese Flächen sind mit Wasserfarben eingestrichen und so gedruckt worden, daß die Platte auf dem Tisch lag und das Papier aufgelegt wurde. Das Papier war teilweise trocken, teilweise feucht. Es wurde viel experimentiert, mit verschiedenen Farben gearbeitet.“ (Hermann Glöckner. Ein Patriarch der Moderne, Hrsg. John Erpenbeck, Berlin 1983, S. 80, zit. nach skd.museum, Zugriff 17.09.2025). Ganz prachtvoller, ausdrucksstarker Druck mit Rand.
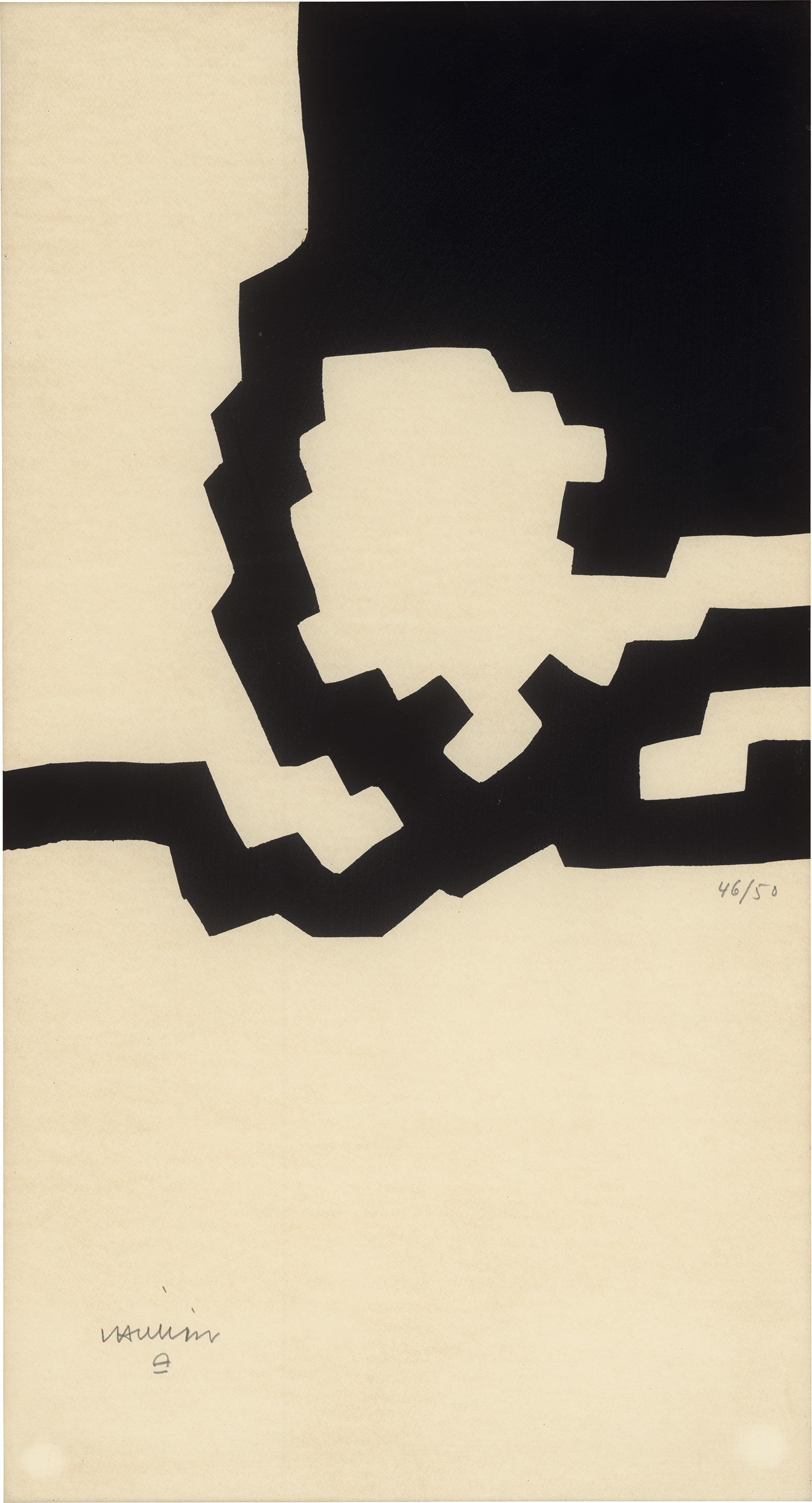
eduardo chillida (1924–2002, San Sebastián)
7201 Munich I Serigraphie auf Kupferdruckkarton. 1977.
40,5 x 34,8 cm (64,8 x 34,8 cm).
Signiert „chillida“ und mit dem Künstlersignet. Auflage 50 Ex. Van der Koelen 77015.
2.000 €
Chillida entwickelt aus kräftigen, klar geschnittenen schwarzen Formen auf weißem Grund ein Spiel mit Positiv und Negativ. Herausgegeben von der Galerie art in progress, München, in einer Gesamtauflage von 65 Exemplaren, mit deren Blindstempel unten rechts. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.
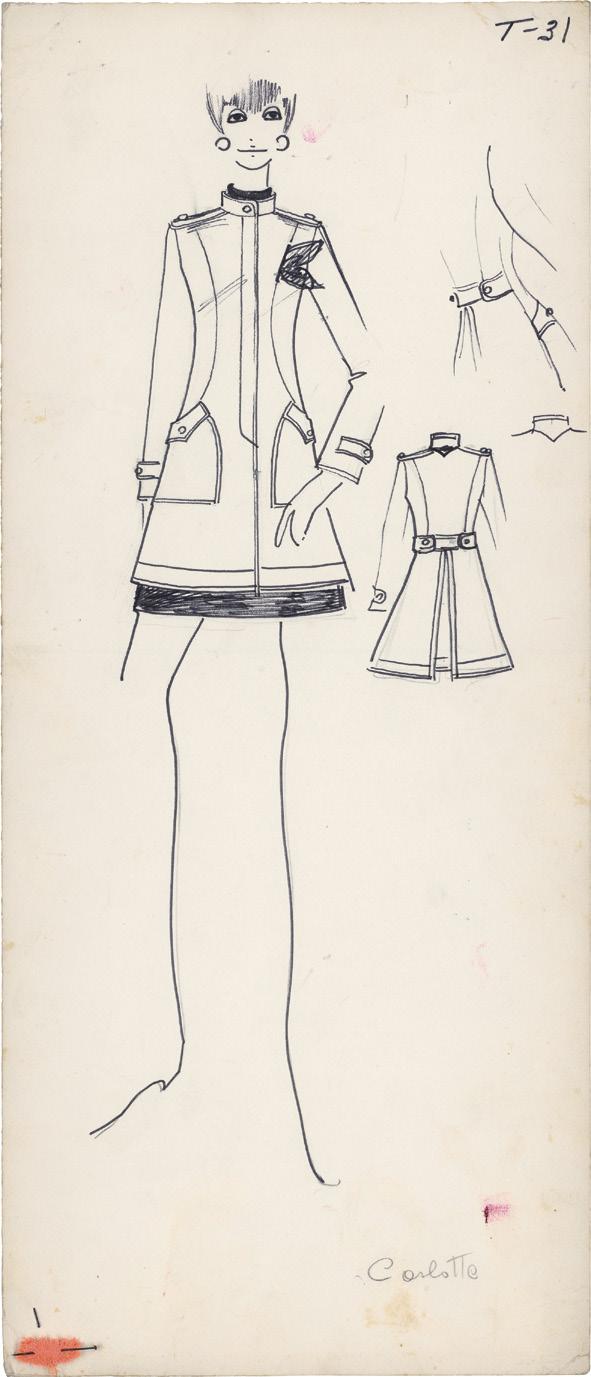
7202
karl lagerfeld (1933 Hamburg – 2019 Neuilly-sur-Seine)
7202 Modezeichnung („Carlotta“)
Faserschreiber über Bleistift sowie unten links mit Stecknadel beimontiertes Stoffmuster auf leichtem Velinkarton. Um 1965.
50 x 21,4 cm.
Oben rechts mit Faserschreiber in Schwarz bezeichnet „T-31“, unten rechts mit Bleistift „Carlotta“.
1.200 €
Der Entwurf für einen Kurzmantel stammt aus den 1960er Jahren, als der Couturier für das römische Modehaus Tiziani arbeitete – nach Fendi eine der ersten Stationen seiner strahlenden Laufbahn. Bis 1969 entwarf der spätere Modezar Kleidung für das 1963 gegründete italienische Unternehmen. Tiziani fertigte damals Filmkostüme und Mode u.a. für Elizabeth Taylor an. Das mit Stecknadel befestigte Stoffmuster veranschaulicht die farbliche Umsetzung des Entwurfs
Provenienz:
Archiv Tiziani, Rom
Nachlass Raf Ravaioli
Privatsammlung Palm Beach, Florida
Palm Beach Fine Art Auctions, Palm Beach, Auktion 18.4.2019, Lot 69
Sammlung Henning Lohner, Berlin
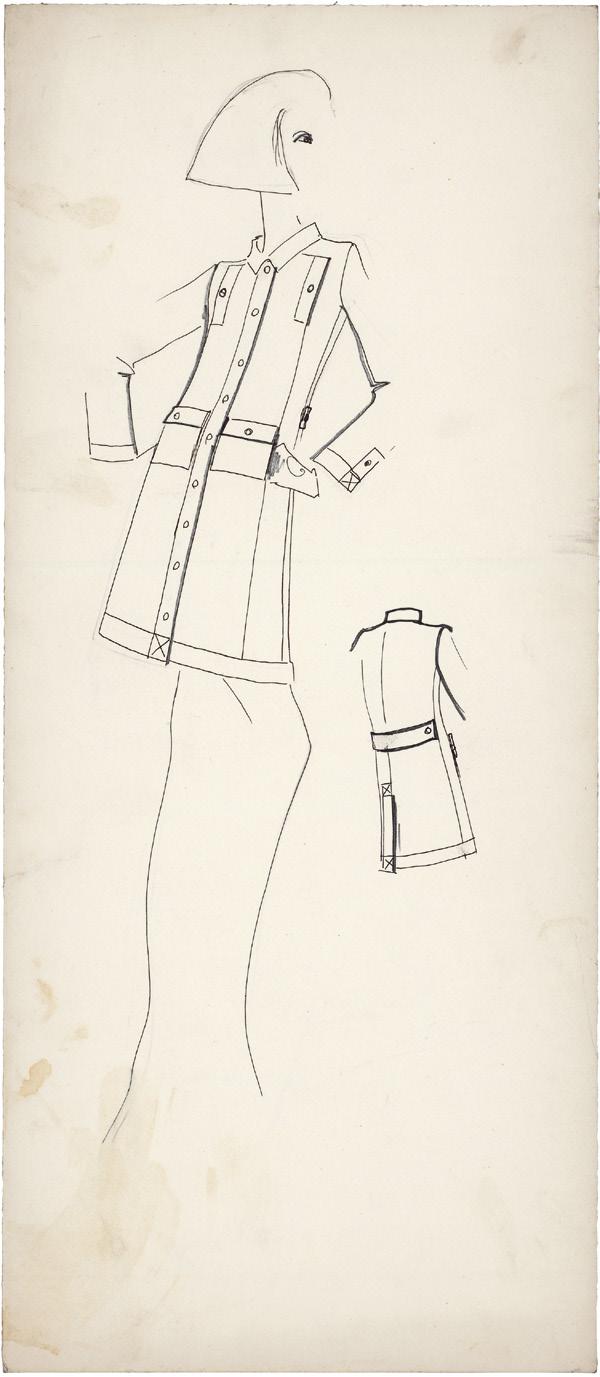
7203
7203 Modezeichnung (Kurzer Mantel)
Faserschreiber über Bleistift auf leichtem Velinkarton. Um 1965.
49,8 x 20,5 cm.
900 €
Die messerscharfen Striche des feinen Zeichenstiftes entsprechen technisch der Akkuratesse, mit der der Modeschöpfer die klare Silhouette des Kurzmantels und die Haltung des Modells erfasst.
Provenienz:
Archiv Tiziani, Rom Nachlass Raf Ravaioli
Privatsammlung Palm Beach, Florida
Palm Beach Fine Art Auctions, Palm Beach, Auktion 18.4.2019, Lot 68 Sammlung Henning Lohner, Berlin

karl lagerfeld
7204 Modezeichnung (Kleid Orangerot)
Schwarze und farbige Faserschreiber sowie unten rechts mit Stecknadeln beimontiertes Stoffmuster auf Velin. Um 1965.
32 x 25 cm.
Oben rechts mit Faserschreiber in Schwarz bezeichnet „572 bis“.
1.200 €
Elegant stilisierte Fragmente von Kopf, Gesicht und Händen wirken zeichenhaft in der Souveränität ihrer Gestaltung. Kleine Details hingegen, wie die eingezeichneten Falten und der Gürtel, zeigen die Detailfreude und Inspiration des damals noch jungen Modeschöpfers.
Provenienz:
Archiv Tiziani, Rom Nachlass Raf Ravaioli
Privatsammlung Palm Beach, Florida
Palm Beach Fine Art Auctions, Palm Beach, Auktion 18.4.2019, Lot 90 Sammlung Henning Lohner, Berlin
karl lagerfeld
7205 Modezeichnung („Ida“)
Faserschreiber über Bleistift auf leichtem Velinkarton. Um 1965.
49,8 x 20,6 cm.
Oben links mit Faserschreiber in Schwarz und Bleistift bezeichnet „419“, unten rechts mit Bleistift „Ida“ sowie verso „Maestelli (marrone)“.
1.200 €
Frontal setzt Lagerfeld den kurzen Mantel ins Bild, souverän belässt er Hände, Füße und Antlitz des Modells in der Andeutung. Zu seinen Lieblingskünstlern zählten deutsche Expressionisten ebenso wie russische Konstruktivisten. Die Klarheit der Zeichnung vermittelt das Gefühl, dem Künstler beim raschen Aufsetzen seiner Linie zuschauen zu können.
Provenienz:
Archiv Tiziani, Rom
Nachlass Raf Ravaioli
Privatsammlung Palm Beach, Florida
Palm Beach Fine Art Auctions, Palm Beach, Auktion 18.4.2019, Lot 80 Sammlung Henning Lohner, Berlin

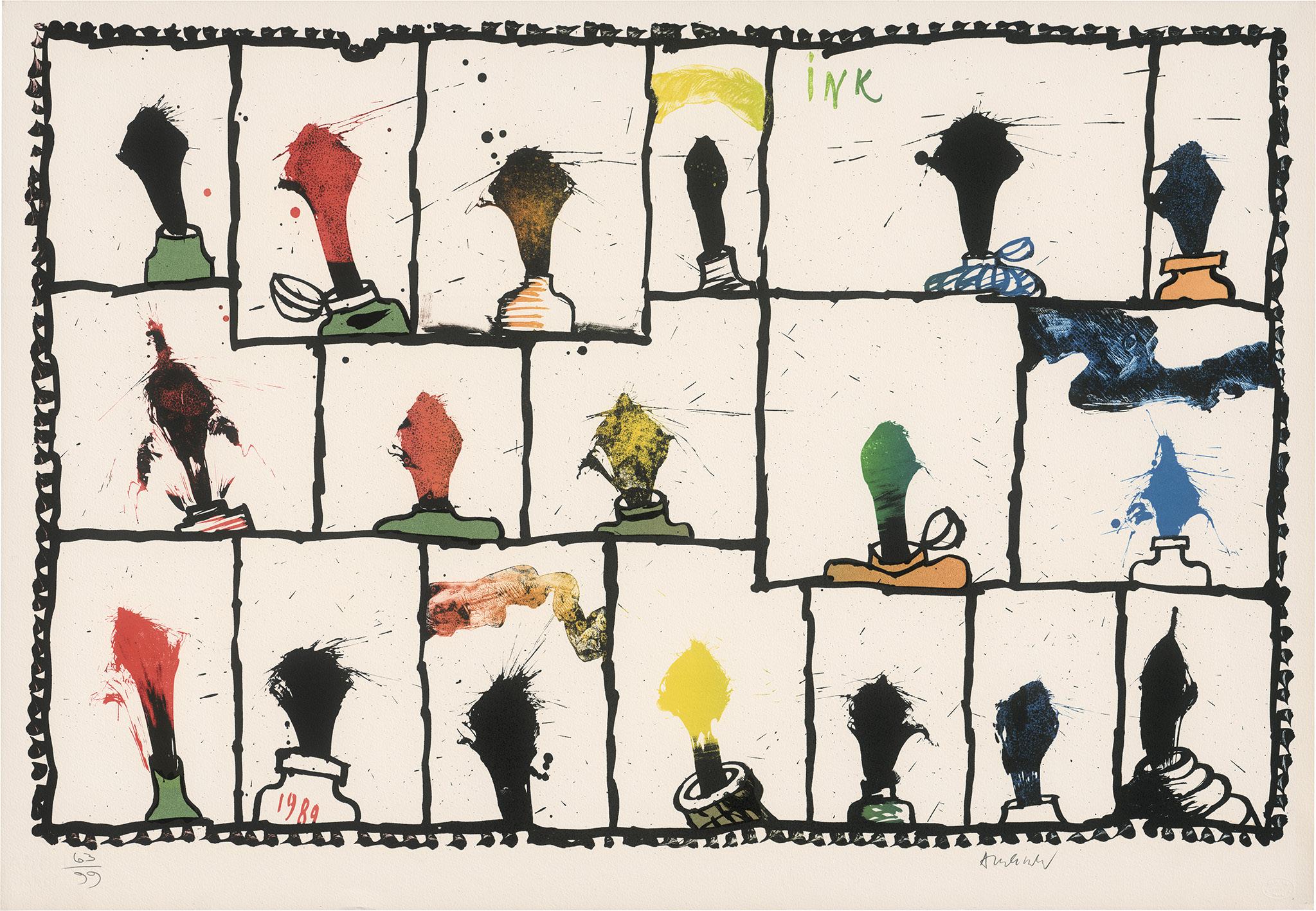

pierre alechinsky (1927 Brüssel, lebt bei Paris)
7206 Composition (Pour Jorn)
Farblithographie auf Velin. 1975/76.
72,5 x 52 cm (75 x 54 cm).
Signiert „Alechinsky“ und bezeichnet „H(ors) c(ommerce)“. Auflage 10 Ex.
1.200 €
Eines von zehn „HC“Exemplaren, neben weiteren Exemplaren, aus dem Mappenwerk „Pour Jorn“, herausgegeben von den Editions Silkeborg Museum (Asger Jorn Foundation), Silkeborg 1976; Druck Clot, Bramsen & Georges, Paris. Prachtvoller, farbintensiver und differenzierter Druck mit dem vollen, kleinen Rand, unten mit dem Schöpfrand.
pierre alechinsky
7207 Ink
Farblithographie auf festem Arches-Velin. 1989. 55 x 83 cm (60 x 86,5 cm).
Signiert „Alechinsky“. Auflage 99 num. Ex.
1.200 €
Herausgegeben vom Atelier Clot, Paris, mit dessen Blindstempel unten rechts. Prachtvoller Druck mit dem wohl vollen, kleinen Rand.

adelchi-riccardo mantovani
(1942 Ferrara – 2023 Berlin)
7208 Der Raum der Erinnerung Öl auf Leinwandkarton. 1975.
47,5 x 59,5 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Weiß signiert „Adelchi-Riccardo Mantovani“ und datiert.
Sgarbi S. 111.
3.000 €
In einer perspektivisch soliden Komposition gruppiert Mantovani seine rätselhaften Figuren und Bildgegenstände zu einer phantastischsurrealen Szenerie, mit feinem Pinsel in fein abgestimmtem
Kolorit akribisch und detailreich gemalt. Die Inspirationen für seine Gemälde fand Mantovani sowohl in der italienischen Renaissance als auch im Surrealismus. Vittorio Sgarbi stellt fest, dass sich „Mantovanis Renaissance vielleicht unbewusst mit der Metaphysik De Chiricos überschneidet“. (V. Sgarbi, AdelchiRiccardo Mantovani, Mailand 1989, S. 12). Im Jahr 1964 wanderte Mantovani als Handwerker nach Deutschland aus; 1972 fand seine erste Gemeinschaftsausstellung mit der Gruppe „Mediterraneum“ in Berlin statt.
Provenienz: Privatbesitz Hessen

keiko minami (1911 Toyama – 2004 Tokyo)
7209 Hibou (VirginiaUhu)
Aquarell auf grünlichem Bütten. Um 1973.
43,7 x 30 cm.
Unten mittig mit Feder in Schwarz signiert „Keiko Minami“. 900 €
Leuchtende Farben und feine ornamentale Hintergrundstruktur verleihen der großformatigen Zeichnung das für die Künstlerin charakteristische Flirren und einen äußerst dekorativen Charakter Ihre intensiv farbigen, ornamental abstrahierten Phantasietiere und pflanzen, die durchaus an existierende Arten erinnern, zeigen die Liebe der Künstlerin zu Motiven aus der Natur ein Markenzeichen, das das Lebenswerk der Künstlerin durchzieht. Minami studierte Malerei bei Yoshio Mori und entdeckte bei Yozo Hamaguchi, ihrem künftigen Ehemann, die Kunst des Kupferdrucks. 1973 schuf Minami mit der Radierung „Gehörnte Eule“ eine vergleichbare Komposition (The National Museum of Art, Osaka, Nr. 30388).
Provenienz:
Sammlung Rachel und Saul Muhlstock, Kanada Bassenge, Berlin, Auktion 106, 03.06.2015, Lot 8615
Privatbesitz Berlin

gustavo
(d.i. Gustavo Peñalver Vico, 1939 Cartagena, lebt in Capdepera) 7210 „La Secretaria“ Öl auf Leinwand. 1970.
73 x 100 cm.
Verso mit Kreide in Braun signiert „GUSTAVO“, datiert, betitelt, mit den Maßangaben, der Künstleradresse „Portals Nous - Mallorca“ sowie bezeichnet „5“.
1.500 €
Eine intensive Farbigkeit und klare, stilisierte Formen, humorvoll kombiniert, kennzeichnen die frühe Arbeit des Künstlers, entstanden während seines Aufenthaltes auf Mallorca um 1970. Zu dieser Zeit beginnt er allmählich, seine charakteristische Formensprache zu entwickeln und findet zu klaren Konturen und geometrisierten Formen. Er schloss Verträge mit den Galerien Sala Pelaires in Palma de Mallorca und Layentana in Barcelona. Da er mit seiner Kunst die politische Situation in Spanien während der Franco Diktatur anprangerte, wurden einige seiner Werke von den faschistischen Machthabern zerstört, 1971 brachte er sich in Berlin in Sicherheit. Als Durchbruch für seine internationale Karriere gilt die Retrospektive von 1986 in der Bonner Redoute.
Provenienz:
Galerie Rudolf Schoen, Berlin (mit deren Klebeetikett verso)
Privatbesitz Berlin

joan miró (1893 Montroig – 1983 Calamajor)
7211 Diane d‘Ephèse
Lithographie auf Arches-Velin. 1975.
55,5 x 40 cm (65,5 x 50,3 cm).
Signiert „Miró“. Auflage 100 num. Ex. Mourlot 181.
1.200 €
Herausgegeben von Maeght, Paris, Druck Mourlot, Paris. Ausgezeichneter Druck mit dem vollen Rand.
joan miró
7212 Aus: Der Lithograph II
Farblithographie auf festem Velin. 1975.
Ca. 37,6 x 27,7 cm (51,5 x 37,5 cm).
Signiert „Miró.“. Auflage 80 röm. num. Ex. Cramer 1043, Cramer Livres 198.
1.200 €
Blatt 7 (14) aus dem Buch „Joan Miró der Lithograph II“, von denen 13 Lithographien in einer Auflage von 80 römisch numerierten Suiten bei Mourlot, Paris, gedruckt und in Mappen präsentiert wurden. Prachtvoller Abzug mit breitem Rand.
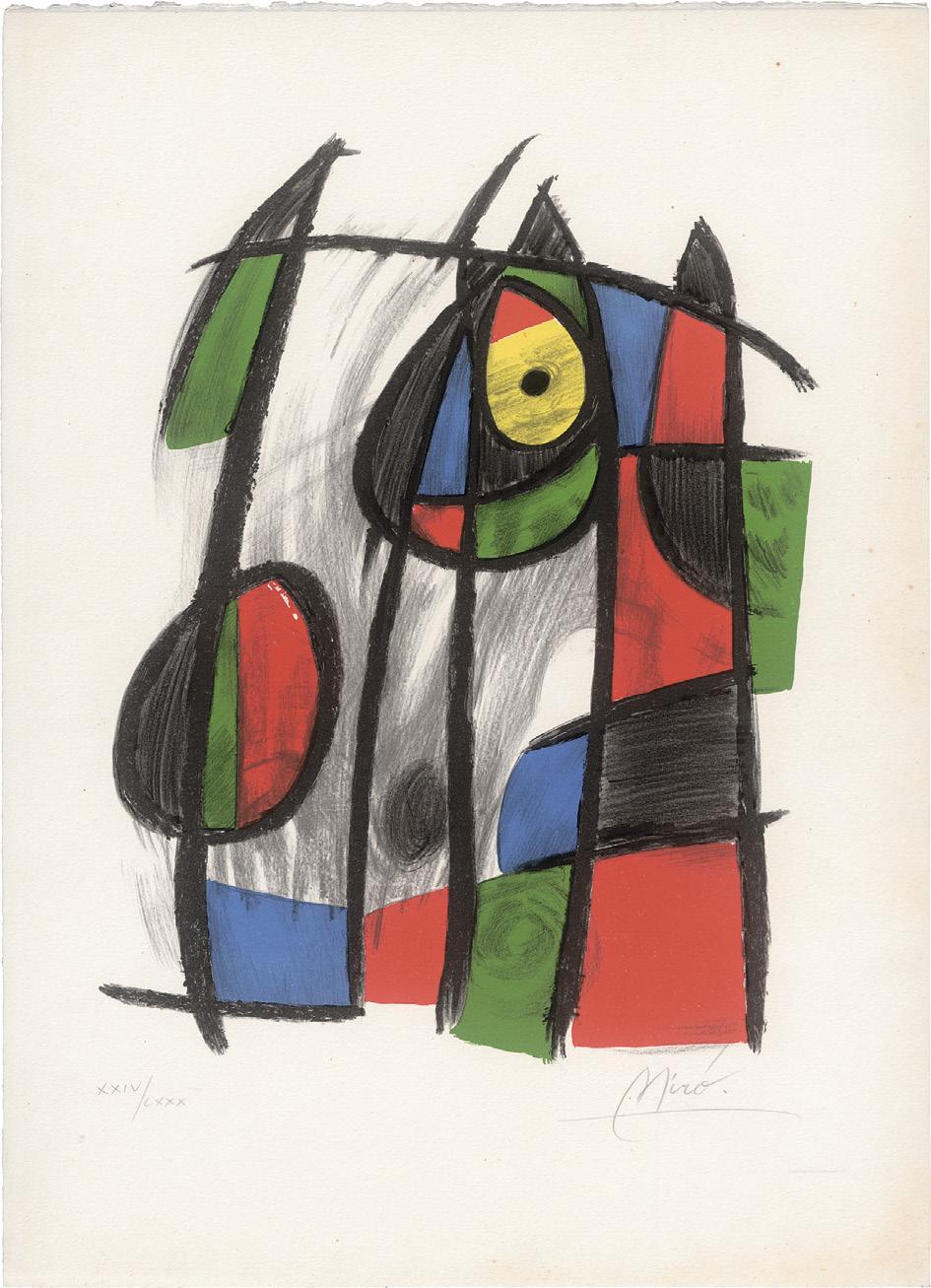
7212
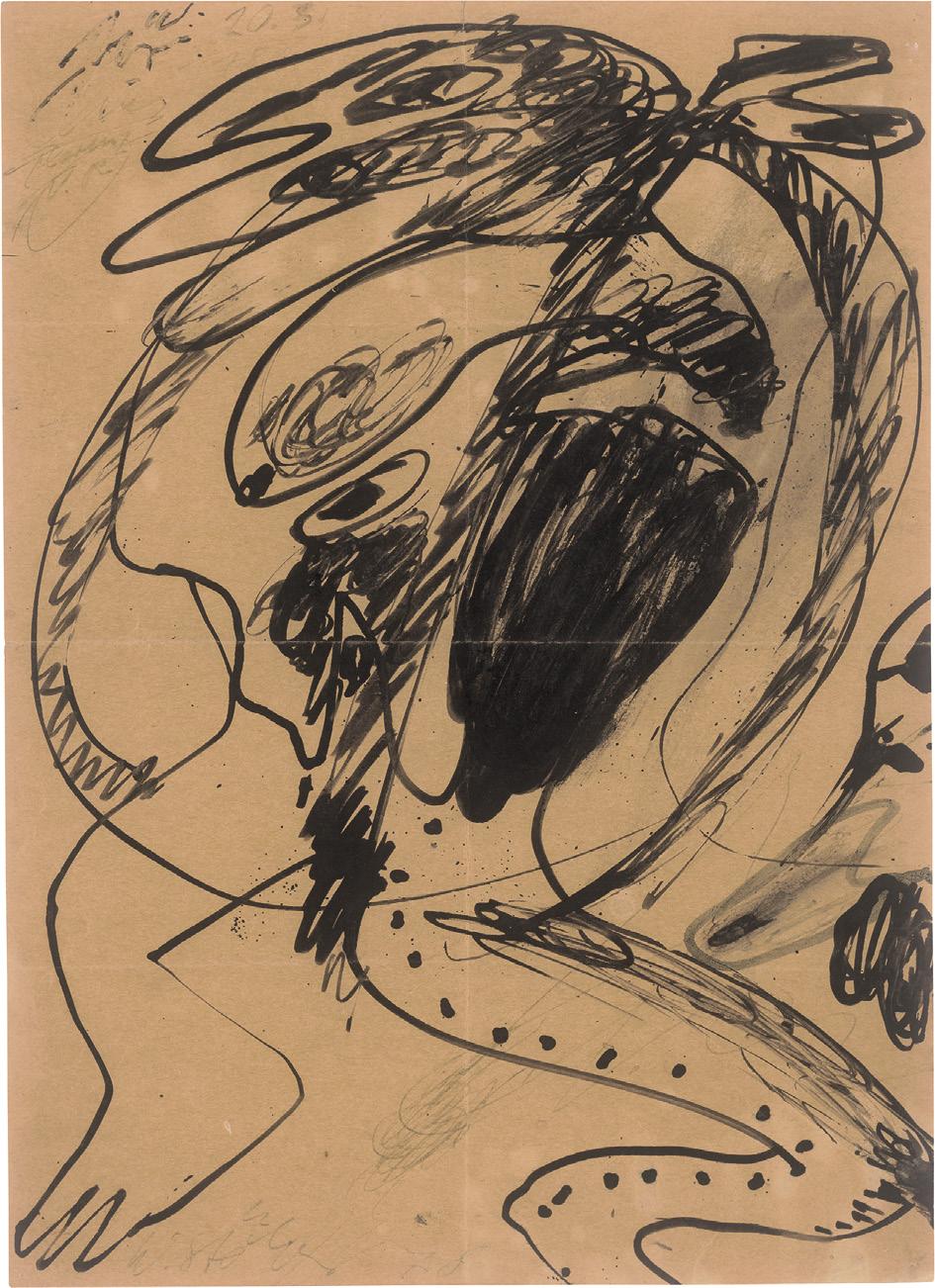
walter stöhrer
(1937 Stuttgart – 2000 Scholderup b. Schleswig)
7213 Ohne Titel (Kreatur)
Mischtechnik mit Pinsel in Schwarz auf bräunlichem Velin. 1978.
32,6 x 23,7 cm.
Unten links mit Feder in Blau (verblasst) signiert „W. Stöhrer“ und datiert, oben links (schwer lesbar) nochmals datiert und bezeichnet.
1.200 €
Figurative Formen beleben diese mit ausholenden Schwüngen gestaltete Arbeit, ganz im Sinne der gelösten malerischen Gesten des abstrakten Expressionismus und des Tachismus. Expressive Zeichnung, typisch für den Stil Stöhrers in den 1970er Jahren.
Provenienz: Privatbesitz Rheinland
walter stöhrer
7214 Figuration
Schwarze und farbige Kreiden auf bräunlichem Velin. 1978.
32,5 x 23,5 cm.
Oben mittig mit Kreide in Blau signiert „W. Stöhrer“.
1.200 €
Wunderbar energetische, kraftvolle Zeichnung mit fein ausbalancierten Kontrasten, in der Stöhrer den für ihn so charakteristischen Weg zwischen Figuration und Abstraktion geht. Der Einfluss der CoBrAKünstler, die sich mit ihrer abstrakten, oft kindlichnaiven Kunst gegen gesellschaftliche und akademische Normen gewandt hatten, ist deutlich spürbar.
Provenienz: Privatbesitz Rheinland



antonio saura
(1930 Hesca – 1998 Cuenca)
7215 Dora Maar Visitada IV
5 Bl. Farblithographie mit Zinkographie auf festem Velin. 1986.
65 x 50 cm (Blattgröße).
Alle signiert „SAURA“. Auflage 140 num. Ex. Weber-Caflisch/Cramer 420-424.
4.500 €
Im Jahr 1983 entstand Sauras erster DoraMaarZyklus, ausgestellt in der Galerie Stadler, Paris, dem die vorliegenden Portraitlithographien folgten. Die Kompositionen zeigen sich auch als Hommage an Picasso. Die komplette Folge von Lithographien, herausgegeben in einer Gesamtauflage von 160 Exemplaren vom Atelier Clot, Paris, mit dessen Blindstempel unten rechts. Gedruckt bei Clot, Bramsen & Georges, Paris. Ganz prachtvolle, farblich schön abgestimmte Drucke der formatfüllenden Kompositionen.
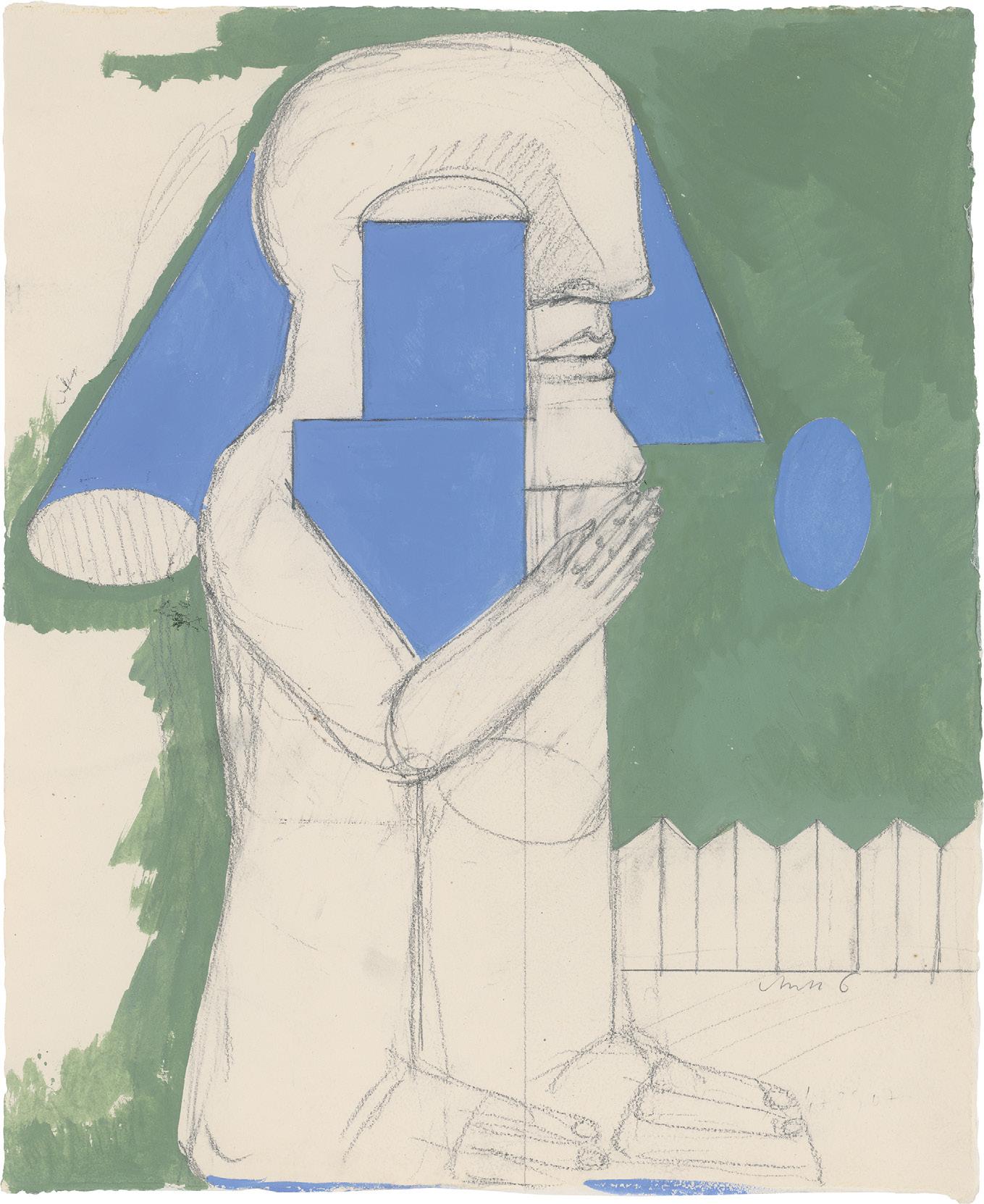
horst antes
(1936 Heppenheim, lebt in Berlin, Karlsruhe und Florenz) 7216 Maskierte Figur vor Zaun Aquatec und Bleistift auf Velin. 1980. 39,5 x 32,3 cm.
Unten rechts in der Darstellung mit Bleistift signiert „Antes“.
6.000 €
Schwebende blaue Farbflächen umgeben und verdecken das ins Profil gedrehte Gesicht der Figur. Mit der Entwicklung des markanten, immer im Profil gezeichneten „Kopffüßlers“, seiner berühmten Kunstfigur, setzte sich Antes klar vom Informel und von der abstrakten Kunst ab. Über Jahre hinweg blieb diese Gestalt eines seiner künstlerischen Hauptmotive. Hier erscheint sie vor dem grünen Grund fast transparent, von Bleistiftlinien umrissen und mit sparsamen Binnenstrukturen, vor dem angedeuteten Zaun. „Der Kopf ist uns also nicht zugewandt, ist vielmehr von uns abgewandt, er nimmt von uns keine Notiz. Der Profilkopf wahrt Distanz. Er will jene Betrachtung zum Betrachter ausdrücklich nicht herstellen, die sich ergäbe, wenn er uns voll zugewandt wäre... Der Dialog findet primär nicht zwischen dem Kopf und uns statt; er hat vielmehr zwischen dem Kopf und dem Künstler stattgefunden. Wir sind lediglich Zeugen eines abgeschlossenen, vielfach unverständlich bleibenden, rätselvollen Gesprächs.“ (Willy Rotzler, Aus dem Tag in die Zeit. Texte zur modernen Kunst, Zürich 1994, S. 239 u. 242).
Provenienz:
Galerie Utermann, Dortmund (dort erworben 2010)
Privatbesitz Berlin
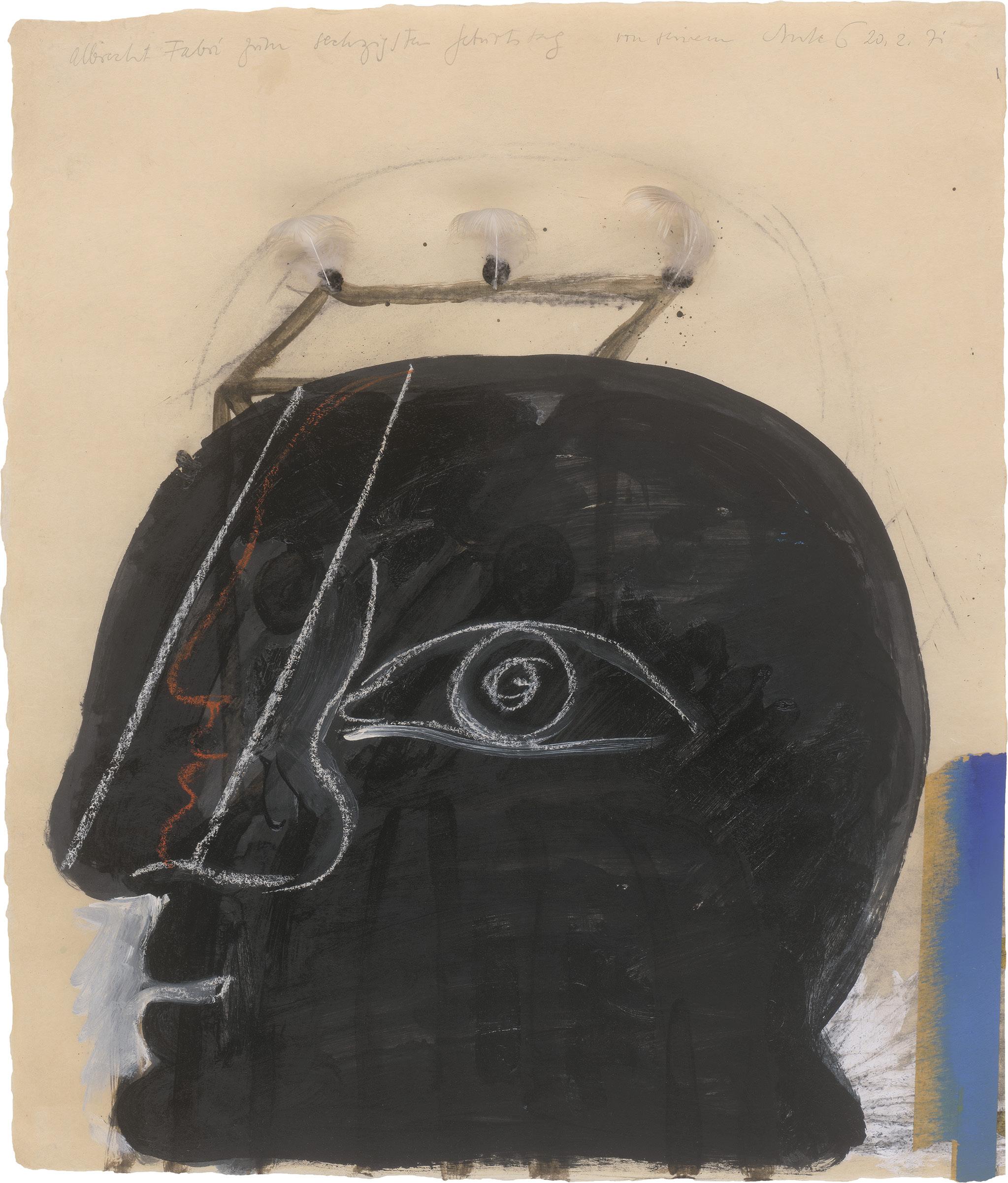
horst antes
7217 Kopf
Mischtechnik und Collage mit Federn auf Japan. 1971.
51 x 43 cm. Oben rechts mit Bleistift signiert „Antes“ und datiert sowie links gewidmet.
4.000 €
In unendlichen Variationen begegnen uns wuchtige Profilköpfe in Antes‘ Werk. Sein profundes ethnographisches Wissen – er sammelt unter anderem KachinaFiguren der Hopi, Federschmuck und Hilfsgeister der Ewe und Dangwe aus Ghana – spiegelt sich immer wieder auch in der Verwendung collagierter Federn, die auch den vorliegenden tiefschwarzen Kopf um geistige Dimensionen bereichern. Mit Widmung des Künstlers an den Kölner Schriftsteller Albrecht Fabri.
Provenienz: Privatbesitz Rheinland

roland topor
7219 Weinetikett („le tirebouchon“)
Feder in Schwarz, Bleistift und farbige Kreiden auf blassgrauem Bütten. 1979.
29,5 x 21 cm.
Unten links mit Feder in Schwarz signiert „Roland Topor“ und datiert, verso mit Bleistift (schwer lesbar) betitelt.
1.500 €
Die Gesetze der Physik setzt Topor außer Kraft in diesem Kunststück seiner Phantasie und Einbildungskraft. „Er wirft seine Steine in den Teich, und der Wellenschlag bringt zahlreiche Boote ins Wanken. Seine große Originalität hat ihn sogleich in die vorderste Linie der humoristischen Graphik gerückt.“ (Ronald Searle, in: Topor Tod und Teufel, Ausst.Kat. München u.a. 1985, S. 42).
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland
Ausstellung:
Topor Tod und Teufel, Stadtmuseum München u.a. 1986, Kat.Abb. S. 37
roland topor (1938–1997, Paris)
7218 „Reculons“
Feder und Pinsel in Schwarz, Gouache, Spritztechnik, Bleistift und farbige Kreiden auf Velin.
35,5 x 25,3 cm.
Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „R. Topor“, in der Darstellung rechts betitelt.
1.200 €
Zurück! Einen Schritt vor dem Abgrund schwingt mit einer spiraligen Bewegung des langen Halses der Kopf des Mannes in die Gegenrichtung und verbildlicht damit das titelgebende Kommando. Das Multitalent Topor war nach Studien an der École des BeauxArts in Paris Maler, Dichter, Zeichner, Bühnenbildner, Dramatiker, Regisseur, Schauspieler, Liedermacher, Trickfilmer und Plakatgraphiker. „Roland Topor ist ein menschliches Feuerwerk, das in alle Richtungen sprüht, krachend und aufrüttelnd, unterhaltsam und erschreckend.“ (Ronald Searle, zit. nach diogenes.ch, Zugriff 25.06.2025).
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

tomi ungerer (1931 Straßburg – 2019 Cork)
7220 „By appointment of the Queen“ Bleistift auf Velin.
40 x 30 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „T. Ungerer“, unten mittig betitelt sowie bezeichnet „Her majesty the queen‘s...“.
900 €
Satirische Zeichnung: Der herrschaftlich auftretenden Dame mit animalisch verzerrten Gesichtszügen hilft ihr Begleiter in einen voluminösen Pelzmantel, während sie darunter nur spärlich bekleidet zu sein scheint. Ungerers Titel setzt die skurrile, sicher gezeichnete Szene in einen monarchischen Kontext.
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

7220
tomi ungerer
7221 Umgarnung
Feder und Pinsel in Schwarz über Bleistiftvorzeichnung auf festem bräunlichen Velin.
46,3 x 35,4 cm.
Unten rechts mit Farbstift in Violett signiert „T. Ungerer“.
1.200 €
Zwei Frauen umwerben den sitzenden Mann im Anzug. Karikierend und pointiert schildert Ungerer mit spitzer Feder das Geschehen, spielt mit Stereotypen und verleiht der Szene durch intensive Helldunkelkontraste, eine schwungvolle Linienführung und die dynamische Komposition ihren besonderen Reiz.
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

7221

lothar fischer (1933 Germersheim – 2004 Baierbrunn) 7222 Weiblicher Torso „M“ Terrakotta. 1981.
35 x 48 x 27 cm.
Im linken Unterschenkel signiert (geritzt) „lothar fischer“ und datiert.
Dornacher 1098.
1.200 €
Klare Konturen, die Reduktion auf das Wesentliche und eine symmetrisch angelegte Formgebung kennzeichnen Fischers Werkphase um 197585, die er selbst als „Idole Konzeption, Strenge und Geschlossenheit 19751985“ bezeichnet. Er zeigt sich inspiriert von den archaischen Formen eines vor und frühgeschichtlichen Menschenbildes (vgl. museumlotharfischer.de, Zugriff 18.08.2025). Die Figur
der Frau und ihre Körperhaltungen bildet das bedeutendste Grundthema in seinem skulpturalen Schaffen. Seit 1962 baut er seine Skulpturen nicht in Modellierton, sondern in Ziegelton hohl auf und brennt sie nach dem Trocknen durch den Zusatz von Kohlenstoff reduzierend, d. h. der ziegelrote Ton (Terrakotta) verändert im Reduktionsbrand seine Farbe zu Beige oder Grau. Vielfach werden seine Arbeiten anschließend mit Gipswasser oder Kalk geweißt. Die Arbeit ist Dr. Pia Dornacher, Museum Lothar Fischer, Neumarkt, bekannt. Unikat
Provenienz:
Privatbesitz BadenWürttemberg Nagel, Stuttgart, Auktion 07.02.2024, Lot 643
Privatbesitz Rheinland

cornelia schleime (1953 Berlin)
7223 Ohne Titel Mischtechnik und Serigraphie in Grau auf Velin. 1988. 60 x 60 cm.
Verso mit Bleistift signiert „C.M.P. Schleime“. Auflage 9 num. Ex. 900 €
Michelangelos Motiv der Hände in seinem Fresko „Die Erschaffung Adams“ in der Sixtinischen Kapelle dient Schleime als Basis für ihren Siebdruck, den sie um die Figur einer Beobachterin und einen Hintergrund in hellgrün leuchtender Farbigkeit ergänzt. Die frühe Arbeit mit unikatärem Charakter entstand in den Jahren nach ihrer Übersiedlung in den Westen Berlins.

k. r. h. sonderborg
(d.i. Kurt Hoffmann, 1923 Sonderborg – 2008 Hamburg)
7224 Ohne Titel
Pinsel und Feder in Schwarz und Bleistift auf Velin. Um 1972-77.
80 x 55,3 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Sonderborg“.
3.000 €
Charakteristische, betont reduzierte, zugleich expressiv ausgeführte Komposition Sonderborgs, der als einer der bedeutendsten
Vertreter des Informel gilt. Anklänge an mechanische Konstruktionen, insbesondere an die Stromabnehmer von Straßenbahnen, verleihen der Zeichnung einen kraftvollen, ausdrucksstarken Charakter. Der Duktus mit den geraden, schräg eingesetzten Linien verleiht der monochromen Komposition einen ganz eigenen Reiz. Nur ungern sah Sonderborg seine Arbeit in kunsthistorische Kategorien eingeordnet.
Provenienz: Privatbesitz Hamburg (direkt beim Künstler erworben)

k. r. h. sonderborg
7225 Komposition
Pinsel und Feder in Schwarz auf Velin. 1975. 110 x 74,5 cm.
Unten rechts in der Darstellung mit Feder in Schwarz signiert „Sonderborg“ und datiert.
2.400 €
Dynamische Schwünge und gerade, stahlseilartige Streben, erinnernd an die Stromabnehmer von Straßenbahnen, ziehen sich durch die ausdrucksstarke, monochrome Darstellung. „K. R. H. Sonder
borgs Botschaft ist Weite und Ferne. Er liebte alles, was Räume überbrückt und Kraftlinien spürbar macht. (...) Alte Segelschiffe, altmodische Eisenkonstruktionen, aber auch die neue Technik in Form von Signalreihen sowie Netzen von Oberspannungsleitungen waren seine Themen. Das Suchen nach Spuren brachte ihn zum Legen einer Spur in einer Art labyrinthischer Traumstadt. Gegenstände verwandeln sich in Zeichen, Apparaturen werden zu abstrakten Figurinen“ (staatsgalerie.de, Zugriff 25.09.2025).
Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland
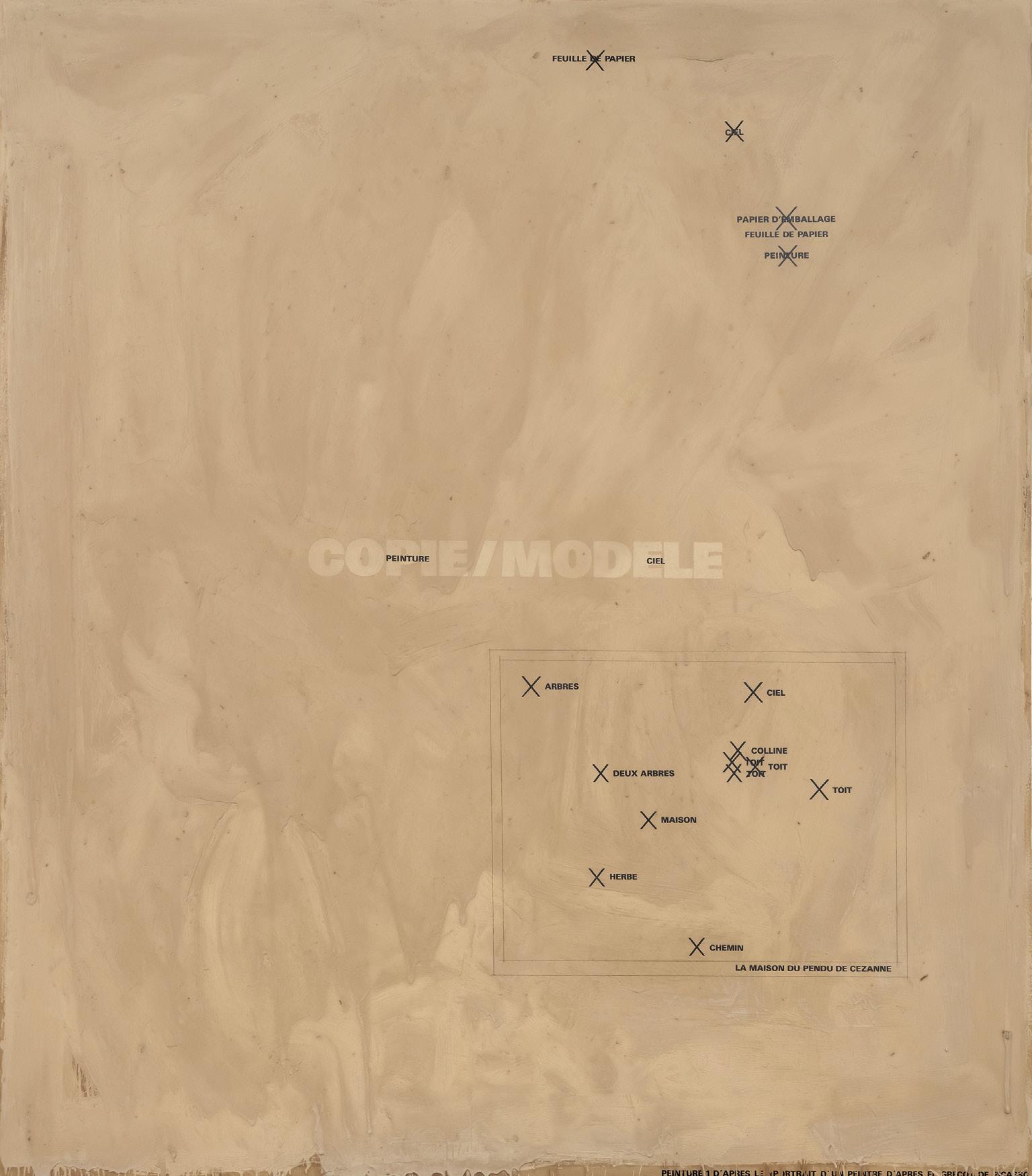
7226 (Diptychon)
rémy zaugg
(1943 Courgenay – 2005 Basel)
7226 Ein Blatt Papier I Diptychon. Bleistift, Siebdruck und Öl auf Kraftpapier, kaschiert auf Baumwolle, auf Keilrahmen gespannt. 1973-80. Je 200 x 175 cm.
Die linke Arbeit verso mit Bleistift signiert „R. Zaugg“ und datiert sowie jeweils mit dem Klebeetikett der Galerie Mai 36, dort betitelt und bezeichnet sowie mit der Werknummer „(SOP. 115/SOP. 116)“.
60.000 €
Die Arbeiten aus der Werkgruppe Une feuille de papier des Schweizer Malers und Konzeptkünstlers Rémy Zaugg verweisen auf das
Offensichtliche: ein leeres Blatt, und zugleich auf das Fragezeichen, das mit dem Blick auf dieses scheinbar Unmittelbare verbunden ist. Das Papier wird zum Ausgangspunkt der Reflexion über Wahrnehmung, Form und Bedeutung. Ab 1973 beginnt Remy Zaugg Backpapiere, die er in seinem Atelier findet, mit Farbe in ähnlich bräunlichem Ton zu bedecken und einige wenige von ihnen auf Leinwand zu kaschieren. „In den auf diese Weise bemalten Papierbogen (erkennt Zaugg) die grundlegende Ambivalenz der Malerei, wie sie sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts darstellt: Die braune Farbe verweist einerseits auf das braune Papier, das ihr Träger ist, anderseits auf sich selbst; sie repräsentiert das Blatt Papier und sie ist selbst als Material präsent.“ (Gerhard Mack, Rémy Zaugg. Eine Monographie, 2005, S. 88). Über Jahre arbeitete der Künstler an der für ihn unabschließbaren Werkgruppe, da im künstlerischen

Prozess immer neue Bedeutungsnuancen für den Künstler sichtbar wurden. So verbindet Zaugg das übermalte Papier seit Ende der 1970er Jahre mit einzelnen Wörtern, welche häufig, als Gebrauchsanweisungen übereinandergelegt, ein unentwirrbares Gemisch aus Bezügen bilden. Mit Sprache „projiziert (er) Gemälde anderer Maler, die sich bereits auf Gemälde wiederum anderer Maler beziehen, auf das Papier und paraphrasiert sie mit brauner Farbe“ (Gerhard Mack, S. 89). Unsere zweiteilige Arbeit enthält den Titel eines Gemäldes von Paul Cézanne, welches 1874 auf der ersten impressionistischen Ausstellung in Paris präsentiert wurde. Während Zauggs vierzigjähriger Karriere, die in den 1970er Jahren begann, beschäftigte sich der Künstler intensiv mit der menschlichen Wahrnehmung. Seine Gemälde, Arbeiten auf Papier, öffentlichen Skulpturen, architektonischen Entwürfe, kuratorischen Arbeiten
und Kritiken untersuchen, wie Sehen und Bewusstsein miteinander verbunden sind. Am bekanntesten ist er für seine textbasierten Gemälde in verschiedenen Sprachen.
Provenienz: Galerie Mai 36, Zürich (dort erworben 1994) Privatbesitz Berlin
Ausstellung: A Sheet of Paper. Rémy Zaugg, Van Abbemuseum, Eindhoven 1984
Ein Blatt Papier. A sheet of paper. Rémy Zaugg, Ausst.Kat. Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven 1992, Abb. S. 48 49 Band I sowie Abb. S. 195 Band II

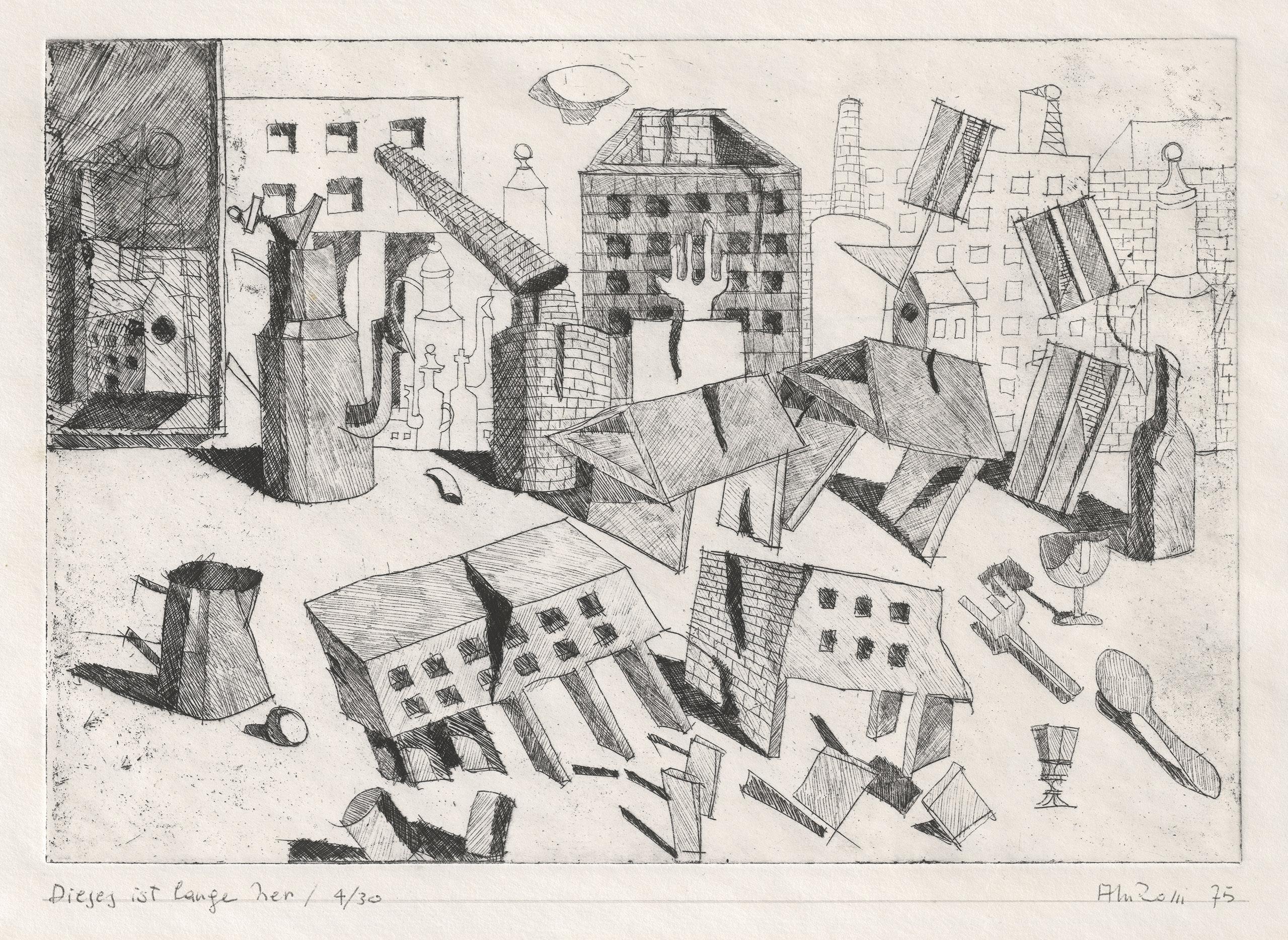
7228
aldo rossi (1931–1997, Mailand)
7227 „Archittetura domestica con piano giallo“ Feder in Schwarz, Filzstift, Aquarell und Pastellkreiden auf Japanbütten. 1974.
31 x 23 cm.
Unten mittig mit Bleistift signiert „Aldo Rossi“, datiert und betitelt, verso mit Feder in Schwarz bezeichnet „10“. 2.500 €
Ansicht einer architektonischen Stadtlandschaft, die in ihrer klaren Komposition, kräftigen Farbigkeit und symbolhaften Bildsprache typisch für Papierarbeiten des Mailänder Architekten und Designers ist. Rossi gilt als einer der großen Architekten und Theoretiker des 20. Jahrhunderts, der Architektur als kulturelles Gedächtnis verstand und die postmoderne Architekturdiskussion maßgeblich beeinflusste.
Provenienz:
Studiogalerie für Architektur Liselotte Ungers, Köln (dort erworben Ende der 1970er Jahre)
Privatbesitz Berlin
7228 „Dieses ist lange her“ Radierung auf Velin. 1975. 18 x 25 cm (25,5 x 34,7 cm).
Signiert „Aldo Rossi“, datiert und betitelt, verso bezeichnet „6“. Auflage 30 num. Ex. 900 €
Die surreal anmutende und mit typischen Gegenständen und Elementen Rossis durchsetzte Komposition, in einem ausgezeichneten Druck mit dem wohl vollen Rand, unten und rechts mit Schöpfrand.
Provenienz:
Studiogalerie für Architektur Liselotte Ungers, Köln (dort erworben Ende der 1970er Jahre)
Privatbesitz Berlin

bettina von arnim
(1940 Zernikow/Mark Brandenburg, lebt in Concots/Frankreich)
7229 Villa (Farbstudie Blau)
Öl auf Leinwand. 1978.
65 x 64 cm.
Verso mit Pinsel in Schwarz signiert „Arnim“ und datiert, auf dem Keilrahmen nochmals signiert.
1.200 €
Zwei Farbskalen, rosablau und gelb blau, im Ober bzw. Unterrand zeigen das Spektrum der verwendeten Töne, die sich hier ausschließlich im Bereich von Blau, Grün und Gelbnuancen bewegen. Im Jahr 1975 zog Arnim von Berlin, wo sie ab 1972 Teil der Gruppe „Aspekt“ und zudem Gründungsmitglied der Künstlergruppe „Kritischer Realismus“ war, nach Südwestfrankreich. Hier entstand ihre kleine Reihe von Gemälden zum Motiv „Villa“.
Provenienz: Privatbesitz Hessen
bettina von arnim
7230 Villa (Farbstudie Rot)
Öl auf Leinwand. 1978.
65 x 64 cm.
Verso mit Pinsel in Rot signiert „Arnim“ und datiert, auf dem Keilrahmen nochmals signiert.
1.200 €
Mit irritierender Ausschließlichkeit liegt die rote Farbe wie ein Film über der Darstellung, und erst die Farbskalen in den Rändern ermöglichen ein Verorten der Nuancen zwischen Warm und Kalt. Zugleich entsteht eine intensive Räumlichkeit. Die Künstlerin studierte u.a. in Paris bei Johnny Friedlaender.
Provenienz: Privatbesitz Hessen
bettina von arnim
7231 Villa (Farbstudie Graubraun)
Öl auf Leinwand. 1978.
65 x 64 cm.
Verso mit Pinsel in Schwarz signiert „Arnim“ und datiert, auf dem Keilrahmen nochmals signiert.
1.200 €
Indem von Arnim den Blick auf Villa und Garten in unterschiedliche Farbschemata übersetzt, versetzt sie das naturalistisch dargestellte, nur leicht stilisierte Motiv auf eine abstrakte Ebene, die sich mit der farblichen Wahrnehmung beschäftigt. So ist die südfranzösische Ansicht vor allem eine Folie für das Ausloten der Wirkung von Farbspektren, von Hell und Dunkel, Warm und Kalt.
Provenienz: Privatbesitz Hessen


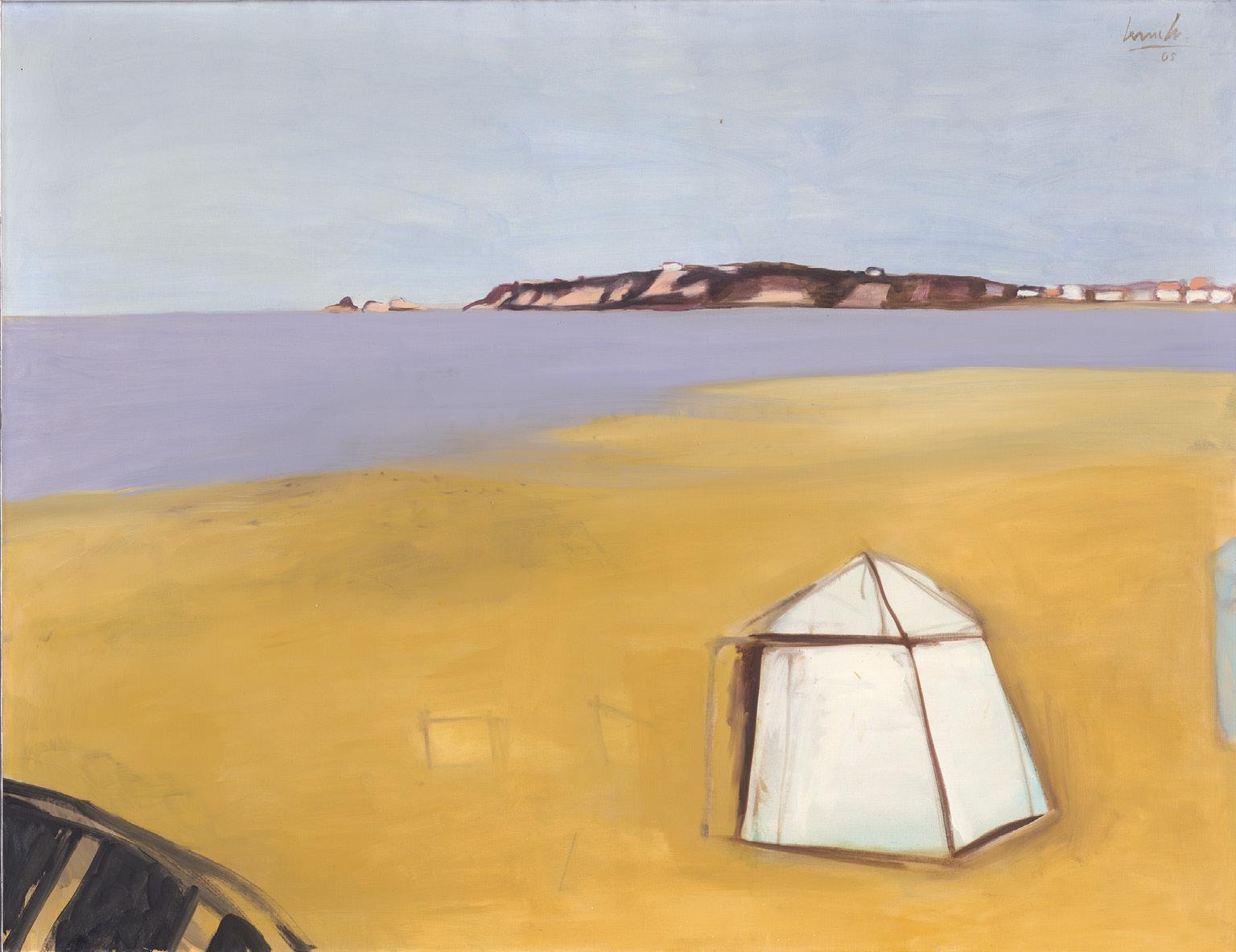
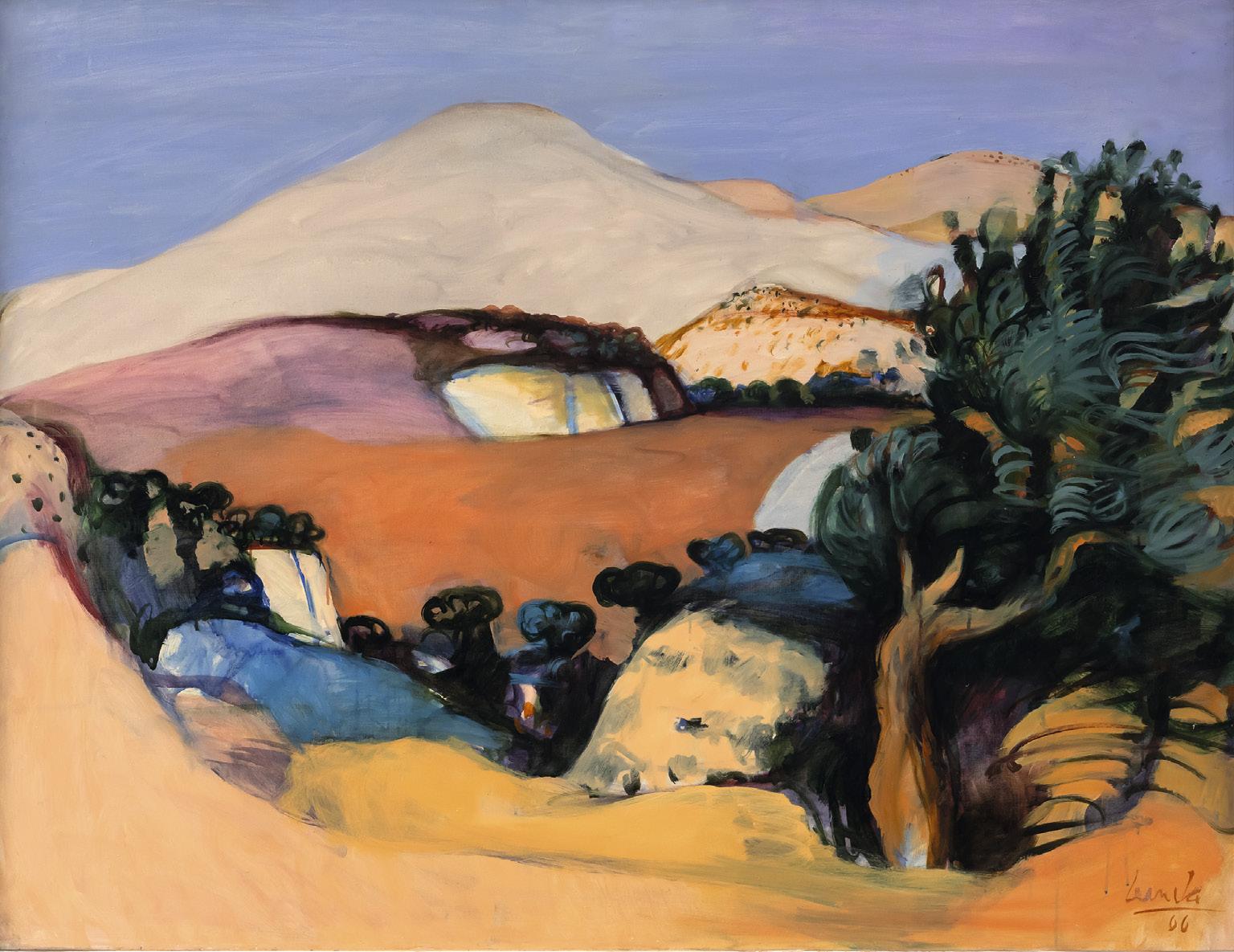

dietmar lemcke
(1930 Goldap/Ostpreussen – 2020 Berlin)
7232 „Normandie“ Öl auf Leinwand. 1965.
100 x 130 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Gelbbraun signiert „Lemcke“ und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Kugelschreiber in Schwarz nochmals signiert „DIETMAR LEMCKE“, datiert, betitelt, mit der Künstleradresse und bezeichnet „Öl“.
1.800 €
Das warme, goldene Leuchten der breiten Strandfläche erfüllt das Bild, ein leichter Dunst hängt über der Landschaft und dämpft das Blau von Meer und Himmel. Fein schwingen die Akkorde von Gelb und BlauViolett und bilden einen harmonischen Hintergrund für die klaren, dunklen Konturen der Bildgegenstände. Spannungsreich lässt Lemcke diese miteinander in Verbindung treten, „sein Sujet allerdings ist die Farbe, die seine Motive in neuer Wahrheit und bildorganischen Einheit erstehen lässt.“ (Lothar Romain, in: Dietmar Lemcke. Bilder, Aquarelle, Zeichnungen 19582003, Ausst.Kat. Galerie Bremer, Berlin 2004, S. 6).
Provenienz: Privatbesitz Berlin
Ausstellung:
Große Kunstausstellung, Haus der Kunst München 1967, Nr. 867 (mit deren Klebeetikett verso auf dem Keilrahmen, dort typographisch bezeichnet)
7233 „Große Schlucht“ Öl auf Leinwand. 1966/67. 100 x 130 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Rot signiert „Lemcke“ und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Bleistift nochmals signiert „DIETMAR LEMCKE“, datiert, betitelt, mit der Künstleradresse sowie bezeichnet „4“ und „Öl“.
1.800 €
Die unter südlicher Sonne leuchtenden Elemente von Landschaft und üppiger Vegetation ergänzen sich in ihrem warmen Kolorit zu einer harmonischen Komposition von intensiver Vitalität. Dietmar Lemcke studiert 194854 an der Berliner Hochschule für Bildende Künste, u. a. bei Karl SchmidtRottluff, Karl Hofer und Ernst Schumacher. Im Anschluss reist er mit einem einjährigen Stipendium nach Paris an die Académie de Montmartre, geleitet von Fernand Léger. Hier beschäftigt Lemcke sich mit den Werken Pablo Picassos, Georges Braques und vor allem Henri Matisses. Als weitere prägende Einflüsse nennt der Künstler Max Beckmanns Amsterdamer Exiljahre und Emil Noldes Spätwerk. 1964 übernimmt Lemcke eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
7234 „Großer Pfirsichkorb“ Öl auf Leinwand. 1990.
55 x 75 cm.
Oben rechts mit Pinsel in Rot signiert „Lemcke“ und datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Bleistift nochmals signiert „DIETMAR LEMCKE“, datiert, betitelt und bezeichnet „Öl“. 1.200 €
Sonnenreife, pralle Pfirsiche und blaue Trauben zählen zu den bevorzugten Sujets in Lemckes vielfältigen, intensiv leuchtenden Stilleben. „Seine auf Tellern und Schüsseln arrangierten Früchte (...) repräsentieren ihren eigenen Kosmos. Seine innere Begrenzung bilden die Platten und Gefäße. Sie sind umschlossen oder eingefangen in einen großen ortlosen Farbraum, der komplementär oder auch kontrapunktisch das Fruchtensemble buchstäblich im Bild hält (...) Das ist ein Bildbestand, der aus sich selbst heraus leuchtet, seine eigene sinnliche, bukolische Üppigkeit feiert.“
(Lothar Romain, in: Dietmar Lemcke. Bilder, Aquarelle, Zeichnungen 19582003, Ausst.Kat. Berlin u.a. 2003, S. 6).
Provenienz: Privatbesitz Berlin
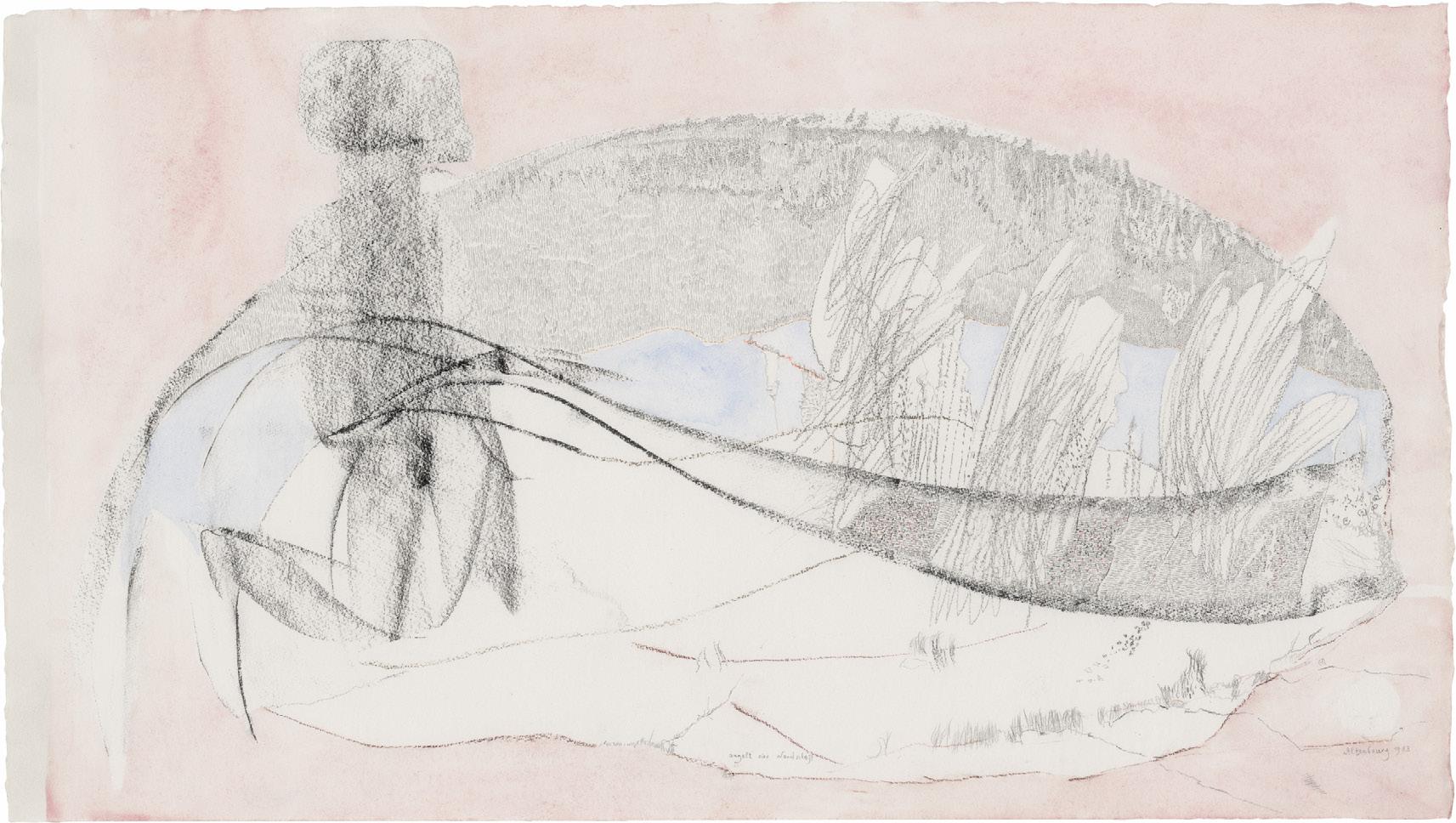


gerhard altenbourg (1926 Rödichen-Schnepfenthal – 1989 Meissen)
7235 angelt eine Landschaft
Mischtechnik auf Velin. 1983. 31,7 x 55,8 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Altenbourg“ und datiert. Janda 83/14.
2.500 €
Eine vielfältige Mischung an Farben: PittKreiden, Bleistift, Pastell, Rötel, Aquarell, Gouache, Pulverfarbe, Chinesische Tusche und Staub kombiniert Altenbourg in der zart schwingenden Komposition, die in hinreißender Weise Figur und Landschaft verknüpft. Tausende von Strichlein, Häkchen, Kringeln und Pünktchen fügen sich zu der poetischen, detailreichskurrilen Darstellung, welche die unregelmäßige Oberfläche des handgeschöpften Papiers wunderbar mit einbezieht.
Provenienz:
Atelier des Künstlers (über Staatlichen Kunsthandel der DDR) Galerie Brusberg, Berlin (dort erworben 1985) Privatbesitz Hannover
walter pichler (1936 Deutschnofen, Südtirol – 2012 Wien)
7236 Ohne Titel
Mischtechnik auf dünnem Velin. 1980. 30 x 42,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Pichler“ und datiert.
1.500 €
Eine schemenhafte Gestalt scheint verwoben mit dem Koordinatensystem des sie umgebenden Raums. In subtilen Andeutungen belassene Bildmotive und ein sensibler Umgang mit dem Material kennzeichnen Pichlers feinsinnig komponierte und nuancenreich
gestaltete Zeichnung. Pichler, Bildhauer, Zeichner und Architekt, verschränkt in seinem Schaffen die verschiedenen Kunstgattungen miteinander. „Wenn man so wie ich sein Leben fast immer zeichnend begleitet, verselbständigt sich die Zeichnung, wird einmal Notation von Zuständen und dann wieder genaue Analyse, trägt zur Verwirrung und dann wieder zur Klärung bei. Ich könnte kaum denken, ohne zu zeichnen.“ (Walter Pichler, Es ist doch der Kopf, Ausst.Kat. CFA Berlin und Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck 2007, S.5, zit. nach: sammlung essl.at, Zugriff 28.09.2025).
Provenienz: Privatbesitz Hessen
otto greis
(1913 Frankfurt/Main – 2001 Ingelheim)
7237 „AtalayarSerie Nr. 20“ Öl auf Leinwand. 1980.
38 x 46 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Braun signiert „Greis“ und datiert, verso mit Pinsel in Rot nochmals signiert, datiert, betitelt und mit den Maßangaben.
1.200 €
Otto Greis erhielt in den 1930er Jahren privaten Mal und Zeichenunterricht bei Johann Heinrich Höhl und wurde in der Nachkriegszeit stark durch die Begegnung mit Ernst Wilhelm Nay beeinflusst. Ab den 1970er Jahren entwickelte Greis eine neue, lichtdurchflutete Farb und Formensprache, inspiriert durch seine mediterranen Segelreisen und die Auseinandersetzung mit der italienischen Renaissancekunst. Seine Malweise zeichnet sich durch schichtweise, transparente Farbaufträge aus, die eine schwerelose, atmende Bildwirkung erzeugen und eine vergeistigte Farbe als eigenständiges bildnerisches Mittel ins Zentrum stellen.
Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

dieter hacker
(1942 Augsburg, lebt in Berlin)
7238 „Haus von Soutine“ Öl auf Leinwand. 1985.
60 x 60 cm.
Verso mit Pinsel in Schwarz signiert „Dieter Hacker“, datiert und betitelt.
900 €
Ein intensiv gelber Lichtstrahl trifft das abstrahierte rote Haus –und scheint zugleich von Soutines Wohnort auszugehen. Dieter Hacker wurde während seines Studiums in München Mitbegründer der Gruppe Effekt, die sich mit kinetischen Installationen beschäftigte. Bekanntheit erlangte er in den 1980er Jahren als Maler im Kontext mit den Jungen Wilden in Berlin, und bereits seit 1971 vollzog er mit seinem Konzept der vom Künstler geführten Produzentengalerie eine radikale Abkehr vom Kunstmarkt. Hacker widmete sich nicht nur der Malerei, sondern schuf auch politische und sozialkritische Installationen, mit denen er die gesellschaftliche Relevanz der Kunst hinterfragt.
Provenienz:
Marlborough Fine Art, London (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite)
Auctionata, Berlin, Auktion 01.12.2015, Lot 108
Privatbesitz Süddeutschland


dieter hacker
7239 „Der Schatten“
Gouache, farbige Kreiden und Kohle auf Velin. 1986. 99 x 119 cm.
Unten rechts mit Kreide in Weiß signiert „Hacker“, datiert und betitelt.
1.500 €
Großformatige, in vehementem Duktus und effektvollen Farbkontrasten ausgeführte Arbeit des Künstlers. Ab 1986 schuf Dieter Hacker, der sich in den 1970er Jahren intensiv mit politischer Fotografie beschäftigt hatte, auch Bühnenbilder für Inszenierungen und verschiedene Theaterprojekte, unter anderem für die Berliner Schaubühne am Lehniner Platz und Schauspielhäuser in Bochum und Düsseldorf. Von 1990 bis 2007 war Hacker Professor für Malerei an der Universität der Künste Berlin.
Provenienz:
Deweer Gallery, Otegem, Belgien (mit deren Klebeetikett verso auf der Rahmenabdeckung)
Van Ham, Köln, Auktion 29.11.2013, Lot 758
Privatbesitz Süddeutschland
klaus fussmann
(1938 Velbert, lebt in Berlin und Gelting)
7240 An der Schlei
Pastellkreiden auf leichtem Velinkarton.
15 x 24 cm.
Unten rechts mit Kreide in Schwarz signiert „Fußmann“.
1.200 €
Boote ziehen auf dem Wasser im Vordergrund durch das Bild, ihre leuchtenden Farben bilden einen schönen Kontrast zum Gelb des Rapsfeldes dahinter. Die flache norddeutsche Landschaft an der Schlei hält Fußmann in leuchtenden, dick aufgetragenen Farben fest. In seiner zweiten, norddeutschen Wahlheimat findet der in Gelting arbeitende Künstler immer neue Motive, deren Farbspiel er begeistert in seinen Zeichnungen und Gemälden, vielfach in übereinander gestaffelten blockartigen Farbstreifen, einfängt.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
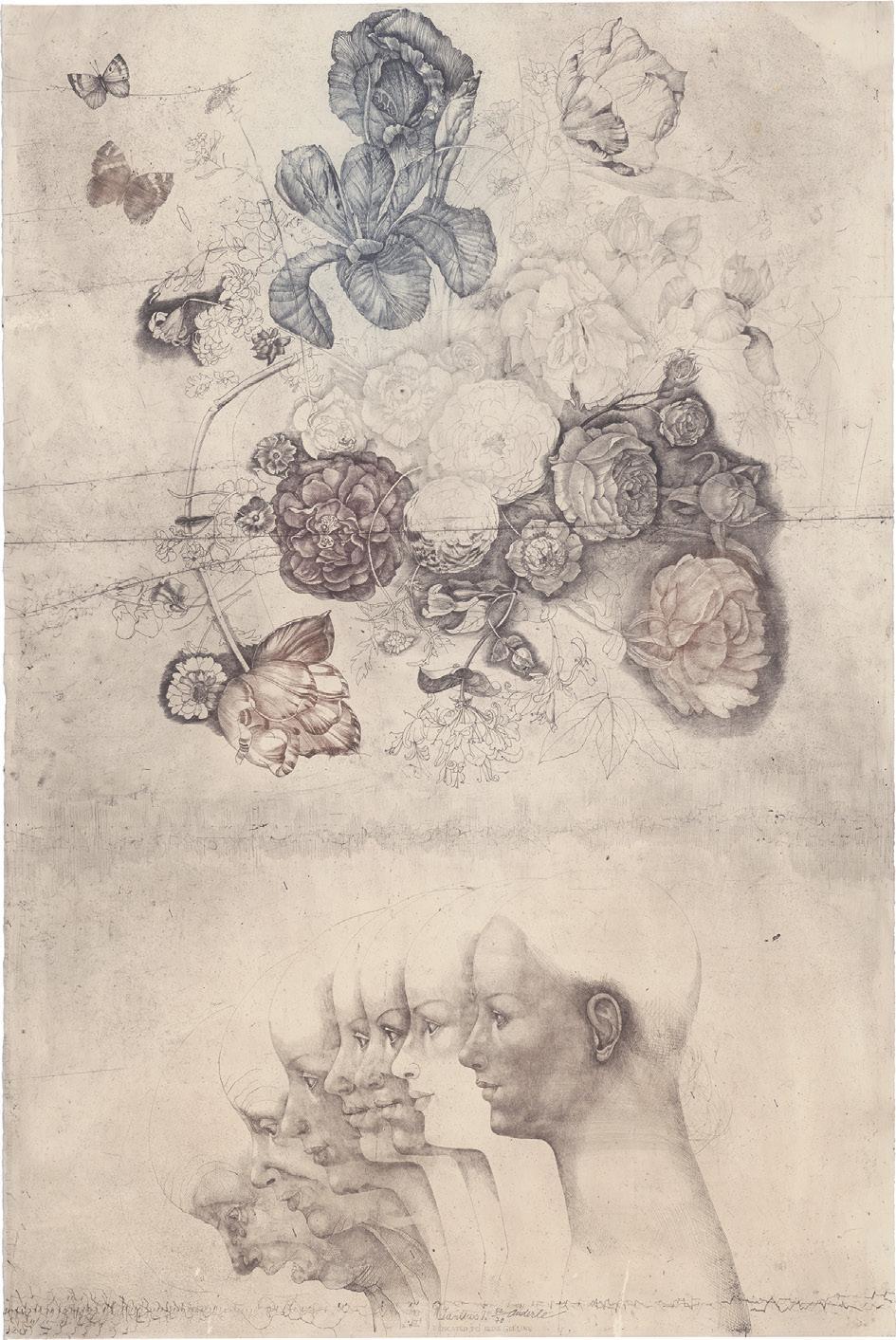
anderle
(1936 Pavlikov, Böhmen, lebt in Prag)
7241 Vanitas II
Farbradierung mit Vernis mou und Kaltnadel auf Van Gelder Zonen-Velin. 1983.
96 x 64 cm.
Signiert „Anderle“ und bezeichnet „248“. Auflage 70 num. Ex.
Nicht bei Spangenberg.
1.200 €
Großformatiges Blatt aus dem VanitasZyklus. Ganz ausgezeichneter, toniger und fein differenzierter Druck der formatfüllenden Darstellung, rechts und links mit dem Schöpfrand.
albin brunovsky
(1935 Zohor – 1997 Bratislava)
7242 „Labyrint sveta a raj srdca VI. Dnadlo sveta“
Farbradierung mit Mezzotinto auf Van Gelder ZonenVelin. 1990.
39,5 x 29,8 cm (64,5 x 47,8 cm).
Signiert „ABrunovsky“, datiert und betitelt sowie bezeichnet „E.(preuve d‘)A.(rtiste)“. Auflage 35 röm. num. Ex. 1.200 €
Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens VI. Tag der Welt so der Titel des Blattes auf Deutsch. Kontrastreiche Darstellung von surrealistischer Drastik. Die Gesamtauflage betrug 100 numerierte Exemplare. Prachtvoller, schön differenzierter Druck in Schwarz und Rotbraun mit dem wohl vollen Rand, oben mit dem Schöpfrand.
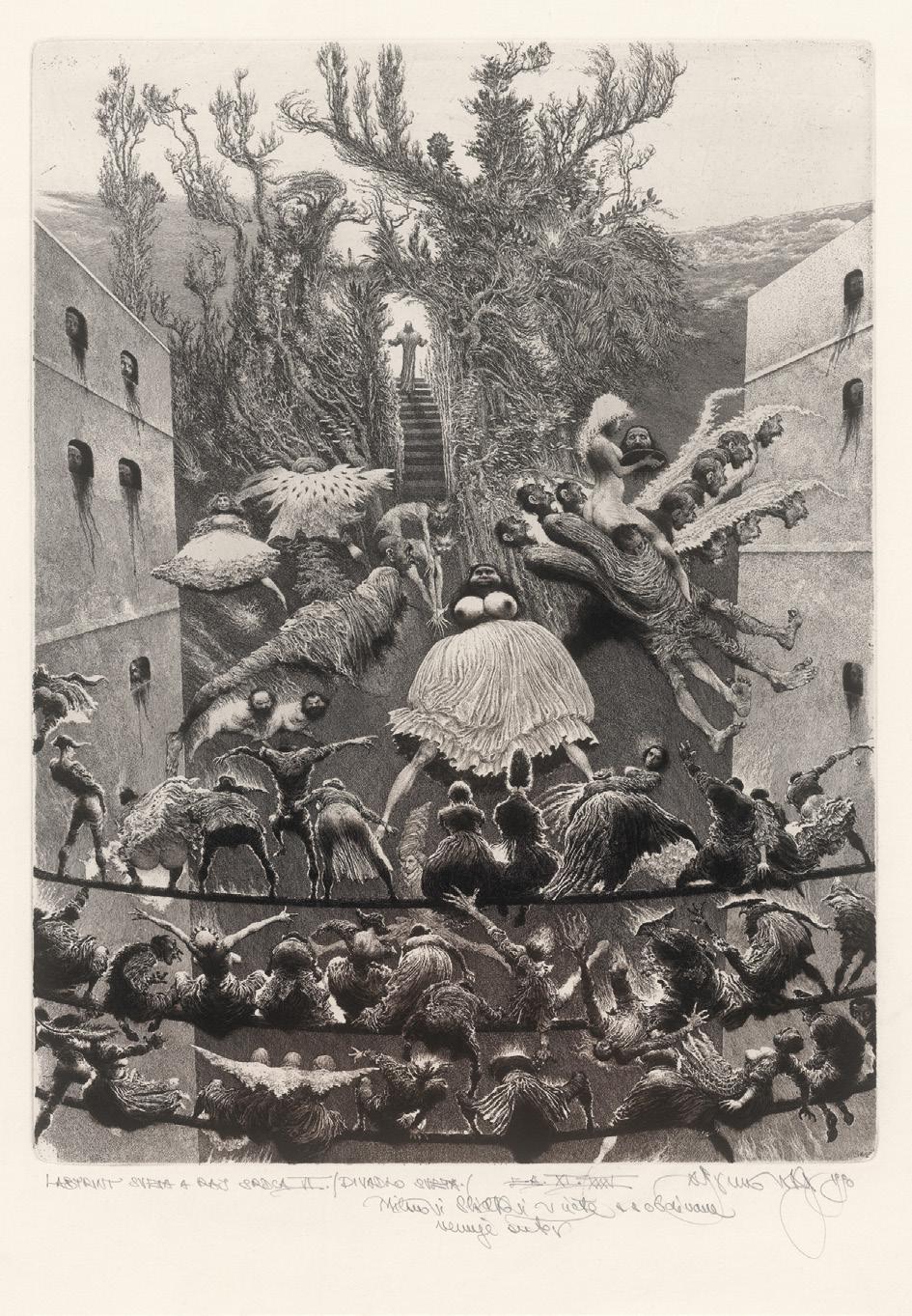
7242

7243
michael parkes
(1944 Sikeston/Missouri, lebt in Spanien)
7243* Pierrot
Öl auf Hartfaser.
35 x 30 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Hellgrau signiert „Parkes“.
1.500 €
Parkes‘ Malstil ist dem magischen Realismus nahe; die raffinierte Akkuratesse in der malerischen Ausführung paart sich bei ihm mit einer phantastischen, geheimnisvollen Motivik. Mit altmeisterlicher Präzision beschreibt er mit spitzem Pinsel Texturen, Konturen und Stofflichkeit. Der 1944 geborene und der Hippie Generation zugehörige Parkes suchte auf seiner Reise nach Indien meditative Erleuchtung. Er wird als der internationale „Swan King“ bezeichnet, und auch hier wird er mit der Darstellung des schlanken Schwanenhalses, der elegant und tröstend vorne im Bild über dem Arm des Pierrots liegt, und dem ziehenden Schwan im Hintergrund in seiner linienvollendeten Schönheit diesem Titel gerecht.

aliute mecys
(1943 Koblenz – 2013 Hamburg)
7244 Vakaras (Abend)
Acryl, Tempera und Öl auf Leinwand, auf Malpappe kaschiert. 1986.
61 x 42 cm.
Unten rechts in der Darstellung mit Pinsel in Schwarz signiert „MECYS“ und datiert.
5.000 €
Als Trompel‘œil gestaltet Mecys den Blick durch das zerbrochene Fenster, ein geisterhaftgrünliches Licht fällt von vorne rechts auf das ernste Gesicht der Künstlerin. Wie so häufig, ist sie selbst hier die Protagonistin ihrer Darstellung. In fast hyperrealistischer Akkuratesse gestaltet Mecys das Bildnis vor dem kargen Landschaftsausschnitt. „Hier reflektiert die Malerin das Schicksal zunehmen
der Vereinsamung. Die zerbrochene Fensterscheibe ist eine Chiffre für zerstörte Kommunikation. Auch hier wird wieder das Eingeschlossensein zum Ausdruck für eine existenzielle Grunderfahrung des leidenden Menschen.“ (GerdWolfgang Essen, in: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990. o.S.).
Provenienz: Ehemals Galerie in Flottbek, Hamburg (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet, datiert und betitelt)
Ausstellung: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990 (mit farb. Abb. sowie Abb. auf dem Vorderumschlag)
aliute mecys
7245 Maler und Modell
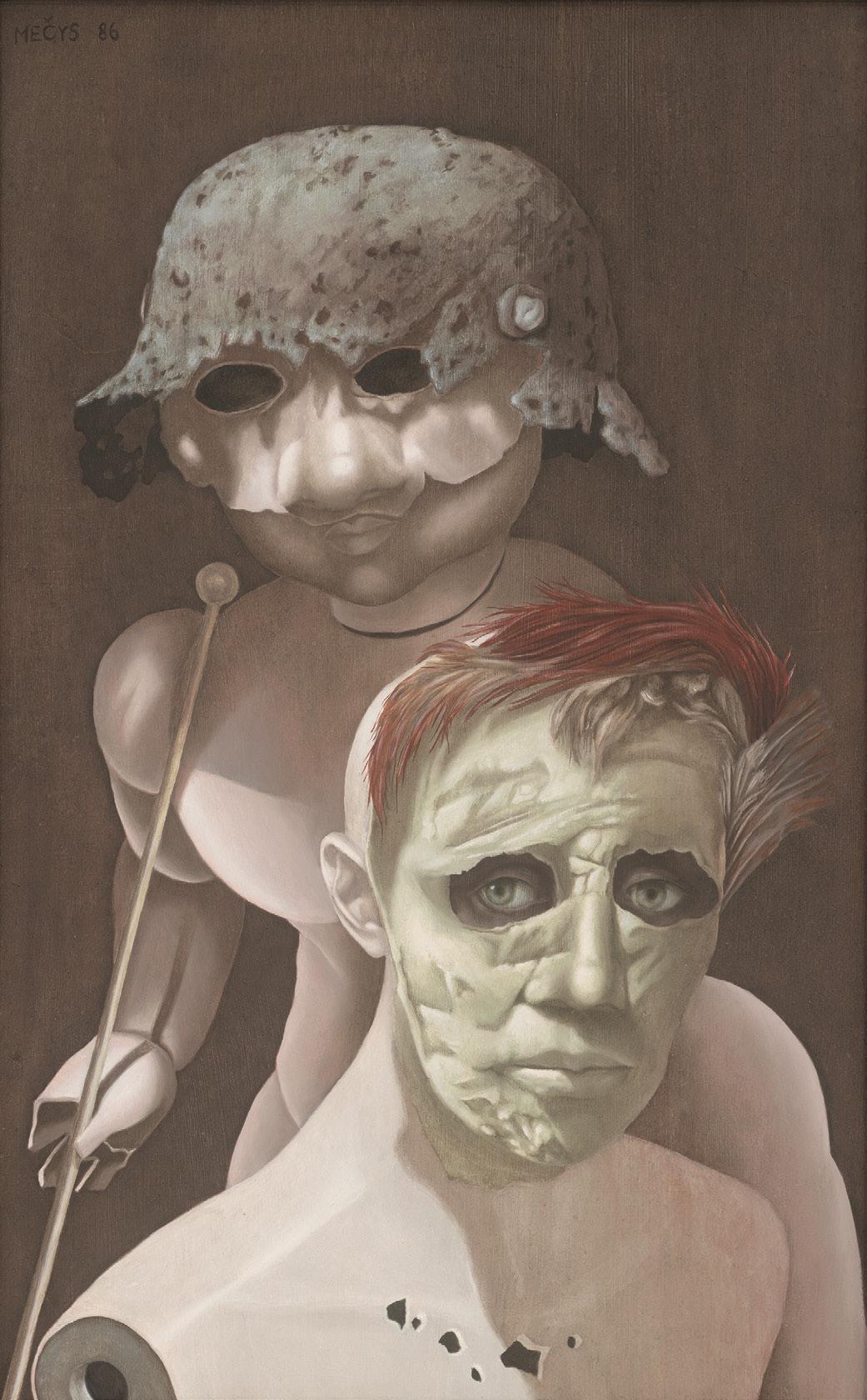
Acryl, Tempera und Öl auf Malpappe. 1986.
55 x 35 cm.
Oben links mit Pinsel in Schwarz signiert „MECYS“ und datiert.
4.000 €
Puppenhaft wirken beide Gestalten, der Maler wie auch sein Modell. Allein die lebendigen Augen hinter der Gesichtsmaske weisen die lädierte Figur im Vordergrund als Mensch aus, während in den
Augenlöchern der anderen, zweiten Maske nur schwarze, leere Höhlen klaffen. Ein Bild des Verfalls, der Traurigkeit, des ahnungsvollen Abwartens: „Der schöne Schein, mit dem die Kunst die Welt so gerne verklärt, ist hier einer düsteren, beklemmenden Grundstimmung gewichen.“ (GerdWolfgang Essen, in: Aliute Mecys, Gemälde, Galerie in Flottbek, Hamburg 1990. o.S.).
Provenienz: Ehemals Galerie in Flottbek, Hamburg (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch bezeichnet, datiert und betitelt)
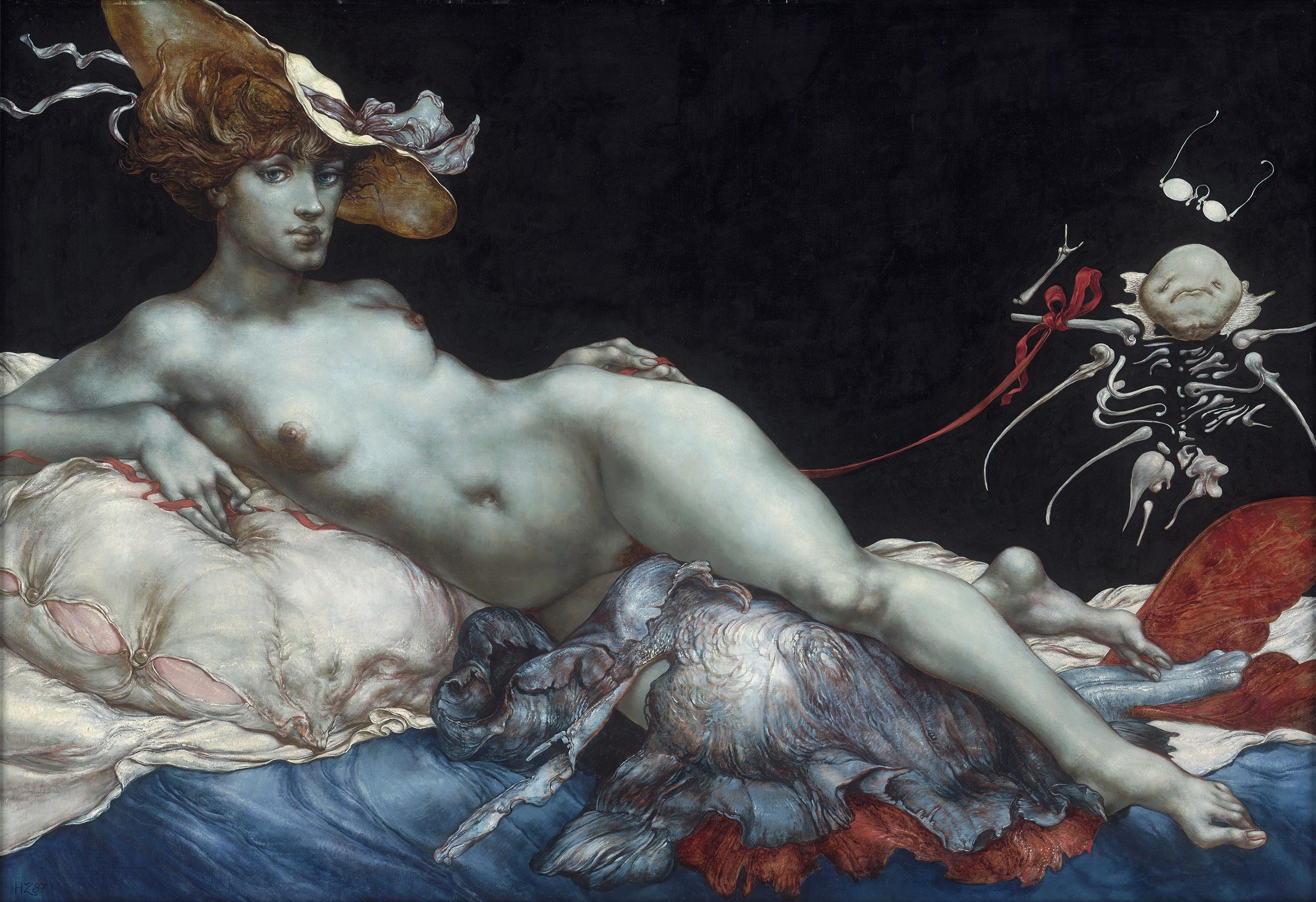
heinz zander (1939 Wolfen – 2024 Leipzig)
7246 Liegende mit schwebenden Gebeinen Öl auf Hartfaser. 1987.
70 x 100 cm.
Unten links mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „HZ“ und datiert.
12.000 €
Verführung und Morbides, Reiz und Bedrohung liegen hier dicht nebeneinander. Die Schönheit und die Abgründigkeit der Welt zeigt Zander mit seinem charakteristischen, altmeisterlich wirkenden Malstil. Unterschiedliche Bilderzählungen deuten sich in der Darstellung synchron an, vor allem aber scheint sich Zander auf das Motiv von Venus und Amor am Band zu beziehen. Das sinnlich durchmodellierte Gesicht und der reizvoll drapierte Körper der Frau wirken zunächst anziehend, das marmorbleichsteingraue Inkarnat erschreckt jedoch in seiner Kälte und Perfektion, während das pralle Kissen unter ihrem Oberkörper vergleichsweise lebensvoll erscheint. Erschreckend sind auch die Attribute der liegenden Schönheit: Neben der am roten Bändchen schwebenden Knochenassemblage mit angedeuteten Flügeln liegen unter ihren Beinen unbestimmbare, an die Haut eines Tieres oder einen Vogelbalg erinnernde, schlaffgewundene Objekte. Besonders effektvoll wirkt die virtuos in detailreicher Manier umgesetzte Szenerie durch den Kontrast mit der Leere des tiefschwarzen Hintergrundes.
Provenienz:
Erhard Kaps, Leipzig (Geschenk des Künstlers)
Privatbesitz Leipzig



gerald müller-simon (1931–2023, Leipzig)
7247 „Altes Haus in Leipzig“ Öl auf Hartfaser. 1991.
60 x 70 cm.
Unten rechts (in die feuchte Farbe geritzt) signiert „Müller Simon“ und datiert, verso mit Pinsel in Schwarz nochmals signiert „Gerald Müller-Simon“, datiert, betitelt und mit der „Werknummer „91005“.
2.000 €
Von leicht erhöhtem Standpunkt aus fällt der Blick auf das schiefe, dem Einsturz nahe Leipziger Haus, wohl im Musikerviertel der Stadt Die Oberfläche der pastosen Farbschichten ist plastisch durchgestaltet und verleiht den Bildmotiven eine jeweils ganz eigene, stimmige Struktur. Die zurückgenommene Palette korrespondiert mit der damaligen Realität der noch vielfach unsanierten Straßenzüge Leipzigs, deren nahenden Verfall der Künstler sensibel protokolliert.
Provenienz:Privatbesitz Sachsen
7248 „Stilleben“ Öl auf Hartfaser. 1999.
40 x 45 cm.
Verso mit Kreide in Schwarz signiert „Müller Simon“, datiert, betitelt und bezeichnet „Öl“.
1.200 €
Im hellen Licht der Bildmitte gruppieren sich die Objekte auf einem weißen Tisch, umgeben von der Stille des dunkelgrauen Umraumes. Das Schimmern der differenziert abgestimmten, fein abgetönten
Nuancen von Blau und Rosawerten erfüllt die intime Szenerie, gestaltet in neoimpressionistisch lockerem Duktus. Nach einer Ausbildung als KeramikLithograph studierte MüllerSimon bei Heinz Wagner an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.
Provenienz: Privatbesitz Sachsen
annette schröter (1956 Meißen, lebt in Leipzig)
7249 „Blaue Studie“ Öl auf Leinwand. 1995.
40,5 x 50 cm.
Unten links (in die feuchte Farbe geritzt) monogrammiert „A SCH“ und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz datiert, betitelt und bezeichnet „2“.
2.000 €
Annette Schröter, eine der wichtigsten Vertreterinnen der Neuen Leipziger Schule, gestaltet die „Blaue Studie“ in expressivem Pinselduktus und reliefhaftpastosem Farbauftrag, der den liegenden weiblichen Akt auf den ersten Blick wie eine abstrakte Komposition erscheinen lässt. Die menschliche Figur, mit breitem Pinselstrich, konzentrierter Abstraktion und reduzierter Palette von Blau und Grüntönen erfasst, steht vielfach im Mittelpunkt ihrer Arbeiten. Annette Schröter studierte bis Anfang der 1980er Jahre unter Bernhard Heisig Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, wo sie von 2006 2022 eine Professur innehatte.
Provenienz: Privatbesitz Sachsen
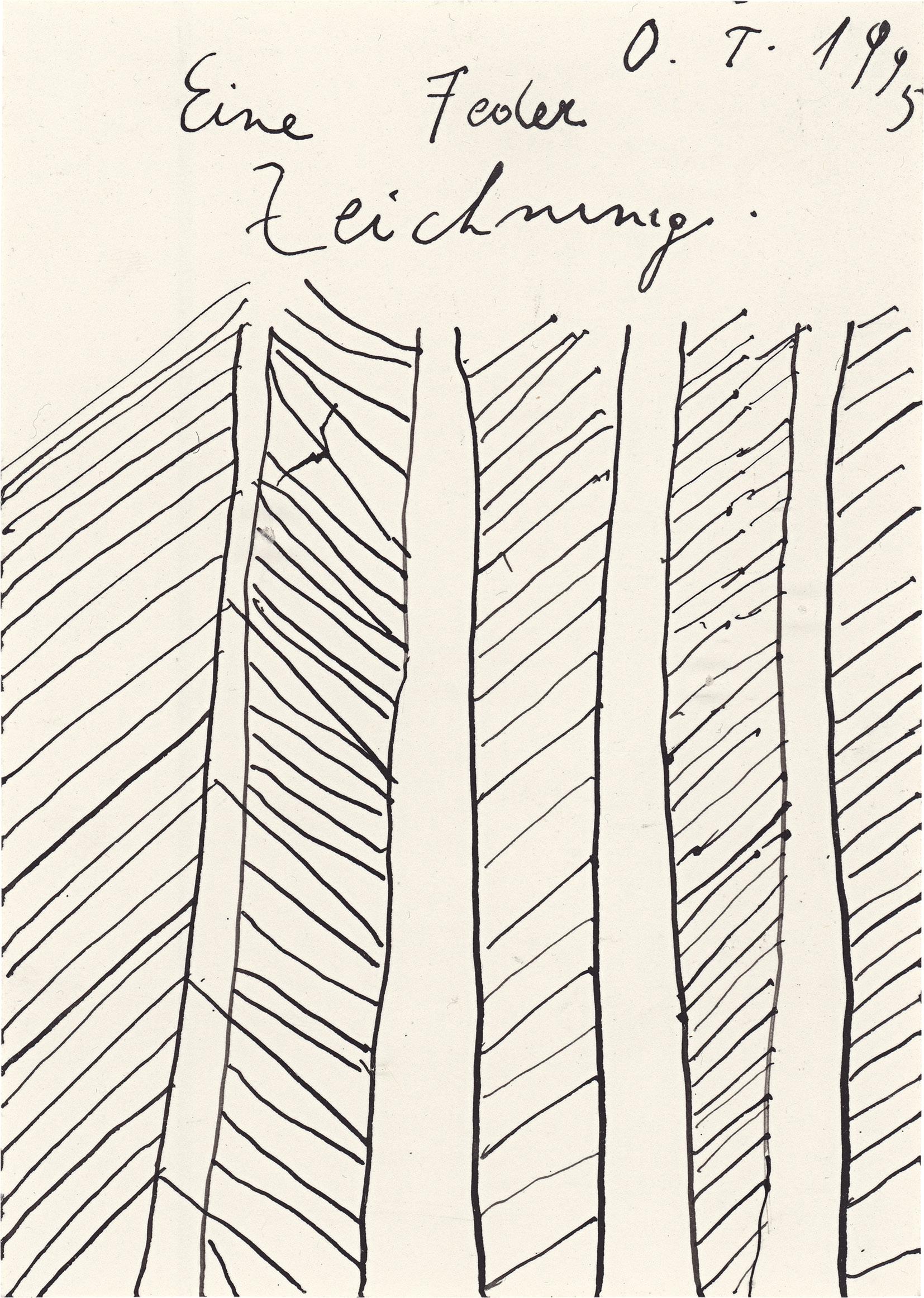
oswald tschirtner
(1920 Perchtoldsdorf – 2007 Maria Gugging)
7250 „Eine Feder Zeichnung“ Feder in Schwarz auf Velin. 1995. 14,8 x 10,4 cm.
Oben rechts mit Feder in Schwarz monogrammiert „O.T.“ und datiert, oben mittig betitelt.
1.500 €
Das Thema ist wie immer oben auf dem Blatt notiert, und Tschirtner füllt das Format dementsprechend mit Federstrukturen. Von
schweren Kriegserlebnissen traumatisiert, lebte er seit 1947 in der psychiatrischen Anstalt Gugging. Von dem Psychater Leo Navratil zu einer künstlerischen Tätigkeit ermutigt, entwickelte er eine zugespitzt minimalistische Zeichenweise, aus der er, meist im kleinen Format, verdichtete und ebenso eigenwillige wie reizvolle Skizzenbilder entwickelte. Er gilt heute als wichtiger Vertreter der Art Brut.
Provenienz: Galerie Oliver Bittel, München Privatbesitz Berlin
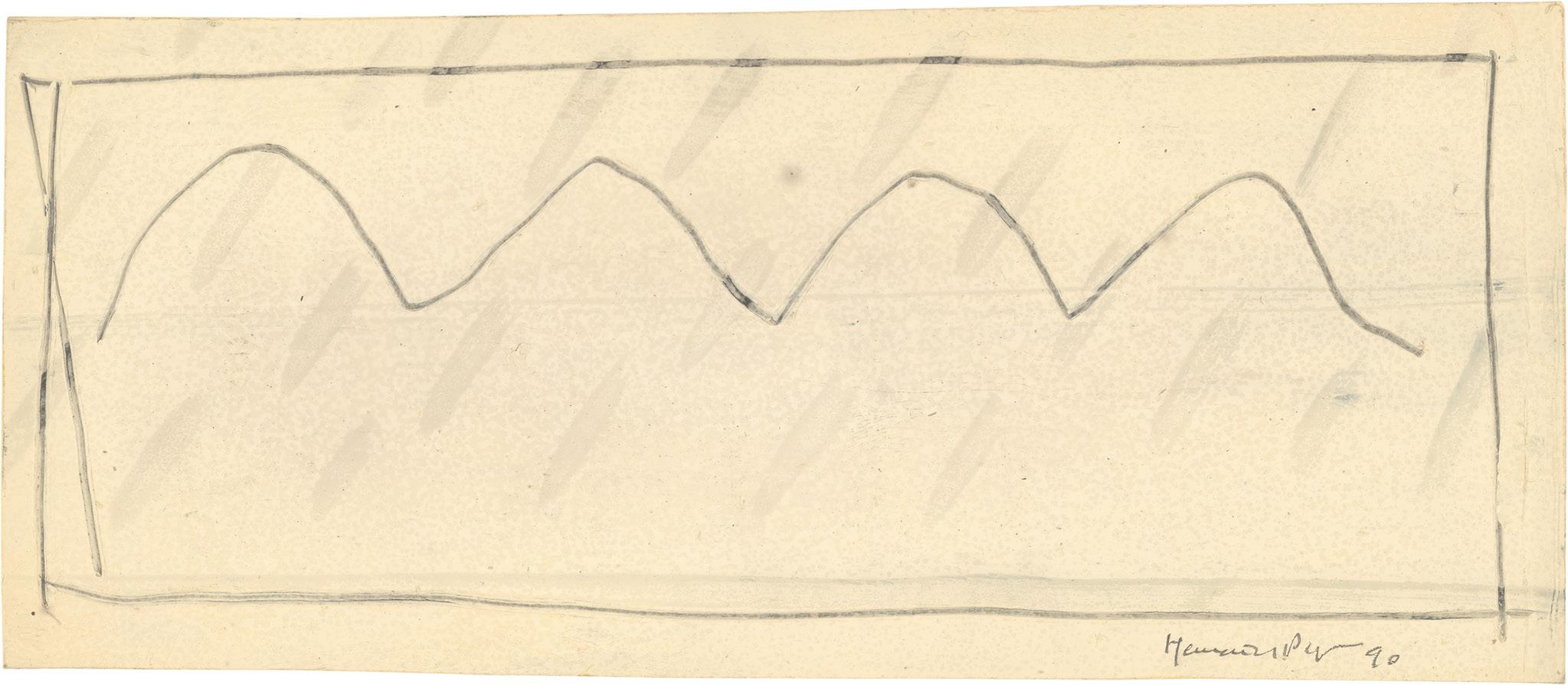
joan hernández pijuan (1931–2005, Barcelona)
7251 Serie Groc de Napols (2) Öl auf Arches-Karton. 1990.
12,5 x 29,5 cm.
Unten rechts mit Bleistift (in die feuchte Farbe geritzt) signiert „Hernandez Pijuan“ und datiert, auf der Rahmenrückseite auf Klebeetikett mit der Werknummer „HP. 142“. 2.000 €
Von geradezu lakonischer Reduktion zeigt sich die vermutlich von der kargen Landschaft Kataloniens beeinflusste, meditativ erscheinende Komposition. Dezent liegen subtil abgetönte, kurze, schräg nach rechts oben weisende Pinselakzente unter der nahezu monochromen Fläche, in deren dicke Schicht feuchter Farbe der Künstler mit einem Kohlestift seine Wellenschwünge ritzt und sie mit Einfassungslinien versieht. So legt er mit einem fast kalligraphischen, konzentrierten Gestus darunterliegende Farbschichten frei Joan Hernández Pijuan zählt zu den wichtigsten Gegenwartskünstlern Spaniens, sein Werk ist weit über die Landesgrenze hinaus bekannt. Im Jahr 2012 würdigte ihn das Museum Reina Sofia in Madrid mit einer umfassenden Retrospektive.
Provenienz:
Galeria Joan Prats, New York (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort typographisch datiert, betitelt und bezeichnet sowie bezeichnet „HP. 142“)
Privatbesitz Süddeutschland
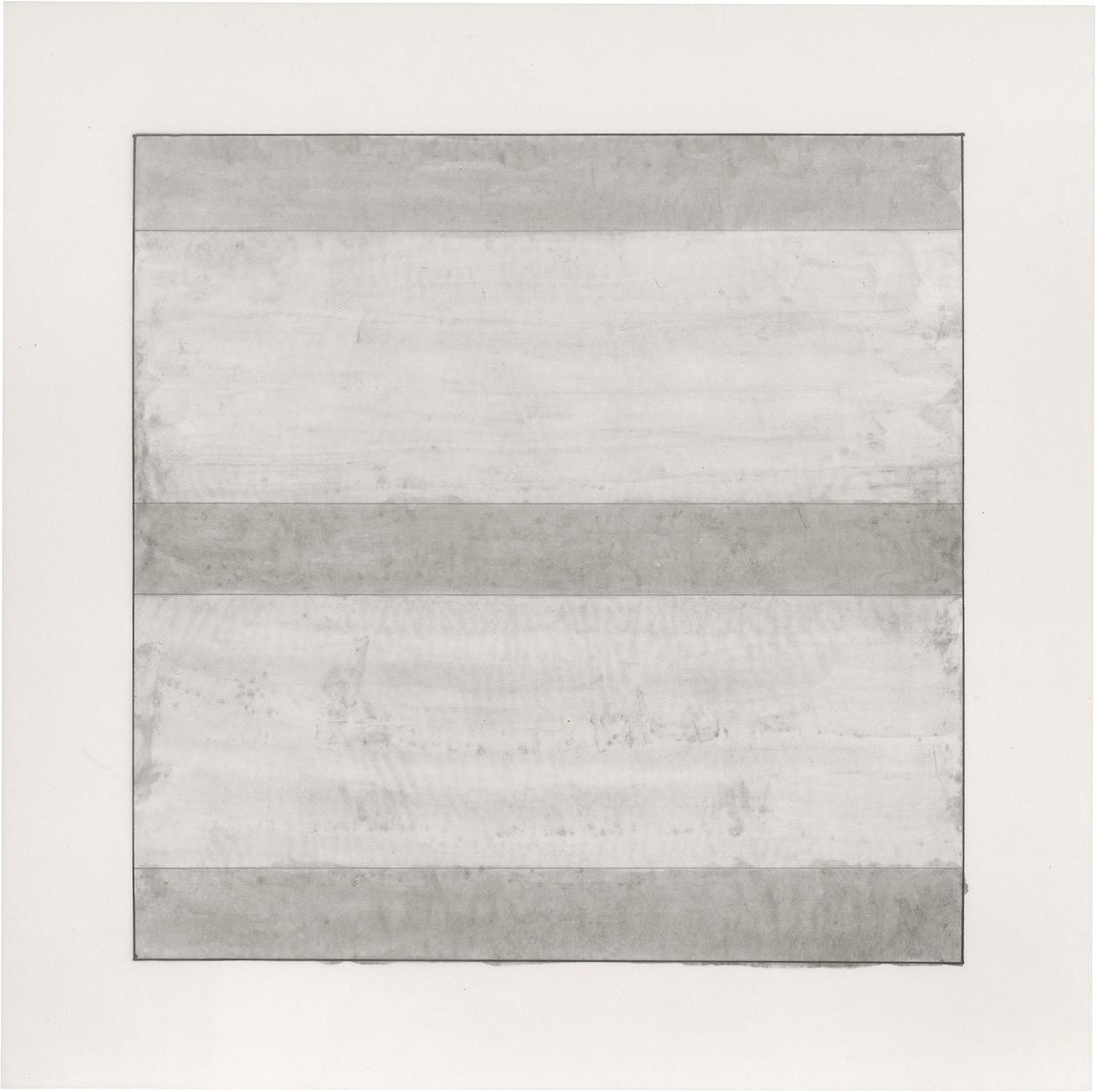

agnes martin (1912 Macklin, Kanada – 2004 Taos, New Mexiko)
7252 Paintings and drawings 19741990 10 Lithographien bzw. Farblithographien auf Pergamin sowie Begleitheft und Ausst.-Katalog. Lose in Orig.-Kartonportfolio. 1991.
Je 29,8 x 29,8 cm.
Auflage 2500 Ex.
2.400 €
Westliche ästhetische Vorstellungen und östliche Philosophie überlagern sich im kontemplativ wirkenden Schaffen der Künstlerin; Malen war für sie stets auch Bewusstseinsentwicklung. Rhythmik und Stille prägen die feinsinnigen Kompositionen. Die komplette Folge von Lithographien nach Werken von Agnes Martin, alle im von ihr bevorzugten quadratischen Format. Entstanden für die Vorzugsausgabe des Kataloges zur Retrospektive der Künstlerin im Stedelijk Museum, Amsterdam u.a., 1991. Erschienen in der Edition Nemela & Lenzen, Mönchengladbach und des Stedelijk Museum, Amsterdam. Gedruckt bei Nemela & Lenzen in Mönchengladbach. Prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand.
peter collingwood (1922 London – 2008 Nayland)
7253 Tapestry
Weberei und Knüpftechnik. Schwarzes Leinengarn und Stahlstreben.
Bis 180 x 90 cm.
Verso an der untersten Strebe auf Metallplakette signiert (graviert) „P. Collingwood“ und mit der Werknummer „M.131 No. 8“.
5.000 €
Luftiggeometrische Weberei des bedeutenden britischen Textilkünstlers. Ausgebildet bei den Weberinnen Ethel Mairet in Ditchling, bei Barbara Sawyer und Alastair Morton und, als Arzt beim Roten Kreuz in der Flüchtlingshilfe engagiert, inspiriert von jordanischen Beduinenwebereien, begann Collingwood ab 1952, in seiner eigenen Werkstatt im Norden Londons, an selbst konstruierten Maschinen die ersten Teppiche zu weben. Seit 1962 stellte er in Nayland seine komplex konstruierten Wandbehänge in faszinierend vielfältigen Kompositionen her, die mit einem reduzierten Farbschema und feinsinnigen geometrischen Mustern stellenweise keltischen Knotentechniken oder afghanischen Teppichwebereien ähneln. Durch seine innovative Technik des „Shaftswitching“ und der „Macro Gauze“ ließ er die traditionelle Beschränkung der Weberei auf gerade Linien und Seiten hinter sich. Seine hängenden, skulpturalen Arbeiten, die feinen Netzen ähneln, bewegen sich, bereichert um ein lebendiges Schattenspiel an der Wand, in ihrer Wirkung in den dreidimensionalen Raum hinein. Beigegeben: Peter Collingwood, The Techniques of Sprang. Plaiting on Stretched Threads, New York, Watson Guptill, 1974.
Provenienz: Privatsammlung Dänemark
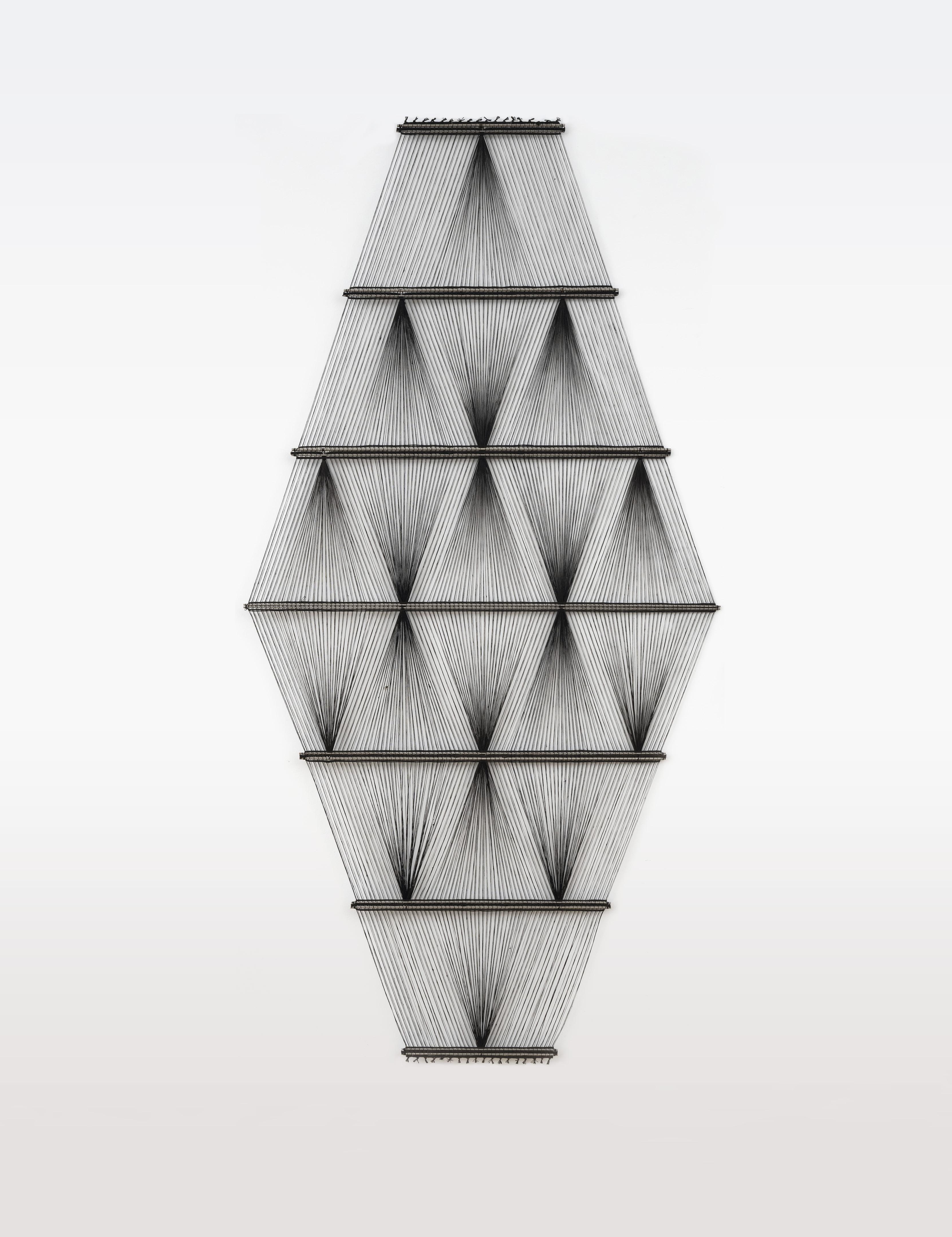

helmut federle
(1944 Solothurn, lebt in Wien)
7254 „Black Series III“ 18-teilige Folge von Zeichnungen. Öl auf verschiedenen Papieren. 1991.
24 x 34 cm.
Jeweils verso mit Bleistift signiert „HFederle“, monogrammiert „HF“, datiert, bezeichnet „Wien“ und numeriert sowie mit dem Künstlerstempel, dort betitelt und bezeichnet.
50.000 €
Die aus 18 Einzelblättern bestehende „Black Series III“ umfasst eine Folge streng linear angeordneter gleichgroßer Zeichnungen, welche sich, von einem einzelnen horizontalen Balken ausgehend,
in kontinuierlicher Zugabe weiterer Balken zu einer immer dichter werdenden Gitterstruktur entwickeln. Einem strengen Additionsprinzip folgend, sind die Blätter identisch mit ihrer eigenen Zählung und beziffern gleichsam ihre Position innerhalb der Reihung. Der Schweizer Maler Helmut Federle thematisiert in mehrfacher Hinsicht das Verhältnis zwischen Bild und Zahl. „Federles Darstellungsweise (kommt) den Stäbchenziffern der chinesischen Zahlenschrift am nächsten, die auf der strikten Alphabetisierung senkrechter und waagrechter Striche beruht. Im Jahr 1985 bereist Federle China, von dessen Kultur er sich besonders angezogen fühlt. Berührungen mit der chinesischen Kunst schlagen sich sowohl in einer Reihe neuer SchwarzweißBilder als auch in der Auseinandersetzung mit fernöstlicher Kalligraphie nieder.“ (Helmut Federle, Ausst.Kat. Kunsthaus Bregenz, Bregenz 1999, S.113)
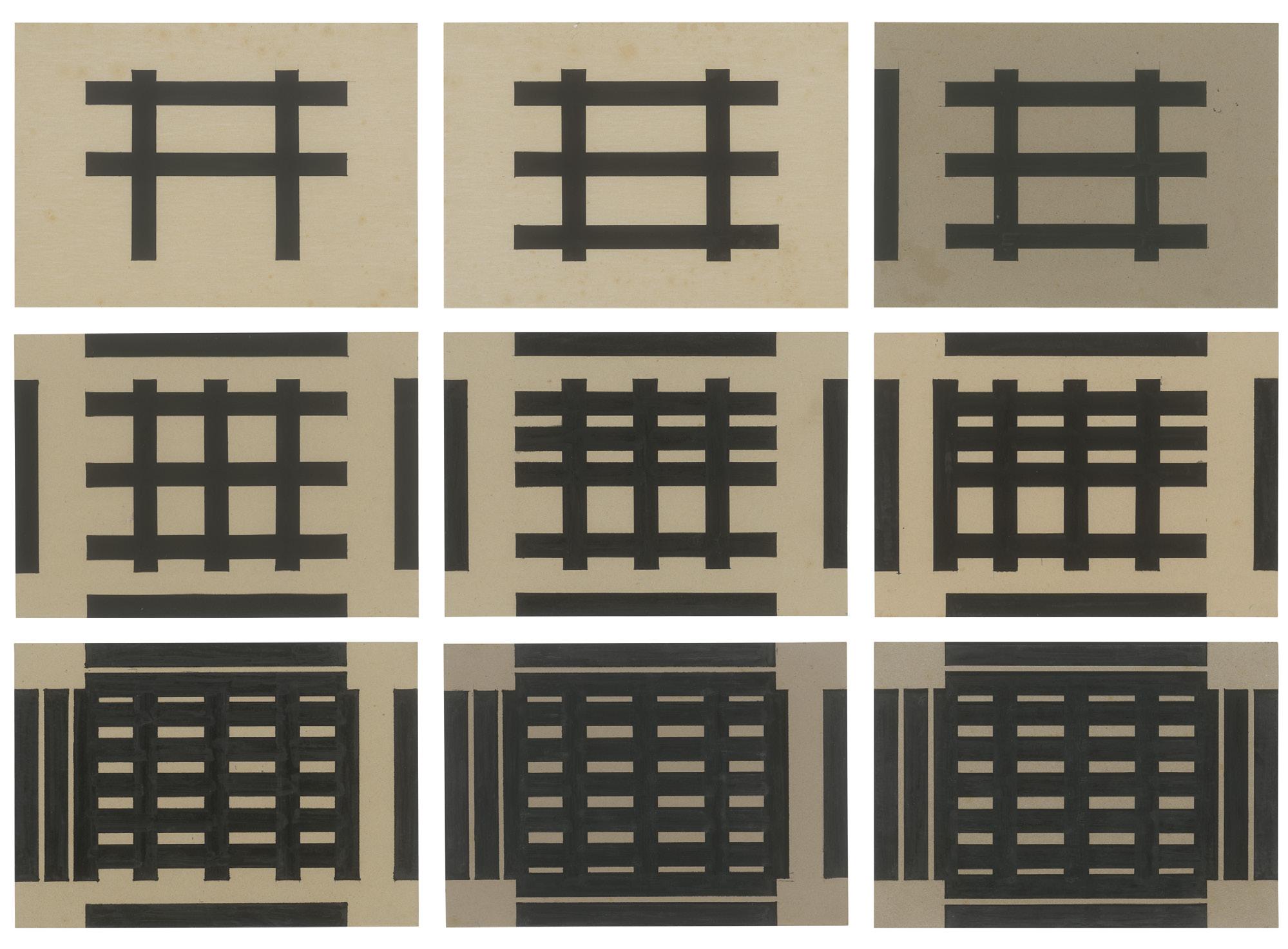
Im gesamten Oeuvre von Helmut Federle nehmen das Zeichnerische und Arbeiten auf Papier einen hohen Stellenwert ein. Seine Zeichnungen zeugen von der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit geometrischen Formen und ihren Balanceverhältnissen auf der Bildfläche. Seine Werke sind in zahlreichen Museumssammlungen vertreten, darunter die Tate Modern, London, und das Centre Pompidou, Paris. 1997 vertrat er die Schweiz auf der Biennale in Venedig.
Provenienz:
Galerie Susanne Kulli, St. Gallen (verso mit deren Klebeetikett, dort mit den Werkangaben)
Galerie nächst St. Stephan, Wien (dort erworben 1995)
Privatbesitz Berlin
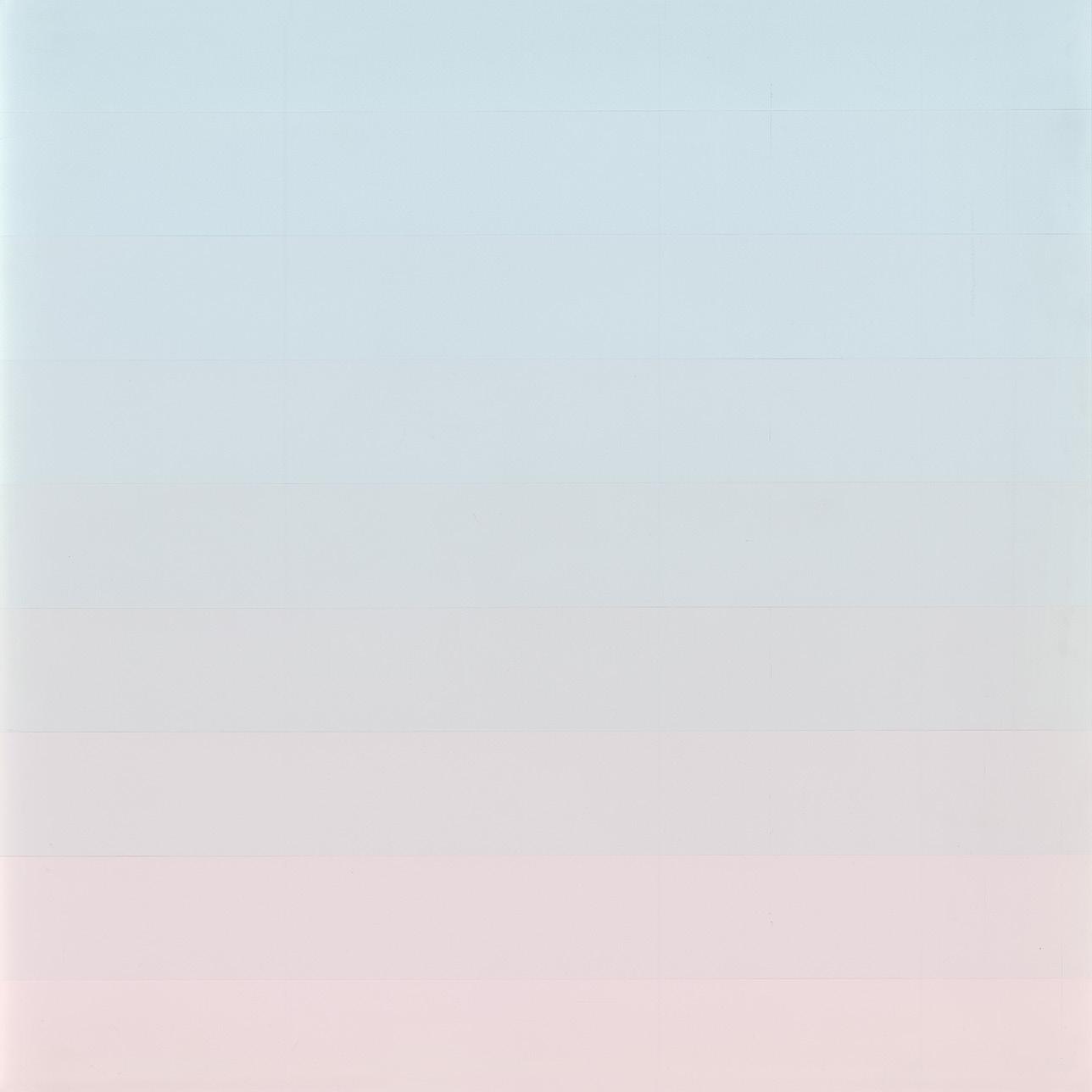
7255
christian roeckenschuss (1929 Dresden – 2011 Berlin)
7255 Ohne Titel (K326)
Alkydharzfarbe auf Phenapan. Um 1980.
100 x 100 cm.
Verso mit Faserstift in Schwarz mit der Werknummer „K326“.
2.200 €
Zwischen Zartblau und Hellrosa changierende Streifenkomposition des Künstlers mit irisierender Wirkung. „Séquences chronomatiques“ (Farbstufenbilder) nennt Roeckenschuss, wichtiger Vertreter des frühen Minimalismus, seine um 1975 begonnene und bis um 2000 fortgesetzte Serie von streng vertikal angelegten Streifenbildern. Er malt oder collagiert dazu Reihungen vertikaler farbiger Streifen, mal schmal und lang, mal breit und kurz, immer jedoch stehen die Streifen in einem raffinierten mathematischmusikalischen System zueinander. Seine Arbeiten sind in internationalen Sammlungen wie beispielsweise dem Museum of Modern Art in New York, der Sammlung der Deutschen Bank sowie der Daimler Chrysler Collection vertreten. Im Künstlerrahmen.
Provenienz:
Köppe Contemporary, Berlin (dort erworben 2020) Privatbesitz Brandenburg
alexander koshin (1949 Archangelsk)
7256 „ФРАГМЕТЬI “ ( FRAGMENTE )
Öl und Mischtechnik auf Leinwand, im Künstlerrahmen. 1990.
85 x 100 cm.
Verso mit Pinsel in Schwarz kyrillisch signiert „A. Koshin“, datiert und betitelt sowie mit Pinsel in Rot mit den Maßangaben und dem (undeutlichen) Adreßstempel des Künstlers (?).
800 €
Ein Echo des Einflusses von Malewitsch findet sich in der Grundform des Quadrates, die die reduzierte Komposition prägt. Rote Bogenfragmente in unterschiedlicher Krümmung beleben mit ihrer rhythmischen Anordnung jedes einzelne dieser Quadrate, deren sensibel gestaltete Textur einen Hauch von Rot durch die weißen, bewegten Farbmassen schimmern lässt. Koshin, ausgebildet bei dem MalewitschSchüler Wladimir Sterligow in Leningrad, gehörte zu den Mitbegründern des SterligowKreises.
Provenienz: Privatbesitz Berlin (direkt beim Künstler erworben)

7256
bernar venet
(1941 Château-Arnoux-Saint-Auban, lebt in New York)
7257 Random Combination of Indeterminate Lines Kaltnadel und Aquatinta auf Velin. 1996. 27,7 x 21,7 cm (57 x 43,2 cm).
Signiert „Bernar Venet“ und datiert. Auflage 40 num. Ex. 1.500 €
Die feine Horizontlinie und minimale, lediglich angedeutete Schatten verleihen der reduzierten Komposition eine beeindrukkende Räumlichkeit. Herausgegeben vom Graphicstudio USF, Tampa, mit dessen Blindstempel unten rechts und dem Editionsstempel verso. Prachtvoller, in den Schwärzen samtiger Druck mit zartem, homogenem Plattenton und tief eingeprägter Plattenkante, mit dem wohl vollen, sehr breiten Rand.

7257
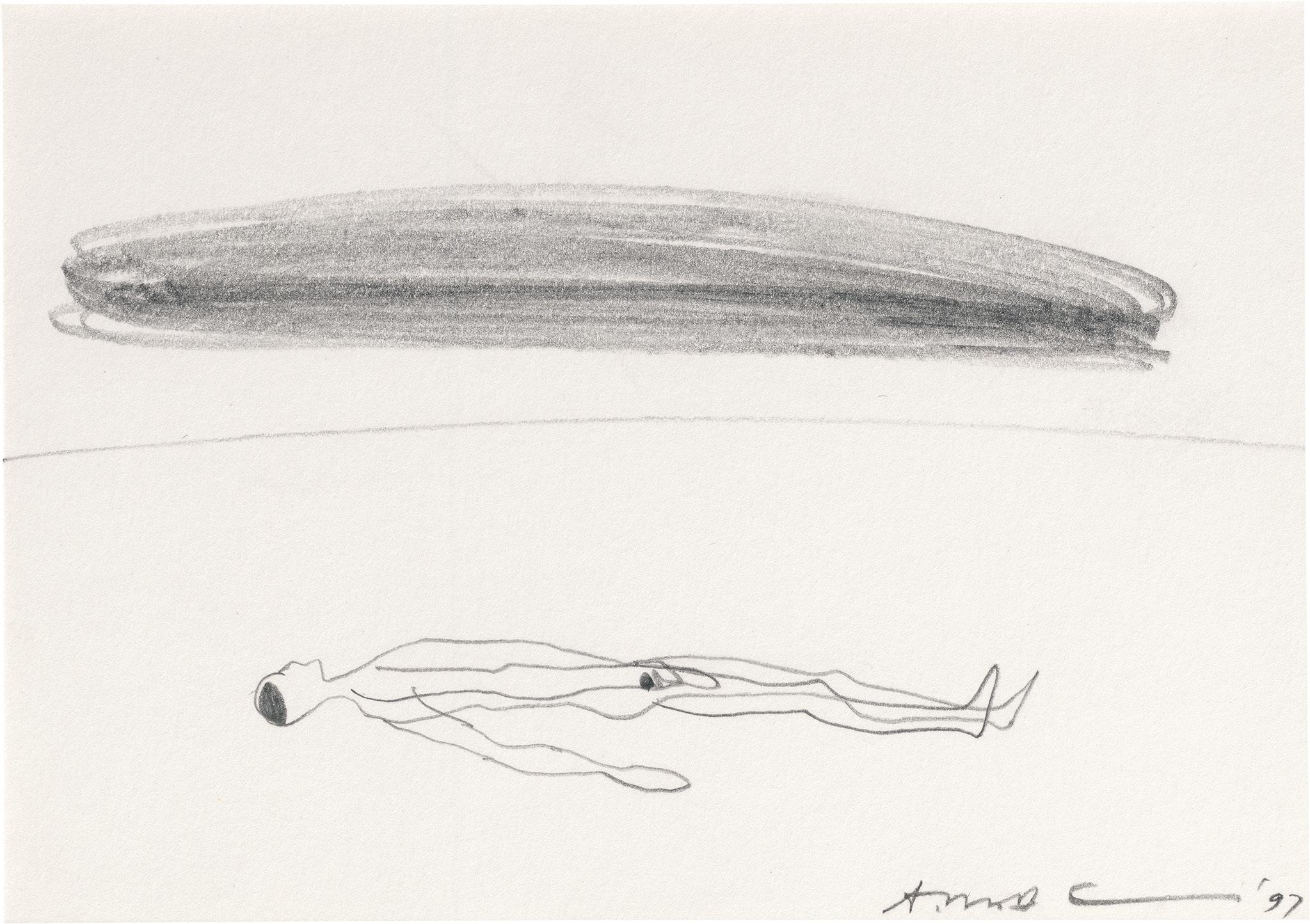
7258
antony gormley (1950 London)
7258 Ohne Titel
Bleistift auf festem Velin. 1997. 10,5 x 14,8 cm.
Unten rechts mit Bleistift signiert „Antony Gormley“ und datiert.
3.000 €
Ein liegender, frei im Raum schwebender Männerkörper. Darüber, etwas größer, eine ebenso frei schwebende Wolke aus Dunkelheit, wie ein vom Körper gelöstes Bewusstsein. Beides hält Gormley mit fließendem Strich fest und setzt als Trennung eine Waagerechte dazwischen. Der menschliche Körper und seine Beziehung zum Raum steht vielfach im Zentrum des künstlerischen Schaffens Gormleys. Immer wieder bezieht der Bildhauer die Arbeit ganzer sozialer Gruppen in den Werkprozess ein und beruft sich dabei auf Joseph Beuys’ Begriff der Sozialen Plastik. Im Interview mit Udo Kittelmann sagt Gormley zu seiner Körperauffassung: „The body is a spaceship and an instrument of extreme subtlety, that communicates whether we recognise its communications consciously or not.“ (in: From Total Strangers, Köln 1999, zit. nach antonygormley.com, Zugriff 16.09.2025).
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
wieland förster
(1930 Dresden, lebt in Oranienburg)
7259 Liegender weiblicher Akt
Bronze mit brauner Patina. 1994.
10,5 x 24 x 6,5 cm.
Verso am Sockel monogrammiert „fö“, unter dem Stand mit dem Gießerstempel „GUSS HANN“. Auflage 10 Ex. Förster 283.
1.200 €
Lebendig geschwungene parallele Furchen setzt Förster wie Binnenschraffuren in die Oberfläche des abstrahierten Frauenaktes.
Auf einem kleinen, unter der Hüfte angebrachten Bronzesockel liegend, scheint der Torso beinahe zu schweben. Der weibliche Akt beschäftigt den Bildhauer, Zeichner, Maler und Schriftsteller in

zahlreichen seiner Arbeiten. Wieland Förster studierte 1953 bis 1958 in Berlin Bildhauerei bei Walter Arnold sowie Hans Steger und war 1959 Meisterschüler bei Fritz Cremer. Er war von 1979 bis 1990 Vizepräsident der Akademie der Künste der DDR und schuf zahlreiche Großplastiken für den öffentlichen Raum, und in seinem Werk setzt sich die bedeutende figürliche Bildhauertradition Berlins fort Entsprechend den handschriftlichen Anmerkungen von Angelika Förster im Werkverzeichnis ist die Auflage ausgegossen; es handelt sich um eine Künstleredition, geschaffen zusammen mit dem „Kleinen Torso mit angewinkeltem Bein“ und dem „Kleinen bewegten Torso“. Entstanden in der Kunstgießerei Wilfried Hann, Wegendorf. Ganz prachtvoller Guss mit ausdrucksvoller Patina. Wir danken Eva Förster, Berlin, für freundliche Hinweise vom 25.09.2025.
Provenienz: Privatbesitz RheinlandPfalz
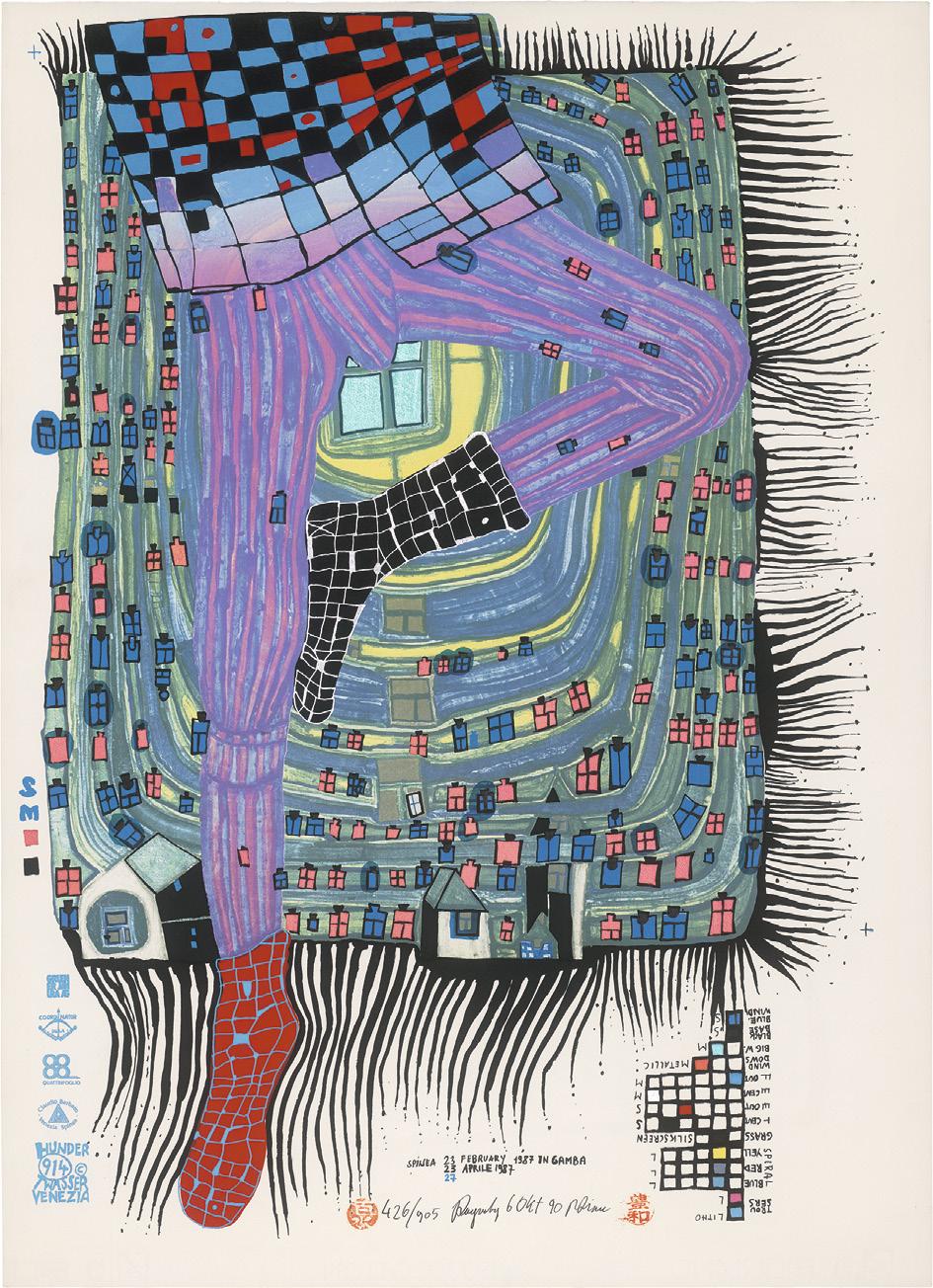
edgar hofschen
(1941 Tapiau – 2016 Radevormwald)
7261 „Modifikation 029“
Öl, Ponal und Papier auf Leinwand, im Künstlerrahmen. 1992.
110 x 100 cm.
Verso mit Kreide in Schwarz signiert „Hofschen“, datiert, betitelt, mit den Maßangaben und Richtungspfeil sowie bezeichnet „Öl/Segelt./Ponal/Papier“.
800 €
Edgar Hofschen untersucht in seinen Modifikationen die Wirkung unterschiedlich gestalteter Farbflächen auf Segeltuch. Als Vertreter der „Analytischen Malerei“ beschäftigt er sich mit den Relationen zwischen Malgrund, Farbmaterial und Farbauftrag ebenso wie mit den Bedingungen, die der Malerei vom Bildträger und der Bildfläche gesetzt werden. Andere bekannte Vertreter dieser internationalen Bewegung der 1970er Jahre sind Antonio Calderara, Kuno Gonschior oder Raimund Girke. Hofschen ordnete seine Malerei in einzelnen Werkgruppen in alphabetischer Reihenfolge, die er „Modifikationen“ nannte. Die Ziffern hinter den Buchstaben in den Bildtiteln markieren die Position des jeweiligen Gemäldes innerhalb der Jahreszählung.
Provenienz: Privatbesitz Tschechien (direkt vom Künstler erworben)
friedensreich hundertwasser
(d.i. Friedrich Stowasser, 1928 Wien – 2000 auf einer Schiffsfahrt im Pazifik)
7260 In Gamba
Fotolithographie und Siebdruck mit Metallprägung auf festem Fabriano-Velin. 1990.
66,9 x 45,5 cm (69,6 x 50,3 cm).
Signiert „Regentag“, datiert und bezeichnet „Wien“. Auflage 905 num. Ex. Koschatzky 104.
1.200 €
Eines von 905 Exemplaren, gedruckt bei Claudio Barbato, Spinea (Siebdruck), Quattrifoglio (Fotolithographie) and Giuseppe Barbato (Metallprägungen), Spinea/Venice, koordiniert von Alberto della Vecchia, Venedig, mit deren vier Prägestempeln sowie verso mit den gedruckten Editionsvermerken. Mit den beiden japanischen Rotstempeln (inkan). Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.
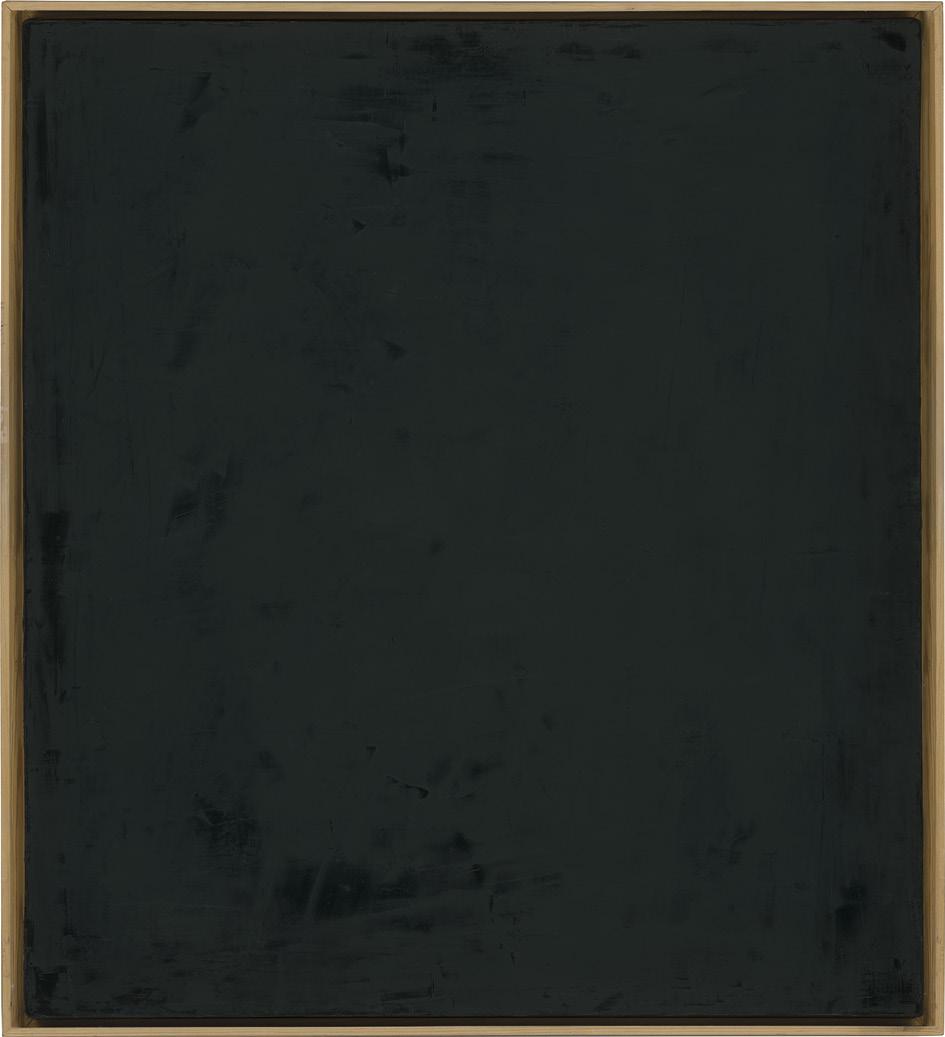

alfred hrdlicka (1928–2009, Wien)
7262 Buon Diavolo Bronze mit dunkelbrauner Patina. 2000.
10 x 17 x 11 cm.
Außen am linken Arm seitlich unten monogrammiert „A.H.“, auf der Standfläche mit dem Gießerstempel „GUSS A. ZÖTTL, WIEN“. Auflage 100 num. Ex. 1.500 €
In halb liegender Position, mit aufgestützten Armen und nach oben angewinkelten Beinen lacht der freundliche kleine Teufel dem Betrachter entgegen. Die locker durchgestaltete Oberfläche verleiht der Figur eine muntere Bewegtheit. Für Hrdlicka stehen der Mensch und seine Körperlichkeit im Mittelpunkt seines Schaffens. Prachtvoller Guss aus dem Spätwerk, nach einem Gipsmodell des Künstlers, mit lebendiger Patina.

noor mahnun (1964 Malaysia)
7263 Zwei Kartenspieler Öl auf Leinwand. Wohl 1990/91. 250 x 100 cm.
Im rechten Bildbereich mit Pinsel in Lila monogrammiert „AMM“, auf beiliegendem Fotozertifikat (in Kopie) nochmals signiert.
15.000 €
Noor Mahnun Mohamed, auch bekannt als Anum, ist Künstlerin, Kuratorin, Autorin und Dozentin. Nach einem Architekturstudium in den Vereinigten Staaten erlangte sie 1996 einen Master an der Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig. Ihre meist figura
tiven Werke zeigen häusliche Szenen und Stilleben, in denen Realismus, Allegorie und ein Hauch von Skurrilität zusammenfließen. In meist persönlichen Anekdoten aus dem Leben gibt die Künstlerin Einblicke in eine geheimnisvolle Mischwelt aus Erinnerungen und Fantasie. Obwohl die Figuren in ihrem Werk physisch überaus präsent erscheinen, wirken diese meist emotionslos und abwesend. Die spielerische Schlichtheit der Formen wirkt trotz oder möglicherweise aufgrund ihrer charmanten Naivität mysteriös. Wie auf einer Bühne präsentiert die Künstlerin auch in diesem Werk das Paar beim Kartenspiel im eigentlich intimen, häuslichen Rahmen. In konzentrierter Stille gehen diese ihrem Spiel nach, lassen sich vom Blick des Betrachters nicht stören. Die nackte Dame lehnt sich

herausfordernd an den Tisch, sie scheint zu führen, der nächste Zug ist entscheidend. Wie das Kartenspiel sein Ende finden wird, bleibt offen, dem Betrachter bleibt die bloße Ahnung einer tieferen Wahrheit, die Vermutung wichtigerer Zusammenhänge, als das bildlich Dargestellte zu zeigen vermag. Die Künstlerin wird international in Gruppen und Einzelausstellungen gezeigt. Mit beiliegendem signierten Fotozertifikat der Künstlerin (in Kopie) vom 10.10.2025.
Provenienz:
Direkt bei der Künstlerin 1991 erworben Privatbesitz Berlin

7264
gogi saroj pal
(1945 Uttar Pradesh – 2024 Delhi)
7264 „NAIYAKA“
Acryl auf Leinwand, auf Hartfaser kaschiert. 1990. 68,5 x 61 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Gogi Saroj Pal“ und datiert, verso am Unterrand mit Faserstift in Schwarz erneut signiert, datiert, betitelt und bezeichnet. 1.500 €
Gogi Saroj Pal zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen Indiens. Ihre Bilder sind das Ergebnis ihrer Suche nach kultureller Identität und dem Bezugspunkt zur heutigen
Zeit. Hauptthema ist das Leben der Frauen, deren Schicksal und ihre Stellung in der Gesellschaft, eingebettet in eine fantastische, farbenfrohe Welt. Bekannt wurde sie vor allem mit ihren Bildern halb menschlicher, halb tierischer Mischwesen. Die vorliegende Arbeit gehört dabei zu dem Komplex „Kinnari“ halb Frau, halb Vogel. Das nahezu quadratische Bild leuchtet vor allem durch den ausdrucksstarken Komplementärkontrast des grünen, fast paradiesischen Umraums zu dem kräftigen Rot des Gefieders.
Provenienz: Privatsammlung Hessen (direkt bei der Künstlerin erworben)
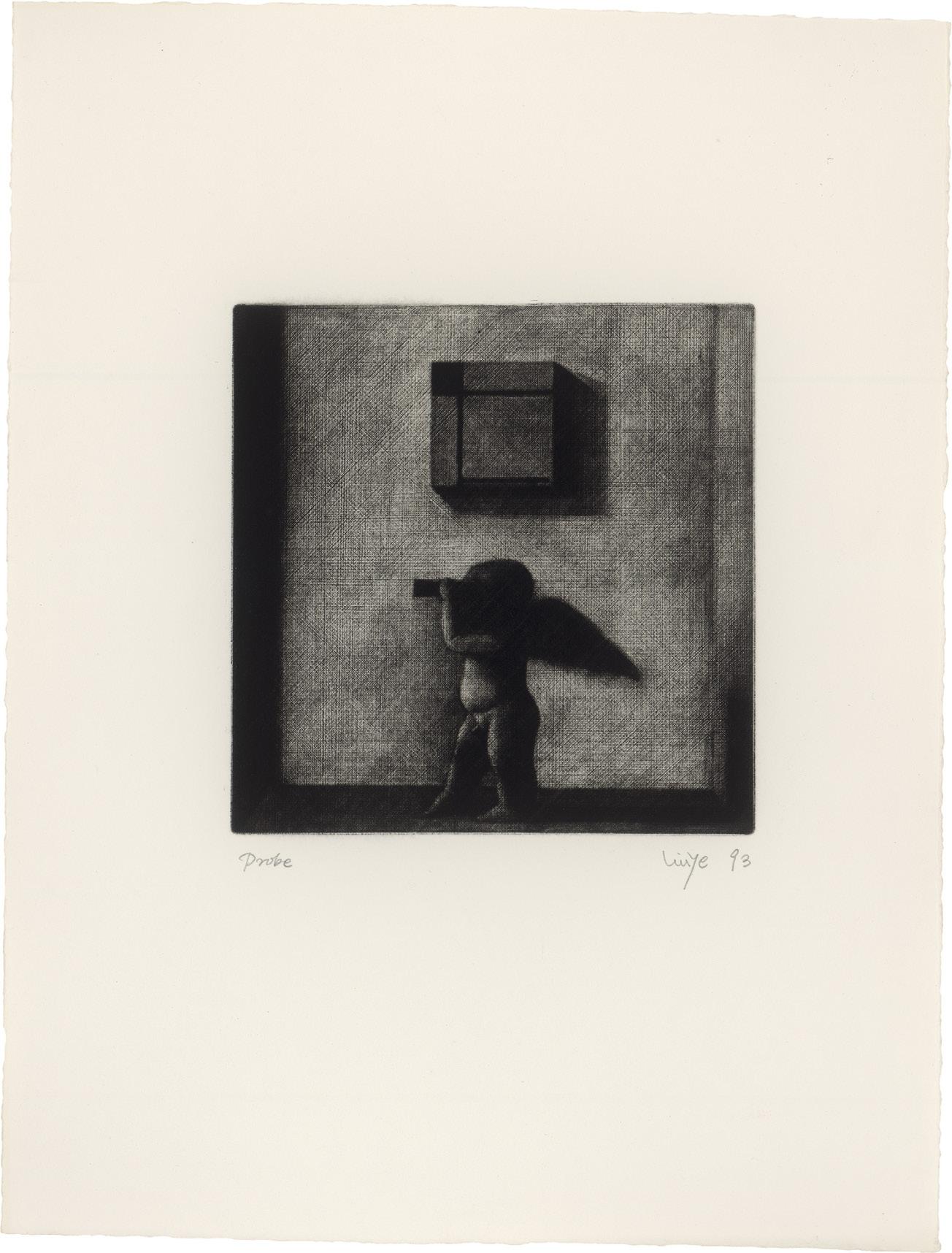
7265
liu ye (1964 Beijing)
7265 Für Mondrian Radierung mit Mezzotinto auf Velin. 1993. 17 x 16,5 cm (39,5 x 30 cm).
Signiert „LiuYe“ und datiert sowie bezeichnet „Probe“. 800 €
In seinem Werk verbindet Liu Ye die Kunstgeschichte mit fiktiven und realen Figuren. Die Bezugnahme auf Piet Mondrian lässt sich auch in weiteren Arbeiten des Künstlers feststellen, dabei verschmelzen vielfach formale Prinzipien und konzeptionelle Ideen aus asiatischen und westlichen Kulturen. Die Auflagenhöhe betrug 50 Exemplare. Prachtvoller, prägnanter Druck mit dem vollen Rand.


gerhard merz (1947 Mammendorf)
7266 Inferno
Offset auf Glas, in Künstlerrahmen. 1988. 177 x 112 cm.
5.000 €
Vor spiegelnder, tiefschwarzer Oberfläche steigen Flammen in hellen Weißtönen vertikal in die Bildmitte auf. Der Titel Inferno evoziert Dantes literarische Hölle. Die Reflexionen im Hintergrund lassen die Umgebung mit dem nach einer Fotografie entstandenen Werk verschmelzen, so dass der Betrachter sich selbst und seine Umgebung unweigerlich im „Feuer“ sieht. So entsteht eine spannende Wechselwirkung zwischen Werk und Betrachter. In Gerhard Merz‘ Arbeiten findet sich oft eine Verbindung aus Architektur und Malerei wieder, in der der Raum selbst zum integralen Bestandteil der Kunst wird. Seine Werke sind häufig ortsbezogene Installationen, die architektonisch gedacht sind und in denen er Bezüge zur Literatur und Kunstgeschichte wie auch zur politischen Geschichte herstellt. Merz nahm insgesamt viermal an der documenta teil und ist mit Werken in wichtigen öffentlichen Sammlungen vertreten, u. a. in der Pinakothek der Moderne München, dem Museum Ludwig Köln und dem Haus der Kunst in München.
Provenienz:
Christie‘s, London, Auktion 26.10.1995, Lot 109
Privatbesitz Berlin
gottfried helnwein
(1948 Wien, lebt in Tipperary und Los Angeles)
7267 Marlene Dietrich Farblithographie auf Velin. Um 1990. 49,8 x 49,8 cm (ca. 71 x 67 cm, Rahmenausschnitt).
Signiert „G Helnwein“ sowie „MarleneDietrich“ und bezeichnet „E.(preuve d‘)A.(rtiste)“.
2.000 €
Künstlerabzug neben der kleinen Auflage von lediglich zehn numerierten Exemplaren, alle vom Künstler und der Schauspielerin signiert und neben der Auflage von 499 Exemplaren mit der lithographierten Schrift. Die Stilikone und androgyne Schönheit Marlene Dietrich zeichnete Helnwein für ein Filmplakat zum Dokumentarfilm „Marlene“. Sie zeigte sich sehr zufrieden mit dem Portrait, und es folgte daraus eine persönliche Verbindung zwischen beiden. „In den letzten Jahren pflegten die Diva und der Maler regelmässigen Kontakt, Marlene Dietrich und Gottfried Helnwein. Gesehen haben sich die beiden jedoch nie. (...) Es gibt kein Rollenklischee, in das sie passen würde. Sie hatte immer etwas Maskulines, Bestimmtes und Direktes. Und sie hat ihr Leben einzelkämpferisch geführt. Wie auch James Dean stand Marlene irgendwo zwischen den Geschlechtern. Sie war nicht eine Frau, sie war das Bild der Frau.“ (gottfriedhelnwein.at, Zugriff 11.08.2025). Prachtvoller Druck in fein abgestimmter Farbigkeit mit dem wohl vollen Rand.
matthias koeppel (1937 Hamburg, lebt in Berlin)
7268* Die Nacht vom 9. November Öl auf Leinwand. 2008.
170 x 200 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Rot monogrammiert „M.K“ und datiert.
12.000 €
Der Mauerfall in der Nacht vom 9. November 1989 – eines der einschneidendsten Ereignisse in den letzten Jahrzehnten der deutschen Vergangenheit. Unter dem kaltweißen Flutlicht der Grenzanlagen spielt sich die tumultuöse Szenerie, die ganze Euphorie dieses Moments der deutschen Wiedervereinigung weitgehend in SchwarzWeiß ab, wie in einem alten Film. Leuchtend farbig strahlen in der Komposition unter dem übermächtigen, dunkeldramatischen Himmel nur die Flaggen, der Grenzpfosten, eine rote Rose und eine Coladose am Boden. Koeppel, der immer wieder die deutsche Zeitgeschichte thematisiert, akzentuiert damit Eckpunkte des Geschehens. Zusammen mit Johannes Grützke, Manfred Bluth und Karlheinz Ziegler hatte Koeppel 1973 die Künstlergruppe „Schule der neuen Prächtigkeit“ gegründet, die sich gegen die abstrakte Malerei wandte und für einen neuen, von Ironie und Satire geprägten Realismus stand.
Provenienz: Privatbesitz Schweiz
Ausstellung:
Matthias Koeppel 2008, Lys over Lolland, LollandFalsters Stiftsmuseum, 2008, vgl. Abb. S. 5
Matthias Koeppel: Himmel, Berlin!, EphraimPalais, Berlin 2014, Abb. S. 87

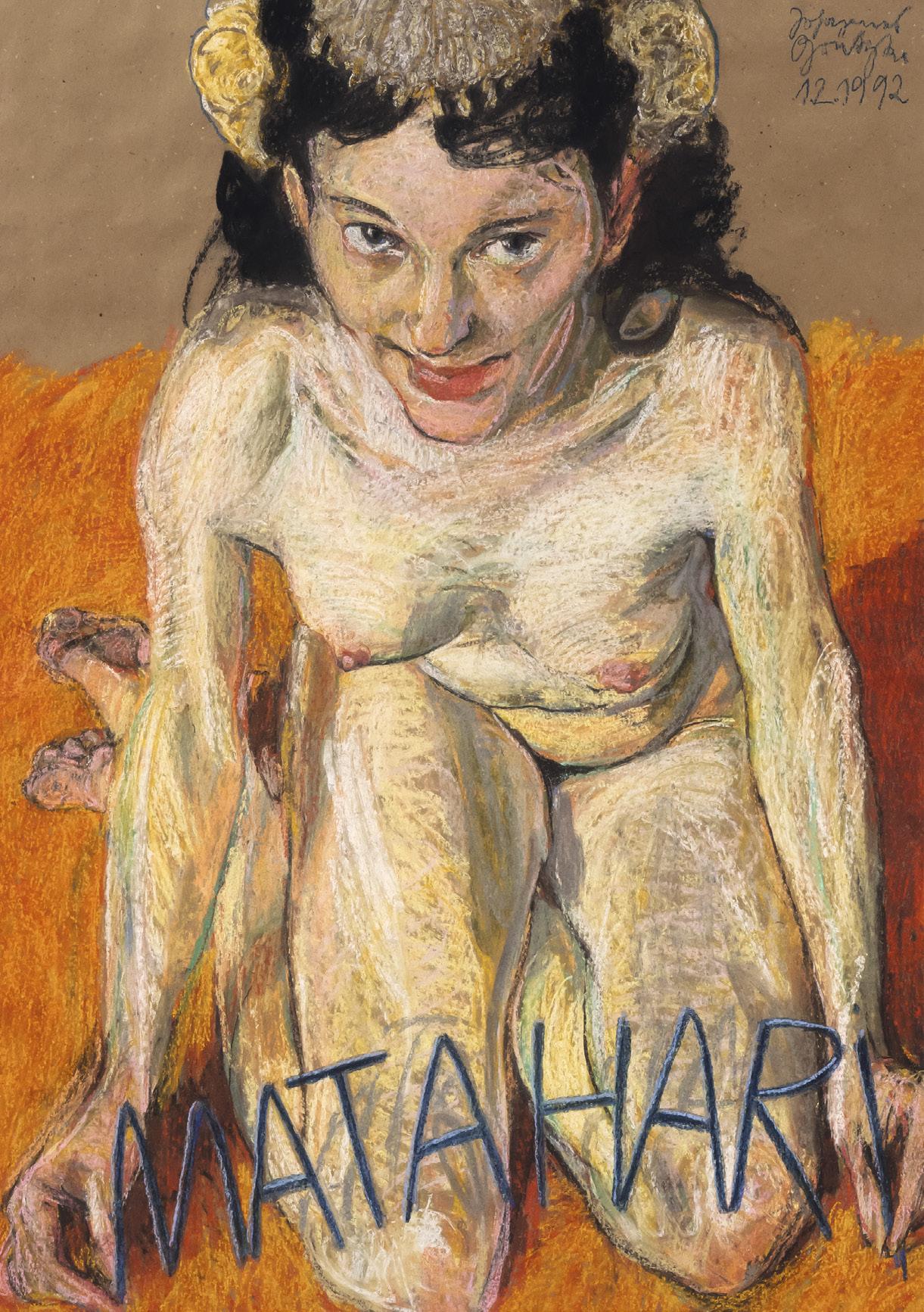
johannes grützke (1937–2017, Berlin)
7269 „MATA HARI“ Pastellkreiden auf Packpapier. 1992.
123 x 96 cm.
Oben rechts mit Kreide in Blau signiert „Johannes Grützke“ und datiert, unten in der Darstellung mit Kreide in Schwarz-Weiß betitelt.
2.500 €
Mit lockendem Lächeln und ungezwungener Nacktheit blickt die am Boden kniende Tänzerin und Doppelspionin zum Betrachter empor in Grützkes großformatigem Entwurf für das Plakat zu den
Tanzaufführungen von Verena Weiss als Mata Hari im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Das Braun des von Grützke mit Vorliebe für seine monumentalen Pastelle verwendeten Packpapiers bildet über dem intensiv leuchtenden Orange des Bodens den Hintergrund für die kniende Figur und schimmert hier und da durch den hellen Glanz des mit lockeren Linien gestalteten Inkarnats hindurch Spielerisch ersetzt der Künstler das „I“ am Schluss des Titels durch einen Bleistift in den Händen Mata Haris, und auch das „M“ greift die berühmte Nackttänzerin, als wäre es ein fragiler Gegenstand.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen

sarah schumann (1933–2019, Berlin)
7270 „Tag und Nacht“ Mischtechnik (Gouache, Pigmente, Kreiden) auf Velin. 1994.
55 x 46 cm.
Unten links mit Bleistift signiert „Sarah Schumann“, datiert und betitelt.
2.000 €
Eine mutige, starke, kämpferische Künstlerin so bezeichnete Schumann akzentuiert und treffsicher sich selber (vgl. textezurkunst.de, Zugriff 16.09.2025). Ein Schwerpunkt in ihrem Werk ist das Bild der Frau, des weiblichen Mythos, und als prominente Protagonistin der um 1970 entstandenen Neuen Frauenbewegung war
ihr Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Feminismus in der Kunst immens. Seit 1968 lebte Sarah Schumann in Berlin mit Silvia Bovenschen zusammen. Sie portraitierte Bovenschen mehrfach, und Bovenschen verfasste ihrerseits im Laufe der Jahre mehrere Texte über Schumann; so fand sie „etwas Explosives, Wildes, ja Elementares in ihrem Verhalten (...), spürbar in ‚dieser Äußerung , in jener Reaktion und in nahezu allen ihrer Bilder‘“ (Silvia Bovenschen, Sarahs Gesetz, Frankfurt/M. 2015, S. 31, zit. nach textezurkunst.de, Zugriff 16.09.2025). Arbeiten der Künstlerin sind in der Berlinischen Galerie, dem Museum Morsbroich Leverkusen sowie im Museum of Modern Art in New York vertreten.
Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

christopher lehmpfuhl (1972 Berlin)
7271 Winterlandschaft mit roter Figur Öl auf Leinwand. 2005.
80 x 100 cm.
Unten rechts (in die feuchte Farbe geritzt) monogrammiert „CL“ und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz nochmals monogrammiert „CL/M“ und mit der Werknummer „5733“.
6.000 €
Die Schneemassen modelliert Lehmpfuhl – meist mit den Fingern – mit den typischerweise, üppig aufgetragenen Farbschichten ebenso reliefhaft wie die Äste in Mittel und Vordergrund, so dass sich ein ganz eigenes, bildimmanentes Spiel von Licht und Schatten ergibt. Die kleine rote Figur in der horizontalen Bildmitte platziert der Künstler wie beiläufig ganz am rechten äußeren Rand. Dadurch erscheint sie weniger als Teil der wogenden Komposition, sondern vielmehr als diese betrachtend.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

christopher lehmpfuhl
7272 „Schloss Güstrow“ Öl auf Leinwand. 2005.
80 x 80 cm.
Unten mittig rechts (in die feuchte Farbe geritzt) monogrammiert „CL“ und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz nochmals monogrammiert „CL/E“, datiert, betitelt und mit der Werknummer „5140“ sowie bezeichnet „11“ und „18“.
6.000 €
Dass Lehmpfuhl ausschließlich im Freien arbeitet, in der Natur oder direkt vor dem Motiv, spiegelt sich in der expressiven Lichtführung und einer Bewegtheit wider, die vom Spiel der Elemente zeugt und den Wechsel von Wind, Sonne und Wolken im Bild sichtbar werden lässt. So gewinnt die Fassade des Schlosses Güstrow eine ganz dem durchs Bild wandernden Menschen entsprechende Lebendigkeit.
Provenienz: Privatbesitz Berlin
christopher lehmpfuhl
7273 Wintersonne (Engadin) Öl auf Leinwand. 2016.
160 x 180 cm.
Verso mit Faserstift in Schwarz monogrammiert „CL/M“ sowie mit der Werknummer „7253“.
15.000 €
Mit Händen und Fingern modelliert Lehmpfuhl die pastosen, ineinanderwogenden Farbmassen. Ist bei all dieser Bewegtheit das Motiv in der Fernsicht sofort erkennbar, so lösen sich in der Nähe die Bildgegenstände auf und werden zu fast gestisch aufgetragener, wild bewegter Farbmaterie von expressiver, abstrakter Anmutung. Das Werk von Christopher Lehmpfuhl lässt sich in der Tradition der deutschen Impressionisten Max Liebermann, Max Slevogt und Lesser Ury verstehen. Farbe und Licht spielen eine große Rolle in seinem Schaffen, das hauptsächlich Landschaften sowie Stadtbilder umfasst. Wie sein Lehrer Klaus Fußmann bevorzugt Lehmpfuhl das Arbeiten im Freien, das ihn mit allen Sinnen den Naturgewalten aussetzt. Die Arbeit ist online verzeichnet und abgebildet unter christopherlehmpfuhl.de/beispielseite/ winter (Zugriff 11.07.2025).
Provenienz: Privatbesitz Berlin

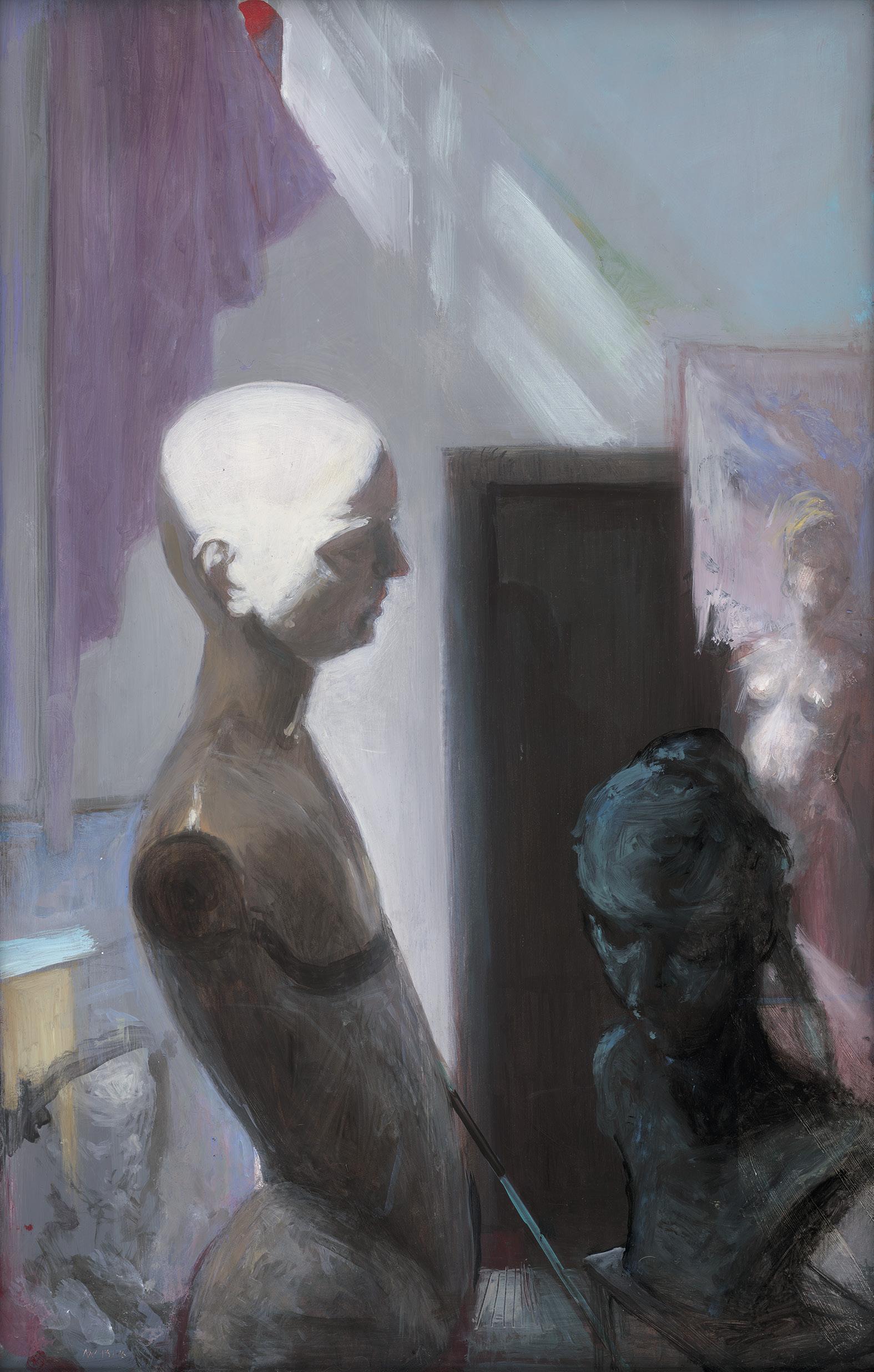
andreas wachter (1951 Chemnitz, lebt in Colditz-Erlln)
7274 „Mittags Atelier“ Mischtechnik auf Hartfaser. 2013/16. 56 x 35 cm.
Unten links (in die Farbe geritzt) mit dem Künstlersignet „AW“ und datiert, verso mit Bleistift signiert „AWachter“, datiert und betitelt.
1.800 €
In der traumartig beleuchteten Atmosphäre des Atelierraums vermischen sich Realität und Imagination: Schaufensterpuppe und Bronzebüste stehen in inniger Korrespondenz zueinander, im Hintergrund blickt ein weibliches Aktmodell aus einem hohen Spiegel. Der kleine rote Farbreflex im Oberrand lenkt den Blick auf
den einfallenden Lichtstrahl. Wachter gilt als Vertreter der mittleren, figurzentrierten Generation der Leipziger Schule. Von 1974 bis 1980 studierte er Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, u.a. bei Arno Rink und Volker Stelzmann. Inspiriert von der italienischen Renaissance und dem Manierismus, zeigt sich seine Lichtregie mitunter von Caravaggios Strategie des Chiaroscuro beeinflusst. Auch hier erhellt Wachter einzelne Teile des zeitgenössischen Settings aus punktuellen Lichtquellen. Diese polarisierte Lichtgestaltung und die Inszenierung von Gegensätzen sind typische Elemente im Schaffen des Künstlers. Häufig erstreckt sich der Malprozess Wachters über eine längere Zeit. Dies zeigt sich hier an der zweifachen Datierung.
Provenienz: Privatbesitz Sachsen

christine weber (1963 Salzgitter, lebt in Berlin) 7275 „Weak end“ (weak end 4) Öl auf Leinwand. 2002.
70 x 120 cm.
Verso mit Faserstift in Schwarz signiert „Christine Weber“, datiert und betitelt sowie mit den Maßangaben.
1.500 €
Filmsequenzen manipuliert die Künstlerin am Computer, arrangier t sie um und setzt ihre mysteriösen Figuren, Leichen, Kämpfende oder Flüchtende, in eine sommerlichhelle Landschaft. Wie in einem filmstill erscheinen die Gestalten erstarrt inmitten ihrer Bewegung am Rande oder auf der Landstraße. Flächig aufgetragene, leuchtende Farben verleihen der „Weak end“Serie eine zunächst heitere Stimmung, die bei näherer Betrachtung der leicht stilisierten Figuren kippt. Partien der Leinwand bleiben weiß und verdeut
lichen das Prozessuale der Entstehung. „Christine Webers Bilder zeichnet eine fröhliche Gefasstheit, eine Friedhofsheiterkeit aus; gepaart mit jenem Voyeurismus, der Anklänge an die Berichterstattung bei Unfällen oder Kriegen zulässt, und nicht zuletzt der daraus resultierenden sublimen Erotik des entkleidenden Blicks.“ (Lokiev Stoof, abelneuekunst.de, Zugriff 15.09.2025). Als Vorlage ihrer Serie dient Weber JeanLuc Godards Film „Weekend“ aus dem Jahr 1967.
Provenienz: Privatbesitz NordrheinWestfalen
Literatur:
Axel Hinrich Murken, Phantastische Welten. Vom Surrealismus zum Neosymbolismus, Ausst.Kat. Kunsthalle Jesuitenkirche, Aschaffenburg u.a. 2009, S. 122, Nr. 1, Abb. S. 68

georg c. wirnharter (1954 Aichach – 2025 Stadtbergen)
7276 Work in Progress
Öl und Acryl auf Leinwand. 1989. 70 x 50 cm.
Verso mit Faserstift in Schwarz signiert „G. C. Wirnharter“ und datiert.
1.500 €
Das Handwerkszeug eines Künstlers: Spachtel, Palette, Handschuhe, Eimer und Lappen, daneben eine von Wirnharters eigenen
Keramiken, eine Skulptur aus der Serie „100 Frauenvasen“. In leuchtender Farbigkeit und fotorealistischer Auffassung setzt der Künstler die Atelierszene mit effektvollem Schattenwurf und überzeugender Räumlichkeit um. Ein immenses technisches Geschick kennzeichnet die Momentaufnahme, deren Nahsicht sich der Betrachter kaum entziehen kann. „Ein Thema, das in allen Schaffensphasen des Künstlers einen großen Raum einnimmt, ist die Darstellung seines Ateliers. Arbeitsutensilien, Bilder und Skizzen, Bücher und Kunstkataloge, Objekte für Stilleben und schließlich das Aktmodell werden hier in Szene gesetzt.“ (mos.bezirkschwaben.de, Zugriff 25.09.2025).
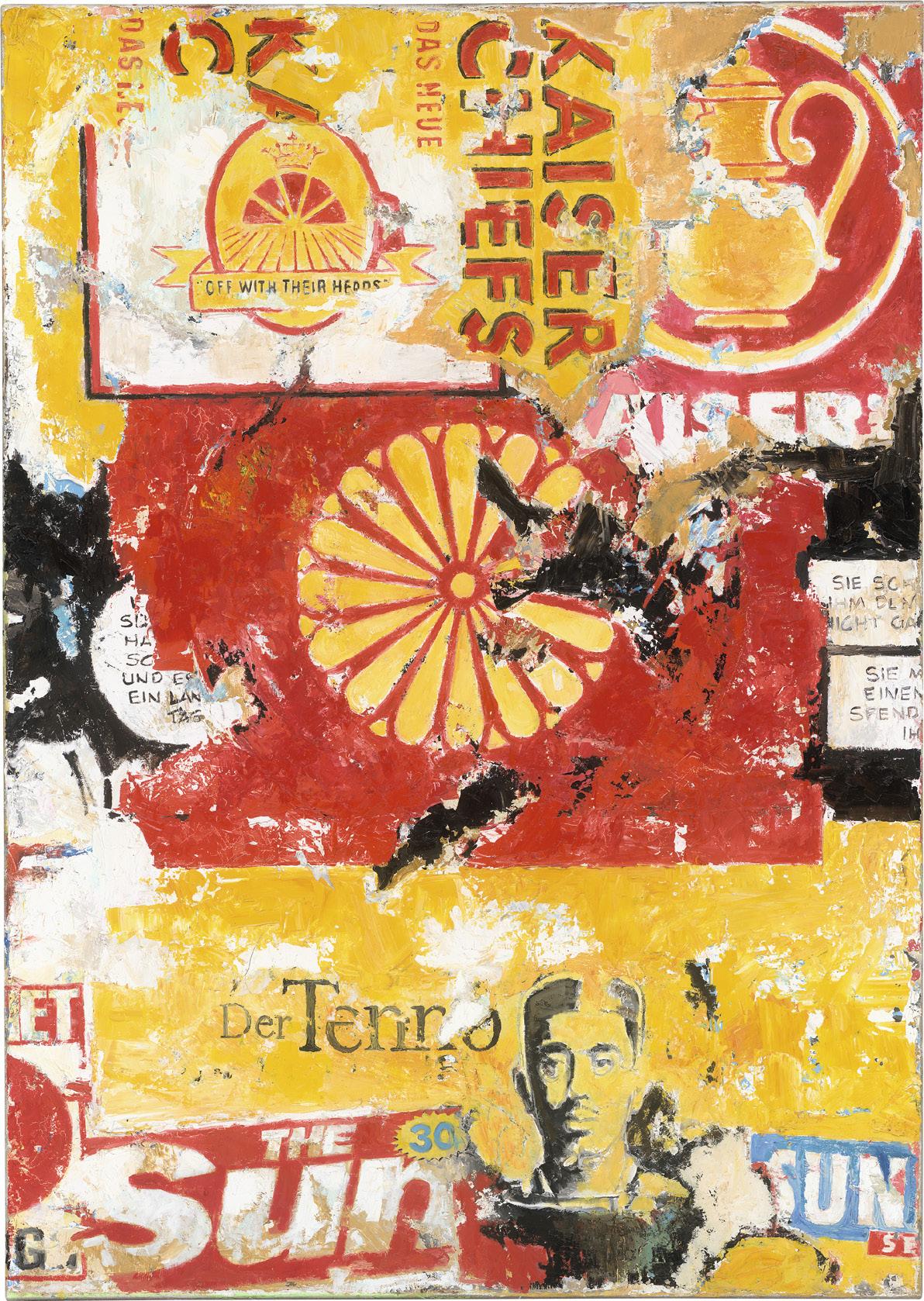
7277
jens lorenzen (1961 Schleswig, lebt in Berlin) 7277 „Mauer II, Element+4“ (Tenno) Öl auf Leinwand. 2008. 140 x 100 cm.
Verso mit Faserschreiber in Schwarz signiert „JENS LORENZEN“, datiert, betitelt, mit den Maß- und Materialangaben sowie mit Pinsel in Braun mit dem Künstlersignet „JL“ und nochmals datiert.
2.000 €
Frühe Arbeit Lorenzens aus seiner „Mauer“Serie. Leuchtendes Rot und Gelb mit schwarzen Kontrasten, zentral darin die stilisierte Chrysanthemenblüte Jirogiku, das Nationalsymbol Japans, das auch mit dem Kaiserhaus und dem Tenno in Verbindung gebracht wird. Darum gruppiert Lorenzen ein Portrait des Kaisers ebenso
wie Versatzstücke aus Reklame und Alltag. Im Mittelpunkt des Schaffens von Jens Lorenzen steht „The Wall“, eine potentiell endlos angelegte Erzählung aus Bildern. Im Jahr 2008 fand seine erste Ausstellung zum Thema „Die Mauer“ in der AxelSpringerPassage, Berlin, statt; inzwischen entstanden vier „Mauer“Serien in unterschiedlichen Bildformaten. Oft sind es alte Plakate, Reklame oder Werbetafeln, die Lorenzen inspirieren. Die frühe Serie „Mauer II“, in der sich japanische KampfkunstMotive in variierenden assoziativen Verknüpfungen finden, begann der Künstler nach seinem Besuch einer SamuraiAusstellung im Schloss Gottorf, Schleswig. Die Arbeit ist abgebildet in Lorenzens OnlineVerzeichnis mauerart. com, Zugriff 11.09.2025.
Provenienz: Privatbesitz Bayern

7278
magdalena abakanowicz (1930 Falenty – 2017 Warschau)
7278 Ohne Titel
Pinsel in Schwarz und Deckweiß auf Velin. 2004. 29,5 x 20,8 cm.
Unten mittig mit Faserstift in Schwarz-Violett signiert „Abakanowicz“ und datiert.
3.000 €
Mit gestischer Dynamik gestaltete Komposition, entstanden vermutlich im Zusammenhang mit der monumentalen Bronzeplastik
„Handlike Tree“ (2003/04, Skulpturenpark Schloss Gottorf). Die polnische Bildhauerin, Textil und Objektkünstlerin Abakanowicz, Pionierin der faserbasierten Skulptur und Installation, schuf seit den 1960er Jahren bedeutende großformatige Wandtextilien bzw. Textilskulpturen aus Sisal und Wolle („Abakans“) und ab den 1970er Jahren die kopflosen und fragmentierten menschlichen Formen, für die sie besondere Bekanntheit erlangte. Eine umfassende Ausstellung ihrer Skulpturen fand 2004 im Schloss Gottorf statt.
Provenienz: Privatbesitz Österreich
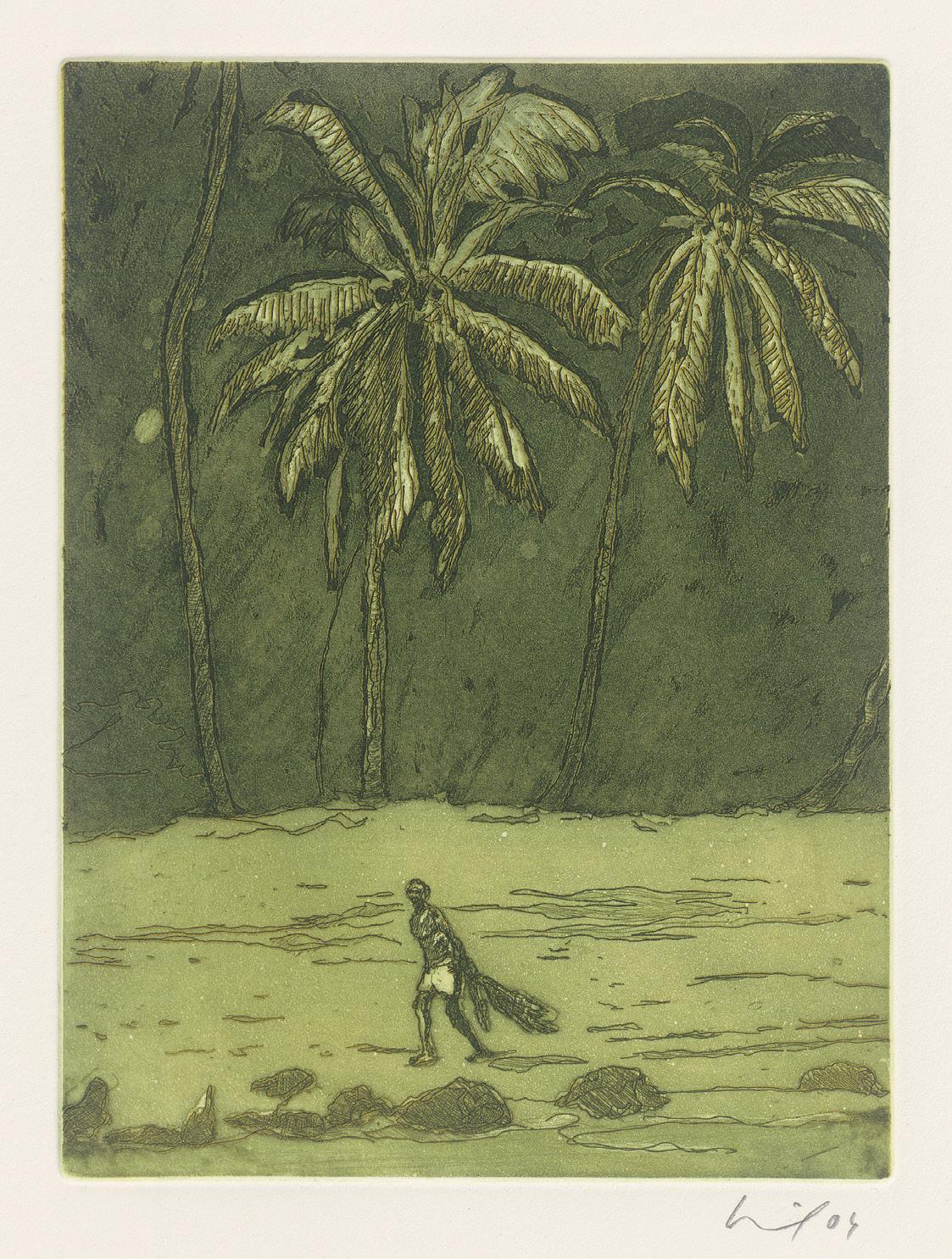
peter doig
(1959 Edinburgh, lebt in Port of Spain/Trinidad)
7279 Black Palms
4 (von 6) Farbradierungen auf Velin. 2004.
Je ca. 53,5 x 38 cm.
Alle signiert „Doig“ und datiert.
Griffelkunst 313 A1, 3, 4 und 5.
2.800 €
Herausgegeben von der GriffelkunstVereinigung, Hamburg. Aus der Folge hier vorhanden die Motive „Pelican“, „Figure by a River“, „Black Palm“ und „Fisherman“. Die Radierungen entstanden in Zusammenarbeit mit dem Drucker Fritze Margull, der dafür nach Port of Spain auf der Insel Trinidad kam, wo Doig sich niedergelassen und ein Atelier eingerichtet hat. Zu den Motiven sagt der Künstler, sie stammten größtenteils von Postkarten aus Indien, erworben in einem Londoner Trödelladen. Die alten, meist anonymen Fotokarten ohne Ortsangaben schienen ihm exotisch und gleichzeitig traurig und erinnerten ihn an bestimmte Aspekte von Trinidad. Kräftige und prachtvolle, farblich sehr schön abgestimmte Drucke mit sehr breitem Rand, teils mit dem Schöpfrand.


alex katz
(1927 New York, lebt in New York und Maine)
7280 Tree 10
Farbserigraphie auf Velin. 2022. 94 x 95 cm (Rahmenausschnitt).
Signiert „Alex Katz“. Auflage 60 num. Ex. Nicht mehr bei Schröder/Markhof.
6.000 €
Immer wieder setzt sich Katz auch mit landschaftlichen Motiven auseinander. Hier jedoch scheint er den Baum wie ein Individuum, einen Protagonisten zu behandeln. Er beschränkt sich auf kühles Blau, Weiß und Schwarz, um die winterliche Kälte und Kargheit der Szenerie zu verdeutlichen. Die Zwischenräume im Geäst der
Krone erscheinen durch die reduzierte, kantige Gestaltung des Baumes in kristalliner Klarheit und fordern den Blick des Betrachters zum Verweilen auf. Herausgegeben von der Frank Fluegel Gallery, Nürnberg und Kitzbühel 2022. „Es ist ein 10 facher Siebdruck, bei dem transparente Farben verwendet werden, um Dichte aufzubauen und weiche Übergänge in den Werten zu schaffen, um die Tiefe und die malerische Qualität des Originalbildes einzufangen. Transparente Blautöne bilden den azurblauen Himmel im Kontrast zu der strengen Form des Baumes und seinen Ästen, die in monochromen Tönen gehalten sind.“ (frankfluegel.com, Zugriff 15.09.2025). Prachtvoller, farbintensiver Druck der großformatigen Komposition.
alex katz
7281 Blue Coat (Vincent) Farbaquatinta auf Velin. 1993. 60,6 x 30,2 cm (93,5 x 60,5 cm).
Signiert „Alex Katz“ und bezeichnet „A(rtist‘s) P.(roof)“. Auflage 12 num. Ex. Schröder/Markhof 280.
2.000 €
Eines von zwölf Künstlerexemplaren, neben der regulären Auflage von 30 Exemplaren. Charakteristisch für die Werke Katz‘ ist die momenthafte Wahrnehmung des Menschen, weshalb seine Arbeiten oft wie gemalte, klar und großflächig ausformulierte Schnappschüsse wirken. Der Künstler profilierte sich seit den 1950er Jahren mit gegenständlichen, leuchtend farbigen, flächig aufgefassten Darstellungen, reduzierten, fast schablonenhaften Bildnissen, die stilistisch die Pop Art vorwegnehmen. Druck SimmelinkSukimoto Editions, Los Angeles, herausgegeben von SimmelinkEditions, Los Angeles. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand.
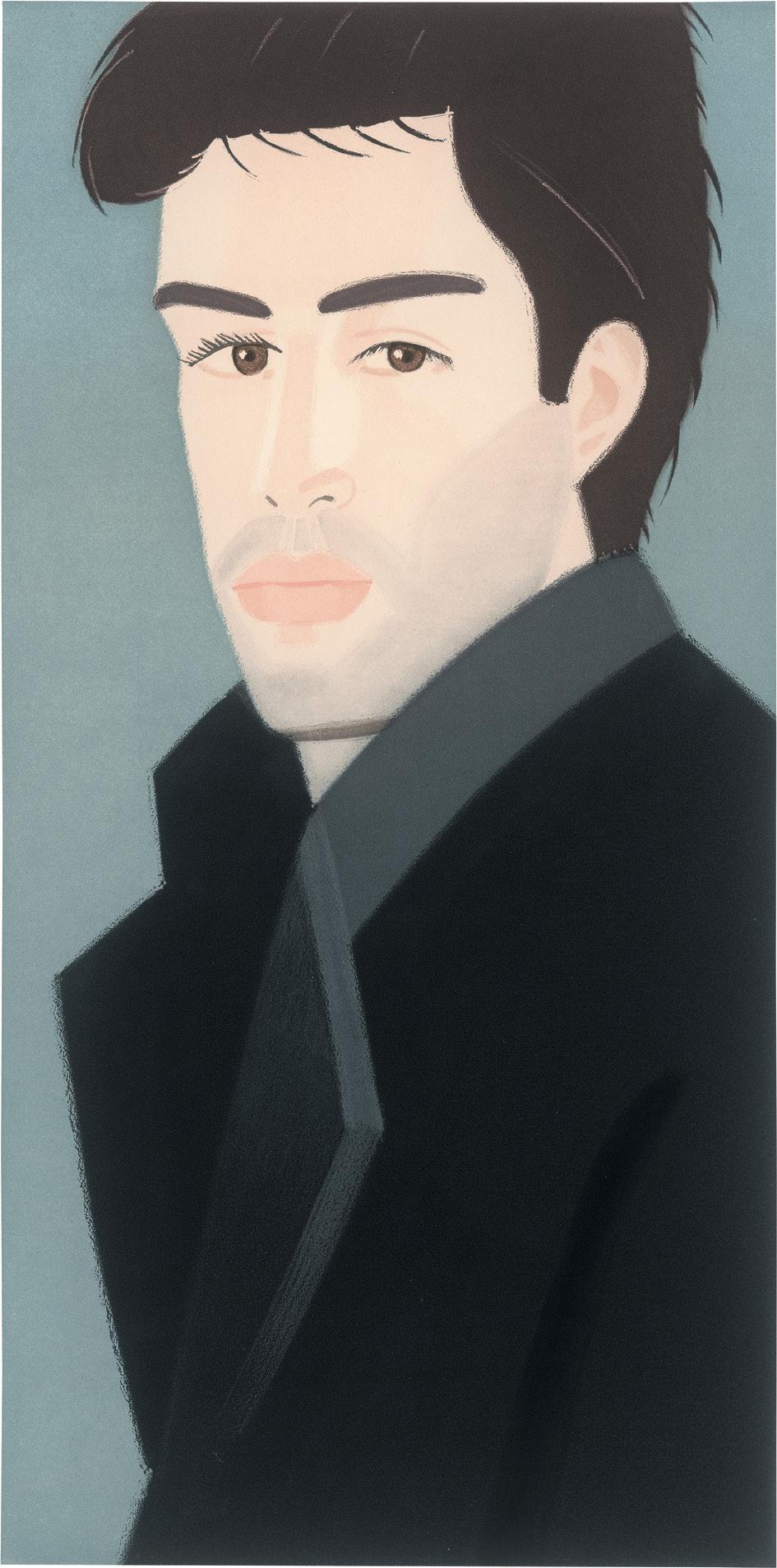
titus schade (1984 Leipzig)
7282 „Regal – Drei Windmühlen“ Acryl auf Holz. 2020/21. 40 x 50 cm.
Verso mit Faserschreiber in Schwarz signiert „Titus Schade“, datiert und betitelt, verso auf Klebeetikett der Galerie Eigen+Art typographisch bezeichnet und mit der Werknr. „TS/21/009“.
8.000 €
Menschenleer, in surrealer, mystisch wirkender Düsternis zeigt sich die präzise gearbeitete, minimalistische Komposition. Horizontal teilt Schade das Bild in zwei Ebenen, jede wie ein Regalfach kirschholzfarben umrahmt und von schachtelartiger Räumlichkeit, die das Kulissenhafte, Künstliche der Komposition unterstreicht. Das Element der Windmühle, das seit zehn Jahren immer wieder in seinen Gemälden auftaucht, findet sich in dreifacher Reihung als geometrische Form auch hier, und steht wie auch die Motive der
stilisierten Bäume und der Burg, für eine zeitlose Allgemeingültigkeit der Bildsprache. „Die Malerei ist sowohl eine geistige als auch eine handwerkliche Tätigkeit. (...) Ähnlich wie ein Modellbauer, der im Keller oder auf dem Dachboden vor seiner Platte sitzt, kreiere ich eine eigene Welt. (...) Es ist bei meiner Malerei auch ganz wichtig, zu betonen, dass es sich um ein zweites Universum, also um eine Parallelwelt, handelt. Meine Welt funktioniert nach ihren eigenen Regeln, bedient sich aber in ihrer Gegenständlichkeit aus unserer Welt.“ (Titus Schade im Interview mit Kevin Hanschke, collectorsagenda.com, Zugriff 23.09.2025). Nach seinem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig war Schade Meisterschüler bei Neo Rauch, er arbeitet heute in seinem Atelier auf dem Leipziger Spinnereigelände.
Provenienz:
Galerie Eigen+Art, Leipzig/Berlin (dort erworben 2021)
Privatbesitz Berlin

martin eder (1968 Augsburg, lebt in Berlin)
7283 „Chasse aux Papillons“ Öl auf Leinwand. 2005.
180 x 240 cm.
Unten links mit Feder in Schwarz signiert „Martin Eder“ und datiert, verso mit Faserstift in Schwarz nochmals signiert, datiert, betitelt, bezeichnet „WVZ 708“ sowie „Berlin“ und mit dem Etikett der Galerie Eigen+Art, dort typographisch betitelt und nochmals mit der Werknummer bezeichnet.
18.000 €
Vor düsterem Himmel und einer apokalyptischen, fast dystopischen Landschaftsszenerie erscheinen die weiße Katze und eine mädchenhafte Figur mit lebloser Haltung im HarlekinKostüm. Das weiße Fell der Katze und die leuchtenden Farben des Kostüms stehen in starkem Kontrast zu ihrer düsteren Umgebung. Martin Eder ist bekannt für seine Mischung aus Hyperrealismus, Kitsch und einer verstörenden Ästhetik. Oft kombiniert er niedlich wir
kende Tiere mit erotischen oder surrealen Elementen, wodurch ein Gefühl von Verunsicherung entsteht. In diesem Bild wird das vermeintlich Kindliche, Katze und Clown, durch die düstere Szenerie und die unheimliche Stimmung ins Gegenteil verkehrt. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen Schönheit und Bedrohung, Vertrautem und Fremdem. In seinen Arbeiten hinterfragt er kulturelle Werturteile und den Relativismus der Schönheit in der Kunstgeschichte, u.a. durch provokante Darstellungen von Kätzchen, Welpen, Kostümen und den weiblichen sowie männlichen Akt.
Provenienz: Galerie Eigen+Art, Berlin Privatsammlung Phillips, OnlineAuktion New York, 02.12.12.2024, Lot 51 Privatbesitz Süddeutschland
Ausstellung: Martin Eder: Der dunkle Grund, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2009, Abb. S. 296 299, 316
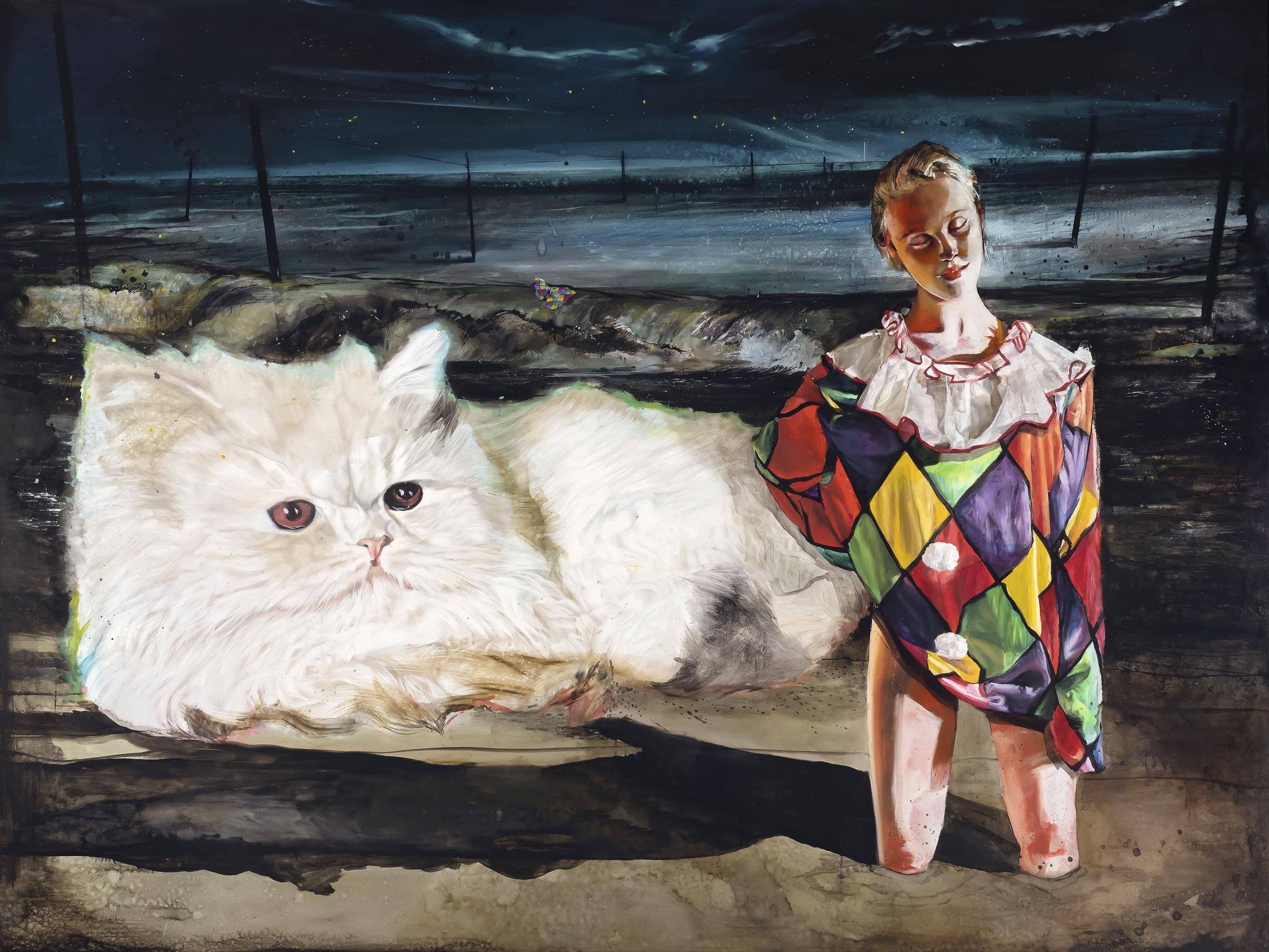
christoph löffler
(1966 Jena, lebt in Berlin)
7284 „Jens (Despair) “
Öl auf Leinwand. 2024.
50 x 40 cm.
Unten rechts mit Pinsel in Blau mit dem Künstlersignet „L“, verso auf dem Keilrahmen mit Filzstift in Schwarz signiert „Löffler“, datiert und betitelt.
10.000 €
Trauriger Tiger, tief im Bild. Portraits von plüschigen Gespenstern bestimmen seit 20 Jahren das malerische Schaffen von Christoph Löffler. Er malt in einer altmeisterlichen Lasurtechnik und sagt selbst über seine Arbeiten: „Ein Paralleluniversum gibt es (…) darin können sich Kinder, genauso wie Künstler verlieren oder wiederfinden – je nachdem. Mit meinen Bildern versuche ich die Grenze durchlässiger zu machen. Deshalb geht es in meiner Kunst auch weniger um Malerei, mehr um Channeling. Die klassische Maltechnik spinnt für mich dabei ein Garn in die Vergangenheit, zum Geheimnis der alten Meister.“ (Christoph Löffler, in: Christoph Löffler. GIFT, Ausst.Kat. Galerie Franzkowiak, Berlin 2022, S. 1). In seinen aktuellen Werken zieht der Künstler in der Regel eine weitere Bildebene ein, die hier nur als Fragment einer dämonischen Tapete rechts über dem Tigerkopf erscheint und „Jens“ eine tragikomische Bedeutung verleiht.
Provenienz: Privatbesitz Berlin

register
moderne
und zeitgenössische kunst i & ii
Die Lose 8000 bis 8315 finden Sie online
A
Abakanowicz, Magdalena 7278
Alechinsky, Pierre 72067207, 80008001
Altenbourg, Gerhard 7235
Altenkirch, Otto 70847087
Anderle, Jirí 7241, 80028004
Antes, Horst 72167217, 8005
Antoine, Otto 70057007
Appel, Karel 8006
Armbruster, Ludi 80078008
Arnim, Bettina von 72297231
Arnold, Karl 80098012
B Bach, Elvira 8013
Balden, Theo 80148015
Balkenhol, Stephan 8016
Baluschek, Hans 7010
Bargheer, Eduard 7112
Barlach, Ernst 7119, 80178021
Baselitz, Georg 8022
Batz, Eugen 80238026
Bauer, Rudolf 80278030
Baumeister, Willi 8031
Baumgartner, Christiane 8032
Bayros, Franz von 8033
Beckmann, Max 70687071
Bellmer, Hans 71677168
Benes, Vlastimil 71587163, 8034
Berndt, Siegfried 8035
Bertoia, Harry 80368040
Beuys, Joseph 7196, 8041
Bilbo, Jack 8042
Bödeker, Erich 8043
Böhm, Hartmut 7186, 8044
Bonato, Victor 80458047
Born, Adolf 80488049
Brailovskaya, Rimma N. 7109
Brailovsky, Leonid M. 7109
Braque, Georges 71527153, 8050
Brauner, Josef 80518052
Breusing, Ima 80538055
Brockhusen, Theo von 7009
Brockmann, Gottfried 7138, 80568057
Brodwolf, Jürgen 80588064
Brunovsky, Albin 7242
Brust, Karl Friedrich 7102
C
Campigli, Massimo 8065
Cézanne, Paul 7000
Chagall, Marc 71497151
Chevalier, Peter 80668067
Chillida, Eduardo 7201
Chirico, Giorgio de 80688070
Claret, Joan 8071
Cocteau, Jean 71547155, 8072
Collingwood, Peter 7253
Corinth, Lovis 70337038, 8073
8083
DDahn, Walter 80848086
Devrim, Nejad Melih 7185
Dienst, RolfGunter 7181
Dion, Mark 8087
Doig, Peter 7279
Dorsch, Ferdinand 7095
Dressler, August Wilhelm 7179, 8088
Dufy, Raoul 80898091
E
Eder, Martin 7283, 8092
Eemans, Marc 7130
Eglau, Otto 8093
Ehmsen, Heinrich 7127
Ende, Edgar 7177
Erb, Leo 71897190, 8094
Ernst, Max 71757176, 8095
F
Federle, Helmut 7254
Feininger, Lyonel 70587060
Felixmüller, Conrad 70817083
Fetting, Rainer 8096
Fischer, Lothar 7222
Flora, Paul 80978099
Förg, Günther 8100
Förster, Wieland 7259
Franck, Philipp 71137114
François, André 81018104
Friedrich, Otto 8105
Fußmann, Klaus 7240
G
Geiger, Rupprecht 71977198, 8106
Geiger, Willi 7115
Gering, Andreas 81078109
Gernhardt, Per 81108111
Gerstner, Karl 81128114
Glöckner, Hermann 71997200
Gontscharowa, Natalja 71077108
Gormley, Antony 7258
Gramatté, Walter 7097
Graphik & Handzeichnungen 8115
Greis, Otto 7237
Gris, Juan 7104
Großpietsch, Curt 81168117
Grosz, George 70887094, 8118
Grützke, Johannes 7269
Gurschner, Herbert 8119
Gustavo 7210
H
Hacker, Dieter 72387239
Hangen, Heijo 8120
Hans, Rolf 71827183
Hauptmann, Ivo 8121
Heine, Thomas Theodor 7047, 81228124
Helnwein, Gottfried 7267
Henri, Florence 71057106
Herrmann, Curt 7020
Hertlein, Willi 81258126
Hertzer, Else 81278128
Höch, Hannah 71357137
Hofer, Karl 7134
Hofschen, Edgar 7261
Holmead 71647165, 81298130
Holzer, Jenny 8131
Hrdlicka, Alfred 7262
Hübner, Ulrich 7030
Hundertwasser, Friedensreich
7260
IImmendorff, Jörg 7171, 8132
Indiana, Robert 8133
Isenburger, Eric 8134
JJacobi, Rudolf 7129
Janssen, Horst 7166, 81358137
Jones, Allen 81388139
K
Kandinsky, Wassily 7061
Kassák, Lajos 7184
Katz, Alex 72807281
Kaus, Max 7075, 8140
Kirchner, Ernst Ludwig 70527055
Klamann, Kurt 81418146
Klapheck, Konrad 8147
Klee, Paul 7062
Kleinschmidt, Paul 7131
Kliemann, CarlHeinz 8148
Klimsch, Fritz 7140
Koehler, Reinhold 7173
Koeppel, Matthias 7268, 8149
Kokoschka, Oskar 8150
Kollwitz, Käthe 70397041, 8151
Kopac, Slavko 8152
Koshin, Alexander 7256
Kretzschmar, Bernhard 7096, 8153
Kruger, Barbara 8154
Kubin, Alfred 70987100, 8155
Kuphal, Walter 8156
L
Laabs, Hans 81578158
Lagerfeld, Karl 72027205
Laserstein, Lotte 7133
Le Corbusier 7156
Lehmbruck, Wilhelm 7046, 8159
Lehmpfuhl, Christopher 72717273
Leistikow, Walter 7004
Lemcke, Dietmar 72327234
Lenk, Franz 7139
Liebermann, Max 70317032, 81608167
Lipchitz, Jacques 81688172
Liu Ye 7265
Löffler, Christoph 7284
Löwy, Leopold 70127015
Lorenzen, Jens 7277
Luther, Adolf 8173
M
Maatsch, Thilo 8174
Mack, Heinz 81758177
Maeder, Karl Hugo Otto 8178
MaetzelJohannsen, Dorothea 70777080
Magritte, René 8179
Mahnun, Noor 7263
Malewitsch, Kasimir 7103
Mammel, Dieter 8180
Manessier, Alfred 8181
Mantovani, AdelchiRiccardo 7208
ManzanaPissarro, Georges 7023
Mappenwerke 7072, 7195
Marc, Franz 8182
Marcks, Gerhard 81838186
Marquet, Albert 7021
Martin, Agnes 7252
Marwan 7180, 8187
Masjutin, Wassili Nikolajewitsch 81888189
Maurer, Dóra 81908194
Mecys, Aliute 72447245
Meese, Jonathan 8195
Meid, Hans 81968197
Merz, Gerhard 7266
Metzkes, Harald 81988199
Meunier, Constantin 8200
Middendorf, Helmut 8201
Minami, Keiko 7209
Miró, Joan 72117212
ModersohnBecker, Paula 7003
Morgner, Wilhelm 7045
Mueller, Otto 8202
MüllerSimon, Gerald 72477248
N
Nesch, Rolf 71417142
Netzband, Georg 7126
Neumann, Ernst 82038204
Neumann, Hans 7011, 82058207
Neumann, Max 8208
Nolde, Emil 70507051
O
Oppenheimer, Max 8209
Orlik, Emil 70167019, 82108221
P
Paik, Nam June 7194
Pal, Gogi Saroj 7264
Paolozzi, Eduardo 8222
Parkes, Michael 7243
Pasternak, Leonid Osipovich 8223
Peiner, Werner 7101
Picasso, Pablo 7022
Pichler, Walter 7236
Piene, Otto 7187, 82248232
Pijuan, Joan Hernández 7251
Platschek, Hans 7172
Poelzig, Hans 82338236
Poliakoff, Serge 7146, 8237
Polke, Sigmar 82388241
R
Radziwill, Franz 7174
Rainer, Arnulf 8242
Rebel, Carl Max 8243
Renoir, Auguste 8244
Richter, Gerhard 7188, 8245
Richter, Günter 7170
RichterBerlin, Heinrich 7008
Roeckenschuss, Christian 7255
Rohlfs, Christian 70487049
Rossi, Aldo 72277228
Roth, Dieter 82468247
Rouault, Georges 82488249
S
Saura, Antonio 7215, 82508251
Schade, Titus 7282
Scharf, Kenny 8252
Schatz, Otto Rudolf 82538254
Schiele, Egon 7073
Schleime, Cornelia 7223
SchmidtRottluff, Karl 70567057
Schramm, Werner 7074
Schreyer, Lothar 70667067
Schröter, Annette 7249
Schultheiß, Arnd 82558256
Schumacher, Emil 8257
Schumann, Sarah 7270
Schwarze, Michael 8258
Severini, Gino 8259
Shapiro, David 82608261
Sieverding, Katharina 8262
Sintenis, Renée 7120, 7128
Smith, Eddy 7076
Smith, Leon Polk 82638265
Sonderborg, K. R. H. 72247225
Spiro, Eugen 71167117
Spiro, Georges 7178
Springer, Ferdinand 8266
Stöhrer, Walter 72137214, 8267
Stoitzner, Josef 8268
Strempel, Horst 7132, 8269
Struck, Hermann 7118
T
Tàpies, Antoni 82708272
Tappert, Georg 7125
Tatafiore, Ernesto 8273
Theunert, Christian 82748275
Thomas, Norbert 8276
Tinguely, Jean 8277
Topor, Roland 72187219, 82788279
Trockel, Rosemarie 8280
Tschinkel, Augustin 8281
Tschirtner, Oswald 7250
Tübke, Werner 7169
Tuttle, Richard 8282
U
Uecker, Günther 71917193, 8283
Ungerer, Tomi 72207221, 82848285
Ury, Lesser 70247029, 82868289
V
Vallotton, Félix 8290
Valtat, Louis 82918293
van LeckwyckCampendonk, Edith 7157
Venet, Bernar 7257
Vogeler, Heinrich 70017002
Voigt, Bruno 71217124
Voigt, Jorinde 8294
Vostell, Wolf 82958297
W
Wachter, Andreas 7274
Wauer, William 70637065, 82988299
Weber, Christine 7275
Wellenstein, Walter 8300
Werner, Theodor 71477148
Wesley, John 83018302
Wilp, Charles 7196
Winter, Fritz 71437145
Wirnharter, Georg C. 7276
Wittlich, Josef 8303
Woyski, Klaus von 83048305
Wunderlich, Paul 8306
Wunderwald, Gustav 8307
Z
Zander, Heinz 7246, 83088310
Zaugg, Rémy 7226
Ziervogel, Ralf 8311
Zille, Heinrich 70427044, 83128315
Zitzewitz, Augusta von 71107111
1. Die Galerie Gerda Bassenge KG, nachfolgend Versteigerer genannt, versteigert als Kommissionärin im eigenen Namen und für Rechnung ihrer Auftraggeber (Kommittenten), die unbenannt bleiben. Die Versteigerung ist freiwillig und öffentlich im Sinne des § 383 III BGB.
2. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Nummern des Kataloges zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge anzubieten oder zurückzuziehen.
3. Sämtliche zur Versteigerung kommenden Gegenstände können vor der Versteigerung besichtigt und geprüft werden. Die Sachen sind gebraucht. Erhaltungszustände der einzelnen angebotenen Arbeiten bleiben im Katalog in der Regel unerwähnt. Die Katalogbeschreibungen sind keine Garantien im Rechtssinne und keine vertraglich vereinbarten Beschaffenheitsangaben. Gleiches gilt für individuell angeforderte Zustandsberichte. Sie bringen nur die subjektive Einschätzung des Versteigerers zum Ausdruck und dienen lediglich der unverbindlichen Orientierung. Alle Gegenstände werden in dem Erhaltungszustand veräußert, in dem sie sich bei Erteilung des Zuschlages befinden. Soweit nicht in der Katalogbeschreibung explizit erwähnt, sind Rahmungen nicht bindender Bestandteil des Angebots. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen Sachmängeln in Anspruch nehmen, wenn dieser seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch, wegen rechtzeitig vorgetragener, begründeter Mängelrügen innerhalb der Verjährungsfrist von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des Zuschlags seine Ansprüche gegenüber dem Einlieferer (Auftraggeber) geltend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer dem Erwerber den Kaufpreis samt Aufgeld. Die Haftung des Versteigerers auf Schadensersatz für Vermögensschäden – gleich aus welchem Grund – ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Versteigerer fiele Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt unberührt.
4. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Wenn mehrere Personen dasselbe Gebot abgeben und nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. Der Versteigerer kann den Zuschlag zurücknehmen und die Sachen erneut ausbieten, wenn irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
5. Im Falle eines schriftlichen Gebotes beauftragt der Interessent den Versteigerer für ihn während der Versteigerung Gebote abzugeben. In schriftlichen Aufträgen ist bei Differenzen zwischen Nummer und Kennwort das Kennwort maßgebend.
6. Telefonische Gebote und Online-Direkt-Gebote über das Internet bedürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zustimmung. Für die Bearbeitung übernimmt der
Versteigerer jedoch keine Gewähr. Telefonische und OnlineGebote werden nur akzeptiert, wenn der Bieter bereit ist, den ihm zuvor mitgeteilten Mindestpreis des jeweiligen Loses zu bieten. Auch bei Nichtzustandekommen einer Verbindung gilt, dass für den Auktionator dieses Gebot in Höhe des Mindestpreises verbindlich ist. Für das Zustandekommen einer entsprechenden Telefon- oder Onlineverbindung übernimmt der Versteigerer keine Gewähr. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf solche Gebote keine Anwendung (§ 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB).
7. Mit der Erteilung des Zuschlages geht die Gefahr für nicht zu vertretende Verluste und Beschädigung auf den Ersteigerer über. Das Eigentum an den ersteigerten Sachen geht erst mit vollständigem Zahlungseingang an den Erwerber über.
8. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 30% zu entrichten, in dem die Umsatzsteuer ohne separaten Ausweis enthalten ist (Differenzbesteuerung) oder ein Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer (Regelbesteuerung) von z.Zt. 7% (Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Graphiken, Bücher etc.) bzw. 19% (Handschriften, Autographen, Kunstgewerbliche Gegenstände, Siebdrucke, Offsets, Fotografien, etc.). Die im Katalog mit einem * gekennzeichneten Objekte unterliegen in jedem Fall der Regelbesteuerung (Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer von z.Zt. 7% bzw. 19%). Bei den im Katalog mit einem ^ gekennzeichneten Objekten ist Einfuhrumsatzsteuer angefallen.
In diesen Fällen wird zusätzlich zu einem Aufgeld von 27% (Differenzbesteuerung) die verauslagte Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.Zt. 7% auf den Zuschlag erhoben.
Für bundesdeutsche Kunsthändler und Antiquare, die zum Vor steuer abzug berechtigt sind, kann die Gesamt rech nung auf Wunsch, wie bisher nach der Regelbesteuerung ausgestellt werden. Von der Umsatzsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (außerhalb der EU) und – bei Angabe ihrer USt.-Identifikations-Nr. bei Auftragserteilung als Nachweis der Berechtigung zum Bezug steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferungen –auch an Unternehmen in anderen EU-Mitgliedsstaaten, unter der Voraussetzung, dass sie für gewerblichen Gebrauch einkaufen. Eine Korrektur nach Rechnungsstellung ist nicht möglich. Alle anderen Käufe aus EU-Ländern unterliegen der Umsatzsteuer. Ausländischen Käufern außerhalb der Europäischen Union wird die Umsatzsteuer erstattet, wenn binnen 4 Wochen nach der Auktion der deutsche zollamtliche Ausfuhrnachweis und der zollamtliche Einfuhrnachweis des entsprechenden Importlandes erbracht werden. Bei Versand durch uns gilt der Ausfuhrnachweis als gegeben. Bei Online-Live-Geboten über Internetplattformen erhöht sich das Aufgeld um die dort anfallende Transaktionsgebühr (i. d. R. 3-5%). Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedür fen einer besonderen Nachprüfung und eventueller Berichtigung; Irrtum vorbehalten. Katalog- und Zusatzabbildungen dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Reproduktionsrechte und digitale Dateien der Abbildungen können gegen Gebühr erworben werden. Gegebenen-
falls noch bestehende Urheberrechte Dritter bleiben davon unberührt und müssen u.U. gesondert eingeholt werden.
9. Die Auslieferung der ersteigerten Stücke erfolgt in unseren Geschäftsräumen gegen Bezahlung. Kreditkarten (Mastercard, VISA, American Express), Schecks sowie andere unbare Zahlungen werden nur erfüllungshalber angenommen. Bankspesen/ Transaktionsgebühren bzw. Kursverluste können zu Lasten des Käufers gehen. Die Auf bewahrung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Versand wird gegen Vorabrechnung des Rechnungsbetrages ausgeführt. Die Versandspesen sowie die Kosten für Versicherung gegen Verlust und Beschädigung gehen zu Lasten des Käufers. Übersteigen die tatsäch lichen Versandkosten die vorab berechnete Pauschale, so wird die Differenz dem Käufer nachträglich in Rechnung gestellt.
10. Bei der Ausfuhr von Kulturgütern ist gem. der EG-Verordnung Nr. 116/2009 bzw. § 24 KGSG abhängig von Kategorie und Wert des Objekts ggf. eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Aus Gründen des Artenschutzes können Objekte aus bestimmten, geschützten Materialien (u.a. Elfenbein, Schildpatt, Perlmutt und einige Korallenarten) besonderen Im- und Exportbeschränkungen unterliegen. Zum Zwecke des Exports (insbesondere außerhalb der Europäischen Union) kann hierfür eine spezielle Ausfuhrgenehmigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 338/97 erforderlich sein. Entsprechende Ausfuhrgenehmigungen können nur unter strengen Bedingungen erteilt und ggf. auch gar nicht erlangt werden, auch kann der Import dieser Gegenstände in manche Staaten eingeschränkt oder untersagt sein. Der Käufer ist selbst dafür verantwortlich, sich über etwaige Im- und Exportbeschränkungen zu informieren. Export und Import entsprechender Objekte erfolgen allein auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
11. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Der Versteigerer ist berechtigt, falls nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Versteigerung Zahlung geleistet ist, den durch den Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrag ohne weitere Fristsetzung zu annullieren, Verzugszinsen in
banküblicher Höhe – mindestens jedoch 1 % auf den Bruttopreis je angebrochenen Monat – zu berechnen und von dem Ersteigerer wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. Der Schadenersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache in einer neuen Auktion nochmals versteigert wird und der säumige Käufer für einen Mindererlös gegenüber der vorangegangenen Versteigerung einschließlich der Gebühren des Auktionshauses aufzukommen hat. Zu einem Gebot wird er nicht zugelassen, auf einen etwaigen Mehrerlös hat er keinen Anspruch.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand im vollkaufmännischen Verkehr ist Berlin. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UNAbkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
13. Die im Katalog aufgeführten Preise sind Schätzpreise, keine Limite.
14. Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung, bei der der Interessent entweder telefonisch oder schriftlich (im Sinne der Ziffern 5 und 6) den Auftrag zur Gebotsabgabe mit einem bestimmten Betrag erteilt. Entsprechende Gebote behalten ihre Gültigkeit für 4 Wochen nach Abgabe.
15. Die Abgabe eines Gebotes in jeglicher Form bedeutet die Anerkennung dieser Versteigerungsbedingungen. Der Versteigerer nimmt Gebote nur aufgrund der vorstehenden Versteigerungsbedingungen entgegen und erteilt dementsprechend Zuschläge. Kommissionäre haften für die Käufe ihrer Auftraggeber.
16. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt.
David Bassenge, Geschäftsführer und Auktionator
Dr. Markus Brandis, öffentlich bestellter u. vereidigter Auktionator
Stand: November 2025

1. The Galerie Gerda Bassenge KG, subsequently called “the auctioneer” carries on business as commission-agent in its own name on behalf of its voluntary consignors. This auction sale is a public one in the sense of § 383 III BGB.
2. The auctioneer reserves the right to combine, to split, to change or to withdraw lots before the actual final sale.
3. All objects put up for auction can be viewed and examined prior to the sale at the times made known in the catalogue. The items are used and sold as is. As long as not explicitly mentioned in the catalogue description, framing is not an inherent part of the offer. As a rule, the condition of the individual work is not given in the catalogue. Catalogue descriptions are made with as much care as possible, but the descriptions do not fall under the statutory paragraph for guaranteed legal characteristics. The same applies for individually requested condition reports. These also offer no legal guarantee and only represent the subjective assessment of the auctioneer while serv ing as a non-binding orientation. The liability for damage to life, body or health shall remain unaffected. In case of a justified claim, however, he will accept the responsibility to make a claim for restitution on behalf of the buyer against the consignor within a period of 12 months, running from the fall of the hammer. In the event of a successful claim the auctioneer will refund the hammerprice plus premium.
4. The highest bidder acknowledged by the auctioneer shall be deemed the buyer. In case of identical bids the buyer will be determined by drawing lots. In the event of a dispute the auctioneer has the absolute discretion to reoffer and resell the lot in dispute. He may also knock down lots conditionally.
5. In the case of a written bid the bidder commissions the auctioneer to place bids on his behalf during the auction. In cases where there is a discrepancy between number and title in a written bid the title shall prevail.
6. Telephone and direct online bidding via the internet must be approved in advance by the auctioneer. The auctioneer cannot be held liable for faulty connections or transmission failure. In such a case the bidder agrees to bid the reserve price of the corresponding lot. For such bidding the regulations of long distance contracts do not apply (Fernabsatzverträge) [cf § 312g II,10 BGB].
7. On the fall of the auctioneer’s hammer title to the offered lot will pass to the acknowledged bidder. The successful buyer is obliged to accept and pay for the lot. Ownership only passes to the buyer when full payment has been received. The buyer, however, immediately assumes all risks when the goods are knocked down to him.
8. A premium of 30% of the hammer price will be levied in which the VAT is included (marginal tax scheme) or a premium of 25% of the hammer price plus the VAT of 7% (paintings, drawings, sculptures, prints, books, etc.) or 19% (manuscripts, autographs letters, applied arts, screen prints, offset prints, photographs, etc.) of the invoice sum will be levied (regular tax scheme). Buyers from countries of the European Union are subject to German VAT. Items marked with an * are subject to the regular tax scheme (premium of 25% of the hammer price plus the current VAT of 19%). Items marked with an ^ are subject to import duty. In these cases in addition to a premium of 27% (marginal tax scheme), the charged import tax of currently 7% will be added to the hammer price.
Exempted from these rules are only dealers from EU-countries, who are entitled, under their notification of their VAT ID-Number, to buy on the basis of VAT-free delivery within the European Union. Notification of VAT ID-Numbers must be given to the auctioneer before the sale.
For buyers from non EU-countries a premium of 25% will be levied. VAT will be exempted or refunded on production of evidence of exportation within 4 weeks of the auction, or, if appropriate, importation to another country. This is taken as given when the dispatch is effected by us.
Live bidding through online platforms entails a transaction fee stipulated by the platform and will be added to the premium (usually 3-5% of the hammer price).
Due to the work overload of the accounting department during auctions, invoices generated during or directly after an auction require careful revision and possible correction; errors excepted. Catalogue images may not be used without permission. Reproduction rights and digital files can be acquired for a fee. Any copyrights of third parties that may still exist remain unaffected by this and may have to be obtained separately.
9. Auction lots will, without exception, only be handed over after pay ment has been made. Credit cards (VISA, Mastercard, American Express), checks and any other form of non-cash payment are accepted only on account of performance. Exchange rate risk and bank charges may be applicable. Storage and dispatch are at the expense and risk of the buyer. If the shipping costs exceed the lump sum on the invoice the outstanding amount will be billed separately.
10. According to regulation (EC) No. 116/2009 resp. § 24 KGSG, export license may be necessary when exporting cultural goods depending on the type or value of the object in question. For the purposes of wildlife conservation, it is necessary to obtain an export license according to regulation (EC) No. 338/97 when exporting objects made from certain protected materials (incl. ivory, tortoiseshell, mother-of-pearl and certain corals) out of the territory of the European Community. Export licenses for objects made of protec -
ted materials are only granted under strict conditions or may not be granted at all. The import of such objects may be restricted or prohibited by certain countries. It is the buyer’s responsibility to inform himself, whether an object is subject to such restrictions. Export and import of such objects are at the expense and risk of the buyer.
11. The buyer is liable for acceptance of the goods and for payment. The purchase price shall be due for payment upon the lot being knocked down to the buyer. In case of a delayed payment (two weeks after the sale) the purchaser will be held responsible for all resultant damages, in particular interest and exchange losses. In case of payment default the auctioneer will charge interest on the outstanding amount at a rate of 1% to the gross price per month or part of month. In such an event the auctioneer reserves the right to annul the purchase contract without further notice, and to claim damages from the buyer for non-fulfilment, accordingly he can reauction the goods at the buyer’s expense. In this case the buyer is liable for any loss incurred, the buyer shall have no claim if a higher price has been achieved. He will not be permitted to bid.
12. The place of fulfillment and jurisdiction is Berlin. German law applies exclusively; the UN-Treaty (CISG) is explicitly excluded.
13. The prices quoted after each lot are estimates, not reserves.
14. The after-sales is part of the auction in which the bidder places either by telephone or in written form (as stated in number 5 and 6) the order to bid a set amount. Corresponding bids are binding for 4 weeks after submission.
15. By making a bid, either verbally in the auction, by telephone, written by letter, by fax, or through the internet the bidder confirms that he has taken notice of these terms of sale by auction and accepts them. Agents who act on behalf of a third party are jointly and separately liable for the fulfillment of contract on behalf of their principals.
16. Should one or the other of the above terms of sale become wholly or partly ineffective, the validity of the remainder is not affected. In the event of a dispute the German version of the above conditions of sale is valid.
David Bassenge, auctioneer
Dr. Markus Brandis, attested public auctioneer
As of November 2025


Moderne und Zeitgenössische Kunst II online unter www.bassenge.com
Vorbesichtigung und Auktion finden wie gewohnt als Präsenzveranstaltungen statt
Catalogue Modern and Contemporary Art II online at www.bassenge.com
The preview and auction will take place as usual
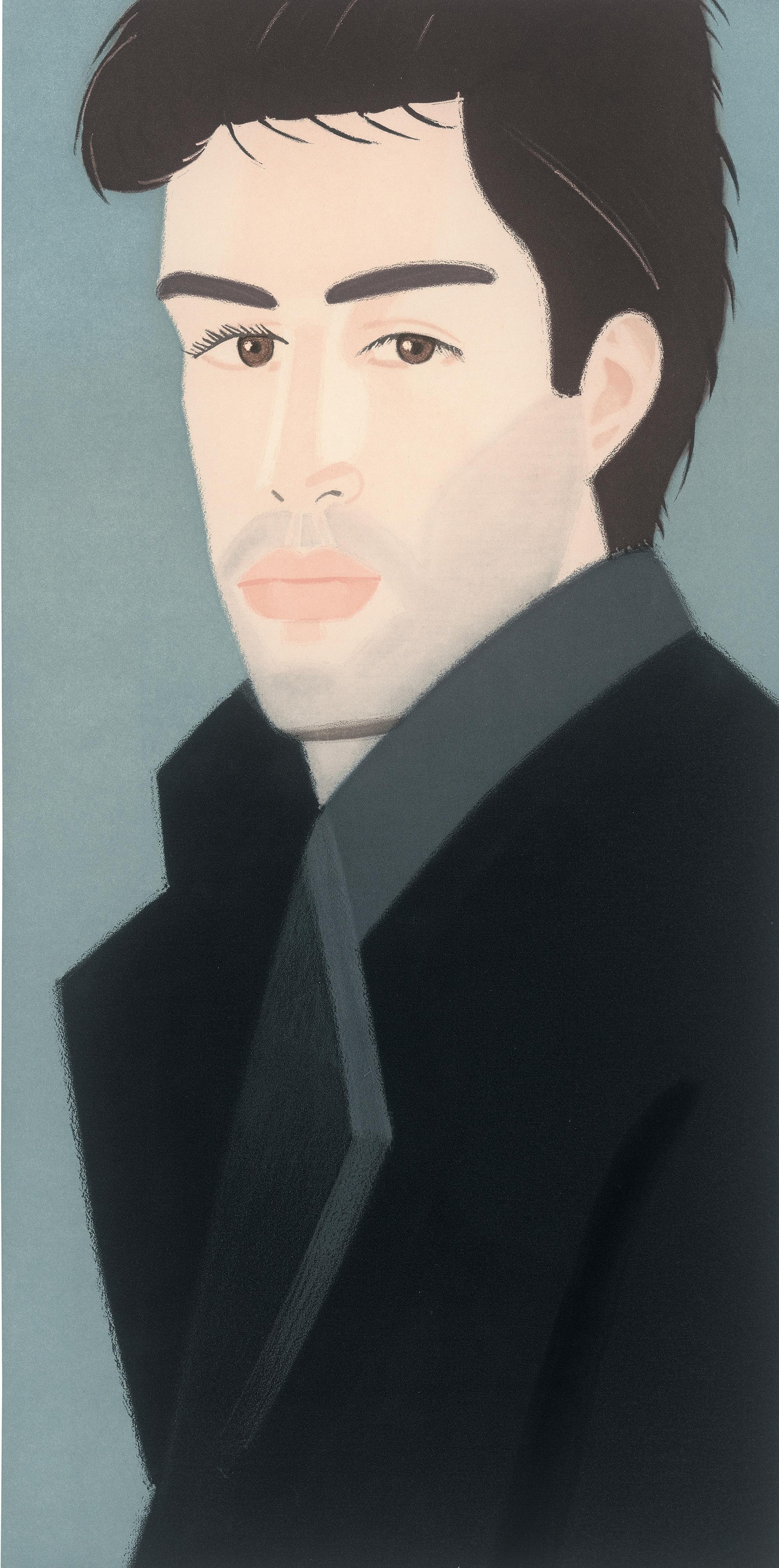
GALERIE BASSENGE BERLIN