BASSENGE



Donnerstag, 27. November 2025 Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin
Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: art@bassenge.com . www.bassenge.com



Dr. Ruth Baljöhr
Telefon: +49 30 - 893 80 29 22
r.baljoehr@bassenge.com

David Bassenge
Telefon: +49 30 - 893 80 29 17 david@bassenge.com
Eva Dalvai
Telefon: +49 30 - 893 80 29 80
e.dalvai@bassenge.com

Lea Kellhuber
Telefon: +49 30 - 893 80 29 20
l.kellhuber@bassenge.com
Nadine Keul
Telefon: +49 30 - 893 80 29 21
n.keul@bassenge.com

Harald Weinhold
Telefon: +49 30 - 893 80 29 13
h.weinhold@bassenge.com
Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind.
Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei

Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.
Erdener Straße 5A 14193 Berlin
Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November 10 bis 18 Uhr
Dienstag, 25. November 10 bis 17 Uhr
Vorbesichtigung ausgewählter Werke in München
11. bis 14. November 2025
täglich von 11 bis 18 Uhr
Galeriestraße 2B (2. Etage), 80539 München

MITTWOCH, 26. November 2025
Vormittag 10.00 Uhr
Nachmittag 15.00 Uhr
Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5261
Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5262-5347
Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5348-5475
Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5476-5714
DONNERSTAG, 27. November 2025
Vormittag 11.00 Uhr
FREITAG, 28. November 2025
Vormittag 11.00 Uhr
Nachmittag 16.00 Uhr
SONNABEND, 29. November 2025
Vormittag 11.00 Uhr
Nachmittag 16.00 Uhr
Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6231 Rahmen Nr. 6232-6256
Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6500-6770
Moderne und Zeitgenössische Kunst I Nr. 7000-7284
Moderne und Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8315
Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4101
Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4102-4252
VORBESICHTIGUNGEN
Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts
Erdener Straße 5A, 14193 Berlin
Donnerstag, 20. November bis Montag, 24. November, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 25. November 10.00–17.00 Uhr
Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II
Rankestraße 24, 10789 Berlin
Donnerstag, 20. November bis Donnerstag, 27. November, 10.00–18.00 Uhr
Fotografie und Fotokunst des 19. bis 21. Jahrhunderts
Rankestraße 24, 10789 Berlin
Montag, 17. November bis Freitag, 21. November, 10.00–18.00 Uhr, Samstag 22. November, 10.00–16.00 Uhr, Sonntag geschlossen, Montag, 24. November bis Donnerstag 27. November, 10.00–18.00 Uhr, Freitag, 28. November 10.00–15.00 Uhr
Schutzgebühr Katalog: 20 €
Umschlag: Los 6072, Johann Baptist Reiter und Los 6142, Friedrich Ballenberger Seite 4: Los 6027, Hendrik de Fromantiou. Seite 6 bis 7: Los 6057, Barend Cornelis Koekkoek




6000 um 1520. Christus als Schmerzensmann. Öl auf Holz, teils parkettiert. 112 x 43 cm.
6.000 €
Provenienz: Lempertz, Köln, Auktion am 25. Mai 2017, Los 1013 (als „Bartholomäus Bruyn d. Ä. zugeschrieben“).
Deutsche Privatsammlung.

Lucas Gassel
(um 1488 Deurne – 1568/69 Brüssel)
6001 Umkreis. Felsige Landschaft mit gotischem Schloss, im Vordergrund wohl die Verstoßung von Hagar. Öl auf Holz. 17,6 x 25,8 cm.
4.000 €
Provenienz: Parke-Bernet Galleries, New York, Auktion am 10. Oktober 1940, Los 28 mit Abb., aus der Sammlung „Marlow“ (als „Joachim de Patinir“; Katalogausschnitt verso montiert).
1977 bei Kunsthandel Xaver Scheidwimmer, München (als „Lucas van Gassel“).
Seither deutsche Privatsammlung.

Leonhard Bramer (1596–1674, Delft)
6002 Nachfolge. Gelehrter in orientalischem Kostüm im Studiolo.
Öl auf Holz. 31 x 23,7 cm. Wohl 18. Jh. 750 €
Provenienz: Erworben 1986 bei Ségal, Basel. Seither in Familienbesitz.
6003* um 1550. Der hl. Hieronymus im Gehäus. Öl auf Holz. 94 x 69,5 cm.
24.000 €
Provenienz: Schweizer Privatsammlung. Koller, Zürich, Auktion 182 am 22. September 2017, Los 3019. The Jack Daulton Collection, Los Altos, Kalifornien, USA.
Das Motiv des in der Studierstube schreibenden Hieronymus läßt sich in der Kunst bereits seit dem Mittelalter nachweisen. In Nordeuropa wird die Darstellung vor allem durch Jan van Eyck und später durch Albrecht Dürers Kupferstich maßgeblich verbreitet. Spätestens bei Dürer wird die Raumdarstellung zu einem Hauptthema des Bildes. So widmet sich auch der Künstler des vorliegenden Gemäldes detailliert der Raumsituation und den zahlreichen, die Stube füllenden Details und Gegenständen.
Der Heilige sitzt in einer durch eine dünne Holzwand abgetrennten
Nische in Klausur. Rechts gibt ein Torbogen den Blick auf einen Flur mit einer kunstvoll geschnitzten Bank frei, und oberhalb der Trennwand sind mit wertvollem Marmor verkleidete Säulen zu erkennen. Das Innere der Kammer ist im Kontrast zur Außenwelt bewusst schlicht gehalten und mit Gegenständen ausgestattet, die Hieronymus als Kirchenvater und Übersetzer des Evangeliums ausweisen. Dabei bleibt das für die Schriften des Hieronymus theologisch prägende - und dem humanistischen Fortschrittsglauben zugleich entgegenlaufende - Thema der inneren Einkehr und der Mahnung an die Vergänglichkeit irdischen Lebens zentral. Neben der titelgebenden Schrifttafel mit dem Sinnspruch „Homo bulla”, was auf Lateinisch „der Mensch ist eine Seifenblase” bedeutet, verweisen zahlreiche Details auf die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins: die halb abgebrannte, gelöschte Kerze, die Dochtschere und der markant vor dem Schreibpult positionierte Totenschädel. Hieronymus selbst schreibt auf einem Zettel die Worte „cogita mori et in (a)eternum non morietur”, also etwa „Gedenke des Todes und du wirst nie sterben”. Damit ist gemeint, dass derjenige, der sich zu Lebzeiten seiner Vergänglichkeit bewusst ist und sich der inneren Einkehr sowie den christlichen Idealen verschreibt, das ewige Leben erlangen kann. Die Darstellung folgt somit ganz dem frühneuzeitlichen Verständnis der Hieronymus-Ikonografie. Der Künstler zeigt zugleich in vielen Details sein künstlerisches Können, so zum Beispiel in der gekonnt wiedergegebenen Perspektive und den Spiegelungen des Raumes auf dem glänzenden Metall des Kerzenständers. Die künstlerische Ausführung und die dargestellten Gegenstände wie die markante Brille oder die Flaschen auf dem Regal lassen sich in Form und Stil einem deutschen Meister aus der Mitte des 16. Jahrhunderts zuordnen.


6004
Deutsch
6004 um 1600. Mariä Heimsuchung. Öl auf Holz. 42,4 x 29,3 cm.
2.400 €
Die Komposition des Gemäldes folgt detailliert dem Vorbild des um 1503 datierten Holzschnitts aus Albrecht Dürers Marienleben (Meder 196). Das Gemälde ist im Kontext der sogenannten Dürer-Renaissance um 1600 einzuordnen und stellt gleichzeitig durch die malerische Übersetzung der gedruckten Vorlage ein interessantes Beispiel für mediale Transferprozesse dar.
Meister der Nürnberger Madonna (tätig in Nürnberg in der 1. Hälfte des 16. Jh.)
6005 Maria Magdalena mit dem Salbgefäß. Lindenholz, ungefasst. Höhe ca. 73,5 cm. Um 1505/15.
18.000 €
Provenienz: Kunsthandel Wenzel, Bamberg 2010. Privatsammlung Berlin.
Die hier kniend mit dem Salbgefäß dargestellte und wohl einst für eine Kreuzigungsgruppe entworfene Maria Magdalena zeichnet sich durch

die für ihre Rolle als „heilige Sünderin“ passende, offen gestaltete und luxuriöse Kleidung aus. Ihr Ausschnitt ist ungewöhnlich tief und ihr Haar fällt unter der nur locker aufgesetzten Haube luftig um ihre Schultern, wie es sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts ansonsten nicht geziemt hätte. Der geschlitzte Ärmel ist ein weiteres Detail, das in dieser Zeit als besonders modisch galt, aber von Sittenwächtern auch oft als dekadent empfunden wurde. Stilistisch weisen der kantig aufgereihte Faltenwurf und das locker fallende Haar auf einen süddeutschen Künstler der ersten beiden Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts hin. Die im
Kontrast zu den großen, plastisch gewölbten Partien gestalteten scharfkantigen Falten und das eher rundliche Antlitz mit den leicht schräg stehenden Augen lassen nach Einschätzung des Experten Dr. Markus Hörsch die Skulptur als Werk des Schöpfers der bekannten Nürnberger Madonna im Germanischen Nationalmuseums identifizieren.Mit einer schriftlichen Expertise von Dr. Markus Hörsch, Bamberg, vom 20. Juli 2010 (in Kopie), in welcher dieser abschließend feststellt: „Die Magdalena erweitert unsere Kenntnis von der Tätigkeit dieses bemerkenswerten Schnitzers um ein entscheidendes Werk.“

Peter Gertner
(um 1495/1500 Franken (Nürnberg?) – nach 1541)
6006 Bildnis Ottheinrich von der Pfalz. Öl auf Holz. 50,7 x 39,8 cm. Um 1535.
75.000 €
Provenienz: Hugo Helbing, München, Auktion vom 3.-4. Mai 1932, Los 13 (als „Deutscher Maler des 16. Jh.“), erworben durch die Galerie Wwe. Heinemann, Wiesbaden.
Sammlung Gustav Hobraeck (1867-1939), Neuwied am Rhein (dieser nachweislich ein Kunde der Galerie Wwe. Heinemann). Seither in Familienbesitz.
Dieses bislang unbekannte Porträt zeigt unverkennbar den Wittelsbacher Ottheinrich, Herzog von Pfalz-Neuburg (1502-1559) und seit 1556 Kurfürst von der Pfalz. Sein Äußeres ist durch mehrere gesicherte Bildnisse, beispielsweise von Barthel Beham überliefert, die ihn zudem in vergleichbarer Aufmachung festhalten. In stattlicher Pose erscheint Ottheinrich im Dreiviertelprofil vor monochromen Grund. Sein bärtiges Haupt bedeckt ein schräg aufgesetztes, rotsamtenes Barett, das mit einer weißen Feder und einer goldenen Agraffe geziert ist, die zeigt, wie Samson oder Herkules den Löwen tötet - ein Sinnbild für die Stärke des Fürsten. An Schmuck trägt er zudem eine Goldkette mit einem reich mit Juwelen und Perlen besetzten Anhänger. Der Mantel besteht aus kostbarem Goldbrokat mit Granatapfelmuster. Darunter trägt er ein mit Goldfäden besticktes rotes Wams sowie ein feines weißes Hemd, das mit aufwendiger Gold- und Perlenstickerei verziert ist: Zwei Hände fassen ein rotes Herz, in das mit Goldfäden ein „S“ eingeschrieben ist. Dieses verweist auf seine Gemahlin Susanna von Bayern, Witwe des Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Ansbach und Burggräfin von Nürnberg, die Ottheinrich 1529 geehelicht hatte. Wahrscheinlich war sie es, die den vormals in Nürnberg tätigen Maler Peter Gertner als Hofmaler für Neuburg empfahl und der auch Schöpfer des vorliegenden Bildnisses ist. Zwar hat es der Künstler nicht wie viele seiner bürgerlichen Porträts signiert, doch stilistisch lässt es sich sehr gut in sein Œuvre in die Jahre um 1535 einfügen. Susanna von Bayern war bereits zuvor auf Peter Gertner aufmerksam geworden, denn dieser schuf 1527 ein Bildnisepitaph von ihr und dem im selben Jahr verstorbenen Kasimir von Brandenburg-Ansbach, eine Kopie hat sich in der Heilsbronner Klosterkirche erhalten. In Neuburg ist er als „maister Petern, hofmaler“ erstmals 1535/36 in den Hofrechnungen greifbar. Gertner war in Nürnberg schon früh zum gefragten Porträtisten geworden, wie etwa die Bildnisse des Wolfgang Eisen von 1523 (Ehemals Berlin, Gemäldegalerie) und das Bildnis von Hans Geyer (Raleigh, North Carolina Museum of Art, Inv. Nr. 52.9.138) von 1524 belegen. Beide tragen sein Monogramm PG und das sprechende Zeichen, einen Spaten. Sein anfänglicher Bildnisstil ist mit dem des zeitgleich in Nürnberg tätigen Hans Brosamer vergleichbar. Die Silhouette der Figuren bestimmt das Bild-
feld großflächig. Die hart modellierten Gesichter sind merkwürdig überzeichnet und wirken blass, die Augen, deren Iris meist keine weitere Modellierung aufweist, erscheinen ausdruckslos und starr. So besitzen seine frühen Männerbildnisse einen eher dokumentarischen Charakter, eine atmosphärische Auffassung fehlt dagegen.
Doch die künstlerische Bandbreite Peter Gertners war weitaus größer, wie ein Frauenbildnis von etwa 1525 (Karlsruhe, Kunsthalle Karlsruhe, Inv. Nr. 129) mit seiner malerischen Auffassung des Inkarnats zeigt, das eine Brücke zu dem feinmalerisch modellierten Gesicht Ottheinrichs im vorliegenden Bildnis schlägt. Hier sind die Licht- und Schattenpartien sorgfältig abgestuft, die Linearität ist zugunsten des Volumens verschwunden. Den Höhepunkt der feinmalerischen Ausprägung begegnet uns jedoch in Gertners aufwändigen, auf Pergament ausgeführten und partiell in Deckfarben kolorierten Bildnissen. Diese dienten ihm als Vorstudien für die Porträtserie der Wittelsbacher, den Verwandten Ottheinrichs, aber auch für die Darstellungen des Pfalzgrafen selbst. Sie alle zeigen eine atmosphärische Lebendigkeit des Inkarnats, auf die sich der Künstler offenbar konzentrierte, denn Kopfschmuck und Kleidung sind nur mit flüchtigen Strichen angedeutet; auch die Augen behalten ihren starren Ausdruck. So dürfte Gertner diese Bildnisstudien jeweils für unterschiedliche Porträtaufträge gedient haben, die jeweils nach Bedarf abgewandelt werden konnten. Für das vorliegende Bildnis hat der Maler wahrscheinlich seine Kopfstudie Ottheinrichs (Sammlung Würth, Inv. Nr. 9326) als Vorlage genutzt, die er allerdings seitenverkehrt verwendete. Die schematische Auffassung des Körpers bleibt bestehen, die prunkvoll verzierte Kleidung geht fast ins Ornamentale über.
Im Vergleich mit anderen Bildnissen von Peter Gertner fällt auf, dass die vorliegende Tafel kein schmales Hochformat aufweist, sondern ein nahezu quadratisches Format, und dass die Hände fehlen, was untypisch ist. Dies lässt sich leicht erklären, denn die untere Bildkante ist beschnitten. Das ursprüngliche Aussehen des Gemäldes ist durch zwei recht getreue, doch sicherlich später, von fremder Hand entstandene Kopien überliefert, die Ottheinrich im erweiterten Bruststück zeigen (Heidelberg, Kurpfälzisches Museum, Inv. Nr. L. 87, Leihgabe des Bayerischen Nationalmuseums München; München, Bayerisches Nationalmuseum München, Inv. Nr. R 66). Dort hat er die Hände vor den Körper geführt und hält in seiner beringten linken Hand einen Brief.
In diesem sehr fein ausgeführten, bisher unpublizierten Gemälde zeigt sich einmal mehr die Bildniskunst des Hofmalers Peter Gertner, deren malerischen Qualitäten dabei höchstes Niveau erreichen.
Dr. Katrin Dyballa
Ein undatiertes Gutachten (ca. 1937) von Ernst Buchner, München, in Kopie vorhanden. Ernst Buchner war der Schwiegervater des Sammlers Gustav Hobraeck. Wir danken Dr. Stephan Klingen, München, für wertvolle Hinweise zur Provenienz.

Anglo-flämische Schule
6007 1598. Bildnis eines Knaben im geknöpften lachsfarbenen Wams mit Goldstickerei und weißem Batistkragen, in den Händen eine Laute.
Öl auf Leinwand. 56 x 46,5 cm. Oben links bez. und datiert „Aetatis 7. 1598“.
18.000 €
Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung.
Österreichisch
6008 1577. Bildnis der Baroness Zsófia Katalin Esterházy de Galántha (geb. Illésházy de Illésháza, 1547-1599) mit breitem Spitzenkragen und Spitzenhaube.
Öl mit Goldhöhungen auf Silber. 7,2 x 5,2 cm. Verso mit gravierter Inschrift „Ill.ma Coms.ss Sofia Illeshazi Francisco Esterhaziana Com.tis Stefani Illeshazi R.H.P. soror Com.tis Nicolai Esterhazi R.H.P. mater Ao 1577“.
2.800 €
Im Jahr 1566 heiratete Zsófia Katalin im Alter von 19 Jahren Ferenc Esterházy de Galántha (1533-1605), dem Begründer der bedeutenden ungarischen Dynastie. Gemeinsam hatten sie in der Folge 13 Kinder, von denen 10 das Erwachsenenalter erreichten. Zsófia Katalin starb 1599 in Galanta, einem der Esterházy Schlösser, wo sich auch ein in Öl ausgeführtes ganzfiguriges Portrait der Baronin befindet. Der Schöpfer dieser Miniatur dürfte sich bei der Ausführung des Porträtkopfes an dem Ölgemälde orientiert haben.

Franz Pourbus II. (1569 Antwerpen – 1622 Paris)
6009 Schule. Bildnis Henri IV, König von Frankreich und Navarra.
Öl auf Holz. 5 x 3,6 cm (im Oval). Um 1610.
800 €
Die Miniatur zeigt den König, wie ihn Franz Pourbus II in der Zeit um 1610 in Gemälden darstellte: Brustbildnis nach links mit Schnurr- und Kinnbart, dazu das schwarze Wams mit der weißen Halskrause und dem blauen Band zum Orden vom Heiligen Geist.


6010 2. Hälfte 17. Jh. Die Heimkehr des Tobias. Öl auf Leinwand, doubliert. 96 x 135 cm.
4.000 €
Nah an den Bildrand gerückt und in delikatem Sfumato modelliert erscheinen die vier Protagonisten der Tobias-Geschichte in halber Figur: Der junge Tobias und der Engel sind von ihrer Reise mit dem Fisch zurückgekehrt, dessen Galle die Blindheit von Tobias‘ Vater heilen soll. Rechts erscheinen der Vater mit über der Brust gefalteten Händen und dessen Frau. Links ist der Erzengel Raphael dabei, dem Fisch die Innereien zu entnehmen, während lediglich Tobias den Blick zu dem Betrachter wendet. Der Künstler dürfte dem Kreis der Tenebrosi verbunden sein, die besonders ihren religiösen Kompositionen ausgehend von Caravaggio durch die gekonnte Lichtregie etwas Mystisches verleihen.
Giulio Cesare Procaccini (1574 Bologna – 1625 Mailand)
6011 Kopf eines Engels. Öl auf Papier, auf Leinwand kaschiert. 31 x 26 cm. Um 1616.
7.500 €
Roberto Longhi war der Erste, der die Bedeutung der Ölskizze im Werk Giulio Procaccinis herausstellte. In seinem grundlegenden Aufsatz „L‘inizio dell‘abbozzo autonomo“ (in: Paragone 195, 1966) geht er auf Procaccinis Ölstudien als eigenständige Kunstwerke ein. Bei unserer Studie eines Engelkopfes handelt es sich jedoch um eine der viel seltener vorkommenden, vorbereitenden Studien, die im Hinblick auf ein Gemälde entstanden sind. Hugh Brigstocke erkennt in dem vorliegenden Werk eine Vorstudie zu dem Kopf des links von Maria stehenden Engels im Altarbild „Madonna mit Kind und Heiligen“ in S. Afra in Brescia (mdl. gegenüber dem Vorbesitzer), das um 1616 entstanden ist. Dieser zweifellos nach einem Modell entstandene Engelskopf zeigt stilistisch deutlich den Einfluss von Correggio und Leonardo, denen Procaccini künstlerisch verpflichtet war. Der kräftige Pinselduktus im Bereich der Locken, das volle, rötliche Haar und das cherubenhafte Gesicht mit den rötlichen Wangen sind charakteristisch für Procaccini. Derartige Engelsköpfe kommen in vielen Altarbildern des Künstlers vor, etwa in der Vision der hl. Teresa in Santa Maria della Grazia in Pavia, der Mystischen Vermählung der hl. Katharina in der Pinacoteca di Brera in Mailand oder etwa in der Hl. Familie im Kunsthistorischen Museum in Wien.


Johann Rottenhammer (1564 München – 1625 Augsburg)
6012 Schule. Eva am Baum der Erkenntnis. Öl auf Kupfer. 29 x 17 cm. Um 1600.
4.500 €

Bartholomäus Spranger (1546 Antwerpen – 1611 Prag)
6013 Nachfolge. Das Urteil des Midas. Öl auf Leinwand, doubliert. 60 x 98 cm. Verso auf der Leinwand eine alte Galerienummer „F.C. 109“. Wohl 17. Jh.
1.200 €
Egbert Lievensz. van der Poel (1621 Delft – 1664 Rotterdam)
6014 Brennender Bauernhof bei Nacht. Öl auf Holz, an vier Seiten abgefast. 16,9 x 20,6 cm. Verso mit alten Etiketten „Incendie par Van Depool / petit tableau sur bois“ und „Hochzeitsgeschenk von / Clemens Frhr. von Bechtolsheim / 27. April 1908“.
1.200 €
und die darauf folgende Verwüstung der Stadt festgehalten, die bekannteste Version befindet sich in der National Gallery in London. Zahlreiche seiner Gemälde zeigen ein brennendes Dorf in der Nacht, häufig mit plündernden und marodierenden Soldaten.

Über die ersten drei Jahrzehnte des Sohnes eines Goldschmieds aus Delft ist nichts bekannt, nicht einmal der Name seines Lehrers. Das erste Dokument, das Aufschluss über sein Leben gibt, ist seine Registrierung bei der Lukasgilde in Delft am 17. Oktober 1650; dort ist er als Landschaftsmaler aufgeführt. Er lebte mit seiner Familie zum Zeitpunkt der großen Pulverexplosion am 12. Oktober 1654 in der Doelenstraat in Delft. Nach der Explosion des Pulvermagazins übersiedelte er nach Rotterdam. In mehreren Gemälden hat er den „Delfter Donnerschlag“ 6014


Süddeutsch
6015 um 1600. Die Kreuzigung, verso: Das jüngste Gericht.
Öl auf Kupfer, oben halbrund. 135 x 108 cm.
12.000 €
Provenienz: Kunsthandel Max Garber, Steyr. Dort erworben vom jetzigen Besitzer im Jahr 2000. Privatsammlung Österreich.
Das doppelseitig bemalte Gemälde ist in Öl auf Kupfer ausgeführt, einer Technik, die sich insbesondere bei Künstlern am Münchner und Prager Hof um 1600 großer Beliebtheit erfreute. Allein die phänomenale Größe der Kupfertafel erhebt das Werk schon in den Rang eines Kunstkammerstücks. Während die Kreuzigung an Bilderfindungen von Künstlern am
Hof Rudolf II. anschließt, geht die Darstellung des „Jüngsten Gerichts“ auf ein Gemälde des Hofmalers Christoph Schwarz zurück, dessen Komposition durch einen Stich Johann Sadelers außerordentlich weite Verbreitung gefunden hat. Das Original von Christoph Schwarz entstand im Auftrag der Herzogin Renata, der Gemahlin von Wilhelm V. von Bayern, die das Werk für ihre Privaträume bestimmt hatte. Die ambitionierte Komposition mit großem Figurenrepertoire und mitreissender Dynamik inspirierte zahlreiche Künstler zu eigenen Fassungen (s. Heinrich Geissler: Christoph Schwarz, Diss. Freiburg/Br. 1960, S. 223-226). Die überaus qualitätvolle Ausführung unseres Werkes sowie das subtile Kolorit mit den changierenden Farben sprechen für einen namhaften süddeutschen Künstler aus dem direkten Umfeld von Christoph Schwarz, möglicherweise sogar von seiner eigenen Hand

Samuel Hofmann
(1595 Sax, Kanton St. Gallen – 1649 Frankfurt a. Main)
6016 Die Anbetung der Könige. Öl auf Leinwand. 116 x 86 cm. Unten links signiert und datiert „S. Hoffmann pinxit 1640“, verso auf dem Keilrahmen ein altes Etikett in Feder bez. „236 / S. Hoffmann 1640 / bezeichnet“.
8.000 €
Samuel Hoffmann wurde in Sax im sanktgallischen Rheintal geboren und erhielt seine künstlerische Ausbildung - nach Angaben von Joachim von Sandrart - bei Gotthard Ringgli, einem der führenden Maler Zürichs seiner Zeit. Bereits in jungen Jahren zog es ihn in die aufstrebenden Kunstzentren Antwerpen und Amsterdam, die zu den dynamischsten Orten barocker Malerei zählten. Ein direkter Kontakt zu Peter Paul Rubens, wie gelegentlich vermutet, bleibt ungesichert. Wahrscheinlicher ist, dass Hoffmann in Amsterdam in verschiedenen Werkstätten tätig war, bevor er um 1617/18 als freier Künstler arbeitete - ohne sich allerdings der Lukasgilde anzuschließen. Werke aus dieser frühen Schaffensphase sind nicht überliefert.
In den 1620er Jahren fand Hoffmann in Zürich als Porträtmaler große Anerkennung. Seine Bildnisse bestechen durch fein nuancierte Farbgebung, gezielte Lichtsetzung und eine bemerkenswerte psychologische Präsenz. Besonders im reformierten Milieu, wo religiöse Kunst kaum gefragt war, stießen seine weltlichen Darstellungen auf breite Zustimmung. Sein Kundenkreis umfasste nicht nur das gebildete Zürcher Bürgertum, sondern auch Adlige und katholische Auftraggeber - darunter etwa die Franziskanermönche im aargauischen Baden, für die er das Gemälde Der Zinsgroschen schuf (heute im Kunsthaus Zürich).
Neben seinen Porträts widmete sich Hoffmann auch dem Stillleben –insbesondere großformatigen Küchenstücken, die als wegweisend für die Entwicklung dieser Gattung in der Schweiz gelten. In diesen Arbeiten verschmelzen niederländischer Einfluss, barocke Fülle und die sachliche Klarheit protestantischer Bildauffassung zu einer ausdrucksstarken Einheit, die Hoffmann mit technischer Präzision umzusetzen wusste.

6017
Sein Wirkungskreis ging weit über Zürich hinaus: Aufträge führten ihn nach Breisach, Mailand und Baden-Baden. Zwischen 1640-41 erhielt er von Pietro Dolce, dem venezianischen Gesandten in Zürich, Aufträge – in diese Zeit datiert auch vorliegendes Werk. Ab 1643 war er in Basel tätig und pflegte enge Beziehungen zu den Markgrafen von Baden. 1644 ließ er sich in Frankfurt am Main nieder, wo er 1649 verstarb. Hoffmann gilt als herausragender Porträtist der deutschsprachigen Schweiz des 17. Jahrhunderts. Durch seine Prägung in Amsterdam wurde er zu einem bedeutenden Vermittler zwischen der niederländischen und der süddeutschen Malerei. Besonders in seinen sorgfältig aufgebauten Stillleben – inspiriert von Künstlern wie Frans Snyders – zeigt sich seine stilistische Nähe zur flämischen Kunst. Mit seinen Küchen- und Jagdszenen, die in der Schweizer Kunstlandschaft damals neuartig waren, verband er meisterhaft seine beiden zentralen Themenbereiche: das Porträt und das Stillleben. Für seine wenigen Historienbilder dienten Rubens und Jacob Jordaens als stilistische Bezugspunkte.
Italienisch
6017 17. Jh. Das Haupt Christi. Öl auf loser Leinwand. 42,2 x 31,5 cm.
1.800 €

Johann Heinrich Schönfeld (1609 Biberach – 1682/83 Augsburg)
6018 Diana und Aktäon. Öl auf Leinwand, doubliert. 59 x 82 cm. Unten links signiert „JH [ligiert] Schönfeld Fecit“. Um 1662/63.
15.000 €
Literatur: Hermann Voss: Johann Heinrich Schönfeld, ein schwäbischer Maler des 17. Jahrhunderts, Biberach 1964, S. 33 (als „Schönfeld“).
Bruno Bushart: „Die Johann Heinrich Schönfeld-Ausstellung in Ulm“, in: Kunstchronik 20, 1967, S. 372 (ohne Angabe von Gründen abgeschrieben).
Herbert Pée: Johann Heinrich Schönfeld. Die Gemälde, Berlin 1971, S. 161, Nr. 97, Abb. 110 (von „Schönfeld, vielleicht unter Mitwirkung eines Gehilfen um 1662/63“).
Ausstellung: Ausst. Kat. Johann Heinrich Schönfeld - Bilder Zeichnungen, Graphik, Museum der Stadt Ulm 1967, Nr. 71.
Provenienz: Privatsammlung München (bis 1957). Sammlung Luitpold Dussler, München. Privatsammlung Süddeutschland.
Das Gemälde schließt an die von Schönfeld zu Beginn der 1660er Jahre gemalten „arkadischen Szenen“ an, wobei vorliegende Arbeit in der weichen, tonalen Wirkung noch über sie hinausgeht (vgl. Herbert Pée in: Ausst. Kat. Johann Heinrich Schönfeld, Ulm 1967, Nrn. 68-70 mit Abb. 70-72). Bei den Frauengestalten orientiert sich der Künstler eher an seinen eigenen, in den Gemälden der italienischen Zeit entwickelten Typus. Eine zweite, nahezu identische Fassung mit geringen Abweichungen in der Foliage wurde in unserem Hause versteigert (Bassenge Berlin, Auktion 84: Kunst in Augsburg von 1500-1800, 3. Dezember 2004, Los 5627).

Niederländisch
6019 17. Jh. Circe verwandelt die Gefährten des Odysseus in Tiere.
Öl auf Leinwand, doubliert. 66,5 x 70 cm. Unten rechts monogrammiert „MC“.
2.500 €

6020 um 1730/40. Ideale Rheinlandschaft im Abendrot. Öl auf Leinwand, doubliert. 96,5 x 122 cm.
1.500 €
Niederländisch
6021 1653. Die Bekehrung des hl. Hubertus im Wald. Öl auf Holz. 59 x 74,5 cm. Verso oben links in der Ecke monogrammiert und datiert „S.N. 1653“ (unter UVLicht sichtbar).
7.500 €
Der Legende nach begegnete der heilige Hubertus während der Jagd einem prächtigen Hirsch. Als er versuchte, das Tier zu töten, erschien ein Kreuz zwischen dessen Geweih. In diesem Moment bekehrte er sich

zum christlichen Glauben. Diese Geschichte ist identisch mit der Bekehrungslegende des heiligen Eustachius; ein Verweis auf diesen ist die römische Uniform, denn Eustachius war unter Kaiser Trajan Heermeister einer römischen Legion gewesen. Eustachius war ursprünglich der ältere Jagdheilige, doch ab dem 15. Jahrhundert wurde die Hirschlegende zunehmend Hubertus zugeschrieben, der heute als bekannterer Schutzpatron der Jäger gilt.
Der heilige Hubertus lebte in Lüttich in den Niederlanden, und seine Bekehrung wurde besonders häufig von flämischen Malern dargestellt - oft als Vorwand für die Ausarbeitung einer prachtvollen Landschaft,
wie sie beispielsweise auch von Jan Bruegel d. Ä. oder Roelant Savery zu dieser Thematik überliefert ist.
Der ruhige Moment der Offenbarung kontrastiert mit der typischen Dynamik der Jagdmalerei und betont die spirituelle Dimension der Szene. Die Hunde verweisen auch auf Hubertus’ Rolle als Schutzpatron der Jäger und Hunde. Die sehr qualitätvolle und realistische Darstellung der Tiere könnte auf einen Maler mit zoologischem Interesse hindeuten. Auch der Hund im Vordergrund rechts ist keinesfalls zu groß geraten - es handelt sich hierbei um einen sogenannten Bärenhund, der in der Tat eine beträchtliche Körpergröße aufweist.

Niederländisch
6022 17. Jh. Kerkerszene: Mann hinter einem Gitterfenster.
Öl auf Leinwand (lose, ohne Keilrahmen). 20,5 x 31,5 cm.
1.200 €
Philippe de Champaigne (1602 Brüssel – 1674 Paris)
6023 Umkreis. Moses mit den Gesetzestafeln. Öl auf Leinwand, doubliert. 95 x 78 cm. Um 1648.
5.000 €


Gabriel Metsu
(1629 Leiden – vor 1667 Amsterdam)
6024 Schule. Junge Frau mit Wasserkrug.
Öl auf Holz. 21,5 x 19,8 cm. Verso mit einem roten Lacksiegel mit dem Initial „H“.
1.500 €
Niederländisch
6025 um 1630. Fröhliche Gesellschaft im Freien.
Öl auf Holz. 15,5 x 31,1 cm.
1.200 €
Niederländisch
6026 17. Jh. Winterliches Eisvergnügen vor einem Stadttor.
Öl auf Holz. 33 x 41,5 cm. Unten rechts von fremder Hand bezeichnet „K. Molenaer“, verso montiert ein handschriftliches Gutachten von Heinrich Zimmermann, Berlin, vom 1. Februar 1950.
1.200 €


Hendrik de Fromantiou (1633 Maastricht – 1694 Potsdam)
6027 Jagdstillleben mit Rebhuhn und Singvögeln. Öl auf Leinwand, alt doubliert. 51,5 x 44,5 cm. Verso auf der Leinwand in einer Schrift des 20. Jh. bez. „Weeninx“, mit geprägter Inschrift im Holz des Spannrahmens „F Leeatham Liner“.
12.000 €
In einer gemalten steinernen Wandnische erblickt man mehrere Vögel, die bei der Jagd erlegt wurden, darunter drei kleinere Singvögel und ein Rebhuhn, das mit einem Fuß an einer Schnur aufgehängt ist. Die Flügel des Rebhuhns sind zur Seite ausgebreitet und geben den Blick auf das raffiniert gemalte Gefieder frei, das die Kunstfertigkeit des Künstlers in der Wiedergabe unterschiedlicher Stofflichkeiten erkennen lässt. An der Rückwand der Nische hängen Jagdflöten, wie sie üblicherweise für die Vogeljagd verwendet wurden. Der in Maastricht geborene Maler Hendrik de Fromantiou gehörte zu den bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten, die am Hofe des Großen Kurfürsten tätig waren. Seit 1670 als Stilllebenmaler in Berlin tätig, arbeitete er für den Kurfürsten zudem als Kunstagent, Sachverständiger, Restaurator und hatte seit 1687 die Aufsicht über die kurfürstliche Gemäldesammlung. Als Stilllebenmaler schuf er für den Kurfürsten vor allem Tierdarstellungen und Stillleben mit Früchten und Blumen. Ein vergleichbares Jagdstillleben des Künstlers mit den gleichen Requisiten und der gleichen Raumdisposition befindet sich in der Gemäldesammlung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.




Pieter Wouwermann (1623 Haarlem – 1682 Amsterdam)
6028 Pferdemarkt vor einem Dorf. Öl auf Holz. 37,1 x 55,9 cm. Unten rechts auf dem Baumstamm monogrammiert „W.“, unten links ein kleines Nummernetikett alt bez. „4.“. 3.000 €
Provenienz: Privatsammlung Wien. Im Kinsky, Wien, Auktion am 21. April 2010, Los 50. Privatsammlung Norddeutschland. Das Gemälde ist unter der Nummer 213862 registriert in der Datenbank des RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Für eine Variante des Motivs vgl. Walther Bernt: Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts, Bd. 3, München 1948, Nr. 1024.
August Querfurt (1697 Wolfenbüttel – 1761 Wien)
6029 Soldatenlager mit Marketenderin. Öl auf Leinwand, doubliert. 42 x 55 cm. Um 1700.
1.500 €
Provenienz: Privatsammlung Augsburg. Bassenge, Berlin, Auktion 99 am 31. Mai 2012, Los 6070. Privatsammlung Norddeutschland.
Die Zuschreibung an August Querfurt stammt von Dr. Gode Krämer, Augsburg (mdl. gegenüber dem Vorbesitzer).


August Querfurt
6030 Die Einkehr zweier Jäger. Öl auf Leinwand, randdoubliert. 44,5 x 34 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „A.Q. 1756“.
4.000 €
Provenienz: Dorotheum, Wien, Auktion am 24. April 2007, Los 225. Privatsammlung Wien.
Dorotheum, Wien, Auktion am 11. Juni 2013, Los 153. Privatsammlung Norddeutschland.
Abbildung Seite 39
Österreichisch
6031 um 1760. Johannes der Täufer vor Gottvater umgeben von Engeln.
Öl auf Leinwand, doubliert. 57,5 x 34,3 cm.
3.000 €
Italienisch
6032 18. Jh. Südliche Küstenszene mit Kastell. Öl auf Leinwand, doubliert. 71,5 x 85 cm. Unten auf dem Abhang unter dem sitzenden Hirten monogrammiert „F. A. fec.“.
1.800 €


Venezianisch
6033 um 1740. Szene aus der Commedia dell‘Arte; Szene aus dem venezianischen Karneval mit zwei maskierten Figuren.
2 Gouachen wohl auf Pergament. Je ca. 4,5 x 7 cm. In Goldrähmchen. (Unausgerahmt beschrieben).
750 €
Giuseppe Bernardino Bison (1762 Palmanova – 1844 Mailand)
6034 Blick von der Piazzetta auf den Canal Grande und Santa Maria della Salute. Öl auf Leinwand, doubliert. 27 x 44 cm.
8.000 €
Provenienz: Galerie Scheidwimmer, München 1972. Privatsammlung München. Privatsammlung Berlin.
Bassenge, Berlin, Auktion 108 am 27. November 2016, Los 6067. Privatsammlung Norddeutschland.
Der im Friaul geborene Maler und Zeichner Giuseppe Bernardino Bison begibt sich nach anfänglichen Studien in Brescia als 15-jähriger im Jahr 1777 nach Venedig, wo er die Bekanntschaft von Antonio Maria Zanetti macht. Ab 1779 studiert er an der Accademia Malerei und Dekoration bei Constantino Cedini und Perspektive bei Antonio Mauro. Von wesentlicher Bedeutung für Bisons Entwicklung ist die Freundschaft zum Architekten des Teatro La Fenice in Venedig, Giovanni Antonio Selva (1751-1819), der ihm zu vielen Aufträgen als Bühnenbildner verhilft.
Neben dem La Fenice ist Bison auch für die Theater von Treviso, für das Teatro Nuovo in Triest (Bühnenbilder zum „Don Giovanni“) und das Teatro Nuovo in Gorizia tätig. Bison arbeitet sein Leben lang in ganz unterschiedlichen künstlerischen Techniken. In seinem umfangreichen Gesamtwerk finden sich Fresken u.a. in der Villa Piva in Breda di Piave, im Palazzo Manzoni in Padua und in verschiedenen Palazzi in Treviso. Er hinterläßt eine große Zahl an Staffeleibildern, aber auch Lithographien und eine bedeutende Zahl an Zeichnungen. Zahlreich sind auch die Palazzi im Veneto, die er ausstattet. 1831 siedelt Bison nach Mailand über. In vielen Ausstellungen an der Accademia di Brera zeigt er zwischen 1833 und 1842 seine meist kleinformatigen Veduten. Bison stirbt am 24. August 1844 in ärmlichen Verhältnissen. Die Zeitenwende zum Ende des 18. Jahrhunderts spiegelt sich auch in Bisons Werk wider: Er ist sowohl einer der letzten bedeutenden Vertreter des venezianischen Rokoko und dessen klassischer Vedutenmalerei als auch Neoklassizist und mit seinen in Tempera gemalten, an Marco Ricci orientierten phantastischen Veduten, Vorreiter des Romantizismus.
6035 Die Piazza San Marco. Öl auf Leinwand, doubliert. 27 x 44 cm.
8.000 €
Provenienz: Galerie Scheidwimmer, München 1972. Privatsammlung München. Privatsammlung Berlin. Bassenge, Berlin, Auktion 108 am 27. November 2016, Los 6066. Privatsammlung Norddeutschland.



Hendrik van Minderhout (1632–1696, Rotterdam)
6036 Orientalischer Seehafen. Öl auf Leinwand, doubliert. 67,5 x 79 cm.
6.000 €
Provenienz: Österreichischer Adelsbesitz.
Im Kinsky, Wien, Auktion am 24. Juni 2014, Los 416 (lt. Angabe im Katalog hat Marijke C. de Kinkelder vom Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, das Gemälde als ein Werk Hendrik van Minderhouts identifiziert).
Norddeutsche Privatsammlung.
Das Werk ist unter der Nummer 540941 in der Datenbank des RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis verzeichnet (https://rkd. nl/imageslite/540941).

Johann Kupetzky (1667 Bazin/Bösing (?) – 1740 Nürnberg)
6037 Bildnis eines adeligen Herrn mit Allongeperücke vor einer Draperie.
Öl auf Papier, auf Holz kaschiert. 34,5 x 28 cm. Verso in Schwarz signiert und datiert „J Kupetzky 1726“ (letzte Ziffer undeutlich).
1.800 €



Österreichisch
6038 um 1730. Kaiser Karl VI. von Österreich und seine Gemahlin Elisabeth Christine von Österreich. Pendants, je Öl auf Karton, Originalrahmen. Je ca 8,1 x 5,2 cm.
1.200 €
Literatur: Jörg Nimmergut und Anna-Maria Wager: Miniaturen - Dosen, München 1982, S. 211 mit Farbabbildung F41.
Karl, Erzherzog von Österreich, König von Spanien 1703-1714, römisch deutscher Kaiser 1711, wurde am 1. Oktober 1685 in Wien geboren. Seine Eltern waren Kaiser Leopold I. und Eleonore Magdalene, Tochter des Kurfürsten Philipp Wilhelm von der Pfalz-Neuburg. Am 1. August 1708 Hochzeit mit Elisabeth Christine, der Tochter des Herzogs Ludwig Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel. Der Ehe entstammten vier Kinder: Leopold, Maria Theresia (spätere Kaiserin von Österreich), Maria Anna und Maria Amalie.

Englisch
6039 um 1710. Bildnis wohl Georg I, König von England, im blauen Rock, weißer Halsbinde und rostrotem Mantel, mit Allongeperücke. Öl auf Kupfer. 7,2 x 5,6 cm (im Oval). Im Silberrahmen mit Spiralaufsatz.
800 €
Provenienz: Cabinet Eric Turquin, Paris.
Nicolas Lancret (1690–1745, Paris)
6040 Umkreis. Galante Festgesellschaft im Park. Öl auf Leinwand, doubliert. 50 x 65 cm. Verso auf dem Keilrahmen ein Lacksiegel mit einem wohl polnischen Topór-Wappen.
4.000 €


Antoine Pesne (1683 Paris – 1757 Berlin)
6041 Knabe mit Samtbarett, einen Singvogel haltend. Öl auf Leinwand, doubliert. 80 x 64 cm.
12.000 €
Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung.
Bei dem Werk handelt es sich um ein genrehaftes Gemälde wohl aus der Frühzeit des Künstlers vor seiner italienischen Zeit (vor 1710). Der Knabe trägt ein rotes Samtbarett, an dem eine Feder befestigt ist: ein Zeichen des Genies. Er hebt zum Sprechen an und wie die erhobene Hand signalisiert, erbittet der Knabe die Aufmerksamkeit des Betrachters. Das Werk gehört zu einer Gruppe meist früher Genrebilder mit nur einer Figur. Besonders vergleichbar ist das 1706 datierte Gemälde in Schloss Sanssouci „Bauernmädchen im Fenster“, bei dem ein sehr ähnlicher Vogelbauer oben rechts aufgehängt ist. Das weiße Hemd des Mädchens zeigt die gleiche lockere Modellierung. Ebenfalls eng verwandt sind zwei signierte und 1712 datierte Pendants in Schloss Mosigkau bei Dessau „Mädchen mit Blumen und Früchten“ und „Klarinettenbläser“. In einem Gutachten vom 31. Mai 2009 bestätigt Prof. Helmut Börsch-Supan die Autorschaft Antoine Pesnes (Gutachten in Kopie vorhanden).
Italienisch
6042 18. Jh. Kleiner Tamburinspieler mit tanzendem Hund.
Öl auf Leinwand, doubliert. 39,5 x 31,5 cm. Verso auf dem Keilrahmen mit altem Klebeetikett mit gestochener Schrift „Mr. Rohde“ (wohl Besitzervermerk).
900 €

6043 Gemüsestillleben mit Weißkohl, Kürbis, Wurzelund Rübengemüse, Stangenbohnen und einem Fink. Öl auf Leinwand. 55 x 74 cm.
3.500 €

6044 Küchenstillleben mit Lammkeule, Heringen, Knoblauch, Kohlkopf und einem Keramikkrug mit einem Teller Butter.
Öl auf Leinwand. 56 x 73 cm.
3.500 €
Der Thüringer Jacob Samuel Beck war der bedeutendste Erfurter Maler seiner Zeit. Im erstaunlich vielseitigen Gesamtwerk dieses biographisch schwer fassbaren Künstlers finden sich alle Gattungen vertreten: neben seiner Tätigkeit als gefragter Portraitist sowie Historien- und Landschafts-
maler, stechen zweifellos seine Stillleben in ganz besonderer Weise hervor. All seinen Stillleben gemein ist die Inszenierung in einer Hell-DunkelMalerei, bei der sich Beck an niederländischen Vorbildern des 17. Jahrhunderts orientiert. Der Hintergrund verbleibt stets im Dunkeln, die drapierten Gegenstände kommen so effekvoll zur Geltung. Bei unserem Gemälde handelt es sich um die Variante eines in Privatbesitz befindlichen Stilllebens; das Arrangement ist überwiegend identisch, lediglich die Zwiebeln wurden in unserer Version gegen kleine Knoblauchknollen getauscht (vgl. Ausst. Kat. Jacob Samuel Beck (1715-1778). Zum 300. Geburtstag des Erfurter Malers, hrsg. von Thomas von Taschitzki, Kai Uwe Schierz, Erfurt 2016, S. 244, Nr. 47, mit Abb. S. 199).

Vincenzo Pacé (tätig um 1780)
6045 Mediterraner Hafen mit Händlern am Quai. Öl auf Karton. Durchmesser 6,6 cm. Auf der hellen Kiste im Vordergrund signiert „V. Pace“.
800 €
Provenienz: Galerie Cailleux, Paris 1967.
Johann Ernst Heinsius (1731 Ilmenau – 1794 Erfurt)
6046 Bildnis des Geheimen Rates und Bibliothekars der Herzogin-Anna Amalia-Bibliothek in Weimar Johann Poppo von Greiner. Öl auf Leinwand, doubliert. 92 x 72,5 cm. Um 1772.
7.500 €
Johann Poppo von Greiners (1708-1772) Hauptverdienst besteht darin, dass er sich als Bibliothekar der rund 11.000 Bände umfassenden Büchersammlung des von 1683-1724 regierenden Herzogs Wilhelm Ernst von Sachsen Weimar, die im sogenannten Grünen Schloss lagerte, angenommen hat und den Umbau dieses Hauses zur Herzogin-Anna-AmaliaBibliothek angeregt hat. Der Umbau nach Plänen von August Friedrich Straßburger erfolgte 1761-1766. Poppo von Greiner gewann durch seine Klugheit und charakterlichen Eigenschaften das Vertrauen Anna Amalias, die 1758 bereits als 19-jährige die Regierungsgeschäfte des Landes übernehmen musste und erst 1775 an ihren Sohn Karl August abgeben konnte. Als „väterlicher Freund“ geschätzt, wurde Poppo von Greiner 1763 in den Adelsstand erhoben.
Johann Ernst Heinsius erhielt im Jahr 1772 die Stelle als Hofmaler in Weimar. Es ist das Jahr, in dem auch Poppo von Greiner starb. Die lebensvolle Darstellung des Portraitierten lässt darauf schließen, dass es sich nicht um ein posthumes Bildnis handelt, sondern um ein Portrait des Bibliothekars kurz vor dessen Tod. Zwei weitere Fassungen dieses Gemäldes, die ebenfalls unsigniert und undatiert sind, befinden sich in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek und im Wittumspalais in Weimar. Bei unserem Werk handelt es sich nach Einschätzung von Prof. Helmut Börsch-Supan um eine dritte eigenhändige Fassung. Ein schriftliches Gutachten von Prof. Helmut Börsch-Supan liegt in Kopie vor.


Anton Radl
(1774 Wien – 1852 Frankfurt a. M.)
6047 Felslandschaft mit Wasserfall und Einsiedler bei einer Grotte.
Öl auf Leinwand. 97 x 133 cm.
4.500 €
Provenienz: Privatsammlung Hessen.
Obwohl Anton Radl zunächst als Zeichner und Radierer bei Johann Gottlieb Prestel in die Lehre gegangen war, wurde er nach 1800 vor allem als Landschaftsmaler bekannt. Er widmete sich in seinen an der Malerei der niederländischen Meister orientierten Landschaften gerne Gegenden aus der Umgebung von Frankfurt oder dem Taunus, griff aber zuweilen auch auf Landschaftseindrücke zurück, die er auf seinen Studienreisen nach Norddeutschland, in den Schwarzwald, die Schweiz und entlang der Donau besucht hatte. Das vorliegende Gemälde wiederholt ein Motiv seines bekannten Bildes im Historischen Museum Frankfurt aus dem Jahre 1812, das schon auf der großen Ausstellung 1827 prominent präsentiert wurde (vgl. Ausst. Kat. Anton Radl, Historisches Museum Frankfurt a.M. 2008, S. 64, Nr. 12). Wir danken Dr. Anke FröhlichSchauseil für wertvolle Hinweise.


Wilhelm Carl F. Trautschold (auch William, 1815 Berlin – 1877 München)
6048 Selbstbildnis des Künstlers. Öl auf Leinwand. 33 x 25 cm. Oben rechts signiert und datiert „W. Tr. p. Giessen 1845 [?]“, verso auf einem alten Klebeetikett bez. „No. 33 / Trautschold, W. / Selbstbildnis“. 900 €
Der in Berlin gebürtige Wilhelm Trautschold lernte zunächst in seiner Geburtsstadt und dann in Düsseldorf, wo er zwischen 1833 und 1835 bei Karl Ferdinand Sohn und Wilhelm Schadow unterrichtet wurde. 1843 ging er nach Gießen und trat eine Anstellung als Zeichenlehrer an der dortigen Universität an. Nach Aufenthalten in London und Liverpool, wo er seine Familie gründete, reiste er durch Italien und war vor allem als Portraitist erfolgreich. Aus gesundheitlichen Gründen unternahm er 1877 eine letzte Reise nach Deutschland, wo er in München verstarb.
Heinrich Rieter (1751 Winterthur – 1818 Bern)
6049 Alpenlandschaft mit Hirten an einer Tränke. Öl auf Holz. 28 x 23,5 cm. Verso mit altem Klebeetikett, dieses in einer Hand des 19. Jh. in brauner Feder bez. „Gemalt von Heinrich Rieter geb. 1751 in Winterthur, gestorben in Bern 1818 nach einem Entwurf von L. Aberli... Neujahrsstück der Künstlergesellschaft in Zürich No. XIII von 1817. pag. 11 ... H. Rieter... Neujahrstück No. XV von 1819“, sowie einem weiteren Klebeetikett mit den Initialen „MR.“.
9.000 €
Trotz seiner Ausbildung zum Bildnismaler bei Johann Ulrich Schellenberg in Winterthur und Anton Graff in Dresden, entschloss sich Heinrich Rieter, bestärkt durch Salomon Gessner, Landschaftsmaler zu werden.

Seit 1777 war er Gehilfe und Mitarbeiter von Johann Ludwig Aberli in Bern und übernahm nach dem Tod seines Lehrers dessen druckgraphische Werkstatt. Rieter war einer der führenden Berner Meister in dessen Nachfolge. Das vorliegende Gemälde entstand nach einer Invention von Ludwig Aberli, zu deren vollständigen Ausführung es jedoch nicht mehr kam, da Aberli über den Arbeiten verstarb. Aberli hatte aber Heinrich
Rieter vorher instruiert, wie das Werk zu vollenden sei. 1817 verfasste Rieter im „Neujahrsstück herausgegeben von der Künstler-Gesellschaft in Zürich“ eine Abhandlung über Aberli, die auch eine Radierung nach dieser letzten Komposition von Aberli enthielt und somit auch das vorliegende Werk dokumentiert.

Johan Laurentz Jensen (1800–1856, Gentofte b. Kopenhagen)
6050 zugeschrieben. Früchtestillleben mit Pfirsich und Trauben.
Öl auf Papier, auf Pappe kaschiert. 18,2 x 24,6 cm. Unten rechts datiert „Dec. [18]50“, verso auf dem Rahmen eine alte kaum leserliche Bezeichnung (Widmung?) in dänischer Sprache, datiert „22 Dez 1850“.
900 €
Friedrich Johann Gottlieb Lieder (gen. Franz, 1780 Potsdam – 1859 Budapest)
6051 Bildnis der Johanna Schubert als Hebe. Öl auf Leinwand, doubliert. 42 x 34 cm. Links im Hintergrund signiert und datiert „F. Lieder p: 1819“, verso auf dem Keilrahmen ein Klebeetikett mit Angaben in brauner Feder zur Dargestellten „Johanna Schubert, geb. Schmidt, Mutter Victor‘s, geboren 1806, gestorben 1836. Gattin Eduards v. Schubert“.
4.500 €
Bereits im Alter von nur siebzehn Jahren stellte Friedrich Lieder erstmals zwei Zeichnungen auf der Berliner Akademieausstellung von 1797 aus und erregte damit einige Aufmerksamkeit. Im Jahre 1802 machte er erneut durch ein Bildnis Napoleons von sich reden und wechselte im Jahre 1804 zum Studium von Berlin an die École des Beaux-Arts in Paris, wo er Schüler von Jacques-Louis David wurde. Schnell etablierte sich der geschickte Portraitist in der Pariser Gesellschaft und heiratete die Tochter des Chevalier d‘Ellevaux de Limon. Auch international wurden seine Fähigkeiten als Bildnismaler erkannt, und so erhielt er unter anderem zahlreiche Aufträge des ungarischen Adels und reiste dafür nach Budapest und Preßburg. Ab dem Jahre 1812 arbeitete er zunächst in Wien, wo er, stark von Isabey beeinflusst, auf dem Wiener Kongress mit großem Erfolg als Bildnismaler und Miniaturist tätig war. Dort fiel er unter anderem Fürst Metternich auf, der ihn fortan förderte. Zwischen 1816-19 hielt er sich auf Einladung Wilhelms III. in Berlin auf und wurde zum Hofmaler ernannt. Seine große internationale Bekanntheit sorgte dafür, dass er auch später viele Reisen unternahm, sich aber meist in Wien oder Budapest aufhielt, wo seine Portraits und Bildnisminiaturen vor allem von den Mitgliedern des Hochadels geschätzt wurden. - Das Bildnis zeigt die junge Johanna Schubert (geb. Schmidt, 1806-1836) als Hebe, Tochter von Zeus und Hera und Mundschenkin der Götter, in einem weißen Empirekleid mit blassviolettem Schal. Die kühle Farbigkeit unterstreicht den porzellanhaften Teint der Dargestellten, deren sorgfältig arrangierte Locken leicht über das Decolleté fallen. Lieders demonstriert mit diesem Werk nicht nur sein Können als hervorragender Bildnismaler, sondern auch als besonders feinsinniger Kolorist.



Jean Victor Bertin (1767–1842, Paris)
6052 Mutter und Kind in einem Brunnenhof. Öl auf Leinwand, doubliert. 74,1 x 60,4 cm.
8.000 €
Ausstellung: Landscape and Antiquity - An Exhibition of Nineteenth Century Landscapes of Italy, Greece and Southern France, The Clarendon Gallery, London, 1987, Kat. Nr. 10 (Abb.). Provenienz: Sammlung Colin McMordie, London, Paris, vor 1987. Privatsammlung Deutschland.
Der Sohn eines Perückenmachers studiert ab 1785 in Paris an der Académie royale de peinture et de sculpture zunächst Historienmalerei bei Gabriel François Doyen. Um 1788 entdeckt er sein Interesse für die Landschaft und tritt in das Atelier des neoklassizistischen Malers Pierre-Henri de Valenciennes ein. Valenciennes schuf eine neue Bildgattung, die paysage historique, die die Landschaftsmalerei mit einer idealisierten, heroischen Sicht auf die Geschichte verband, um das Ansehen dieses geringgeschätzten Genres zu stärken. Kennzeichen dieses Neoklassizismus sind die strenge Kompositionen und die glatte Pinselführung. Zwischen 1800 und 1805 bevorzugt Bertin in seinen französischen Landschaften grüne und blaue Töne, die er glatt und porzellanhaft aufträgt. Die Staffage gibt er mit einfachen, sicheren und leicht eckigen Pinselstrichen wieder. Vorliegendes Werk ist ein schönes Beispiel dieser Zeit. Harmonisch und
geschickt malt er die Vegetation, die sich um das alte Gemäuer rankt. Die Mutter, die mit dem Kind liest, sowie der Leben spendende Brunnen sind Zeichen der Hoffnung, die Ruine steht für die Vergänglichkeit. Nach einer zweijährigen Italienreise ab 1806 wird Bertin, neben dem Claude Lorrain und Nicolas Poussin verpflichtetem Klassizismus, den er lebenslang verfolgt, auch ein früher Verfechter des Skizzierens im Freien und damit das Bindeglied zur Pleinairmalerei. Er fördert diese Praxis bei seinen zahlreichen Schülern, zu denen u.a. Boisselier, Cogniet, Corot oder Daubigny zählen.
6053 1825. Reisendes Paar auf einem Wanderweg bei einem Gehöft, im Hintergrund Blick auf Lucca mit dem Ponte San Quirico.
Öl auf Leinwand. 27,8 x 36,7 cm. Unten links undeutlich bez. (oder signiert?) und datiert „... 1825“, sowie verso auf dem Keilrahmen in brauner Feder betitelt „Tenuta nelle vicinanze di Lucca“.
3.000 €

Peter Jakob Büttgen (aktiv zwischen 1820–1846)
6054 Blick vom Ufer des Bodensees auf die Insel Mainau und das Schloss.
Öl auf Leinwand. 41 x 53,8 cm. Signiert und datiert „1831“.
4.000 €
Provenienz: Aus den Sammlungen des Markgrafen Wilhelm von Baden, sowie der Prinzessin Elisabeth (verso mit deren Sammlungsetiketten).
Théodore Gudin

(1802 Paris – 1880 Boulogne-sur-Seine)
6055 Die Tochter des Künstlers Elisabeth (gen. Bessy), spätere Baroness Meyendorff, mit ihrem Hund „Bijé“ am Strand.
Öl auf Holz, auf Holztafel kaschiert. 45,5 x 35,5 cm. Unten rechts signiert und datiert „T. Gudin / avril 1848“, sowie links unten bezeichnet „ma Bessy. / a 10 mois et son Bijé“.
2.400 €
Einfühlsames und liebevoll aufgefasstes Portrait der Tochter des Künstlers. Die zärtliche Aufschrift weist das Gemälde als ganz persönliches Familienzeugnis aus: Gudin zeigt seine kleine Tochter am Strand, wo sie
mit Muscheln und Seetang spielt, die sie wie kostbare Kleinode in ihren Händen hält und vor sich aufgereiht hat. Neben ihr liegt der kleine Hund, den er liebevoll als ihren „Bijé“ bezeichnet. Der ungewöhnliche Name könnte eine umgangssprachliche oder kindliche Wortschöpfung in Anlehnung an das französische Wort Bijoux sein und den Hund als „ihren Schatz, ihr Schmuckstück“ bezeichnen - ein auch schon im 19. Jahrhundert gebräuchlicher Name für kleinere Hunde. Das Wort entfaltet hier aber auch eine doppelte Bedeutung, die sowohl auf das Haustier als auch auf die bunten „Schmuckstücke“ in den Händen der Tochter verweist. So verbindet sich die innige Beobachtung des Kindes mit einem humorvollen Wortspiel, das die heitere, intime Stimmung der Darstellung weiter verstärkt.
Franz Xaver von Lampi (1782 Klagenfurt – 1852 Warschau)
6056 Bildnis der Karolina Beata Hauke, geb. Steinkeller, im blauen Samtmantel mit Nerzbesatz. Öl auf Leinwand, doubliert. 83 x 66,5 cm. Unten links signiert „Lampi.“.
16.000 €
Beinahe wirkt es so als sei die gedämpfte, fast monochrome Farbigkeit des Bildes auf die schön geschnittenen, grauen Augen der Dargestellten abgestimmt. Sie blickt uns aus einem Gesicht mit feinen Zügen entgegen, gerahmt von einer wunderbar duftig gemalten Haube aus durchscheinender Spitze - einem Markenzeichen des Malers Franz von Lampi, wie der Vergleich mit Damenbildnissen im Wiener Belvedere (Inv. 6218) und in den Nationalmuseen von Warschau (Inv. MP 2982 MNW) und Breslau (Inv. MNWr VIII-3245) zeigt. Bei der Porträtierten handelt es sich um Karolina Beata Jozefa HaukeBosak, geborene Steinkeller (1803 Warschau - 1874 Palermo), deren Namen vor allem wegen ihres Sohnes Józef Hauke-Bosak bekannt ist, der ein Anführer des polnischen Aufstands von 1863 war. Karolina war die Tochter eines deutsch-polnischen Industriellen. Sie heiratete 1827 in zweiter Ehe Oberst Jozef Hauke von Bosak, der kurz zuvor von Nikolaus I. in den Adelsstand erhoben worden war. Der Zar beförderte ihn dann 1829 zum aide-de-camp, weshalb die Familie nach St. Petersburg umsiedelte. Womöglich gab Karolina vorliegendes Bildnis kurz vor ihrer Abreise in Auftrag, vielleicht als Abschiedsgeschenk für ihre polnische Verwandtschaft. Auf jeden Fall sprechen ihr Kleid und die Haartracht für eine Entstehung in den 1820er Jahren. Zu dieser Zeit war Franz Xaver von Lampi, der seit 1815 mit kürzeren und längeren Unterbrechungen in Warschau lebte, einer der gefragtesten Bildnismaler im polnischen Königreich. Er war der jüngste Sohn des berühmten österreichischen Porträtisten Johann Baptist d. Ä., der ihm das Talent in die Wiege gelegt hatte.

Barend Cornelis Koekkoek (1803 Middelburg – 1862 Kleve)
6057 Große Winterlandschaft mit Eseltreiber im Sonnenlicht (Große Winterlandschaft mit Staffage). Öl auf Leinwand, doubliert. 82,5 x 105 cm. Unten links auf dem Felsen signiert und datiert: „B. C. Koekkoek / 1834“. 75.000 €
Literatur: Friedrich Gorissen: B. C. Koekkoek. 1803-1862. Werkverzeichnis der Gemälde, Düsseldorf 1962, Nr. 34/84 mit Abb. Provenienz: Kunsthandel Douwes, Amsterdam. Lempertz, Köln, Auktion am 26. Oktober 1926, Los 109. Lempertz, Köln, Auktion am 9.-10. Mai 1983, Los 328. Privatbesitz, Hessen.
1834 ließ sich Barend Cornelis Koekkoek, der „Prinz der Landschaftsmaler“, gemeinsam mit seiner Frau, der Malerin Elise Thérèse Daiwallie, für den Rest seines Lebens in Kleve nieder. 1841 gründete er dort eine Zeichenschule und war stilprägend für die sogenannte Klever Romantik im Rheinland und den benachbarten Niederlanden. Über sein Heimatland sagte er einmal: „Unser Vaterland hat keine Felsen, Wasserfälle, hohe Berge oder romantische Täler zu bieten. Stolze, erhabene Natur ist in diesem Land nicht zu finden.“ In Kleve und Umgebung fand Koekkoek alle poetischen Elemente seiner idealen romantischen Landschaftsauffassung. Orientiert am Stil der holländischen Kunst des 17. Jahrhunderts schuf Koekkoek zahlreiche, häufig fiktive und idealisierte Landschaften. Seine Vorliebe für Felsen als rahmendes
Element war seit seinen Reisen durch das Rheinland und den Harz einige Jahre zuvor offensichtlich geworden. Die auf diesen Reisen entstandenen Naturstudien dienten ihm als Vorlage. Er hatte damit eine Ausdrucksweise gefunden, die er auf unterschiedliche Weise einsetzen konnte.
Das vorliegende, 1834 datierte Werk dürfte zu den ersten Landschaften überhaupt gehören, die der aus einer Middelburger Künstlerfamilie stammende Koekkoek in seiner neuen, inspirierenden Umgebung malte. Es vereint dabei alle Aspekte, die er als Maler so sehr schätzte. Das beeindruckende, großformatige Gemälde zeigt eine überwältigende Winterlandschaft, die die Erhabenheit der Natur über den Menschen offenbart. Diese Betonung der emotionalen Wirkung ist nicht nur ein Hauptmerkmal der romantischen Kunst, die auf die Bedeutung der Vernunft im Zeitalter der Aufklärung reagiert, sondern auch der Malkunst Barend Cornelis Koekkoeks.
Die Felsen auf der linken Seite ragen hoch über den einsamen Reisenden empor, dessen zwei Esel vorsichtig über den vereisten Weg schreiten. Die Bäume im Mittelgrund trennen den Berg vom Fluss, der sich durch das winterliche Tal seinen Weg bahnt. Das gleißende Sonnenlicht dringt durch das Geäst der Bäume und lässt den Schnee in funkelnden Effekten erstrahlen. Die beinahe greifbare Morgenkälte in der Luft verleiht der gesamten Szenerie eine majestätische Ruhe. Der romantische Charakter, die monumentale Kraft der Natur bleibt allgegenwärtig spürbar. Die berührende Winterlandschaft zählt zweifellos zu den Höhepunkten in Koekkoeks malerischem Œuvre.


6058 um 1830. Knabe in blauem Kittel mit Bilderbuch auf einer Terrasse mit üppigem Blumenstrauß. Öl auf Leinwand. 66,3 x 56,6 cm.
800 €
Dänisch
6059 um 1830. Bildnis einer jungen Frau im weißen Kleid mit einem Haarkranz aus rosa Rosen. Öl auf Leinwand. 23,9 x 18,8 cm. Verso auf dem Schmuckrahmen das Etikett des Kopenhagener Hofvergolders Peder Christian Damborg.
1.500 €
Qualitativ steht das reizende Porträt den Arbeiten des dänischen Genreund Porträtmalers Wilhelm Ferdinand Bendz (1804-1832) sehr nahe. In einem Rahmen des berühmten Kopenhagener königlichen Hofvergolders und Ornamentkünstlers Peder Christian Damborg (1801-1865), der für fast alle bedeutenden Künstler und Sammler seiner Zeit Rahmen und andere Objekte anfertigte.

François-Pascal Simon Gérard (1770 Rom – 1837 Paris)
6060 nach. Bildnis Alexander I., Zar von Russland. Aquarell, Deckfarben (und Öl?) auf Porzellan. 12,5 x 9,5 cm (im Oval).
3.500 €
Das Werk geht wohl auf das Portrait Alexander I. von François Gérard im Nationalmuseum Stockholm aus dem Jahr 1814 zurück, dass den Monarchen ebenfalls als Brustbildnis mit nach links gewandtem Kopf und den Orden zeigt. Bei vorliegender Arbeit ist lediglich die blaue Schärpe ergänzt.

Kontinentaleuropa
6061 um 1850. Bildnis eines jungen Mannes mit Backenbart, in blauer Jacke, bestickter Weste und gestreifter Halsschleife.
Email. 4,2 x 3,7 cm. In einem Kapselrahmen.
350 €


Albrecht Adam (1786 Nördlingen – 1862 München)
6062 Reitknecht mit drei Pferden und Hund im Stall. Öl auf Holz. 38,7 x 51 cm. Unten rechts signiert und datiert „AAdam 1827“, verso auf einem Klebeetikett der Eigentumsvermerk des Künstlerkollegen „Hofrat i.R. / Dr. Arthur Freih. von Ramberg / Graz [...]“.
9.000 €
Provenienz: Sammlung Dr. Arthur Freiherr von Ramberg (laut umseitigem Klebeetikett).
Albrecht Adam ist der Stammvater einer in vier Generationen tätigen bayerischen Künstlerfamilie. Berühmtheit erlangt er vor allem mit seinen vor Ort beobachteten Schlachtengemälden. Offizielle Auftraggeber waren unter anderen König Ludwig I. von Bayern, König Wilhelm von Würt-
temberg und Kaiser Franz Joseph von Österreich. Neben den Schlachtengemälden spezialisiert sich Adam auf Bildnisse seiner adeligen Auftraggeber auf ihren Lieblingspferden und Portraits eben dieser Pferde. In München hat Adam sich seit 1824 auf seinem Anwesen, der sogenannten „Adamei“, ein ebenerdiges Atelier eingerichtet, in das die Pferde geführt werden konnten. Die exakte Wiedergabe der Anatomie, die die Vorzüge der jeweiligen Rasse herausstellte, steht im Mittelpunkt dieser Pferdebildnisse, mit denen Adam zum bedeutendsten Pferdemaler seiner Zeit aufsteigt. Im Jahr der Entstehung unseres Gemäldes 1827 beginnt er, mit Hilfe seiner Söhne, zudem mit der Veröffentlichung des auf über 100 Tafeln angelegten lithografischen Prachtwerkes Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu‘à Moscou fait en 1812, welches Adam als am Feldzug teilnehmender Attaché des Prinz Eugène in umfangreichen Zeichnungen direkt vor Ort in zahlreichen Skizzen vorbereitet hatte.

Wilhelm Melchior (1817 Nymphenburg – 1860 München)
6063 Der Münchener Stadtkommandant begrüßt das k.u.k. Regiment Latour in Sendling. Öl auf Leinwand. 26,6 x 33 cm. Signiert und datiert unten rechts „Melchior. 48“. Verso mit altem handschriftlichen Etikett „Aus dem Besitz der ZÜRN‘schen Familie / General a.d. Max Z. *1943 / Durchmarsch des k.u.k. Regiments Latour durch München 1848 auf seinem Marsch nach Oberitalien. / Begrüßung des Regiments durch den Münchener Stadtkommandanten in Sendling (beim heutigen Kaffee „Harras“ / gemalt von MELCHIOR.“
3.000 €
Provenienz: Generalmajor Maximilian Zürn (1871-1943, München).
Die revolutionären Ereignisse von 1848 fanden auch in mehreren Provinzen Italiens starken Widerhall. Aufstände italienischer Freiheitskämpfer hatten im Januar 1848 auf Sizilien, in Brescia und Padua gegen die Vorherrschaft der Bourbonen im Süden und die der Österreicher im Norden begonnen und griffen am 17. März 1848 auf Venedig und Mailand über. In Mailand erklärten die Revolutionäre die Unabhängigkeit der Lombardei von Österreich und der Volksaufstand nahm so gravierende Ausmaße
an, dass sich die österreichischen Truppen unter Josef Wenzel Radetzky in das Festungsviereck Mantua-Peschiera del Garda-Verona-Legnago zurückziehen mussten, um auf Verstärkung aus Österreich zu warten. Diese Situation führte schließlich zum Ersten Italienischen Unabhängigkeitskrieg. Eines dieser Unterstützungsregimenter war das k.u.k. Regiment Latour. Unser Gemälde zeigt das Treffen des Regiments mit dem Münchner Stadtkommandanten Johann von Kunst. Es fand vor dem alten Schloß Löwenhof in Untersendling, an der Gabelung der Landstraßen von München nach Wolfratshausen und Weilheim, statt. Die Straße nach Wolfratshausen führt über Mittenwald, Innsbruck und den Brenner ziemlich direkt nach Norditalien. Das im Bild gezeigte Schloss wurde 1856 abgerissen. Teile davon erwarb der Gastwirt Robert Harras, der dort ein Café mit Gartenwirtschaft errichtete, das „Zum Harras“ hieß und sich als beliebter Ausflugsort für die Münchner etablierte. Das Café existierte bis 1903, der Platz aber behielt bis heute seinen Namen. Im Mittelgrund ist die alte Pfarrkirche St. Margaret in Untersendling zu sehen, im Hintergrund rechts die Silhouette der Stadt München. - Der Tiermaler und Lithograph Wilhelm Melchior entstammte einer Künstlerfamilie: sein Vater Georg Wilhelm (1780-1826) und sein älterer Bruder Joseph Wilhelm (1810-1883) waren ebenfalls Maler. Er studierte seit 1832 an der Königlichen Akademie der Künste in München und setzte sein Studium von 1850 bis 1851 in London fort.



Carl Friedrich Heinzmann (1795 Stuttgart – 1846 München)
6064 Entenjagd im Murnauer Moos. Öl auf Leinwand. 34,8 x 58,5 cm. Unten rechts monogrammiert (ligiert) und schwer leserlich datiert „CH 1837 [letzte Ziffer undeutlich].“.
3.000 €
Ferdinand Kobell (1740 Mannheim – 1822 München)
6065 zugeschrieben. Sommerliche Flusslandschaft. Öl auf Leinwand, kaschiert auf Platte. 28 x 33,5 cm. Unten links wohl eigenh. monogrammiert „F.K.“.
800 €
Johann Georg Paul Mohr (1808 Bordesholm – 1843 München)
6066 Blick auf die Theatinerkirche in München, gesehen vom Arco-Palais. Öl auf Papier, alt (wohl original) auf Leinwand kaschiert. 28,5 x 29,8 cm. Unten links in der nassen Farbe signiert und datiert „J. Mohr 1837“, verso auf dem Rahmen das Galerieetikett von Otto Lemming, Kopenhagen.
1.800 €
Provenienz: Norddeutsche Privatsammlung.
Diese besonders aufgrund ihrer zurückhaltenden Farbigkeit einnehmende Ansicht zeigt einen Blick vom Piano Nobile des nach Plänen von Leo von Klenze am Wittelsbacher Platz in München errichteten Arco-Palais auf die Theatinerkirche am Odeonsplatz.

Adalbert Schäffer (auch Béla, 1814 Großkarol (Carei) – 1871 Düsseldorf)
6067 Sonntag im Stadtwäldchen (Városliget) in Budapest. Öl auf Leinwand. 39,7 x 47,5 cm. Unten links signiert und datiert „A. Schäffer inv: et fecit [18]48“.
1.500 €
In seinen jüngeren Jahren schuf der ungarische Künstler Adalbert Schäffer in Pest und Wien noch vermehrt charmante Genrebildern wie das vorliegende, ehe ihm als Stilllebenmaler der Druchbruch gelang.


Aristides Oeconomo (1821 Wien – 1887 Athen)
6068 Bildnispaar eines Akademischen Legionäres und seiner Frau.
2 Gemälde, je Öl auf Malkarton. Je ca. 31,6 x 26,7 cm. Beide unten rechts signiert und datiert „Oeconomo / 1848“, verso jeweils auf einem Klebezettel bezeichnet „Hickel / Brünn g.[eb?] / ...“ sowie das Etikett des Malerkartonherstellers Johann Hall, Wien.
4.500 €
Entstanden im Revolutionsjahr 1848 zeigen die Portraits eine Frau in weißem Seidenkleid und einen Herren in der Uniform der Akademischen Legion. Diese hatte sich beflügelt von Nationalbewusstein und erneuertem Freiheitsdrang im März 1848 in Wien aus dem Kreis der Studierenden und Akademiker als Unterabteilung der bürgerlichen Nationalgarde gebildet. Mit der Rückeroberung Wiens im Oktober desselben Jahres wurde die Legion bereits wieder aufgelöst.

Carl von Blaas (1815 Nauders in Tirol – 1894 Wien)
6069 Blick über die römische Campagna mit den Albaner Bergen.
Öl auf Papier, kaschiert auf Karton. 17,8 x 28,4 cm.
800 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (dessen Stempel auf dem Rückdeckel).
Ausstellung: Ausst. Kat. Kunst-Verein, 369. Ausstellung, Wien 1888, S. 11, Nr. 94.
Provenienz: Nachlass Friedrich von Amerling, Wien (Marie Amerling, geb. Nemetschke, gesch. Paterno, spätere Gräfin Hoyos). Wawra, Wien, 264. Auktion vom 11.-12. März 1921, Nr. 8 mit Abb. Tafel II.
Dorotheum, Wien, 365. Auktion vom 10.-12. Dezember 1925, Nr. 3 mit Abb. Tafel I.
Sammlung Otto Drucker, Wien (1927).
Friedrich Ritter von Amerling (1803 Spittelberg – 1887 Wien)
6070 Der Bankier Demeter Theodor Tirka. Öl auf Leinwand. 60 x 50,5 cm. Unten links des Dargestellten in die nasse Farbe geritzt „D Tirka“ sowie rechts im Hintergrund datiert „21/11 1847“.
12.000 €
Literatur: Günther Probszt: Friedrich von Amerling. Der Altmeister der Wiener Porträtmalerei, Zürich/Leipzig/Wien 1927, Nr. 726. Sabine Grabner: Friedrich von Amerling. Werkverzeichnis der Gemälde, Belvedere Werkverzeichnisse Band 13, Wien 1925, S. 216, GE 826.
Das Bildnis des Wiener Bankiers und Kunstsammlers Demeter Tirka gehört zu einer Serie von Portraits, die Friedrich von Amerling von Freunden malte, die sein Atelier besuchten. Von jedem dieser Portraits gibt es zwei Fassungen: Die erste Version wurde vom Portraitierten signiert und verblieb als Andenken in Amerlings Privatsammlung, während die zweite Version von Amerling selbst signiert dem Portraitierten als Geschenk überreicht wurde. Bei unserem Werk hat der Dargestellte Demeter Tirka selbst seinen Namen mit der Spitze des Pinselstils links neben seinem Konterfei in die nasse Farbe geritzt. Tirka (1802 Craiva1874 Wien) entstammte einer griechisch-orthodoxen Familie von Kaufleuten und Bankiers aus Voskopoja im heutigen Albanien. Nach dem Studium in Prag trat er 1839 die Nachfolge als Eigentümer des Großhandelsunternehmens und der Bank seines Vaters in Wien an. Im Jahr 1840 kaufte er ein Haus in Maria Enzersdorf, wo er seine umfangreiche Kunstsammlung, darunter zahlreiche Werke Amerlings, unterbrachte.

Johann Baptist Reiter (1813 Urfahr – 1890 Wien)
6071* Porträt des Sohnes Moritz als Edelknabe. Öl auf Leinwand. 62,5 x 49,5 cm. Unten links signiert „Reiter“. Um 1877/78.
15.000 €
Literatur: Alice Strobl: Johann Baptist Reiter, Wien, München 1963, S. 101, Nr. 370 (dort als „Edelknabe“).
Provenienz: Kunstsalon Pisko, Wien, Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Miniaturen aus dem Nachlasse des Herrn kaiserl. Rates Dr. Karl J. Haschek, Wien, aus dem Besitze der Familie des Altwiener Malers J. B. Reiter und aus Privatbesitz, Auktion am 15. April 1913, Los 40. Sotheby’s, London, Auktion am 22. Juni 1983, Los 214 (als Paar). Privatsammlung, Wien.
Dorotheum, Wien, Auktion am 24. Oktober 2023, Los 544. The Jack Daulton Collection, Los Altos Hills, Kalifornien, USA.
Mit diesem und dem nachfolgenden Werk, die der Forschung bis vor Kurzem lediglich aus der Literatur bekannt waren, setzte Reiter seinen Kindern aus seiner zweiten Ehe ein einzigartiges Denkmal. Nachdem er in den 1840er Jahren als Porträtmaler bereits große Erfolge erzielt hatte, zerbrach zunächst seine erste Ehe. Im Jahr 1853 lernte er dann die aus Böhmen stammende Anna Josefa Theresia Brayer kennen, die bald zu
seinem Lieblingsmodell und Lebenspartnerin wurde. Während die Verbindung anfangs kinderlos blieb, markierten die Geburten seiner beiden Kinder Moritz (1862) und Alexandrine, liebevoll „Lexi“ genannt (1864), in Reiters künstlerischem Schaffen den Beginn einer besonders produktiven Phase. Reiter widmete sich in den Folgejahren immer wieder dem Motiv seiner Kinder und stellte sie dem Zeitgeschmack entsprechend auch gelegentlich in verschiedenen historischen Rollen und Kostümen dar. Malerisch erreichte er in dieser Zeit seinen künstlerischen Höhepunkt, wovon auch die beiden hier vorliegenden Gemälde eindrucksvoll Zeugnis ablegen.
Die fein ausgeführten und einfühlsam erfassten Porträts vermitteln eine spürbare innige väterliche Zuneigung. Mit großer Detailtreue und zugleich in einer luftigen Malweise erfasst Reiter die Porträts der Kinder. Beide sind im Stil frühneuzeitlicher Porträts im Halbprofil vor einer idealisierten Landschaft präsentiert und tragen prächtige, phantasievolle, von der Renaissance inspirierte Kostüme und Schmuck. Während der Junge zwei fliegende Paradiesvögel an einer Schnur hält, präsentiert die jüngere, reich geschmückte Schwester (folgende Losnummer) einen farbenfrohen Vogel auf ihrer Hand. Die beiden Bildnisse stehen mit ihrer akribischen Ausführung, gepaart mit atmosphärischer, leichter Farbigkeit, beispielhaft für die künstlerische Eigenständigkeit Reiters und zählen zu den malerischen Höhepunkten seines Spätwerks.

6072* Portrait der Tochter Alexandrine „Lexi“ als Edelfräulein.
Öl auf Leinwand. 62,5 x 49,5 cm. Unten rechts signiert „Reiter“. Um 1877/78.
15.000 €
Literatur: Alice Strobl: Johann Baptist Reiter, Wien/München 1963, S. 101, Nr. 369.
Provenienz: Kunstsalon Pisko, Wien, Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen und Miniaturen aus dem Nachlasse des Herrn kaiserl. Rates Dr. Karl J. Haschek, Wien, aus dem Besitze der Familie des Altwiener Malers J. B. Reiter und aus Privatbesitz, Auktion am 15. April 1913, Los 39.
Sotheby’s, London, Auktion am 22. Juni 1983, Los 214 (als Paar). Privatsammlung, Wien. Dorotheum, Wien, Auktion am 24. Oktober 2023, Los 544. The Jack Daulton Collection, Los Altos Hills, Kalifornien, USA.

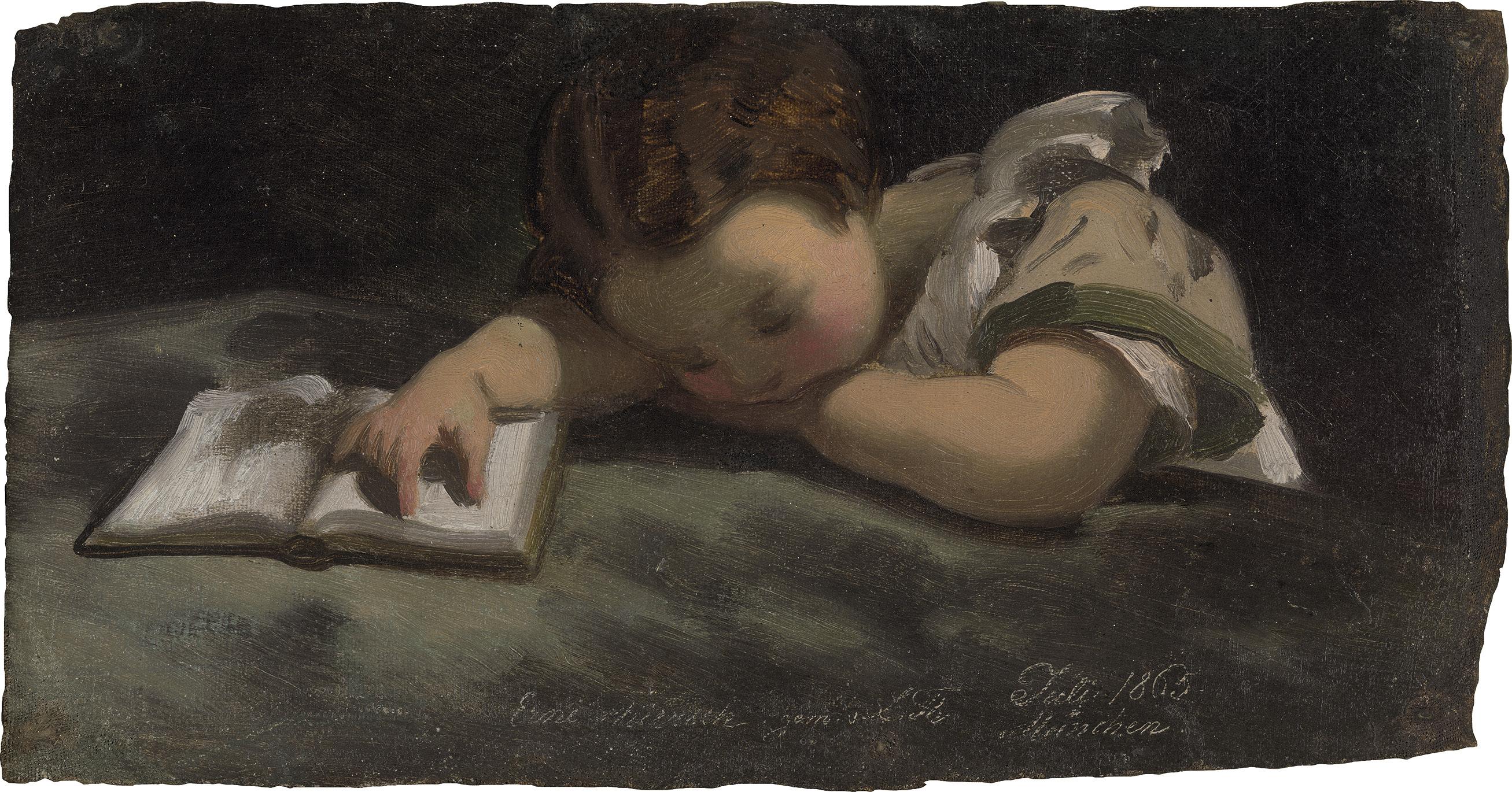
Ludwig Thiersch (1825–1909, München)
6073 Die Tochter des Künstlers Ernie, schlafend. Öl auf Leinwand, auf Karton kaschiert. 15,4 x 29,5 cm.
Am Unterrand in die nasse Farbe geritzt „Ernie Thiersch gem. v. L. Th. Juli 1865 München“.
600 €
Deutsch
6074 um 1840. Studienblatt mit roten Chili, Kirschtomaten und einer Rosenblüte.
Öl über Graphit auf graubraun grundiertem Papier. 29 x 19,5 cm.
3.500 €

August Ferdinand Hopfgarten (1807–1896, Berlin)
6075 Gruppenbildnis mit Kind und zwei Frauen, wohl das Porträt einer Verstorbenen betrachtend. Öl auf Leinwand. 53,5 x 53 cm (Darstellung im Rund). Rechts unterhalb des Vogelkäfigs signiert „A. Hopfgarten“. 18.000 €
In einem nahansichtig erfassten Interieur sitzen drei Personen auf einem Canapé innig beisammen: Im Mittelpunkt der Komposition ist ein Knabe im roten Kittel, zärtlich umsorgt von zwei Frauen, wahrscheinlich Verwandten, in ausladenden Kleidern. Während die eine ihn auf ihrem Schoß hält, führt ihm die andere das Bildnis einer dritten Frau vor. Um wen es sich bei dieser Figur wohl handelt, die nur indirekt im Bild anwesend sein kann? Vielleicht um eine verstorbene Angehörige, gar die Mutter? Dem Kind scheint ihr Konterfei auf jeden Fall vertraut zu sein, deutet es doch leicht lächelnd mit ausgestrecktem Ärmchen auf sie. Mit wenigen Gesten und Bildelementen wird das klassische Gruppenbildnis so subtil um ein narratives Moment erweitert, das von Verlust und Erinnern erzählt. Das Gemälde stammt von der Hand des Berliner Malers August Ferdinand Hopfgarten, der sich eigentlich mit Vorliebe literarischen und historischen Stoffen widmete. Doch zeigt dieses Gemälde eindrücklich,
dass sein Talent auf dem Gebiet Porträtmalerei lag. Neben der einnehmenden Komposition besticht die Darstellung insbesondere durch die meisterhafte Behandlung des Kolorits. In den Kleidern bilden die glatt vertriebenen Farben exquisit aufeinander abgestimmte Farbklänge von sattem Rot und Purpur in Nuancen wie Zinnober, Flieder und Kastanienrot, aufgegriffen und verstärkt durch den weinroten Ton des Vorhanges im Hintergrund. Diese Akkorde harmonieren raffiniert mit dem Goldgelb des Sofas, das sich im Rahmen und den Akzenten im Kleidchen des Buben wiederholt.
Es handelt sich hierbei zweifelsfrei um ein Glanzmoment der Berliner Porträtmalerei der Biedermeierzeit. Hopfgartens Kunstfertigkeit steht jener weitaus berühmterer Zeitgenossen in nichts nach. Ein weiterer Hinweis auf sein bislang verkanntes Talent ist die Tatsache, dass das von Wilhelm Schadow gemalte Bildnis der Fürstin von Liegnitz (SPSG, Potsdam, Kriegsverlust) in Vergangenheit fälschlicherweise immer wieder unserem Künstler zugeschrieben wurde (zuletzt Irmgard Wirth: Berliner Malerei im 19. Jahrhundert, Berlin 1990, S. 204f). Letztlich verwundert es angesichts von Hopfgartens hohem malerischem Können, dass kaum weitere Porträts von seiner Hand bekannt sind. Ein Grund mehr, die Bedeutung vorliegenden Werkes hervorzuheben.


Franz Ittenbach (1813 Königswinter – 1879 Düsseldorf)
6076 zugeschrieben. Mondsichelmadonna mit Kind. Öl und Goldhöhungen auf Leinwand, reliefierter Goldgrund mit ligiertem Marienmonogramm. 55,2 x 34,6 cm.
4.000 €
Albrecht Dürer (1471–1528, Nürnberg)
6077 nach. Der hl. Lazarus. Öl über Goldgrund, auf Malpappe. 40,3 x 32 cm. Verso ein Zettel mit handschriftl. Angaben zu Dürers Vorlage. Deutsch, vor 1827.
1.500 €
Das Gemälde gibt ausschnitthaft die Büste des hl. Lazarus aus Albrecht Dürers Tafelbild „Die hll. Simeon und Lazarus“ wieder. Dürers Vorlage ist die Flügelinnenseite des um 1503/05 datierten Jabach-Altars, welche der rückseitige Vermerk in der Sammlung Boisserée in München verortet. Die Tafel wurde aus dieser Sammlung im Jahr 1827 anlässlich des anstehenden 400. Todestages des Nürnberger Meisters für die Pinakothek angekauft. Daraus ergibt sich der terminus ante quem für die Entstehung vorliegender Arbeit, die ein malerisch besonders qualitätvolles Beispiel für die erneute Dürer-Renaissance in dieser Zeit darstellt.


Giovanni Bellini (um 1437–1516, Venedig)
6078 nach. Bildnis des Dogen Leonardo Loredan. Öl auf Leinwand. 62,5 x 45,5 cm. Verso auf dem Keilrahmen bezeichnet „copied by E. Hinchliffe, London“, auf der Leinwand der Stempel des Londoner Künstlerbedarfs „Winsor & Newton“. In einem prunkvollen Ädikula-Rahmen, verso mit Etikett „Hermann Richter, Rahmenfabrik und Kunsthandlung, Prag“. Englisch, 19. Jh.
1.500 €



Thorald Læssøe (1816 Frederikshavn – 1878 Kopenhagen)
6079 Der Titusbogen in Rom. Öl auf Leinwand. 31 x 43,5 cm. Um 1850.
4.500 €
Deutsch
6080 um 1840. Im Inneren des Kolosseums. Öl auf Papier. 20 x 27,7 cm. Verso alt bezeichnet „Al Colosseo“.
900 €
Ernst Meyer (1797 Hamburg-Altona – 1861 Rom)
6081 Junge Italienerinnen am Brunnen. Öl auf Leinwand, auf Holz kaschiert. 31,5 x 22,4 cm. Um 1830.
600 €
Literatur: Ulrich Schulte-Wülwer: Sehnsucht nach Arkadien. SchleswigHolsteinische Künstler in Italien, Heide 2009, S. 167, Abb. 87.
Felix Possart (1837–1928, Berlin)
6082 Orientalische Tempelhalle. Öl auf Leinwand. 24,5 x 32 cm. Unten links signiert „Felix Possart“.
400 €
Friedrich Preller d. J. (1838 Weimar – 1901 Dresden)
6083 Am Strand von Cumae. Öl auf Malkarton. 16 x 35,5 cm. Unten rechts in Rot monogrammiert „F. P.“, verso mit altem Klebeetikett, dort in Feder betitelt. Um 1860.
1.800 €
Abbildung Seite 90
Josef Hoffmann (1831–1904, Wien)
6084 Blick über die Serpentara bei Olevano. Öl auf Holz. 26 x 40 cm. Unten links datiert „den 18. October 1860“, verso Annotationen zum Künstler.
1.800 €
Abbildung Seite 90

6081



Carl Blechen (1798 Cottbus – 1840 Berlin)
6085 Schule. Parkmauer der Villa Borghese mit der Villa Raphaela. Öl auf Leinwand. 24 x 33,5 cm.
3.500 €
Literatur: Paul Ortwin Rave: Karl Blechen. Leben. Würdigungen. Werk Berlin 1940, S. 267, wohl Nr. 820 (ohne Abbildung; die dort fälschlicherweise wiedergegebene Abbildung bezieht sich auf die Rave Nr. 819; dort mit 24 x 30 cm angegeben).
Provenienz: Sammlung Herrmann Werner, Cottbus. Privatbesitz Norddeutschland.
Carl Blechens Landschaftsmalerei lebt von der spannungsvollen Balance zwischen präziser Naturbeobachtung und einer romantisch überhöhten Auffassung der Landschaft. Der Künstler entschied sich 1828, seine Tätigkeit als Bühnenmaler am Königstädtischen Theater in Berlin aufzugeben und für ein Jahr nach Italien zu reisen. Die dort gewonnenen Ein-
drücke prägen sein künstlerisches Schaffen in nachhaltiger Weise. Zurück in Berlin entstanden Zeichnungen und Gemälde, die skizzenhaft und unmittelbar den Eindruck des Gesehenen wiederzugeben suchen. Charakteristisch für Blechens eigenwilligen Zugang ist der bewusste Verzicht auf die gängigen, romantischen Veduten Italiens - ein Zug, der auch diese eindrucksvolle Ansicht der Villa Borghese und Villa Raphaela prägt. Nicht die berühmten Bauwerke oder die sanfte Hügellandschaft der Campagna stehen im Vordergrund; vielmehr beherrscht eine mächtig aufragende Mauer das Bildfeld, die sich von rechts bis weit über die Mitte in die Landschaft schiebt und den Blick erst am Ende zu den dahinterliegenden Gebäuden freigibt. Rave führt insgesamt drei Fassungen dieses außergewöhnlichen Motivs auf (Rave Nrn. 819, 820 und 821). Während die erste als eigenhändige Arbeit Blechens gilt, werden die beiden anderen, in Auffassung und Qualität eng anschließenden Versionen heute von der Forschung dem Kreis seiner Schüler zugewiesen. Ausgangspunkt der Kompositionen war eine lavierte Federzeichnung mit dem Titel „Beschattete Stadtmauer“, datiert auf den 9. Januar 1829, die Teil eines römischen Skizzenbuchs mit 42 losen Blättern war (Rave Nr. 773).

Sir Edwin Henry Landseer (1802–1873, London)
6086 Gloucestershire Old Spots: Studie zu einem Schwein.
Öl auf Leinwand. 15 x 21,3 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „EL Nov [18]34“.
1.200 €
Provenienz: Barbara und Ernest Kafka, New York. Privatsammlung USA.

Abraham Teerlink (1776 Dordrecht – 1857 Rom)
6087 Ausblick aus einer Grotte in den Abruzzen. Öl auf Leinwand, doubliert. 56,2 x 78 cm. Unten rechts signiert „A. Teerlink fecit“.
6.000 €
Inmitten einer weitläufigen Gebirgslandschaft öffnet sich der Blick in das Innere einer großflächigen Grotte, in der ein Hirte kniend vor einem Kreuz in stiller Andacht verharrt. Umgeben ist er von seinen Ziegen, die im Schatten der kühlen Felsen Zuflucht suchen. Der Kontrast zwischen dem dunklen, fast sakral anmutenden Innenraum der Höhle und der lichter-
füllten Weite des Tals im Hintergrund erzeugt eine spannungsvolle Gegenüberstellung von Enge und Offenheit, Innerlichkeit und Weltbezug. Am Höhleneingang begegnen sich eine Italienierin und ein Pilger - ein scheinbar beiläufiges Gespräch, das dem Bild eine narrative Tiefe verleiht und zugleich den Aspekt des Reisens und der menschlichen Begegnung in den Mittelpunkt rückt. Die Komposition demonstriert eindrucksvoll Teerlinks souveränen Umgang mit Licht und Raum: Der gezielte Einsatz von Hell-Dunkel-Kontrasten verleiht dem Gemälde eine dramatische Wirkung, wie sie für die romantisch geprägte Landschaftsmalerei des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts charakteristisch ist

Rudolf Schick (1840–1887, Berlin)
6088 Weinstock am Monte Brione am Nordufer des Gardasees.
Öl auf Leinwand, auf feste Pappe aufgezogen. 23,8 x 14,9 cm. Verso oben links betitelt und datiert „Gardasee 1864 / Weinstock / am Monte Brione“, unten rechts signiert „Rud. Schick“.
900 €
Der Berliner Genre-, Bildnis- und Landschaftsmaler Rudolf Schick begann seine Ausbildung bei Wilhelm Schirmer. In den Jahren 1864/66 verbrachte er einen ersten Studienaufenthalt in Italien, dem zahlreiche weitere folgten. In Rom lernte er auch Arnold Böcklin kennen, mit dem er ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, und den er bei der Ausführung seiner Wandgemälde im Naturhistorischen Museum in Basel unterstützte.


Anton von Werner (1843 Frankfurt an der Oder – 1915 Berlin)
6089 Caprifischer.
Öl auf Papier, auf Karton kaschiert, die Kanten original mit schwarzem Papierstreifen gefasst. 39 x 32,5 cm. Unten rechts monogrammiert, bez. und datiert „AvW Capri 1869“.
900 €
Literatur: Dominik Bartmann: Anton von Werner. Werkverzeichnis der Gemälde einschließlich der Wandbilder, Ölstudien und Ölskizzen (digital), Nr. G 1869-5.
Provenienz: Leo Spik, Berlin, Auktion 518 im Oktober 1981, Los 383. Berliner Privatbesitz.
1869 unternahm Anton von Werner eine Reise nach Italien, die ihn auch nach Capri führte, wo der Künstler zusammen mit seinem Malerfreund Ascan Lutteroth sechs Wochen verbrachte. Zahlreiche Ölstudien und Zeichnungen der sagenhaften Landschaft zeugen von diesem Aufenthalt. Sehr treffend und lebensnah erscheint auch die hier vorliegende Studie eines Fischers, der, offenbar müde von seinem Tagwerk, den Kopf in die Hand gelegt hat. Die Zeichnung diente als Vorlage für eine Figur auf dem Gemälde „Don Quijote bei den Ziegenhirten“ (vgl. Dominik Bartmann (Hrsg.): Anton von Werner - Geschichte in Bildern, München 1993, Nr. 63).
Frans Vervloet (1795 Mecheln – 1872 Venedig)
6090 Fröhliche Runde mit neapolitanischen Fischern beim Wein trinken. Öl auf Papier, auf Karton kaschiert. 21 x 27,7 cm. Unten links monogrammiert und datiert „FV napoli 1822“.
4.500 €
Provenienz: Aus der Sammlung des dänischen Malers David Jacob Jacobsen (1821 Kopenhagen - 1871 Florenz, Annotation in brauner Feder auf dem Schmuckrahmen verso).
Eine kleine Gesellschaft von Neapolitanern hat sich um einen einfachen Holztisch versammelt. Sie genießen den Wein aus einer großen Karaffe, während ein Austernfischer daneben seine Muscheln verarbeitet. Die lebendige Studie dürfte als eine mögliche Bildidee für Vervloets eindrucksvolle neapolitanischen Hafenansichten gedient haben, die der Künstler ab 1820 in verschiedenen Versionen malte. Andreas Stolzenburg, Hamburg, bestätigte die Autorschaft Vervloets nach Begutachtung des Originals (mdl. am 23. Juli 2025).



Deutsch oder Dänisch
6091 1861. Blick von Capri auf den Golf von Neapel und die sorrentinische Halbinsel. Öl auf Leinwand. 32,8 x 44 cm. Unten links monogrammiert und datiert „BH [18]61“.
900 €
Dänisch
6092 19. Jh. Küste von Sorrent. Öl auf Leinwand. 31,5 x 41 cm.
1.200 €
Dänisch
6093 um 1840. Felsenbogen in den Sabiner Bergen bei Civitella.
Öl auf Papier, auf Leinwand kaschiert, doubliert. 45 x 58,5 cm.
2.400 €
Dieselbe Ansicht hielt 1836 Carl Morgenstern in einer Ölstudie auf seiner Italienreise fest; das Werk befindet sich im Frankfurter Städel (Inv. SG 1068).



Carl Frederik Sørensen
(1818 Besser, Samsø – 1879 Kopenhagen)
6094 Segelschiff vor der Küste Dänemarks.
Öl auf Malkarton. 25,5 x 35,5 cm. Unten links monogrammiert und signiert „C. F. S. 1845“.
1.500 €
Dänisch
6095 um 1850. Blick auf das Tal der Rhône gegen Avignon.
Öl, teils in der nassen Farbe gekratzt, auf Papier, auf Pappe kaschiert. 15,7 x 23,5 cm. Unten links undeutlich bezeichnet.
900 €
Adolph Heinrich Wilhelm Carl (1814 Kassel – 1845 Rom)
6096 Landschaft mit Blick auf die Insel Møn, Dänemark.
Öl auf Leinwand. 44,5 x 70 cm. Verso auf dem Keilrahmen alt bez. „Udsigt fra Moen / Adolph H. V. Carl 1834“.
1.800 €
Das Gemälde entstand vermutlich für den Kunstforeningen. Der dänische Kunstverein verpflichtete Künstler, die ihre Werke an den Verein verkauften, eigenhändig eine Zeichnung oder Radierung der Arbeit anzufertigen. Die umfangreiche Sammlung von Originalzeichnungen dänischer Künstler im Kunstverein wurde 1933 bei Winkel & Magnussen versteigert („Kunstforeningens Samling af Haandtegninger”, Auktion 142). Die unserer Darstellung entsprechende Zeichnung wurde dort unter Los 96 und im Jahr 2022 erneut bei Bruun Rasmussen in Kopenhagen angeboten.

Christen Dalsgaard (1824 Krabbesholm – 1907 Sorø)
6097 Studie mit Wiesengräsern. Öl auf grau grundiertem Papier. 35,3 x 28 cm. Verso bezeichnet „C. Dalsgaard“. Um 1840.
1.200 €
Ernst Christian Frederik Petzholdt (1805 Kopenhagen – 1838 Patras)
6098 Felslandschaft im Harz. Öl auf Papier, kaschiert auf Malkarton. 27 x 37,5 cm. Um 1830.
3.500 €
Traditionell ging auch Petzholdt nach seinem Studium an der Akademie in Kopenhagen auf Künstlerreise und kam dabei 1830 auf dem Weg nach Italien auch durch Deutschland, wo er im Harz haltmachte und die Landschaft porträtierte.
Louis Gurlitt (1812 Altona – 1897 Naundorf b. Schmiedeberg)
6099 Farnkraut auf einem Geröllfeld in Norwegen. Öl auf Papier, auf Leinwand kaschiert. 26,5 x 32 cm. Oben rechts signiert (Initialen ligiert) und datiert „LGurlitt 1832“.
1.500 €
Literatur: Ulrich Schulte-Wülwer, Bärbel Hedinger (Hrsg.): Louis Gurlitt 1812-1897. Porträts europäischer Landschaften in Gemälden und Zeichnungen, München 1997, Kat. 10, Abb. 22, S. 29.
Provenienz: Rudolph Lepke‘s Kunst-Auctions-Haus, Berlin, Gemälde alter und neuerer Meister aus norddeutschem Museumsbesitz, Auktion am 25.-26. November 1924, Los 41.
Die Naturstudie entstand vor Ort auf Gurlitts erster Reise nach Norwegen, die er zwanzigjährig mit dem Künstlerfreund Adolph Kiste noch vor Beginn ihres Studiums an der Kopenhagender Akademie unternahm.



Christian Friedrich Gille (1805 Ballenstedt – 1899 Wahnsdorf/Dresden)
6100 Wolken bei untergehender Sonne. Öl auf Leinwand, auf festem Karton montiert. 24 x 30,6 cm.
3.000 €
Provenienz: Sammlung Erhard Frommhold (1928-2007), Dresden (verso das Sammlungsetikett „124 Christian Friedrich Gille. Wolkenstudie“).
Johann Hermann Carmiencke (1810 Hamburg – 1867 Brooklyn, New York)
6101 Abendhimmel: Wolken gegen das Licht der letzten Sonnenstrahlen.
Öl auf Papier, auf Pappe kaschiert. 22,2 x 31,7 cm. Unten links in der nassen Farbe monogrammiert „HC“ und unleserlich datiert.
2.400 €
Literatur: Ulrich Schulte-Wülwer: „Der Landschaftsmaler Johann Hermann Carmiencke“, in: Nordelbingen- Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 79 (2010), S. 47-76, hier S. 49, Abb. 1.
Die Studie entstand um 1831 während Carmienckes Aufenthalt in Dresden bei Johan Christian Clausen Dahl.
Christian Friedrich Gille (1805 Ballenstedt – 1899 Wahnsdorf/Dresden)
6102 Partie an der Elbe.
Öl auf Papier, auf Papier aufgezogen. 17,1 x 25 cm. Verso auf der Rahmenabdeckung ein altes handschriftliches Galerie- oder Sammlungsetikett mit Werkangaben.
2.400 €
Provenienz: Kunstauktionshaus Schloss Ahlden, Ahlden/Aller, Auktion im Mai 1982, Los 899. Seither deutsche Privatsammlung.



6103 Ansicht von Burg und Schloss Allstedt im Südharz.
Öl auf Leinwand. 47,5 x 60,5 cm. Unten links signiert „C. Hummel“.
2.400 €

Georg Heinrich Crola (1804 Dresden – 1879 Ilsenberg) 6104 Harzlandschaft im Morgenlicht. Öl auf Leinwand. 56 x 70 cm. Unten links signiert „Crola [18]78“, verso auf dem Keilrahmen bezeichnet „Andenken an meinen theuren alten Freund Crola, kurz vor seinem am 6. Mai 1879 erfolgten Tode zum Geschenk erhalten [Monogramm]“.
3.000 €

Gustav Friedrich Papperitz (1813–1861, Dresden)
6105 Wildbach im Gebirge.
Öl auf Papier, auf festen Karton aufgezogen. 50 x 40 cm. Rechts unten mit schwer leserlicher geritzter Datierung „30. Aug. 1858“.
1.500 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (verso mit dem Nachlassstempel).
Sammlung Oskar Schütz, Dresden (Schwiegersohn des Künstlers).
Rudolf Bangel, Frankfurt a. M., Sonderversteigerung Nachlass Gustav Friedrich Papperitz, Auktion Nr. 993 am 27. Januar 1920, Los 16 (mit Abb. auf Tafel II).
Privatsammlung Rheinland.
Der Landschaftsmaler und Radierer Gustav Friedrich Papperitz war in Dresden Schüler von Johan Christian Clausen Dahl. Anschließend studierte er in München bei Carl Rottmann und bildete sich zwischen 1838 und 1841 in Rom weiter. In der Folgezeit bereiste Papperitz Norwegen und Spanien, wo er 1851 längere Zeit verblieb. Zurück in seiner Heimatstadt Dresden tat er sich vor allem als Landschaftsmaler hervor.
Deutsch
6106 um 1840. Kleine Waldpartie in den Alpen. Öl auf dünnem Karton, auf Leinwand montiert und anschließend auf Karton kaschiert. 35 x 32,7 cm.
800 €
Die wunderbare Pleinair-Studie zeigt den Blick durch ein lichtes Gehölz auf ein sommerliches Hochtal in den Alpen. Die Nadellöchlein in den Ecken lassen erkennen, dass das Motiv direkt vor der Natur aufgenommen wurde, was die Unmittelbarkeit der Darstellung erklärt.


Carl Julius von Leypold (1806 Dresden – 1874 Niederlößnitz)
6107 Winterlandschaft mit verschneitem Bauerngehöft.
Öl auf Leinwand, doubliert. 44 x 54,5 cm. Unten rechts signiert „C Leypold“.
7.500 €
Der in Dresden geborene Carl Julius von Leypold studierte von 1820 bis 1829 an der Dresdener Kunstakademie in der Landschaftsklasse bei Johan Christian Clausen Dahl. Ab Mitte der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde der Einfluss von Caspar David Friedrich immer spürbarer und zwar in einem solchen Maße, dass einige von Leypolds Werken lange Zeit als Arbeiten von Friedrich galten. Leypold hatte eine besondere Affinität zur Darstellung von Winterlandschaften. Die zahlreichen Farbschattierungen des Schnees und der weißgrauen Wolken vor eisblauem Himmel evozieren sehr wirkungsvoll das Gefühl von klirrender Kälte im Winter.

Albert Heinrich Brendel (1827 Berlin – 1895 Weimar)
6108 Britischer Zweimaster am Pier in einer Flussmündung.
Öl auf Malpappe. 33,2 x 31,5 cm. Rechts unten in Rot signiert und datiert „A. Brendel. 9.1849“.
3.500 €
Albert Brendel machte seine ersten künstlerischen Schritte im Atelier des Landschaftsmalers Wilhelm Schirmer, der schon früh sein Talent erkannt hatte und ihn zum Besuch der Akademie aufforderte. Dort
widmete er sich unter anderem der Marinemalerei unter Wilhelm Krause und ging 1851 über Holland und die Normandie nach Paris, wo er bei Thomas Couture und Filippo Palizzi lernte. 1852 führten ihn seine Studienreisen nach Italien und Sizilien bevor er 1854 wieder nach Paris zurückkehrte und dort bis 1864 blieb. In dieser Zeit folgte er der Schule von Fontainebleau und verbrachte die Sommer in Barbizon mit Künstlern wie Théodore Rousseau, Jean-François Millet und Constant Troyon. Im Jahre 1869 kehrte er für einige Jahre nach Berlin zurück bevor er 1875 nach Weimar übersiedelte und eine Professur an der Weimarer Kunstschule antrat, deren Direktor er 1882 wurde.

Georg Friedrich Erhardt (1825 Winterbach/Remstal – 1881 Stuttgart)
6109 Kinderbildnis des Hans von Faber du Faur im schwarzen Samtanzug mit weißem Kragen Öl auf Leinwand. 49 x 39,5 cm. Um 1869.
1.200 €
Provenienz: Aus dem Besitz von Karin von Faber du Faur, Hamburg. Privatbesitz Hamburg.
Hans von Faber du Faur war der Enkel von Christian Wilhelm von Faber du Faur. Er wurde später selber Maler.

Carl Emil Baagøe (1829 Kopenhagen – 1902 Snekkersten)
6110 Ansicht des Hafens von Helsingør mit Schloss Kronburg.
Öl auf Leinwand. 32 x 47 cm. Unten links signiert und datiert „Carl Baagøe 1890“.
3.500 €
Carl Neumann (1833–1891, Kopenhagen)
6111 Abendstimmung am Meer.
Öl auf Leinwand. 35 x 51,7 cm. Unten rechts undeutlich signiert, verso auf dem Keilrahmen signiert und datiert „Carl Neumann 1874.“.
2.400 €
Vilhelm Kyhn (1819 Kopenhagen – 1903 Frederiksberg)
6112 Felsen auf Bornholm bei stürmischem Wetter. Öl auf Malpappe 23,4 x 35 cm. Um 1845-50.
1.800 €
Der Maler und Radierer Vilhelm Kyhn gehört zu den wenigen Künstlern der Kopenhagener Schule, die aufgrund ihres langen Lebens die Kunstentwicklung eines ganzen Jahrhunderts miterlebt und mitgestaltet haben. Nach seiner Ausbildung an der dortigen Akademie konzentrierte Kyhn sich um die Mitte der 1840er Jahre ganz auf die Landschaftsmalerei und fand seine Bildmotive während Reisen und Sommeraufenthalten auf Bornholm, in Jütland und Nordseeland. Ausgestattet mit einem Reisestipendium der Kopenhagener Akademie reiste Kyhn 1850-51 zu Studienzwecken nach Paris und Rom. Mit erstaunlicher Kontinuität war der Künstler von 1843 bis 1903 alljährlich auf den Ausstellungen der Akademie in Charlottenborg vertreten. Die vorliegende, souverän ausgeführte Naturstudie gehört dem frühen Schaffen des Künstlers an. Die Darstellung lebt von dem subtilen chromatischen Kontrast zwischen den Brauntönen der schroffen Felsen und die nuanciert abgestuften Grüngrau- und Grautönen der Brandung und des bleischweren Wokenhimmels. Mit pointiertem Strich hat Kyhn die Gischt der aufschäumenden Wogen charakterisiert und mit großer Ökonomie der Mittel ein Höchstmaß an visueller Prägnanz und ungekünsteltem Naturempfinden erzeugt.



Carl Maria Nikolaus Hummel (1821–1907, Weimar)
6113 Tal in den Tiroler Alpen mit kleinem See. Öl auf Leinwand, auf Karton kaschiert. 32,6 x 50,5 cm. Unten links signiert, datiert und undeutlich bez. „C. Hummel 1854 bei G...“.
1.800 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
Vilhelm Peter Carl Petersen (1812–1880, Kopenhagen)
6114 Castel Toblino am Tobliner See bei Trient. Öl auf Leinwand. 29 x 43 cm. Unten rechts monogrammiert (ligiert) und datiert „VP 1878“, verso auf dem Keilrahmen vom Künstler bezeichnet „Doblino, Arco-Dalen [Arco-Tal] / Syd Tyrol / Vilh. Petersen“.
1.500 €
Frederik Christian Jakobsen Kiærskou (1805–1891, Kopenhagen)
6115 Alpenlandschaft bei Untertein in Tirol. Öl auf Leinwand. 24 x 32,6 cm. Unten links signiert „F C Kierskou“.
600 €





Christian Morgenstern (1805 Hamburg – 1867 München)
6116 Blick über eine Alpenformation. Öl auf festem Papier, auf Karton kaschiert. 27,2 x 22,1 cm. Unten rechts signiert und unleserlich datiert „C. Morgenstern / 18[...]“.
1.500 €
Alexandre Charles Bertin (1855 Fécamp – 1934 Paris)
6117 „Une source dans les Alpes“: Quelle in den Alpen. Öl auf Leinwand. 32,7 x 46 cm. Unten rechts signiert „A. Bertin“, verso auf der Leinwand eigenh. bez. und signiert „Une source dans les Alpes / A. Bertin“.
1.500 €
Robert Kummer (1810–1889, Dresden)
6118 Alpenlandschaft mit Hochgebirgsjäger. Öl auf Leinwand. 104,5 x 105 cm (Darstellung im Rund). Unten rechts signiert und schwer leserlich datiert „Kummer 1870[?]“.
2.400 €
Provenienz: Kunstauktionshaus Schöninger & Co., München, Auktion am 9. Mai 1984, Los 237. Seither deutsche Privatsammlung.
Wir danken Dr. Elisabeth Nüdling für freundliche Hinweise und die Bestätigung der Autorschaft Carl Robert Kummers.



Franz Xaver von Hofstetten (1811 München – 1883 Waidhaus)
6119 Voralpenlandschaft mit einem Hirten und seinem Vieh.
Öl auf Leinwand, doubliert. 47,5 x 60,5 cm. Rechts unten signiert und datiert „v[on] Hofstetten 1840“.
2.400 €
Provenienz: Hampel, München, Auktion am 29. März 2009, Los 407 (mit Abb.). Privatsammlung Polen.
Franz Xaver von Hofstetten studierte zunächst an der Münchener Universität, begann aber schon relativ früh, sich der Landschaftsmalerei zu widmen. Er stellte erstmals 1830/31 seine Werke in einer Serie von sieben Landschaften im Rahmen der Ausstellung des Kunstvereins München aus. Von Hofstettens Landschaften sind meist von seinen Reisen in Südbayern und Österreich inspiriert.
Eduard Schleich d. Ä. (1812 Haarbach – 1874 München)
6120 Blick auf München bei aufziehendem Gewitter. Öl auf Leinwand. 39,5 x 49,5 cm.
9.000 €
Provenienz: Kurt Meissner, Zürich. Norddeutsche Privatsammlung. Über München ziehen schwere Gewitterwolken auf, ein erster Regenguss erfasst bereits die Altstadt. Das Gemälde zeigt den Blick von Großhesselohe im oberen Isartal auf die Stadt. Rechts liegt auf der Anhöhe die Wallfahrtskirche St. Anna, links erkennt man die Sendlinger Kirche.

Eduard Fischer (1852 Berlin – 1904 Chiemsee)
6121 Abendstimmung am Chiemsee.
Öl auf Leinwand. 20,5 x 40,4 cm. Unten rechts signiert und schwer leserlich datiert „Ed. Fischer [...6]“, verso auf dem Keilrahmen das Fragment eines älteren Künstleretiketts sowie ein maschinenschriftliches Etikett u.a. „Hier: Starnberger See / 1876“.
800 €
Fischer studierte zunächst an der Berliner Akademie und anschließend an der Kunstakademie in München. Ab 1874 zeigte er seine Bilder auf den Ausstellungen der Berliner Akademie und den Großen Berliner Kunstausstellungen. In München machte Fischer, ohne zu dessen Kreis zu zählen, die Bekanntschaft von Wilhelm Leibl. Um Leibl finanziell zu unterstützen, ließ er sich von ihm 1875 porträtieren (heute WallrafRichartz-Museum, Köln). Zur Blütezeit von Karl Raupp und Josef Wopfner kam Fischer 1894 erstmals an den Chiemsee, wo er ein großes Seegrundstück bei Gstadt erwarb. Die finanzielle Unabhängigkeit erlaubte ihm fortan, einzig zum Vergnügen zu malen. Zu Lebzeiten war Fischer kaum zu einem Verkauf seiner Bilder zu bewegen.
Abbildung Seite 116
Eduard Schleich d. J. (1853–1893, München)
6122 Alpenlandschaft mit Sennerhütten. Öl auf Leinwand. 44 x 74 cm. Unten links signiert (in die nasse Farbe geritzt) „E Schleich“, verso auf dem Keilrahmen mit dem Stempel des Rahmenmachers Anton Chramosta, Wien (zur Stadt Düsseldorf, Kärntner Str. 48).
1.800 €

Franz Skarbina (1849–1910, Berlin)
6123 „Ave Maria“: Frau mit Rosenkranz auf dem Friedhof in Schenna, Südtirol. Öl auf Leinwand. 69,5 x 98,5 cm. Unten links signiert „F. Skarbina“, in der Darstellung bezeichnet „Ave M[aria?]“ sowie verso von fremder Hand bezeichnet „Fr Skarbina / Ave-Maria“.
6.000 €
Provenienz: Hugo Helbing, München, Gemäldesammlung Prof. Albert Schmidt, München; ferner Gemälde aus den Nachlässen Prof. Franz Skarbina, Berlin [...] Kunstmaler F. Pernat , Auktion am 18. Oktober 1913, Los 203 („Ave Maria“). Berliner Privatbesitz.
In diesem atmosphärisch dichten Gemälde richtet Franz Skarbina seinen Blick auf eine stehend, betende Frau, die, einen Rosenkranz in den Hän-
den, einen Friedhofsweg in einem Südtiroler Dorf beschreitet. Der Bildtitel „Ave Maria“ verweist nicht nur auf das stille Gebet, sondern verleiht der gesamten Szene eine sakrale, fast liturgische Aura. Die Frau trägt eine einfache Südtiroler Tracht. Die Frontalität mit der sie dem Betrachter entgegentritt, lässt ihn an ihrer privaten Andacht teilhaben. Die Abendstimmung mit zartem Rosa am Himmel verleiht dem Bild eine melancholisch-harmonische Grundstimmung. Skarbina war nachweislich zwischen 1881 und 1896 mehrfach in Südtirol tätig. Aus dieser Phase stammen mehrere Friedhofsdarstellungen, darunter auch das kleinere Werk „Friedhof in Schenna“ (Bassenge Auktion 120, Los 8004). Wie in „Friedhof in Schenna“ wird auch hier die Frau aus einfühlsamer Distanz gezeigt, eingebettet in eine Landschaft, die trotz des Todesmotivs Trost und Ruhe ausstrahlt. Skarbinas Arbeiten aus dieser Schaffensphase stehen noch spürbar im Zeichen des von Adolph Menzel geprägten Realismus, doch offenbart sich zugleich bereits ein feines Gespür für Stimmungen, Übergänge und psychologische Tiefe - Merkmale, die sein Werk später zunehmend bestimmten.

Rudolf Heinrich Schuster (1848–1902, Markneukirchen i. Vogtland)
6124 Blick auf einen Felsenkeller.
Öl auf Papier, auf festem Karton kaschiert. 24,8 x 32,4 cm. Verso ein kleines Klebeetikett bez. „8. / Schuster / Markneukirchen“ sowie mit handschriftl. Angaben zur Provenienz.
1.500 €
Literatur: Ausst. Kat. Rudolf Schuster, 1848-1902, Sächsischer Kunstverein zu Dresden, Brühlsche Terrasse, 18. Februar - 15. März 1936, Nr. 6. Ausst. Kat. Rudolph Schuster. Sonderausstellung, Kunsthütte zu Chemnitz, 30. April - 1. Juni 1936, Nr. 6.
Maria Krause: Der Landschaftsmaler Rudolf Schuster (1848-1902), ein Schüler Ludwig Richters, Diplomarbeit Karl Marx Universität, Leipzig 1961 (Typoskript), Nr. 40.
Provenienz: Sophie Schuster (1865-1953, Cousine des Künstlers).
Ihr Bruder Paul Martin Schuster (gest. 1947), bzw. dessen Sohn Helmut Schuster (gest. 1984).
Bis 2013 im Besitz der Nachfahren.
6125 Wintertag in Görz (Gorizia) mit Blick auf die Julischen Alpen.
Öl auf Leinwand, alt auf Karton kaschiert. 20,5 x 32,2 cm. Unten rechts datiert „5/1 [18]93.“.
800 €
Literatur: Maria Krause: Der Landschaftsmaler Rudolf Schuster (18481902), ein Schüler Ludwig Richters, Diplomarbeit Karl Marx Universität, Leipzig 1961 (Typoskript), Nr. 275.
Provenienz: Paul Leander Schuster (1854-1919, Bruder des Künstlers).
Bis 2009 im Besitz der Nachfahren.
6126 Sandsteinfelsen im Harz bei Quedlinburg. Öl auf Papier, auf dünnem Karton kaschiert. 12,7 x 25,4 cm. Unten rechts in der nassen Farbe (schwer leserlich) bezeichnet „Quedlinburg Jul / 1870“, verso mit dem Etikett der Papierwarenhandlung Gebrüder Bretschneider, Marktneukirchen.
750 €
Literatur: Maria Krause: Der Landschaftsmaler Rudolf Schuster (18481902), ein Schüler Ludwig Richters. Diplomarbeit Karl Marx Universität, Leipzig 1961 (Typoskript), Nr. 20 (Abb.-Nr. 7).
Provenienz: Sophie Schuster (1865-1953, Cousine des Künstlers)
Bis 2007 deutsche Privatsammlung.




Buchholz (1849–1889, Weimar)
6127 Landschaft im Buchfart-Tal (oder bei Vollersrode) unweit Berka in Thüringen. Öl auf Malkarton. 21 x 30 cm.
600 €

Stanislaus Graf von Kalckreuth (1820 Koschmin (Kozmin)– 1894 München)
6128 Wassertümpel in bewaldeter Hügellandschaft. Öl auf Leinwand. 33,5 x 58,8 cm.
1.200 €
Provenienz: Kunsthandlung J.P. Schneider jr., Frankfurt a. M., 1962. Kalckreuth war zwischen 1846 und 1849 an der Kunstakademie Düsseldorf Schüler u. a. von Johann Wilhelm Schirmer. Ab 1848 unternahm er Studienreisen durch die Schweiz, die Pyrenäen, Frankreich und Italien, anfangs mit königlichen Reisestipendien. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. ernannte Kalckreuth 1852 zum Professor. 1858 zog er nach Weimar, wo er maßgeblich an der Gründung der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule beteiligt war und zu deren ersten Direktor ernannt wurde.
Von seinen Reisen brachte er zahlreiche Skizzen mit, um sie dann im Atelier zu klassischen Bildkompositionen zu verarbeiten. An der Wiedergabe atmosphärischer Phänomene interessiert, malte er vor allem menschenleere Gebirgslandschaften.
Peter Christian Thamsen Skovgaard (1817 Hammershus bei Ringsted, Seeland – 1875 Kopenhagen)
6129 Bäume im Park von Charlottenlund. Öl auf Leinwand. 40,5 x 33,7 cm. Unten rechts in der nassen Farbe unleserlich signiert und datiert „[...]46[?]“ sowie verso auf der Leinwand wohl eigenh. in roter Farbe undeutlich „P.C. Skovgaard“ sowie darüber noch einmal.
1.800 €
Ausstellung: P.C. Skovgaard: Udstilling i 150 aret for kunsterens fodsel [Ausstellung zum 150. Geburtstag des Künstlers], Skovgaard Museet, Viborg, 4. April - 4. September 1967, Nr. 172 (verso mit dem Stempel).
Bernardo Hay

(auch Bernard Hay, 1864 Florenz – 1931/1934 Capri)
6130 Küstenpartie auf Capri mit den Faraglioni-Felsen.
Öl auf Leinwand. 35,5 x 56,5 cm. Unten links signiert und bezeichnet „Bernard Hay Capri“. Um 1900.
1.500 €
Bernardo Hay, Sohn der in Florenz lebenden britischen Malerin Jane Benham Hay und des italienischen Malers Francesco Saverio Altamura, studierte in Neapel und lebte im Anschluss an sein Studium in Venedig, Florenz und Brügge. Ab den 1880er Jahren ließ er sich wieder in Neapel nieder. Capri hatte es Hay besonders angetan, er reiste viele Male auf die Insel und ließ sich später dort nieder. Auf Capri fand Hay auch eine Vielzahl an motivischen Impressionen für seine Gemälde.
Konstantin Gorbatoff (1876 Stavropol– 1945 Berlin)
6131 Venedig im Sonnenuntergang.
Öl auf Holz. 14 x 18 cm. Verso mit grünem Stift in Kyrillisch signiert „K. Gorbatof“. Wohl um 1912. 800 €
Nachdem Gorbatoff in den Jahren 1905-1911 an der Petersburger Kunstakademie studiert hatte, führte ihn ein Stipendium 1912 zunächst nach Rom. Einer Einladung Maxim Gorkis folgend ging er dann nach Capri, wo sich der Schriftsteller im Exil befand. Bevor er 1922 Russland endgültig verließ, besuchte er den 84-jährigen Künstlerkollegen Ilja Repin und ließ sich dann 1926 in Berlin nieder, wo er bis 1945 - unterbrochen von zahlreichen Reisen - lebte.
Karl Theodor Boehme (1866 Hamburg – 1939 München)
6132 Brandung an der Küste.
Öl auf Leinwand. 56 x 70,3 cm. Unten links signiert „Karl Boehme“.
1.500 €



Bartolomeo Pagani (italienischer Künstler, tätig in Rom 2. Hälfte 19. Jh.)
6133 Karneval in Rom auf der Via del Corso. Öl auf Leinwand, doubliert. 101 x 75 cm. Unten links signiert „B. Pagani“, verso mit altem Galerieetikett des chilenischen Kunsthandels „Mori - Casa de arte“.
4.500 €

Französisch
6134 1906. Blick auf den Torre dell‘Orologio auf dem Markusplatz in Venedig. Öl auf Leinwand, doubliert. 75 x 57 cm. Unten rechts betitelt „Torre dell:Orologio Venise“ und undeutlich signiert „E de Ruvert [?] [1]906“.
1.200 €
Deutsch
6135 1858. Bucht mit römischen Fundamenten im Golf von Neapel. Öl auf Papier, kaschiert auf Leinwand. 29,5 x 42,3 cm. Unten rechts datiert „18 mai [18]58“.
1.600 €




Hermann Effenberger (1842 Lauban, Schlesien – 1911 Rom)
6136 Blick auf eine italienische Küstenstadt (Ligurien?).
Öl auf Malkarton. 36,7 x 48 cm. Unten links monogrammiert und bezeichnet „HE Rom“, verso bez. „[...]berger 1911 geschenkt / Wally Effenberger, März 1917“.
1.200 €
Karl Theodor Boehme (1866 Hamburg – 1939 München)
6137 Fischerboote am Strand von San Fruttuoso an der ligurischen Küste.
Öl auf Leinwand, auf Malkarton kaschiert. 42,5 x 54 cm. Am Unterrand signiert und datiert „Karl Boehme“ und „S. Fruttuoso, d. 13.4.1925“.
1.200 €
Provenienz: Privatsammlung Norddeutschland.
Die letzte große Reise nach Ligurien in den Jahren 1924/25 führte Karl Boehme an die Bucht San Fruttuoso bei Camogli/Genua an der italienischen Riviera di Levante. In dem vorliegenden Gemälde zeigt sich Boehmes viel gepriesenes Talent für die brillante Darstellung von Wasser und Küstenlandschaften. Friedrich Furchheim bemerkt 1916 zum Werk Boehmes: „... [er hat] viele Bilder gemalt, [...] die sich durch besonderen Farbenreiz auszeichnen. Er versteht es wunderbar, die wahre Farbe des Meeres, der Felsen im Sonnenglanz und ihre Spiegelung wiederzugeben [...]“.
Karl Theodor Boehme
6138 Stürmische See an der Küste bei Biarritz. Öl auf Leinwand, auf Platte kaschiert. 43 x 55 cm. Am Unterrand signiert, datiert und bez. „Karl Boehme. Biarritz, d. 21. Dec. [19]09“.
1.800 €

Max Merker (1861–1928, Weimar)
6139 Brunnen im Park der Villa Borghese. Öl auf Leinwand. 61 x 84 cm. Unten rechts signiert, datiert und bezeichnet „M. Merker Roma [19]01“, verso auf dem Keilrahmen wohl eigenhändig signiert „Max Merker Weimar“ sowie zwei Etiketten handschriftl. alt bez. „Max Merker / Weimar Gartenstrasse 21II / No 11 / Brunnen in der Villa Borghese (Roma)“ und „Brunnen i.d. Villa Borghese / Rom December / Max Merker / Weimar“ und ein Etikett des „Kunstsalon Gerstenberger Weimar 871“
1.800 €
Skandinavisch
6140 1904. Kleine Prinzessin im Wald mit einem Holzspielzeug.
Öl auf Leinwand. 61 x 50,5 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „WDA 1904“.
1.200 €


Italienisch
6141 19. Jh. Landschaft mit Zypressen in der Umgebung Genuas.
Öl auf Holz. 12 x 7,6 cm. Verso bez. „near Genova“.
400 €

Friedrich Ballenberger (1865 München – bis 1930 nachweisbar)
6142 Sizilianischer Hochzeitsschleier.
Öl auf loser Leinwand, am Oberrand auf Untersatzkarton montiert. 51 x 40,9 cm.
800 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (verso zweifach der Nachlassstempel).
an Spuren kreativen Schaffens und alltäglichen Lebens seines Bewohners ist. Im Zentrum der Komposition steht ein mit rotem Samt bezogener Stuhl, über den ein gestreiftes Tuch lässig drapiert ist - als hätte der Künstler seinen Platz nur für einen Moment verlassen.
Rubens Santoro (1859 Mongrassano – 1941 Neapel)
6143 „Primo dipinto“: Schreibtisch im Atelier eines Künstlers.
Öl auf Papier, kaschiert auf Malkarton. 36,1 x 26,2 cm. Unten links auf einem kleinen Zettel, montiert in die Darstellung bezeichnet und signiert „Primo dipinto di Rubens Santoro“.
4.500 €
Mit feinem Gespür für Details und Atmosphäre gewährt Rubens Santoro in diesem Werk einen intimen Einblick in ein Künstleratelier, das reich
Auf dem Arbeitstisch im Stil Napoléon III. liegt ein geöffneter Kasten, aus dem eine Oboe hervorlugt - ein subtiler Verweis auf die Verbindung von bildender Kunst und Musik. Daneben befinden sich eine kleine Metallkanne, vermutlich zum Erhitzen von Wasser, eine Porzellankanne mit Untertassen sowie eine Glasflasche. Besonders ins Auge fällt eine in einem prächtigen Goldrahmen präsentierte Druckgraphik. Unter dem Tisch lehnt ein Gemälde mit der Ansicht der Aqua Claudia bei Rom. Jede Ecke wird hier offensichtlich als Stauraum genutzt.
Die rechte Wand ist reich bestückt mit weiteren Gemälden, Malutensilien und Staffeleien. Farbpaletten und kleine Porträts geben Einblick in das vielseitige künstlerische Wirken. Ein auffälliger Wandteppich mit der Darstellung einer idealisierten Landschaft suggeriert einen illusionistischen Ausblick ins Freie – ein kunstvoller Trompe-l’œil-Effekt, der die imaginative Dimension des Raumes betont.
Rubens Santoro, bekannt für seine detailverliebten Veduten Venedigs und stimmungsvollen Genreszenen, beweist auch hier seine Meisterschaft in der Darstellung von Textur und Raumkomposition. Das Atelierinterieur ist nicht nur eine Hommage an die Kunst und das schöpferische Milieu des 19. Jahrhunderts, sondern zugleich ein stilles, vielschichtiges Stillleben voller Symbolik und kunsthistorischer Anspielungen – eine Einladung an den Betrachter, auf Entdeckungsreise zu gehen.


Ernst Carl Eugen Koerner (1846 Stibbe/ Westpreußen – 1927 Berlin)
6144 Mondnacht an der Küste von Zakynthos in Griechenland.
Öl auf Leinwand. 84 x 126 cm. Unten links signiert und datiert „Ernst Koerner 1880“, verso zwei handschriftliche Adressetiketten des Künstlers, das Etikett des Vereins Berliner Künstler sowie mehrfach gestempelt „Ad. Hess Berlin“.
1.800 €
Literatur: Friedrich von Boetticher: Malerwerke des 19. Jahrhunderts, Nr. 44.
Ausstellung: IV. Allgemeine Deutsche Kunstausstellung, Düsseldorf 1880, Nr. 416.
William-Adolphe Bouguereau (1825–1905, La Rochelle)
6145 Umkreis. „Jeunesse et l‘Amour“ (Allegorie der Jugend und der Liebe).
Öl auf Leinwand. 60 x 27 cm.
9.000 €
Das Werk wohl aus dem Umkreis Bouguereaus ist eine kleinere Version von dessen bekanntem Gemälde „Jeunesse et l‘Amour“, das Bouguereau im Jahr 1877 ausgeführt hat und welches sich jetzt im Musée d‘Orsay in Paris befindet.


Henrik Gamst Jespersen (1853 Undløse Sogn – 1936 Frederiksberg)
6146 Heidelandschaft an der Küste im Sonnenuntergang.
Öl auf Leinwand. 36 x 56 cm. Unten links signiert „Henrik J.“.
1.200 €
Adolf Hohneck (1812 Dresden – 1879 Oberlößnitz bei Dresden)
6147 Ruinen am Wasser, im Vordergrund heimkehrende Fischer.
Öl auf Leinwand. 47 x 59 cm. Verso auf dem Keilrahmen die Reste eines handschriftl. Etiketts mit dem Namen des Künstlers.
900 €
Thorald Brendstrup (1812 Sengeløse – 1883 Kopenhagen)
6148 Landschaft mit Gehöft, umgeben von Bäumen und einem Teich.
Öl auf Papier, kaschiert auf Leinwand. 15 x 20 cm. Unten links monogrammiert „Th B“.
1.200 €





Ulrich Hübner
(1872 Berlin – 1932 Neubabelsberg)
6149 Wäscheplatz.
Öl auf Leinwand. 60 x 75,5 cm. Unten links signiert „Hübner“, verso auf dem Keilrahmen mit zwei Ausstellungsetiketten, sowie in grauem Stift bez. „Ulrich Hübner Wäsche...Travemünde“. Um 1913.
1.800 €
Literatur: Simone Westerhausen: Ulrich Hübner - Stadt, Land, See. Tradition und Rezeption impressionistischer Landschafts- und Marinemalerei im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Dissertation, Berlin 2020 (online), WVZ-Nr. 154.
Provenienz: Berliner Privatsammlung.
Ulrich Hübner
6150 An der Mole: Auslaufende Boote bei stürmischer See.
Öl auf Malkarton. 50 x 63 cm. Unten links signiert „Ulrich Hübner“. Um 1901.
1.800 €
Literatur: Simone Westerhausen: Ulrich Hübner - Stadt, Land, See. Tradition und Rezeption impressionistischer Landschafts- und Marinemalerei im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Dissertation, Berlin 2020 (online), WVZ-Nr. 19.
Provenienz: Leo Spik, Berlin, Auktion am 11. Oktober 2001, Los 146. Berliner Privatsammlung.
Bei dem Gemälde handelt es sich möglicherweise um eine Vorstudie zu dem Werk „Ausfahrender Dampfer“ (Westerhausen 18), das 1901 entstand.
Paul Wilhelm Tübbecke (1848 Berlin – 1924 Weimar)
6151 „Auf den Dünen bei Coserow auf Usedom“: Fischerhütten an der Küste bei Koserow. Öl auf Malkarton. 26,6 x 51,6 cm. Unten links signiert „P. Tübbecke“, verso alt bez. „Paul Tübbecke. Weimar. / Auf den Dünen b[ei] Coserow auf Usedom“.
3.000 €

Ulrich Hübner (1872 Berlin – 1932 Neubabelsberg)
6152 Im Garten. Öl auf Leinwand. 81 x 100 cm. Unten rechts signiert und datiert „Ulrich Hübner 1913“.
3.000 €
Literatur: Simone Westerhausen: Ulrich Hübner - Stadt, Land, See. Tradition und Rezeption impressionistischer Landschafts- und Marinemalerei im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Dissertation, Berlin 2020 (online), WVZ-Nr. 153.
Provenienz: Karl & Faber, München, Auktion am 7. Juni 2013, Los 965. Berliner Privatsammlung.
Hermann Linde (1863 Lübeck – 1923 Arlesheim)
6153 Markttag in Lübeck. Öl auf Leinwand. 50,3 x 71 cm. Unten rechts signiert „H. Linde“. Um 1889. 4.000 €
Nach seinem Kunststudium zog es Hermann Linde in die weite Welt. Europa ließ er zunehmend hinter sich, um ferne Länder zu bereisen und neue Eindrücke zu gewinnen. Erste Studienreisen führten ihn über Sizilien nach Ägypten, später nach Tunesien. Von 1892 bis 1895 lebte Linde in Indien, bevor er zu weiteren Reisen durch den asiatischen Raum und Europa aufbrach.

Die Begegnungen mit fremden Kulturen und Lebensweisen prägten sein künstlerisches Schaffen nachhaltig. Die Eindrücke dieser Reisen finden sich in zahlreichen Werken wieder und machen ihn als „Orientmaler“ bekannt. Neben seinem Interesse für das Fremde wandte sich Linde ab 1910 verstärkt spirituellen Themen zu. Nach einer Begegnung mit Rudolf Steiner schloss er sich der anthroposophischen Bewegung an. Steiner beauftragte ihn unter anderem mit der Ausmalung des ersten Goetheanums. Doch noch vor seiner Hinwendung zum Orient und zur Anthroposophie, zu Beginn seiner Laufbahn, entstanden Werke, in denen Linde seiner Heimatstadt Lübeck künstlerisch nah bleibt. Mindestens zwei Gemälde, darunter das vorliegende Werk sowie ein weiteres, 1889 datiertes Bild, zeigen den Markt auf dem Lübecker Rathausplatz. Sie entstanden vermutlich während seiner Studienzeit an den Akademien in Dresden und Weimar.
Im Zentrum des Bildes stehen zwei Frauen im Gespräch: eine Händlerin in blauer Tracht mit markantem grünem Schleier und Strohhut, und
eine schwarz gekleidete ältere Dame. Die schwarze Kleidung und die Interaktion der beiden Frauen lassen vermuten, dass die Besucherin gerade einen Verlust erlitten hat und trauert, so legt die Marktfrau ihr zur Beileidsbekundung die Hand auf den Arm. Vor ihnen breitet sich der mit Sorgfalt arrangierte Verkaufstisch mit Möhren, Kohlköpfen, Rüben, Eiern und anderen bäuerlichen Produkten auf. Der Platz wird von weiteren Marktbesuchern, Händlern und Passanten belebt, während im Hintergrund ein spätmittelalterlicher Backsteinbau die Stadtkulisse bildet.
Lindes malerischer Stil ist realistisch und detailgenau, dabei jedoch nie dokumentarisch nüchtern. Vielmehr gelingt es ihm, durch feine Farbnuancen und präzise gesetzte Lichtstimmungen eine atmosphärisch dichte Szene zu schaffen, die tief in das bürgerlich-alltägliche Leben Lübecks um 1889 eintaucht, ein Werk, das sowohl Lindes technische Meisterschaft als auch seine emotionale Verbundenheit mit der Heimatstadt eindrucksvoll belegt.

Ernst Albert Fischer-Cörlin (1853 Körlin an der Persante – 1932 Berlin)
6154 Pottascheherstellung im Schwarzwald. Öl auf Leinwand. 56 x 75,5 cm. Unten rechts signiert „AFischer-Coerlin“.
1.500 €
Albert Fischer-Cörlin, der sich in seinen Gemälden häufig dem ländlichen Leben und der Arbeit widmete, griff diese historischen Bezüge auf. Seine Darstellungen der Köhler zeigen nicht nur das Handwerk selbst, sondern auch die raue und entbehrungsreiche Existenz dieser Berufsgruppe. In seinen Werken wird deutlich, wie sehr der Alltag der Menschen mit der Natur und den wirtschaftlichen Entwicklungen der Zeit verflochten war.
Otto Flecken (1860 Düsseldorf – 1925 Frankfurt am Main)
6155 Abschied am Meer. Öl auf Malpappe. 31,9 x 38,3 cm. Unten links signiert und datiert „Otto Flecken 1905“.
800 €
Der Landschafts- und Vedutenmaler, Illustrator und Plakatkünstler Karl Otto Leonard Flecken lebte seit spätestens 1869 mit seinen Eltern in Frankfurt am Main. Dort war er von 1875 bis 1877 Schüler des Bildhauers Gustav Kaupert. Im Anschluss wechselte er zur Malerei und besuchte die Städelschule, die er 1882 „stillschweigend“ wieder verließ. Zwischen 1886 und 1889 unternahm er Reisen nach Norwegen und malte nordische Landschaften. Als Illustrator arbeitete er von 1885 bis 1901 für die „Kleine Presse“, eine in Frankfurt herausgegebene Stadtzeitung, aber auch für die Zeitschrift „Die Gartenlaube“.
Eugen Kampf (1861 Aachen – 1933 Düsseldorf)
6156 Flandrische Dorfstraße im Herbst. Öl auf Leinwand. 31 x 44 cm. Unten links signiert und datiert „E. Kampf [19]04“.
300 €
Beigegeben ein signiertes Gemälde von Robert Friedersdroff: Herbstlandschaft am Fluss (Öl auf Leinwand, 53 x 73 cm).




Christian Vigilius Blache (1838 Århus – 1920 Kopenhagen)
6157 „Stranden ved Hirtshals“: Wolkenverhangener Himmel vor der Küste Jütlands.
Öl auf Leinwand. 40,1 x 60,7 cm. Unten links in der nassen Farbe signiert und datiert „Chr. Blache 1916“ sowie verso auf dem Keilrahmen bezeichnet „Prof. Chr. Blache Stranden ved Hirtshals“.
1.500 €
Søren Christian Bjulf (1890 Løgstør – 1958 Roskilde)
6158 Der Gammel Strand im Zentrum von Kopenhagen mit St. Nikolai im Hintergrund.
Öl auf Leinwand. 67 x 54,2 cm. Unten rechts signiert.
600 €

Gustav Vermehren (1863–1931, Kopenhagen)
6159 Ved Kaffen - Interieur mit junger Frau, die Kaffee am gedeckten Tisch zubereitet Öl auf Leinwand. 30 x 22 cm. Unten links der Mitte signiert und datiert „G. Vermehren 1890“.
1.800 €
Peter Ilsted (1861 Saxkobing – 1933 Kopenhagen)
6160 Bildnis einer jungen Frau mit Haube. Öl auf Leinwand. 44 x 35,8 cm. Links über der Schulter monogrammiert (ligiert) und datiert „18 PI 85“.
1.500 €


Dänisch
6161 um 1920. Blühender Echinopsis Kaktus. Öl auf Leinwand. 48,7 x 39 cm. Verso mit einem Etikett in dän. Sprache handschriftl. bez. „Malet af Frk. Ebeling [...]“.
1.000 €
Hans Hilsøe (1871 Thystrup – 1942)
6162 Interieur mit Sonnenstrahlen. Öl auf Leinwand. 67,2 x 57,4 cm. Unten rechts signiert „H. HILSØE“, verso der Stempel des Kopenhagener Kunsthandels Knud Juhline.
3.000 € 6161


Holger Lübbers
(1850–1931, Kopenhagen)
6163 Segelschiffe im Øresund bei aufziehendem Gewitter.
Öl auf Leinwand. 52,5 x 78,5 cm. Unten links signiert „HLübbers“.
2.400 €
Hans Michael Therkildsen (1850 Lystrup – 1925 Kopgenhagen)
6164 Junge mit Fischreuse am Strand. Öl auf Leiwand. 44 x 53,5 cm. Unten rechts etwas undeutlich monogrammiert „M TH“.
3.500 €
Im warmen Licht eines sommerlichen Nachmittags sitzt ein barfüßiger Junge am Rand eines Fischerbootes. Konzentriert hält er eine Fischreuse in der Hand. Der Blick des Knaben ist nachdenklich gesenkt, sein Körper entspannt. Hans Michael Therkildsen, ein Vertreter der dänischen Realismusbewegung im späten 19. Jahrhundert, fand seine Motive häufig im ländlichen Leben seiner Heimat. Mit präzisem Auge für Licht und Textur, aber auch mit einem feinen Gespür für Stimmung, gelingt es ihm, scheinbar beiläufige Szenen in leise Erzählungen zu verwandeln.



6165 zugeschrieben. Bergarbeiterdorf in der Borinage. Öl auf Leinwand. 56 x 90 cm. Rechts unten monogrammiert „CM“.
1.200 €
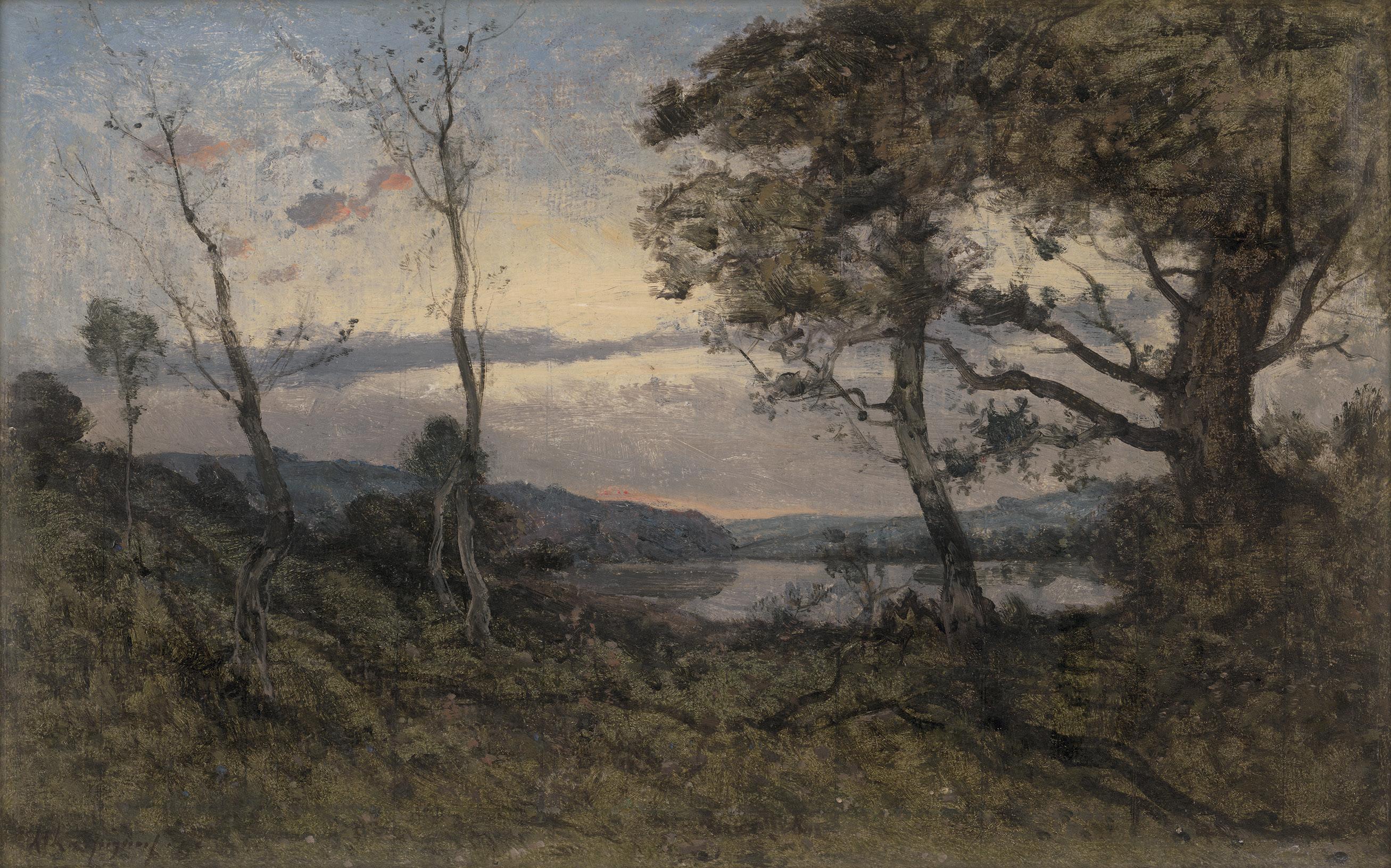
Constantin Meunier
6166 Der Steinbrecher (Le carrier).
Bronze mit bräunlicher Patina. H. ca. 59 cm; Br. 23 cm. Auf dem Sockel mit geritzter Signatur und dem Atelierstempel „Atelier 59 Rue l‘Abbaye“. Um 1896/1900.
2.400 €
Literatur: Vgl. Kat. Constantin Meunier 1831-1905, Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Ernst Barlach Haus, Hamburg 1998.
Unter dem Sockel mit einem alten Klebeetikett des „Kunstsalon Emil Richter, Dresden“ (1848-1930). Der Kunstsalon Emil Richter wurde 1848 in Dresden gegründet und befand sich im 1. Stock an der Prager Straße 13. Die Kunsthandlung war bis zu ihrer Schließung 1930 wesentlich an der Gestaltung des kulturellen Lebens in Dresden beteiligt und präsentierte die neuesten Strömungen der Kunst vom Impressionismus bis zu den Expressionisten. 1898 wurde erstmals ein monographischer Katalog des belgischen Bildhauers Constantin Meunier präseniert.
Der Stiel des Hammers mit einem Bruch.
Henri Joseph Harpignies (1819 Valenciennes – 1916 Saint-Privé)
6167 Abendstimmung über einer Flusslandschaft. Öl auf Karton, auf Holz kaschiert. 30 x 47 cm. Unten links signiert und undeutlich datiert „H Harpignies [...]“, verso auf dem Holz mit Klebeetikett.
3.200 €
Provenienz: Sotheby‘s, London, Auktion am 16. November 1994, Los 106. Norddeutsche Privatsammlung.

6168 Sonnenstrahlen in den Gassen am Montmartre, Paris.
Öl auf Leinwand. 57 x 42 cm. Unten rechts bezeichnet und signiert „PARIS PEDER KNUDSEN“.
800 €
Dänisch
6169 um 1830. Sitzender männlicher Akt in Rückenansicht, auf einen Stab gestützt. Öl auf Leinwand. 52,7 x 42 cm.
1.800 €
Zum Pflichtprogramm junger Kunsteleven in Kopenhagen gehörte das Malen nach lebendigem Modell in C. W. Eckersbergs Klasse. Besonderen Feinsinn beweist unser Künstler hier bei der tonal fein abgestuften Modellierung der muskulösen Rückenpartie und der differenzierten Wiedergabe von Hell-Dunkeleffekten.


Französisch
6170 um 1880. Bildhauer in seinem Atelier. Öl auf Holz. 50,5 x 33 cm.
3.000 €

Louis Braun (eigentl. Ludwig, 1836 Schwäbisch Hall – 1916 München)
6171 Heerführer des Dreissigjährigen Krieges mit Kommandostab.
Öl auf Holz. 18,3 x 12,7 cm. Unten links monogrammiert „LB“ (ligiert), verso bezeichnet „Louis Braun an seinen / Freund Fritz Schierholz / zum Geburtstag 1887. / München 27. April 1887“.
400 €
Louis Braun, seit 1889 Professor an der Münchner Akademie, zählt zu den berühmtesten deutschen Militärmalern. Die vorliegende Ölstudie, die möglicherweise Wallenstein oder Tilly darstellt, schenkte er dem befreundeten Frankfurter Bildhauer Fritz Schierholz (1840-1894) zu dessen 47. Geburtstag.
Carl Max Kruse (1854–1942, Berlin)
6172 Junge Liebe. Bronze, auf Mamorsockel. H. 29,5 (ohne Sockel); 2 cm (Sockel). Mit dem Stempel der Gießerei ”Akt[ien]Ges[ellschaft] vorm H. Gladenbeck & Sohn, D2468”. 1895/97.
600 €


Adalbert Begas (1836 Berlin – 1888 Nervi)
6173 Im Hochsommer.
Öl auf Leinwand. 110,5 x 80,5 cm. Unten rechts signiert und datiert „Adalbert Begas. [18]80.“. Verso auf dem Keilrahmen das Etikett des Vereins Berliner Künstler sowie Reste alter Ausstellungsetiketten.
4.500 €
Literatur: Friedrich von Boetticher: Malerwerke des 19. Jahrhunderts, Nr. 22.
Georg Kaspar Nagler: Allgemeines Künstler-Lexikon, Leipzig 1885, Bd. 3, S. 306.
Ausstellung: 4. Allgemeine Deutsche Kunstausstellung, Düsseldorf 1880, Nr. 52.
55. Ausstellung der Königlichen Akademie der Künste, Berlin 1881, Nr. 41.
50. Ausstellung Kunstverein Hannover, Hannover 1882.
Werke von Adalbert Begas und Wilhelm Riefstahl. Sonder-Ausstellung in der Königlichen National-Galerie zu Berlin, Berlin 1888, Nr. 28. Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers.
1924 Privatsammlung München, seither in Familienbesitz.

James Wells Champney (1843 Boston – 1903 New York)
6174 Im Garten.
Öl auf Holz. 30,3 x 40,2 cm. Verso die Reste des Adressetiketts des Künstlers, ein Ausstellungsetikett der American Art Association sowie das Etikett des Künstlerbedarfs M. T. Wynne, New York.
1.800 €
Östereichisch
6175 19. Jh. Indische Azalee (Rhododendron simsii). Öl auf Papier, alt auf festen Karton aufgezogen. 25,9 x 31 cm.
600 €
Betzy Marie Petrea Libert (1859 Kopenhagen – 1944)
6176 Studienblatt mit violettem Wiesenstorchschnabel und weißer Tulpe. Öl auf grau grundiertem Malkarton. 13,7 x 17,3 cm.
450 €
Provenienz: Nachlass der Künstlerin, Kopenhagen. Beigegeben von derselben vier weitere Ölstudien mit Rosen.



Hans Hermann (tätig Anfang 20. Jh)
6177 Orientalische Fischer mit Booten am Meeresstrand mit Blick über eine Bucht auf eine weiße Stadt (Tunis?).
Öl auf Leinwand, doubliert. 37 x 58 cm. Unten links signiert „Hans Hermann“.
900 €
Jules-Joseph Lefebvre (1834 Tournan-en-Brie – 1912 Paris)
6178 Orientalischer Akt mit rotem Schleier und Tamburin.
Öl auf Holz, an vier Seiten abgefast. 27,3 x 13,1 cm. Oben links signiert „Jules LeFebvre“.
4.000 €
Lefebvre studierte ab 1852 in Paris Malerei bei Léon Cogniet, schließlich wechselte er an die renommierte École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris. 1855 stellte er seine Werke erstmals auf dem Pariser Salon aus. Ab 1864 mit zunehmenden Erfolg - bis 1898 wurden dort insgesamt 72 Werke gezeigt. 1870 wurde er zum Offizier der Ehrenlegion ernannt, im selben Jahr nahm er eine Anstellung als Lehrer an der Académie Julian auf. Unter seinen zahlreichen Schülern seien stellvertretend Fernand Khnopff und Lesser Ury genannt. Lefebvre konzentrierte sich ab jener Zeit vor allem auf Porträts und Akte. Die lebensgroße (187 x 124 cm) Hauptfassung unseres Gemäldes befindet sich seit 2005 in der National Gallery of Victoria, Melbourne (Inv.-Nr. 2005.237). Das Bild wurde zuerst auf dem Pariser Salon 1872 mit dem Titel „La Cigale“ (Die Zikade) als allegorische Illustration einer berühmten Fabel von Jean de La Fontaine mit dem Titel „Die Ameise und die Zikade [auf Deutsch: die Heuschrecke]“ präsentiert. In La Fontaines Geschichte verbringt die Zikade den Sommer mit Singen und Spielen und macht sich dabei über die fleißige Ameise lustig, die Vorräte anlegt und ihr Haus für den Winter vorbereitet. Mit den ersten Winterwinden wird die Zikade unvorbereitet und frierend obdachlos. Eine weitere, wesentlich kleinere Version des wohl sehr erfolgreichen Motives (44,5 x 22 cm) wurde 1997 auf dem Londoner Auktionsmarkt unter dem Titel „Une beauté orientale“ erfolgreich versteigert. Beide Versionen unterscheiden sich von unserem Gemälde nicht nur durch die Andersfarbigkeit des Schleiers, sondern vor allem durch das Fehlen des hier an die Wand gelehnten Tamburins.




Josef Adolf Lang (1873–1936, Wien)
6179 Römische Nacht: Liebespaar bei Vollmond im Garten mit lachender Pansherme.
Öl auf Malkarton. 17,5 x 35,5 cm. Unten links signiert „J... Adolf Lang“.
900 €
Sigmund Lipinsky (1873 Graudenz – 1940 Rom)
6180 Circe verwandelt die Gefährten des Odysseus in Schweine.
Öl auf Malpappe. 22,1 x 30,8 cm.
1.200 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers, seitdem in dessen Familienbesitz.
1919 läßt sich Lipinsky endgültig in Rom nieder. Er gründet in der legendären Künstlerstraße Via Margutta die Sigmund-Lipinsky-Akademie, eine Mal- und Zeichenschule in der Nähe der Spanischen Treppe, dem Epizentrum der deutschsprachigen Künstlerkolonie. An erster Stelle
steht für ihn dort das Zeichnen nach dem lebenden Modell, insbesondere dem weiblichen Akt: „[…] der Naturalismus seiner Akte ist kaum zu überbieten, und man kann schon sagen, daß seit dem Tode Greiners, dem Lipinsky nahegestanden hat, nur wenige als Aktzeichner neben ihm bestehen dürften.“ (Richard Braungart: Deutsche Exlibris und andere Kleingraphik der Gegenwart, München 1922). Zwischen 1923 und 1929 entsteht eine achtteilige Radierfolge zu Homers Odyssee. Die Folge gilt als die höchste künstlerische Leistung Lipinskys als Radierer, die er mit hunderten von Zeichnungen vorbereitete (vgl. Bassenge, Auktion 123, 30. Mai 2024, Los 6345 und 6346). Die vorliegende Ölstudie wird im Zusammenhang mit diesem Projekt entstanden sein. Beigegeben: Ölstudie einer Dame in weißem Kleid mit Bratsche (recto), Ölstudie eines Rosenstraußes in Glasvase (verso) auf Malpappe, 28,7 x 24,2 cm.
Alexander Rothaug (1870–1946, Wien)
6181 In Arkadien: Kleine Insel mit Tempel, Zypressen und einem Flötenspieler. Öl auf Leinwand. 15 x 24 cm.
2.400 €

Émile Gallé (1846–1904, Nancy)
6183 Kleine Vase mit Iris. Farbloses Glas, violett überfangen, umlaufend mit geätztem Dekor. Unten auf der Wulst in Hochätzung bez. „Gallé“. H. 13 cm.
350 €
Fritz Schwimbeck (1889 München – 1977 Friedberg bei Augsburg)
6184 Schleichender Panther. Gips (?), schwarz-silber glasiert. 8,5 x 6,5 x 36 cm; Sockel 3,5 x 8,5 x 37,5 cm. Auf der Unterseite des Sockels signiert „F. Schwimbeck fec.“. Um 1920.
750 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers, Privatbesitz München (laut den jetzigen Besitzern).
Abbildung Seite 192
Gabriel Argy-Rousseau (1885 Meslay-le-Vidame – 1953 Paris)
6182 „Faunes et Nymphes“ - Vase. Polychrome Pâte-de-verre, formgeschmolzen. H. 22,4 cm. In der Wandung unterhalb des Faunes signiert „G. ArgyRousseau“ (vertieft formgeschmolzen), auf dem Boden nummeriert. Um 1923.
3.500 €


6185
Ferdinand Knab (1837 Würzburg – 1902 München)
6185 Italienische Villa im Abendrot. Öl auf Holz. 51,3 x 41 cm. Unten rechts signiert und datiert „18 F. KNAB 98/2“.
4.000 €
Provenienz: Larcada Gallery, New York (Etikett verso).
Adolf Hiremy-Hirschl (1860 Temesvár – 1933 Rom)
6186 Liegender Akt am Meeresufer. Öl auf Leinwand. 45 x 94,5 cm.
3.000 €
Abbildung Seite 164




Ferenc Paczka
(auch Franz, 1856, Monor/ Ungarn – 1925, Berlin)
6187 Sinnender Frauenakt.
Öl auf Leinwand. 106 x 81,5 cm. Links unten signiert „Paczka F.“, verso auf dem Keilrahmen auf Fragmenten alter Klebezettel bezeichnet „Paczka, Ferenz“ und „(Ab) schied der [...]“.
1.500 €
Der in Ungarn geborene Ferenc Paczka studierte an der Kunstakademie in München unter Alexander Strähuber, Rudolph von Seitz und Wilhelm von Diez. Im Jahre 1874 ging er nach Paris, um sich dort dem Zirkel um Mihály von Zichy anzuschließen. Im Jahre 1882 siedelte Paczka nach Rom über, wo er viele Jahre lebte und auch seine Ehefrau, die Künstlerin Cornelia Paczka-Wagner, Tochter des berühmten Wirtschaftswissenschaftlers Adolf Wagner, kennenlernte. Gemeinsam siedelten sie im Jahre 1895 nach Berlin über, eröffneten ein erfolgreiches Atelier und schufen viele ihrer Kunstwerke auch gemeinsam. Enge Freundschaften pflegten sie unter anderem mit Max Klinger und Karl Stauffer-Bem.
Adolf Frey-Moock (1881 Jona, St. Gallen – 1954 Egnach)
6188 „Liebeserwachen“ - Pan und Nymphe. Öl auf Holz. 60 x 50 cm. Unten links signiert „A Frey Moock“, verso wohl eigenh. in schwarzem Pinsel nochmals signiert und betitelt „A. Frey Moock Liebeserwachen“.
1.200 €
Melchior Lechter (1865 Münster – 1937 Raron, Kanton Wallis)
6189 „Wiesenlandschaft“: Rote Wolken. Öl auf Malkarton, auf Pappe montiert. 18,5 x 16,5 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „ML 1930“.
600 €
Literatur: Ausst. Kat. Melchior Lechters Gegen-Welten. Kunst um 1900 zwischen Münster, Indien und Berlin. Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster, Münster 2006, S. 275. Provenienz: Sammlung Sonja Schön-Beetz (1965-2017), München. Deren Auktion bei Nosbüsch & Stucke, Berlin, am 23.-24. Februar 2018, Los 1235. Privatsammlung Berlin.
Diese Landschaft mit vom Wind getriebenen Bäumen unter einem dramatischen Himmel, der von roten und blauen Wolkentürmen durchzogen ist, stammt von Melchior Lechter, dessen Werk die zu Beginn des 20. Jahrhunderts virulenten Fragen nach der Einheit von Kunst, Leben und Spiritualität anschaulich macht. Der Künstler schreibt: „Landschaften der Seele sind es eigentlich die man schafft: die Natur ist nur immer das Sprungbrett, von dem man sich aufschwingt in die Zaubergärten der Seele“. Die vorliegende, kraftvolle Komposition ist eine eindrucksvolle Umsetzung dieser Gedanken.



Edmund Steppes (1873 Burghausen – 1968 Deggendorf)
6190 „Löwenzahn“ - Frühlingslandschaft im Jura. Tempera auf Leinwand, vom Künstler auf Spanplatte aufgezogen. 37,8 x 60,3 cm. Unten rechts signiert und datiert „E Steppes / 1928“, verso grün grundiert und in rotbrauner Farbe eigenhändig bezeichnet sowie malerisch verziert „Löwenzahn/ 1928 / Edmund Steppes / München / Franz-Josefstr. 27“, sowie mit Bleistiftannotationen.
1.200 €
Provenienz: Privatsammlung Süddeutschland.
Arthur von Kampf (1864 Aachen – 1950 Castrop-Rauxel)
6191 Landschaft mit Sandsteinfelsen. Öl auf Malkarton. 56,5 x 76 cm. Unten links signiert „A. Kampf“.
1.500 €
Provenienz: Aus dem Besitz Albert Südekum, Berlin.
Anton Konrad Schmidt (1887–1974, Wien)
6192 Adoleszens (Junge Frau auf Frühlingswiese). Öl auf Leinwand. 70 x 56 cm. Unten links signiert „Ant. K. Schmidt“.
4.500 €

Julius Seyler (1873–1958, München)
6193 Mitternachtssonne über den Lofoten.
Öl auf Malpappe, verso: Feldlandschaft. 45,2 x 69,2 cm. Unten links sowie verso unten rechts jeweils signiert „J. Seyler“, verso auf dem Rahmen Reste eines Ausstellungsetiketts der Münchner Sezession.
1.200 €
Ausstellung: Kunstausstellung der Münchener Secession, Mai-Oktober 1912, Nr. 180 („Mitternachtssonne“).
Godfred Christensen (1845–1928, Kopenhagen)
6194 Sonnenuntergang bei Landbolyst in Nordjütland. Öl auf Papier, auf Leinwand kaschiert. 25,8 x 36,2 cm. Unten links monogrammiert und bezeichnet „G C N Landbolyst“.
800 €
Vilhelm Kyhn (1819–1902, Kopenhagen)
6195 Sommerliche Landschaftspartie mit wolkenreichem Himmel. Öl auf Leinwand, doubliert. 29 x 39 cm.
1.200 €



Julius Jacob d. J. (1842–1929, Berlin)
6196 zugeschrieben. Die Potsdamer Vorstadt vom Wasser aus gesehen mit Blick auf die Nikolaikirche. Öl auf Leinwand. 68,5 x 34 cm. Um 1900.
1.200 €
Emil Pottner (1872 Salzburg – 1942 Treblinka)
6197 Lastkähne am Kai auf der Havel in Petzow bei Potsdam.
Öl auf Leinwand. 60,5 x 75,5 cm. Links unten in Rot signiert „E. Pottner.“.
2.400 €
Emil Pottner wurde als Kind einer jüdischen Schauspielerfamilie in Salzburg geboren und studierte ab 1891 an der Münchner Akademie, schloss sein Studium aber an der Akademie in Berlin ab. Ab 1904 war er Mitglied der Berliner Secession und zählte bald zum engeren Kreis um Max Liebermann. Innerhalb der Secession galt er neben Struck, Spiro u. a. als eigentlicher Vertreter impressionistischer Prinzipien. Pottner war vor allem als Maler, Graphiker und Keramiker aktiv und pendelte zwischen seinem Keramik-Atelier in Berlin-Charlottenburg und seinem Landhaus in Petzow an der Havel bei Potsdam, wo auch das vorliegende Gemälde entstanden sein wird. Nachdem ihm schon 1933 von den Nationalsozialisten ein Arbeitsverbot auferlegt wurde, wurde er 1942 nach Theresienstadt deportiert und schließlich im Vernichtungslager Treblinka ermordet.
Margarete von Zawadzky (1889–1964, Berlin)
6198 Segelboote auf dem Wannsee. Öl auf Leinwand, doubliert.54,5 x 45,8 cm. Signiert unten rechts „M.v.Zawadzky“.
600 €
Margarete von Zawadsky studierte an der Berliner Akademie und war von 1916-1930 mehrfach auf der großen Berliner Kunstausstellung vertreten.



Walter Moras (1856 Berlin – 1925 Harzburg)
6199 Abendstimmung an der norwegischen Küste. Öl auf Leinwand. 40,5 x 25,7 cm. Unten rechts signiert „W. Moras“.
1.200 €
Wilhelm Trübner (1851 Heidelberg – 1917 Karlsruhe)
6200 Lichtung im Wald. Öl auf Leinwand, auf Malpappe kaschiert. 35,2 x 27,5 cm. Unten links monogrammirt „W. T.“.
900 €


Oskar Moll
(1875 Brieg/Schlesien – 1947 Berlin)
6201 Märkischer Waldsee im Herbst. Öl auf Leinwand. 56 x 67 cm. Unten rechts signiert „Oskar Moll“. Um 1897.
4.500 €
Literatur: Siegfried und Dorothea Salzmann: Oskar Moll, Leben und Werk, München 1975, Nr. 90.
Provenienz: Kuhlmann und Struck, Auktion im Mai 1994. F. von Rosenberg, Hamburg.
Leo Spik, Berlin, Auktion 594 am 12. Oktober 2000, Los 210 mit Farbtafel 17.
Privatsammlung Berlin.

Viktor Markewitsch (1881 Zgierz – 1932 Frankfurt am Main)
6202 Winterliche Straße in Prag (Die Kleinseite mit St. Nikolaus in Hintergrund?).
Öl auf Leinwand. 41,8 x 42,5 cm. Rechts unten signiert und datiert „Viktor Markewitsch [19]14“.
800 €
Franz Skarbina (1849–1910, Berlin)
6203 Pferdedroschke vor der Mohrenkolonade im verschneiten Berlin.
Öl auf Leinwand, auf Malkarton kaschiert. 44 x 32,5 cm. Oben rechts signiert „F. Skarbina“, verso auf dem Karton (eigenh. ?) bez. „F. Skarbina /Mohren Kolonade“. Um 1903.
7.500 €
Provenienz: Ehemals Sammlung Baronin von Puttkamer, Ostpreußen. Berliner Privatbesitz.
Die noch heute bestehende Mohrenkolonade in Berlin-Mitte ist das einzige noch existierende Stück eines ursprünglich vierteiligen Torzugangs über den Festungsgraben in die Friedrichstadt. Die Architektur entwarf Carl Gotthard Langhans um 1787. Die über den gebogenen Endarkaden liegenden Figuren versinnbildlichen die Flussgötter der vier Erdteile. Hinter den Arkadenbögen befanden sich um 1900 kleine Ladenlokale und Büros. Die wartende Droschke, die in einen dicken Mantel gehüllte Dame auf dem Trottoir, die vereisten Dächer und die Schneehaufen am Straßenrand tragen zur Stimmung eines typischen Winternachmittags in Berlin bei. Skarbina hat die Mohrenkolonade ein weiteres Mal in einem Ölgemälde, das in das Jahr 1903 datiert, festgehalten (s. Margit Bröhan: Franz Skarbina, Berlin 1996, Nr. 61).



Julius Sergius von Klever (auch Yuliy Yulevich Klever, 1850 Dorpat – 1924 St. Petersburg)
6204 Winterlandschaft.
Öl auf Malkarton. 22,5 x 16,5 cm. Unten links in kyrillisch signiert, unten rechts datiert „1896“, verso auf dem Rückdeckel mit dem Stempel von „P. G. Malmquist / Helsinki - Helsingfors[...]“.
3.500 €
Provenienz: Kunsthandel P. G. Malmquist, Helsinki.
Richard Friese (1854 Gumbinnen/Ostpreußen (heute Gusev) – 1918 Bad Zwischenahn)
6205 Wisent im winterlichen Wald der Rominter Heide.
Öl auf Malpappe. 17,4 x 25,1 cm. Unten links datiert und signiert „5.9. [18]87 / R. Friese“.
2.400 €
Die Rominter Heide ist ein Hügel-, Wald- und Heidegebiet im heutigen Südosten der russischen Oblast Kaliningrad sowie der nordöstlichen polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Traditionell war die Rominter Heide ein beliebtes Jagdgebiet der preußischen Landesherren. Mitten in der Heide stand das von Kaiser Wilhelm II. im norwegischen Stil errichtete Jagdschloss Rominten. Richard Friese und später Gerhard Löbenberg (1891-1967) waren häufige Gäste der Heide und malten ausführlich die dortige Tierwelt. - Angeregt und gefördert durch Paul Meyerheim studiert Friese an der Kunstakademie Berlin. Er reüssiert ab Anfang der 1880er Jahre mit kleinformatigen Wildtier-Darstellungen. 1883 ist er Mitarbeiter von Anton von Werner am Berliner Panorama der Schlacht von Sedan. 1898/99 zählt er zu den Mitbegründern der Berliner Secession. 6205

Vilém Kreibich (1884 Zdice – 1955 Prag)
6206 Vor der Abfahrt: Dampfende Lokomotive am winterlichen Gleis.
Öl auf Leinwand. 88 x 126 cm. Unten rechts signiert und datiert „Kreibich 1912“, verso auf dem Keilrahmen mehrfach der Stempel des tschechischen Malereibedarfs Emil E. Dousa.
2.400 €
Provenienz: Erworben 2002 auf der 33. Westdeutsche Kunstmesse, Köln (Etikett verso).
Deutsche Privatsammlung.

Erwin Heckmann (deutscher Maler und Kunstpädagoge, 1881–1963)
6207 Selbstbildnis mit weißer Kappe. Öl auf Leinwand, kaschiert auf Holz. 50,3 x 38,5 cm. Unten links signiert und datiert „E. Heckmann [19]09“.
1.200 €


Hugo Duphorn (1876 Eisenach – 1909 Kärnesjö (Schweden))
6208 Vorfrühling im Wald von Hasbruch bei Oldenburg.
Öl auf Malkarton. 42,7 x 33,6 cm. Verso in Bleistift signiert und bezeichnet „No 7 Hugo Duphorn Via Amalieneiche“ (in brauner Feder nachgezogen).
750 €
Paul Mishel (1862 Danzig – 1929 Fangschleuse bei Berlin)
6209 Landschaft bei Gdingen (Gdynia) in Ostpreußen. Öl auf Malkarton. 22,6 x 32,7 cm. Unten links signiert und datiert „Gdingen Aug [18]85 P Mishel“.
1.200 €
Paul Mishel war ein Meisterschüler des Landschaftsmalers Eugen Bracht Motive für seine stimmungsvolle Malerei fand der Künstler auf seinen Reisen durch Deutschland, Großbritannien, Schweden und Norwegen. Ab etwa 1890 lebte er in Friedrichshagen bei Berlin. Zu seinen Freunden zählten unter anderem die Mitglieder des Friedrichshagener Dichterkreises um Wilhelm Bölsche und Bruno Wille.

Petras Kalpokas (1880 Miskine, Litauen – 1945 Kaunas)
6210 Baumbestandener Bachlauf im Vorfrühling. Öl auf Karton. 31,8 x 40,2 cm. Signiert und datiert unten links „P. KALPOKAS 1905.“. 8.000 €
Im Werk von Petras Kalpokas dominiert die lyrische, spätimpressionistische Landschaft. Er wurde im heutigen Bezirk Biržai in Litauen auf einem Bauernhof im Dorf Miškinë in der Nähe von Kvetkai im Gouvernement Kaunas (bis 1918 zum Russischen Reich zählend) geboren. Von 1890 bis 1895 besuchte er das Gymnasium im lettischen Jelgava und wurde zuletzt von der Schule verwiesen, als er eine Karikatur seines
Lehrers auf einen Ofen zeichnete. 1898 zog Kalpokas nach Odessa, wo er zwei Jahre lang Kunst studierte, um im Anschluss mit Hilfe des Barons M. Kansdagen sein Studium in München fortzusetzen. 1907 wurde er Mitglied der Münchner Secession und nahm regelmäßig an deren Ausstellungen teil. Während des Ersten Weltkriegs gingen bei der Vorbereitung zu einer Einzelausstellung mehr als 120 seiner Gemälde verloren. Bis 1920 reiste Kalpokas durch die Schweiz, Ungarn und Italien. Nach seiner Rückkehr nach Litauen begann Kalpokas zu unterrichten. 1928 veranstaltete er eine große Einzelausstellung in Kaunas. 1930 folgte die Veröffentlichung eines Lehrbuches über Maltechniken, 1945 wurde Kalpokas zum Professor berufen.

6211
Französisch
6212 um 1860. „La chêne“ - Studie einer bewachsenen Eiche.
Öl auf Holz. 22,7 x 19,3 cm. Verso mit einer alten Zuschreibung an Achille Etna Michallon (1796-1822, Paris).
750 €
Ausstellung: Ausst. Kat. Portrait d‘une forêt: Promenade en forêt de Fontainebleau avec les peintres de l‘école de Barbizon, Musée en herbe, Paris, Januar 1988, Nr. 43 (laut rückseitigem Etikett, dort betitelt).
Provenienz: Aus der Sammlung Barrie-Chevalier.
Alexander Demetrius Goltz (1857 Püspökladány – 1944 Wien)
6211 Blühende Obstbäume in der Wachau.
Öl auf Leinwand. 42,5 x 34 cm. Verso auf dem Keilrahmen mit dem Stempel des Rahmenmachers Anton Chramosta, Wien (zur Stadt Düsseldorf, Kärntner Str. 48).
400 €
Provenienz: Aus dem Nachlass des Künstlers (mit dessen Nachlassstempel auf dem Keilrahmen).
Nachlass Robert Seitschek (akad. Maler, 1910 Wien - 1990 Kufstein).


Marie Egner (1850 Bad Radkersburg – 1940 Maria Anzbach)
6213 Frühlingsblumen und Herbstlaub. Öl auf Leinwand. 28 x 40 cm. Auf dem Keilrahmen mit dem Stempel des Künstlerbedarfs Alois Ebeseder, Wien. 6.000 €
Provenienz: Kunsthandlung Bessler, Augsburg (dort erworben 1979, Galerieaufkleber verso).
Süddeutsche Privatsammlung.
Joseph Wopfner (1843 Schwaz in Tirol – 1927 München)
6214 Zwei Mädchen am Fenster. Öl auf Leinwand. 54 x 70 cm. Unten rechts signiert „J. Wopfner“.
1.200 €


Maria Slavona (1865 Lübeck – 1931 Berlin)
6215 Strauss mit Ranunkeln, Dahlien und Kapuzinerkresse auf einem Tisch mit gestreiftem Tischtuch. Öl auf Holz. 61 x 50 cm. Rechts unten signiert „Slavona“.
3.000 €
Maria Slavona wurde als Marie Dordette Caroline Schorer in Lübeck als Tochter eines angesehenen Apothekers geboren. Bereits mit 17 Jahren begann sie eine Ausbildung in Malerei in Berlin. Da ihr die Kunstakademie als Frau verschlossen blieb, ging sie zunächst an die private Malschule Eichler und dann an die Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums. Dort studierte sie bei Karl Stauffer-Bern, der großen Einfluss auf ihre künstlerische Entwicklung hatte. Sie setzte ihr Studium an der Damenakademie des Münchner Kunstvereins fort, wo sie mit Käthe Kollwitz zusammen lernte und erste Bekanntschaft mit dem französischen Impressionismus machte. Im Jahre 1890 ging sie mit dem däni-
schen Künstler Willy Gretor, den sie in Lübeck kennen gelernt hatte, nach Paris und berichtete später: „Hier ging mir eine neue Welt auf. Die ersten Besuche im Louvre betäubten mich fast. Aber von den Schulen, die ich sah, war ich enttäuscht, dort gefiel mir nichts. Ich entschloß mich, allein zu arbeiten und Rat und Urteil nur im Kreise einiger junger gleichgesinnter Freunde, fast alles Dänen und Norweger, zu suchen.“ (zit. nach Margrit Bröhan: „Maria Slavona“, in: Das verborgene Museum, Berlin 1987, S. 164). In Paris gab sie sich den Künstlernamen Maria Slavona und zog mit Gretor und mehreren Künstlerfreunden, wie Rosa Pfäffinger, Ivana Kobilca und Hans Dahlerup in einer Wohngemeinschaft zusammen. Inspiriert von Nietzsches Ideen zur Freien Liebe ergaben sich in der jungen Gemeinschaft mehrere Affären zwischen Willy Gretor und Rosa Pfäffinger, Ivana Kobilca und Slavona, wobei sowohl Pfäffinger als auch Slavona von Gretor schwanger wurden. Slavonas Tochter war die spätere Schauspielerin Lilly Ackermann. Als Gretor 1894 die Wohngemeinschaft verließ, hinterließ er Pfäffinger und Slavona

mehrere Gemälde des damals noch unbekannten Vincent van Gogh. Die beiden jungen Künstlerinnen unterstützten sich gegenseitig und auf Slavonas Initiative wurde die erste van Gogh-Ausstellung in Paris organisiert, auf der Slavona den Kunsthändler Otto Ackermann kennenlernte, den sie später heiratete. Obwohl sie schon in Paris große Anerkennung als Künstlerin erfahren hatte und mit Persönlichkeiten wie Camille Pissarro verkehrte, siedelte sie 1895 zunächst nach Berlin und 1906 nach Lübeck über, wo sie ein offenes Haus führte, in dem Persönlichkeiten wie Edvard Munch, Walter Leistikow, Max Liebermann oder Rainer Maria Rilke und Käthe Kollwitz verkehrten. In der Spätphase ihres Schaffens widmete sie sich in ihrem Ammerländer Landhaus vermehrt dem Stillleben und der Landschaft. Als Mitglied erst der Berliner Secession und später der Freien Secession unter Max Liebermann fand sie auch in Deutschland breite Anerkennung, ihr Werk geriet aber nach ihrem Tod zunächst in Vergessenheit, bis Margrit Bröhan sie im Jahre 1981 wieder als bedeutende Künstlerin des deutschen Impressionismus würdigte.
Gustav Lehmann (1883 Braunschweig –1914 Prien am Chiemsee)
6216 Dorf in winterlicher Vorgebirgslandschaft. Öl auf Leinwand. 61 x 49,9 cm. Uten rechts signiert und datiert „G. Lehmann / [19]14.“.
1.800 €
Der jung verstorbene Gustav Lehmann schuf zunächst Porträts in altmeisterlicher Manier oder Landschaften in kühlen Farben, bis ihn der von Claude Monet tief beeindruckte und bestens mit der Avantgarde der Franzosen vertraute Professor der Münchner Kunstakademie Charles Johann Palmié ermutigte, zu leuchtenden Farben zu greifen und wie die Neoimpressionisten zu arbeiten. Lehmann gehörte bald zur Braunschweiger und Münchener Bohème. Im Juli 1914 starb er nach einer Blinddarmoperation.


Französisch
6217 1880er Jahre. Pariser Boulevard im Regen. Öl auf Malpappe. 45,9 x 37,8 cm. Verso mit dem Stempel des Künstlerbedarfs „Tableaux Rey & Perrot Paris, 51, Rue de la Rochefoucauld“.
2.400 €
Der 1875 von Alexandre Rey begründete Künstlerbedarfsladen trug den Namen Rey & Perrot in den Jahren 1878-1891. Dort bezog in seinen Pariser Jahren unter anderen auch Vincent van Gogh seine Malutensilien - sein Bruder Theo wohnte ab Ende der 1880er Jahre nur wenige Schritte vom Laden entfernt. Aber auch auf Gemälden anderer Impressionisten findet sich der Stempel von Rey & Perrod: Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, Van Gogh, Caillebotte - und anderen Künstlern wie Médéric Bottin, Élie Delaunay, André Devambez, Jean-Louis Forain, Albert Lebourg, Stanislas Lépine, Eugénie Venot d‘Auteroche und Géo Weiss.
François Charles Cachoud (1866 Chambéry, Savoyen – 1943 Saint-Alban-de-Montbel)
6218 Häuschen in den Savoyen bei Vollmond. Öl auf Leinwand. 46 x 38,5 cm. Unten rechts signiert „FChachoud“, verso mit dem Stempel des Pariser Künstlerbedarfs L. Besnard (Stempel von 1901-1912).
800 €
Cachoud studierte an der Pariser Akademie der bildenden Künste bei Jules-Élie Delaunay und Gustave Moreau. Von Anfang an konzentrierte er sich auf stimmungsvolle Landschaften im Lichte der Dämmerung oder bei Mondschein. Diesem Genre blieb er sein ganzes Leben lang treu. Nur selten schuf er Porträts und Stillleben. 1891 debütierte er auf dem Salon des artistes français und wurde mit dem Preis der Troyon-Stiftung ausgezeichnet. Zwei Jahre später erhielt er einen Preis der Akademie von Savoyen.

Osteuropäisch
6219 1917. Interieur mit lesender Dame. Öl auf Leinwand. 49,9 x 36,4 cm. Rechts unten in Rot bezeichnet „Blozéna / Ma 25 1917“.
1.200 €
Dänisch
6220 1901. Studie mit weißen Iris. Öl auf Leinwand. 27,2 x 19,6 cm. Unten rechts monogrammiert und datiert „VH / 1901“.
750 €


Deutsch
6221 um 1920. Selbstbildnis vor der Staffelei. Öl auf Malkarton. 67,5 x 49,5 cm.
900 €
Österreichisch
6222 um 1920. Sonnenflecken: Stillleben mit Nelken im Glas.
Öl auf Malkarton. 31 x 20 cm. Oben links undeutlich signiert (in die nasse Farbe geritzt) „Molarice L“ (?).
450 €

Hans Unger (1872 Bautzen – 1936 Dresden)
6223 Weiblicher Halbakt mit Rotwild und Papagei. Öl auf Malpappe, verso: Waldweg. 41,3 x 33,4 cm. Verso unten links in Rot bezeichnet „Hans UNGER“. 1.200 €
Hans Unger, ursprünglich als Dekorationsmaler am Königlichen Hoftheater Dresden ausgebildet, gilt als einer der wichtigsten Dresdner Künstler des Jugendstils und Symbolismus. Nachdem er in den frühen 1890er Jahren unter Friedrich Preller d. J. und Herrmann Prell die Dresdner Akademie absolviert und 1897/98 die Académie Julian in Paris unter Tony Robert-Fleury und Jules-Joseph Lefebvre besucht hatte, galt er schnell als einer der interessantesten Künstler Dresdens. Bekannt wurde er in den ersten Jahren vor allem durch seine dem Jugendstil verpflichteten „arkadischen Frauen“. Schon im Jahre 1899 erhielt er auf der dortigen Deutschen Kunstausstellung einen eigenen Saal zur Präsentation seiner Gemälde, den er ganz in Lila und Schwarz gestaltete. Eine enge Freundschaft verband ihn unter anderem mit den Künstlern Oskar Zwintscher und Sascha Schneider. In Ungers Werk sind die Frauengestalten keine Individuen, sondern stets Sinnbilder für die Kraft und Rätselhaftigkeit des Weiblichen.

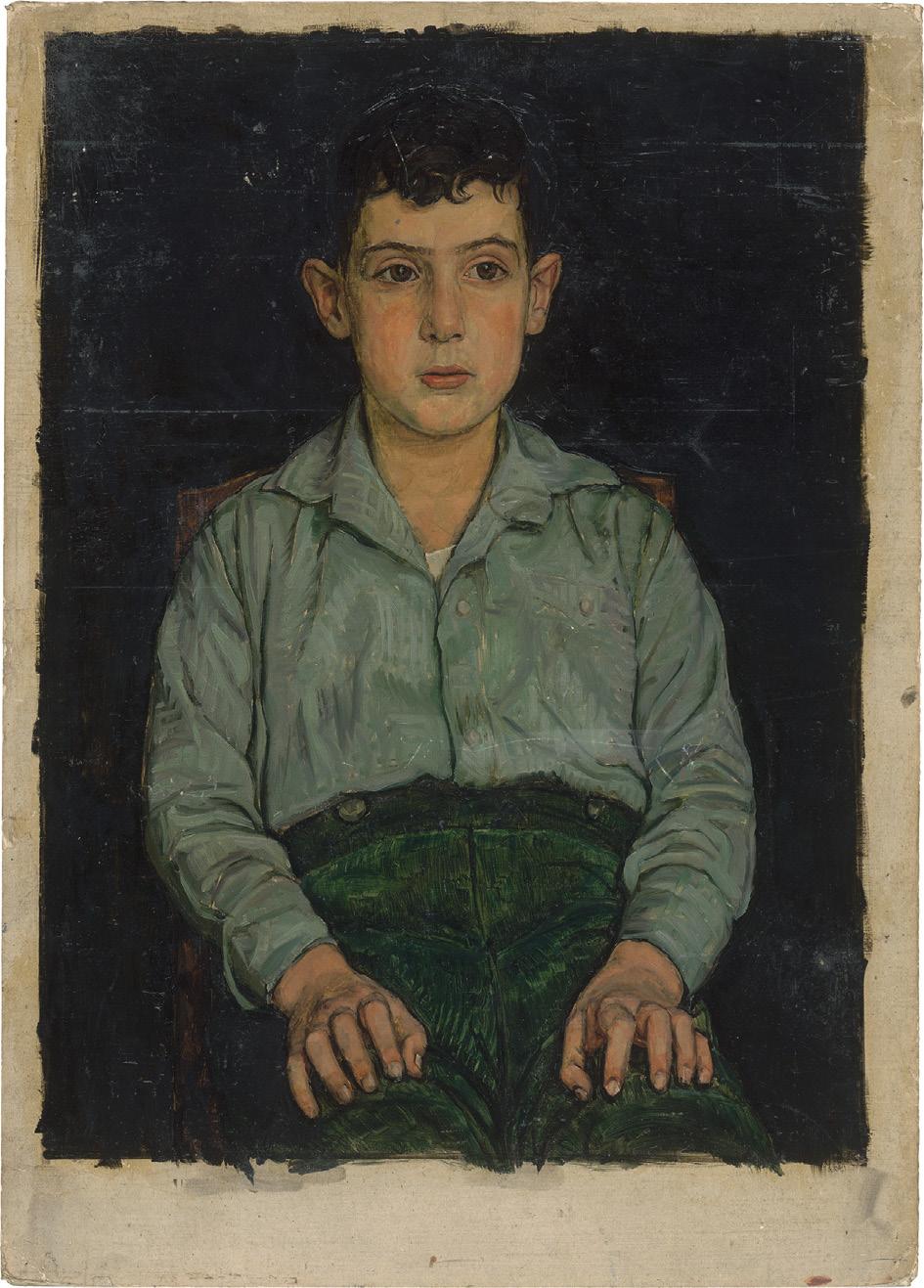
6224 um 1920. Bildnis eines Knaben im grünen Hemd Öl auf Malkarton. 69,5 x 50 cm.
800 €
Ruhig sitzt das Kind auf dem Stuhl, um sich vom Maler portraitieren zu lassen. Der Blick des Knaben verliert sich in unbestimmter Ferne. Die Sensibilität, mit der das Kind dargestellt ist, lässt vermuten, dass es dem Maler sehr nahe stand und es sich möglicherweise dabei um den Sohn des Künstlers handelt, dessen Identität uns leider unbekannt ist.

Hans Frank (1884 Wien – 1948 Salzburg)
6225 Interieur mit Tulpenbouquet. Öl auf Malpappe. 65 x 49,5 cm. Unten rechts signiert „Hans Frank“, verso auf der Malpappe mit braunem Papieretikett mit handschriftl. Bez. „V.Z. 482“. Um 1930. 1.200 €
Provenienz: Nach Auskunft des Vorbesitzers aus dem Nachlass des Künstlers.

Hans Frank
6226
Stillleben mit Akelei, Kapuzinerkresse und tränenden Herzen.
Öl auf Malpappe. 55 x 42,5 cm. Unten rechts signiert und datiert „Hans Frank 45“, verso auf der Malpappe mit braunem Papieretikett mit handschriftl. Bez. „V.Z. 696“.
1.200 €
Provenienz: Nach Auskunft des Vorbesitzers aus dem Nachlass des Künstlers.
Theodor Baierl (1881–1932, München)
6227 Porträt des Architekten Robert Vorhölzer. Öl auf Holz. 50,2 x 39,8 cm. Rechts unten signiert „THEODOR BAIERL“, oben mittig bezeichnet und datiert „ROBERT VORHÖLZER 1923“, verso auf der Tafel und auf dem Rahmen mit Adressetiketten von Tilde Vorhoelzer, verso Stempel des Malbrettmachers G. Oberndorfer.
7.500 €
Theodor Baierl studierte an der Münchner Akademie u.a. bei Carl von Marr und Franz von Stuck. Er war Mitglied der Münchner Secession. Bemerkenswert ist seine Vorliebe für die Kunst der Frührenaissance, von der er sowohl in seiner Technik als auch thematisch sehr stark beeinflusst war. Es zeigen sich Einflüsse der frühen Italiener und Niederländer, bei Bildern wie „Der Ritter und der Tod“ (Privatsammlung) aber auch eine eindeutige Hommage an Albrecht Dürer. Auch in unserem Porträt sind deutliche Reminiszenzen an die frühneuzeitliche Porträtkunst Albrecht Dürers, Hans Mielichs und Hans Holbeins d. J. erkennbar. Baierl nahm in den 1920er Jahren regelmäßig an den Kollektivausstellungen des Münchner Glaspalastes teil, wobei in den Ausstellungsberich-
ten seine altmeisterliche und überlegene Technik bewundert wird. Der Dargestellte Robert Vorhoelzer (1884-1954) gilt als der bedeutendste Vertreter moderner Architektur in Süddeutschland vor dem Nationalsozialismus. Nach dem Studium an der Technischen Hochschule München bei Friedrich von Thiersch und Theodor Fischer wurde er 1920 Leiter der Bauabteilung der Münchner Oberpostdirektion. Diese unterlag nicht dem Genehmigungsverfahren der konservativen bayerischen Baubehörden und konnte deshalb moderne Bauten in Bayern errichten. Ab Ende der 1920er Jahre entwarf er zahlreiche entschieden moderne und funktionale Postbauten im Stil der Neuen Sachlichkeit. Zu diesen zählen beispielsweise die Münchner Postämter Tegernseer Landstraße („Tela-Post“) in München-Obergiesing, das Postgebäude am Goetheplatz oder das Postamt am Harras in München-Sendling. 1930 wurde Vorhoelzer als Professor an die Technische Hochschule München berufen. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde diese Architektur als „undeutsches, jüdisches und bolschewistisches Bauen“ verunglimpft und dem vorgeblichen „Baubolschewisten“ der Lehrstuhl entzogen. 1939-1941 lehrte er an der Akademie in Istanbul. Nach Kriegsende konnte er seinen Münchner Lehrstuhl wieder einnehmen und wurde 1946 sogar Rektor der Hochschule.






Peter Götz Pallmann (1908–1966, Berlin)
6228 Venedig: Belebte Straßeszene mit Alimentari, Sartoria und Tabacchiladen an einem Kanal.
Öl und Mischtechnik auf Hartfaserplatte. 50 x 65 cm. Unten rechts auf der Brücke signiert „P. G. Pallmann“ sowie vereinzelt in der Darstellung bez. .
1.500 €
6229 Seitenkanal in Venedig mit Blick auf die Kuppel von Santa Maria della Salute.
Öl und Mischtechnik auf Hartfaserplatte. 50 x 65 cm.
Unten rechts signiert (geritzt) „P. G. Pallmann“.
1.800 €
6230 Straße in Lille.
Öl und Mischtechnik auf Hartfaserplatte. 36 x 55 cm. Unten rechts signiert (geritzt) „P. Götz Pallmann“ sowie verso wohl erneut signiert und betitelt „P. Götz Pallmann / Strasse im Lille“.
1.200 €
6231 Nächtliches Treiben am Berliner Kurfürstendamm.
Öl auf Hartfaserplatte. 42,8 x 68 cm. Unten rechts signiert „P. Götz Pallmann“.
2.400 €
Das Gemälde stellt das rege Treiben auf dem hell erleuchteten Berliner Kurfürstendamm auf Höhe der Uhlandstraße dar. Gut zu erkennen ist links das heutige Maison de France mit der berühmten Paicos-ZigarettenWerbung, sowie zur Rechten die Leuchtreklamen des Roxy und des Haus Uhland, sowie der U-Bahnhof und die noch bis 1954 dort fahrende Straßenbahn.

6232 Profilrahmen, Niederlande 17. Jh., Nussholz, furniert, profilierte Sichtleiste, glatte Platte. 800 €
Lichtes Maß: 16,5 x 13,5 cm. Profibreite: 5,3 cm.
6233 Kassettenrahmen, Niederlande 17. Jh., Obstholz, eboniert, glatte Sichtleiste, aufsteigender Karnies, Rundstab, glattes Profil, ansteigende Leiste, glatter Abschluss.
1.200 €
Lichtes Maß: 17 x 12,5 cm.
Profilbreite: 8,2 cm.


6234 Wellenleistenrahmen, Niederlande/Venedig 17. Jh., Birnenholz, furniert und ebonisiert, Sichtleiste Wellendekor, Halbrundstab mit Wellendekor, abfallendes Profil mit verzierten Bastionsecken, Flammleiste, glattes Profil als Abschluss.
1.800 €
Lichtes Maß: 33 x 27,2 cm.
Profilbreite: 15,5 cm.
6235 Kassettenrahmen, Italien (Toskana?) 17. Jh., geschnitzt, ebonisiert und vergoldet, Sichtleiste glattes ansteigendes Profil, Wulstprofil mit Bandelementen und Blättern in den Ecken und Mitten, Astragal, abfallendes Profil als Abschluss. Mit Aufhänger.
800 €
Lichtes Profil: 39,5 x 53,3 cm.
Profilbreite: 8 cm.


6236 Louis XIII. Rahmen, Frankreich 1. Hälfte 17. Jh., Eichenholz, geschnitzt, Sichtleiste Karnies, Taustab, glatte Kehle, Wulstprofil mit Blattfries, abfallendes Profil mit stilisiertem Blattwerk.
1.200 €
Lichtes Maß: 80,4 x 55 cm.
Profilbreite: 9,8 cm.



6237 Barockrahmen, Alpenländisch/Norditalien 17. /18. Jh., geschnitzt, aus zwei Teilen zusammengesetzt und modern vergoldet/bronziert, Blattwerk, mittig unten Wappen (wohl der Familie Glutz-Blozheim, Schweiz). Mit altem Aufhänger.
800 €
Lichtes Maß: 29,8 x 23,8 cm.
Profilbreite: 10 cm.
6238 Barockrahmen, Italien 17./18. Jh., graviert, gefasst und vergoldet, Sichtleiste Wulstprofil mit verzierten Ecken, glattes Profil, abfallendes Profil als Abschluss.
2.400 €
Lichtes Maß: 97 x 69,5 cm.
Profilbreite: 10,5 cm.
6239 Barockrahmen, Spanien 17. Jh., geschnitzt und vergoldet, Sichtleiste Rundstab, ansteigendes Profil mit Blattornamenten, abfallende Kehle, gravierte Platte mit aufgesetzten Blumenelementen je in der Mitte, aufsteigendes Profil mit Blattornamenten als Abschluss.
300 €
Lichtes Maß: 24 x 18 cm.
Profilbreite: 9,5 cm.


6240 Salvator Rosa Rahmen, Rom 18. Jh., vergoldet, profilierte Sichtleiste, Halbrundstab, ansteigende Kehle, hinterkehltes Wulstprofil, abfallende Kehle als Abschluss. Mit altem Aufhänger.
900 €
Lichtes Maß: 32 x 24,6 cm.
Profilbreite: 6,5 cm.
6241 Louis XV. Rahmen, Frankreich Mitte 18. Jh., graviert und vergoldet, Sichtleiste Zackenmuster, glatte Kehle, ansteigendes Profil mit Zackenmuster, Halbrundstab als Abschluss.
350 €
Lichtes Maß: 36 x 28,7 cm.
Profilbreite: 2,6 cm.
6242 Louis XV. Rahmen, Frankreich 18. Jh., geschnitzt und vergoldet, Sichtleiste stilisierter Blattfries, ansteigende Kehle mit Blattschnitzereien.
450 €
Lichtes Maß: 32 x 17,5 cm.
Profilbreite: 5,2 cm.

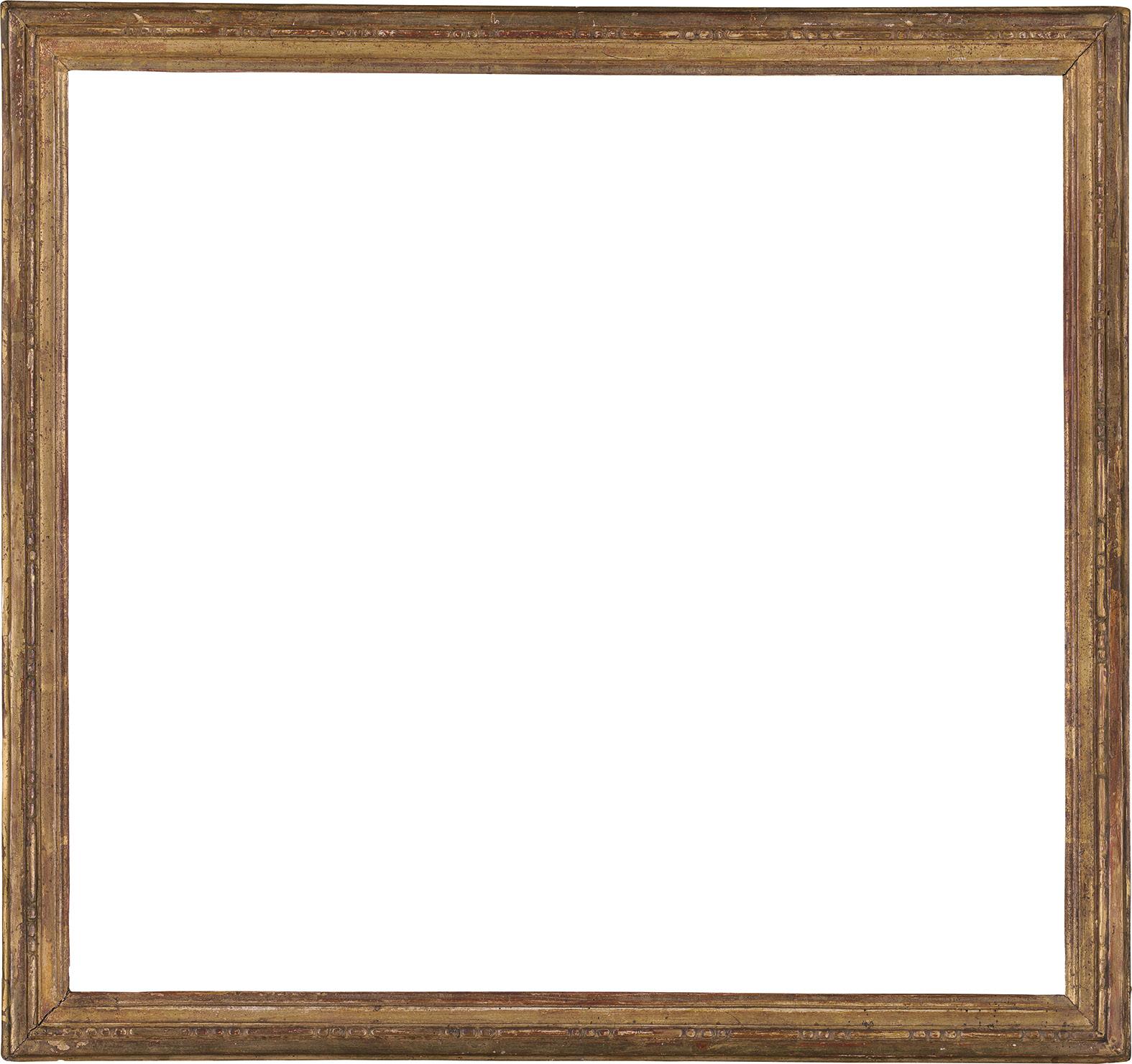
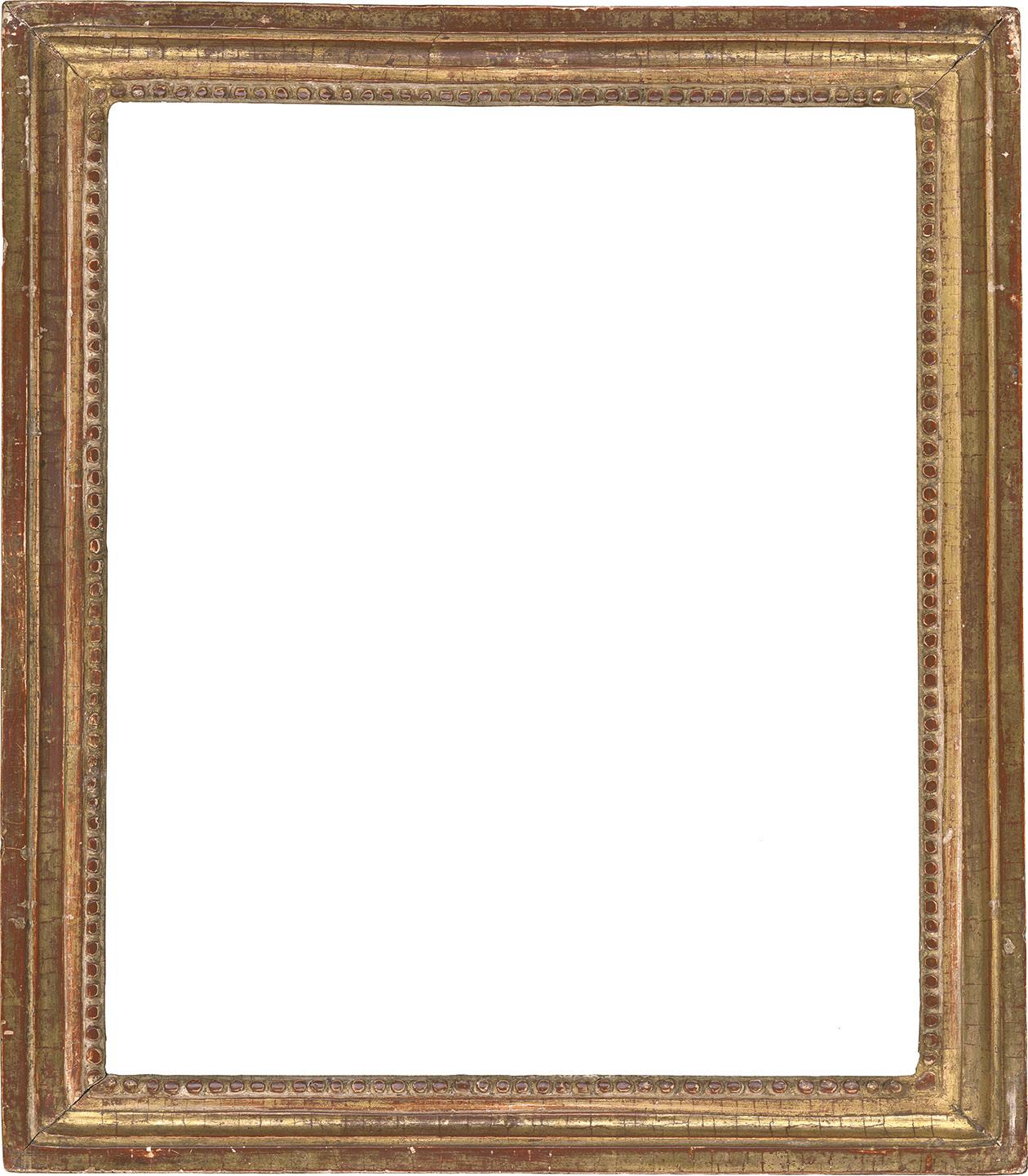
6243 Louis XVI. Rahmen, Frankreich 2. Hälfte 18. Jh., geschnitzt und vergoldet, Sichtleiste glatte ansteigende Kehle, glatte Platte, Astragal, Vierkant, abfallende glatte Kehle als Abschluss. Mit zwei alten Aufhängern.
750 €
Lichtes Maß: 52,6 x 56,7 cm.
Profilbreite: 4 cm.
6244 Louis XVI. Rahmen, Frankreich 2. Hälfte 18. Jh., geschnitzt und vergoldet, Sichtleiste Perlstab, ansteigendes Profil, Vierkant als Abschluss.
400 €
Lichtes Maß: 31,5 x 26,5 cm.
Profilbreite: 3,3 cm.

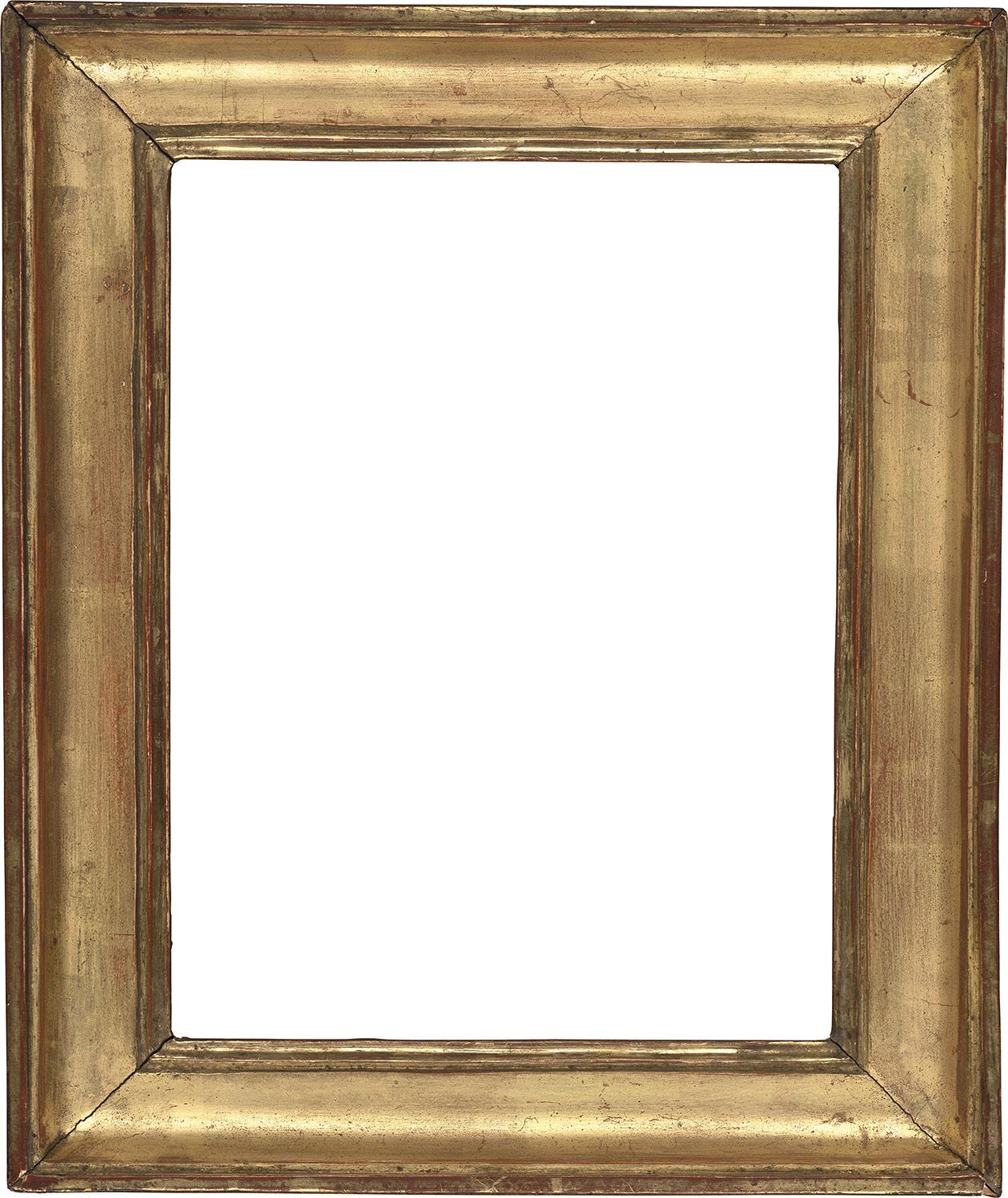
6245 Profilrahmen, Frankreich, um 1800, 2 Rahmen, Pendants, vergoldet, Sichtleiste Karnies, ansteigende glatte Kehle, Viertelstab als Abschluss.
600 €
Lichtes Maß: je 22,8 x 17,3 cm.
Profilbreite: je 4,3 cm.
6246 Louis XVI. Rahmen, Frankreich 2. Hälfte 18. Jh., geschnitzt und vergoldet, Sichtleiste Lotusblattfries, Vierkant, glattes Profil, Karnies, Vierkant als Abschluss.
400 €
Lichtes Maß: 21 x 15 cm.
Profilbreite: 4,3 cm.




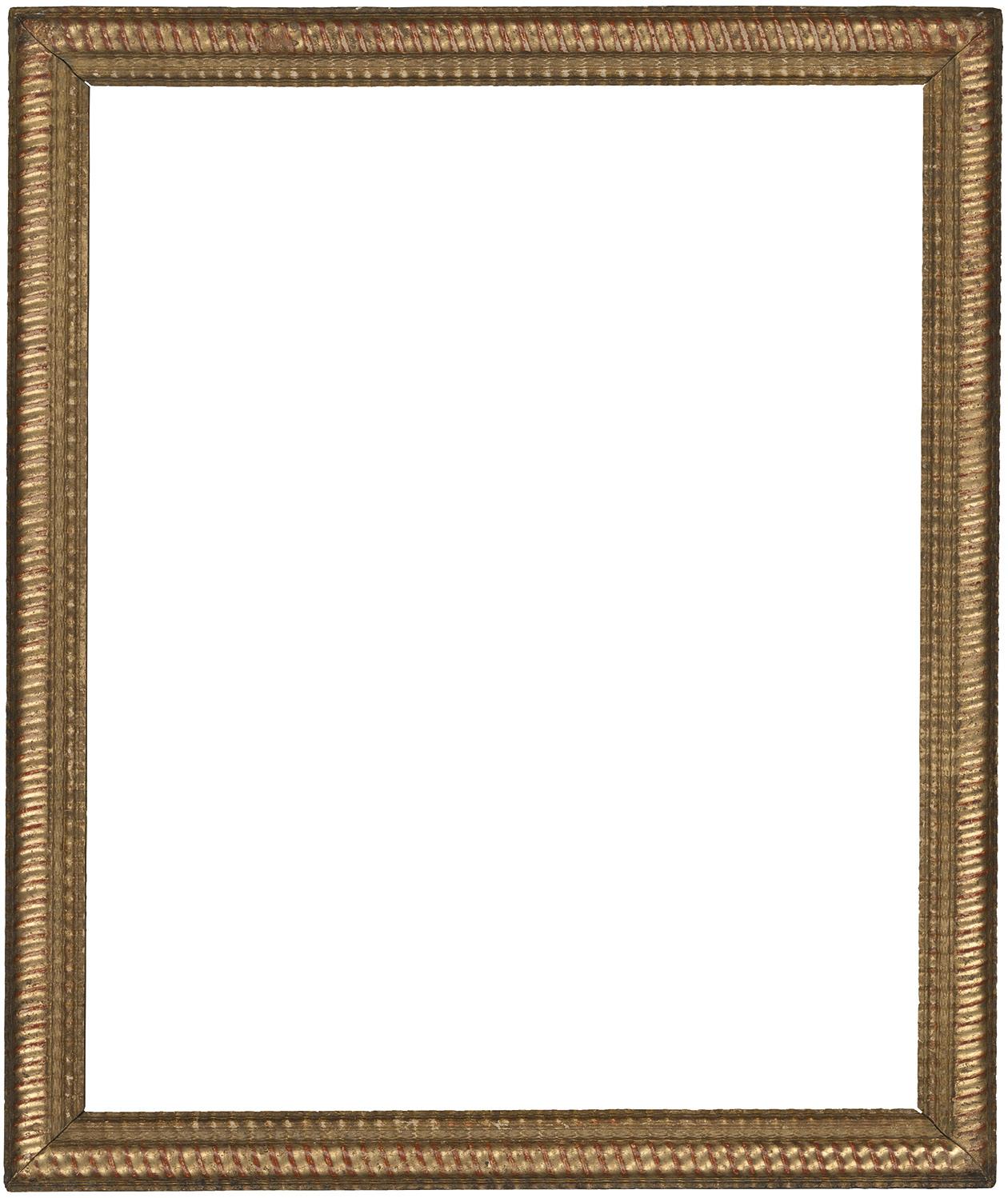
6247 Profilrahmen, Frankreich um 1800, vergoldet, Sichtleiste Blattfries, glatte Kehle, Vierkant als Abschluss.
350 €
Lichtes Maß: 40 x 29,3 cm.
Profilbreite: 4,3 cm.
6248 Empire Rahmen, Frankreich um 1800, Stuck, vergoldet, Sichtleiste Lotusblattfries, glatte Platte, Perlstab, ansteigende glatte Kehle, ansteigende Kehle mit Palmettenfries, Vierkant als Abschluss.
600 €
Lichtes Maß: 23 x 17,8 cm.
Profilbreite: 9 cm.
6249 Profilrahmen, Italien 18. Jh., Masse (Pastiglia), vergoldet, Sichtleiste stilisierter Blattfries, Taustab, abfallendes Profil mit Arabesken, punziert, Perlstab als Abschluss.
450 €
Lichtes Maß: 41 x 30,4 cm.
Profilbreite: 5 cm.
6250 Louis Philippe Rahmen, Frankreich um 1830, Stuck, vergoldet, Sichtleiste Wellenfries, verziertes Wulstprofil.
400 €
Lichtes Maß: 69,4 x 57 cm.
Profilbreite: 6 cm.
6251 Profilrahmen, Italien Ende 18. Jh., geschnitzt und versilbert, Sichtleiste stilisierter Blattfries, glatte Platte, Astragal, Zackenfries, abfallendes Profil mit Fries. Mit altem Aufhänger. Monogrammiert und datiert „GC / CF / N°183 / 1790“.
1.800 €
Lichtes Maß: 66 x 54 cm.
Profilbreite: 9 cm.
6252 Canaletto Rahmen, Venedig 18. Jh., geschnitzt und versilbert, Sichtleiste Fries, ansteigender Karnies mit Blattornamenten, abfallendes Profil mit Fries als Abschluss.
1.500 €
Lichtes Maß: 51,6 x 40,5 cm.
Profilbreite: 7,5 cm.





6253 Klassizistischer Rahmen, Frankreich Ende 18. Jh., Nussholz, glatte Sichtleiste mit Messing-Halbrundstab, in den Ecken runde Messing-Applikationen.
400 €
Lichtes Maß: 38 x 30,4 cm.
Profilbreite: 4,2 cm.
6254 Italienischer oder südfranzösischer Kassettenrahmen, 19. Jh., Walnussholz (?), blau gefasst und vergoldet, gekehlte Sichtleiste, glattes Profil, ansteigender Karnies, glatte Platte mit Fleur-de-lis, ansteigender Karnies mit Viertelstab als Abschluss.
600 €
Lichtes Maß: 25 x 17,8 cm.
Profilbreite: 7 cm.

6255 Klassizistischer Rahmen, Frankreich, 19. Jh., ebonisiert, Sichtleiste ansteigendes Profil, Vierkant, glatte Fläche, Vierkant, mit Quadraten und aufgesetzen Rundmotiven in den Ecken.
350 €
Lichtes Maß: 29,2 x 21 cm.
Profilbreite: 4 cm.
6256 Konvex-Spiegel im Regency-Stil, Englisch 19. Jh. Holz geschnitzt, vergoldet und ebonisiert, mit geschnitzten Schleifen und Kugelelementen, mit eingelassenem Konvex-Spiegel. Durchmesser ca. 58 cm.
600 €
A
Adam, Albrecht 6062
Amerling, Friedrich
Ritter von 6070
Argy-Rousseau, Gabriel 6182
B
Baagøe, Carl Emil 6110
Baierl, Theodor 6227
Ballenberger, Friedrich 6142
Beck, Jacob Samuel 6043-6044
Begas, Adalbert 6173
Bellini, Giovanni 6078
Bertin, Alexandre Charles 6117
Bertin, Jean Victor 6052
Bison, Giuseppe B. 6034-6035
Bjulf, Søren Christian 6158
Blaas, Carl von 6069
Blache, Christian Vigilius 6157
Blechen, Carl 6085
Boehme, Karl Theodor 6132, 6137-6138
Bouguereau, William-Adolphe 6145
Bramer, Leonhard 6002
Braun, Louis 6171
Brendel, Albert Heinrich 6108
Brendstrup, Thorald 6148
Buchholz, Karl 6127
Büttgen, Peter Jakob 6054
C
Cachoud, François Charles 6218
Carl, Adolph Heinrich W. 6096
Carmiencke, Johann H. 6101
Champaigne, Philippe de 6023 Christensen, Godfred 6194
Crola, Georg Heinrich 6104
D
Dalsgaard, Christen 6097
Duphorn, Hugo 6208
Dürer, Albrecht 6077
E
Effenberger, Hermann 6136
Egner, Marie 6213
Erhardt, Georg Friedrich 6109
F Fischer, Eduard 6121
Fischer-Cörlin, Ernst Albert 6154
Flecken, Otto 6155
Frank, Hans 6225-6226
Frey-Moock, Adolf 6188
Friese, Richard 6205
Fromantiou, Hendrik de 6027
G
Gallé, Émile 6183
Gassel, Lucas 6001
Gérard, François-Pascal S. 6060
Gertner, Peter 6006
Gille, Christian Fr. 6100, 6102
Goltz, Alexander Demetrius 6211
Gorbatoff, Konstantin 6131
Gudin, Théodore 6055
Gurlitt, Louis 6099
H
Harpignies, Henri Joseph 6167
Hay, Bernardo 6130
Heckmann, Erwin 6207
Heinsius, Johann Ernst 6046
Heinzmann, Carl Friedrich 6064
Hermann, Hans 6177
Hilsøe, Hans 6162
Hiremy-Hirschl, Adolf 6186
Hoffmann, Josef 6084
Hofmann, Samuel 6016
Hofstetten, Franz Xaver von 6119
Hohneck, Adolf 6147
Hopfgarten, August F. 6075
Hübner, Ulrich 6149-6150, 6152
Hummel, Carl Maria Nikolaus 6103, 6113
IIlsted, Peter 6160
Ittenbach, Franz 6076
JJacob d. J., Julius 6196
Jensen, Johan Laurentz 6050
Jespersen, Henrik Gamst 6146
K
Kalckreuth, Stanislaus
Graf von 6128
Kalpokas, Petras 6210
Kampf, Arthur von 6191
Kampf, Eugen 6156
Kiærskou, Frederik Christian Jakobsen 6115
Klever, Julius Sergius von 6204
Knab, Ferdinand 6185
Knudsen, Peder Jacob M. 6168
Kobell, Ferdinand 6065
Koekkoek, Barend Cornelis 6057
Koerner, Ernst Carl Eugen 6144
Kreibich, Vilém 6206
Kruse, Carl Max 6172
Kummer, Robert 6118
Kupetzky, Johann 6037
Kyhn, Vilhelm 6112, 6195
L
Læssøe, Thorald 6079
Lampi, Franz Xaver von 6056
Lancret, Nicolas 6040
Landseer, Sir Edwin Henry 6086
Lang, Josef Adolf 6179
Lechter, Melchior 6189
Lefebvre, Jules-Joseph 6178
Lehmann, Gustav 6216
Leypold, Carl Julius von 6107
Libert, Betzy Marie Petrea 6176
Lieder, Friedrich Johann G. 6051
Linde, Hermann 6153
Lipinsky, Sigmund 6180
Lübbers, Holger 6163
M
Markewitsch, Viktor 6202
Meister der Nürnberger Madonna 6005
Melchior, Wilhelm 6063
Merker, Max 6139
Metsu, Gabriel 6024
Meunier, Constantin 6165-6166
Meyer, Ernst 6081
Minderhout, Hendrik van 6036
Mishel, Paul 6209
Mohr, Johann Georg Paul 6066
Moll, Oskar 6201
Moras, Walter 6199
Morgenstern, Christian 6116
N
Neumann, Carl 6111
O
Oeconomo, Aristides 6068
P
Pacé, Vincenzo 6045
Paczka, Ferenc 6187
Pagani, Bartolomeo 6133
Pallmann, Peter Götz 6228-6231
Papperitz, Gustav Friedrich 6105
Pesne, Antoine 6041
Petersen, Vilhelm Peter Carl 6114
Petzholdt, Ernst Chr. Fr. 6098
Poel, Egbert Lievensz. van der 6014
Possart, Felix 6082
Pottner, Emil 6197
Pourbus II., Franz 6009
Preller d. J., Friedrich 6083
Procaccini, Giulio Cesare 6011
Q
Querfurt, August 6029-6030
R
Radl, Anton 6047
Reiter, Johann Baptist 6071-6072
Rieter, Heinrich 6049
Rothaug, Alexander 6181
Rottenhammer, Johann 6012
S
Santoro, Rubens 6143
Schäffer, Adalbert 6067
Schick, Rudolf 6088
Schleich d. Ä., Eduard 6120
Schleich d. J., Eduard 6122
Schmidt, Anton Konrad 6192
Schönfeld, Johann Heinrich 6018
Schuster, Rudolf H. 6124-6126
Schwimbeck, Fritz 6184
Seyler, Julius 6193
Skarbina, Franz 6123, 6203
Skovgaard, Peter Chr. Th. 6129
Slavona, Maria 6215
Sørensen, Carl Frederik 6094
Spranger, Bartholomäus 6013
Steppes, Edmund 6190
T
Teerlink, Abraham 6087
Therkildsen, Hans Michael 6164
Thiersch, Ludwig 6073
Trautschold, Wilhelm C. F. 6048
Trübner, Wilhelm 6200
Tübbecke, Paul Wilhelm 6151
U
Unger, Hans 6223
V
Vermehren, Gustav 6159
Vervloet, Frans 6090
W
Wells Champney, James 6174
Werner, Anton von 6089
Wopfner, Joseph 6214
Wouwermann, Pieter 6028
Z
Zawadzky, Margarete von 6198

Moderne und Zeitgenössische Kunst Auktion 28. und 29. November 2025
GALERIE BASSENGE · ERDENER STRASSE 5A · 14193 BERLIN
Telefon: (030) 893 80 29-0 Fax: (030) 891 80 25 E-Mail: art@bassenge.com Kataloge online: www.bassenge.com
1. Die Galerie Gerda Bassenge KG, nachfolgend Versteigerer genannt, versteigert als Kommissionärin im eigenen Namen und für Rechnung ihrer Auftraggeber (Kommittenten), die unbenannt bleiben. Die Versteigerung ist freiwillig und öffentlich im Sinne des § 383 III BGB.
2. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Nummern des Kataloges zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge anzubieten oder zurückzuziehen.
3. Sämtliche zur Versteigerung kommenden Gegenstände können vor der Ver steigerung besichtigt und geprüft werden. Die Sachen sind gebraucht. Erhaltungszustände der einzelnen angebotenen Arbeiten bleiben im Katalog in der Regel unerwähnt. Die Katalogbeschreibungen sind keine Garantien im Rechtssinne und keine vertraglich vereinbarten Beschaffenheitsangaben. Gleiches gilt für individuell angeforderte Zustandsberichte. Sie bringen nur die subjektive Einschätzung des Versteigerers zum Ausdruck und dienen lediglich der unverbindlichen Orientierung. Alle Gegenstände werden in dem Erhaltungszustand veräußert, in dem sie sich bei Erteilung des Zuschlages befinden. Soweit nicht in der Katalogbeschreibung explizit erwähnt, sind Rahmungen nicht bindender Bestandteil des Angebots. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen Sachmängeln in Anspruch nehmen, wenn dieser seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Der Versteigerer verpflichtet sich jedoch, wegen rechtzeitig vorgetragener, begründeter Mängelrügen innerhalb der Verjährungsfrist von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des Zuschlags seine Ansprüche gegenüber dem Einlieferer (Auftraggeber) geltend zu machen. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer dem Erwerber den Kaufpreis samt Aufgeld. Die Haftung des Versteigerers auf Schadensersatz für Vermögensschäden – gleich aus welchem Grund – ist ausgeschlossen, es sei denn, dem Versteigerer fiele Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt unberührt.
4. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag verweigern oder unter Vorbehalt erteilen. Wenn mehrere Personen dasselbe Gebot abgeben und nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, entscheidet das Los. Der Versteigerer kann den Zuschlag zurücknehmen und die Sachen erneut ausbieten, wenn irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen.
5. Im Falle eines schriftlichen Gebotes beauftragt der Interessent den Versteigerer für ihn während der Versteigerung Gebote abzugeben. In schriftlichen Aufträgen ist bei Differenzen zwischen Nummer und Kennwort das Kennwort maßgebend.
6. Telefonische Gebote und Online-Direkt-Gebote über das Internet bedürfen der vorherigen Anmeldung beim Versteigerer und dessen Zustimmung. Für die Bearbeitung übernimmt der
Versteigerer jedoch keine Gewähr. Telefonische und OnlineGebote werden nur akzeptiert, wenn der Bieter bereit ist, den ihm zuvor mitgeteilten Mindestpreis des jeweiligen Loses zu bieten. Auch bei Nichtzustandekommen einer Verbindung gilt, dass für den Auktionator dieses Gebot in Höhe des Mindestpreises verbindlich ist. Für das Zustandekommen einer entsprechenden Telefon- oder Onlineverbindung übernimmt der Versteigerer keine Gewähr. Das Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen findet auf solche Gebote keine Anwendung (§ 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB).
7. Mit der Erteilung des Zuschlages geht die Gefahr für nicht zu vertretende Verluste und Beschädigung auf den Ersteigerer über. Das Eigentum an den ersteigerten Sachen geht erst mit vollständigem Zahlungseingang an den Erwerber über.
8. Auf den Zuschlagspreis ist ein Aufgeld von 30% zu entrichten, in dem die Umsatzsteuer ohne separaten Ausweis enthalten ist (Differenzbesteuerung) oder ein Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer (Regelbesteuerung) von z.Zt. 7% (Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Graphiken, Bücher etc.) bzw. 19% (Handschriften, Autographen, Kunstgewerbliche Gegenstände, Siebdrucke, Offsets, Fotografien, etc.). Die im Katalog mit einem * gekennzeichneten Objekte unterliegen in jedem Fall der Regelbesteuerung (Aufgeld von 25% auf den Zuschlag zzgl. der Umsatzsteuer von z.Zt. 7% bzw. 19%). Bei den im Katalog mit einem ^ gekennzeichneten Objekten ist Einfuhrumsatz steuer angefallen. In diesen Fällen wird zusätzlich zu einem Aufgeld von 27% (Differenzbesteuerung) die verauslagte Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von z.Zt. 7% auf den Zuschlag erhoben. Für bundesdeutsche Kunsthändler und Antiquare, die zum Vor steuer abzug berechtigt sind, kann die Gesamt rech nung auf Wunsch, wie bisher nach der Regelbesteuerung ausgestellt werden. Von der Umsatzsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (außerhalb der EU) und – bei Angabe ihrer USt.-Identifikations-Nr. bei Auftragserteilung als Nachweis der Berechtigung zum Bezug steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferungen –auch an Unternehmen in anderen EU-Mitgliedsstaaten, unter der Voraussetzung, dass sie für gewerblichen Gebrauch einkaufen. Eine Korrektur nach Rechnungsstellung ist nicht möglich. Alle anderen Käufe aus EU-Ländern unterliegen der Umsatzsteuer. Ausländischen Käufern außerhalb der Europäischen Union wird die Umsatzsteuer erstattet, wenn binnen 4 Wochen nach der Auktion der deutsche zollamtliche Ausfuhrnachweis und der zollamtliche Einfuhrnachweis des entsprechenden Importlandes erbracht werden. Bei Versand durch uns gilt der Ausfuhrnachweis als gegeben. Bei Online-Live-Geboten über Internetplattformen erhöht sich das Aufgeld um die dort anfallende Transaktionsgebühr (i. d. R. 3-5%). Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedür fen einer besonderen Nachprüfung und eventueller Berichtigung; Irrtum vorbehalten. Katalog- und Zusatzabbildungen dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Reproduktionsrechte und digitale Dateien der Abbildungen können gegen Gebühr erworben werden. Gegebenen-
falls noch bestehende Urheberrechte Dritter bleiben davon unberührt und müssen u.U. gesondert eingeholt werden.
9. Die Auslieferung der ersteigerten Stücke erfolgt in unseren Geschäftsräumen gegen Bezahlung. Kreditkarten (Mastercard, VISA, American Express), Schecks sowie andere unbare Zahlungen werden nur erfüllungshalber angenommen. Bankspesen/ Transaktionsgebühren bzw. Kursverluste können zu Lasten des Käufers gehen. Die Auf bewahrung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Versand wird gegen Vorabrechnung des Rechnungsbetrages ausgeführt. Die Versandspesen sowie die Kosten für Versicherung gegen Verlust und Beschädigung gehen zu Lasten des Käufers. Übersteigen die tatsäch lichen Versandkosten die vorab berechnete Pauschale, so wird die Differenz dem Käufer nachträglich in Rechnung gestellt.
10. Bei der Ausfuhr von Kulturgütern ist gem. der EG-Verordnung Nr. 116/2009 bzw. § 24 KGSG abhängig von Kategorie und Wert des Objekts ggf. eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich. Aus Gründen des Artenschutzes können Objekte aus bestimmten, geschützten Materialien (u.a. Elfenbein, Schildpatt, Perlmutt und einige Korallenarten) besonderen Im- und Exportbeschränkungen unterliegen. Zum Zwecke des Exports (insbesondere außerhalb der Europäischen Union) kann hierfür eine spezielle Ausfuhrgenehmigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 338/97 erforderlich sein. Entsprechende Ausfuhrgenehmigungen können nur unter strengen Bedingungen erteilt und ggf. auch gar nicht erlangt werden, auch kann der Import dieser Gegenstände in manche Staaten eingeschränkt oder untersagt sein. Der Käufer ist selbst dafür verantwortlich, sich über etwaige Im- und Exportbeschränkungen zu informieren. Export und Import entsprechender Objekte erfolgen allein auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
11. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Der Kaufpreis ist mit dem Zuschlag fällig. Der Versteigerer ist berechtigt, falls nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Versteigerung Zahlung geleistet ist, den durch den Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrag ohne weitere Fristsetzung zu annullieren, Verzugszinsen in
banküblicher Höhe – mindestens jedoch 1 % auf den Bruttopreis je angebrochenen Monat – zu berechnen und von dem Ersteigerer wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. Der Schadenersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache in einer neuen Auktion nochmals versteigert wird und der säumige Käufer für einen Mindererlös gegenüber der vorangegangenen Versteigerung einschließlich der Gebühren des Auktionshauses aufzukommen hat. Zu einem Gebot wird er nicht zugelassen, auf einen etwaigen Mehrerlös hat er keinen Anspruch.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand im vollkaufmännischen Verkehr ist Berlin. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UNAbkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) findet keine Anwendung.
13. Die im Katalog aufgeführten Preise sind Schätzpreise, keine Limite.
14. Der Nachverkauf ist Teil der Versteigerung, bei der der Interessent entweder telefonisch oder schriftlich (im Sinne der Ziffern 5 und 6) den Auftrag zur Gebotsabgabe mit einem bestimmten Betrag erteilt. Entsprechende Gebote behalten ihre Gültigkeit für 4 Wochen nach Abgabe.
15. Die Abgabe eines Gebotes in jeglicher Form bedeutet die Anerkennung dieser Versteigerungsbedingungen. Der Versteigerer nimmt Gebote nur aufgrund der vorstehenden Versteigerungsbedingungen entgegen und erteilt dementsprechend Zuschläge. Kommissionäre haften für die Käufe ihrer Auftraggeber.
16. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt.
David Bassenge, Geschäftsführer und Auktionator
Dr. Markus Brandis, öffentlich bestellter u. vereidigter Auktionator

Stand: November 2025
1. The Galerie Gerda Bassenge KG, subsequently called “the auctioneer” carries on business as commission-agent in its own name on behalf of its voluntary consignors. This auction sale is a public one in the sense of § 383 III BGB.
2. The auctioneer reserves the right to combine, to split, to change or to withdraw lots before the actual final sale.
3. All objects put up for auction can be viewed and examined prior to the sale at the times made known in the catalogue. The items are used and sold as is. As long as not explicitly mentioned in the catalogue description, framing is not an inherent part of the offer. As a rule, the condition of the individual work is not given in the catalogue. Catalogue descriptions are made with as much care as possible, but the descriptions do not fall under the statutory paragraph for guaranteed legal characteristics. The same applies for individually requested condition reports. These also offer no legal guarantee and only represent the subjective assessment of the auctioneer while serv ing as a non-binding orientation. The liability for damage to life, body or health shall remain unaffected. In case of a justified claim, however, he will accept the responsibility to make a claim for restitution on behalf of the buyer against the consignor within a period of 12 months, running from the fall of the hammer. In the event of a successful claim the auctioneer will refund the hammerprice plus premium.
4. The highest bidder acknowledged by the auctioneer shall be deemed the buyer. In case of identical bids the buyer will be determined by drawing lots. In the event of a dispute the auctioneer has the absolute discretion to reoffer and resell the lot in dispute. He may also knock down lots conditionally.
5. In the case of a written bid the bidder commissions the auctioneer to place bids on his behalf during the auction. In cases where there is a discrepancy between number and title in a written bid the title shall prevail.
6. Telephone and direct online bidding via the internet must be approved in advance by the auctioneer. The auctioneer cannot be held liable for faulty connections or transmission failure. In such a case the bidder agrees to bid the reserve price of the corresponding lot. For such bidding the regulations of long distance contracts do not apply (Fernabsatzverträge) [cf § 312g II,10 BGB].
7. On the fall of the auctioneer’s hammer title to the offered lot will pass to the acknowledged bidder. The successful buyer is obliged to accept and pay for the lot. Ownership only passes to the buyer when full payment has been received. The buyer, however, immediately assumes all risks when the goods are knocked down to him.
8. A premium of 30% of the hammer price will be levied in which the VAT is included (marginal tax scheme) or a premium of 25% of the hammer price plus the VAT of 7% (paintings, drawings, sculptures, prints, books, etc.) or 19% (manuscripts, autographs letters, applied arts, screen prints, offset prints, photographs, etc.) of the invoice sum will be levied (regular tax scheme). Buyers from countries of the European Union are subject to German VAT. Items marked with an * are subject to the regular tax scheme (premium of 25% of the hammer price plus the current VAT of 19%). Items marked with an ^ are subject to import duty. In these cases in addition to a premium of 27% (marginal tax scheme), the charged import tax of currently 7% will be added to the hammer price.
Exempted from these rules are only dealers from EU-countries, who are entitled, under their notification of their VAT ID-Number, to buy on the basis of VAT-free delivery within the European Union. Notification of VAT ID-Numbers must be given to the auctioneer before the sale.
For buyers from non EU-countries a premium of 25% will be levied. VAT will be exempted or refunded on production of evidence of exportation within 4 weeks of the auction, or, if appropriate, importation to another country. This is taken as given when the dispatch is effected by us.
Live bidding through online platforms entails a transaction fee stipulated by the platform and will be added to the premium (usually 3-5% of the hammer price).
Due to the work overload of the accounting department during auctions, invoices generated during or directly after an auction require careful revision and possible correction; errors excepted. Catalogue images may not be used without permission. Reproduction rights and digital files can be acquired for a fee. Any copyrights of third parties that may still exist remain unaffected by this and may have to be obtained separately.
9. Auction lots will, without exception, only be handed over after pay ment has been made. Credit cards (VISA, Mastercard, American Express), checks and any other form of non-cash payment are accepted only on account of performance. Exchange rate risk and bank charges may be applicable. Storage and dispatch are at the expense and risk of the buyer. If the shipping costs exceed the lump sum on the invoice the outstanding amount will be billed separately.
10. According to regulation (EC) No. 116/2009 resp. § 24 KGSG, export license may be necessary when exporting cultural goods depending on the type or value of the object in question. For the purposes of wildlife conservation, it is necessary to obtain an export license according to regulation (EC) No. 338/97 when exporting objects made from certain protected materials (incl. ivory, tortoiseshell, mother-of-pearl and certain corals) out of the territory of the European Community. Export licenses for objects made of protected
materials are only granted under strict conditions or may not be granted at all. The import of such objects may be restricted or prohibited by certain countries. It is the buyer’s responsibility to inform himself, whether an object is subject to such restrictions. Export and import of such objects are at the expense and risk of the buyer.
11. The buyer is liable for acceptance of the goods and for payment. The purchase price shall be due for payment upon the lot being knocked down to the buyer. In case of a delayed payment (two weeks after the sale) the purchaser will be held responsible for all resultant damages, in particular interest and exchange losses. In case of payment default the auctioneer will charge interest on the outstanding amount at a rate of 1% to the gross price per month or part of month. In such an event the auctioneer reserves the right to annul the purchase contract without further notice, and to claim damages from the buyer for non-fulfilment, accordingly he can reauction the goods at the buyer’s expense. In this case the buyer is liable for any loss incurred, the buyer shall have no claim if a higher price has been achieved. He will not be permitted to bid.
12. The place of fulfillment and jurisdiction is Berlin. German law applies exclusively; the UN-Treaty (CISG) is explicitly excluded.
13. The prices quoted after each lot are estimates, not reserves.
14. The after-sales is part of the auction in which the bidder places either by telephone or in written form (as stated in number 5 and 6) the order to bid a set amount. Corresponding bids are binding for 4 weeks after submission.
15. By making a bid, either verbally in the auction, by telephone, written by letter, by fax, or through the internet the bidder confirms that he has taken notice of these terms of sale by auction and accepts them. Agents who act on behalf of a third party are jointly and separately liable for the fulfillment of contract on behalf of their principals.
16. Should one or the other of the above terms of sale become wholly or partly ineffective, the validity of the remainder is not affected. In the event of a dispute the German version of the above conditions of sale is valid.
David
Bassenge, auctioneer Dr. Markus Brandis, attested public auctioneer
As of November 2025

Dr. Ruth Baljöhr
David Bassenge
Eva Dalvai
Reproduktionen
Ana Briceño
Philipp Dörrie
Torben Höke
Stefanie Löhr
Clara Schmiedek

Lea Kellhuber
Nadine Keul
Harald Weinhold
Gestaltung & Satz
Stefanie Löhr
