VOM MITTELALTER BIS ZUR GEGENWART
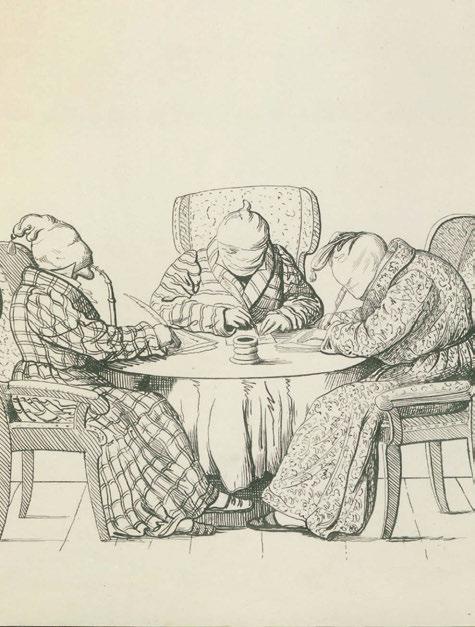
Herausgegeben von Christian Hesse
VERÖFFENTLICHUNGEN DER GESELLSCHAFT FÜR UNIVERSITÄTSUND WISSENSCHAFTSGESCHICHTE
In Verbindung mit Notker Hammerstein (Nj), Walter Höflechner und Martin Kintzinger
In Verbindung mit Rüdiger vom Bruch (†), Notker Hammerstein, Walter Höflechner, Martin Kintzinger und Wolfgang Eric Wagner
In Verbindung mit Rüdiger vom Bruch (†), Notker Hammerstein, Walter Höechner und Martin Kintzinger
Herausgegeben von Rainer Christoph Schwinges
Herausgegeben von Rainer Christoph Schwinges
Herausgegeben von Rainer Schwinges
Band 18
Band 16
Band 17
Antiakademismus und Wissenschaftskritik vom Mittelalter bis zur Gegenwart
Herausgegeben von Christian Hesse
Redaktion: Livia Meyer und Fabian Stadelmann
Schwabe Verlag
Christa Klein
Naturheilkunde und Antiakademismus um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
Stefanie Coché
Antiakademismus und Evangelikale in den USA im 19. und 20. Jahrhundert
Rüdiger Hachtmann
Antiintellektualismus, Wissenschaftsförderung und Forschungspolitik unter der NS-Diktatur 1933–1945
Folker Reichert
Frank wider die Griechlein
Anne Kwaschik
Autonomie und Institution. Frauenbewegung und Frauenforschung in der Bundesrepublik (1976–1982)
Peter J. Schneemann
Die Ästhetiken von Regelwerk und Diskurs. Warum die Kunst den Akademismus braucht
Maximilian Schuh
Antiakademismus und Wissenschaftskritik vom Mittelalter bis zur Gegenwart – einige zusammenfassende Bemerkungen
Antiakademismus und Wissenschaftskritik vom Mittelalter bis zur Gegenwart
Einführung
Christian Hesse
Im Nachgang zum Überfall der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Einmarsch der israelischen Armee in den palästinensischen Gazastreifen gerieten Universitäten in den USA und Europa in heftige Kritik, weil sich zahlreiche ihrer Angehörigen mit der palästinensischen Bevölkerung solidarisiert hatten. Bezeichnend war dabei, dass diese Kritik als wenig differenzierte Debatte geführt und die Diskussion mit Vorwürfen befeuert wurde, die seit längerer Zeit gegenüber nordamerikanischen und europäischen Universitäten von unterschiedlicher Seite formuliert werden: Dass die Hochschulen und ihre „Eliten“, vor allem in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten, politisch respektive ideologisch und damit – so der Kehrschluss – unwissenschaftlich agieren würden. In diesem Zusammenhang gerieten auch konkrete Teile des Forschungs- und Lehrprogramms in das Visier der Kritikerinnen und Kritiker. Ganz besonders werden seit Längerem etwa die Postcolonial und Gender Studies unter Ideologieverdacht gestellt und sind daher unter heftigen Beschuss geraten.1 Die Ablehnung einer bestimmten, an Universitäten von Teilen der Lehrenden betriebenen Wissenschaft und Forschungsrichtung wird zudem populistisch von rechten Parteien ausgeschlachtet.2 Zugleich wurden Vorwürfe laut, dass die Wissenschafts- und Redefreiheit von außen und innen nicht nur durch die Universitätsleitungen, sondern auch durch eine sogenannte ‚Cancel Culture‘ eingeschränkt werde, wodurch der viel zitierte akademische Freiraum Gefahr laufe, zu einem „Unsafe Space“ zu werden, wie
1 U. a. Thomas Ribi, Ideologie statt Wissenschaft, in: Neue Zürcher Zeitung (12.12.2023), S. 17; als Reaktion auf diese Vorwürfe vgl. z. B. den Beitrag von Patricia Purtschert, Francesca Falk und Barbara Lüthi, in: Republik (13.05.2024), <https://www.republik. ch/2024/05/13/der-aufbruch-zu-einer-gemeinsamen-gegenwart> (04.11.2024); ausführlich z. B. Sabine Hark und Paula-Irene Villa (Hg.), Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen, Bielefeld 2015.
2 So jüngst vom Vlaams Belang in den Niederlanden, Daniel Steinvorth, Die rechten F lamen wagen den Aufstand, in: Neue Zürcher Zeitung (06.06.2024), S. 5.
es Tom Slater 2016 formuliert hat.3 Die Universitäten würden in Aktivismus abdriften, ja sie seien das ‚Zentrum der Verrücktheit‘, so lautet die Einschätzung eines an einer englischen Universität lehrenden Politikprofessors.4 Weltfremdheit gerade der geisteswissenschaftlichen Forschung und vor allem Praxisferne und Nutzlosigkeit gehören damit noch zu den weniger polemischen Vorwürfen in aktuellen Debatten, mit denen die Universitäten, ihre Angehörigen und die von ihnen erforschten und vermittelten Wissensformen konfrontiert werden. In der Schweiz manifestiert sich diese Diskussion in einer Klage über eine zu hohe Maturitätsquote allgemein und über die Infragestellung des akademischen Bildungswegs für einzelne Berufsgruppen im Besonderen. Deren Angehörige sollten in erster Linie anwendungsorientierte „Skills“ besitzen – also genau das, so lässt sich schließen, was an der Universität gerade nicht vermittelt würde. Akademiker als Schimpfwort – so lässt sich die Schlagzeile eines Artikels in einer Berner Tageszeitung interpretieren, mit der eine Bildungsexpertin auf den Vorwurf einer zu hohen Maturitätsquote eines Wirtschaftsexperten reagierte.5 Im Kontext dieser Auseinandersetzung betonen die Verteidiger der höheren Bildung – und damit auch der Notwendigkeit von Akademisierung –, dass die Betreffenden nicht nur mit der Praxis, sondern auch mit Theorie und mit neuen pädagogischen Konzepten konfrontiert werden – wie kurz vor der Tagung der Professor für Bildungsökonomie an der Universität Bern in einer Zürcher Tageszeitung in seinem Beitrag unter dem Titel die „Mär von der Akademisierung“ hervorgehoben hat.6 Mehr noch, jenen Personen, die unter finanziellen Entbehrungen höhere Abschlüsse erwerben, solle man dankbar sein. Sie würden nämlich die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken, da sie die ‚Signale des Arbeitsmarktes‘ gehört hätten. Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren, auch um den Aspekt der zunehmenden Unterwerfung der Universität unter die Regeln der liberalen
3 Tom Slater, Conclusion. How to Make Your University an Unsafe Space, in: Unsafe Space. The Crisis of Free Speech on Campus, hg. von Tom Slater, London 2016, S. 129–131; vgl. auch die Kolumne von Caspar Hirschi, Im Streit um Nahost wird gerade die Wissenschaftsfreiheit kaputt geredet, in: NZZ am Sonntag (14.04.2024), S. 20.
4 Eric Kaufmann, Unis sind das Zentrum der Verrücktheit, in: Neue Zürcher Zeitung (16.11.2023), S. 32.
5 Nina Fargahi, Akademiker ist ein Schimpfwort geworden, in: Berner Zeitung (17.8.2022), <https://www.bernerzeitung.ch/akademiker-ist-ein-schimpfwort-geworden301982183798> (04.11.2024); zur Kritik an der zu hohen Maturitätsquote, Sebastian Briellmann, in: Tages Anzeiger (02.08.2022), <https://www.tagesanzeiger.ch/in-derschweiz-glauben-wir-alle-probleme-mit-mehr-bildung-loesen-zu-koennen-1441769 20272> (04.11.2024).
6 Stefan C. Wolter, Die Mär von der Akademisierung, in: NZZ (24.08.2022), S. 18.
Antiakademismus und Wissenschaftskritik vom Mittelalter bis zur Gegenwart 5 stellt. Gerade diese Weltfremdheit, die seit dem 19. Jahrhundert in dem für Universitäten häufig benutzten Begriffs des ‚Elfenbeinturms‘ auch räumlich zum Ausdruck kommt,14 gehört neben den institutionellen Mechanismen der Universitäten, der Frage nach ihrer Nützlichkeit und den studentischen Taugenichtsen zu den besonders wirkmächtigen Topoi des Antiakademismus.15
Hier setzte die Tagung ein, die sich mit der Infragestellung, Kritik und Bedrohung von Wissenschaft, ihrer Institutionen und Akteure eines Themas von hoher tagespolitischer Aktualität widmete. Die Absicht der Tagung, die der vorliegende Band nun aufnimmt, war es, nach Formen, Ursachen sowie Inhalten und Folgen, ja dem historischen Wandel und damit den Konjunkturen von Antiakademismus und Wissenschaftskritik aus einer Perspektive der langen Dauer zu fragen. Neben den Trägern dieser Kritik galt es auch, die aus dieser Kritik entstandenen neuen Ausbildungswege und Institutionen in ihrem jeweiligen historischen Kontext in den Blick zu nehmen und zu untersuchen, wie sich diese zu den Universitäten und damit zu den ‚etablierten‘ Institutionen verhielten und was sie auf Dauer bewirkten. Es lässt sich etwa zeigen, dass Kritik nicht nur als störend oder unangemessen vom universitären System abgetan wurde, sondern konstruktiv eingearbeitet werden konnte. Die Infragestellung der Wissenschaftlichkeit und ihrer Angemessenheit an den Lebensrealitäten hat etwa auch zur Entstehung neuer Disziplinen, ja zu Reformen überhaupt und damit zur Weiterentwicklung entscheidend beigetragen.16 Die historische Perspektive auf den Problemkomplex Antiakademismus wird im vorliegenden Band zudem um eine interdisziplinäre ergänzt, indem sowohl ein Beitrag aus der Philosophie wie aus der Kunstgeschichte das Phänomen von ihrer jeweiligen Disziplin her beleuchten.
Inhaltlich steigt der Band mit einer Begriffsbestimmung aus philosophischer Perspektive ein. Die darauffolgenden Beiträge folgen dann einer chronologischen Ordnung vom Hochmittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Inhaltlich eröffnen die Beiträge ein breites Spektrum von Akteuren, Formen und Wirkungsweisen von Antiakademismus. Die ersten Beiträge zeigen, dass bereits die scholastische Wissenskultur des hohen Mittelalters vehemente Kritiker kannte, später traten die Humanisten gegen die Universitäten auf, bis sich während der Reformationszeit ein vorläufiger Höhepunkt der Institutionenkritik einstellte. Gleichzeitig wird auch ein Blick auf die Herausforderungen geworfen, die sich für klösterliche Gemeinschaften durch ein Studium und die sich daraus ergebenden sozialen Perspektiven ihrer Mitglieder ergaben. Die Beiträge aus frühneuzeitlicher Warte hingegen setzen sich wiederum damit aus -
14 Engelmeier/Felsch, „Gegen die Uni studieren“ (Anm. 7), S. 10.
15 Marian Füssel, Schulfüchse, Streithähne und gelehrte Affen. Topoi des Antiakademismus seit der fr ühen Neuzeit, in: Mittelweg 36 (Anm. 7), S. 30–46.
16 Engelmeier/Felsch, „Gegen die Uni studieren“ (Anm. 7), S. 5.
Claus Beisbart
sche Institution oder wirklich eine ganze Wissenschaft, wie es das Wort ‚Wissenschaftskritik‘ suggeriert? Und was genau ist hier unter Kritik zu verstehen?
Wenn wir wirklich von Wissenschaftskritik reden können, dann müsste es Parallelen zu anderen Figuren, Bewegungen und Positionen geben, die als wissenschaftskritisch firmieren. Als Beispiel wäre Friedrich Nietzsche zu nennen, der in seinen „Unzeitgemäßen Betrachtungen“ die zeitgenössische Geschichtswissenschaft mit dem Vorwurf der Lebensfeindlichkeit kritisiert.4 In der „Genealogie der Moral“ wittert Nietzsche hinter den Wissenschaften problematische Einstellungen wie „Missmuth, Unglauben, Nagewurm, despectio sui, schlechtes Gewissen“ oder die jüngste Ausprägung des von ihm kritisierten asketischen Ideals.5 Als wissenschaftskritisch versteht sich auch die feministische Epistemologie. Ein zentraler Kritikpunkt ist dabei der Androzentrismus in den Wissenschaften, der sich etwa am ‚Gender Data Gap‘ festmachen lässt. Die feministische Epistemologie geht aber weiter und problematisiert auch gängige Vorstellungen von Wissen und Objektivität (was natürlich auch Nietzsche getan hat).6
Kann man also auch im Kontext der Corona-Pandemie und der Klimakrise von Wissenschaftskritik sprechen? Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn geklärt ist, was Wissenschaftskritik eigentlich ist. Auch historisch vergleichende Forschung zur Wissenschaftskritik sollte sich auf einen klaren Begriff stützen. Daher möchte ich in diesem Aufsatz die Frage diskutieren, was Wissenschaftskritik ist, und so den entsprechenden Begriff klären. Dabei möchte ich nicht bewerten, inwiefern unterschiedliche Ausprägungen von Wissenschaftskritik legitim sind, sondern Analysewerkzeuge für die Untersuchung von Wissenschaftskritik zur Verfügung stellen.
4 Friedrich Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, in: Kritische Studienausgabe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 1, München 1999, S. 243–427, hier besonders S. 257 (Leipzig 1887).
5 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, in: Kritische Studienausgabe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 5, München 1999, S. 245–412, hier S. 397 (ND Leipzig 1887). Zur Wissenschaftskritik bei Nietzsche siehe etwa Babette E. Babich, Nietzsche’s Critique of Scientific Reason and Scientific Culture. On ‚Science as a Problem‘ and ‚Nature as Chaos‘, in: Nietzsche and Science, hg. von Gregory Moore und Thomas H. Brobjer, London/New York 2016 (ND Aldershot 2004), S. 133–153.
6 Etwa Sandra Harding, Rethinking Standpoint Epistemology. What Is „Strong Objectivity?“, in: The Centennial Review 36 (1992), Nr. 3, S. 437–470. Für einen Ü berblick siehe Mona Singer, Feministische Wissenschaftskritik und Epistemologie. Voraussetzungen, Positionen, Perspektiven, in: Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, hg. von Ruth Becker und Beate Kortendiek, Wiesbaden 32010, S. 292–301. Für aktuelle Beispiele siehe Birkner (Hg.), Emanzipatorische Wissenschaftskritik (Anm. 3).
Was, woran, warum? 11
zulassen, dass diese fach- und epochenspezifisch ausbuchstabiert werden. Eine solche Position ist etwa bei Thomas S. Kuhn angelegt.11
Wie lassen sich dann die gemeinsamen Ziele und Standards der Wissenschaften grob umschreiben? Sicher gehört das Wissen oder der Gewinn von Wissen zu den konstitutiven Zielen der Wissenschaften. Insofern sich Verstehen nicht im Wissen erschöpft, lässt sich auch das Verstehen als weiteres grundlegendes Ziel nennen.12 Diese Zielbeschreibung ist besonders in Bezug auf viele Geisteswissenschaften angemessen, deren Ziel man nicht ausreichend als Wissenserwerb charakterisieren kann. Vielleicht gibt es noch weitere Ziele der Wissenschaften, aber bei ihnen geht es um ähnliche epistemische Leistungen wie Wissen und Verstehen, sodass ich die konstitutiven Ziele der Wissenschaften summarisch als epistemisch kennzeichnen möchte. Natürlich werden diese Ziele oft um höherer Ziele willen verfolgt. So dient der Wissenserwerb in der Medizin letztlich der Gesundheit. Insofern die Medizin als Wissenschaft firmiert, verfolgt sie aber unmittelbar bloß epistemische Ziele.13
Nicht jeder Versuch, die Welt besser zu erkennen und zu verstehen, kann aber wissenschaftlich genannt werden. Charakteristisch für das Betreiben der Wissenschaft ist zusätzlich erstens, dass wissenschaftliches Wissen und Verstehen besonders hohen epistemischen Standards genügen müssen. Mit epistemischen Standards sind dabei solche gemeint, die für jedes Wissen beziehungsweise Verstehen als solches gelten. Wissenschaftliches Wissen soll besonders gut begründet sein, ja besser begründet, als es in anderen Kontexten der Fall ist.14 Das zeigt sich etwa daran, dass in der Mathematik Theoreme bewiesen werden müssen. In der Teilchenphysik und in anderen Gebieten wird
11 Thomas S. Kuhn, Objectivity, Value Judgment, and Theory Choice, in: The Essential Tension, hg. von Thomas S. Kuhn, Chicago 1977, S. 320–339.
12 Zum Verstehen und zu seinem Verhältnis zum Wissen siehe Christoph Baumberger, Claus Beisbar t und Georg Brun, What Is Understanding? An Overview of Recent Debates in Epistemology and Philosophy of Science, in: Explaining Understanding. New Perspectives from Epistemolgy and Philosophy of Science, hg. von Stephen Grimm, Christoph Baumberger und Sabine Ammon, London/New York 2017, S. 1–34.
13 Die Identifikation von Zielen und Standards, die für eine Praxis konstitutiv sind, wirft ein methodisches Problem auf, wenn diese Ziele und Standards später für eine Kritik an der Praxis verwendet werden sollen: Wie lassen sich die Ziele und Standards aus der Praxis selbst heraus ablesen, ohne dass wir annehmen müssen, die Ziele und Standards würden immer schon realisiert bzw. befolgt (so etwa Axel Honneth, Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit, Berlin 2007, S. 27–30)? Das Problem kann aber gelöst werden. So kann Kritik anhand der konstitutiven Ziele und Standards Teil der Praxis sein. Hilfreich ist außerdem die Methode des Überlegungsgleichgewichts (erhellend in diesem Zusammenhang: Edward Stein, Rationality and Reflective Equilibrium, Synthese 99 (1994), S. 137–172).
14 Das betont Sven Ove Hansson, Cutting the Gordian Knot of Demarcation, in: International Studies in the Philosophy of Science, 23 (2009), Nr. 3, S. 237–243, hier S. 239.
Claus Beisbart
erst dann von einem wissenschaftlichen Ergebnis, etwa der Entdeckung eines neuen Teilchens, ausgegangen, wenn Fehlerwahrscheinlichkeiten bestimmte Schwellen unterschreiten. Auch das wissenschaftliche Verstehen muss den einschlägigen Desideraten besonders gut genügen: Erklärungen, die zum Verstehen beitragen, sollen beispielsweise möglichst gut zu unserem Hintergrundwissen passen. Die Wissenschaften nehmen dabei sogar in Anspruch, eine Avantgardeposition einzunehmen und andere Versuche zu übertreffen, Wissen und Verständnis zu gewinnen. In diese Richtung geht auch eine jüngere Charakterisierung der Wissenschaften, die sich bei Paul Hoyningen-Huene findet. Ihm zufolge ist wissenschaftliches Wissen (und dieser Punkt kann wohl auch auf wissenschaftliches Verstehen ausgeweitet werden) durch seine vergleichsweise hohe Systematizität gekennzeichnet. Diese Systematizität zeigt sich beispielsweise bei Begründungen, aber auch bei der Vernetzung des Wissens. Außerdem erwerben die Wissenschaften das Wissen in systematischerer Art, als das im Alltag der Fall ist, weil sie das Wissen planvoll zu erweitern und zu vervollständigen suchen.15
Einen weiteren wichtigen Standard nennt zweitens Robert K. Merton, wenn er von „communism“ spricht. Damit ist gemeint, dass wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlicht werden müssen.16 Privatgelehrte, die nur im stillen Kämmerchen vor sich hinforschen, ohne daran zu denken, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, sind daher nicht dem Wissenschaftssystem zuzurechnen. Wissenschaftliche Forschung versteht sich als Versuch, den Kenntnisstand einer Fachgemeinschaft sichtbar weiterzuentwickeln.
Insgesamt ist die Wissenschaft damit eine soziale Praxis, die auf Wissen und Verstehen zielt, wobei besonders hohe epistemische Standards gelten und Resultate veröffentlicht werden. Was dabei genau als Wissen und Verstehen gilt und wie die hohen Standards auszulegen sind, die an die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung gelegt werden, ist dabei fach- und epochenspezifisch auszubuchstabieren – etwa durch ein Paradigma, wie es Kuhn für jede normalwissenschaftliche Forschung annimmt.17
Für die folgenden Überlegungen ist noch wichtig, dass die Kritik für das Selbstverständnis der Wissenschaften eine zentrale Rolle spielt. Das hat besonders Karl R. Popper hervorgehoben. In seiner Autobiographie schreibt er, dass die wissenschaftliche Haltung kritisch ist, „eine Haltung, die […] kri-
15 Paul Hoyningen-Huene, Systematicity. The Nature of Science (Oxford Studies in Philosophy of Science), New York 2013.
16 Robert K. Merton, A Note on Science and Democracy, in: Journal of Legal and Political Sociology 1 (1942), Nr. 1, S. 115–126, hier S. 121, wiederabgedruckt Robert K. Merton, The Normative Structure of Science, in: Ders., The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations, Chicago 1973, S. 267–278.
17 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 42012 (Chicago 1962); dt. als ders., Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Berlin 262020.
tische Überprüfungen sucht […]: Überprüfungen, die die Theorie widerlegen“ können.18 Auch Hoyningen-Huene nennt die kritische Diskussion, um die Systematizität der Wissenschaften zu erklären.19 Kritik bezieht sich dabei auf Wissens- und Verstehensansprüche. Diese Ansprüche werden in den Wissenschaften nicht einfach hingenommen, sondern kritisch, das heißt ergebnisoffen und gründlich, geprüft. Dabei richtet sich die Kritik nicht nur auf epistemische Ansprüche, die von außerhalb der Wissenschaft erhoben werden, sondern gerade auch auf Ideen, die aus den Wissenschaften selbst kommen. Insofern ist die Kritik hier auch Selbstkritik. Sie ist letztlich ein Mittel, um die hohen Standards an Wissen und Verstehen einzuhalten und um sicherzustellen, dass wissenschaftliches Wissen besser begründet ist, als das andere Wissensformen sind.
Die wissenschaftsphilosophischen Würdigungen der wissenschaftlichen Kritik setzen dabei durchaus unterschiedliche Akzente. So betont Popper die individuelle kritische Einstellung, die er mit der dogmatischen Haltung kontrastiert.20 Merton hebt hingegen die Institutionalisierung von Kritik hervor, wenn er von „organized skepticism“ spricht.21 Und während die kritische Einstellung bei Popper als zentrales Ideal für Wissenschaftlichkeit gilt22, betont Kuhn, dass nicht immer alles kritisiert werden kann. Die sogenannten Normalwissenschaften seien, was die eigenen Grundlagen, das eigene Paradigma angehe, letztlich unkritisch.23
3. Wissenschaftskritik
Wenn Wissenschaft eine menschliche Praxis ist, die durch grobe konstitutive Ziele und Standards charakterisiert ist, wie kann sie kritisiert werden? Das hängt natürlich davon ab, was genau unter ‚Kritik‘ zu verstehen ist. Sicher geht es bei vielem, was ‚Wissenschaftskritik‘ heißt, nicht oder nicht bloß um eine neutrale, ergebnisoffene Prüfung. Vielmehr werden eine oder mehrere Wissenschaften negativ bewertet. Wenn Nietzsche beispielsweise die Lebensfeindlich-
18 Karl R. Popper, Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung, Hamburg 1979, S. 48.
19 Hoyningen-Huene, Systematicity (Anm. 15). S. 108–114.
20 Karl R. Popper (1963), Science: Conjectures and Refutations, in: Karl R. Popper, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, London 1963, S. 33–65, hier Abschnitte Vif.
21 Merton, Note (Anm. 16), S. 126.
22 Karl R. Popper, Normal Science and Its Dangers, in: Criticism and the Growth of Knowledge, hg. von Imre Lakatos und Alan Musgrave, Cambridge 1970, S. 51–58.
23 Thomas S. Kuhn, Logic of Discovery or Psychology of Research?, in: Criticism (Anm. 22), S. 1–23.
Claus Beisbart
keit der modernen Wissenschaften kritisiert, dann möchte er damit ein Problem mit den Wissenschaften geltend machen.24
Wie jede Bewertung muss die negative Bewertung der Wissenschaften dabei begründet werden können. So hat Richard M. Hare argumentiert, dass uns jedes Werturteil, das sich auf einen einzelnen Fall bezieht, auf ein allgemeines Prinzip festlegt. Dieses Prinzip kann dann als Begründung des einzelfallbezogenen Werturteils verwendet werden und nennt einen Maßstab.25
Kritik im hier untersuchten Sinn liegt also immer dann vor, wenn eine Urheberin U der Kritik einen Adressaten A für einen bestimmten Tatbestand T anhand eines Maßstabs M negativ bewertet. Unterschiedliche Möglichkeiten von Wissenschaftskritik ergeben sich, wenn wir uns überlegen, was für die ‚Leerstellen‘ U, A, T und M infrage kommt.26
Wer ist zunächst Adressat A der Wissenschaftskritik? Natürlich soll es um die Wissenschaften gehen, aber die Kritik könnte sich genauer an einzelne Forschende, Gruppen, einzelne Fächer oder sogar die Gesamtheit der Wissenschaften richten. Man kann auch dann von Wissenschaftskritik sprechen, wenn wissenschaftliche Institutionen wie Universitäten, Akademien oder Fachgesellschaften kritisiert werden. Das Wort ‚Wissenschaftskritik‘ suggeriert allerdings, dass nicht bloß einzelne Forschende oder Institutionen, sondern mindestens eine oder mehrere Wissenschaften kritisiert werden. Ein besonders interessanter Adressat von Wissenschaftskritik dürfte dabei eine Fachgemeinschaft, eine ‚scientific community‘, sein. Eine solche Fachgemeinschaft ist diejenige Einheit, auf die sich Thomas Kuhns Paradigmentheorie bezieht.27 Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Menschen, die aufgrund ihrer Ausbildung in dieselbe Tradition hineingewachsen sind. Die Angehörigen einer solchen ‚scientific community‘ adressieren einander mit ihren Publikationen und tauschen sich auf Konferenzen aus. Sie definieren damit einen Forschungsstand auf einem bestimmten Sachgebiet. Dabei sind Fachgemeinschaften, wie sie Kuhn bestimmt, aufgrund der fortgeschrittenen Spezialisierung heute unterhalb der Ebene von Fächern wie Physik oder Soziologie angesiedelt. Gute Beispiele für Fachgemeinschaften wären etwa die Epidemiologie, die Klimawissenschaft oder die Religionssoziologie. Ich möchte Wissen-
24 Nietzsche, Nutzen und Nachtheil (Anm. 4), S. 257.
25 Richard M. Hare, The Language of Morals, Oxford 1952, Abschnitt 5.2; Richard M. Hare, Freedom and Reason, Oxford 1963, Kapitel 2–3.
26 In der Alltagssprache bezeichnet das Akkusativobjekt von ‚kritisieren‘ entweder eine Instanz (die Kommission kritisieren) oder einen Tatbestand, für den eine Instanz kritisiert wird (den Beschluss der Kommission kritisieren). Deshalb wird in der Formel im Haupttext zwischen Adressat und Tatbestand unterschieden. Beide hängen natürlich miteinander zusammen: Wenn man eine Instanz kritisiert, dann in der Regel für einen Tatbestand, und umgekehrt.
27 Kuhn, Structure (Anm. 17), Postscript (seit der zweiten Auflage).
schaftskritik im Folgenden so verstehen, dass sie sich auf eine Fachgemeinschaft (kurz: eine Wissenschaft, ein Fach oder eine Disziplin) bezieht oder aber generalisierend auf ganze Gruppen von Fächern.
Wer Urheberin U der Wissenschaftskritik ist, ergibt sich nicht aus dem Begriff der Wissenschaftskritik. Daher muss hier offenbleiben, ob die Kritik von einzelnen Personen, bestimmten Institutionen oder sogar der Öffentlichkeit oder der Politik kommt. Interessant ist dabei aber die Unterscheidung zwischen Innen und Außen. Wenn eine Fachgemeinschaft kritisiert wird, dann kann diese Kritik aus der Fachgemeinschaft selbst oder aber von außen kommen.
Für welchen Tatbestand T und anhand von welchem Maßstab M können die Wissenschaften schließlich kritisiert werden? Hinsichtlich des Maßstabs können wir zwischen (wissenschafts-)internen und externen Maßstäben unterscheiden. Mit den internen Maßstäben sind dabei diejenigen Ziele und Standards gemeint, die konstitutiv für eine Disziplin sind. Kritik dieser Art ist besonders gravierend, weil sie eine Wissenschaft als das angeht, was sie im Kern ist oder sein will. Weil die konstitutiven Ziele der Wissenschaften epistemisch sind, muss es die interne Kritik mit Wissen und Verstehen zu tun haben. Externe Kritik an einer Wissenschaft beruft sich hingegen nicht auf die Maßstäbe, die für eine Wissenschaft konstitutiv sind. Diese Kritik könnte beispielsweise darauf hinauslaufen, dass die wissenschaftliche Praxis Anliegen des Tierschutzes nicht ernst genug nimmt oder dass sie zu viele Ressourcen verbraucht.
Die Maßstäbe, die bei der Kritik angelegt werden, haben es selbstverständlich auch mit dem Tatbestand T zu tun. Bei der Wissenschaftskritik dreht es sich dabei vor allem um die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und die Tätigkeiten, welche die Forschung ausmachen. So könnte kritisiert werden, dass eine bestimmte Disziplin eine Theorie akzeptiert hat oder dass sie bei ihren Untersuchungen Tierversuche durchgeführt hat. Dabei entzündet sich die Kritik oft auch erst an den Folgen, welche die wissenschaftliche Forschung hat und welche nach internen oder nach externen Maßstäben beurteilt werden können. Dabei drängt uns der Begriff der Wissenschaftskritik aufgrund seiner Allgemeinheit zu der Forderung, dass der Fokus der Wissenschaftskritik nicht auf einzelnen Ergebnissen oder Handlungen liegen kann, sondern dass Ergebnistypen oder Verfahrensweisen und Methoden in den Blick genommen werden müssen.
Insgesamt soll es daher im Folgenden um Kritik gehen, welche sich von innen oder von außen anhand interner oder externer Maßstäbe gegen eine Disziplin richtet und allgemein deren Ergebnisse oder Verfahren betrifft. Zu dieser Präzisierung der Wissenschaftskritik drängt uns vor allem die Idee, dass in der Wissenschaftskritik letztlich eine Wissenschaft selbst im Fokus steht. Das hat die problematische Konsequenz, dass der Adressat und der Tatbe -
Claus Beisbart
Eine etwas andere Möglichkeit, die wissenschaftlichen Ziele und Standards zu problematisieren, besteht schließlich noch darin zu sagen, dass sie zwar durchaus wertvoll sind, aber vom Menschen nicht realisiert werde könnten. Wissenschaftliche Bemühungen, die Ziele zu erreichen, seien daher von vornherein zum Scheitern verurteilt, so die Kritik. Zur Begründung einer solchen Kritik müsste aber plausibel gemacht werden, dass der Mensch viele Dinge nicht wissen und verstehen kann. Das erscheint wenig glaubwürdig. In der heutigen Zeit, in der die Wissenschaften Wissensansprüche zu vielen Gebieten vertreten, müsste gezeigt werden, dass die Wissenschaften das gewünschte Wissen wider den Anschein gar nicht geliefert haben.
Die zweite Option innerhalb der externen Kritik bestreitet nicht den Wert der für die Wissenschaften konstitutiven Ziele und Standards, sondern legt an die Wissenschaften andere Maßstäbe an. Dabei geht es heute etwa um Anliegen des Tierschutzes. So wird die wissenschaftliche Forschung an Tieren vor allem deswegen kritisiert, weil sie Tieren Leid oder sogar den Tod zufügt.32
Der zentrale Kritikpunkt besteht verallgemeinert gesprochen darin, dass die Verfolgung der wissenschaftlichen Ziele und Standards in der Forschungspraxis problematische Nebenaspekte oder -folgen hat.
Auch diese Kritik ist sehr wichtig – so wichtig, wie es die moralischen Werte sind, auf denen sie basiert. Allerdings betrifft die hier in Rede stehende Kritik die Wissenschaften nicht als Wissenschaften. Mit den Maßstäben des Tierschutzes lassen sich auch die Landwirtschaft und die Industrie kritisieren. In diesem Sinne zielt die externe Wissenschaftskritik nicht auf den Kern der Wissenschaften. Sie bleibt den Wissenschaften ein Stück weit äußerlich. Das sieht man daran, dass die Wissenschaften die Kritik manchmal berücksichtigen können, ohne dass die Verfolgung ihrer epistemischen Ziele eingeschränkt würde. In anderen Fällen gibt es einen Zielkonflikt zwischen den konstitutiven Zielen einer Wissenschaft und anderen Anliegen, deren Verfolgung die Forschung stark einschränkt. Dann ist letztlich eine Art von Güterabwägung erforderlich.
Insgesamt ist der Spielraum für eine interessante Wissenschaftskritik nach externen Maßstäben begrenzt. Es ist wenig plausibel, das wissenschaftliche Streben nach Wissen und Verstehen als solches zu problematisieren. Eine externe Kritik, die das nicht tut, sondern einfach andere Maßstäbe an ein Fach legt, bleibt diesem äußerlich und trifft es nicht im Kern.
scher Charakter, siehe dazu Matthieu Queloz, The Practical Origins of Ideas. Genealogy as Conceptual Reverse-Engineering, Oxford 2021, insbesondere S. 123–126.
32 Für eine systematische Diskussion s. Bernard E. Rollin, The Ethics of Animal Research, in: T he Oxford Handbook of Animal Studies, hg. von Linda Kalof, New York 2017, S. 345–363.
b. Interne Kritik
Die interne Wissenschaftskritik problematisiert Ergebnisse oder Verfahren einer Wissenschaft anhand von deren Zielen und Standards.33 Die Kritik läuft also darauf hinaus, dass das, was als wissenschaftliches Resultat ausgegeben wird, diesen Namen gar nicht verdient oder dass Verfahren, die in den Wissenschaften angewandt werden, nicht dazu geeignet sind, zu neuem Wissen oder Verstehen zu führen. Dass die wissenschaftlichen Standards nicht zur Geltung kamen, ist bei Fälschungen von Daten offensichtlich. So wurde vor einigen Jahren der Physiker Jan Hendrik Schön der Erfindung und Fälschung von Daten überführt.34 Allerdings bezieht sich die Kritik an Fälschungen in der Regel auf das Fehlverhalten einzelner Forschender und kann daher nicht als Wissenschaftskritik gelten.
Daran zeigt sich ein allgemeineres Problem mit Wissenschaftskritik, die sich auf interne Maßstäbe beruft. Eine Kritik dieser Art, die sich wirklich auf eine Wissenschaft bezieht, müsste aufweisen, dass diese als Ganze ihren eigenen Standards nicht genügt. Dass es sich so verhält, erscheint aber unwahrscheinlich, wenn man berücksichtigt, dass die Wissenschaften selbstkritisch sind und dass die Kritik im Sinne des „organized criticism“ von Merton institutionalisiert ist. Wenn interne Kritik an einer Wissenschaft nicht einfach auf Verschwörungstheorien oder Falschaussagen beruht, dann muss sie daher von der entsprechenden Wissenschaft aufgenommen und so letztlich internalisiert werden. Die Kritik ist ja als wissenschaftliche Kritik gemeint und muss als solche ernst genommen werden. Wenn sie tatsächlich ernst genommen wird, dann mutiert diese Kritik ‚an einer Wissenschaft‘ in ‚wissenschaftliche‘ Kritik, die innerhalb dieser Wissenschaft Platz hat.35 Wohlgemerkt ist der entscheidende Punkt hier nicht, dass die Wissenschaften die Kritik berücksichtigen sollten oder tatsächlich berücksichtigen – das ist bei viel Kritik der Fall. Vielmehr ist schon die Kritik, um die es hier geht, das Geschäft der Wissenschaft selbst.
33 Mit interner (Wissenschafts-)Kritik meine ich im Folgenden immer Wissenschaftskritik nach internen Maßstäben. Diese kann von innen oder von außerhalb eines Fachs kommen.
34 Siehe etwa Stefan Jorda, Zu schön, um wahr zu sein, Physik Journal 11 (2002), S. 7–8
35 Das gilt, obwohl die Kritik, die für die Wissenschaften typisch ist, streng genommen nicht ganz genau dasselbe ist wie die in der Wissenschaftskritik. Erstere zielt auf eine vorurteilsfreie Prüfung von Hypothesen oder Annahmen, während letztere als negative Bewertung zu verstehen ist. Aber eine negative Bewertung einer Wissenschaft in Bezug auf interne Maßstäbe besagt ja, dass wissenschaftliche Ergebnisse oder Verfahren letztlich keine Erkenntnis bilden oder fördern. Aussagen dieser Art sind einer wissenschaftlichen Kritik zuzurechnen.
