DOING PATIENT
Psychotherapeutisches Schreiben in der DDR
Henriette Voelker
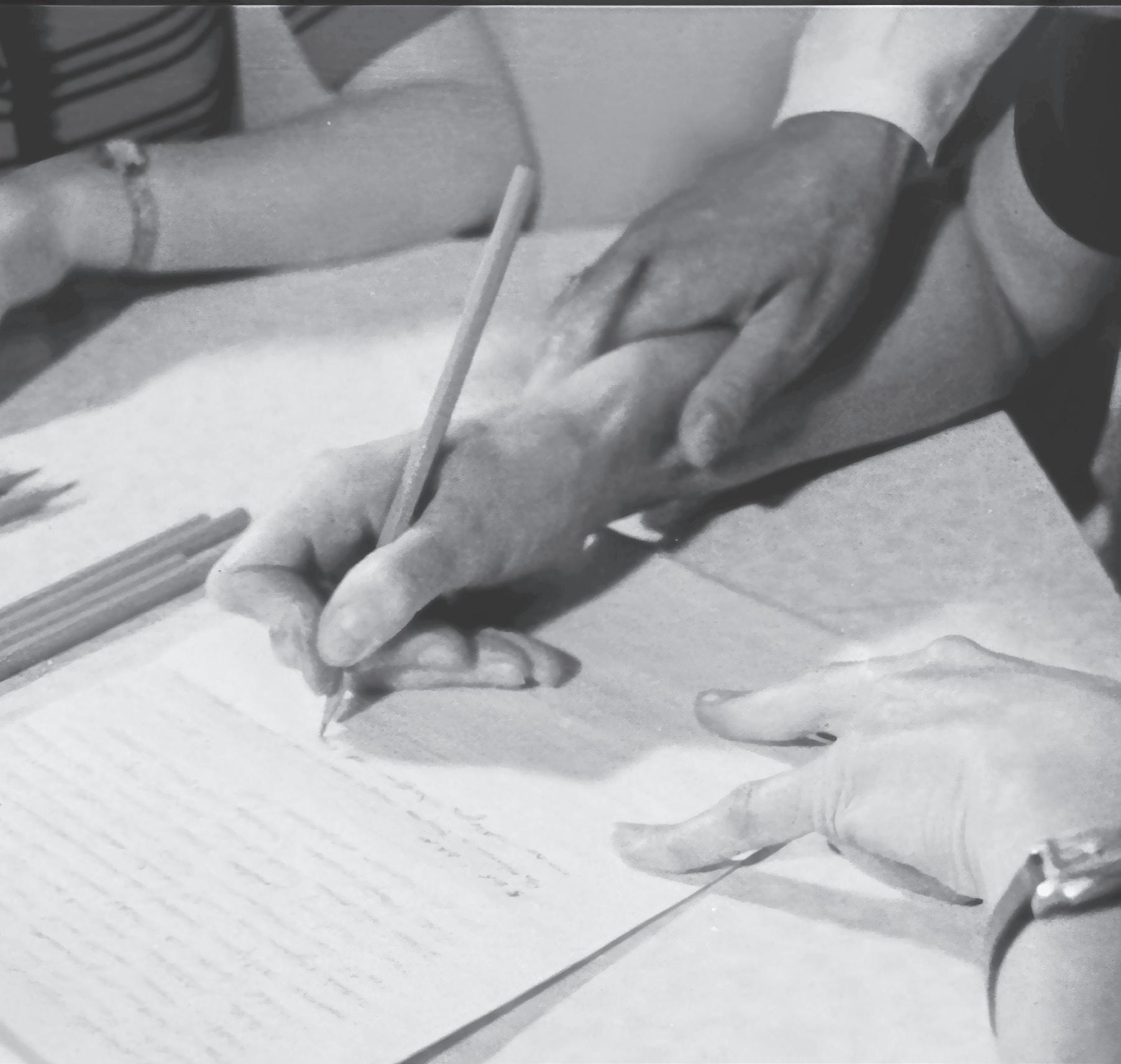

Henriette Voelker
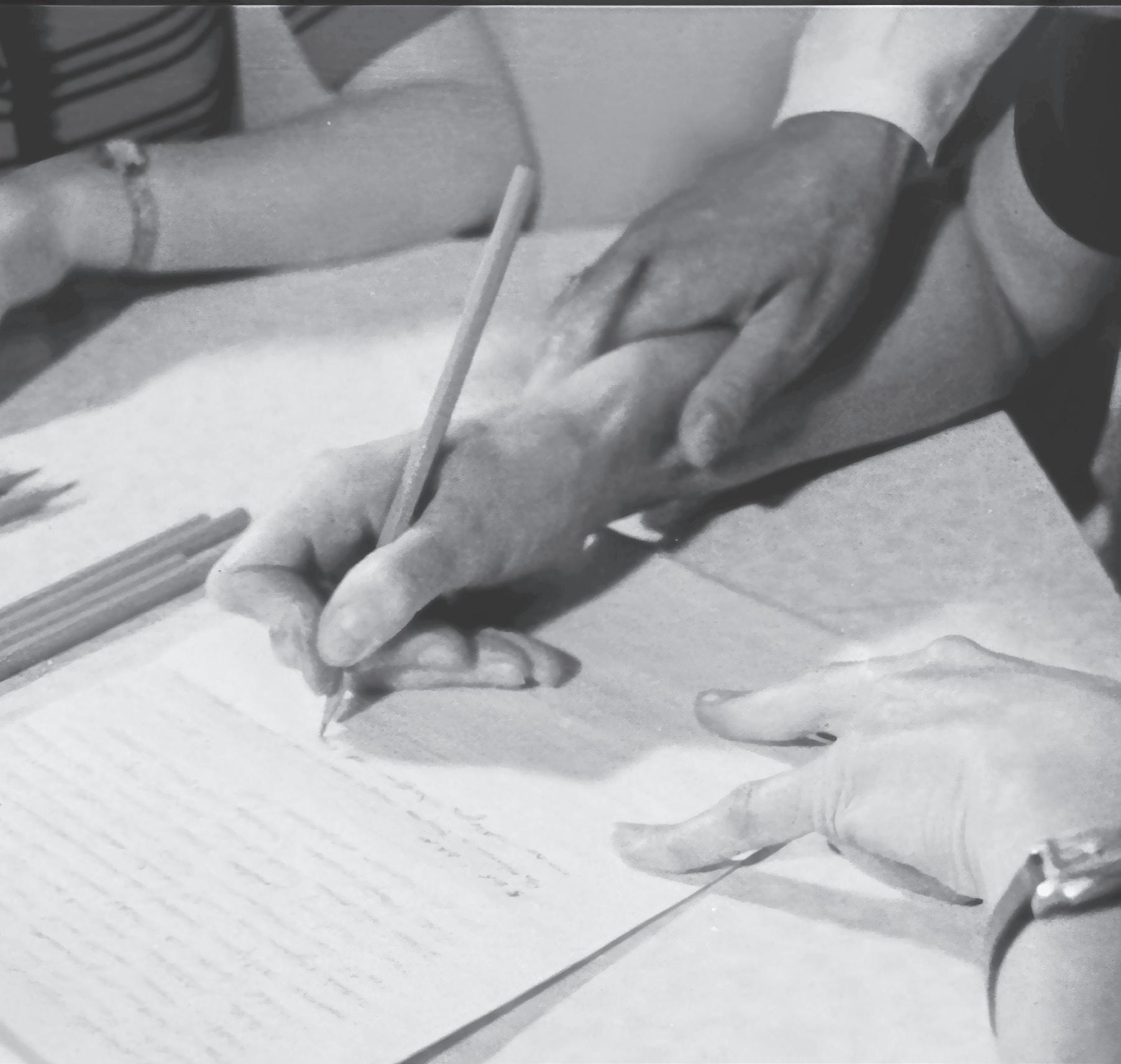
Edited by Vincent Barras, Mariacarla Gadebusch Bondio, Martina King, Susanne Michl
Volume 4
Meine Gefühle auf dem Weg in die Charité waren zwiespältiger Art. Auf der einen Seite riß ich mich schwer von meiner Frau los, auf der anderen Seite war ich glücklich, endlich auf dem Weg der Genesung zu sein. Das letztere Gefühl dominierte. Beklemmt, in Erwartung dessen, was mich hier erwartet, trat ich durch den Eingang der Station 4/5. Beklemmt, aber trotzdem froh über meinen Entschluß.1
Diese Sätze formulierte ein Mann unmittelbar nach seiner Aufnahme für eine gruppenpsychotherapeutische Behandlung an der Charité im August 1976. Die Stationen 4und 5bildeten die Psychotherapieabteilung der Psychiatrischen und Nervenklinik,2 die sich in einem der hinteren, abgelegenen Flügel des unweit der Berliner Mauergelegenen Backsteinbaus befand. Dort hatte der Mann die Zeilen am Abend mit Kugelschreiberauf Blankopapierverfasstund den nicht beschriebenen Teil des Blattes händisch abgetrennt. Dann hatte er den Berichtgefaltet und in einen kleinenPostkasten neben einem Büro der Psychotherapeut:innen eingeworfen.Amnächsten Morgen leerten die Therapeut:innen3 den Postkasten und entnahmen ihm diesen und weitereals «Tagesberichte»überschriebene Zettel, die von anderen Mitgliedern der Therapiegruppe stammten. Eilig gingen sie die Texte durch, bevor das Stationsgeschehen sie für den restlichen Tag einnahm. Im November1977 konnten sie beispielsweiselesen:
Erster Tag. Ich stelle fest:Ich habe mich gut darauf vorbereitet. Es ist alles wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich, am ersten Tag gearbeitet. [ ]Die Patienten. Gott sei Dank, normale Leute. Wie komme ich bloß darauf, daß hier Irre rumlaufen?Und ich hatte Angst davor, über komisches Verhalten lachen zu müssen. Aber komisch verhalten sich nur die Normalen. [ ]Ich war fleißig [und]habe den Küchendienst für Nichtanwesende übernommen. Nun befürchte ich, alle denken ich mach sowas gerne. Ich machs bloß weils ja einer machen muß. [ ]Die Hygiene war abwesend. Nun ja, es war kein warmes Wasser da. Jetzt bin ich (kalt)geduscht [und]mache einen halbwegs gepflegten Eindruck. […]Wovon man keine Ahnung hat, davor hat man Angst. Was ist das:kommu-
1 HPAC, 429/76M, Tagesbericht vom 23. 08. 1976. In den Quellenzitaten dieser Arbeit werden die alte Rechtschreibung und die Originalschreibweise hinsichtlich Abkürzungen, Zeichensetzung und etwaiger Rechtschreibfehler weitgehend beibehalten.
2 Im Folgenden:Nervenklinik.
3 Da sowohl Ärzt:innen als auch Psycholog:innen als Psychotherapeut:innen tätig waren, nutzt die Arbeit übergreifend den Begriff «Therapeut:innen».
Die eine Psychotherapie hat es in der DDR nicht gegeben. Wie MarionSonnemoser betont, war sie nicht zentralistisch, sondern multizentrisch organisiert.8 Eines dieser Zentren war die Nervenklinik der Charité.9 DerenLeitunghatte der Psychiater Karl Leonhard (1904–1988)zwischen 1957 und 1970 übernommen.10 Zwei Jahre später etablierte er eine Psychotherapiestation,auf der Patient:innen mit Neurosen mit seiner sogenannten Individualtherapie behandelt wurden.11 Berichte von Zeitzeug:innen über die Psychotherapie an der Charité beschränken sich überwiegend hierauf.12 Wie Henry Malach zeigt, nahm diese Methode konzeptuell manche Entwicklungen der späterenVerhaltenstherapie vorweg.13 Alexa Geisthövel machte darauf aufmerksam, dass LeonhardsEngagement für die Institutionalisierung der Psychotherapie paradoxerweise gerade den ehedem abgelehnten psychodynamischen Methoden an der Charité den Weg bereitete.14 Zwar wissen wir dank Rainer Herrn von den frühen Spuren psychoanalytischer Arbeit in der Nervenklinik vor dem Nationalsozialismus.15 Wie man Neurosen in den 1950er Jahren behandelte, besonders aber wie sich die Psychotherapie an der Charité in den 1970er Jahren weiterentwickelte, das heißt nach dem Ende von LeonhardsAmtszeit als Klinikdirektor, blieb bisher weitgehend unklar. Die vorliegende Arbeit untersucht die Etablierung psychodynamischer Therapieansätze an der Charité zu DDR-Zeiten. Sie trägt damit zur Erforschung der Geschichte der Psychotherapie in Ostdeutschland bei und füllt zugleich eine Leerstelle in der Geschichte der Institution. Dafür wenden wir uns der Rezeption der sogenannten Intendierten dynamischen Gruppenpsychotherapie16 nach Kurt Höck (1920–2008)sowie der späteren Wiederkehr psychoanalytisch orientierter Einzeltherapien zu.
Vonallen Psychotherapieformen, die in der DDR entwickelt wurden, lässt sich über die dynamische Gruppenpsychotherapie am ehesten sagen, dass sie «stilbildend»oder gar «DDR-typisch» gewesen sei.17 Zuweilen wird sie gar als
8 Vgl. Sonnemoser 2009b.
9 Zu deren Geschichte vgl. u. a. Hess 2005.
10 Zu seinem Werdegang vgl. Leonhard 1995.
11 Zur Therapie vgl. Leonhard 1959;Leonhard 1963.
12 Vgl. u. a. Neumärker 2011.
13 Vgl. Malach 2009.
14 Vgl. Geisthovel 2019.
15 Vgl. Herrn 2013.
16 Diese Bezeichnung nutzte Höck in seiner Promotion B(entspricht der Habilitation), vgl. Höck 1978. Zuvor findet sich bereits der Begriff «dynamische Gruppenpsychotherapie». Dies ist auch der Quellenbegriff aus den Akten des HPAC und er wird daher in dieser Arbeit übernommen.
17 Geisthovel 2019, S. 222.
«wichtigste Psychotherapiemethode»der spätsozialistischen Versorgungslandschaft bezeichnet, die in den 1980er Jahren eine «Monopolstellung» erreicht habe.18 Diese Position verdeckthäufig die Geschichte andererVerfahren, wie die der Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie,die es in der DDR ebenfalls gab.19 In der geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung der Psychiatrie in der DDR fanden alle diese Methoden zunächst eher wenig Beachtung. Auch als sich in den Jahren nach dem Zusammenbruch der DDR Fragennach einem etwaigen politischen Missbrauch der Psychiatrie aufdrängten, spielte die Psychotherapie eine untergeordnete Rolle.20
Die Verdrängung der Psychoanalyse hingegen fand bereits in den 1990er Jahren wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Wie Heike Bernhardt darstellte, zeichnete man den als bürgerlich stilisierten Sigmund Freud (1856–1939)zuBeginn der 1950er Jahre als den vermeintlich unwissenschaftlichen Gegenspieler Iwan PetrowitschPawlows (1849–1936).21 Der ideologische Pawlowismus, mit seiner Hochzeit zwischen 1953 und 1958, bedingte die Vertreibung von Psychoanalytiker:innen.22 In der Folge konnten keine psychoanalytischen Einrichtungen etabliert und Lehranalysen nicht offen durchgeführt werden. Sandra Schmitt machte vor wenigen Jahren darauf aufmerksam, dass sich die Psychotherapie in dieser Zeit aber zunehmend unabhängig von der Psychiatrie professionalisierte und sich zu einer eigenständigen Fachrichtung entwickelte.23 1960 gründete sich die Gesellschaft für ärztliche Psychotherapie in der DDR (GäP), in der psychotherapeutischeStrömungen aus Psychiatrie und Innerer Medizin zusammenliefen.24
Dass es einigen Therapeut:innen seit den 1970er Jahren schließlich doch gelang, psychoanalytisches Denken in der DDR zu rehabilitieren,zeigte Bernhardt gemeinsam mit Regine Lockotzur Jahrtausendwende.25
Inwiefern die dynamische Gruppenpsychotherapie als psychoanalytisch bezeichnet werden könne, war in den 1990er Jahren Gegenstand fachpolitischer Debatten. Gerade Therapeut:innen der sogenannten alten Bundesländer kritisierten diesen Anspruch, währendVertreter:innen der sogenannten neuen Bundesländer auf die Rückgewinnung psychoanalytischer Anleihen unter erschwer-
18 Sonnemoser 2009a, S. 264;vgl. Sonnemoser 2009b.
19 Vgl. Frohburg 2004.
20 Vgl. Süß 1999.
21 Vgl. Bernhardt 1998.
22 Zum Pawlowismus vgl. Dörre 2020;Balz 2019;Busse 1998. Der Pawlowismus entstammte der Sowjetunion, wo man unter Stalins Regime die Lehren Pawlows über die «höhere Nerventätigkeit», über Erregungs- und Hemmungsprozesse sowie über die klassische Konditionierung in Medizin, Biologie und Psychologie verbindlich zu machen suchte.
23 Vgl. Schmitt 2018, S. 229.
24 Vgl. König 2011c.
25 Vgl. Bernhardt/Lockot 2000a.
Therapeut:innen in der DDR auf33 und konnte zeigen, dass die dynamische Gruppenpsychotherapie in der Bundesrepublik (BRD)fast nicht rezipiert wurde, während ostdeutsche Psychotherapeut:innen über die methodischen Entwicklungen im Westen durchaus im Bilde waren.34 Neben der Literaturanalyse widmet sich die Arbeitsgruppe einem umfassenden Oral-History-Projekt mit lebensgeschichtlichen Interviews von Therapeut:innen als Zeitzeug:innen.
Bisher konzentrierten sich sowohl Debatten unter Fachvertreter:innen als auch die historische Forschung zur Psychotherapie in der DDR, zumal zur dynamischen Gruppenpsychotherapie, maßgeblich auf konzeptuelle Aspekte und die Perspektiven der Therapeut:innen. Nicht zuletzt bedingt durch die Quellenlage werden zwei entscheidende Perspektiven vernachlässigt:die Perspektiven von Patient:innen35 und der Blick in die Praxis.36 Mit der Auswertung der Tagesberichte als historische Quellen leistet die vorliegende Arbeit hier einen substanziellen Beitrag. Ein Vorteil der Praxisorientierung liegt darin,dass sie anders als bisweilen ideologisch überformte Konzeptliteratur eher Einblicke in ambivalente Alltagserfahrungen von DDR-Bürger:innen erlaubt.37 Auf diese Weise lassen sich beispielsweisedie bisher unterbelichtetenindirekten Auswirkungen der staatlichen Repression auf die Psychotherapie adressieren.38 Außerdem verknüpfen dieBefunde dieGeschichteder Psychotherapie mit derPatient:innengeschichte derDDR.ImZugeder Aufarbeitung fanden Ansichtensächsischer Psychiatrie-Patient:innen bereitsMitte der2000erJahre Beachtung.39 ViolaBalzzeigt miteiner Mikrostudie über einenPatienten derNervenklinikder Charité, wiePatient:innen in den1960erJahrenals Konsument:innen agierenkonnten,das heißt, wiesie Behandlungsmöglichkeiten auswählten undIn-
33 Vgl. Storch et al. 2020.
34 Vgl. Storch et al. 2022.
35 Dass Patient:innenperspektiven in der Medizingeschichte stärkere Beachtung finden sollten, forderte Mitte der 1980er Jahre bereits Roy Porter, vgl. Porter 1985. Seither hemmte das Quellenproblem allerdings entsprechende Bemühungen in der medizinhistorischen Forschung. Monika Ankele griff für einen Einblick in Alltagspraktiken und die Lebenswelt von PsychiatriePatient:innen um 1900 jenseits von Krankenakten auf künstlerische Objekte der Sammlung Prinzhorn zurück, vgl. Ankele 2009. Ein Band, den Philipp Osten herausgab, widmet sich vorwiegend textlichen Selbstzeugnissen wie autobiografischen Dokumenten, Tagebüchern, Briefen und Bittschriften von Patient:innen aus dem 16. bis zum 20. Jahrhundert, vgl. Osten 2010. Der Band macht besonders auf das Paradoxon der institutionellen Überformung und Unfreiheit von Selbstzeugnissen einerseits und dem Ausdruck selbstbestimmten und reflektierten Handelns andererseits aufmerksam.
36 Die historische Praxeologie erlaubt der Kulturgeschichte, über Muster des Tuns und Sprechens den vergangenen Alltag zu untersuchen, vgl. programmatisch Haasis/Rieske 2015a.
37 Zur Alltagsgeschichte der DDR vgl. Fulbrook 2008a.
38 Vgl. Gallistl et al. 2022, S. 433.
39 Vgl. Mitzscherlich/Muller 2006;Müller 2022.
formationeneinforderten.40 FannyLeBonhommewählt fürihreUntersuchungdas gleicheSetting unddiskutiert, wiePatient:innen politisch-ideologischeAspekte in derNervenklinikder 1960er Jahrethematisierenkonnten, weil sich ihrWortdurch diePathologisierung befreite 41 FlorianBruns untersucht Eingaben alsPartizipationsmöglichkeit vonPatient:innen im Gesundheitswesen.Von ihmerfahrenwir vonden spezifischen Erwartungenund Hoffnungen,die kranke Menschen an Staat undGesundheitswesenrichteten.42 DieEingabengeben außerdem Aufschluss über Mangelerfahrungenund dieGrenzen desfür Patient:innenAkzeptablen,aberauch desSagbaren. Zugleich macht Brunsauf dieweitgehende Unterbelichtungvon Patient:innenperspektiveninder Medizingeschichteder DDRaufmerksamund betont dabeiden Wert «ereignisnaher»Quellen.43 Diesem Desideratkommt diehistorische Forschungaktuell nach.MarkusWahlverweistbeispielsweiseauf die ambivalenten Alltagserfahrungen vonPatient:innenzwischenEigeninitiativeund staatlicherEingrenzung.44 Nominell schlossder umfassende Versorgungsanspruch desFürsorge- undErziehungsstaates dieEigeninitiativevon Patient:innen aus. Dass tradierteHierarchienzwischenÄrzt:innenund Patient:innen häufig bestehen blieben, führtWahlauchauf dasProfilierungsbedürfnisder Ärzt:innenschaft und eine verbreitete Erwartungshaltungvon Patient:innenbezüglich derAnleitung durchExpert:innenzurück.45 DiesePassivitätsei durchaus im Interesseder SEDFührunggewesen,daihr eineigensinniges Verhaltenvon Patient:innengefährlich erschien.Soverwundereesauchnicht,dassFunktionär:inneninder Breite die Gründung vonSelbsthilfegruppenund Patient:innenorganisationenverhinderten. Die vorliegende Arbeit eröffnet Einblicke in die Polyfonie oft gegensätzlicher und konfligierender Patient:innenstimmen. Als Mikrostudie erlaubt sie, die Komplexität und Graustufen der Alltagserfahrungen im lokalen Rahmen zu untersuchen. Damit lassen sich dem gesundheitspolitischen Paternalismus zuwiderlaufende Entwicklungen aufzeigen, die die Widersprüchlichkeiten der DDR-Geschichte unterstreichen.46 Mit dem Blick auf psychodynamische Therapien und das therapeutische Schreiben lässt sich untersuchen, wie sich der Versuch, Menschen zu therapeutisch informierter Selbstsorge anzuleiten,zum Fürsorge- und Erziehungsanspruch des Regimes verhielt. Dabei ergibt die Untersuchung der Charité mehr als nur eine Fallstudie.Zwar verfügte sie als Prestigeobjekt des DDR-Gesundheitswesens über diverse materielle, personelle und finanziellePri-
40 Vgl. Balz 2013.
41 Vgl. Le Bonhomme 2016.
42 Vgl. Bruns 2012.
43 Vgl. Bruns 2016;Bruns 2022.
44 Vgl. Wahl 2020c.
45 Vgl. Wahl 2020a, S. 20.
46 Eine solche Entwicklung zeigt bspw. Anja Werner, die auf die gelungene Selbstorganisation gehörloser Patient:innen hinweist, vgl. Werner 2020.