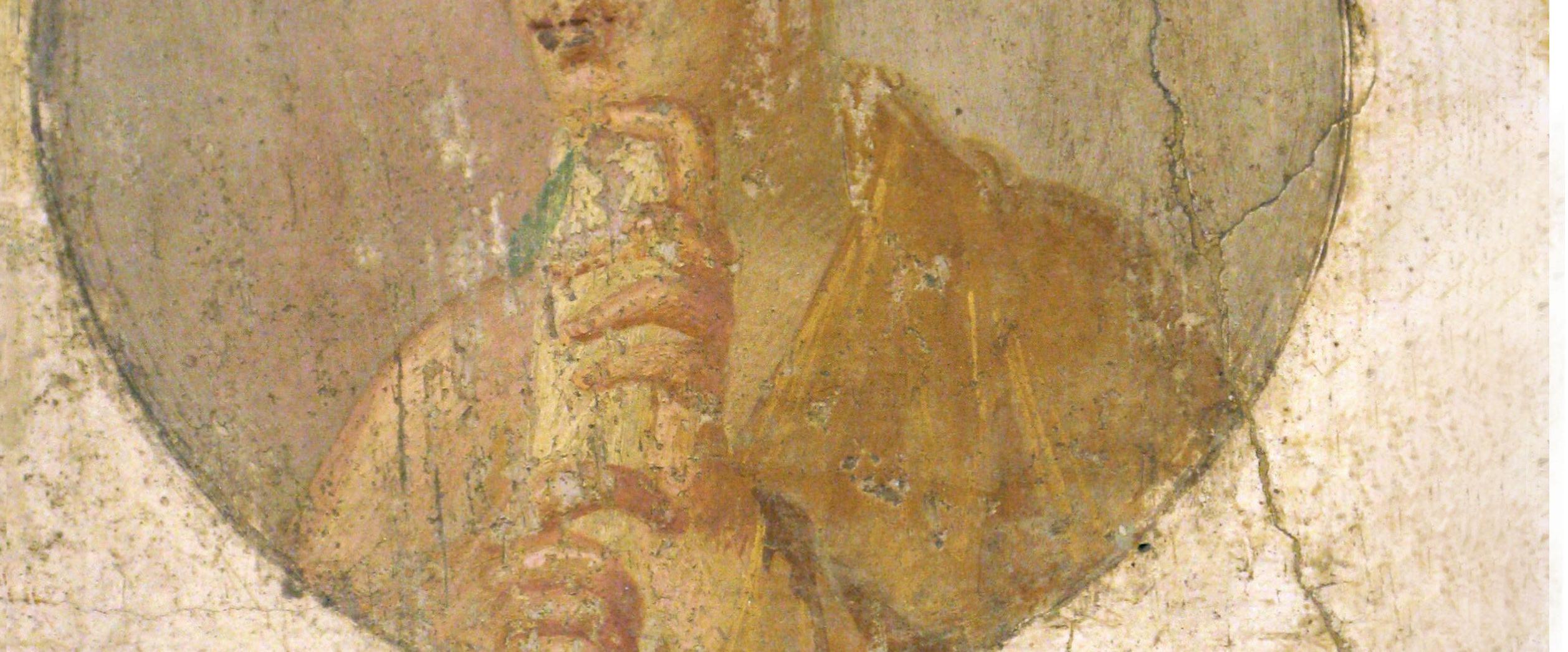
Elegie als Medienfiktion
Selbstreflexion in der Buchdichtung des Properz
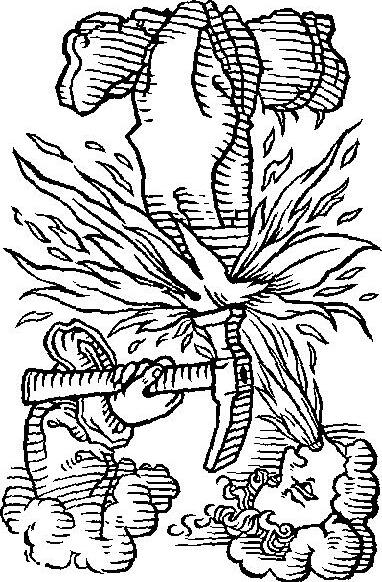

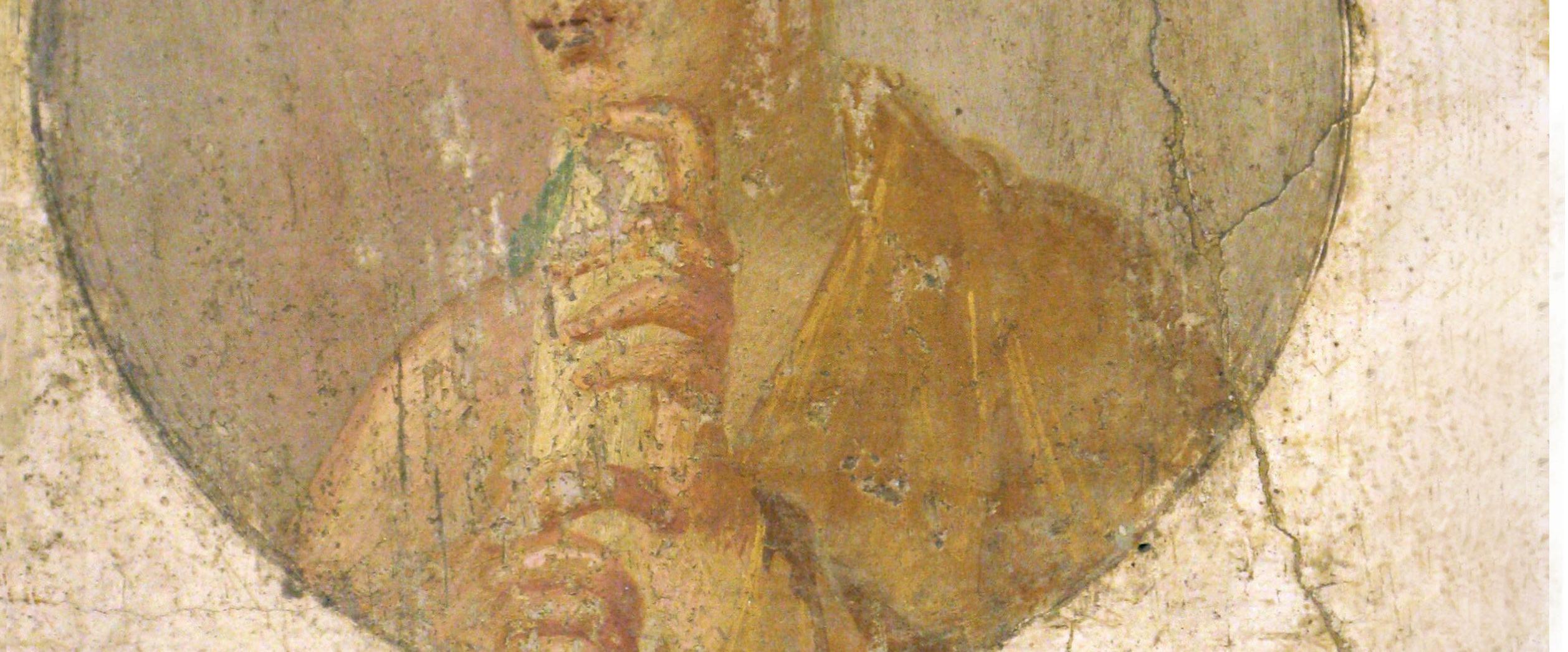
Selbstreflexion in der Buchdichtung des Properz
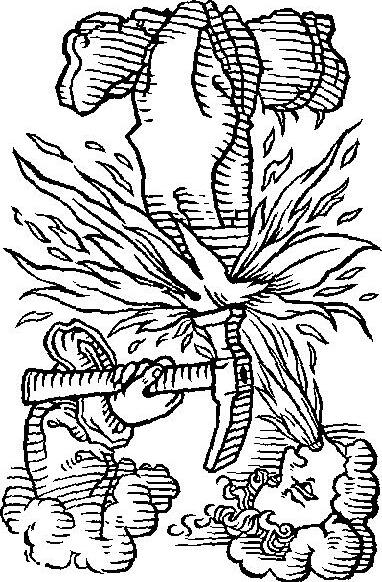
Band 64
Im Auftrag der Schweizerischen Vereinigung für Altertumswissenschaft
herausgegeben vonCédric Brélaz, Ulrich Eigler, Gerlinde Huber-Rebenich und Paul Schubert
Selbstreflexioninder Buchdichtung des Properz
Schwabe Verlag
Die Druckvorstufe dieser Publikation wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung derwissenschaftlichen Forschung unterstützt.
Open Access:Wonicht andersfestgehalten, istdiese Publikationlizenziertunter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung,keine kommerzielle Nutzung, keineBearbeitung 4.0International (CCBY-NC-ND4.0)
Jede kommerzielle Verwertung durch andere bedarf der vorherigen Einwilligung des Verlages.
Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ohne Zustimmung des Verlags ist untersagt.
Bibliografische Informationder Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2026 CorneliaRitter-Schmalz, veröffentlicht durch Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz Abbildung Umschlag: © The Picture Art Collection/Alamy Stock Foto
Korrektorat:CorneliaVoelsch,Bad Nauheim Gestaltungskonzept:icona basel gmbh, Basel Cover:KathrinStrohschnieder,Stroh Designagentur, Oldenburg Satz:3w+p, Rimpar
Druck:Prime Rate Kft., Budapest Printed in the EU
Herstellerinformation:Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Print 978-3-7965-5462-9
ISBN e-Book (PDF)978-3-7965-5463-6
DOI 10.24894/978-3-7965-5463-6
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnisund Überschriften verlinkt.
rights@schwabe.ch www.schwabe.ch
I Verba dare:Buchdichtung, ein handelbares Gut
2.1 Quid nisi verba feres? Acanthis und die Abwertung der Worte (Prop. 4,5).
2.2 Gaudere /tangere:Werthaftigkeit der Buchdichtung als ästhetisches Erlebnis (Prop. 2,26;1,8;3,2).
2.3 Tot monumenta:Prestigegewinn durch poetische Verewigung (Prop. 3,2). 81
3. Verba als Lobdichtung für augusteische Autoritäten:Wie viel ist genug? 89
3.1 Vilia tura damus: Erzähltes Ungenügen der elegischenBuchdichtung (Prop. 2,1;2,10;3,9). 93
3.2 Satis est: Erzählendes Vermögen der elegischen Buchdichtung (Prop. 2,1;2,10;3,9).
II Furores utiles:(Un-)Nutzen des Elegienbuches Einführung.
4.Musenwerk, Inschrift, Liebesbrief, Abrechnung: Der materielleText zwischen otium und negotium
4.1 Inschriften:Gewichtige (Selbst-)Repräsentation und (un-)beschäftigte Leser (Prop. 4,2). .....
4.2 Liebesbrief: Der unschöne Text als persönlicher und dringlicher Text(Prop.4,3;3,23). 134
5.Liebeslehre, Liebesmedizin, Prophezeiung: Fiktionen zweckmässiger Übertragung 145
5.1 Post haec me legatassidue neglectus amator: Erotodidaxe als Medienpoetik (Prop. 1,7;3,3). 147
5.2 Liebesdichtung – Liebesmedizin – Liebeszauber (Prop.1,10;1,5). . 159
5.3 Utinam patriaesim verus haruspex! (Un-)Lautere Weissagungen (Prop. 3,8;3,13;4,1) ..
III Velox puella:Dynamiken der Zirkulation des elegischen Gedichtbuches
Einführung.
173
187
6.Literarische Publikation und Rezeption als urbanes Liebesdrama .... .. 199
6.1 Mediale SelbstreflexionimParaklausithyron: Das Buchals Barrikade?(Prop. 1,16). ...
203
6.2 Verlorene Worte, gelungene Veröffentlichung (Prop. 1,16;1,17;1,18). 216
6.3 Toto Cynthialecta foro:Die publizierte puella (Prop.2,32). .. ... .. 229
7. Fiducia forma:Überzeitliche Prekarität und Persistenz des Elegienbuches
7.1 Das corpus zwischen Seenot, Krankheit, Alter und Brandbestattung (Prop. 2,26;2,28;3,24).
7.2 Rettung, Genesung und Apotheose der puella (Prop. 2,26;2,28;2,32). 267
7.3 Der untote TextI:Ewige Ruhe und ewige Einsamkeit im Elysium (Prop. 4,7;4,11)
7.4 Der untote TextII: Heimsuchungendes Autors und der Leserschaft (Prop. 4,7;4,11)
8.1 Zusammenfassung Teil I.
8.2 Zusammenfassung Teil II
8.3
Dass meine langjährige Auseinandersetzung mit den properzischen Gedichtbüchern nun als materieller Textvorliegt, habe ich vielfältiger Anregung und Unterstützung zu verdanken:
Der erste Dank giltdem Hauptbetreuer meiner Dissertation, Ulrich Eigler. Mit unversieglichem Wissen zur antiken bis modernen Textkultur sowie ebensolcher Aufmerksamkeit für meine Thesen hat er das Projekt und auch mich begleitet. Seinestetige Zugewandtheit gegenüberdem Alltags- und insbesondere Familienleben hat die Arbeit an diesem Buch wesentlich gefördert und freudvoll erhalten. William Fitzgerald hat mich als Zweitbetreuer mit seiner Expertise und wissenschaftlichen wie menschlichen Offenheit durchgehend unterstützt. Ihm verdanke ich eine frühe Forschungsphase in England, welche mich nachhaltig darin geprägt hat, eigene Standpunkte zu verfolgen. Helmut Krasser hatsich freundlicherweise bereit erklärt, die externe Gutachterfunktionzuübernehmen.
Das Seminar für Griechische und Lateinische Philologie der UniversitätZürich hat beste Umstände für die Promotiongeboten. Ich bedanke mich bei Carmen Cardelle de Hartmannund Christoph Riedweg für die anregendeund herzliche Atmosphäre am SGLP sowie für zahlreiche wertvolle Gespräche. Einen Aufenthalt amKing’sCollege London ermöglichte mir die grosszügigeFörderung des Schweizerischen Nationalfonds (SNF). Die Assistenzzeit durfte ich mit Kolleg_innen aus Latein, Gräzistikund Mittellatein teilen, welche diese Jahre in fachlicher wie persönlicher Hinsicht enorm bereichert haben. Mein herzlicher Dank geht hier an Laura Napoli-Zogg,Raphael Schwitter, Barbara Sigrist Leumann und Fabian Zogg sowie an Nicola Schmid-Dümmler und Urs Müller. Ebenso verbunden bin ich dem Lehrstuhlteam mit Shana Fehr und Michael Wittweiler sowie Anita Harangozó, Brigitte Marti und Dominique Stehli. Kolloquien am SGLP, an denUniversitäten Tübingen, Gießen und Göttingen sowie am King’sCollege haben es mir ermöglicht, die Dissertation im erweiterten Kreis zu diskutieren. EntscheidendeImpulse erhieltdas Projekt durch Properzkenner_innen in Oxford sowie Expert_innen aus der Mediävistik in Zürichund Bochum – besten Dank dafür. Zur Vorbereitung der Publikation haben Cornelia Voelsch und Leon Schmieder mit aufmerksamemBlick viel beigetragen. Für die freundliche Aufnahme in die Reihe bedanke ich mich bei den Herausgeber_innen der «Schweizerischen Beiträge zur Altertumswissenschaft». Arlette Neumann und Ruth Vachek vom Schwabe Verlag gilt mein Dank für die umsichtige Betreuung des Manuskriptes. Ebenfalls danke ich dem Schweizerischen Nationalfondsfür die finanzielle Unterstützung der Veröffentlichung.
Danksagung
Schliesslich durfte ich im privaten Umfeldauf Interesse und Engagement zählen:Ich bedankemich bei dem Team Platten der Stiftung kihz sowie Nina Gallizzi und Alyssa Jada Panjan. Noëmi Sohn Nad,PhilippJunker sowie Isabelle Schmalz, Stefan Ritter, Martin Ritter, Nadine Moroni, Anja Widmer und besonders meine SchwiegerelternElisabeth Ritter-Lüthi und MaxRitter standen mir stets zur Seite. Meine Eltern Verena Schmalz-Ramseyer und Peter Schmalz waren mit tatkräftiger Anerkennung immer für mich und meine Familie da.Besondersdanke ich Christian Ritter, für seine Zuversicht, Klugheit und unverbrüchliche Komplizenschaft.Ihm und unseren beiden Kindern, Grazia und Valentin, widme ich dieses Buch in Liebe.
Dieses Buch untersucht die Elegien des Properz als eine poetische Auseinandersetzung mit ihrem besonderen medialen Charakter:als Reflexion über eineBuchdichtung, wie sie um 29 bis 16 v. Chr. für das spezifische Formatder Papyrusrolle verfasst wurde. Dieses brachte die Elegiensammlung erst zu ihrer unverwechselbaren Darstellung und machte sie mittelbar.
Die Studie zeigt auf, wie der Elegiker am Übergang von der späten Republik zum Prinzipat die Präsentationseiner Dichtung in ihrer aufwendigen materiellen Gestaltung auf traditionsbewusste und zugleich innovative Weise verhandelt. Gleichermassen kommen in den Gedichten die spezifischen medialen Potenziale der Buchrolle – respektive der Kollektion mehrerer Buchrollen – zur Sprache wie auch die Grenzen und Risiken dieser Möglichkeiten. Das properzische Werkwird invariierenden, spannungsvollen Kontexten in Szene gesetzt, welche aufvisuell, auditivund haptisch wahrnehmbare Eigenheiten des Gedichtbuchs bei der Vermittlung derBuchdichtungabzielen. Schillernde Facetten der Medialitätblitzen auf an den Übergängen vonStofflichkeit und Immaterialität, von kognitiver und affektiver Wirksamkeit, von Sprachlichkeit und Nichtsprachlichkeit, von elegischerund alltäglicherWelt. Die properzischen libelli,«Büchlein», präsentieren sichals eingebettet in komplexe Zusammenhänge der Produktion, Rezeption und Distribution poetischer Texte. Sie erscheinen beteiligt an vielfältigen (literar-)kulturellen, (literar-)soziologischen sowie (literar-)ökonomischen Praktiken und Diskursen, zugleich als Artefakt und als Akteur in wechselnden (Zeit-)Räumen sowie inBeziehungen mit Autor- wie mit Leserinstanzen.
Die mediale Selbstreflexion vollziehtsich in den elegischen Gedichten über bald punktuelle, bald elaborierte Referenzen auf die römische Buchkultur und den augusteischenLiteraturbetrieb. Mit derartigen metaleptischen1 Angeboten vermag es Properz, sich und sein Schaffen als berückend greifbar auszustellen und zu problematisieren – gegenüber einer entsprechend gebildeten Leserschaft, welche mit ihrer voraussetzbaren Alltagserfahrung, insbesondere ihrem voraussetzbaren implizitenwie expliziten Medienwissen,2 am Text partizipiert. Die Art der Bezugnahmeder properzischen Schreib- und Lese-Szenen3 auf eine Realität
1 S. u. Kap. 1.5.3.
2S.u.Kap. 1.4.2.
3S.u.Kap. 1.5.3.
ausserhalb der Poesie unterscheidet sich vonVers zu Vers, von Gedicht zu Gedicht. Das Spektrum der literarischenFiktionen und ihrer Verfahrensweisen erstreckt sich von deiktischen Verweisen auf Schrift und Textträger bis hin zu Personifizierungenvon Vers und Werk. Aber auch Erzählungen historischer Medialität jenseits des Gedichtbuches werden angeboten, durch intermediale Suspension tatsächlicher Verhältnisse, wie beispielsweise anhand von Referenzen aufEpigraphik oder auf Mündlichkeit und Klanglichkeit. Der selbstreflexive Gehalt solcher oft phantastisch anmutenden Figurationen und Konstellationen eröffnet sich im Spiel von Allusionen auf erweiterteThemenbereiche des Medialen wie Körperlichkeit, Macht und Begehren. Einen besonderen Fokus legt dieses Buch aufdie subtilen und radikalen,hybriden und brüchigen Verflechtungen, welche die mediale Selbstinszenierung mit prominenten und tradierten Facetten des elegischen Narrativs eingeht – und dabei ein eigenes Narrativ begründet:Properz verschränkt seine Überlegungendarüber, was seine Elegien in Buchform für Leser_innen4 und Verfassersein können (oder eben gerade nicht), raffiniert mit Erzählungen von Liebe, Tod und Freundschaftsbeziehungen. Ebenso behandelt er zusammen mit seiner Buchpoesie diffizileFragen nach «römischer»Identität, Moral undAutonomie in besonders bewegten Jahrzehnten vor undnach der Schlacht von Actium –sowienicht zuletzt sich selbst:als Vertreter eines noch immer neuen, verheissungsvollen wie prekären Lebensstilsund alsAutor von Büchern einer nicht weniger herausforderndenGattung mit einer vielschichtigenTradition.
Mit der vorgelegten Studie5 diskutiere ich monographisch und in drei Teile gegliedert die poetische Beschaffenheit sowie die Sinn- und Wirkungspotenziale fingierter Medialität bei Properz:als sprachlich, erzähltechnisch undinihrer Imaginationskraft eigensinnige, baldspielfreudige und bald schonungslose Reflexionen über diespätrepublikanische sowie augusteische Buch- und Lesekultur.Inder literarischen Medienfiktion findet sich ein Gegenstand,welcher es ermöglicht, einen bislang noch nicht umfassend verfolgten Blickwinkel aufdas komplizierte wie faszinierende Werk von Properz einzunehmen.6 Auf derSpur metamedialer Si-
4 Ausgehend von derAnnahmeeines gemischtgeschlechtlichen augusteischenLesepublikums werden im Folgenden anderartigen Stellen inklusive Sprachformen verwendet.
5 Einige Anmerkungen zum Text:Auf lateinische Autoren und Werkeverweise ich gemäss dem Index des Thesaurus linguae Latinae,auf griechische nach dem Oxford Classical Dictionary. Zur Erleichterungder Suchfunktion im Text wurden sämtliche antikenStellenangaben mit Kommata zwischen den Nummern von Buch, Gedicht und Zeile angegeben. Im Literaturverzeichnis sind Handbücher aufgeführt gemäss den Abkürzungen in Der neue Pauly 1(1996)XV–XXXIX, die Zeitschriften sindabgekürzt nach den Angaben in der Annéephilologique
6 Publikationen, welche nach 2023 erschienen sind, konnten nur in einzelnen Fällen berücksichtigt werden. Aus den letzten zwei Jahrzehnten seien die grossen Untersuchungen zu Properz genannt,auf welche sich die Studie bezieht und die im Forschungsstand jeweils nicht gesondert erwähnt werden:Monographien: Cairns (2006b); Debrohun (2003); Gazeau (2017); Janan (2001); Johnson/Parker (2009); Keith (2008); Pinotti (2004); Ruhl (2000); Syndikus (2010); Wallis (2018). Als ältere Monographien herauszuheben:Boucher (1965); Hubbard (1974); La Penna(1977); Papanghelis (1987); Stahl (1985); Warden (1980). Sammelbände und Handbücher: Franklinos/Ingleheart (2024); Greene/Welch (2012); Günther (2006); James(2022)sowiedie Ta-
gnale und ihrer AssemblagenimText wird versucht,einem Korpus beizukommen, welches sich in seiner extremen Poetizitätgegen Interpretationen entlang linearer temporaler, biographisch-historischer, textkritisch-editorischer7 oder sonstiger Logiken gleichsam zu sträuben scheint:8 Gerade die für den Elegiker in der Forschungsgeschichteimmer wieder als charakteristisch verstandenen Brüche, Unstimmigkeiten und Kippmomente9 können in betont textnahen Lektüren literaturwissenschaftlich-philologisch produktiv gemacht werden und bisher kaum beachtete Assoziationen und Anordnungen offen legen. Auch ermöglicht es das Interesse am Zusammenhang vonelegischem Narrativ und medialer Selbstreflexion, bereits umfassend erforschte Aspekte der properzischen Elegien sowie des Genres insgesamt integrierend aufzugreifen und in neue, vornehmlich intratextuelle10 Bezüge zu setzen. Hinzu tritt die Aussicht, über eine Herangehensweise, welche die Fiktion stets ernst nimmt, zu der Ergründung der römischen Text- undinsbesondere Buchkultur beizutragen, mit welcher die poetischePhantasie darüber untrennbarverbunden ist.
Anhand von ersten Textbeispielen präzisiere ich nun Gegenstand, Herangehensweisen undForschungsstandimHinblick auf Konzepte undTheorien (Kap. 1.2–1.5), welche für die vorliegendeUntersuchung zentralsind.
gungsbände der Academia Properziana(Bonamente/Cristofoli/Santini (2014); Bonamente/Cristofoli/Santini (2016); Bonamente/Cristofoli/Santini(2018); Bonamente/Cristofoli/Santini (2020); Bonamente/Cristofoli/Santini(2023); Catanzaro/Santucci (2002); Cristofoli/Santini/Santucci (2010); Cristofoli/Santini/Santucci (2012); Santini/Santucci (2004); Santini/Santucci (2005); Santini/Santucci (2008)). Kommentare:Coutelle (2005); Fedeli (2005); Fedeli/Dimundo/Ciccarelli (2015);Heyworth (2007a); Heyworth/Morwood (2011); Hutchinson(2006); Karacsony (2018); Liberman (2020).
7Die Textgrundlage dieser Arbeit ist Fedeli (22006). Ohnetextkritischen Anspruch zu erheben, wird auf editorische Fragen punktuell eingegangen, wo sie relevant für die Argumentation erscheinen oder wenn umgekehrt dieliteraturwissenschaftlich-philologische Analyse Impulse für die Diskussion der Textgestalt geben könnte.
8E.g.O’Rourke (2024)34: «Like many lovers, Propertius is sometimes difficult to understand. Quintilian found Tibullus tersus atque elegans, but could betaken to imply that not everyone held Propertius in the same esteem (Inst. 10,1,93sunt qui Propertium malint, ‹there are some who prefer Propertius›). As a ‹modernist poet of antiquity› noted for ‹verbal exuberance› and ‹mythological complexity›,and with atext thatgoes down in OCT-history as ‹one of the worst transmitted of the classicalLatinauthors› Propertiuscalls forscholars of the highest editorial competenceand literary sensibility. Difficulties of text and style are mutually reinforcing, and inPropertius achicken-or-eggproblematic circulates between textual and literary criticism.»
9 S. zusammenfassendButrica (1997)179–183 undHubbard (1974)1–7.
10 Eine Untersuchung davon, wie Properz durch intertextuelle Gesten derAneignung sowieder Abgrenzung nicht nur an einer griechischenwie römischen Traditiondes Verfassens, sondern auchdes poetischen Beschreibens von Buchdichtungmitwirkt, ist m. E. äusserst vielversprechend, wird aber in diesem Rahmen nicht geleistet. Es kann auf folgendeStudienverwiesen werden,welcheProperz unter einzelnen Meta-Aspekten im Kontextaugusteischer Zeitgenossen betrachten:Baker(1973b); Blanco Major (2017); Farrell (2009); Fear (2000a); Gundlach (2019); Heyworth (2018); Kimmel(2014); Lowrie (2009); McCarthy (2019); Meyer(2001); Oliensis (1997); O’Rourke (2025); Roman(2006); Roman(2014); Schrader (2017); Sharrock (1991); Wyke (1989a); Wyke (1989b).
1.2 Elegie – Elegische(s) Narrativ(e)
at tu finge elegos,fallax opus (haec tua castra!), /scribat ut exemplo ceteraturba tuo. (Bsp.1:4,1,135–136)
Am Auftakt seines letzten Buches weist Properz sich selbst die elegische Gattung zu, beziehungsweise lässt er sie sich durch Apollo und den Seher Horos auftragen.11 Dies in einem Kontext schriftlich und kollektiv betriebener Dichtung (scribat ut cetera turba), innerhalb welchem dem fabulierlustigen (finge)Autor und seinem ebensolchen (fallax)Werk (opus)eine prägende Rolle zukommen soll (exemplo tuo). An zahlreichen weiteren Stellen verortet sich Properz, über explizite Referenzen auf Verfasser und Werke, im traditionsreichen elegischen Genre als einer der frühstenund passioniertesten römischen Elegiker. Vonpoetischer Machart und dabeinachhaltig gattungspoetisch und -historisch belastbar,wirddiese Selbsteinordnung in späteren antiken Metatexten – im Sinne von «Texten über Texten»12 – und bis hin zur aktuellsten modernen Forschung akzeptiert.
Als elegoi bezeichnet werden ab dem 7. Jh. v.Chr. meist kürzere Gedichte in Distichen aus Hexametern und Pentametern. Auf diese archaischen Elegien bezieht sich Properz mit Mimnermosbereits im ersten Buch (Mimnermi versus,1,9,11).13 Hervorzuheben ist an den Anfängen die Vielfalt der Themen, welche in den lediglich bruchstückhaft überlieferten Gedichten anscheinend behandelt werden – sie erstreckt sich von moralischen undpolitischen Klagen sowie Ermahnungenüber Symposiastisches bis zum Gegenstand der Liebe und der Dichtung an sich.14 Aus den wohl musikalisch begleiteten, mündlichen Präsentationen heraus entstanden spätestens im 4. Jh. v. Chr. Sammlungen in Buchform, wie von Antimachos(Antimacho,2,34,45)mit möglicherweise erotischem Schwerpunkt.15 Mit den hellenistischen Poeten wurde die Elegie zu einem Genre transformiert, dessen schriftlichliterarische Charakteristika den Verfassern durchaus bewusst waren:Von einer kunstsinnigenÄsthetik geleitet, wurde religiöse, enkomiastische, aitiologische, di-
11Vgl. zurStelleausführlich Kap.5.3.
12 Vgl. Kap. 1.5.1. Die Testimonien zu Properz als Elegiker beginnenmit Ovid: Ov. trist. 4,10,53–54: successor fuit hic tibi, Galle, Propertiusilli;/quartus ab his serie temporis ipse fui.;Quint. inst. 10,1,93: elegia quoque Graecos provocamus, cuiusmihi tersus atque elegans maxime videtur auctor Tibullus. Suntqui Propertium malint. Ovidius utroque lascivior, sicut durior Gallus; Plin. epist. 9,22,1–2: praeterea in litteris veteres aemulatur, exprimit, reddit, Propertium in primis, aquo genus ducit [ ].
13 Im ÜberblickzuProperz undden griechischenUrsprüngen s. Cairns (2006a).
14Zuden Anfängen der griechischenElegie siehe Cairns (2006a); van Groningen (1958); West (1974).Zur Gattungsterminologie s. Bowie(1986). Hunter (2013)26geht von einem «narrative ofvarious kinds»aus, soweit es die Quellenlage erlaubt.
15 Vgl. West (1974)75–76;Cairns (2006a)76f
1.Einleitung15
daktische und nicht zuletzt erotische Dichtung dezidiert alsLesetext, alsBuchpoesie produziert, verbreitet und rezipiert.16 Als römischer Fortsetzer der elegischen Tradition eines Philetas (2,34,31;3,1,1;3,3,52;3,9,44;4,6,3)und Kallimachos (2,1,40;2,34,32;3,1,1;3,9,43; Romani … Callimachi,4,1,64)präsentiert sich Properz ausgiebig und selbstbewusst – nicht zuletzt mit intertextuellen Bezugnahmen auf die alexandrinische Metapoesie und-medialität 17
Keine Frage, dass er sich ebenso unter diejenigenAutoren der späteren Republikeinschreibt,welche imGefolge von Catull (2,25,4;2,32,45)über Gallus (2,34,91) mit römischen Umsetzungen des Genresund weiterer griechischer Kleinformen experimentieren (Varro Atacinus:2,34,85–86;Calvus:2,25,4;2,34,89;Vergil:2,34,61–80).18 Fürdie lateinischeElegie prägend ist die Beschäftigung mit erotischen Themen undvornehmlich aus einer Authentizitätsuggerierenden IchPerspektive, was sich auch in der properzischen Version des Kanons am Ende von Elegie 2,34 niederschlägt bzw. durch diese weiter verfestigt wird. Wie Fantham hierzu betont, ist die römische elegische Produktionjedoch keineswegsauf eine sogenannte «Liebeselegie»zureduzieren:«For in the sum of their workTibullus, Propertius and especiallyOvid show themselves aspiring to virtually the whole amazing spectrum of speech acts, social functions and themes that[…]were explored not only by archaic Greek elegy but by its Hellenistic counterpart.»19 Inder modernen Forschung wird und wurde die (vor-)augusteische elegische Dichtung von Properz, aber auch Ovid und Tibull/Sulpicia ausunterschiedlichen Richtungen angegangen:Früh standen Fragen der Gattungsgenese und-genealogie im Vordergrund sowie die «Liebeselegie»mitsamt ihren autobiographischen Verheissungen 20 Grosses Interessegaltauch einer (sozial-)politischen Perspektivierung der Gedichte bzw. deren Verfasser, unter Annahme einer oftmals strikt gedachten Trennung zwischen pro-bzw. kontraaugusteischer Haltung.21 In den letzten Jahrzehnten rückte verstärkt das Potenzial der Elegie in den Vordergrund, jenseits derartiger Dichotomien soziale, kulturelleund politische Spannungsfelder amÜbergang von Republik und Prinzipat zu reflektieren – etwa in derpoetischen
16Vgl. Bing(1988); Cameron (1995); Hutchinson (1988).
17 Liveley (2020)246 beschreibt den fortlaufenden gattungsgenealogischen Prozess folgendermassen:«There is an apt (con)fusion here between Propertius’ characterization of his elegiac predecessors, his future readers, andhimself:itis, after all, Propertius no less than his reader who is implicatedinthe intermedial ‹imitation› (imitere)ofCallimachus.» Zur Selbstreflexion inder hellenistischenDichtung s. Asper (1997); Heerink (2015). ZurNachwirkung auf Properz s.Hollis (2006); Keith (2008)45–51;Mitchell (1985). Zur römischen Poesie s. Fantuzzi/Hunter (2002); Hutchinson (1988)277–354;zuKallimachos s. Hunter (2006); Meyer (2005); Wimmel (1960).
18 Zu Properz und den Neoterikern vgl. Courtney (1993); Hollis(2006); Hollis (2007); La Penna (1977); Ross (1975). Zu Properz und Gallus s. u. Kap. 5.2.
19 Fantham (2001) 186.
20 Zur Ursprungsfrage Jacoby(1905)und Stroh (1983), kritisch Fantham (2001) 184. Zur Auseinandersetzung mit der «Subjektivität»s.Holzberg (22001) 1f.und Jacoby (1905); zu biographischen Lektüren s. Kalinka (1930)und Wyke (2002)11–31.
21 Vgl. zur Forschungsdiskussion Berry (2005)und Kennedy (1992).
Auseinandersetzung mit Aspekten vonGeschlecht, Identität und Macht.22 Immer mehr als konstitutiv für das Genre erkannt wurde dabei – geleitet von einer Skepsis gegenüber starrenGattungskonzepten23 – die Literarizitätund Medialitätder Elegie als Buchdichtung in betont «kleiner Form»sowie der selbstreflexive Umgang damit:die eigenwillige Art zu erzählen, das Potenzialbei der Transformation und Transgression eigener sowie der Integration«fremder»gattungstypischer Eigenheiten über das strikt erotischeRepertoire hinaus sowie die spezifische Form als (im-)materieller Text in unterschiedlichsten Kontexten der Entstehung, Verbreitung und Rezeption.24 Wie dieses Buch aufzeigt, wird bei Properz eine besondere Aufmerksamkeit gegenüberletzteren Facetten der Elegie manifest, die zugleich vom Selbstbewusstsein und der Experimentierlust des Autors zeugt wie von dessenAmbiguitätsempfinden undVerunsicherungen. Damit soll ein Beitrag geleistet werden zu einem zeitgemässen und weiter entwicklungsfähigenVerständnis der Elegie als Gattungstradition.
1.2.2
Im direkten Anschluss an die obigen Überlegungen gilt es dasKonzepteines genretypischen, eines «elegischen Narrativs» bzw. «elegiacnarrative»zubeleuchten: Die englischsprachigeForschung arbeitet damit seit den1990er-Jahren gleichermassen selbstverständlich wie beiläufig, wenn es darumgeht, wiederkehrende Erzählmuster zu bezeichnen.25 Erst die grundlegenden Untersuchungen von Liveley/ Salzmann-Mitchellbieten eine dezidiert narratologische Aufarbeitung der lateinischen elegischen Dichtung unter der Leitfrage eines gattungstypischenErzählens: «whatthe nature of elegiac narrative might be and how it might differ from the ways in whichmoretraditionallynarrativegenres tell stories».26 Während dort
22Einen Überblick über moderneAnsätzegibt Fear(2000b), unterBetonung deskomplexen Status der Elegie gegenüber augusteischenRealitäten (S.154): «The elegiac text is neither asimple window onto Augustan reality nor atranscendentlinguistic artifact that has no relation to its historical moment of conception.» Rezeptionsästhetisch orientiert s. Wilson (2009)200: «Evenmore than other poetry, Roman elegy is abalancing act that requiresaudience participation. The genre lives in aliminalzonebetween literary conventionand real life in the city of Rome under Augustus. Push it oneway and it collapses into aself-referential gameofliterary subtleties;nudge it in the other direction anditdies on ahard surface of political influence and power negotiation.Itisthe reader’swillingness to sustain the spell, to refuse to read reductively, that creates the necessary atmosphere for elegy to breathe.»
23 Vgl. Fear (2000b)155.
24 Vgl. Fantham (2001) 185 f. inkl. Anmerkungen; vgl. Forschungsstand in Kap. 1.4–1.5.
25Bspw. Flaschenriem(1999)45zuSulpicia:«In poem 3,16, by contrast, the eroticnarrative takes avery different course from the oneintimated in 3,13.» Vgl. Fear (2005)13: «Finally, I consider how the endofPropertius Book 3might affect ourunderstanding of the idiosyncrasies of the elegiac vision andthe extent to which we are bound to process elegiac narrative alongset lines.»
26 Liveley/Salzmann-Mitchell(2008)34. Vgl. S. 7das Interesse an «dynamics and mechanisms of elegiac narratives using the instrument(s) and theories of narratology in asystematic way».
«narrative»implizit meist weit gefasst ist,27 beziehe ich mich aufein Konzept mit Fokus auf die Ebene der erzählten Weltals «Erzählformular»,28 zu welchem sich innerhalb der elegischen Gattungstradition gewisse Handlungsschemata29 so weit verfestigt haben, als dass sie von unterschiedlichen Erzählernausgefüllt werden können.30
Am Beispiel der Sulpicia-DichtungstelltLiveley folgende«Topoi»des elegischenNarratives zusammen:«separation;sexual infidelity;anover-protective guardian or vir;her reputationor fama;the writing of erotic poetry;and,above all, realizing amutually shared, equal love».31 Für Properz betonen gerade Wyke und Flaschenriem die zentraleBedeutung der puella Cynthia, der weiblichen Hauptfigur,imgattungsspezifischen Erzählprogramm.32 Zweifelsohne dominiert im römischen elegischen Narrativ die Liebeshandlung vordergründig, alsliterarisches«Masternarrativ».33 Dies gilt auch für Properz, trotz aller Experimente, Brüche und Suspensionen, die sich durch die vier Gedichtbände hindurchziehen –wohl auch aufgrund der gattungskonstitutiven Bedeutung sowie der Belastbarkeit, Wandelbarkeit und Anschlussfähigkeit des erotischen Narrativs für andereErzählungen. Nicht zuletzt bietet die Ausstellung erotischer Verstrickungen dem Autor wie seinen Leser_innen faszinierende und immersionsfördernde Dramatik und Brisanz sowie die Verheissung exklusiver Authentizität dererzählten Geschehnisse, Gefühle und Gedanken. Wenn die römische Elegie, wie bereits die griechische Elegie, nicht auf die Liebesthematik beschränkt verstanden werden soll, bietet sich eine Perspektive auf die Texte an, die weitere Facetten des Narrativs, weitere Erzählstränge identifiziert. Sozusagen als Para-, Sub- oder Teilnarrative kommen beispielsweise Vergänglichkeit und Tod, Autonomie vs. Abhängigkeit, individuelle vs. kollektive Identität, Urbanität vs. Ländlichkeit und traditionelle vs. progressive Lebensführung in den Blick.34 Diese in sich oftmalsspannungsvollen Themenkom-
27Eswerden unter anderem diverse Ebenen des sprachlichen Ausdrucks damit umfasst,vgl. die frühe Forschungsdiskussion um «elegiac» vs. «epic narrative»(vgl.Blanco Mayor (2017).
28Koschorke (42017)34.
29 Zur Diskussion,inwieweit Elegien über erzählte Handlung verfügen, vgl. Liveley/SalzmannMitchell (2008)2–7.
30 Koschorke (42017)30–34.
31 Liveley (2012)414. Vgl. Wyke (1994)114 ebenfalls zu Sulpicia, aberbeispielhaft füralle Augusteer: «This lover/poet, like the others, renders the beloved subservient to herelegiac narrative oflargely frustrated love and poetic composition.»
32 Bspw. Flaschenriem (1997)261:«Even in her absence, then, Cynthia’sname punctuates the narrative and helps sustain its continuity [ ].»; Wyke (2002)53: «Correspondingly, the elegiac woman is not portrayed as abeloved receiving or inspiring poetry, but as anarrative subject tobecontinued or abandoned.»
33 Der Begriff wird allerdings wie bei Koschorke (42017)19vor allem auf einer soziologischen Ebeneverwendet für Narrative, «indenen sich Gesellschaften als ganze wiedererkennen».
34ZuProperz s. Weinlich (2011) 40:«Moreover, he widens both the scopeand the topic of Roman love elegy’snarrative, which is commonly confined in each individual poem to arathernarrow time frame, on the one hand,and to the theme of elegiac love, on the other.» Ohne narratologische Perspektivierungen s. zu den genannten Themenkomplexenbeispielsweise Bowditch(2023); Eigler (2002); Janan (2001); Lowrie (2009); Papanghelis(1987); Roman (2014); Zimmermann Damer (2019).
plexe werden in der properzischen Poesie wiederkehrend auserzählt undarbeiten dabei inter- wie intratextuell an der elegischenTradition mit. Wie dasBeispiel der gattungsprägendenDenkfigurdes servitium amoris als Nexus der (Teil-)Narrative35 von Liebe und Abhängigkeit zeigt,36 sind die Erzählstränge nicht isoliert zu betrachten, sondern vielmehr alsmiteinander verflochten. Dabei hatauch die Dichtung ihren Platz, etwa wenn Cynthia ausdrücklichdurch sanfte Verse gezügelt wird (1,8,39–40) – oderals domina das Schreiben des verliebten Dichters bewertet (2,13a,11–14).37
Es ist erklärtes Anliegen dieser Monographie, die elegische Buchpoesie an sich, mitsamt ihrer Gestaltals materieller Textund in vielfältigen medialen Funktionen, als prominenten Gegenstand des gattungstypischen Erzählensbei Properz zu erkennenund zu analysieren. Hierzu anregend, bestimmt Liveley im Dichten über das Dichten einen von zwei konstitutiven, gleichermassen von Strapazen und Kampf geprägten Strängen des elegischen Narrativs:«the […]story-arcs moreover which appear to shape the narrative of all Romanlove elegy, sharing the same agents and emplotting the same events:the battle to find an equallove, and the battle to write about it in elegiacform.»38 Mit «elegiac form»weist sie darauf hin, dassessich um ein metapoetisches Narrativ handelt:Gerade durch die bereitsangesprochenen Referenzen auf die elegische Gattung sowie Werk-und Autorennnamen wird die Identität von erzählter und erzählender Dichtungimmer wieder aufs Neue verheissen. Oder lakonisch ausgedrückt:«The elegiacnarrative ispainfully self-absorbed.»39 Wie präsent und dabei eng verbunden Selbstreflexionund Erotik sich im elegischen Text begegnen, beschreibt bereits Connolly:«one ofelegy’smost distinctive features is what we might call its ‹unifying› stance toward the twin discourses of sex and poetics».40 Regelrecht blumig formuliertFear: «the dynamicsofloving and writing eddy around each other in adizzying swirl».41 Die gattungstypische Nähe des erotischenund (meta-)poetischen, selbstreflexiven Narrativs wird auch deutlich im properzischen Protagonistenpaar und
35ImFolgenden bezeichne ich auch einzelne Erzählstränge als «Narrative», vor allemdas erotische oder das metamediale Narrativ. Mit «elegischem Narrativ»ist jedoch stets das heterogeneKollektiv gemeint.
36 Vgl. Fulkerson (2013)inkl. Bibliographie,insb.S.181 f.: «the compulsion to write may be figured as an all-consuming erotic relationship in which the difficult and intractable subject matter holds all the power, and this may itself be seen as akind of enslavement. […]So, on a narrative level,the capricious domina makes an ideal blocking character (Veyne (1988)138).» Dabei wird die enorme Variabilität derNarrative betont (S.187): «But either way, it is important to note thatthis is only oneofa series of subject-positionsadoptedbythe elegist;there are many otherpartstothe story andmany other roles to play.»
37 S. zu diesen Stellen Kap. 2.2 undKap. 6.1.
38 Liveley (2012)414. Gesondert für Properz, jedoch ohne narratologische Perspektive, listet Maltby (2006)folgende «major themes and motifs»auf, welche auch auf weitere Erzählmuster verweisen können:«teacher of love»; «love as adisease»; «love as slavery»; «love as military service»; «love and death»; «poetry».
39 Wyke (1994)111.
40 Connolly (2000)89. S. auch McNamee (1993).
41 Fear (2012)89.
1. Einleitung19
seinem Tun:Propertius und Cynthia funktionieren bereits aufder elegischen Handlungsebene zugleich als Liebhaber und Geliebte sowie alsDichter undAdressatin oder Inspiration dessen Dichtung. Auf einer Metaebene hingegen vermögen puella und poeta ebenso wirkungsvoll die Instanzen von Autor und Text, aber auch Leser zu verkörpern.
An diesem Punkt setzt der Fokus meiner Untersuchung aufzweifache Artan. Erstens, indem das metapoetische Narrativ dezidiert und in einem der Forschung bislang singulärem Umfang auch alsein metamediales Narrativ verstanden wird: Wenn Properz von seiner oder auch fremder Dichtung erzählt, vollzieht sich dies oft mit Emphase auf spezifische (im-)materielleEigenheiten des poetischen Textes. Ebenso kommen die vielfältigen kommunikativen Konstellationen insSpiel, innerhalb derer der Text fungiert – oder eben gerade nicht fungiert. So wird an der eingangs zitierten Beispielstelle1 mit wenigen Versen elegische Produktion differenziert in Szene gesetzt:Die Schar der Nachahmer von Properz wirdbei der handfesten und als mühselig konnotiertenSchreibhandlung (scribat)42 nach menschlichem Vorbild(exemplo … tuo)imaginiert. Dagegen soll die eigene Poesie (elegos; carmine,133 s. u.) in einem schöpferischen Prozess (finge)und durch göttliche Eingabe (Apollo,133 s. u.) entstanden sein, in Ursprung und Form schillernd zwischen Prophezeiung und Diktat sowie Mündlichkeit und Schriftlichkeit (pauca … dictat,133).
Zweitens, indem die Verflechtungen im Detail untersucht werden, welche die metamedialenErzählungen mit dem erotischen Erzählstrang, aberauch mit anderen Elementen des elegischenNarrativs eingehen. Ein Blick auf den Kontext von Textbeispiel1 vermagdiese hybride Grundkonstellation zu verdeutlichen,bei welcher gleichermassen traditionsreiche43 wie experimentell-innovativeThemen, Motive, Diskurse, Orte undInstanzen miteinander ins Spiel kommen:Zunächst stellt Properz die MotivationseinesSchaffens als göttlich verordnete Abwendungvon alltagssprachlichen,juristisch-politischen Diskursen (verba tonare)und den damit verbundenen, durchdas Forum repräsentierten konservativen Tätigkeiten und Werten der männlichen römischen Oberschicht dar (4,1,133–134): tum tibi pauca suo de carmine dictat Apollo/ et vetat insano verba tonare Foro. Wie bereitsgezeigt, wird Propertius (71)eine modellhafte DichterlaufbahnimKreis der aktuellen Literaturszene befohlen.Erst dann, im Fortgang des Gedichts, erfolgt die als Selbstverständlichkeit präsentierte Assoziierung des Verfassens erotischer Poesie mit erotischerErfahrung: militiamVeneris blandis patiere sub armis /etVeneris pueris utilis hostis eris (137–138). Unter rasanter Bemühung topischer Imaginationen der Liebe als Militär- und Sklavendienst (bene fixum mento uncum,141; ansa,142),44 aber auch alsNiederlage von athletischem Ausmass, erscheint sämtli-
42S.u.Kap. 5.3.
43 Vgl. Riesenweber (2007)385 zu den kallimacheischenAnklängen sowieS.214 zu Ovid-Bezügen.
44 Vgl. Hutchinson (2006)85f