LogikDAVID
SCHMEZER
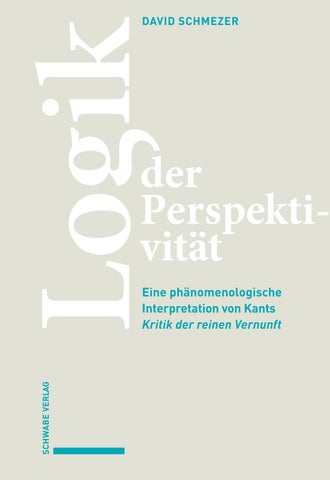
SCHMEZER
Eine phänomenologische
Interpretation von Kants
Kritik der reinen Vernunft
David Schmezer
Eine phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft
Schwabe Verlag
Die Druckvorstufe dieser Publikation wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt.
Open Access:Wonicht anders festgehalten, ist diese Publikationlizenziertunter der Creative-CommonsLizenz Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung 4.0 International (CCBY-NC-ND 4.0)
Jede kommerzielle Verwertung durch andere bedarf der vorherigen Einwilligung des Verlages.
Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.deabrufbar.
© 2025 David Schmezer, veröffentlicht durch Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz
Korrektorat:Julia Müller, Leipzig
Cover:icona basel gmbh, Basel
Layout:icona basel gmbh, Basel
Satz:3w+p, Rimpar
Druck:Prime Rate Kft., Budapest
Printed the EU
Herstellerinformation:Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch
Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR:Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Printausgabe 978-3-7965-5408-7
ISBN eBook (PDF)978-3-7965-5409-4
DOI 10.24894/978-3-7965-5409-4
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
rights@schwabe.ch www.schwabe.ch
Nirgends ist, was du erstrebst;das Geliebte, wende dich ab!verlierst du. Was du erblickst, ist nur Schatten, nur Spiegelbild. Aus sich selbst ist es nichts:Mit dir kam es, mit dir bleibt es, mit dir wird es scheiden –wenn du nur zu scheiden vermöchtest!
Ovid, Metamorphosen
Zweiter Teil
II.1.3 Abstrakte
II.1.6 Begriff und Anschauung:psychologisch?.
II.1.7 Funktion und Gegenstand:mathematisch?.
II.1.8 Das Logische als Funktion:Aber wie ist die Welt in dieses Netz geraten?.
II.2 Formallogische Sackgassen
II.2.1 Die Übereinstimmung von Begriff und Gegenstand
II.2.2 Die oberste Gattung und die
II.2.2.1
II.2.2.2
Konkrete Identität
II.3.2.1 Analytisch
II.3.3
II.3.4
II.3.5 Die Kategorie und die Ausklammerung des Seins
II.3.6 Funktion und Gegenstand:transzendentallogisch
Dritter Teil
III.1 Kants
III.2 Dekonstruktion des naiven Realismus: Ich und ‹Gegen-stand›
III.2.1 Vonder Substanz zur Funktion
III.2.2 Der unendliche Behälterraum als das formallogische ὑποκείμενον
III.2.2.1 Die Empfindung als mathematischer Punkt
III.2.2.2 Das Sehen des Sehens:Das Lichthafte des Bewusstseins
III.2.3 Transzendenz in Immanenz
III.2.4 Andere Räume, oder:Ding versus Gegenstand ...
III.3 Der Begriff der Perspektive
III.3.1 Die Perspektive in der Kant-Forschung ..
III.3.2 Die Perspektive aus kunsthistorischer Sicht und als Form menschlichen Weltumgangs ...
III.3.3 Die philosophische Relevanz der Perspektive
III.3.4 Punkt und Perspektive ...
III.3.4.1 Eine neue Ausgangslage für das alte Problem der Bewegung
III.3.4.2 Der springende Punkt:Bewegung als Transcreation
III.3.4.3 Die Falte:Ewige Formen als vergegenständlichte Funktionen
III.3.4.4 Der lebendige Spiegel: Die Monade als das wahre Atom
III.4 Der sich zum Raumkontinuum aufspannende (Zeit) Punkt des Bewusstseins
III.4.1 Raum und Zeit als Formen der Anschauung
III.4.2 Die Nulldimensionalität der Zeit und das qualitative Moment der Bewegung
III.4.3 Die Aktualisierung des inneren Sinnes als Selbstaffektion
III.4.3.1 Selbstaffektion, oder:Von der Introspektion zum Beisichsein im Anderen
III.4.3.2 Der Schematismus
III.4.3.3 Der Punkt
III.4.3.4 Die Linie
III.4.3.5 Die Fläche
III.4.3.6 Der Raum
Ausblick:Der Widerspruch und die Frage der Darstellung
Anhang
1.
2.
Zur Schreibweise
Die vorliegende Untersuchung handelt von der philosophischen Logik. In systematischer Rekonstruktion der Kritik der reinen Vernunft (KrV)wird aufgezeigt, weshalb die KrV anders als gemeinhin angenommen nicht als Erkenntnistheorie sondern als eine philosophische Logik zu lesen ist, konkret als Reflexion auf die Möglichkeitsbedingungen des Gegenstandsbezuges oder der Sachhaltigkeit einer sich als bloss formal verstehenden Logik – so wird nämlich die in der Arbeit als Hauptfrage bezeichnete Frage nach den Möglichkeitsbedingungen synthetischer apriori Urteile ‹übersetzt›, deren Beantwortung nach Kant die «eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft»(KrV, B19) ist. Dabei stellt sich heraus, dass, wenn der Ausdruck ‹formale Logik›heute nach einem Pleonasmus klingt –weil Logik per definitionem formal sei –und darüber hinaus die Vorstellung eines Instrumentes oder Werkzeugs evoziert, das auf ausserlogisch gegebenes Material angewendet wird, dass Kants Probleme dann immer noch die unsrigen sind.
Die Interpretation der KrV als Logik ermöglicht eine kohärente Gesamtauslegung der KrV und eröffnet einen Blick auf den systematischen Zusammenhang von Logik, Erfahrung und Sprache, in dessen Gesichtskreis noch Hegels Phänomenologie des Geistes (PhG)steht. So wird nachvollziehbar, warum aus der KrV «gerade Linien»1 in die PhG führen. Am Begriff der ‹Perspektivität› wird die im Ausdruck ‹Phänomenologie›anklingende Vermittlung von Logik und Erfahrung, die in den jeweiligen Erfahrungs- respektive Bewusstseinsbegriffen der KrV und der PhG auf unterschiedlich fortgeschrittenen Reflexionsebenen verhandelt wird, der Kantischen Verständnisstufe dieser Vermittlung gemäss mithilfe von Leibniz, dem Kant viel verdankt, erstmals detailliert herausgearbeitet. Der Nachweis, dass diese beiden Schlüsselwerke des deutschen Idealismus nicht nur nicht gegeneinander auszuspielen sind, sondern sich hinsichtlich der genannten Problemkreise gegenseitig bedingen und erhellen, wird über eine Kontextualisierung der Sprache formallogisch-empiristischer Bewusstseinsanalyse erbracht, mit der die KrV zwar noch ringt, über die sie an sich aber hinaus ist. Wider naiv realistische, ontische Fehldeutungen des philosophischen Idealismus ist ein Verständnis für die Unabdingbarkeit nicht-denotativer Redeformen (nicht nur)inKants logischer Reflexionsarbeit zu gewinnen. Die Schwierigkeit besteht allgemein gesagt darin, den sich selbst enthaltenden Be-
1 F. Kaulbach, Der philosophische Begriff der Bewegung,229.
griff, den Limes der formalen mathematischen Logik, ins Denken aufzunehmen und zu begreifen, dass der Logos der philosophischen Tradition Kants und Hegels die Form eines Selbstgespräches besitzt, das jedoch kein Soliloquium ist, und dass diese Philosophie, der die sprachliche Darstellungsform des prädikativen Aussagesatzes ‹S ist P› nicht weniger fremd ist als diejenige poetischer Allusion, nie bloss über positivierbare Gegenstände spricht, sondern der Versuch ist, durch die Arbeit am Begriff zu verstehen, was es heisst, nicht formallogische Modellwelten, sondern Wirklichkeit ins Wort zu setzen.
Der Mainstream der akademischen Kant-Forschung ist heute nicht in der Lage, die immense philosophiegeschichtliche Bedeutung der KrV über eine historisierend-philologische Verwaltung dieses epochalen Werks hinaus sachlich nachzuvollziehen. Nicht selten wird Kant nach wie vor als Gründer einer als Phantasiedisziplin verschrienen «transcendental psychology»2 gelesen, in der die im schlechten Wortsinne ‹spekulativen›idealistischen Systeme seiner Nachfolger schon angelegt seien, oder aber als lange überholter, metaphysisch-obskurer Vorläufer einer spätestens mit Gottlob Frege einsetzenden, bescheideneren Philosophie der Begriffs- und Sprachanalyse. Dass die KrV jenseits solcher formallogisch-empiristischen Vereinnahmungen durchaus verständlicher ist als eine «curious mixture of metaphysics and epistemology»3,kann nur begriffen werden, wenn die Kopernikanische Revolution nicht als Hinwendung zu einem neuartigen Untersuchungsgegenstand namens ‹Erkenntnissubjekt›oder ‹menschliches Erkenntnisvermögen›gelesen wird, dessen Einrichtung und Aktivität Kant dann beschrieben haben soll, sondern als Revolution der philosophischen Logik im Rahmen der Beantwortung der eingangs erwähnten Hauptfrage. Kant hat in der KrV nicht die Frage beantwortet, was oder wieviel wir erkennen können. Am Grunde seiner logischen Reflexionsarbeit, der es –ganz in der Tradition des platonischen Liniengleichnisses –umdas systematische Einholen der Voraussetzungen des Denkens und Erkennens zu tun ist, schlummert die schwierige Logik der Selbsterkenntnis, des Gnothi seauton,des Erkenne dich selbst, des höchsten Zwecks der Philosophie.
Dieses Buch ist die leicht überarbeitete Version meiner Dissertationsschrift, die Ende Frühjahr 2024 dem Philosophischen Institut der Universität Bern vorgelegen hat. Sie entstand zu Teilen am Lehrstuhl von Prof. Dr. Richard King, dem ich die Ermöglichung des Doktoratsstudiums verdanke. Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer danke ich herzlich für die Bereitschaft zur Übernahme des Zweitgutachtens, für das Interesse und die Offenheit, die er meiner Arbeit entgegengebracht hat, für die beratende Funktion bei der Verlagssuche und nicht zuletzt für seinen monumentalen Kommentar der Phänomenologie des Geistes,der mir
2 P. F. Strawson, The Bounds of Sense,32.
3 M. und W. Kneale, The Development of Logic,355.
vor zehn Jahren einen ersten Zugang zur Hegelschen und Kantischen Philosophie eröffnet hat. Die Dr. Joséphine de Karman-Stiftung und die Universität Bern, Letztere in Zusammenarbeit mit swissuniversities,der Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der schweizerischen Hochschulen, haben die Anfertigung des Manuskripts durch ein Promotions- respektive Mobilitätsstipendium unterstützt. Den drei Institutionen gilt mein aufrichtiger Dank. Herzlich danke ich auch Christian Barth vom Schwabe Verlag für das Interesse an meiner Arbeit und für die äusserst kompetente und umsichtige Betreuung der Publikation.
Dieses Buch würde nicht existieren ohne sehr viele Menschen, die mit ihrer Unterstützung und Anteilnahme das Entstehen des Manuskripts über fünf Jahre hinweg begleitet haben.
Besonderen Dank aussprechen möchte ich DDr. phil. Max Gottschlich, ohne dessen Hilfe diese Arbeit womöglich im Keim erstickt worden wäre. Herzlichen Dank für die langjährige Unterstützung, für das Verständnis und die wohlwollende Anteilnahme, für die gemeinsame Kant-Lektüre, für die Gewissheit, dass der Preis für den Ausbruch aus den festen Geleisen der abstrakten Identität nicht der Verlust des Verstandes ist, sondern der Gewinn des menschlichen Begriffs und nicht zuletzt für den Hinweis auf die Perspektivität und die Arbeiten Friedrich Kaulbachs.
Dr. Werner Schmitt danke ich für die meisterhaften Vorträge, die mich durch das Doktoratsstudium begleiteten, für die plastischsten, anschaulichsten, lebendigsten mir bekannten Erörterungen des Hegelschen Begriffs, für die vielen lehrreichen Briefe, für die Geduld und für die Ermutigung, langsam zu sein.
Vongrösster Bedeutung für meine philosophische Bildung und für die Auseinandersetzung mit Kant waren die Tutorien zur KrV, die ich in den Jahren 2017–18 an der Universität Bern zusammen mit David Hermann leitete, dem ich viel verdanke. Nie die grossen Fragen aus den Augen verlierend versuchten wir, uns zu orientieren, herauszufinden, was die Transzendentale Deduktion mit unserem Leben zu tun hatte und begannen irgendwo zwischen Michael Hampes makroskopischen Die Lehren der Philosophie und der akribischen Lektüre der KrV zu verstehen, dass das grosse Ganze nur am Detail aufleuchtet und dass in der Philosophie mit der Nüchternheit auch die Begeisterung wächst4 –vielen Dank, David, für deinen Scharfsinn, deine Kritik, für das andauernde Gespräch. Ich danke den Teilnehmenden der Kant-Tutorien und Hegel-Seminare, die ich zwischen 2017 und 2024 am philosophischen Institut der Universität Bern halten durfte, allen, die Fragen stellten, Kritik und Bedenken äusserten, mitdachten und bereit waren, ihre Ideen zu teilen;ausserdem den Multeguezlis past
4 «Das ist das Maas Begeisterung, das jedem Einzelnen gegeben ist, dass der eine bei grösserem, der andere nur bei schwächerem Feuer die Besinnung noch im nöthigen Grade behält. Da wo die Nüchternheit dich verlässt, da ist die Gränze deiner Begeisterung.» (F.Hölderlin, Frankfurter Aphorismen,58).
and present von Herzen fürs Dasein, Nachfragen, Zuhören, Caren, Kochen, Ablenken, Feiern und vieles mehr; Alex und Levin insbesondere für die AmöbenPerformance;Claudia für die Gespräche über Betreuungsverhältnisse, Forschungspolitik, den Wissenschaftsbegriff, Interdisziplinarität und die Körperlichkeit des Schreibens, für das Verständnis, das gemeinsame Einordnen und Kontextualisieren und nicht zuletzt für die Hinweise auf Fördergefässe und Eingabefristen;meinen Eltern für die Suche nach den opalgrünen Bänden;meiner Mutter für den Vorlesungsbesuch, für die Begeisterung, für die Bedingungslosigkeit;meinem Vater insbesondere für das Korrekturlesen, das gemeinsame Feilen an der Sprache, für all die Stunden;meinen Geschwistern Yannic und Nico für die Leichtigkeit;Sarah für das Verständnis, fürs Dasein, für Wien, für das Wort von Mariella Mehr und den schönsten Blumenstrauss;Jonas und Samir für die Bereitschaft, darüber zu diskutieren, ob man einen Meter sehen kann;Philipp Schmutz von der Beratungsstelle Berner Hochschulen für die Erinnerung an 塞翁失馬焉知非福;Sebi für die Erklärungsvideos und langen Sprachnachrichten zur Funktionenlehre und Kurvendiskussion; ausserdem allen, die mich an der Kaiserstrasse besuchten und mir die letzten Meter versüssten;allen, die an die Verteidigung kamen:Hädi, Nora Räss und Nora Ryser, Niccolo, Zoe, Yann, Linda, Marc, Roland, Verena, Lia, Michi, Leonardo, Joana, Luki, Cleme, Janir, Mirj, Léo, Thea, Beni, Rahel, Nici und Louise;allen Freund: innen, die Anteil nahmen, die Verständnis hatten für wiederkehrende Phasen übermässiger Absorbiertheit und entsprechender Abwesenheit, die nicht müde wurden, nachzufragen, zuzuhören, Mut zuzusprechen –danke für eure unbedingte Unterstützung.
Bern, im Februar 2025 David Schmezer
Den Verstand muss man achten und verachten.
Günter Wohlfart
Aus der gemeinen Wirklichkeit gibt es nur zwei Auswege, die Poesie, welche uns in eine idealische Welt versetzt, und die Philosophie, welche die wirkliche Welt ganz vor uns verschwinden lässt.
F. W. J. Schelling
Der auf den folgenden Seiten entwickelte Gedankengang hebt an mit der allgemeinen Frage nach dem Motiv, dem Gegenstand und dem Zweck der Kritik der reinen Vernunft (KrV). Wenn wir, wie Kant denkt, unsere «Beurtheilung»jeweils «vom Ganzen an[zu]fangen»und «auf die Idee des werks samt ihrem Grunde [zu] richten»haben, wobei «[d]as übrige […]zur Ausführung [gehört], darin manches […]gefehlt seyn und besser werden»5 kann, dann ist gegen die in der akademischen Philosophie zu beobachtende Tendenz einer Engführung von Wissenschaftlichkeit und isolierbarem Expert:innenwissen über vorgängig festgelegte und mannigfach eingegrenzte Untersuchungsgegenstände zunächst an «das Systematische der Erkenntnis»(KrV, A645/B 673)zuerinnern und darüber hinaus ein Bewusstsein für die Differenz zwischen dem Sprechen über Philosophie und dem Philosophieren selbst zu wahren. Weil die vorliegende Studie sich an Letzterem versucht, tritt sie, wider den Usus, nicht als eine dem Geschehen entrückte Moderatorin auf, die abwechselnd ‹verschiedenen›(Hegel)Lesarten einschlägiger Passagen und prominenter Begriffe das Wort gibt, sondern mutet sich zu und erachtet es als ihre Aufgabe, sich auf das Grundsätzliche und Allgemeine, i. e. auf das Wesentliche einzulassen, aus dem nach Kant alles Weitere fliesst. Die vermeintliche Anmassung hat ihren Grund in der Sache selbst. Die Transzendentale Logik ist nämlich nichts anderes als die Reflexion der Formalen Logik und damit an sich die Überwindung der mathe-
5 Kant, Reflexionen zur Logik,AAXVIII, 64.
matisch-technischen Selbstinterpretation des Denkens,6 das meint, in der tragischen Disjunktion festzustecken, entweder «an vielen Dingen wenig» oder «an wenigen Dingen viel»(Log. §16) erkennen zu müssen und sich, um seinen Ruf nicht zu verlieren, stets für Letzteres entscheidet, wobei es übersieht, dass unter diesen Voraussetzungen wirkliche Erkenntnis von vornherein ausgeschlossen ist (cf. Kap. II.2). Deshalb ist denn auch die Befürchtung, die dem mathematischformallogisch geschulten common sense unmittelbar einleuchtet, dass Fragen, die aufs Ganze gehen, aufgrund ihres übermässigen Umfangs (Extension)der Differenziertheit oder Tiefe (Intension)akademischer Schriften abträglich seien, frei nach Hegel nicht als Furcht vor der Oberflächlichkeit zu interpretieren, sondern als Furcht vor der Reflexion.7
Die Vorstellung, dass das überblickshafte, abstrakte, inhaltsarme Allgemeine oder Grundsätzliche und das in die Tiefe gehende, konkrete, inhaltsreiche Besondere oder Detail an gegenüberliegenden Enden eines kontinuierlichen Spektrums liegen und dass also die Wege zum Allgemeinen und zum Besonderen, dass Abstraktion und Konkretion in entgegengesetzte Richtungen führen, wird widerlegt vom höchsten Begriff der Transzendentalen Logik, dem (transzendental)logischen Ich oder wie Kant es nennt:der ‹synthetischen Einheit der transzendentalen Apperzeption›. Das logische Ich ist der «höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr, die Transzendental-Philosophie heften muss»(KrV,B 134). Es ist das laut Kant bei Aristoteles vergeblich gesuchte Prinzip ‹aller›Kategorien, die keine vereinzelten, in losem Verbund nebeneinanderliegenden und «rhapsodistisch», in einer «auf gut Glück unternommenen Aufsuchung»(KrV, A81/B 106)gefundenen, grundlegenden Formen des Seins oder allgemeinste Prädikate der erkennbaren Gegenstände sind. Es ist im Ansatz das Hegelsche konkrete Allgemeine, das die KrV durchzieht wie der Fluchtpunkt das perspektivisch gemalte Bild. Es ist die Idee, die dieses Werk trägt und von der her es bis ins letzte Detail auszulegen ist. Darüber hinaus kämpft das Allgemeine oder das Grundsätzliche mit dem Vorurteil, dass wir mit ihm, dieser Abstraktion, schnell fertig sind. In der Tat weiht ein kurzer Blick in die B-Einleitung in das offene Geheimnis ein, dass die «eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft»und somit der KrV in der Frage «enthalten» sei, wie «synthetische Urteile apriori möglich» (KrV, B19) sind. Aber die Nominaldefinition einer Sache ist bekanntlich «geschenkt»(KrV, A 58/B 82), und fruchtbarer als vielzitierte Passagen wortgetreu zu referieren, wäre es, in einer lebendigen und verständlichen, i. e. in einer vernünftigen Sprache, die weder Kant paraphrasiert, noch, bedacht darauf, sich im «dornichten» (KrV, BXLIII)Dickicht der Philosophie keine Blessuren zuzuziehen, erleichtert den ausgetretenen Pfaden kanonisierter Kommentare folgt, auszuformulieren,
6 Cf. M. Gottschlich, Die Überwindung der technischen Auffassung der logischen Form.
7 Cf. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, TW 3, 70.
was das eigentlich heisst. Die Bedingung der Möglichkeit der hier vorzutragenden Auslegung der KrV, ja überhaupt allen Lesens, ist ein Begriff des Nominalismus, oder anders gesagt, ein Bewusstsein für die Differenz von Schrift und Geist. Kant selbst wusste,
dass es gar nichts Ungewöhnliches sei, sowohl im gemeinen Gespräche, als in Schriften, durch die Vergleichung der Gedanken, welche ein Verfasser uber seinen Gegenstand äussert, ihn so gar besser zu verstehen, als er sich selbst verstand, indem er seinen Begriff nicht genugsam bestimmte, und dadurch bisweilen seiner eigenen Absicht entgegen redete, oder auch dachte. (KrV, A314/B 370)
In diesem Sinne wird der Gedankengang der KrV an bestimmten Stellen zuzuspitzen sein, um durch diese Pointierung die dialektische Bewegung, die am Grund des Werks schlummert, zum Vorschein zu bringen. Das ist keine Zauberei, sondern ergibt sich aus dem konsequenten Festhalten an den formallogischen Eindeutigkeitsforderungen (Liebrucks), so z. B. im Rahmen der Diskussion des Synthetischen Apriori, dieses aus formallogischer Sicht hölzernen Eisens, das die Einführung eines Zeitbegriffes erfordert, der nicht identisch ist mit dem formallogischen, den wir in Anschlag bringen, wenn wir sagen, dass ein Ding a zu einem gegebenen Zeitpunkt tentweder Poder ¬P ist, aber nie beides gleichzeitig. Dass das Synthetische Apriori die (formallogischen)Bedingungen seiner eigenen Formulierbarkeit gerade aufhebt und einen anderen Zeitbegriff verlangt, ist nur nachvollziehbar, wenn wir streng an der formallogischen Auffassung festhalten, dass das Prädikat entweder im Subjektbegriff liegt (analytisch) oder nicht (synthetisch), und es kein Drittes gibt. Es wird also nicht darum gehen, formallogische Auffassungen etwa von logischer Form und Zeit einfach zu verneinen, sondern darum, sie zu Ende zu denken. So nimmt die Dialektik ihren Lauf.
Den Verstand [die Formale Logik, D. S.] muss man achten und verachten. Es gilt, durch den Verstand zur Vernunft zu kommen;zur Vernunft zu kommen, ohne den Verstand zu verlieren. Es gilt ganz bei Verstand zu bleiben. Am Verstand festhaltend stösst sich der spekulativ-vernünftige Begriff von ihm ab.8
Denn «Kant verstehen heisst über ihn hinausgehen».9 Es ist zu betonen, dass das nicht heisst:Wir können Kant besser verstehen, wenn wir über ihn hinausgehen und ihm in den Mund legen, was er noch alles hätte sagen sollen. Was Kroner sagt, ist radikaler:Kant zu verstehen, heisst nichts anderes, als über ihn hinauszugehen. Ihn verstehen ist gleichbedeutend mit dem Hinausgehen über ihn. Nur im Hinausgehen über Kant –das in Wahrheit ein Bei-ihm-Bleiben ist –hin zu Hegel erschliesst sich einem die immense philosophiegeschichtliche
8 G. Wohlfart, Der Punkt,34.
9 Richard Kroner, VonKant bis Hegel,27.
Bedeutung der KrV, die unter den Prämissen der heutigen Kant-Forschung nicht nachvollziehbar ist (cf. Kap. II.3.6). Die in der Forschungsliteratur routiniert vorgenommene, ganz nominalistische Trennung zwischen der Philosophie ‹Kants›und derjenigen seiner Nachfolger ‹Fichte›, ‹Schelling›und ‹Hegel›ist ohne substantielle Begründung wert- und in der Tat gedankenlos. Dass Kant und Hegel der Sache nach zunächst überhaupt nicht gegeneinander ausgespielt werden können, werden wir sehen. Das heisst aber auch, dass es nicht zu vermeiden sein wird, bisweilen ausdrücklich gegen den Wortlaut der KrV zu schreiben. Kants Frage nach dem Synthetischen Apriori fungiert jedoch auch in dieser Studie als Leitfaden der Ausführungen. Denn in dieser «expressis verbis logische[n] Frage»10 liegt der Schlüssel zu der in der neueren Kant-Forschungsliteratur bis auf wenige Ausnahmen (z.B.Max Gottschlich)nicht diskutierten Auslegung der KrV nicht als einer Erkenntnistheorie, Ontologie, Wissenschaftstheorie, Vermögenspsychologie, philosophischen Anthropologie, Metaphysik der Erfahrung oder blossen «analysis of the concept of experience»11,sondern als einer Logik, wofür, beginnend mit Kants unmittelbaren Nachfolgern Fichte, Schelling und Hegel, im 20. Jahrhundert insbesondere Richard Kroner12 und Bruno Liebrucks argumentiert haben, wobei letzterer im vierten Band von Sprache und Bewusstsein eine entsprechende Gesamtinterpretation der KrV vorgelegt hat, die in der akademischen Kant-Forschung bis heute nicht rezipiert wird. Die Differenz von Schrift und Geist hervorzuheben, bedeutet nun freilich nicht, sich einen hermeneutischen Freipass auszustellen und der willkürlichen, tendenziösen Aneignung fremder Gedanken Tür und Tor zu öffnen. Es bedeutet aber, dass zur Kunst des Lesens (ahd. lesan, auswählend sammeln, aufheben, an sich nehmen, [sich ver]sammeln, in Ordnung bringen), wenn sie die Bedingung der Aufrechterhaltung der Differenz von philosophiegeschichtlicher Forschung und Paraphrasiertechnik bleiben soll, eine Kunst des Nicht-Unterscheidens13 (cf. das von Kant hervorgehobene Moment der Synthesis in der Erkenntnis)gehört. Das Schlagwort der Stunde ‹analysieren›(griech. ἀναλύειν,auflösen)legt nahe, dass diese Kunst gemeinhin zu kurz kommt. Die Kunst des Nicht-Unterscheidens, die in Wahrheit nichts anderes ist als die Kunst des Unterscheidens, ist die Kunst des Lesens und Verstehens. Texte sind auszulegen. So stossen nicht nur Interpretationen, die den Anspruch verfolgen, eine Schrift von der ihr zugrundeliegenden Idee her systematisch zu rekonstruieren, zwangsläufig auf ein-
10 B. Liebrucks, Drei Revolutionen der Denkart,85.
11 Strawson beschreibt die Transzendentale Deduktion, die als Kernstück der KrV gilt, als «analysis of the concept of experience»(P. F. Strawson, The Bounds of Sense, 31).
12 Indem Kant «als Erster den Gedanken der Selbstbesinnung des Ich in die Logik ein[führt]», wird er «der Schöpfer einer neuen Logik.» (R.Kroner, VonKant bis Hegel, 39).
13 Cf. das Kapitel «Die Kunst der relevanten (Nicht‐)Unterscheidung»in: P. StekelerWeithofer, Hegels Phänomenologie des Geistes I, 95 ff.
zelne Formulierungen oder ganze Passagen, die sich nicht nahtlos ins Gesamtbild einfügen. Und abgesehen davon, dass nicht auszuschliessen ist, dass sich der Autor der KrV bisweilen selbst widersprach, kommen wir in der Philosophie nur weiter, wenn es uns gelingt, das Wesen einer Sache im günstigen Augenblick beim Schopfe zu packen und uns nicht in Einzelheiten zu verlieren. Es gilt, die «stiptische»14 Kraft des Denkens zu kultivieren, seine Gedanken zusammenzubringen15 und der Verlockung der Zerstreuung, des entspannten Buchführens über Gebrauch und grammatischen Zusammenhang einschlägiger Ausdrücke, i. e. dem bequemem «Wortforschen»16 zu widerstehen, das sich meistens darin erschöpft, unter der schützenden Autorität der Primärquelle streng am ursprünglichen Wortlaut entlang zu schreiben, Aspekte zu unterscheiden und sich in der Kunst des Paraphrasierens zu üben. Aber das blosse Unterscheiden, das sich, weil es kein inneres Mass besitzt, aus Verlegenheit dem magischen Sprachverständnis17 des Nominalismus anheimgibt, verkommt zum Sophismus.18 Auch Kant rät davon ab, in scholastischer Gelehrsamkeit Namen auseinanderzuhalten.
Wir haben den Verstand oben auf mancherlei Weise erklärt:durch eine Spontaneität der Erkenntnis, (imGegensatz der Rezeptivität der Sinnlichkeit)durch ein Vermögen zu denken, oder auch ein Vermögen der Begriffe, oder auch der Urteile, welche Erklärungen, wenn man sie beim Lichten besieht, auf eins hinauslaufen [Hervorhebung, D. S.].
(KrV, A126)
Angesichts des Vorwurfes unrechtmässiger Vereinfachung primärliterarischer Komplexität –wobei sich dialektisches Denken nebenbei bemerkt jenseits der Gegenüberstellung von ‹einfach›und ‹komplex›bewegt –ist daher stets an die Kunst des Nicht-Unterscheidens und die Systematizität allen Erkennens zu erinnern und zu betonen, dass der Sophismus gerade dort lauert, wo das Ziehen terminologischer Unterscheidungen und das Hervorheben von Schwierigkeiten zum Selbstzweck erhoben wird.19 Die KrV aber ist schwierig genug. Wir wollen versuchen, sie zu begreifen.
14 Kant, Träume eines Geistersehers, AA II, 368.
15 «[D]enn das Spekulative besteht im allgemeinen in nichts anderem, als seine Gedanken, d. i. die man schon hat, nur zusammenzubringen». (G.W.F.Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion II, TW 17, 452).
16 Kant, Über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll,AAVIII, 250.
17 Die Formulierung stammt von Max Gottschlich.
18 Hegel erblickte in der «skeptische[n] Methode»eine blosse «Ausrede für den Mangel an Philosophie»(Hegel an Mehmel, 26.8.1801, Briefe I, 63).
19 «Aber es ist ein sophistischer Kunstgriff, Sätze nicht geradezu zu widerlegen, sondern nur Schwierigkeiten zu zeigen.» (Log. §79).