ELITEHÄFTLING

Wie Österreichs Bundeskanzler Kurt Schuschnigg die Nazi-Gefangenschaft überlebte
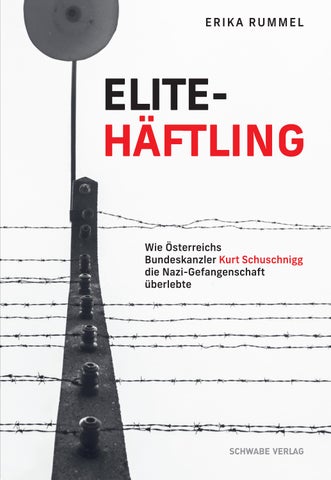

Wie Österreichs Bundeskanzler Kurt Schuschnigg die Nazi-Gefangenschaft überlebte
Wie Österreichs Bundeskanzler Kurt Schuschnigg die Nazi-Gefangenschaft überlebte
Aus dem Englischen von Christine Christ-von Wedel
Schwabe Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2025 Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschließlich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.
Abbildung Umschlag:Karsten Winegeart über unsplash.com
Korrektorat:Thomas Lüttenberg, München
Cover:icona basel gmbh, Basel
Layout:icona basel gmbh, Basel
Satz:3w+p, Rimpar
Druck:Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza
Printed in Germany
Herstellerinformation:Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch
Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR:Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de
ISBN Printausgabe 978-3-7965-5397-4
ISBN eBook (PDF)978-3-7965-5398-1
DOI 10.24894/978-3-7965-5398-1
Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
rights@schwabe.ch www.schwabe.ch
Ich danke meinen Freunden und Kollegen Susan Ingram, Karin MacHardy und Milton Kooistra für ihre Hilfe und ihren Rat. Dank gebührt auch Karin Holzer, Christoph Mentschl, James Baker, Nancy Lyon und James King sowie den Mitarbeitenden des Österreichischen Staatsarchivs, des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Wien, der Sterling Library an der Yale University bzw. der Bibliothek der University of Warwick. Auch danke ich den anonymen Gutachtern des Manuskripts für ihre entscheidenden Kommentare, Anne Laughlin für ihr scharfsinniges Lektorat und Stephen Shapiro für die Begleitung dieses Buches durch den Veröffentlichungsprozess. Ich bin ihnen sehr dankbar für ihre Zeit und ihren Einsatz.
Christine Christ-von Wedel, einer langjährigen Kollegin und lieben Freundin, danke ich dafür, dass sie die schwierige Aufgabe übernommen hat, mein Buch ins Deutsche zu übersetzen und die Originalzitate zum besseren Verständnis vorsichtig neuerer Sprech- und Schreibweise anzugleichen. Ich kann mir keine fähigere und effektivere Übersetzerin vorstellen. Sie hat ein feines Gespür für Sprache und musste in diesem Fall die zusätzliche Schwierigkeit bewältigen, die österreichisch geprägte und inzwischen etwas antiquierte Sprache Schuschniggs für heutige Deutschsprachige zugänglich zu machen. Für all ihre Bemühungen und ihr Durchhaltevermögen in der Zeit einer schweren Krankheit, die nun glückerweise überwunden ist, möchte ich ihr meinen herzlichen Dank aussprechen. Auch Rolf Zaugg gilt mein Dank, der die Chronologie für die Ansprüche der deutschsprachigen Lesenden erweiterte, und Yvonne Häfner für ihr Korrekturlesen sowie den Verantwortlichen im Schwabe Verlag für die Publikation der deutschen Version.
Sachsenhausen,1942. Unser Heimist recht nett. Außen Holzverschalung, innen Zentralheizung und elektrischer Herd. Zimmer zwar klein, aber immerhin genügend:4 ganze und 2halbe Räume, plus Küche und Bad.
Nur wenige Menschen in Deutschland genossen im Zweiten Weltkrieg den Luxus einer Zentralheizung und eines funktionierenden Elektroherds –schon gar nicht die Häftlinge in den Konzentrationslagern. Ja, das oben beschriebene gemütliche holzgetäfelte Häuschen befand sich in einem Konzentrationslager nördlich von Berlin, wo Kurt Schuschnigg von 1941 bis 1945 interniert war. In Sachsenhausen starben etwa 100.000 Menschen, insbesondere Juden und politische Gefangene. Laut der Aussage des Lagerkommandanten Anton Kaindl bei seinem Prozess 1947 in Berlin gab es „eine Hinrichtungsstätte, in der Häftlinge erschossen wurden, einen mobilen Galgen und einen mechanischen Galgen, an dem jeweils 3oder 4Häftlinge erhängt wurden …ImMärz 1943 führte ich Gaskammern für Massenvernichtungen ein.“1
Die Gräueltaten, die in den Konzentrationslagern begangen wurden, und die Schrecken der Gaskammern sind gut dokumentiert und weithin bekannt. Aber kaum jemand hat je von Elite- oder „VIP“-Abteilungen gehört, die in verschiedenen Lagern existierten. Kein normaler Häftling hatte je Zutritt zu diesen besonderen Bereichen. Primo Levi schreibt in seinem Buch Survival in Auschwitz (Überleben in Auschwitz), dass sie „für die Prominenz“ reserviert waren:für die Berühmten, die Wohlhabenden, die Aristokraten.2 Die Nationalsozialisten sonderten Häftlinge aus, die bedeutende Verbindungen zur Außenwelt hatten und deren Tod oder Verschwinden für das Regime unangenehme Fragen aufgeworfen hätte. Gegen Ende des Krieges, als sich die Niederlage abzuzeichnen begann, galten alle Elitehäftlinge
als wertvolle Geiseln und wurden an sichere Orte gebracht.3 Kurt Schuschnigg, der letzte österreichische Bundeskanzler vor dem „Anschluss“, gehörte selbstverständlich zu dieser auserwählten Gruppe. Er beschreibt seine Wohnung im Konzentrationslager Sachsenhausen in einem auf den 15. Januar 1942 datierten Brief an seinen Onkel, Hermann Wopfner.4 Schuschnigg wurde ein Haus zugewiesen und auf sein wiederholtes Drängen hin sogar eine Haushaltshilfe. Vor allem durfte er mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter zusammenleben. Schuschnigg war privilegiert, aber er blieb ein Gefangener:Aus dem normalen Leben gerissen, ohne ordentliches Verfahren inhaftiert und –jelänger, je mehr –ohne Hoffnung auf Entlassung. Seine Schriften zeugen von dem Trauma, unter dem er litt, als er, der Kanzler eines Landes, über Nacht zur Unperson wurde. Er wurde zunächst in den Gestapo-Zentralen in Wien und München in Einzelhaft gehalten (Mai 1938 bis Dezember 1941) und dann in das Konzentrationslager Sachsenhausen überführt. Dort blieb er in Gefangenschaft, bis zu seiner Befreiung durch die Alliierten im Mai 1945. Mein Buch behandelt die Jahre von Schuschniggs Gefangenschaft zwischen 1938–1945. Es soll die materiellen Bedingungen seiner Haft dokumentieren und durch eine kritische Lektüre von Schuschniggs Tagebüchern und Briefen seinen Umgang mit diesen Bedingungen und seine Strategien für das psychologische und intellektuelle Überleben untersuchen. Bei diesem Ansatz stellt sich natürlich die Frage nach der „Wahrheit“. Wie kann sie in Selbstzeugnissen gefunden werden, die auf persönlichen Erinnerungen beruhen und durchsetzt sind mit unausgesprochenen Absichten?Solche Quellen zu analysieren, erfordert Sensibilität für die Probleme der Subjektivität, der psychischen Blockierung und, da „alles Erzählen das Erzählte modifiziert“,5 für die rhetorische Gestaltung des Materials durch den Autor. Auf diese Probleme gehe ich im folgenden Abschnitt „Quellen“6 näher ein. Dort erörtere ich die Publikationsgeschichte der Schuschnigg-Tagebücher und die Art, wie sie im Laufe des Redaktionsprozesses verändert wurden. Andere Fallstricke behandle ich in den Kapiteln über Schuschniggs Umgang mit seinen Erinnerungen, die er als eine Art Palliativum nutzte. Ich diskutiere die Absicht des Autors und die Historisierung.7 Den politischen Kontext –Hitlers Annexion Österreichs und die Frage, ob Schuschnigg falsche Entscheidungen traf oder mehr hätte tun können, um die Autonomie seines Landes zu retten, und ganz allgemein den Verlauf des Zweiten Weltkriegs
behandle ich nur, soweit sie für mein Hauptthema, für Schuschniggs Bewältigungsstrategien, bedeutsam sind.
In der historischen Forschung ist es wichtig (und oft frustrierend), die Fakten aus künstlichen Konstruktionen und Vorstellungen herauszulösen.
In meinem Buch steht jedoch nicht die Suche nach einer historischen Rekonstruktion im Mittelpunkt. Vielmehr will diese Studie, um Bruno Latour zu zitieren, über die „Tatsachen“ zu den „Anliegen“8 vordringen, also erst den faktischen Wahrheitsgehalt von Schuschniggs Erzählung ermitteln, um sie dann als Beitrag zur kollektiven Erinnerung an das NS-Regime zu betrachten. Dies wiederum wird zum Nachdenken über die dauerhaften Auswirkungen und die Relevanz von Schuschniggs Erfahrungen für unsere Zeit anregen, in der Entmenschlichung und unrechtmäßige Inhaftierung nach wie vor Realität sind. Schuschnigg sieht seine Tagebücher als Zeugnis für den Versuch eines Menschen, Mensch zu bleiben. Die Frage, wie man sicherstellen kann, dass etwas von uns, so wie wir einmal waren, noch übrig bleibt, war ein existenzielles Problem für alle Nazi-Häftlinge.9 Psychologen haben viel über die Auswirkungen des Lebens in Gefängnissen und insbesondere in Konzentrationslagern geschrieben –berühmt ist Viktor Frankl, eher umstritten Bruno Bettelheim.10 Die allgemeinen Forschungsinteressen verlagerten sich im Laufe der Zeit, von der Betonung des intensiven Leidens der Häftlinge hin zum „emotionalen Freeze“, zum Erstarren, in das sie angeblich fielen. Neueste Studien beurteilen die Auswirkungen nuancierter. Sie konzentrieren sich eher auf die psychischen Ressourcen der Gefangenen und analysieren den Einfluss der inneren Stärke des Einzelnen auf die Art, wie er seine Haft bewältigte. Als Historikerin erhebe ich nicht den Anspruch, einen Beitrag zur Psychologie zu leisten. Meine Studie nutzt Schuschniggs Ich-Erzählungen insbesondere als sozialgeschichtliche Quelle. Mein Ziel ist, seine persönlichen Überzeugungen, Gewohnheiten und kulturellen Interessen zu untersuchen sowie die Rolle, die sie in der Zeit seiner Haft für ihn gespielt haben, herauszuarbeiten. Die Geschichte dieses einzelnen Mannes wirft ein helles Licht auf die Verhaltensmuster des Bildungsbürgertums, der kulturell und intellektuell engagierten Menschen in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Parallelen zwischen Schuschniggs Erzählung und den Memoiren anderer NS-Häftlinge weisen darüber hinaus auf Gemeinsamkeiten in den Überlebensstrategien hin. Dabei soll keine einfache Gleichung zwischen den Erfahrungen von Schuschnigg und anderen
Holocaust-Überlebenden gezogen werden. Im Gegenteil, es geht darum, sie schärfer voneinander zu unterscheiden und unsere Wahrnehmung der Häftlingshierarchien zu verfeinern, indem ein Thema behandelt wird, das die Geschichtswissenschaft bisher kaum beachtet hat:das Leben der VIPGefangenen.
Wenn in Studien über das Leben in den Konzentrationslagern die Eliten erwähnt werden, beziehen sich die Passagen auf die Hierarchieinnerhalb der allgemeinen Lagerbevölkerung und die Privilegien, die beispielsweiseVeteranen gegenüber Neuankömmlingen,Nicht-Juden gegenüber Juden undpolitische Häftlinge gegenüber Kriminellen genossen.11 Mir ist nur eine Studie bekannt, die sich speziell mit dem Thema der Elitehäftlinge befasst: Volker Koops In Hitlers Hand:Sonder- und Ehrenhäftlinge der SS. Im Gegensatz zu meinem Buch, das Strategien des emotionalen und intellektuellen Überlebens untersucht, erforscht Koop die Gründeund Umstände,die zur Gefangennahme prominenter Personen führten, und konzentriert sich auf ihre Behandlung in den Gefängnissender Nationalsozialisten.12 Das entsprach lange dem allgemeinen Trend der Forschung:InStudien, die das Leben von Häftlingen in Konzentrationslagern beschreiben, treten ihre Gedanken, Emotionen, kulturellen Ausdrucksformen und ihr soziales Engagement oft hinter den leichter nachprüfbarenFakten in den Hintergrund.
Die Tendenz, sich auf die Fakten zu konzentrieren, ist auch in vielen autobiografischen Schriften von Überlebenden spürbar. Wahrscheinlich fiel es den Betroffenen leichter, die Manifestationen der Grausamkeit zu beschreiben und für sich selbst sprechen zu lassen, als die Gefühle und Gedanken auszudrücken, die diese bei ihnen auslösten.13 Ein weiterer Grund für die Betonung äußerer Fakten könnte die beabsichtigte Funktion dieser IchErzählungen sein. Nur wenige Häftlinge schrieben für sich selbst, um sich geistig über die schmerzhafte Realität zu erheben und ein Gefühl ihrer selbst zu bewahren.14 Die meisten wollten nicht nur persönliche Tagebücher schreiben. Ihre Aufzeichnungen sollten mehr sein als Erfahrungen eines Einzelnen. Sie schrieben sie als Dokumente, die für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Die Verfasser betrachteten ihre Berichte als Zeugenaussagen über die Verbrechen des NS-Regimes und nicht als Zeugnis ihrer eigenen grausamen Erniedrigung. Rudolf Wunderlich, als „Läufer“ in Sachsenhausen in einer bevorzugten Stellung, wurde von seinen Mitgefangenen ausdrücklich beauftragt, zu „überleben, um in der Stunde der Abrechnung der
Justiz als Zeuge zur Verfügung zu stehen“. Die Memoirenschreiber verfassten ihre Werke auch im Blick auf ihren didaktischen Nutzen, denn für junge Leute bestehe die Geschichte oft nur aus vielen Worten. Lebendig werde sie nur, wenn sie aus den Erfahrungen der Einzelnen etwas lernen könnten.15 Daher war es für die Autoren wichtig, sich auf die Fakten zu konzentrieren, sich der Sprache des Gerichtssaals anzunähern und in einem Stil zu schreiben, „der frei von der Frivolität der Literatur ist“. Primo Levi erklärte:
„Ich habe bewusst die ruhige, nüchterne Sprache des Zeugen übernommen, weder die klagenden Töne des Opfers noch die zornige Stimme eines Rächers.“ In ähnlicher Weise betonte Pater Johann Lenz, ein in Dachau internierter Priester, das Hauptziel seines Buches sei, nur direkte Fakten zu präsentieren und einen absolut wahrheitsgetreuen Bericht zu geben.16
Sowohl Memoirenschreiber als auch moderne Forscher hatten Bedenken, sich auf die sozialen und kulturellen Aspekte des Lebens in den Konzentrationslagern zu konzentrieren, da sie angesichts des enormen Leids dort unbedeutend, ja geradezu trivial erschienen. Harry Naujoks und Arnold Weiss-Rüthel, beide politische Häftlinge in Sachsenhausen, beschrieben zwar die von Mitgefangenen organisierten kulturellen Anlässe, fühlten sich aber verpflichtet, ihre Schilderungen in die richtige Perspektive zu rücken. Weiss-Rüthel wollte die Trostlosigkeit seiner Erinnerungen durch die Schilderung dieser Aktivitäten abmildern. Zugleich befürchtete er, man werde ihm „diese Neigung, gelegentlich auch einmal einen Lichtblick zu geben, zum Vorwurf“ machen, weil einige Leser dadurch verführt werden könnten zu glauben, die Bedingungen in Sachsenhausen seien eben „doch nur halb so wild gewesen“. Die Leser müssten sich darüber im Klaren sein, dass die Beschreibung dieser Anlässe dazu diente, einmal „dem Dunkel unseres Lebens auch eine helle Stunde abzuringen“. Ähnlich erklärte Naujoks geradezu entschuldigend, die Kulturanlässe seien nicht nur zur Unterhaltung gedacht gewesen, sie hätten dem inneren politischen Widerstand gedient, und die Sketch- und Musikabende hätten „vor allem den Sinn“ gehabt, den Menschen „neuen Mut zu machen“ und „neue Lebensimpulse zu geben“. Auch erreichten sie nur ungefähr 20 Prozent der Insassen, die übrigen waren zu geschwächt, um daran teilnehmen zu können. Naujoks fühlte sich zu diesen Erklärungen gedrungen, weil er fürchtete, man könnte sich von den „kulturellen Veranstaltungen“ ein „falsches Bild machen“, wenn er von Konzerten und Spielen erzählte.17 Tatsächlich, so berichtet Christoph
Daxelmüller, wurde ihm genau das vorgeworfen:Erwurde beschuldigt, ihm mangele es an Einfühlungsvermögen und er gebe ein falsches Bild vom Leben in den Konzentrationslagern, weil er über Konzerte, Weihnachtsfeiern, künstlerische und andere soziale und kulturelle Aktivitäten berichtete.18
In jüngster Zeit wird jedoch neben den Strafmaßnahmen in den nationalsozialistischen Gefängnissen und Konzentrationslagern mehr und mehr auch danach gefragt, wie die Häftlinge mit den Entbehrungen fertig wurden und einander durch kulturelle Aktivitäten unterstützten. Die Gedenkstätte Sachsenhausen zum Beispiel arbeitete in den 1990er Jahren an dem Forschungsprojekt „Kultur in nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Kultur als Überlebenstechnik“.19 Diese neue Forschungsrichtung erkennt an, dass die Häftlinge im KZ wohl ihre Freiheit und ihren materiellen Besitz verloren, nicht aber ihre soziale und kulturelle Zugehörigkeit. Kulturelle Aktivitäten erfüllten einen wichtigen Zweck für die Gefangenen. Sie erlaubten ihnen, ein gewisses Maß an Handlungsfähigkeit zu bewahren und stellten sogar eine Form des Widerstands dar. Darum wurden sie von der Lagerleitung oft vereitelt oder lediglich im Geheimen durchgeführt.20 Solche Aktivitäten dienten also einem strategischen Ziel und sollten dementsprechend ihren Platz in Untersuchungen über Konzentrationslager finden. Das Festhalten, Vergegenwärtigen und Erneuern von kulturellen Erinnerungen trug dazu bei, angesichts der unmenschlichen Bedingungen die Menschlichkeit der Häftlinge zu bewahren.21 Sie waren für das emotionale Überleben der Häftlinge bedeutsam und bilden in meiner Studie ein Schlüsselelement.
Mit diesem Buch beabsichtige ich, die Rolle zu skizzieren, die kulturelle, intellektuelle und spirituelle Aktivitäten in Schuschniggs Gefängnisaufzeichnungen gespielt haben. Dazu müssen seine Erinnerungen in einen Kontext gestellt werden. Die folgenden Abschnitte werden den notwendigen Hintergrund dazu liefern und 1. den Ort von Schuschniggs Inhaftierung vorstellen, 2. in sein Leben und seine Karriere einführen und 3. die Quellen darstellen, die ich für meine Forschung verwendet habe.
Die Gestapo verlegte Schuschnigg mehrere Male:aus einer Einzelhaft in Wien und dann München schließlich in das Konzentrationslager Sachsenhausen, wo er die letzte und längste Phase seiner Gefangenschaft verbrachte. Im etwa 30 Kilometer nördlich von Berlin auf einem großen Grundstück gelegenen KZ Sachsenhausen wurde im Sommer 1936 ein erstes Häftlingskontingent aufgenommen. Das Lager sollte als Vorzeigelager dienen, um offiziellen Gästen der Regierung zu zeigen, dass die Behandlung der Häftlinge im Lager „hart, aber korrekt“ sei. Die Realität aber sah anders aus. Ein Gefangener berichtete, die Neuankömmlinge seien mit Stöcken durch das Tor getrieben worden. SS-Posten „fuchtelten mit ihren Pistolen, ständig Schimpfworte ausstoßend und Bedrohungen. …Austreten war nicht gestattet. …Und so standen wir im grellen Scheinwerferlicht die ganze Nacht.“ Einige Häftlinge starben schon auf dem Transport nach Sachsenhausen, oder in der ersten Nacht. Die „Bedrohungen und das Herausprügeln“ hatten sie „fertig gemacht. …Ein versagender Dreiundsechzigjähriger bat einmal den Scharführer um den Gnadenschuss; er war aber das Pulver nicht wert, sondern nur Fußtritte.“22
Sachsenhausen war ein Arbeitslager, kein Vernichtungslager. Die Verantwortlichen entmenschlichten die Häftlinge durch Brutalität, harte Arbeit, unzureichende Ernährung und andauernden psychischen Terror. Kurz gesagt, Sachsenhausen war ein „Laboratorium totaler Unterjochung“.23
Gern würden wir wissen, ob sich Schuschnigg selbst darüber im Klaren war, dass der Unterschied zwischen den nationalsozialistischen Lagern ein grundsätzlicher war und nicht nur auf mehr oder weniger große Brutalität hinauslief. In seinen Schriften hat er diesen Unterschied nirgends ausdrücklich herausgestellt. Ich vermute, dass er, wie die meisten seiner Zeitgenossen, sich des Unterschieds nicht bewusst war und die Shoah in seiner allgemeinen Vorstellung von den Gräueltaten der Nazis nicht als einzigartig wahrgenommen hat. In der Tat, wie Michael Rothberg bemerkt, „die Einzigartigkeit des Völkermordes wahrzunehmen, brauchte Jahrzehnte“, und kristallisierte sich erst in den 1960er Jahren heraus, vielleicht unter dem Einfluss der Zeugenaussagen im Eichmann-Prozess in Jerusalem.24
Die besondere Bauweise des Lagers Sachsenhausen sollte die systembedingte Brutalität im Inneren verbergen und sie von der Öffentlichkeit ab-
schotten.25 Der dreieckige Bereich des Komplexes war von einer zweieinhalb Meter hohen Mauer umgeben. Ein elektrischer Zaun aus Stacheldraht verlief parallel dazu auf der Innenseite. Er wurde durch einen zweiten ausgerollten Stacheldrahtzaun verstärkt, den so genannten Spanischen Reiter, der jeden daran hinderte, sich der Mauer auch nur zu nähern. VonWachtürmen aus wurde das Gelände mit Maschinengewehren bewacht, Suchscheinwerfer erhellten es in der Nacht.26 Am nordöstlichen Rand der Anlage waren Quartiere für privilegierte Häftlinge eingerichtet. In einem Bericht heißt es allerdings kritisch, dass bei der Errichtung weiterer Sonderbauten darauf zu achten sei, dass diese ihrer Zweckbestimmung gemäß etwas abseits liegen, damit sie nicht von allen möglichen Leuten begafft werden könnten.27
Kurt Schuschnigg schildert seinen ersten Eindruck beim Betreten des Lagers im Dezember 1941. Er sah eine „Barackenstadt inmitten flacher, sandiger, von schütteren Kiefernbeständen durchzogener Landschaft.“28 Der Dichter Theodore Fontane hatte die Region in Versen besungen, wie Schuschnigg festhielt:
„Am Waldessaume träumt die Föhre, Am Himmel weiße Wölkchen nur, Es ist so still, dass ich sie höre, Die tiefe Stille der Natur.“29
Doch Schuschnigg sah nur das graue und namenlose Elend des Lagers, die Insassen, die ihrer Individualität beraubt und auf Chiffren reduziert waren mit eintätowierten Nummern auf ihren Armen. „Zwischen den Baracken schleppen sich abgehärmte Gestalten, aschfahl im Gesicht –und fast alle mit flackernden Augen.“30
Nachts hörte er Schüsse. „Die Scheinwerfer blinken von den Wachtürmen aus entlang der Mauern und Barackenwände. Vernehmbares Stöhnen und Wimmern im Stacheldraht;und neuerdings Schüsse …ein Aufschrei –dann wieder verebbende Stimmen –und Ruhe.“ Das Schlimmste:„Es war nichts Außerordentliches oder Abnormales.“31 Der Schock und die Bestürzung Schuschniggs entsprechen der Reaktion anderer Häftlinge, die im Elitetrakt des Lagers untergebracht waren. Die Familie Albrechts von Bayern bezog im Dezember 1944 Schuschniggs Nachbarunterkunft.32 Die Schwes-
tern Marie-Charlotte und Marie-Gabrielle, die zum Zeitpunkt ihrer Inhaftierung junge Mädchen waren, beschrieben in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk im Jahr 201133 die Wohnräume in Sachsenhausen als Bungalows, die durch Mauern mit Stacheldraht voneinander getrennt waren. Sie erinnerten sich an ihr Entsetzen, als zu Skeletten abgemagerte Häftlinge ihr Gartengrundstück umgraben mussten und gierig die gefrorenen Kartoffeln aßen, die noch vom Vorjahr in der Erde lagen. „Uns ist es gut gegangen“, berichteten die Schwestern. Sie hätten nicht hungern müssen, denn sie erhielten Wehrmachtsverpflegung –die gleichen Rationen wie die Angehörigen der deutschen Armee. Entsprechend äußerte sich Irmingard von Bayern, eine weitere Insassin des Sonderlagers, die Mahlzeiten seien karg gewesen:ein Stück einfaches Brot, eine Suppe aus Wurzeln und Kohl, Fleisch habe es selten gegeben und dann nur in der Form von abscheulichen Würsten. Den anderen Häftlingen sei es jedoch viel schlechter gegangen. Sie erhielten weniger und einige seien brutal misshandelt und gefoltert worden.34
Die für Elitehäftlinge vorbehaltene Abteilung in Sachsenhausen umfasste vier Häuser, die voneinander, von der Außenwelt und vom übrigen Lager abgeschottet waren. An der Mauer, hinter der die allgemeinen Häftlinge untergebracht waren, befand sich ein langes, schmales Gebäude, in dem Schweine gehalten wurden, von denen ein ekelerregender Gestank ausging. Die Schuschniggs konnten den hohen Schornstein des Krematoriums sehen, der Rauch ausstieß, und manchmal regnete es Asche. Einer der Wachtürme, der mit Scheinwerfern ausgestattet war, befand sich in unmittelbarer Nähe und überblickte ihr Haus. Während seiner Haft in Sachsenhausen gehörten zu Schuschniggs Nachbarn neben der Familie des Wittelsbacher Prinzen Albrecht von Bayern auch die Familie des Kronprinzen Rupprecht, des Oberhauptes des Hauses Wittelsbach. Er selbst entzog sich der Haft 1939 durch Flucht nach Italien. Schuschnigg berichtete über die Anwesenheit der Familie im Dezember 1944 in einem Brief an seinen Onkel. Er identifizierte die Familie nicht, sondern erwähnte lediglich, dass sie dem Adel angehöre:„Neben uns –exteris paribus [d.h.auf der anderen Seite der Trennungsmauer]– sind gleich 5Kinder, noch dazu aus heimatlich benachbarten, wenn auch sozial höher gestellten Sphären. Vera [Schuschniggs Frau]kennt die Eltern.“35 Vera, die das Leben in Sachsenhausen freiwillig mit ihrem Mann teilte, konnte das Lager verlassen, um Vorräte zu
kaufen, die sie gelegentlich mit den Wittelsbachern teilte.36 Schuschnigg bedauerte, dass Sissy, ihre kleine Tochter, keine Gelegenheit hatte, mit den Nachbarskindern zu spielen –imGegensatz zu den Mitgliedern der beiden Wittelsbacher Familien, die in nebeneinanderliegenden Sonderhäusern wohnten. Sie konnten sich gegenseitig Gesellschaft leisten, nachdem Kommandant Kaindl erlaubt hatte, ein Loch in die Mauer zwischen den beiden Häusern zu schlagen. Weitere Nachbarn von Schuschnigg waren der prominente Sozialdemokrat Rudolf Breitscheid und dessen Frau (erbeschreibt ihn als einen „bejahrten und besonders sympathischen Herrn“.37 Schuschnigg kommunizierte gelegentlich mit ihnen:Erwickelte Nachrichten auf Papier um Steine und warf sie über die Mauer.38 Breitscheid wurde später nach Buchenwald verlegt und starb dort, als eine Bombe das Lager traf. „Dann kam Prinz Louis von Bourbon-Parma mit seiner Gattin Prinzessin Maria von Savoyen, einer Tochter des italienischen Königs, und zwei reizenden Kindern“, berichtet Schuschnigg.39 Ein weiterer prominenter Insasse war Oberstleutnant John („Mad Jack“) Churchill, ein Mann, der für seine Tollkühnheit bekannt war. An ihm sah Schuschnigg die erste englische Uniform in diesem Krieg. Er berichtet auch, dass die französischen Staatsmänner Paul Reynaud und Edouard Daladier eine Zeit lang in einem der „Sonderhäuser“ festgehalten wurden, „ohne dass es uns jedoch möglich war, mehr als einen …freundschaftlichen Abschiedsblick zu wechseln“. Sie fanden nie eine Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu treten. Sie konnten nur freundlich nicken, wenn sie aneinander vorbeigeführt wurden. Die beiden Männer waren 1940 beim Einmarsch der Nationalsozialisten in Frankreich gefangen genommen worden. Später zog der „preußische Staatsrat und Industrielle Fritz Thyssen“ in das Haus ein.40 Er und seine Frau wurden im Mai 1943 nach Sachsenhausen verlegt, nachdem sie zweieinhalb Jahre lang in einer psychiatrischen Klinik interniert worden waren.41 1944 griffen Flieger der Alliierten Sachsenhausen an.42 Schwere Bombardierungen im März und April 1945 töteten Hunderte von Häftlingen und führten schließlich zur Evakuierung des Lagers, die in der Nacht vom 21. April 1945 begann. Etwa 33.000 Häftlinge wurden in Gruppen zu 500 Personen in Richtung Hamburg geführt. Wer zu krank oder zu schwach war, um weiterzugehen, wurde von der SS erschossen. Viele Häftlinge verhungerten oder starben an Erschöpfung, bevor die vorrückenden alliierten Truppen und das Internationale Rote Kreuz sie retten konnten. Die Spezial-
Häftlinge, darunter auch Schuschnigg und seine Familie, transportierten die Nazis auf einem Umweg von Sachsenhausen nach Südtirol, wo sie schließlich von amerikanischen Truppen befreit wurden.43
Kurt Schuschnigg wurde 1897 als älterer von zwei Brüdern geboren. Seine Familie stammte aus Tirol, einer Region, die traditionell von einem engagierten Patriotismus geprägt war, der bis ins Jahr 1809 zurückreichte, als Bauern in den Bergdörfern einen Partisanenkrieg gegen Napoleons Soldaten geführt hatten. Schuschnigg fühlte sich als Erbe dieser Tradition und versuchte als gebürtiger Tiroler, die Autonomie Österreichs zu erhalten. Ein Mann seiner Abstammung könne nicht zulassen, dass sein Land zur Kolonie und Provinz des Deutschen Reiches werde.44 Nicht nur die Tiroler Geschichte, sondern auch die Traditionen der katholischen Kirche prägten Schuschniggs Gesinnung und sein Auftreten. Er wurde im Jesuitenkolleg Stella Matutina ausgebildet und blieb sein ganzes Leben lang eng mit der katholischen Kirche verbunden. Das Internat, so bemerkte er einmal, übte einen entscheidenden Einfluss auf seinen Werdegang und seine Ansichten aus und je älter er wurde, desto mehr war er sich dessen bewusst. Dort wurde ihm beigebracht, dass die Treue zum Staat und die Treue zur Nation einander ergänzen sollten.45 Schuschniggs Vater war Berufssoldat. In Armeekreisen sei es üblich gewesen, die Kinder schon früh auf ein Internat zu schicken, weil sie als Erbe nichts anderes als eine gute Erziehung erwarten konnten.46 Unmittelbar nach der Matura 1915 meldete sich Schuschnigg zum Militär und diente im Ersten Weltkrieg als Leutnant.
Nach dem Krieg studierte er in Innsbruck Rechtswissenschaften. Unter Anrechnung seiner Militärdienstzeit schloss er sein Studium in zwei Jahren ab und begann 1922, als Rechtsanwalt zu praktizieren.
In seinem autobiografischen Bericht Ein Requiem in Rot-Weiss-Rot beschäftigt sich Schuschnigg rückblickend mit seiner Berufswahl. Motivierte ihn sein Patriotismus oder waren es doch eher praktische Erwägungen?Als er zwanzigjährig aus dem Krieg nach Hause zurückkehrte, war er hin- und hergerissen, „fand sich am Scheideweg“, wie er formuliert. Er spricht hier interessanterweise von sich selbst in der dritten Person, als ob er sich von
seinem Bericht distanzieren wollte:„Gefühl oder Verstand;deren Richtung ging auseinander. Nach kurzem innerem Kampf, durch mannigfachen Widerstand in seinem Trotz bestärkt, entschloss er sich, den Wegen des Gefühls zu folgen. So ist er in erster Linie Österreicher geblieben.“ Damit will Schuschnigg vermutlich ausdrücken, dass es typisch für einen Österreicher sei, seinen Gefühlen zu folgen. Diese Analyse passt nicht ganz zu der im nächsten Absatz wiedergegebenen Ich-Erzählung: „Ich hätte meinem Herzensdrang folgend, gerne Literatur und Kunstgeschichte sowie allgemeine Geschichte studiert;aber es blieb keine Wahl.“ Aus finanziellen Gründen „kam nur die kürzeste und daher billigste Lösung in Frage“. Die Entwertung der österreichischen Währung nach dem Krieg hatte die Ersparnisse der Familie fast ganz aufgezehrt und die Pension seines Vaters lag „fast unter dem Existenzminimum“.47 Ebenso erklärt er (wieder in der dritten Person): „Von Politik war weit und breit auf seinem Weg nichts zu sehen. Er lehnte sie ab, weil er sie unfruchtbar und zu ihren Trägern kein inneres Verhältnis fand.“
In die erste Person wechselnd schreibt er, er sei Mitglied einer katholischen Burschenschaft geworden, „um nicht als Einzelgänger den Kontakt zu verlieren“. Burschenschaften boten nicht nur Kontakte, sie hatten damals auch starke Verbindungen in die Politik, und er gesteht, er sei bald „in hochschulpolitische Funktionen gewählt“ worden.48 Einige Jahre später trat er in die Politik ein und wurde 1927 als Vertreter der rechtsgerichteten Christlichsozialen Partei in den Nationalrat gewählt.
Die große und aufrüttelnde Frage in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, der mit der Niederlage Österreich-Ungarns zur Auflösung des Kaiserreichs geführt hatte, war:Sollte sich Österreich Deutschland anschließen und, wenn ja, in welcher Form?Die Christlichsoziale Partei unter der Führung des Priesters und Theologen Ignaz Seipel galt allgemein als nostalgisch monarchistisch eingestellt, aber die Partei war gespalten und uneins im Hinblick auf die Frage eines Anschlusses an Deutschland. Was Seipel selbst wollte, blieb rätselhaft. Er hielt sich seine Optionen offen. Er war sich nicht sicher, wie er sich ausdrückte, „wo der liebe Gott uns Deutsch-Österreicher haben will.“49 Schuschnigg behauptete, Seipel sei absichtlich vage geblieben, nach dem Motto:immer nur darüber reden, aber nichts tun. Tatsächlich jedoch verfasste die Christlichsoziale Partei Mitte der 1920er Jahre ein programmatisches Dokument, das so genannte Sylvesterprogramm (31. De-