Manfred Kaufmann im Interview
Seite 6

Energiefachstelle
Liechtenstein
energiebündel.li


In Generationen denken. Vermögen lenken.
Wir sichern Ihre Werte über Generationen hinweg –für Kinder, Enkel und das Morgen.

llb.li/vorsorge
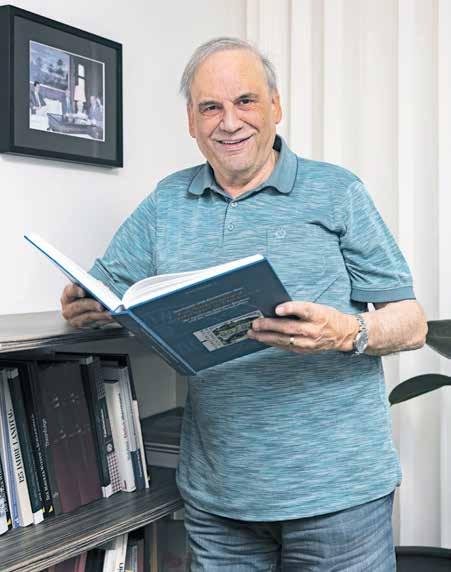

Liebe Leserin, lieber Leser
«Mit voller Kraft für Land und Leute» ist ein Motto von Landtagspräsident Manfred Kaufmann. Unserem Mitarbeiter Heribert Beck berichtet Kaufmann im Interview, wie er seine Rolle interpretiert, welche Diskussionskultur er erwartet und wie die Arbeit des Parlaments effizienter werden soll.
Wie können wir dem Arbeitskräftemangel erfolgreich begegnen? Mit diesem Thema befassen sich fünf Frauen der politischen Parteien in der Monatsfrage.
Acht Runden sind in der Challenge League gespielt, und mit dem Heimspiel gegen Rapperswil-Jona endet am Sonntag das erste Viertel der Meisterschaft. Der FC Vaduz liegt auf Tabellenrang 3, und der Auftakt in die neue Spielzeit darf durchaus als gelungen bezeichnet werden. Geblieben ist leider aus der vergangenen Saison die Schwäche auf fremden Terrains. Unser Mitarbeiter Chrisi Kindle berichtet vom FC Vaduz und hat dem Vereinspräsidenten Burgmeier vier Fragen gestellt.
Die Zahl der Restaurants, Hotels, Gasthäuser und Cafés hat sich in der Gemeinde Mauren-Schaanwald in den vergangenen 20 Jahren merklich zurückentwickelt. Heute gibt es in der Unterländer Gemeinde nur noch fünf Restaurants bzw. Cafés. Der Rückgang vollzog sich nicht nur in Mauren, sondern weit darüber hinaus. Ein Grund für das Gastronomiesterben war die dreijährige Pandemie von 2020 bis 2023.
Vor 85 Jahren erschien der «Umbruch», das Kampfblatt der Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein. Bei der ersten Ausgabe der Zeitung am 5. Oktober 1940 herrschte Aufregung in der Bevölkerung. Herausgeber des neuen Mediums war die Volksdeutsche Bewegung, die das Land an das Dritte Reich anschliessen wollte. Das «Kampfblatt», wie sich die Zeitung nannte, erschien bis 1944, bis die Regierung die weitere Herausgabe verbot. Unser Mitarbeiter Günther Meier berichtet über den «Umbruch» und die damalige Zeit.
In diesem Sinne wünsche ich euch sonnige Herbsttage, weiterhin alles Gute und viel Freude bei der Lektüre der neuesten Ausgabe der «lie:zeit».
plus Versandkosten CHF 6.–Herausgeber: Gemeinnütziger
Verein für Ahnenforschung, Pflege der Kultur und des Brauchtums Mauren
Paketversand heute abgeholt, morgen zugestellt. Bis 31.5 kg nur CHF 10.50. +423 375 05 50 . info@zva.li . www.zva.li
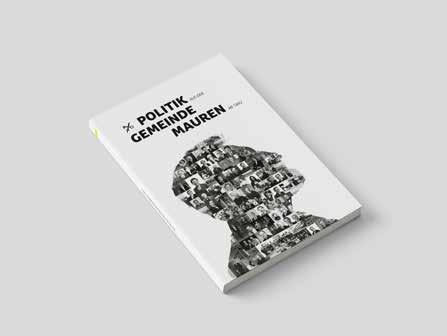
Herbert Oehri, Redaktionsleiter
BUCHBESTELLUNG
bei Brigitte Hasler, Medienbüro Oehri & Kaiser AG, 9492 Eschen Tel. +423 375 90 08 oder brigitte.hasler@medienbuero.li

Kinderärztliche Versorgung
Situation entschärft sich
stetig

Referendumskomitee im Interview
10 Wie weit geht die Pressefreiheit?
Impressum
Verleger: Zeit-Verlag Anstalt, Essanestrasse 116, 9492 Eschen, +423 375 9000 · Redaktion: Herbert Oehri (Redaktionsleiter), Johannes Kaiser, Vera Oehri-Kindle, Heribert Beck · Beiträge/InterviewpartnerInnen: Landtagspräsident Manfred Kaufmann, Referendumskomitee, Wilfried Marxer, Bürgermeister Florian Meier, Philipp Batliner, Carmen Oehri, Klaus Risch, Fabian Frick, Dr. Maximilian Rüdisser, René Schierscher, Christoph Kindle, Günther Meier · Grafik/Layout: Carolin Schuller, Stephanie Lampert · Anzeigen: Vera Oehri-Kindle, Brigitte Hasler · Fotos: LIHK, Michael Zanghellini, Tatjana Schnalzger, Paul Trummer, Jürgen Posch, Adobe
Vaduz im:fokus 18

«Wer die Zukunft gestalten will, muss mutig investieren»

24
jugend:zeit mit Philipp Batliner
«Chancen für die Jugend erhalten»
Freepik, ZVG · Urheberschutz: Die Texte und Bilder dürfen ohne vorherige Genehmigung des Herausgebers/Verlegers nicht kommerziell genutzt, weitergegeben oder veröffentlicht werden. · Meinungsvielfalt: Die lie:zeit gibt Gastautoren Platz, um ihre Meinung zu äussern. Dabei muss der Inhalt mit der Meinung der Redaktion und der Herausgeber nicht übereinstimmen. · Druck: Somedia Partner AG, Haag · Auflage: 22’500 Exemplare · Online: www.lie-zeit.li · Erscheinung: 04. Oktober 2025 · «lie:zeit» nicht erhalten? Rufen Sie uns an: Tel. 375 90 03 (Vera Oehri), Zustellung erfolgt sofort. Nächste Ausgabe: 08. November 2025


Projektpräsentation «Düergarta»
Grösstes Hotel in Rekordzeit entstanden
Historisches 69
Alte Wirtshäuser von Mauren
Aus dem Inhalt
Menschen aus der FBP: Nadine Vogelsang 13
Beitragsreihe: «Das politische System
Liechtensteins» – Parteien in Liechtenstein 16
Jahrmärkte – Ein Stück Heimat und Tradition 34
Zahltag bei der Freiwilligenarbeit der LAK 40 54
FC Vaduz – die Auswärtsschwäche ist geblieben
Freundschaftstreffen: FC Schweizer Nationalrat vs. FC Liechtensteiner Landtag in Bern
Eisenbahn Feldkirch-Buchs vor 80 Jahren

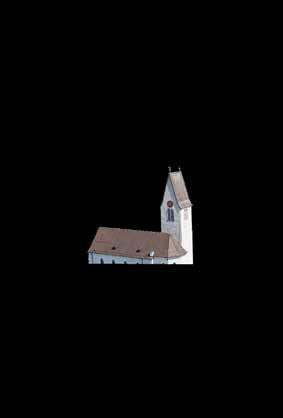
«Der Umbruch» – das Kampfblatt der Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein


Titelstory
«Mit voller Kraft für Land und Leute»
Landtagspräsident Manfred Kaufmann berichtet im Interview über seine Aufgaben, darüber, welche Ansprüche er an sich selbst stellt und wie er seine Rolle interpretiert, welche Diskussionskultur er erwartet und wie die Arbeit des Parlaments effizienter werden soll.
Interview: Heribert Beck
Herr Landtagspräsident, Sie bekleiden das Amt des höchsten Volksvertreters nun seit dem 10. April, also seit einem knappen halben Jahr. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Manfred Kaufmann: Es ist für mich eine grosse Ehre und Freude, das Amt des Landtagspräsidenten ausüben zu dürfen. Ich danke dem Landtag nochmals herzlich für das mir mit der Wahl zum Präsidenten entgegengebrachte grosse Vertrauen.
Die Anfangszeit war ziemlich intensiv. Im Zuge der Nachbesetzung der Stelle des Landtagssekretärs und der im vergangenen Jahr angestossenen Landtagsreform gab es mehrere ausserordentliche Sitzungen des Landtagspräsidiums von relativ grossem Zeitaufwand. Auch waren die ersten Landtagssitzungen von umfangreichen, teils auch sehr komplexen Traktandenthemen geprägt. Dies auch als Folge der längeren sitzungsfreien Übergangszeit aufgrund der Neuwahlen und der Sommerpause. Generell empfinde ich die mit dem Amt des Landtagspräsidenten verbundenen Aufgaben als äusserst interessant und herausfordernd, aber auch sehr verantwortungs- und ehrenvoll.
Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag seither verändert?
In der letzten Legislaturperiode war ich Fraktionssprecher sowie Vorsitzender der Aussenpolitischen Kommission und der EWR/EFTA-Delegation – auch dies war zeitintensiv. Damit ich mich nun voll und ganz auf das Amt des Landtagspräsidenten konzentrieren kann, habe ich mich lediglich für den Vorsitz in der Internationalen Parlamentarischen Bodenseekonferenz zur Verfügung gestellt, welche sich nur zweimal im Jahr trifft. Grundsätzlich hat sich mein Alltag also nicht stark verändert, wohl aber die Aufgaben im Landtag.
Was sind Ihre Hauptaufgaben als Parlamentspräsident?
Die wichtigste Aufgabe ist die Leitung der Landtagssitzungen sowie die Vertretung des Landtags nach aussen. Dazu gehören auch die Treffen mit anderen Parlamentspräsidenten. So war ich kürzlich am Treffen der Parlamentspräsidenten der europäischen Kleinstaaten in Zypern – ein Austausch, der für alle Beteiligten sehr wertvoll war. Zudem stehe ich von Amtes wegen dem Landtagspräsidium vor und bin neben der Sitzungsführung auch für die Veranlassung der Vor- und Nachbereitung sowie die Umsetzung der in diesen Sitzungen verabschiedeten Beschlüsse verant-
wortlich. Ebenfalls arbeite ich eng mit dem Parlamentsdienst zusammen.
Mit 23 Stimmen sind Sie bei der Eröffnungssitzung mit einem Glanzresultat gewählt worden. Was bedeutet Ihnen dies und inwiefern empfinden Sie es als Auftrag?
Die hohe Zustimmung im Landtag, quer über die Parteigrenzen hinweg, hat mich sehr gefreut. Sie spiegelt auch mein Wahlresultat im Februar wider, bei dem ich einen grossen Teil der Stimmen aus anderen Parteien erhalten habe. Für mich steht das Miteinander im Vordergrund. Ein starkes Liechtenstein braucht das Verbindende, nicht das Trennende. Das Vertrauen verstehe ich als klaren Auftrag: Ich möchte alle im Landtag vertretenen Parteien so gut wie möglich in die Arbeit einbinden, so weit es die gesetzlichen Rahmenbedingungen zulassen.
Wie haben Sie die ersten Sitzungen unter Ihrer Leitung erlebt? Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg, wie ist die Diskussionskultur?
Fast die Hälfte der 25 Abgeordneten ist neu im Landtag. Entsprechend waren die Mai- und die Juni-Sitzung noch von einer gewissen Einarbeitung und Anspannung geprägt, was völlig normal ist. Bereits im September war ein deutlicher Rhythmus spürbar, die Abläufe waren merklich effizienter. Die Diskussionskultur spiegelt meines Erachtens letztlich auch die unterschiedlichen Charaktere der im Landtag vertretenen Abgeordneten wider. Meine Aufgabe ist es, die Debatten zu leiten und bei Bedarf einzugreifen. Mir ist eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen wichtig. Persönliche Angriffe oder Beleidigungen haben im Landtag keinen Platz. Diese sind schlichtweg dem Ansehen und der Würde des Hohen Hauses in jeglicher Hinsicht abträglich.
Zu Beginn der ersten Arbeitssitzung des neuen Landtags haben Sie sich für Effizienz ausgesprochen. Aufhorchen lassen haben Sie mit der Aussage: «Ich fühle mich auch keinesfalls angegriffen, wenn nicht bei jeder Wortmeldung ‹besten Dank für das Wort, Herr Präsident› gesagt wird.» Eine kleine Massnahme, aber mit Symbolgehalt. Wie möchten Sie persönlich die Arbeit des Landtags sonst noch effizienter gestalten?
Mir ist wichtig, dass die Debatten zielgerichtet und ohne unnötige Wiederholungen geführt werden. Themen sollen konzentriert behandelt

werden, ohne vom wesentlichen Punkt abzuschweifen. Dabei sollen die essenziellen Fragen gründlich diskutiert werden mit dem Ziel, die Pro- und Contra-Argumente für die Entscheidungsfindung sorgfältig abzuwägen. Effizienz bedeutet für mich, legitime Anliegen der Bevölkerung oder übergeordnete Landesinteressen einer möglichst raschen und lösungsorientierten Behandlung zuzuführen.
Generell können Sie die Effizienz wohl auch als Präsident nicht allein steigern. Wie steht es um die seit Jahren immer wieder diskutierte Anpassung der Geschäftsordnung des Landtags, kurz GOLT? Denken Sie, dass sich diesbezüglich in der laufenden Legislaturperiode etwas tun könnte? Falls ja: Was wünschen Sie sich von einer neuen GOLT?
Wir sind bei der Landtagsreform bereits weit fortgeschritten und können den Entwurf des Gutachtens demnächst den im Landtag vertretenen Fraktionen und der Wählergruppe zur Vernehmlassung zustellen. Es sind spannende Vorschläge enthalten, die ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht im Detail erläutern möchte. Mein Ziel ist klar und ich bin optimistisch, dass in dieser Legislaturperiode im Rahmen dieser Reform einiges umgesetzt werden kann, damit die Prozesse in der Landtagsarbeit eine merkliche Verbesserung erfahren.
Sie bringen sich selbst stärker mit Wortmeldungen in die Debatten ein als Ihre Vorgänger, so scheint es zumindest. Wie interpretieren Sie Ihre Rolle? Sind Sie als Präsident eher Moderator oder Teilnehmer an den Debatten?
Als Landtagspräsident habe ich an den Landtagssitzungen neben der Leitung der Sitzungen grundsätzlich die gleichen Rederechte wie jedes andere anwe-
sende Mitglied des Landtags. Ich sehe mich keinesfalls ausschliesslich auf die Rolle eines Moderators beschränkt. Von Beginn an habe ich klargestellt, dass ich mich auch in der neuen Rolle als Landtagspräsident weiterhin bei der Themendiskussion im Plenum einbringen werde. Dafür bin ich schliesslich gewählt worden. Ich sehe dies übrigens auch als eine klare Verpflichtung gegenüber meinen Wählerinnen und Wählern.
Welche Ziele haben Sie sich generell für die Legislaturperiode 2025 bis 2029 gesetzt?
Mein Ziel ist es, meinen politischen Beitrag zu leisten, damit Liechtenstein auch in Zukunft erfolgreich bleibt. Als Volksvertreter ist es unsere Aufgabe, legitime Anliegen und Interessen der Bevölkerung aufzunehmen und uns für sie einzusetzen. Darüber hinaus möchte ich die Wahrnehmung des Landtags im Aussenbild stärken und unser Land auch aussenpolitisch bestmöglich vertreten. Mit der Landtagsreform zielen wir auf eine generelle Effizienzsteigerung und Verbesserung in den Prozessabläufen bei der Landtagsarbeit hin.
Wie lautet Ihr persönlicher Wunsch, wenn Sie gefragt werden, was hiermit ja geschieht, wie die Bevölkerung die Arbeit des Landtags am Ende der Legislatur bewerten soll?
Es ist mir ein grosses Anliegen, die Rolle und Funktion des Landtags in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken. Am Ende der Legislaturperiode soll die Bevölkerung sagen können: Der Landtag hat sich mit voller Kraft für Land und Leute eingesetzt, gute Ideen im politischen Wettbewerb hervorgebracht und dies alles mit einem wachsamen und verantwortungsvollen Umgang mit den Staatsfinanzen. Das ist nicht nur mein Wunsch, sondern auch mein Anspruch.
polit:zeit

Kinderärztliche Versorgung:
Situation entschärft sich stetig

Anfang 2025 konnten der Liechtensteinische Krankenkassenverband und die Ärztekammer Druck aus der kinderärztlichen Versorgung nehmen, indem eine Praxis in Chur mit einem OKP-Vertrag ausgestattet wurde. Diese Lösung hat sich inzwischen wieder zerschlagen. Die Verbände können jedoch schon eine neue präsentieren und stellen weitere Erleichterungen in Aussicht, wie LKV-Geschäftsführerin Angela Amann und Kammer-Geschäftsführer Stefan Rüdisser informieren.
Interview: Heribert Beck
Wie hat die Liechtensteiner Bevölkerung das pädiatrische Angebot in Chur aufgenommen?
Angela Amann: Zunächst gab es gewisse Bedenken wegen der Distanz. Der Grund für die meisten Besuche bei Kinderärzten sind aber Vorsorgeuntersuchungen, also gut planbar. So konnten wir mit dem neuen Angebot Luft ins System bringen. Leider wurden die Eltern der Patienten im Sommer durch die Praxis informiert, dass die Möglichkeit nicht mehr besteht und sie sich an eine Praxis in Bonaduz wenden sollen.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Wir als Krankenkassenverband sind nicht direkt informiert worden, sondern haben es über Eltern erfahren. Diese waren mit der Praxis in Bonaduz in aller Regel zufrieden. Das Problem war, dass sie über keinen Liechtensteiner OKP-Vertrag verfügte, womit die Leistungen von den Krankenkas-
sen nicht erstattet wurden – ausgenommen bei Versicherten in der OKP+. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, und nun erhält diese Praxis, die auch noch über Kapazitäten für neue Patienten verfügt, einen entsprechenden OKP-Vertrag. Da sie zu einer Praxisgruppe gehört, hat sich sogar noch eine weitere Lösung abgezeichnet.
Die da wäre?
Die Gruppe hat auch einen Standort in Maienfeld. Beide gemeinsam werden mit einem OKP-Vertrag ausgestattet. In Maienfeld sind zwar keine Fachärzte für Pädiatrie beschäftigt, aber «Familienärzte».
Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Stefan Rüdisser: Es handelt sich dabei in aller Regel um Allgemeinmediziner mit vertieften pädiatrischen Kenntnissen. Sie haben sich während der Weiterbildung und anschliessend in ihrer ärztlichen
Tätigkeit entsprechend spezialisiert. Das ist keine neue Erscheinung, sondern in eher ländlichen und nicht mit Kinderärzten gesegneten Regionen der Schweiz durchaus üblich, erprobt und wird von Eltern wie Kindern gut angenommen. Es handelt sich also nicht etwa um ein Experiment oder eine Bastellösung, sondern um ein bewährtes System, das nun auf Liechtenstein ausgedehnt werden kann. Eltern, die keinen Kinderarzt im Land mehr finden konnten, können sich nun entscheiden, ob sie lieber etwas weiter zur Pädiaterin nach Bonaduz oder weniger weit zu den Familienärzten in Maienfeld fahren. Ab 1. Januar 2026 zeichnet sich überdies nochmals eine Lösung ab.
Was sprechen Sie konkret an?
Angela Amann: Dann wird eine weitere Praxis in der Region, in der mehrere Pädiater wirken werden, mit einem OKP-Vertrag ausgestattet. Bei dieser Praxis handelt es sich um eine Neueröffnung. Sie startet also komplett ohne Bele-
gung. Überdies liegt sie noch näher an Liechtenstein als Bonaduz und Chur. Sobald dort Termine vereinbart werden können, werden wir die Bevölkerung informieren.
Stefan Rüdisser: Wir sind zuversichtlich, dass diese neuen Lösungen zu einer wesentlichen Entlastung des Systems führen und die medizinische Versorgung der Liechtensteiner Kinder deutlich voranbringen – und wie schon angesprochen, sind es vor allem die planbaren Vorsorgeuntersuchungen, die Ressourcen binden. Akute Krankheiten sind nicht so häufig und zeitaufwendig, und dafür finden sich immer Lösungen, auch im Inland. In schwerwiegenden Fällen erfolgt die Behandlung ohnehin in einem Kinderspital. Gleichzeitig sind wir aber auch bestrebt, bald wieder ein neues kinderärztliches Angebot im Inland zu schaffen. Das Fazit lautet: Wir können bereits zählbare Erfolge aufweisen, und die Situation wird sich in naher Zukunft weiter entschärfen. Bis dahin hoffen wir auf die Geduld der betroffenen Eltern.
Wie weit geht die Pressefreiheit – was dürfen Journalisten sich erlauben?
Interview: Herbert Oehri
Sie haben gegen das Vaduzer Medienhaus AG sowie deren Journalisten Gary Kaufmann, Patrik Schädler und David Sele geklagt. Was war der Grund?
Referendumskomitee: Eigentlich war es die schlechte und nicht neutrale Berichterstattung im Zusammenhang mit der 5,43 Millionen-Franken-Schenkung der Gemeinde Vaduz an die Landesbibliothek, nachdem die Gemeinde bereits zusätzlich 3,3 Millionen zugesagt hatte. Der Landtag hatte zuvor den Kredit abgelehnt. Das «Vaterland» hat unseres Erachtens völlig einseitig die Position der VU-Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter übernommen und von uns vorgebrachte kritische Äusserungen ins Lächerliche gezogen. Aber gegen einseitige Berichterstattung kann man bekanntlich nicht vorgehen, obwohl das Medienhaus vom Land eine Förderung in Höhe von rund einer Million Franken pro Jahr erhält, die künftig noch um rund 0,5 Millionen aufgestockt werden soll. Wir waren der Ansicht, dass gleich mehrere unsachgemässe Anschuldigungen erfolgten, die das Ausmass an normaler Berichterstattung und auch Kritik bei weitem überschritten hatten.
Was konkret haben Sie eingeklagt?
Gemäss Paragraf 112 des Strafgesetzbuches ist, wer einen anderen in einer für einen Dritten wahrnehmbaren Weise einer verächtlichen Eigenschaft oder Gesinnung bezichtigt oder eines unehrenhaften Verhaltens oder eines gegen die guten Sitten verstossenden Verhaltens beschuldigt, das geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen, wenn er weiss, dass die Verdächtigung falsch ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer die Tat in einem Druckwerk, im Radio oder Fernsehen oder sonst auf eine Weise begeht, wodurch die Verleumdung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Es ging uns um die Feststellung, wie weit eine Zeitung mit ihren Darstellungen gehen darf, bis dieser Tatbestand vor Gericht greift. Anders gesagt: Was dürfen sich Journalisten erlauben, wenn sie über Privatpersonen öffentlich schlecht reden. Wir sind ja definitiv nicht die einzigen, die sich über die Berichterstattung des «Vaterlands» beklagen. Die Macht der Medien ist sehr gross. Wenn sie vorwiegend ihre eigene Meinung in der Bevölkerung verbreiten, hat dies natürlich
Einfluss. Das wäre dann aber keine seriöse Berichterstattung, sondern Meinungsmache. Eine entsprechende Stellungnahme haben wir am 7. Mai 2025 veröffentlicht und geschrieben: «Ehrlich wäre, wenn sich die drei ‹Vaterland›-Redaktoren und allen voran Gary Kaufmann einfach offiziell zu den Ja-Sagern und Befürwortern bekennen würden, anstatt vorzutäuschen, neutralen Journalismus zu betreiben.»
Wir sind ja definitiv nicht die einzigen, die sich über die Berichterstattung des «Vaterlands» beklagen.
Was konkret waren die Vorwürfe?
Zuerst war es David Sele, der in seinem Sapperlot behauptete, dass wir «irreale Alternativphantasien» propagieren würden. Wir hatten statt des Umbaus des Post- und Verwaltungsgebäudes einen Bibliotheksneubau als Alternative befürwortet. Dann behauptete er, dass wenn die Vaduzer am 18. Mai mit einem Nein stimmen, werde weder das eine noch das andere Realität. Die Landesbibliothek werde dann Vaduz verlassen, und im Städtle bleibe eine Landesruine. Dazu meinte er noch, dass unser wahres Motiv sei, dass wir um den Erhalt der Fussgängerbrücke fürchten, ohne die künftig die Fussgänger den Autoverkehr auf der Äulestrasse belästigen könnten und endete wie folgt: «Mischverkehr. Igitt. Haram!» Gut, dass die Brücke so oder so bleibe, wie die Gemeinde Vaduz nun klargestellt habe.
Das war eine reine Behauptung. In diesem Zusammenhang wurden Sachen veröffentlicht, die gemäss unserer Meinung schlicht und einfach

journalistisch unhaltbar sind. Man versteckt sich dann einfach hinter einem Sapperlot, einem Kommentar oder hinter Paul Zinnober, wo nicht einmal der Schreiberling bekanntgegeben wird. Das ist der «Journalismus» im «Vaterland», den wir nicht mehr akzeptieren wollten.
Was war der Vorwurf an Gary Kaufmann?
Gary Kaufmann hat sich in der Ausgabe des «Vaterlands» vom 6. Mai 2025 auf Seite 3 über uns in seinem Kommentar unter anderem wie folgt geäussert: Wir, das «edle Quartett», verhinderten den Abbruch einer nahegelegenen Brücke, damit alle, denen es nach Wissen dürstet, weiterhin die Strasse sicher überqueren können etc. Dies höre sich nach dem klassischen Happy End an. Dann unterstellt er uns: «Das Referendumskomitee hat dieses Märchen frei erfunden, um die Vaduzer Stimmbürger in die Irre zu führen.» Und einige Zeilen später meinte er: «Es ist bedauerlich, was für Unwahrheiten die Projektgegner verbreiten.»
Diese öffentliche Äusserung unterstellte uns ohne Einschränkung, dass wir die Absicht hätten, die Vaduzer Stimmbürger in die Irre zu führen! Bei Gary Kaufmann handelte es sich um ein Mitglied der Redaktionsleitung des «Vaterlands». Wir haben per E-Mail vom 8. Mai 2025 unseren Brief an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung vorab an die Redaktion und später auch unterzeichnet und in schriftlicher Form per Post an beide Gremien der Vaduzer Medienhaus AG zugestellt. Darin wurde verlangt, die Unterstellung öffentlich zurückzunehmen, ansonsten wir Strafanzeige erstatten müssen.
Im «Vaterland» war zu lesen, dass die Strafanzeige nach der Gemeindeabstimmung vom 18. Mai 2025 eingereicht wurde.
Die Aussage, dass wir erst nach der Gemeindeabstimmung Anzeige erstattet hätten ist zu präzisieren: Sie suggeriert, dass wir schlechte Verlierer seien. Wir haben dem «Vaterland» bereits am 8. Mai, also zwei Tage nach den beleidigenden Äusserungen von Gary Kaufmann mitgeteilt, dass wir solche öffentlichen Diskreditierungen nicht akzeptieren und Strafanzeige erstatten werden, falls die Äusserungen von der Zeitung nicht zurückgenommen werden. Die Anzeige konnten wir natürlich erst einreichen, nachdem sich sowohl der Verwaltungsrat als auch der Geschäftsführer Daniel Bargetze geweigert hatten, das zu tun. Bis es so weit war, dauerte es bis nach der Abstimmung.
Was waren die Äusserungen von Patrik Schädler, die Sie zur Anzeige veranlasst haben?
Patrick Schädler hat wohl unsere Schelte an der unseres Erachtens oftmals fragwürdigen Berichterstattung im «Vaterland» während der ganzen Zeit nicht gefallen und vor allem unser folgendes Statement: «Wir haben aufgrund der vielfältigen Unterstützer des Projekts von Anfang an mit einer Niederlage rechnen müssen. Die Regierung, die Gemeinde Vaduz, die Institution Liechtensteinische Landesbibliothek, die organisierte Gruppe der Befürworter und allen voran das ‹Liechtensteiner Vaterland› mit seiner parteiischen und einseitigen Berichterstattung waren eine beachtliche Gegnerschaft. Beim ‹Liechtensteiner Vaterland› mussten wir immer wieder feststellen, dass eine
Ehrlich wäre, wenn sich die drei ‹Vaterland›-Redaktoren und allen voran Gary Kaufmann einfach offiziell zu den Ja-Sagern und Befürwortern
bekennen würden, anstatt vorzutäuschen, neutralen Journalismus zu betreiben.
ausgewogene und unparteiische Berichterstattung durch deren Journalist Gary Kaufmann bei weitem verfehlt wurde.» Der seinerzeitige Chefredaktor – Patrik Schädler arbeitet ja inzwischen nicht mehr beim «Vaterland» – hat dann ein Sapperlot verfasst, in dem er uns öffentlich mitteilte, dass man unsere Reaktion auf das «Alter der Referendumsführer zurückführen» könnte, und meinte zusätzlich: «Doch das würde viel zu kurz greifen.» Solche persönlichen Diffamierungen und Diskreditierungen sollten in einem seriösen Blatt keinen Platz haben. Wenn jemand dünnhäutig reagierte, war es das «Vaterland», das gerne austeilt, aber nicht gerne einsteckt.
Haben Sie darauf reagiert?
Ja, nämlich wie folgt: «Innert kürzester Zeit haben wir es auf nicht weniger als drei Sapperlots gebracht. Das zeigt, wie emotional sich gewisse Redaktoren bei ihrer journalistischen Tätigkeit verhalten. Die persönlichen Beleidigungen von Noch-Chefredaktor Patrik Schädler, zielen auf unser Alter ab, um gleich noch auszuholen: Was aber viel zu kurz greifen würde. Solche Animositäten sind einer von Steuergeldern massiv unterstützten Zeitung nicht würdig.»
Das hat dann der Richter wohl aufgegriffen, als er sagte: «Wer austeilt muss auch einstecken können»?
Ja, das ist gut möglich. Fragt sich nur, wer angefangen hat mit dem Austeilen. Wir hatten kein Interesse daran, uns schlecht mit dem «Vaterland» zu stellen. Das entwickelte sich erst, als wir feststellen mussten, dass die Berichterstattung nach unserer Meinung völlig einseitig verlief und oft mit reinen Behauptungen gearbeitet wurde – so wie oben aufgeführt. Was hätten wir denn tun sollen, wenn uns von Journalisten wie Gary Kaufmann unterstellt wird, es «sei bedauerlich, was für Unwahrheiten die Projektgegner verbreiten». Wenn wir als Lügner bezeichnet werden, dann sollte man wenigstens sagen, was die Unwahrheit war. Das konnte das «Vaterland» aber nie. Es blieb schlichtweg bei den allgemeinen Beleidigungen und anderen Behauptungen. Wir haben immer die Fakten zu unseren Aussagen offengelegt. Das darf man wohl auch von seriösem Journalismus erwarten?
Sind Sie schlechte Verlierer, was Ihnen ja auch noch unterstellt wurde?
Nein, das sind wir sicher nicht. Wir haben öffentlich geschrieben, dass wir das Ergebnis als klares Votum der Bevölkerung akzeptieren – konkret: «Wir akzeptieren den Beschluss und wünschen dem Projekt einen guten Verlauf. Den Befürwortern gratulieren wir zum Sieg.»
Ausserdem sind Karlheinz Ospelt und Christoph Pirchl noch am Abstimmungssonntag zu den Befürwortern des Umbaus in die Landesbibliothek gefahren und haben ihnen persönlich zum Abstimmungsergebnis gratuliert, unter anderem Bürgermeister Florian Meier und dem Stiftungsratspräsidenten Pascal Seger sowie Geschäftsführer Daniel Quaderer. Es folgte ein gutes Gespräch, das über eine Stunde dauerte. Mit diesen Personen gab es auch keine Probleme. Man hat sich mit Argumenten ausgetauscht und sich nicht auf persönlicher Ebene beleidigt.
Gehen Sie nun in Berufung?
Nein. Aber wir hätten nicht einmal eine schriftliche Begründung des Urteils bekommen, wenn wir nicht Berufung angemeldet hätten. Bei der ganzen Sache geht es uns einzig und allein um die Antwort auf die Frage, wie weit das «Vaterland» bei Unterstellungen und Beleidigungen gehen darf. Klar ist nun, dass das Vaterland uns unterstellen durfte, dass wir die Bevölkerung in die Irre führen wollten. Die Hürden für Verleumdung wurden vom Landgericht sehr hoch angelegt. Journalisten haben demnach kaum Grenzen, wenn sie auch künftig gegen einzelne Personen vorgehen und dürfen ihnen Dinge unterstellen, die offenbar nicht belegt werden müssen. Unter diesen Umständen wird sich wohl mancher überlegen, ob er noch bereit ist, die demokratischen Instrumente von Referendum und Initiative zu nutzen. Immerhin hatten wir weit über 500 Unterschriften gesammelt. Man kann sich fragen, ob mit solcher Berichterstattung der Demokratie ein Bärendienst erwiesen wird. Nun wurde die Pressefreiheit einmal mehr hochgehalten. Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen.
Das Interview wurde schriftlich geführt.
Seite der FBP

Menschen in der FBP
Nadine Vogelsang
Mit Herz, Hand und Verstand für ein lebenswertes Liechtenstein.
Wer Nadine Vogelsang begegnet, spürt sofort ihre Energie und Begeisterung für das, was sie tut. Die 48 jährige Schaanerin ist Betriebsökonomin und führt zusammen mit ihrem Mann seit mehr als 20 Jahren ihr eigenes mittelgrosses Industrieunternehmen. Seit 2021 ist sie stellvertretende Landtagsabgeordnete der FBP und zudem im Vorstand der FBP Ortsgruppe Schaan aktiv. Ihr politisches Engagement ist geprägt von Bürgernähe, Pragmatismus und einer grossen Portion Lebensfreude.
Als berufstätige Mutter ist ihr die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein echtes Herzensanliegen. Sie weiss aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd es sein kann, Beruf, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. «Ich wünsche mir ein Liechtenstein, das allen Familienmodellen in den elf Gemeinden die gleichen Möglichkeiten bietet», betont Nadine Vogelsang. Eltern, die arbeiten wollen, sollten die dafür notwendige Infrastruktur vorfinden. «Dazu gehört unter anderem eine flächendeckende und flexible Betreuungsorganisation, die neu aufgrund der FBP Motion durch die Gemeindeschulen koordiniert wird und damit die Organisation von Familie, Beruf und Freizeit für Eltern und Kinder vereinfacht.»
In den vergangenen Jahren hat Nadine Vogelsang sich im Landtag und in verschiedenen Kommissionen immer wieder für wirtschaftsliberale Lösungen und den Abbau von Hürden eingesetzt. «Prozesse müssen vereinfacht und unnötige Bürokratie abgeschafft werden.»
Auch das Verkehrsproblem zu Stosszeiten ist für sie ein Dauerbrenner: «Als berufstätige Mutter von drei Kindern begleitet mich das Thema täglich. Diesbezüglich braucht es endlich wirksame und möglicherweise unkonventionelle Lösungen, um die Dorfzentren und Quartiere zu entlasten und allen Verkehrsteilnehmenden auch zu Stosszeiten einen fliessenden Verkehr zu ermöglichen.» Denn die Anzahl der Arbeitsplätze in Liechtenstein wird weiter zunehmen, was zwangsläufig zu grösseren Pendlerströmen führt. Demgegenüber ist der Boden in Liechtenstein wertvoll und knapp. «Eine spannende Aufgabe, aber nicht unlösbar», meint sie augenzwinkernd.
Was Nadine Vogelsang auszeichnet, ist ihre positive und pragmatische Haltung. «Ich bin weiterhin motiviert, diese Herausforderungen anzugehen und mich fürs Land und für konstruktive Lösungen einzusetzen.» Sie glaubt an die Kraft des Dialogs und daran, dass Politik bürgernah und verständlich sein muss.
Abseits der Politik tankt die 48 Jährige Kraft in der Natur: Beim Biken, Skifahren oder auf Reisen mit ihrer Familie kann sie am besten abschalten. «Zu einem guten Essen mit Freunden sage ich nie nein», betont sie und lacht. «Das Leben ist zu kurz, um es nicht zu geniessen.»
Nadine Vogelsang steht für ein Liechtenstein, das offen, lebendig und zukunftsfähig bleibt – und in dem Herz und Verstand gleichermassen zählen.
Fragen an
Frauen im Liechtensteiner Arbeitsmarkt
Vor einigen Jahren war vom Fachkräftemangel die Rede, der sich in der Folge zum allgemeinen Arbeitskräftemangel entwickelt hat. Ein Mittel gegen beide wäre es, das Potenzial gut ausgebildeter Frauen stärker zu nutzen.
Fragen
Was muss unternommen werden, um Frauen in Liechtenstein stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren?

Formal gibt es in Liechtenstein heute mehr Möglichkeiten als noch vor 10-15 Jahren. In der Praxis erleben Frauen jedoch weiterhin Diskriminierung, sobald es um Kinderwunsch, Pensum und Verfügbarkeit geht. Das ist kein Widerspruch, sondern die Diskrepanz zwischen Politik und Praxis.
Besonders deutlich wird diese Diskrepanz beim Thema Karriere. In Liechtenstein werden Führungspositionen nach wie vor fast ausschliesslich mit Vollzeitpräsenz verbunden. Damit bleiben qualifizierte Teilzeitkräfte von Aufstiegschancen ausgeschlossen. Gleichstellung heisst, dass Frauen und Männer die gleichen Möglichkeiten haben. Statt zu sagen: «Niemand kann Karriere in Teilzeit machen», sollten wir uns doch eher fragen: «Wie schaffen wir Strukturen, damit es möglich wird?»
Modelle wie Jobsharing oder Co-Leadership zeigen international, dass auch zwei Personen in 50 bis 60 Prozent eine Abteilung erfolgreich führen können. Entscheidend sollten Wirkung und Qualität sein, nicht die reine Quantität an Arbeitsstunden. Der Gender Intelligence Report 2024 zeigt: Frauen wollen Karriere, erhalten aber weniger Unterstützung – Männer werden dreimal häufiger ermutigt. Gerade angesichts des Arbeitskräftemangels kann Liechtenstein es sich nicht leisten, das Können gut ausgebildeter Frauen ungenutzt zu lassen. Es braucht Mut zu neuen Modellen. Nur wenn Liechtenstein traditionelle Denkmuster hinter sich lässt, wird diese wertvolle Ressource endlich voll genutzt.

Serpil Yörümez
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Familien- und Gesellschaftsthema, kein rein frauenspezifisches. Auch viele Männer möchten sich stärker an der Familienarbeit beteiligen, stossen aber oft auf dieselben Hürden wie Frauen: fehlende Unterstützung, unflexible Arbeitsbedingungen usw. Um Familie und Beruf gut zu verbinden, braucht es Angebote, die für alle gelten und unterschiedliche Lebenssituationen berücksichtigen. Mögliche Ansätze aus Angestelltenperspektive:
• Teilzeitarbeit mit echten Karriereperspektiven
• flexible Arbeitszeiten, Jobsharing-Modelle und verlässliche Rückkehrmöglichkeiten nach Familienphasen
• verständnisvolle Vorgesetzte, die familienbedingte Abwesenheiten fair berücksichtigen
• Nulltoleranz gegenüber Diskriminierung oder Benachteiligung aufgrund von Familienverantwortung
• bezahlbare Betreuungsangebote wie Tagesschulen, Ferienbetreuung etc. sowie betriebliche Notfallbetreuung
Oft bleiben Frauen aufgrund von immernoch vorhandener Lohnungleichheit zu Hause. Teilweise bleiben gut ausgebildete Frauen auch aufgrund veralteter Rollenbilder zu Hause. Schwangerschaften können dazu führen, dass Frauen im Unternehmen benachteiligt werden oder «auf dem Abstellgleis» landen. Bei Einstellungen werden bei gleichen oder sogar höheren Qualifikationen seltener Frauen eingestellt, da sie als höheres Ausfallrisiko durch Schwangerschaften gelten. Diese Missstände müssen wir beheben.
Aus Sicht der Unternehmen sind deshalb folgende Ansätze sinnvoll:
• Förderprogramme und Anreize für Unternehmen, qualifiziertes Personal unabhängig vom Familienstatus einzustellen und zu halten
• Unterstützung bei familienfreundlichen Arbeitsmodellen als Investition in Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit
• Programme zur Vereinbarkeit, die sowohl Mütter als auch Väter aktiv einbeziehen


As’Ad
Der Fach- und Arbeitskräftemangel ist nicht nur ein ökonomisches Problem, sondern auch ein Ausdruck von verpasster Gleichstellung. Er ist das Resultat von politischen Entscheidungen und ungenutztem Potenzial. Viele hervorragend ausgebildete Frauen in Liechtenstein arbeiten unter ihren Möglichkeiten oder in Teilzeit. Nicht, weil sie das so wollen, sondern weil Strukturen fehlen, die eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen. Frauen, und damit die Hälfte der Bevölkerung, werden seit Jahrzehnten systematisch ausgebremst. Sie leisten tagtäglich Care-Arbeit im Haushalt, in der Kindererziehung, in der Pflege. Und obwohl die Wirtschaft ohne diese Arbeit stillstehen würde, wird sie nur unzureichend anerkannt und bezahlt, nicht fair verteilt und kaum abgesichert.
Statt die Frauen zu «integrieren», müssen wir endlich jene Strukturen ändern, die sie vom Arbeitsmarkt fernhalten. Dazu gehören flächendeckende und bezahlbare Kinderbetreuungsangebote, die allen Familien offenstehen. Wir brauchen ein zeitgemässes Elternzeitmodell, das beide Eltern gleichermassen in die Verantwortung nimmt. Auch steuerliche und soziale Regelungen müssen so ausgestaltet sein, dass sich Arbeit für alle lohnt – unabhängig davon, ob man Erst- oder Zweitverdiener beziehungsweise -verdienerin ist. Unternehmen und Branchen wiederum müssen flexible Arbeitszeitmodelle, faire Löhne und echte Karrierechancen für Frauen schaffen.
Es geht nicht um Sondermassnahmen für Frauen, sondern um gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten. Wenn wir Wohlstand und soziale Sicherheit langfristig erhalten wollen, müssen wir die Gleichstellung endlich zur Priorität machen.


Wir schreiben das Jahr 2025, Arbeitskräftemangel ist spürbar wie nie zuvor, und es stellt sich dringend die Frage: Welche Massnahmen sind nötig, um das Potenzial von Frauen besser zu nutzen?
Diese Frage lässt viele Frauen innehalten, sie regt zum Nachdenken an und hinterlässt ein grosses Fragezeichen. Denn obwohl sich seit Jahren ein klarer Trend abzeichnet, bleibt die tatsächliche Einbindung von Frauen in der Arbeitswelt hinter ihren Möglichkei-ten zurück. Bereits 2023 schlossen in Liechtenstein 59 Prozent der jungen Frauen das Gymnasium ab. An den Schweizer Hochschulen liegt der Frauenanteil bei 44,6 Prozent, an den Uni-versitäten sogar bei 52 Prozent. Beim Eintrag im Goldenen Buch dieses Jahr lag der Frauenanteil bei 48,8 Prozent. Die zahlen zeigen deutlich: Frauen sind gut ausgebildet. Doch ihr Potenzial wird nicht konsequent genutzt. Frauen und Männer starten mit ähnlichen Voraussetzungen ins Berufsleben. Doch nur Frauen bekommen Kinder, und das führt häufig zu einem Karriereknick. In den Jahren in denen Frauen Mütter werden und sind, absolvieren Männer Weiterbildungen und steigen beruflich auf. Was es braucht, ist eine grössere Akzeptanz für Mütter in der Arbeitswelt, und zwar nicht nur in weniger verantwortungsvollen Positionen, sondern auch in Positionen, die ihren Qualifikationen entsprechen. Die Wirtschaft sieht sich immer mehr mit dem Phänomen der Teilzeitarbeit konfrontiert und unternimmt Anstrengungen, um Mitarbeiter zu halten und ihnen diese zu ermöglichen. Doch Teilzeitarbeit gibt es schon länger, nur dass Frau-en diese meist nicht für ihre Work-Life-Balance in Anspruch nehmen, sondern für die sogenannte Care-Arbeit, die unbezahlte Arbeit zu Hause. Dabei sind Mütter im Berufsleben oft besonders engagiert, effizient und multitaskingfä-hig. Würde unsere Gesellschaft diesen Umstand nicht als Hindernis, sondern als Chan-ce und Gewinn sehen, müssten wir nicht über das ungenutzte Potenzial von Frauen sprechen. Stattdessen würden wir jede gut qualifizierte Arbeitskraft aus Liechtenstein, ob Frau oder Mann, als wertvolle Ressource schätzen.

Peggy Meuli

Die Diskussion um die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt darf nicht isoliert geführt werden. Wer über Erwerbstätigkeit spricht, sollte immer auch über Familie sprechen – als gemeinsame Verantwortung. Niemand sollte sich zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen. Wir setzen uns für ein Modell ein, in dem beide Eltern beruflich aktiv sein können –aber so, wie es zu ihrer Familie passt, nicht nach einem Schema F.
Die zentrale Frage lautet daher: Wie können Frauen, die zum Beispiel nach einer Familienphase wieder in den Beruf einsteigen möchten, besser unterstützt werden? Dazu braucht es flexible, verlässliche und faire Rahmenbedingungen – auf drei Ebenen.
Erstens: Unternehmen sollten Rückkehrprogramme, Homeoffice, Teilzeit ohne Karriereverlust und eine familienfreundliche Kultur fördern.
Zweitens: Der Staat muss hochwertige Betreuungsangebote schaffen, rechtlich gesicherte Elternzeit für beide Elternteile ermöglichen und Wiedereinstieg sowie Weiterbildung gezielt fördern.
Drittens: Gesellschaftlich braucht es mehr Anerkennung für die Leistung von Eltern – ob im Beruf oder zu Hause.
Gleichstellung bedeutet nicht, alle Lebensmodelle anzugleichen. Es bedeutet, frei wählen zu können, ohne Nachteile. Wer Familie lebt, darf nicht ins Abseits geraten – und wer arbeiten möchte, muss die Möglichkeit dazu haben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
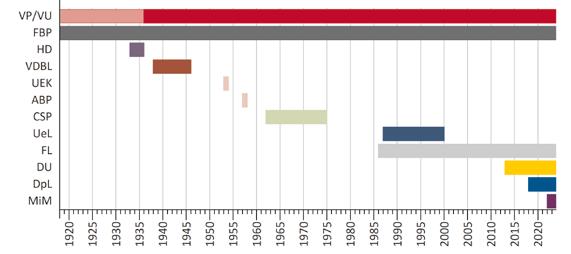
VP=Volkspartei; VU= Vaterländische Union (seit 1936); FBP=Fortschrittliche Bürgerpartei; HD=Liechtensteiner Heimatdienst; VDBL=Volksdeutsche Bewegung in Liechtenstein; UEK=Liste der Unselbständig Erwerbenden und Kleinbauern; ABP=Arbeiter- und Bauernpartei des Liechtensteiner Unterlandes; CSP=Christlich-Soziale Partei; UeL=Überparteiliche Liste; FL=Freie Liste; DU=Die Unabhängigen; DpL=Demokraten Pro Liechtenstein; MiM=Mensch im Mittelpunkt
Parteien in Liechtenstein seit 1918
Beitragsreihe
zum Handbuch
«Das politische System Liechtensteins»
Parteien in Liechtenstein
Viele Jahrzehnte dominierten zwei Parteien die Politik in Liechtenstein: die Fortschrittliche Bürgerpartei und die Vaterländische Union. Doch seit den 1980er-Jahren weitet sich das Parteienspektrum aus.
Text: Wilfried Marxer
In Liechtenstein wurden die ersten beiden Parteien erst 1918 gegründet: die Christlich-soziale Volkspartei (VP) und die Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP). Diese lieferten sich in den 1920erund 1930er-Jahren heftige Parteienkämpfe. Zunächst dominierte die von Wilhelm Beck gegründete Volkspartei, aber der Sparkassaskandal 1928 leitete die Vorherrschaft der FBP bis Ende der 1960er-Jahre ein.
1930er-Jahre und Zweiter Weltkrieg
In den 1930er-Jahren wurde der Liechtensteiner Heimatdienst aktiv. Dieser fusionierte 1936 mit der Volkspartei zur Vaterländischen
Union (VU). In dieser Zeit wurde auch das Proporzwahlrecht eingeführt. 1939 fanden jedoch sogenannte stille Wahlen ohne Urnengang statt. FBP und VU hatten sich auf eine proportionale Vertretung im Landtag mit acht FBP- und sieben VU-Mandaten geeinigt. Mit der stillen Wahl wurde der nationalsozialistisch orientierten Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein (VDBL) der Einzug in den Landtag verwehrt – wobei zusätzlich eine 18-Prozent-Sperrklausel ins Wahlrecht aufgenommen worden war. 1943 verlängerte der Fürst die Mandatszeit, sodass erst 1945 wieder Landtagswahlen stattfanden.
1950er- bis 1970er-Jahre 1953 kandidierte eine dritte Partei, die «Liste der Unselbständig Erwerbenden und Kleinbauern», erfolglos zum Landtag, erreichte aber immerhin 6,9 Prozent der Stimmen. Grösseren Zuspruch erhielt die Christlich-soziale Partei (CSP) 1962. Mit 10,1 Prozent der Stimmen scheiterte sie aber an der Sperrklausel von 18 Prozent, die später vom Staatsgerichtshof aufgehoben wurde. Bei den folgenden Wahlen 1966, 1970 und letztmals 1974 schnitt die CSP immer schwächer ab.
1970 kam es zu einer Umkehr der Mehrheitsverhältnisse: die VU konnte acht Mandate



gegenüber sieben Mandaten der FBP erringen und somit auch den Regierungschef und die Mehrheit in der Regierung stellen, nachdem bis dahin die Regierungskoalition unter Führung der FBP gestanden hatte. Doch schon 1974 kehrten die Mehrheitsverhältnisse wieder, ebenso 1978 – dies leitete eine lange VU-Mehrheit ein, die unter Regierungschef Hans Brunhart bis 1993 dauerte.
1980er- bis 2000er-Jahre
Nach dem Ende der CSP dauerte es zwölf Jahre, bis mit der Freien Liste (FL) wieder eine dritte Partei neben VU und FBP zu Landtagswahlen antrat. Sie scheiterte 1986 und bei den vorgezogenen Neuwahlen 1989 jeweils knapp an der 1970 eingeführten 8-Prozent-Sperrklausel. 1989 nahm erstmals eine vierte Partei an Landtagswahlen teil. Die Überparteiliche Liste Liechtenstein (UeLL) schnitt mit 3,2 Prozent eher schwach ab und kandidierte kein weiteres Mal. 1993 schaffte die FL im dritten Anlauf den Einzug in den Landtag, es blieb aber weiterhin bei einer klaren Dominanz der beiden Traditionsparteien. Die grosse Koalition wurde nun unter FBP-Führung (Markus Büchel) fortgesetzt, nach dessen Abwahl im gleichen Jahr folgte ab Herbst 1993 die Koalition unter VU-Führung (Mario Frick).
1997 begab sich die FBP nach dem erneuten Wahlsieg der VU in die Opposition und es kam zu einer Alleinregierung der VU, vier Jahre später zu einer Alleinregierung der FBP unter Otmar Hasler. 2005 konnte er die zweite Mandatsperiode als Regierungschef antreten, die schwächere VU begab sich als Juniorpartner wieder in die Regierung. 2009 kehrten die Mehrheitsverhältnisse erneut und Klaus Tschütscher führte eine VU-FBP-Koa-
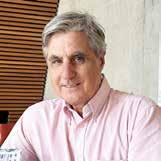
Dr. Wilfried Marxer, ehemaliger Forschungsbeauftragter für Politikwissenschaft am Liechtenstein-Institut, 2011–2018 auch Direktor, Mitherausgeber des Handbuchs «Das politische System Liechtensteins»
lition an. Die FL konnte bei allen Wahlen ab 1993 mit wenigen Mandaten den Einsitz im Landtag bestätigen.
2010er-Jahre bis in die Gegenwart Bei den Wahlen 2013 trat erstmals seit 1989 wieder eine vierte Partei zu den Landtagswahlen an: DU – Die Unabhängigen. Der Gründung der Partei war der Austritt des Abgeordneten Harry Quaderer aus der VU-Fraktion vorausgegangen. Sie erreichte 2013 vier von 25 Mandaten, 2017 sogar fünf. Bis zu den nächsten Landtagswahlen 2021 spaltete sich DU, sodass nun erstmals fünf Parteien antraten: FBP, VU, FL, DU und DpL (Demokraten pro Liechtenstein). DpL schnitt mit 11,1 Prozent der Stimmen und zwei Mandaten deutlich besser ab als DU mit 4,2 Prozent und keinem Mandat. 2013 bis 2021 wurde eine FBP-VU-Koalition von Adrian Hasler angeführt.
Zwischen VU und FBP ergab sich 2021 erstmals ein Mandatspatt mit je zehn Sitzen, die FL erreichte drei Mandate, DpL zwei. Daniel Risch wurde Regierungschef in der VU-FBP-Koalition. 2025 trat DU nicht mehr an. DpL konnte stark zulegen und kam auf sechs Mandate, die VU konnte ihre zehn Mandate verteidigen, die FBP sank dagegen auf sieben, die FL auf zwei Mandate. Die VU-FBP-Koalition unter der erstmaligen Führung einer Frau, Brigitte Haas, wurde fortgesetzt.
Nach den Wahlen 2021 hatte sich noch eine weitere Partei ins Spiel gebracht: Mensch im Mittelpunkt (MiM). Trotz Ankündigung trat diese Partei jedoch weder bei den Gemeindewahlen 2023 noch bei den Landtagswahlen 2025 an.
Das politische System Liechtensteins
Handbuch für Wissenschaft und Praxis Schriftenreihe des Liechtenstein-Instituts, 1. Baden-Baden: Nomos, 2024. Herausgegeben von Wilfried Marxer, Thomas Milic und Philippe Rochat.
Das Handbuch enthält in 23 Kapiteln Informationen zu Themen wie Souveränität, Regierung, Landtag, Parteien, Medien, Wahlen und Wahlsystem, Politische Kultur u. v. a.
Die Print-Ausgabe ist im Buchhandel erhältlich. Das ePDF kann kostenlos von der Website des Liechtenstein-Instituts oder des Nomos-Verlags heruntergeladen werden.


Mit dieser Beitragsreihe möchte das Liechtenstein-Institut das Handbuch «Das politische System Liechtensteins» näher vorstellen.
Heute zum Thema: «Parteien»
Der Beitrag zu den Parteien von Wilfried Marxer im Handbuch «Das politische System Liechtensteins» gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Parteiwesens, die rechtlichen Grundlagen, Parteienprofile, Parteienfinanzierung, Parteimedien u.a. Abgerundet wird der Beitrag durch einen internationalen Vergleich, eine umfangreiche Literaturliste und Internetlinks zu relevanten Websites.
Die inhaltliche Verantwortung für die einzelnen Beiträge liegt bei den jeweiligen Autoren.

www.liechtenstein-institut.li
im:fokus
Vaduz
«Wer die Zukunft gestalten will, muss mutig investieren»
Seit August 2024 ist Florian Meier Bürgermeister von Vaduz. Im Interview schildert er die Herausforderungen, die sich seiner Gemeinde stellen, und wie er sie zu meistern gedenkt. Besonders wichtig sind ihm dabei der Einbezug aller interessierten Kräfte und die Zusammenarbeit, auch über die Gemeindegrenzen hinweg. «Kooperation schafft Stärke», lautet eines seiner Credos.
Interview: Heribert Beck
Herr Bürgermeister, eines der dominierenden gemeindepolitischen Themen im ersten Halbjahr 2025 war die Abstimmung über den Vaduzer Gemeindebeitrag von rund 5,5 Millionen Franken für die Realisierung der Landesbibliothek im ehemaligen Post- und Verwaltungsgebäude. Sie haben sich klar dafür ausgesprochen. Was macht dieses Projekt aus Ihrer Sicht so bedeutend – und wie deuten Sie das unmissverständliche Ja von 64,8 Prozent der Stimmberechtigten?
Bürgermeister Florian Meier: Mich freut diese klare Zustimmung enorm, und ich werte sie als starkes Signal. Die Vaduzerinnen und Vaduzer sehen, dass die Landesbibliothek mehr ist als nur ein Ort für Bücher. Sie wird ein Ort der Begegnung, der Bildung und des Austauschs mitten in Vaduz. Diese Entscheidung gibt uns zudem den Rückhalt, in der Zentrumsentwicklung entscheidend voranzukommen – speziell beim Parkhaus Marktplatz. Für mich ist klar: Wer die Zukunft gestalten will, muss mutig investieren.

Die Zentrumsgestaltung scheint dem aktuellen Gemeinderat ohnehin ein zentrales Anliegen zu sein. Anfang des Jahres hat er sich für den Kauf von zwei Liegenschaften in der Nähe des Rathauses für 14 Millionen Franken ausgesprochen. Was ist auf diesem Areal geplant?
Solche Chancen kommen nicht zweimal. Mit dem Kauf dieser Liegenschaften haben wir die Möglichkeit geschaffen, diesen zentralen Ort aktiv zu gestalten, anstatt nur zuzusehen, wie er sich entwickelt. Das war ein strategisch wichtiger Schritt, der uns langfristig betrachtet zentrale Spielräume verschafft – und er zeigt, dass wir nicht nur verwalten, sondern gestalten wollen.
Apropos Gestaltung: Wie sehen die Pläne in Bezug auf den Rathausplatz aus und wann ist mit konkreten Ergebnissen zu rechnen?
Wir haben in den vergangenen Monaten verschiedene Szenarien geprüft und erste Ideen entwickelt. Ich lade alle Vaduzerinnen und Vaduzer zu einem Informationsabend am 23. Oktober 2025 um 18.30 Uhr in den Rathaussaal ein. Dort werden wir über den aktuellen Stand informieren. Der Rathausplatz soll ein Ort sein, der Identität stiftet. Deshalb ist uns die Mitwirkung der Bevölkerung ein besonderes Anliegen.
Welche weiteren Massnahmen planen Sie, um das Vaduzer Zentrum attraktiver und zukunftsfähig zu machen?
Das Parkhaus Marktplatz ist ein Dauerbrenner – und offen gesagt ist es überfällig, dass wir dieses Projekt angehen. Wer heute dort parkiert, weiss, wovon ich spreche. Es geht nicht nur um Parkplätze, sondern um die Aufenthaltsqualität im gesamten Zentrum. Wir wollen ein Vaduz, in dem man gerne verweilt – egal ob Bevölkerung, Arbeitnehmende
oder Besucherin beziehungsweise Besucher. Aber natürlich soll auch das Ankommen unkompliziert funktionieren.
Und wie sieht es mit den Flächen ausserhalb des Zentrums aus?
Dort müssen wir die Balance halten: ein lebendiges Zentrum und gleichzeitig starke Gewerbegebiete. Im Neugut wollen wir den Betrieben Platz geben, um zu wachsen. Ebenso müssen wir uns mit der Natur auseinandersetzen. Starkniederschläge, Steinschläge, Hochwasserschutz – das sind keine abstrakten Themen, sondern handfeste Aufgaben. Dabei geht es um die Sicherheit aller Einwohnerinnen und Einwohner. Dazu kommt die Belebung unserer Quartiere – wie derzeit beim Landgasthof Mühle oder mit dem Erhalt unserer denkmalgeschützten Gebäude wie unlängst die Sanierung der Hofstätte Hintergass. Solche Orte stiften Gemeinschaft – als Restaurant, als Treffpunkt oder als Ferienziel.
Die Gemeindepolitik wirkt derzeit auffallend geschlossen. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat scheint konstruktiver als in früheren Legislaturperioden. Wie erleben Sie das?
Ich kann nicht für frühere Zeiten sprechen. Wir diskutieren schon auch hart in der Sache, aber stets respektvoll im Ton. Das ist der Schlüssel. Politik lebt vom Ringen um die besten Lösungen, nicht vom kleinlichen Gegeneinander. Ich habe das Gefühl, dass wir derzeit mehr gestalten als blockieren – das wird auch bei den Projekten sichtbar, die jetzt anstehen respektive umgesetzt werden.
Einigkeit ist auch beim Thema Verkehr gefragt – insbesondere beim geplanten Ausbau des Rheindamms. Die Gemeinde hat Beschwerde gegen eine abschlägige Verfügung des Amts für Umwelt

Die Aufenthaltsqualität und Verkehrssituation der Sport- und Freizeitzone Mühleholz wird, voraussichtlich bis Ende Mai 2026, massgeblich verbessert.
eingereicht. Wann rechnen Sie mit einer Entscheidung?
Zum aktuellen Stand der Beschwerde liegt mir keine neue Information vor. Wir warten die Entscheidung der Beschwerdekommission ab.
Was wäre der nächste Schritt, falls die Gemeinde mit ihrer Beschwerde Erfolg hat – und in welchem Zeitrahmen?
Sollte die Gemeinde mit ihrer Beschwerde Erfolg haben, könnten wir das Projekt rasch wieder aufnehmen. Die Grundlagen und Pläne liegen bereit.
Und falls die Beschwerde abgelehnt wird? Gibt es bereits einen alternativen Plan zur Entlastung des Zentrums?
Der Ausbau des Rheindamms allein löst nicht alle Probleme, aber er kann Teil der Lösung sein. Die temporäre Umfahrungsstrasse hat gezeigt, dass sie Entlastung für das Zentrum bringen kann. Für mich ist wichtig, dass wir Lösungen entwickeln, die langfristig tragen – und nicht nur Pflaster auf alte Wunden kleben. Mit der Einführung des Ortsbusses Vaduz und den LieBike-Stationen wurden in der Vergangenheit bereits Schritte gesetzt.
Das neue Feuerwehrdepot im Norden der Schaanerstrasse steht kurz vor der Fertigstellung. Was passiert mit dem bisherigen Gebäude, das künftig von Ortsvereinen genutzt werden soll?
Am 8. November wird das neue Feuerwehrdepot an der Schaanerstrasse

schreibermaronsprenger.li
Moderne Technologien und Traditionen widersprechen sich nicht.
Im Gegenteil: Aus tiefen Wurzeln kann ein starker Baum wachsen.
Florian Meier Bürgermeister von Vaduz


eröffnet. Und das alte Depot wird nicht leer stehen. Wir wollen es den Ortsvereinen öffnen. Das ist ein klares Bekenntnis zum Vereinsleben. Aber wir werden nicht einfach Räume verteilen – wir wollen zuhören, was die Vereine brauchen, und im Anschluss beispielsweise die Raumaufteilung sowie weitere bauliche Massnahmen durchführen. Das ist für mich partnerschaftliches Arbeiten.
Auch im Gebiet Mühleholz tut sich einiges: Kürzlich wurde das gemeinsam mit Schaan realisierte Stufenpumpwerk eröffnet, weitere Projekte – wie die geplante Kletterhalle – folgen. Wie wichtig ist Ihnen die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit?
Sehr wichtig. Wir dürfen nicht an der Gemeindegrenze stehenbleiben. Speziell nicht, wenn es um unsere gemeinsame Infrastruktur geht. Das Stufenpumpwerk oder die Strassenraumgestaltung beim Schwimmbad sind Beispiele dafür, wie es geht. Kooperation schafft Stärke – und Krisenfestigkeit.
Ein weiteres Grossprojekt betrifft das Rheinpark Stadion und dessen unmittelbare Umgebung. Was genau ist dort geplant – und wer wird davon profitieren?
Das Rheinpark Stadion und die gesamte Umgebung werden nicht nur modernisiert, wir machen daraus einen Ort für alle Generationen. Der Breiten- und Freizeitsport soll mehr Raum bekommen. Aber genauso wichtig ist: Wir wollen etwaige Spannungsfelder früh erkennen und gemeinsam im Dialog lösen.
Welche weiteren Vorhaben stehen kurz- bis mittelfristig an, um die Lebensqualität in Vaduz weiter zu steigern?
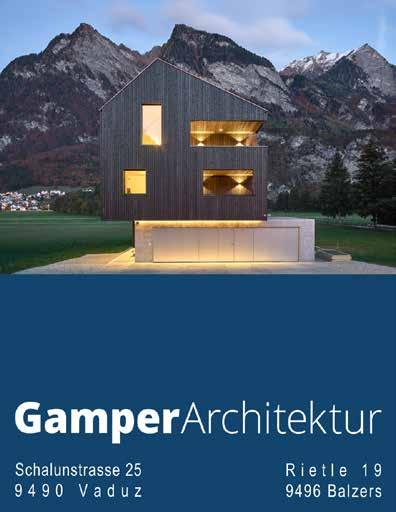

Die denkmalgeschützte Hofstätte Hintergass 35/37 wurde aufwendig saniert und steht nun für Veranstaltungen, Ferien im Baudenkmal und für die Winzergenossenschaft zur Verfügung.


Samstag, 25. Oktober 11:00 – 16:00 Uhr Kürbis schnitzen

Übernachtung im Einkaufszentrum
Samstag, 15. November ab 16:30 Uhr
Jetzt anmelden:



Ein Stein ist unvergänglich.
Solides Handwerk auch!
Ein Stein ist unvergänglich.
Solides Handwerk auch!
Brogle AG ww w.brogle.li
Brogle AG ww w.brogle.li
Wir haben eine volle Agenda. Marktplatz, Rathausplatz, Rheinpark-Anlage, neue Gewerbeflächen, das Solarfaltdach im Fabrikweg, die Arbeiten beim Riethof oder das Grundwasserpumpwerk Wiesen 2, um einige zu nennen. Parallel gestalten wir auch die Bereiche rund um das Freibad Mühleholz neu, was die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich deutlich erhöhen wird. Ein sehr grosses Anliegen ist mir die Beteiligung der jungen Generation – der Mitwirkungstag am 26. Oktober 2025 im Vadozner Huus ist ein starkes Signal. Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren sind eingeladen, unsere Gemeinde mitzugestalten –auch bei der Zentrumsentwicklung. Ebenfalls in diesem Bereich aktiv ist die Arbeitsgruppe «Kinderfreundliche Gemeinde», beispielsweise mit der Analyse unserer Spielplätze. Wir haben das Glück, an einem wunderbaren Ort zu leben – und es liegt an uns, ihn gemeinsam weiterzuentwickeln, damit auch künftige Generationen darauf aufbauen können. Aber genauso gilt es, auf die ältere Generation zu schauen. «Wohnen im Alter» muss in Vaduz möglich sein. Dafür setze ich mich ein. Und ebenso dürfen wir unsere Mitarbeitenden in der Verwaltung und die Organisationsstruktur nicht vergessen. Diesbezüglich gilt es mit der Zeit zu gehen, denn ein moderner Arbeitsplatz ist keine Kür, sondern eine Pflicht.
Sie legen auch Wert auf die Pflege des Brauchtums. Was bedeutet Ihnen das ganz persönlich – und wie will die Gemeinde dieses Thema künftig begleiten?
Traditionen und Brauchtum sind kein nostalgischer Anhang, sondern Teil unserer Identität. Moderne Technologien und Traditionen wider-
sprechen sich nicht. Im Gegenteil: Aus tiefen Wurzeln kann ein starker Baum wachsen. Mit Projekten wie der neuen Brockenstube und dem Wohnmuseum «Doozmool» schaffen wir Räume, in denen Geschichte lebendig wird. Abschliessend lade ich alle ein, sich mit uns gemeinsam auf diesen zukunftsweisenden und spannenden Weg zu machen. Wir sind eine Gemeinschaft, und jede und jeder leistet einen wertvollen Beitrag, damit unser Zuhause das bleibt, was es schon lange ist: Ein Ort, der uns alle verbindet und uns am Herzen liegt.

Ich bin für Sie da in Vaduz.
Oehri Versicherungs- und Vorsorgeberater T +423 237 65 41
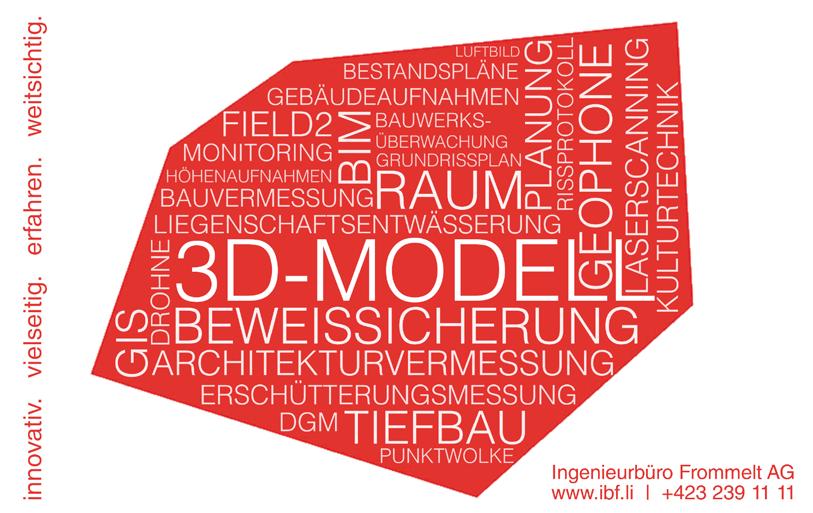
jugend:zeit

«Chancen für die Jugend erhalten, Standortattraktivität weiterentwickeln»
Philipp Batliner aus Mauren ist 21 Jahre jung und studiert seit dem Ablegen seiner Matura an der Ostschweizer Fachhochule in Rapperswil in der Studienrichtung Bsc Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung – einem Thema, das in Liechtenstein immer wichtiger wird. Philipp hat für seinen weiteren Ausbildungsweg klare Zielsetzungen und gibt einen eindrücklichen Einblick in diverse Anliegen, welche die Jugendlichen berühren und bewegen.
Interview: Johannes Kaiser

Philipp, du widmest dich seit deiner Matura im Jahr 2023 der sehr interessanten Studienrichtung Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung an der Ost – Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil?
Philipp Batliner: Ja, nach meiner Matura absolvierte ich zuerst ein Praktikum bei der SLIV AG in Eschen. Seit September 2024 bin ich nun in Rapperswil, um Stadt-, Verkehrsund Raumplanung zu studieren. Vor kurzem habe ich wieder begonnen, einen Tag in der Woche bei der SLIV AG zu arbeiten.
Welches sind die Ausbildungsschwerpunkte und wie gestalten sich deine weiteren beruflichen sowie persönlichen Ziele?
Die Schwerpunkte des Studiums sind Städtebau, Verkehrsplanung und Raumentwicklung. Nach dem Studium möchte ich in St. Gallen eine weiterführende Ausbildung zum Master in Real Estate Management absolvieren. Dabei geht es um Immobilienschätzung und -entwicklung. Da der Immobilienmarkt in Liechtenstein sehr gross ist, plane ich, nach den Studien in Liechtenstein zu arbeiten.
Welche gesellschaftspolitischen Themen beschäftigen dich als junger Erwachsener?
Grundsätzlich ist mir wichtig, dass die heutigen Jugendlichen in Liechtenstein dieselben
Chancen und Voraussetzungen vorfinden, wie die älteren Generationen und dass die Standortattraktivität sehr hoch bleibt. Ich hoffe, dass die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Liechtenstein auch in Zukunft erhalten bleibt beziehungsweise sich weiterentwickelt.
Was sind deine Wünsche an die aktuellen Verantwortlichen in der Politik?
Vor kurzem wurde von LIEmobil das Bildungsabonnement eingeführt, mit dem alle Schüler und Lernenden bis zum Abschluss der Lehre kostenlos den Öffentlichen Verkehr benutzen können. Ausgenommen hiervon sind die Studentinnen und Studenten mit Wohnsitz in Liechtenstein. Ich finde es nicht richtig, dass Studentinnen und Studenten nicht ins Bildungsabonnement einbezogen werden. Dies würde die Attraktivität des ÖV bei den jungen Erwachsenen heben. Ich würde mir wünschen, dass dies geändert wird.
Werden die Jugendlichen in ihrer Meinungsbildung ausreichend gehört beziehungsweise ihre Ideen in die Entscheidungsprozesse aufgenommen?
Es fällt auf, dass die Parteien vermehrt versuchen, die Jugendlichen über Social Media zu erreichen. Ich bin der Ansicht, dass dies Wirkung zeigt und das Interesse der jüngeren Generationen an der Politik steigt. Daher finden
unter den Jugendlichen auch mehr politische Gespräche statt, was zu mehr Eigeninitiative führen kann. Gute Beispiele sind die aktuelle Volksinitiative der jungen FBP zum Wahlgesetz oder der Einsatz des Jugendparlaments.
Wäre das Wahlalter 16 ein Weg der früheren politischen Partizipation?
Man sollte sich die Frage stellen, ob 16-Jährige Interesse an Politik haben oder ob in diesem Alter nicht andere Interessen wichtiger sind. Eventuell wäre es eine Möglichkeit, in einem ersten Schritt das Stimmrechtsalter 16 auf Gemeindeebene einzuführen. Dann könnte man auch Erfahrungen sammeln, ob 16- beziehungsweise 17-Jährige überhaupt an Wahlen teilnehmen und sich für Politik interessieren.
Was machst du in der Freizeit – welches sind deine Hobbys?
Ich spiele gerne Tennis und wandere sehr gerne in der Bergwelt Liechtensteins. Mein Ziel ist es, alle Gipfel abzuwandern, über die Hälfte habe ich schon erklommen. Im Winter findet man mich oft auf den Skipisten in Malbun. An den Wochenenden treffe ich mich gerne mit meinen Kollegen.
Danke, Philipp, für dieses interessante, inspirierende und sehr sympathische Gespräch.
wirtschafts:zeit
Recht Gasser Partner
Revision des Vereinsrechts
Am 1. Januar 2025 ist das revidierte Vereinsrecht in Kraft getreten. Die neuen Gesetzesbestimmungen beziehen sich unter anderem auf gemeinnützige Vereine. Das Thema des Missbrauchs von Rechtsträgern für Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung steht seit einigen Jahren im Fokus. Insbesondere gemeinnützige Organisationen können ein besonderes Risiko für Terrorismusfinanzierung darstellen. Während es in Liechtenstein für gemeinnützige Stiftungen und Anstalten bereits seit längerer Zeit ein enges Regelungsgeflecht sowie eine entsprechende Aufsicht gibt, waren die Anforderungen an gemeinnützige Vereine vor der Gesetzesrevision vergleichsweise niedrig.
Hintergrund
Anlass für die Gesetzesrevision waren die Ergebnisse einer Evaluation durch Moneyval, dem Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Massnahmen gegen Geldwäscherei und Terrorismusbekämpfung. Obwohl Liechtenstein im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut abschnitt, wurden im Bereich des Vereinsrechts Schwachpunkte aufgezeigt. Als vorrangige Massnahme empfahl Moneyval den liechtensteinischen Behörden, risikobasierte Vorschriften zur Überwachung bzw. Beaufsichtigung von Non-Profit-Organisationen (sogenannte NPOs), die ein hohes Risiko für Terrorismusfinanzierung aufweisen, einzuführen und durchzusetzen. Unter diese Definition fallen NPOs, welche sich hauptsächlich mit der Sammlung oder Verteilung von Vermögenswerten für gemeinnützige Zwecke beschäftigen. Klassische Sportvereine, Gesangsvereine, Interessenvertretungen und Beratungsstellen fallen nicht darunter.
Schwerpunkte der neuen Gesetzesbestimmungen sind die Verbesserung der Transparenz und Dokumentation von Vereinen mit einem erhöhten Risiko der Terrorismusfinanzierung. Zudem sollte der Zugang zu relevanten Informationen und Unterlagen in Verdachtsfällen erleichtert werden. Ein weiterer
Text: Carmen Oehri
Schwerpunkt betrifft die Aufbewahrungspflichten von sämtlichen Verbandspersonen, die im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage klar geregelt wurden.
Eintragung in das Handelsregister
Für Vereine, die unter die Definition von NPOs fallen, besteht neu die Verpflichtung zur Eintragung in das Handelsregister. Das Handelsregister ist öffentlich zugänglich. Dritte können gewisse Informationen kostenlos einsehen. Dadurch entsteht ein hohes Mass an Transparenz und ein rascher Zugang zu Informationen. Bei Vorliegen eines geringen Risikos des Missbrauchs für Terrorismusfinanzierung kann auf Antrag eine Ausnahme von der Eintragungspflicht gewährt werden.
Weitere Verpflichtungen
Ist ein Verein zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet, resultieren daraus verschiedene weitere Pflichten. Dazu zählen insbesondere die Bestellung eines Repräsentanten zur Vertretung des Vereins gegenüber den Behörden. Sodann besteht eine Verpflichtung zu einer Bestellung einer Person nach Art. 180a PGR in die Verwaltung, sofern nicht sämtliche Zahlungen des Vereins über eine oder mehrere auf ihn lautende Kontoverbindungen in Liechtenstein, einem ande-
ren EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz erfolgen. Zudem erstreckt sich die Pflicht zur Führung eines Mitgliederverzeichnisses auf alle eintragungspflichtigen Vereine. Ausgenommen bleiben diejenigen Vereine, die für ihren Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben. Ferner gelten für sämtliche Verbandspersonen, also nicht nur für Vereine, neue Aufbewahrungspflichten.
Inkrafttreten
Die dargestellten Änderungen gelten für neu errichtete gemeinnützige Vereine ab dem 1. Januar 2025. Bestehende gemeinnützige Vereine müssen sich bis spätestens 30. Juni 2026 in das Handelsregister eintragen, einen Repräsentanten bestellen sowie ein Mitgliederverzeichnis erstellen oder bis zu diesem Zeitpunkt beim Handelsregister einen Antrag auf eine Ausnahme einreichen. Ist ein bestehender gemeinnütziger Verein bereits im Handelsregister eingetragen, so hat dieser beim Handelsregister eine Erklärung, dass es sich um einen gemeinnützigen Verein handelt, einzureichen. Die Frist dafür läuft ebenfalls bis 30. Juni 2026. Des Weiteren haben bestehende gemeinnützige Vereine, sofern sie nicht davon ausgenommen sind, innerhalb derselben Frist der Pflicht zur Bestellung einer Person nach Art. 180a Abs. 1 PGR nachzukommen.

Über die Person
Carmen Oehri ist als Rechtsanwältin in Liechtenstein zugelassen und verfügt zudem über das Anwaltspatent des Kantons Zürich. Schwerpunktmässig beschäftigt sie sich mit Gesellschafts- und Vertragsrecht. Darüber hinaus befasst sich Carmen Oehri mit Fragen des Erbrechts und der Nachlassplanung. Sie ist für in- und ausländische Privatpersonen und Unternehmen beratend sowie prozessführend tätig.

Feldkircher Strasse 31 9494 Schaan T +423 236 30 80
office@gasserpartner.com www.gasserpartner.com

LIHK-Positionspapier zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein
Die geopolitische Lage, die US-Zollpolitik und protektionistische Tendenzen im Allgemeinen führen zu Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und belasten die exportorientierte Wirtschaft Liechtensteins. Eine Umfrage bei den Mitgliedsunternehmen der Liechtensteinischen Industrie-und Handelskammer (LIHK) vom August 2025 bestätigt dabei die Betroffenheit von der US-Zollpolitik: Die Auslandumsätze von zwei Dritteln der LIHK-Industriemitgliedsunternehmen sind substantiell von der US-Zollpolitik betroffen. Die in den vergangenen Monaten erfolgte starke Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar belastet die liechtensteinischen Exporteure zusätzlich massiv.
Text: Klaus Risch, Fabian Frick, Dr. Maximilian Rüdisser
Weil Liechtensteins Industrie und warenproduzierendes Gewerbe mehr als 40 Prozent der Bruttowertschöpfung des Landes ausmachen, gefährden diese externen Effekte und daraus resultierenden Unsicherheiten den Wohlstand Liechtensteins mit möglichen weitreichenden Konsequenzen auf den Staatshaushalt und damit auch die zur Verfügung stehenden Mittel für beispielsweise Bildung, Infrastruktur und Gesundheitswesen.
Die erwähnte Umfrage unter den LIHK-Mitgliedsunternehmen zeigt auch, dass die Unternehmen nicht untätig sind und aktiv auf die
aktuellen herausfordernden Rahmenbedingungen reagieren. Die Unternehmen geben unter anderem an, neue Märkte erschliessen, ihre Lieferketten anpassen und Effizienzsteigerungsmassnahmen umsetzen zu wollen.
Da die Massnahmen seitens der Unternehmen nicht ausreichen werden, um die für die Exportwirtschaft negativen externen Effekte inklusive der Stärke des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar abzufedern, tritt die LIHK mit vorliegendem Positionspapier mit sieben Massnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein an Regierung und Politik heran und bietet an, bei der Bearbeitung dieser Massnahmen mitzuwirken:
1. Kurzarbeit stärken: Damit Unternehmen in Krisen Zeit erhalten, um sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen und das betroffene Personal ohne erhebliche Lohneinbussen gehalten werden kann, soll die Kurzarbeitsbeantragung und -abrechnung administrativ vereinfacht und beschleunigt werden sowie die Auslegungspraxis, wann wirtschaftliche Gründe vorliegen, die zu einem unvermeidbaren Arbeitsausfall führen, erweitert werden. Diesbezüglich soll kurzfristig auch geprüft werden, wie die Regierung durch ihre im Arbeitslosenversicherungsgesetz normierte Verordnungskompetenz den Handlungsspielraum

zu Gunsten der Unternehmen grösstmöglich ausnutzen kann.
2. Ausbau des Netzwerks an Freihandelsabkommen: Der Abschluss zusätzlicher und die Erneuerung bestehender Freihandelsabkommen soll gemeinsam mit der Schweiz und den weiteren EFTA-Staaten vorangetrieben werden, um den Unternehmen den Zugang zu neuen Märkten zu erleichtern und damit eine stärkere Diversifizierung ihrer Auslandumsätze zu ermöglichen.
3. Deregulierung schnellstmöglich umsetzen und Prüfung der Aussetzung aktueller Regulierungsvorhaben: Die für Liechtenstein aufgrund der EWR-Mitgliedschaft relevanten Inhalte der Omnibuspakete der Europäischen Union in Sachen Deregulierung sollen jeweils schnellstmöglich – und wenn möglich auch vor einer EWR-Übernahme – umgesetzt werden. Zudem soll die Regierung prüfen, welche aktuellen Regulierungsvorhaben sistiert oder verschoben werden können.
4. Internationale Steuerpolitik aktiv begleiten: Verschiedene Länder, darunter die USA, China und Indien, haben angekündigt, die OECD-Mindeststeuer nicht umzusetzen.
In Deutschland und der Schweiz könnte eine partielle Aussetzung der OECD-Mindeststeuer geprüft werden. Diese Entwicklungen in Deutschland und der Schweiz sowie allenfalls weiteren europäischen Ländern sollen aktiv verfolgt werden, um schnellstmöglich handeln zu können, falls Deutschland, die Schweiz und weitere Staaten entscheiden, die OECD-Mindeststeuer partiell oder gänzlich auszusetzen.
5. Einsetzen einer Arbeitsgruppe Standortattraktivität: Zur systematischen und mittelfristigen Stärkung des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein soll eine Arbeitsgruppe unter Einbezug der Wirtschaftsverbände eingesetzt werden. Diese Arbeitsgruppe soll unter anderem im Kontext allfälliger Mehreinnahmen durch die OECD-Mindeststeuer verschiedene Massnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein –beispielsweise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Vorsorgeeinrichtungen – erarbeiten und zur Umsetzung bringen.
6. Attraktive Energie- und Wasserversorgung sowie moderne und stabile Netze und Infrastruktur: Unternehmen sind auf eine verlässliche Energieversorgung und stabile Netze für Energie, Wasser und Kommuni-
kation zu wirtschaftlich tragbaren Preisen angewiesen. Diesen zentralen Standortattraktivitätsfaktoren ist durch entsprechende Projekte und Massnahmen Rechnung zu tragen. Die Erhöhung der Grenzwerte für Mobilfunkantennen soll geprüft werden, damit eine stabile Kommunikation und das Arbeiten über das Mobilfunknetz in Liechtenstein und im Grenzgebiet ohne Netzunterbrüche und ohne damit verbundene Kosten möglich sind.
7. Keine zusätzliche finanzielle Belastung: Zur Verhinderung einer weiteren Verteuerung der Arbeit und damit auch zur Verhinderung einer Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland sollen mittelfristig weder neue Steuern und Sozialabgaben erhoben, noch bestehende Steuern und Sozialabgaben erhöht werden.
Für vertiefende Gespräche zu den Massnahmen steht die LIHK jederzeit zur Verfügung. Wir sind überzeugt, dass Regierung und Politik mit einer konsequenten Bearbeitung und Umsetzung der sieben Massnahmen einen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und Sicherung des Werkplatzes Liechtenstein im Wohle der gesamten Volkswirtschaft leisten können.
ROBERT BRUNOLD, ZENTRALPRÄSIDENT, BÜNDNER KANTONALER PATENTJÄGER-VERBAND

Umfassende Verlagsdienstleistungen aus einer Hand. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstehen gesamtheitliche Lösungen. Wir beraten kompetent, vernetzen intelligent und produzieren exzellent. Fragen Sie nach unseren Referenzen: Tel. 081 255 52 52. www.somedia-production.ch
«‹Nachhaltigkeit› wird heute zu oft als sinnleere Worthülse verwendet»
Die Terramo AG publizierte im Juni eine Analyse der Jahresberichte der öffentlichen Unternehmen Liechtensteins. Der Bericht zeigte auf, inwieweit diese den Vorgaben der Regierung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechen. René Schierscher, Partner bei Terramo, über die Bedeutung der Nachhaltigkeit in Organisationen und die Berichterstattung dazu.
Interview: Johannes Kaiser
Die Regierung hat erstmals Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bei öffentlichen Unternehmen gemacht, Terramo hat diese analysiert. Was hat Sie überrascht?
René Schierscher: Etwas überraschend war die klare Zweiteilung, wir hätten uns ein uneinheitlicheres Bild erwartet: Eine Gruppe von Unternehmen, darunter die LLB, FMA, Post, LKW, Liechtenstein Wärme oder die Telecom, nutzt Nachhaltigkeit strategisch, oft sogar als Teil ihrer Kultur. Man erkennt, dass sie sich schon länger damit beschäftigen. Für die andere Gruppe ist das Thema neu. Es ist wichtig, diesen Unternehmen nun die Zeit einzuräumen, sich damit auseinanderzusetzen. Mit den neuen Vorgaben der Regierung ist die Stossrichtung aber klar definiert.
Ist Nachhaltigkeit ein Luxusthema?
Menschen und Unternehmen blicken sehr unterschiedlich auf das Thema: Viele sehen in dieser dynamischen Zeit unternehmerische Chancen, andere haben Fragen, einzelne offene Ablehnung. Ob es ein Luxusthema ist, ist wohl eher eine Frage der persönlichen Einstellung.
Ist «Nachhaltigkeit» nicht ein Allerweltswort geworden?
Das ist leider nicht falsch. Nachhaltigkeit wird heute zu oft als sinnleere Worthülse verwendet. Im Marketing ist es nett, aber viele wollen eigentlich möglichst wenig tun. Man hat das Gefühl, es würde einem etwas weggenommen. Aber wir sehen auch das Gegenteil: Viele KMU
machen sich Gedanken, was Nachhaltigkeit für sie bedeutet und wie sie das Thema als Chance für sich nutzen können.
Warum berichten Unternehmen über Nachhaltigkeit?
Meistens, weil Kunden, der Gesetzgeber oder Investoren dies verlangen. So zum Beispiel bei den öffentlichen Unternehmen in Liechtenstein. Die Regierung fordert dies in der Eignerstrategie.
Warum?
Als Nachhaltigkeitsberichterstattung wird die Offenlegung von Zahlen zu ESG-Themen verstanden, also Umwelt, E, Soziales, S, und Unternehmensführung, G. Unternehmen berichten, wie sie mit den damit zusammenhängenden Chancen und Risiken umgehen. Zahlen zum Status quo, klare Ziele sowie nachvollziehbare Meilensteine. Der Nachhaltigkeitsbericht ist zusammen mit der Finanzberichterstattung Teil des Jahresberichts. Grosse Unternehmen müssen den Bericht von einer Revisionsgesellschaft prüfen lassen. So klare Aussagen machen nur die wenigsten ganz freiwillig.
Würden die Unternehmen nicht besser Massnahem umsetzen als Berichte zu schreiben?
Investitionen zu tätigen, ohne die Zahlen zu kennen, ist Blindflug. Auch eine glaubwürdige Kommunikation ist ohne Kenntnisse der Fakten nicht ratsam. KMU können auch sehr knapp berichten. Ein farbiger Bericht ist freiwillig.
Einige argumentieren aber, dass Nachhaltigkeit oft nicht wirtschaftlich sei.
Die Frage ist, wie ich auf mein Unternehmen blicke und wie ich mit den Risiken umgehe. Nachhaltigkeitsberichterstattung zielt darauf ab, den Blick über das Unternehmen hinaus zu lenken: Welche neuen Märkte öffnen sich jetzt und in Zukunft? Wie priorisiere ich meine Investitionen? Welche Anforderungen stellen meine Kunden? Kann ich sie vielleicht sogar in ihren Bemühungen unterstützen? Wie ich mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehe, ist auch ein Spiegelbild meiner Sicht der Welt.
Vor allem kleinere Unternehmen scheuen den Aufwand.
Kurz innezuhalten und nüchtern die längerfristigen Entwicklungen zu betrachten, ist Aufgabe jedes Unternehmens. Das kostet ausser etwas Zeit zuerst einmal gar nichts. Die relevanten Themen zu identifizieren, ist ebenfalls mit überschaubarem Aufwand machbar. Mit kleinen Schritten zu beginnen, kann rasch kleine Erfolge sichtbar machen. Aus Erfahrung weiss ich auch, dass diese Überlegungen die Unternehmen in ihrem Selbstverständnis stärken.
Die Terramo AG Terramo ist der Partner für strategische Nachhaltigkeit für Unternehmen, NGOs und die öffentliche Hand. Ihre Expertise liegt in der Strategieentwicklung, in der Umsetzung von zirkulären Lösungen und in der Nachhaltigkeitskommunikation. www.terramo.com
New Kia Sportage
New Kia Sportage
Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.
Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.
New Kia Sportage
New Kia Sportage
Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.
Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.
New Kia Sportage
Jetzt Probe fahren bei Ihrem Kia Partner.
NUFA AG
NUFA AG Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz +423 239 19 90 | info@nufa.li www.nufa.li



Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz +423 239 19 90 | info@nufa.li www.nufa.li
NUFA AG Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz +423 239 19 90 | info@nufa.li www.nufa.li
NUFA AG Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz +423 239 19 90 | info@nufa.li www.nufa.li
10 Jahre EPALE Liechtenstein neu dabei
Die europäische Plattform EPALE feiert ihr 10-jähriges Bestehen – und Liechtenstein ist seit 2025 erstmals offiziell dabei. Die Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein startete anfangs Jahr das Projekt EPALE 2025–2026, das Fachpersonen und Einrichtungen neue Möglichkeiten eröffnet.
EPALE ist die zentrale Online-Plattform für Erwachsenenbildung in Europa. Sie vernetzt Lehrende, Forschende, Institutionen und Entscheidungsträger. EPALE bietet Fachwissen, Praxisbeispiele sowie digitale Ressourcen und fördert Austausch, Qualität und lebenslanges Lernen. Im Mittelpunkt stehen dabei Vielfalt und Inklusion.
EPALE ist die grösste Plattform der Erwachsenenbildung – jetzt Mitglied werden!
Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein T +423 232 95 80, stiftung@erwachsenenbildung.li



Tamara von Aarburg Projektleiterin EPALE der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein «Wir freuen uns, dass Liechtenstein nun Teil von EPALE ist. Das eröffnet Fachpersonen neue Chancen zum Austausch und stärkt die Erwachsenenbildung im ganzen Land.“

Unser Genussgipfel in Liechtenstein.
So – Do 17.30 – 23.30 Uhr Fr + Sa 17.30 – 01.00 Uhr


COCKTAILS
Unser Roof Top Bar im 4. Stock.
Fr + Sa 18.00 – 03.00 Uhr Selemad 10, 9487 Gamprin-Bendern, +423 222 77 77
Ein Stück Heimat und Tradition Jahrmärkte
Nach dem Steger Viehmarkt am 20. September und dem Vaduzer Jahrmarkt am 4. Oktober steigt in einer Woche am 11. Oktober der Unterländer Jahr- und Prämienmarkt in Eschen.
Text: Herbert Oehri
Die Durchführung dieser drei Märkte, deren Wurzeln weit zurückreichen, verkörpern ein Stück Heimat und Tradition. Die Menschen hoffen indes, dass ihnen die Jahrmärkte noch lange erhalten bleiben, auch wenn es immer schwieriger wird, einen adäquaten Ort für die Abhaltung der Vieh- und Warenmärkte zu finden.
Die jeweilige Gemeinde unterstützt die Abhaltung des Jahr- und Prämienmarktes. Die landwirtschaftliche Leistungsschau und der Verkauf von bäuerlichen Erzeugnissen sowie von Produkten des täglichen Bedarfs bilden seit jeher die Grundlage für den Jahrmarkt. Darüber hinaus ist der Jahrmarkt ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Besonders die Kinder und Jugendlichen freuen sich aufs Markttreiben und das Angebot im Vergnügungsbereich, den Rummel und den Zauber, den nur der Jahrmarkt in dieser Form auszustrahlen vermag.

Bremimart beim Feuerwehrdepot in Eschen
Das wird sich am kommenden Wochenende auch wieder beim Unterländer Bremimart in Eschen zeigen. Bereits seit mehr als 25 Jahren organisiert der Verein zur Förderung des Unterländer Prämienmarktes den Eschner Bremimart. Wie schon in den vergangenen drei Jahren positioniert sich der Prämienmarkt auf dem Platz neben dem Feuerwehrdepot gegenüber der Firma ThyssenKrupp Presta in Eschen. Aufgrund der Veränderungen im Dorfzentrum war es dem Verein nicht mehr möglich, den Markt und die Prämierungen wie in den Vorjahren am alten Platz durchzuführen. Der Platz beim Feuerwehrdepot bietet zudem Gewähr, dass die Tradition des Prämienmarktes erhalten bleiben kann. Dank vieler Helfer werden der Transport und die Auffuhr aller Tiere (Kühe, Rinder, Schafe, Esel, Ziegen) bis um zirka 9 Uhr abgeschlossen sein. Die Experten der IG Tierzucht rangieren danach Braunvieh- und Fleckviehkühe sowie Schafe im Ring.
PROGRAMM
Freitagabend, 10. Oktober 2025
Festzelt, Bahnen
Samstag, 11. Oktober 2025
Marktstände, Festzelt, Bahnen, Prämienmarkt, Vertretung der Gastgemeinde Mauren-Schaanwald auf dem Dorfplatz
Sonntag, 12. Oktober 2025
Marktstände, Festzelt, Bahnen
Bei guter Witterung stehen Parkplätze auf der Wiese nahe dem Festzelt zur Verfügung. Am Samstag wird bei jeder Witterung ein kostenloser Shuttle vom Parkhaus «Essanepark» im Wirtschaftspark zum Prämienmarkt und ins Zentrum angeboten.

Um 12 Uhr wird die traditionelle Viehsegnung durch den Eschner Gemeindepfarrer vorgenommen. Gleich im Anschluss beginnen die Tiervorführungen. Um etwa 14 Uhr werden die Miss-Unterland-Wahl und die Wahl der beiden Schöneuter-Kühe folgen. Gleich anschliessend wird sich die frisch gebackene Miss Unterland ihrer Konkurrenz aus dem Oberland stellen und um die «Miss Glocke» kämpfen.
Vorführung «Mein Lieblingstier»
Auch in diesem Jahr darf die Vorführung «Mein Lieblingstier» durch die IG Tierzucht nicht fehlen. Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren dürfen mit ihrem Lieblingsnutztier an den Prämienmarkt kommen und sich ebenfalls dem grossen Publikum zeigen.
Attraktives Rahmenprogramm Im Eschner Zentrum wartet ein stimmungsvolles Wochenende voller
Begegnungen, toller Unterhaltung und kulinarischer Genüsse auf die Gäste. So hält der Unterländer Jahr- und Prämienmarkt auch in diesem Jahr für alle etwas bereit. Neben den 75 Marktfahrern, die ein buntes Angebot an Waren und Produkten bereithalten, ist im Festzelt, das von der Freiwilligen Feuerwehr betrieben wird, ausgelassene Unterhaltung und fröhliches Zusammensein angesagt. Die Bahnen im Zentrum sind auch in diesem Jahr der grosse Anziehungspunkt, vor allem für die kleineren Marktbesucher.
Mauren als Gastgemeinde
Neu ist am Jahrmarkt die Einladung einer Gastgemeinde aus dem Liechtensteiner Unterland. In diesem Jahr macht Mauren-Schaanwald den Anfang auf dem Eschner Dorfplatz mit vier Ständen und drei musikalischen Formationen, die abwechselnd für Stimmung sorgen.

11.-12. Oktober 2025, Eschner Zentrum


Unsere Öffnungszeiten am Unterländer Jahrmarkt:
Samstag 11:00 – 23:30 Uhr
Sonntag 11:00 – 17:00 Uhr
Champagnerhütte draussen vor dem Fago am Jahrmarktsamstag von 11:00 – 23:00
senioren:zeit

Vom Einbezug der Älteren profitieren alle
Silver Agers, Golden Agers, Best Agers und so weiter: Die Synonyme für die ältere Generation sind heute vielfältiger denn je. Sie kommen inzwischen nicht nur modern auf Englisch daher, sondern zeigen auch, wie sich das Alter und die Begegnung mit ihm verändert haben. Seniorinnen und Senioren nehmen nach der Pension noch lange am aktiven Leben teil und leisten einen unschätzbaren Beitrag an die Gesellschaft.
Text: Vera Oehri-Kindle
Mit ihrer reichen Lebenserfahrung, ihrem unschätzbaren Wissen und der Weisheit, die sie über Jahrzehnte angesammelt haben, sind Seniorinnen und Senioren Träger des kulturellen Erbes und der Traditionen, die sie an jüngere Generationen weitergeben. Sie erfüllen dadurch eine wichtige Brückenfunktion. Durch ihre langjährige Präsenz im Leben vieler Menschen bieten sie
Stabilität und Kontinuität und sind eine unersetzliche Unterstützung für ihre Familien und die Gesellschaft insgesamt. Ihr Wissen kann den Jüngeren Orientierung zu geben, sie vor Fehlern bewahren und einen fundierten Dialog über die Herausforderungen und Chancen der Zukunft zu ermöglichen. Die ältere Generation hilft, die Gegenwart besser zu verstehen. Die Seniorinnen und Senioren sind die Hüter von Erzählungen, Bräuchen
und Werten, die Generation für Generation weitergegeben werden. Indem sie ihre Geschichten und Erfahrungen teilen, ermöglichen sie es jüngeren Menschen, eine Verbindung zu ihren Wurzeln und ihrer kulturellen Identität aufzubauen. Dieses Weitergeben des kulturellen Erbes ist entscheidend für den sozialen Zusammenhalt und die Bewahrung einer lebendigen und vielfältigen Gesellschaft. Die Interaktion mit Senioren fördert
das persönliche Wachstum und die Entwicklung der jüngeren Generationen. Durch den Austausch mit erfahrenen Menschen lernen Jüngere Empathie, Respekt und Geduld. Senioren können als Mentoren fungieren und wertvolle Ratschläge für die Berufswelt, für zwischenmenschliche Beziehungen und für die persönliche Lebensgestaltung geben.
Wirtschaftlicher Beitrag und gesellschaftliche Rolle
Doch das ist selbstverständlich nicht alles, was die Seniorinnen und Senioren in Liechtenstein, der Region, der ganzen Welt für die Gesellschaft leisten. Auch wenn es meist im Hintergrund geschieht, erbringen ältere Menschen oft einen wertvollen wirtschaftlichen und sozialen Beitrag. Viele von
ihnen engagieren sich ehrenamtlich, helfen in der Familie, insbesondere auch bei der Betreuung von Enkelkindern oder anderen Verwandten, übernehmen Verantwortung in Vereinen oder teilen ihr Know-how aus langjähriger Berufserfahrung. Nicht umsonst wird derzeit auch in Liechtenstein diskutiert, wie ältere Menschen, die gerne weiterarbeiten würden, länger im Berufsleben gehalten werden können, um so einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel zu leisten und damit jüngere Arbeitskräfte von ihrem Wissen, ihren Kenntnissen und Fähigkeiten profitieren können. All diese Leistungen sind unentbehrlich für das Funktionieren der Gesellschaft, sie stärken das soziale Miteinander genauso wie die Volkswirtschaft. Die Vitalität und der Wunsch der Seniorinnen und Senioren,
aktiv am Leben teilzuhaben, sind somit eine wertvolle Ressource für alle Altersgruppen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Best Agers, Golden Agers oder Silver Agers wahrlich keine Last sind, sondern ein unschätzbarer Reichtum für die Gesellschaft. Ihr Wert liegt in der unerschöpflichen Quelle von Wissen, Erfahrung, Weisheit und emotionaler Unterstützung, die sie für aktuellen und kommenden Generationen bereithalten. Es ist die Aufgabe von Politik und Gesellschaft, diesen Wert anzuerkennen, zu würdigen und sie aktiv in das Leben einzubeziehen. Auf welch unterschiedliche Art dies passieren kann – und einiges mehr –, zeigen die folgenden Seiten.







Freiwillige in der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe
Zahltag bei der Freiwilligenarbeit der LAK
Ihr freiwilliges Engagement ist ein Geschenk für die Bewohnenden der LAK-Häuser. Sie schenken das Wertvollste, das es gibt: Zeit und Aufmerksamkeit. Aber auch die Freiwilligen profitieren. Sie erweitern ihre sozialen Kompetenzen und die persönliche Perspektive. Sie lernen mit unterschiedlichen Menschen und Situationen umzugehen, werden zu verschiedenen Themen sensibilisiert und erhalten Einblick in andere Lebenswelten. Stellvertretend für die Freiwilligen der LAK geben Maria Kieber und Margrith Lampert einen Einblick in die Freiwilligenarbeit. Sie sind im LAK-Haus St. Peter und Paul in Mauren im Einsatz. Freiwillige können in der LAK jederzeit einsteigen, beispielsweise für regelmässige Spaziergänge mit Bewohnenden oder als Rikschafahrer.

Wie viele Freiwilligeneinsätze habt ihr im Haus St. Peter und Paul pro Monat? 3–5
Wie viele Bewohnende betreut ihr im Haus St. Peter und Paul? 1–45 Personen, je nach Art des Einsatzes
Direkter Draht zur Freiwilligenkoordination der LAK:
Wie alt ist der/die älteste Bewohnende, den/die ihr im Haus St. Peter und Paul betreut habt? 101


Die Freiwilligen engagieren sich auch in der Cafeteria.
Wie viele Stunden Freiwilligenarbeit wurden 2024 in der LAK geleistet?
5'027
Wie viele Bewohnende leben derzeit in den Häusern der LAK?
340
Wie viele Freiwillige zählt die LAK?
196
Wie lange dauert der längste Freiwilligen-Einsatz in der LAK bereits?
40
93–24 Jahre Jahre
Wie alt sind der älteste und der jüngste freiwillig Mitarbeitende?
Wie viele Weiterbildungen können Freiwillige in der LAK absolvieren?
2
pro Jahr

Fit und aktiv im Alter – mit Unterstützung der Pandas GmbH
Alt werden heißt nicht, auf Lebensfreude zu verzichten! Bewegung, soziale Kontakte und ein selbstbestimmtes Leben sind die Grundlage für ein fittes und glückliches Altern. Damit das gelingt, braucht es manchmal kleine Hilfen – und genau dafür sind wir da.
Die Pandas GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen so lange wie möglich mobil, aktiv und unabhängig zu halten. Dafür bieten wir eine Vielzahl an Produkten, die den Alltag erleichtern und Lebensqualität schenken:
• Liftsysteme – ob Treppenlifte, Plattformoder Hebelifte: Sie sorgen dafür, dass jede Etage im eigenen Zuhause sicher und bequem erreichbar bleibt.
• E-Mobile – mit unseren wendigen und zuverlässigen Elektromobilen bleiben Sie mobil, erledigen Einkäufe selbstständig und können Spazierfahrten im Freien genießen.
• Pflegebetten – unsere modernen Pflegebetten bieten höchsten Komfort, Sicherheit und Unterstützung – sowohl für Menschen, die Hilfe im Alltag benötigen, als auch für pflegende Angehörige.
So ermöglichen wir es, weiterhin selbstbestimmt am Alltag teilzunehmen, Freundschaften zu pflegen und Freude an Bewegung zu erleben.
Denn wir sind überzeugt: Mit der richtigen Hilfe bleibt das Alter nicht stehen – sondern in Bewegung!

Pandas GmbH
Schleipfweg 21 6800 Feldkirch, Austria
T +43 (0) 5522 365 83 info@pandas.cc | www.pandas.cc

wohn:zeit bau &
Förderung
von Photovoltaikanlagen
Photovoltaikanlagen wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Idealerweise wird der produzierte Strom im Gebäude gleich selber genutzt, überschüssiger Strom kann in das öffentliche Netz eingespiesen werden.
Sie bauen energieeffizient – wir fördern!
Die Installation einer Photovotaikanlage auf z. B. Dach oder Fassade wird abhängig von der installierten Leistung und Standort gefördert.

Anlagengrösse 15 kWp
Investition, ca. CHF 30'000
Förderung (Land + Gemeinde) CHF 9'750 + 9'750 = 19'500
Investition nach Abzug der Förderung CHF 10'500
Energieertrag/Jahr, ca. 13'500 kWh
Einsparung bzw. Vergütung/Jahr, ca. CHF 1'215
Beispiel für eine Anlage auf dem Dach eines bestehenden Einfamilienhauses mit 33 % Eigenverbrauch und 67 % Rückspeisung.
Die Gemeinden fördern gemäss ihren eigenen Beschlüssen und verdoppeln meist bis zu ihren jeweiligen Maximalbeträgen.
Energiefachstelle Liechtenstein
Amt für Volkswirtschaft | Haus der Wirtschaft | 9494 Schaan T +423 236 69 88 | info.energie@llv.li | energiebündel.li | llv.li
FREIHEIT
ODER ZWANG?
Neue Ansätze für eine Wahlfreiheit in der Mobilität
SYMPOSIUM:
Mobilität und Alltag jenseits der Stadt
Wann: Freitag, 24. Oktober 2025, 09:00 bis 17:30 Uhr
Wer im Agglomerationsraum Werdenberg-Liechtenstein lebt, kennt das: Ohne Auto geht oft nichts. Doch ist das wirklich eine freie Entscheidung oder ein Zwang, weil Alternativen fehlen?
Ein Symposium an der Universität Liechtenstein mit Expertinnen und Experten der ETH Zürich, TU München und TU Wien widmet sich der Frage, ob sich die Prinzipien der Stadt der kurzen Wege auch auf Regionen mit geringer bis mittlerer Sieldungsdichte übertragen lassen. Beiträge aus Forschung, Planung und Lehre geben Einblicke in aktuelle Studien zur Nutzungsmischung und diskutieren neue Modelle vernetzter Siedlungsstrukturen.

Wo: Universität Liechtenstein, Auditorium
Infos und Anmeldung: www.uni.li/freiheitoderzwang

„Verwittertes Pflaster?! –Die
Alternative
Die Steinpfleger Schweiz-Ost, das Team im Interview:
Eine kurze Einleitung bitte. Was genau bieten Die Steinpfleger an?
Wir haben uns darauf spezialisiert, Oberflächen im Außenbereich aufzubereiten und diese nachhaltig zu schützen. Im Grunde vergleichbar mit der Pflege eines Autos. Richtig geschützt hat man auch hier deutlich länger Freude daran und erhält zeitgleich den Wert.
Kurz zum Ablauf, wie kann man sich einen Steinpflegerbesuch vorstellen?
Zunächst schaut sich ein Mitarbeiter die Flächen an, legt eine Probereinigung, bspw. In einer Ecke an, und erstellt dann ein Aufmaßblatt inkl. Fotos. Dieses wird noch vor Ort an unser Büro versendet. Direkt im Anschluss erhält der Kunde ein schriftliches Angebot. Das Besondere bei uns: Bis hierhin ist alles kostenfrei und völlig unverbindlich. Für uns sind die Angebote verbindlich, es wird kein Cent mehr abgerechnet als vereinbart, auch wenn wir länger bleiben müssen.
Und wie läuft so eine Aufbereitung, bspw. die eines Pflasters ab?
Reinigung mit bis zu 100° C heißem Wasser (350 BAR Druck)
Gleichzeitige Absaugung von Fugenmaterial und Schmutzwasser
Wir reinigen mit bis zu 100°C heißem Wasser und einem angepassten Druck von bis zu 350 bar. Dabei saugen wir gleichzeitig das entstehende Schmutzwasser sowie das Fugenmaterial ab. Im Anschluss wird die Fläche einer umweltverträglichen Art der Desinfektion unterzogen. Damit entfernen wir selbst die kleinsten Rückstände und Sporen. Damit es aussieht wie neu verlegt und die Flächen ihre Stabilität behalten, werden diese neu verfugt. Im Anschluss imprägnieren wir die Flächen und schützen diese so langfristig.
Warum sollte man die Steinpfleger beauftragen?
Zum einen natürlich der Faktor Zeit. Ich denke, ein Garten ist in erster Linie ein Ort der Ruhe und Erholung. Wer möchte schon die wenigen Sonnenstunden damit verbringen, zu reinigen und Sachen von A nach B zu schleppen. Außerdem ist ja zu beachten, reinigt man selbst, ist das i. d. R. alle 3-4 Monate nötig. Dabei wird viel Dreck an Fenstern und Türen verursacht, teilweise werden die Fugen ausgespült, Pfützen entstehen und natürlich wird jedes Mal das Pflaster weiter angeraut. Dadurch ist das Pflaster im neuen Jahr noch schmutzanfälliger. Wenn wir da waren, bieten wir mit STEINPFLEGER Protect 4 Jahre Garantie, auch gewerblich! Und dank unserer hauseigenen festen

Neuverfugung mit unkrauthemmendem Fugenmaterial
Langzeitschutz dank Steinpfleger-Protect-Imprägnierung



zur Neuverlegung.“
Systemfuge ist auch eine nachhaltige chemiefreie Unkrauthemmung möglich.
Man hört und liest ja immer wieder von Drückerkolonnen, welche vor Ort direkt abkassieren und mit dubiosen Mitteln nachhelfen. Was unterscheidet Sie davon?
Einfach alles! Das beginnt schon damit, dass wir Angebote ausschließlich schriftlich versenden, geht über unsere Auftragsbestätigungen bis hin zu einer ordnungsgemäßen Rechnung, welche auch zum Teil steuerlich geltend gemacht werden kann. Nicht zuletzt sind wir einfach vor Ort und mit offenem Visier am Kunden. Das gibt Sicherheit. Garantiert haben wir auch in Ihrer Nähe Referenzen zu bieten.
Ein letztes Statement an alle Unentschlossenen, und wie man Sie erreichen kann!
Testen Sie uns. Bis zu Ihrem „Go“ zur Durchführung der Arbeiten ist es kostenfrei und unverbindlich, Sie können nur gewinnen!
Auf www.die-steinpfleger.ch haben wir ein informatives Video am Beispiel einer Auftragsdurchführung, telefonisch sind wir unter +41 71 510 06 40 erreichbar.

Fair und seriös - schriftliche Angebote und Topbewertungen
ca. 75 % günstiger als eine Neuverlegung


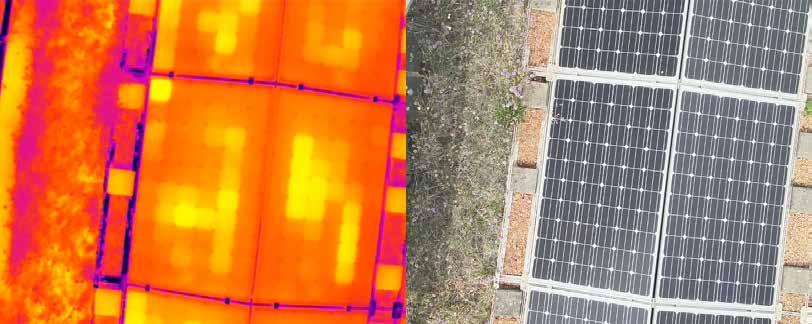
Wartung & Service für alle
PV-Anlagen – herstellerunabhängig
Eine Photovoltaikanlage ist eine Investition in die Zukunft. Damit sie über Jahrzehnte hinweg zuverlässig Strom liefert, braucht es nicht nur hochwertige Technik, sondern auch regelmässige Wartung und kompetenten Service.
Leistung & Lebensdauer
Regelmässige Wartungen und Funktionskontrollen garantieren opti-
Für alle PV-Anlagen – herstellerunabhängig
Unsere erfahrenen Servicetechniker betreuen sämtliche Anlagen –auch jene, die nicht durch die Hasler Solar AG geplant oder installiert wurden. So sorgen wir dafür, dass alle Anlagen dauerhaft auf höchstem Niveau arbeiten.
Unser Service umfasst:
für‘s Leben info@haslersolar.li
für‘s Leben info@haslersolar.li
Energie für‘s Leben info@haslersolar.li
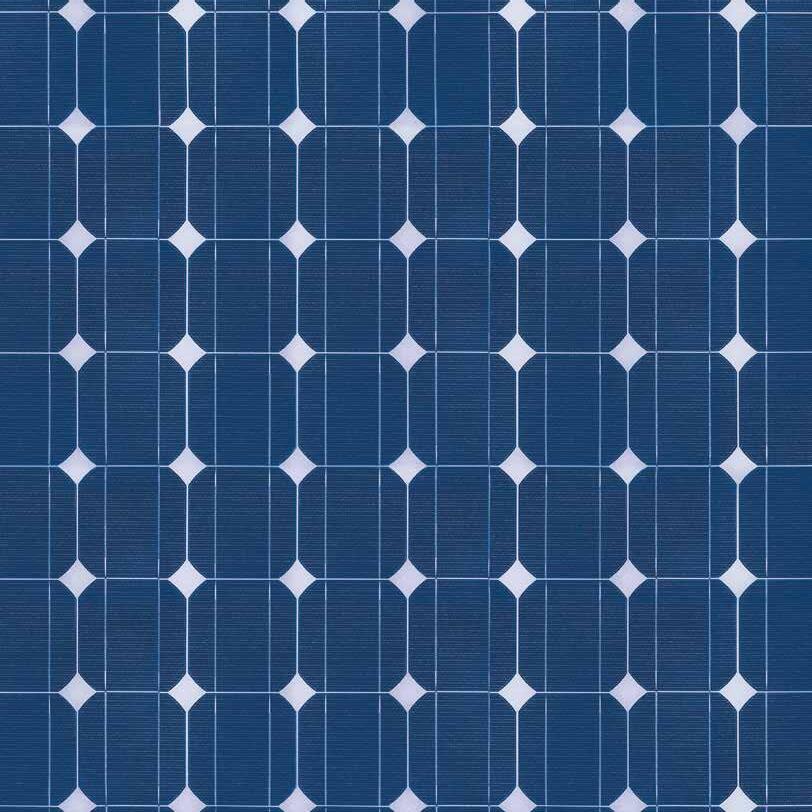

Projektpräsentation «Düergarta»
Das grösste Hotel des Landes entstand in Rekordzeit
Vor rund drei Jahren wurde die Idee geboren, in Eschen ein grosses Business-Hotel mit Parkhaus zu bauen. Die Investorengruppe wandte sich an die Axalo Gruppe, die durch ihr komplexes hausinternes Angebot an Dienstleistungen Kompetenz aus einer Hand bietet und für diverse Kunden sowie Investorengruppen schon einige Grossprojekte entwickelt und umgesetzt hat.

Kompetenz aus einer Hand
Immobilien
Buchhaltung
Unternehmensberatung
Versicherungsberatung
Steuerberatung
Unternehmensverkauf



«Wir bedanken uns bei der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag»
Elektroplanung
Gebäudeautomation
Telekom / Netzwerk
Elektroinstallation
Wuhrstrasse 7 · LI-9490 Vaduz +423 237 46 00 · www.megasolutions.li
Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag und die angenehme Zusammenarbeit.
Projektpräsentation «Düergarta»
Die Axalo Gruppe erwies sich als richtiger Ansprechpartner für ein solch anspruchsvolles Projekt. Eschen und dort wiederum der Wirtschaftspark als Standort für das Business-Hotel und Parkhaus waren aus Sicht der Experten die ideale Lage, insbesondere durch die Verkehrsachse Schweiz und Österreich über die Essanestrasse, die Nähe zur Sport- und Freizeitanlage, zum Naherholungsgebiet, zu zahlreichen Betrieben und durch die nahe Anbindung an den Bahnhof Eschen-Nendeln. Vor allem für Geschäftsleute, Tagestouristen und Reisegruppen ist das inzwischen fertiggestellte, grösste Hotel Liechtensteins ideal gelegen. Die Axalo Immobilien AG war dabei verantwortlich für die Abwicklung der Finanzierung, der Projektentwicklung, die Bauherrenvertretung und das Kostencontrolling. Ebenfalls übernimmt sie die gesamte Liegenschaftsverwaltung- und betreuung.
Viel Holz und teilweise Elementbauweise
Das Gesamtprojekt mit dem Namen Düergarta konnte perfekt auf dem dafür ausgewählten Grundstück realisiert werden. Das Besondere am Bauprojekt ist die gesamte Gebäudehülle von innen nach aussen, die in einer Holzelementbauweise mit einer Alucobond-Fassade geplant und erstellt worden ist. In den Hotelzimmern ist das Natur-

produkt Holz direkt sichtbar. Ebenfalls wurden die 126 Nasszellen in Elementbauweise produziert und eingebaut. Dies hatte auch eine positive Auswirkung auf den zeitlichen Ablauf des Projekts.
Die Bauarbeiten sind sehr gut verlaufen. Die Entwicklungs- und Planungsphase konnte in zirka einem Jahr abgeschlossen werden, und die Umsetzung des Bauprojekts dauerte rund zwei Jahre. Dann konnte die Übergabe an den Betreiber erfolgen. Die Bauarbeiten mit Liechtensteiner Unternehmen sind grösstenteils reibungslos verlaufen.
Ein grosser Dank an alle Beteiligten
Die sehr kurze Bauzeit für ein solches Grossprojekt war sicherlich eine Herausforderung für das ganze Team und die Unternehmen. An dieser Stelle bedankt sich die Axalo Gruppe nochmals ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und den Einsatz aller Projektbeteiligten. Von ihrer Seite als Bauherrenvertreterin ist die Axalo sehr zufrieden mit dem Ergebnis, da die Zusammenarbeit mit den Investoren, dem Hotelbetreiber und den Unternehmen ausgezeichnet war. Das Gebäude selbst passt sich hervorragend in die Umgebung ein, und das Parkhaus wird sicherlich die Parkplatzsuche im umliegenden Gebiet erleichtern.
PITARO GmbH UNTERLAGSBÖDEN
Grossfeldstrasse 44
Filiale: Eichholzweg 11 7320 Sargans 9495 Triesen
pitarogmbh-unterlagsboeden.ch





Entwicklungs- und Planungsphase:
ca. 1 Jahr
Umsetzung des Bauprojekts: ca. 2 Jahre
Bruttogrundfläche inkl. Parkhaus: 14‘785,96 m2
Geöffnet:
seit 1. September 2025 (24/7/365)
Projektpräsentation «Düergarta»
Z A H L E N & F A K T E N
Hotel:
126 Hotelzimmer (1. bis 5. OG)
• Frühstücksraum
• Lobby mit persönlich besetzter Rezeption (EG)
• Digitales Check-in Self Service-Store
• Hotelbar
• Fitnessraum
• Konferenzraum
• Büro- und Serviceräume
• 2 Personenaufzüge
• 1 Warenaufzug
• Photovoltaikanlage
• Gebäudehülle von innen nach aussen mit einer Alucobond-Fassadenverkleidung (Holzelementbauweise)
Parkhaus / Parkplätze aussen:
299 Parkplätze im Parkhaus
• E-Ladestationen
• 4 Behindertenparkplätze im Parkhaus
• 1 Behindertenparkplatz vor dem Hotel
• 16 Aussenparkplätze
• 2 Bus-Aussenparkplätze
• 20 überdachte Fahrradabstellplätze (einige mit E-Bike-Ladestation)
• 1 Personenaufzug
• Naturnahe Umgebungsgestaltung

Ein energieautarkes Industriegebäude
Am 1. Juli wurde in der Industriestrasse 24 in Mauren mit dem symbolischen Spatenstich der Startschuss für ein zukunftsweisendes Bauprojekt gegeben. Unter dem Namen «industrie24» entsteht ein hochmodernes und energieeffizientes Gebäude, das neue Massstäbe in Sachen Technologie und Nachhaltigkeit setzt.
Im kommenden Jahr wird dort modernste Produktion Einzug halten: mikroperforierte und kalottierte Folien sowie Profilbleche aus Edelstahl und Aluminium für Anwendungen in der Automobilindustrie und den Fassadenbau. Ergänzt wird das Portfolio durch die Herstellung innovativer Kunststoffteile für Batterieabdeckungen. Ein besonderer Meilenstein ist darüber hinaus die geplante Fertigung von Speicherbatterien «Made in Liechtenstein», die einen wichtigen Beitrag zur Energiezukunft leisten werden.
Mit «industrie24» entsteht nicht nur ein neuer Produktionsstandort, sondern ein starkes Symbol für Innovationskraft, regionale Wertschöpfung und eine nachhaltige Zukunft.
«Besonders stolz sind wir darauf, dass dieses Projekt als energieeffizientes und nahezu autarkes Vorhaben konzipiert ist. Der gesamte Energiebedarf wird durch erneuerbare Quellen gedeckt und durch modernste Speicherlösungen effizient genutzt. Damit setzen wir ein klares Zeichen für verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Ein spezielles Highlight
bezieht sich auf überschüssige Energie: Diese stellen wir unseren Mitarbeitenden kostenfrei für das Laden ihrer E-Fahrzeuge zur Verfügung. So verbinden wir nachhaltige Mobilität mit gelebtem Umweltbewusstsein», sagt Bauherr Alexander Dobler, der das Projekt gemeinsam mit seiner Gattin Andrea und den Töchtern Katja, Verena und Nora realisiert.
«Signifikant reduzierter CO₂-Fussabdruck»
Das entstehende Gebäude erzeugt seinen Strom durch eigene regenerative Quellen. Überschüssige



Mitarbeiter der Kalotte AG
Energie wird in einer von LiEnergyLabs eigens entwickelten Speicheranlage zwischengespeichert und steht bei Bedarf – etwa nachts oder bei geringer Sonneneinstrahlung – zuverlässig zur Verfügung. Dadurch erreicht das Projekt eine weitgehende Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz. Die Speicherlösung ist zudem so ausgelegt, dass sie auch Strom von Nachbargebäuden aufnehmen und als gemeinschaftlicher Energiespeicher genutzt werden kann.
«Wir von LiEnergyLabs sind stolz darauf, gemeinsam mit der Familie Dobler ein so weg-
weisendes Projekt realisieren und mit einem innovativen Stromspeicher ausstatten zu dürfen. Dieser Speicher wurde in Liechtenstein konzipiert und produziert – proudly made in Liechtenstein. Wir sind überzeugt, dass lokales Know-how im Batteriesektor einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Energiezukunft und zur langfristigen Stärkung der heimischen Wirtschaft leisten kann», sagt Daniel Meier, Geschäftsführer von LiEnergyLabs.
Das Lastmanagement ist so geplant, dass Strom durch intelligente Steuerung bedarfs-
orientiert verteilt werden kann. Technische Systeme werden also bevorzugt dann betrieben, wenn überschüssiger Strom verfügbar ist. Stromüberschüsse werden zum Beispiel zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt. Ein zentrales Energiemanagementsystem optimiert den Betrieb aller Komponenten. Der automatisierte Datenaustausch wiederum gewährleistet reibungslose Stromflüsse zwischen den Gebäuden. Dies alles erhöht die Versorgungssicherheit zusätzlich und reduziert die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz nochmals, was



Gemeindevorsteher Peter Frick mit Andreas Brugger (Kalotte AG) und Martin Dietsche (Meisterbau AG)
Zahlen und Fakten
Tiefgarage: 1'740 m²
• Produktions- und Bürofläche: 8'320 m²
• PV-Fläche: 400 kWp
• Stromspeicher: 2,7 – 6,0 MWh / 600 kWh Lade- und Entladeleistung
insbesondere auch bei Netzunterbrüchen ein entscheidender Vorteil ist. Derzeit läuft die Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen und von Fragen zu Einspeisung, Abrechnung und Netzanschluss. «Durch Eigenproduktion, Speicherung und effiziente Nutzung reduzieren wir den CO₂-Fussabdruck signifikant», sagt Andrea Dobler.
«Ein echter Meilenstein» Alle technischen Systeme des Gebäudes sind auf maximale Energieeffizienz ausgelegt. Für die Wärmeversorgung kommen moderne
Wärmepumpen mit intelligenter Steuerung zum Einsatz. Auch die Betriebseinrichtungen entsprechen höchsten Effizienzstandards: Von Walzeinheiten und Vakuumschneidegeräten über Kunststoffkaschiermaschinen, Schweissroboter und 3D-Drucker bis hin zu hocheffizienten Kompressoren – die gesamte Ausstattung ist konsequent auf ressourcenschonende Fertigung und höchste Produktqualität ausgelegt.
Das Gesamtkonzept begeistert auch die mit der Umsetzung beauftragten Unternehmen.
«Mit Begeisterung und Stolz begleitet die BLB Projekt- und Bauleitung Anstalt das Pilotprojekt industrie24 – ein visionäres Industriegebäude, das Flexibilität, Innovation und vollständige Energieautarkie vereint», sagt Bauleiter Thomas Zauner. Architekt Peter Estermann wiederum betont: «Es erfüllt mich mit grosser Freude, Teil dieses zukunftsweisenden Projekts zu sein. Die Verbindung von architektonischer Klarheit, technischer Innovation und ökologischer Verantwortung macht dieses Gebäude zu einem echten Meilenstein.»
sport:zeit

DER SCHLAUSTE SPIELZUG DER
SICHERN
Besuche 18 Heimspiele, davon 7 gratis, mit kostenloser Hin- und Rückfahrt im gesamten LIEmobil-Liniennetz
Erhältlich auf fcvaduz.li oder auf der Geschäftsstelle.
AB CHF 19.–PRO HEIMSPIEL

Die Auswärtsschwäche ist geblieben
Acht Runden sind gespielt in der Challenge League, und mit dem Heimspiel gegen Rapperswil-Jona endet am Sonntag das erste Viertel der Meisterschaft. Der FC Vaduz liegt auf dem 3. Tabellenrang, nur einen Zähler hinter dem zweitplatzierten Yverdon. Der Auftakt in die neue Spielzeit darf durchaus als gelungen bezeichnet werden. Als negativ genannt werden muss allerdings das bestehengebliebene Problem aus der vergangenen Saison: die Schwäche auf fremden Terrains.
Text: Christoph Kindle
Der FC Vaduz konnte in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel gewinnen, hat allerdings auch nur eines verloren – mit 0:1 beim souveränen Leader Aarau. Drei Partien – gegen Etoile Carouge, Xamax Neuchâtel und Stade Lausanne – endeten jeweils 1:1.
Im gesamten Kalenderjahr 2025 steht erst ein einziger Auswärtserfolg (am 1. April in Wil) auf dem Konto des FC Vaduz. Sportchef Franz Burgmeier sagte im Anschluss an die vergangene Saison: «Wir müssen uns auswärts deutlich steigern, und ich bin zuversichtlich, dass
wir das auch tun werden.» Die Leistungen sind in der Tat auswärts besser geworden, die Resultate allerdings widerspiegeln dies noch nicht wie gewünscht. Im heimischen Rheinparkstadion ist die Bilanz hingegen bislang makellos: Aus allen vier Heimspielen ging der FCV als Sieger vom Platz.
Fehlende Effizienz das Problem Zuletzt erkämpften sich die Vaduzer auf der Pontaise gegen Stade Lausanne Ouchy ein 1:1-Unentschieden. Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit, Campos erzielte für den FCV eine Minute nach dem Rückstand den
Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel erspielte sich der FC Vaduz mehrere Top-Möglichkeiten, doch der Siegestreffer wollte einfach nicht gelingen. Entsprechend verärgert war Trainer Marc Schneider nach geschlagener Schlacht: «Dieses Spiel hätten wir ganz einfach gewinnen müssen, ohne Wenn und Aber.» Die fehlende Effizienz wurde den Vaduzern zwei Wochen zuvor schon bei der 0:1-Niederlage bei Leader Aarau zum Verhängnis. Die Schneider-Elf konnte die Partie im Brügglifeld beim Aufstiegsfavoriten weitestgehend offen gestalten, das entscheidende Tor aber erzielten die Platzherren mit dem Pausenpfiff.


FCV-Präsident
Patrick Burgmeier
Heimspiel gegen Rapperswil An diesem Sonntag können die Vaduzer nun wieder ihre Heimstärke unter Beweis stellen. Zu Gast im Rheinparkstadion ist um 14 Uhr der Aufsteiger FC Rapperswil-Jona. Das Team von Trainer David Sesa (36-facher Schweizer Nationalspieler) hat aus den ersten acht Spielen sieben Punkte geholt und liegt auf Tabellenrang 7. Zuletzt kassierte Rapperswil eine 1:3-Heimniederlage gegen Xamax, zuvor gab es ein 1:1-Remis in Bellinzona. Der FC Vaduz steigt als klarer Favorit in diese Begegnung und peilt den fünften Heimsieg in Folge an.
Vier Fragen an
FCV-Präsident
Patrick Burgmeier
Der FCV liegt nach acht gespielten Runden mit 15 Punkten auf dem 3. Tabellenrang. Wie zufrieden bist du mit der ersten Phase der neuen Saison?
Patrick Burgmeier: Wir sind mit vier Siegen, drei Unentschieden und lediglich einer Niederlage positiv und sehr solide in die neue Meisterschaft gestartet. Dazu gabs das Weiterkommen in der UEFA Conference League-Qualifikation in Runde 3. Uns stimmt aber vor allem auch die Art und Weise, wie das Team auftritt, und der Fussball, den wir spielen, zuversichtlich. Wenn wir noch etwas effizienter und abgeklärter werden, wird es für jeden Gegner schwierig, uns zu schlagen.
Wie schon in der vergangenen Saison gilt ein wenig das Motto: Zuhause hui, auswärts pfui. Gibt es dafür eine Erklärung?
Das ist schwierig zu erklären und schon ein wenig speziell, obwohl unsere bisherigen Aus-

wärtsspiele in dieser Saison besser waren als in der vergangenen Spielzeit. Unser Team bereitet sich genau gleich akribisch auf ein Spiel vor, sei es nun ein Heim- oder Auswärtsspiel. Zudem ist es auch kein Muster in Sachen Übernachtung, Tageshotel oder direkte Anfahrt ans Spiel zu erkennen. Ich denke, dass wir diese negative Auswärtsbilanz einfach einmal ablegen müssen, und danach läuft es von ganz alleine wieder.
Welche Neuzugänge haben dich bisher überzeugt, bei welchen siehst du noch Steigerungspotenzial?
Wir sind generell mit dem gesamten Kader zufrieden. Spieler wie Mack, Seiler und auch Dantas haben sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft und sind mittlerweile wichtige Eckpfeiler der Mannschaft. Offensiv haben wir sicherlich auch Qualität, konnten diese aber noch zu wenig auf den Platz bringen. Diesbezüglich gilt es auch, ein wenig Geduld an den Tag zu legen und den Spielern weiterhin das Vertrauen zu schenken. Zudem bringen auch unsere erfahrenen Spieler gute Leistungen, was aktuell einen guten Mix ausmacht.
Aarau scheint unaufhaltsam Richtung Super League zu marschieren. Ist Platz zwei für den FCV am Ende ein realistisches Ziel?
Aarau gehört stets zu den Topteams der Liga und verpasste den Aufstieg in den vergangenen drei Jahren zweimal nur ganz knapp. Somit überrascht grundsätzlich ihre Positionierung nicht. Allerdings ist die makellose Bilanz schon eindrücklich und anerkennenswert. Wir haben aber bei unserem Auswärtsspiel gesehen, dass wir uns keineswegs zu verstecken brauchen und im Brügglifeld eigentlich die bessere Mannschaft waren. Aber am Ende zählt das Resultat, und dort lassen sie momentan nichts anbrennen. Wenn wir uns als Team präsentieren und uns auf unsere Stärken konzentrieren, bin ich überzeugt, dass wir das Potenzial haben, diese Saison ganz vorne um die beiden ersten Plätze mitzuspielen.


«Wir müssen als Mannschaft stabiler auftreten»
In der ersten Mannschaft des FC USV Eschen-Mauren fehlt es derzeit an der nötigen Stabilität. Ein Blick auf die Tabelle genügt, um zu sehen, dass die Mannschaft von Trainer Michele Polverino in acht Spielen erst sieben Punkte geholt hat. Der Hauptgrund liege in der Effizienz im Abschluss, so der Trainer. Er begründet auch die vielen Wechsel, die Spiel für Spiel vorgenommen werden.
Interview: Herbert Oehri
Michele, es sind acht Meisterschaftsspiele gespielt. Dein Fazit?
Michele Polverino: Mit sieben Punkten aus acht Spielen können wir natürlich nicht zufrieden sein, das ist uns allen bewusst. Wir hätten in manchen Partien mehr herausholen können, haben uns aber selbst nicht immer belohnt. Positiv ist, dass wir uns in vielen Spielen Chancen erarbeitet haben. Wir wissen, wo wir ansetzen müssen, und arbeiten intensiv daran, die Punkteausbeute in den nächsten Wochen deutlich zu steigern.
Es zeigt sich fast in jeder Partie: Dem FC USV fehlt vorne die Durchschlagskraft. Und was sagst du zur Abwehr?
Es stimmt, im Offensivbereich fehlt uns aktuell noch die letzte Durchschlagskraft. Wir kommen oft bis ins letzte Drittel, schaffen es aber zu selten, die Aktionen konsequent zu Ende zu spielen. Daran arbeiten wir im Training. Positiv hervorheben möchte ich unsere Defensivarbeit – ausser gegen Wettswil. Die Mannschaft steht insgesamt kompakt, wir lassen nur wenige klare Chancen des Gegners zu und sind in der Rückwärtsbewegung
stabiler geworden. Wenn wir vorne noch effizienter werden, holen wir uns die nötigen Punkte.
Es fällt auf, dass die Aufstellungen von Spiel zu Spiel teils sehr stark verändert werden. Was sind die Gründe?
Die Veränderungen ergeben sich aus mehreren Faktoren. Einerseits hatten wir einige Verletzungen und Ausfälle, die natürlich Einfluss nehmen. Andererseits möchte ich den gesamten Kader einbinden und den Spielern, die im Training überzeugt haben,

Adejumo ist derzeit der beste Torjäger beim FC USV.
auch im Wettkampf die Chance geben. Wir brauchen Konkurrenzdruck und frische Impulse, um uns weiterzuentwickeln. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft flexibel bleiben. Das macht uns auf lange Sicht stärker.
Was willst du unternehmen, um die Mannschaft aus dem Abstiegskeller zu holen? Ist für manche Spieler die erste Liga eine zu hohe Liga?
Wir wissen, dass die aktuelle Situation nicht zufriedenstellend ist. Um da rauszukommen, brauchen wir Kontinuität, harte Arbeit und
Überzeugung. Wir müssen unsere Effizienz im letzten Drittel steigern und die einfachen Fehler abstellen, dann werden wir auch die Ergebnisse einfahren, die wir brauchen. Was die Spieler betrifft: Es geht weniger um die individuelle Qualität, sondern darum, dass wir als Mannschaft stabiler auftreten und jeder seine Stärken konsequent einbringt. Wenn uns das gelingt, bin ich sicher, dass wir uns Schritt für Schritt aus dieser Zone befreien werden.
Danke für das Interview.

1. LIGA – Classic – GRUPPE 3
Spiele 9. Runde
Freitag 03.10.2025
20:15 Uhr
FC Kosova - FC Dietikon
Samstag 04.10.2025
15:00 Uhr
FC Collina d'Oro - USV Eschen/Mauren
16:00 Uhr FC Baden 1897 - FC Winterthur U-21
SV Schaffhausen - FC St. Gallen 1879 U-21
FC Wettswil-Bonstetten - AC Taverne
SV Höngg - SC YF Juventus
Sonntag 05.10.2025
14:00 Uhr
FC Widnau - FC Mendrisio
15:00 Uhr
FC Freienbach - FC Tuggen

«Wir sind auf einem guten Weg»
Nach keinem idealen Start in die neue Meisterschaftssaison hat der FC Balzers nach zwei Katersiegen innert drei Tagen in die richtige Spur gefunden. Nach dem 4:1-Erfolg vor einer Woche im Heimspiel gegen Erstliga-Absteiger FC Linth folgte am vergangenen Mittwoch mit einem 1:6-Erfolg beim KF Dardania St. Gallen der nächste Kantersieg. Trotzdem bleibt Marco Wolfinger, Sportlicher Leiter des FC Balzers auf dem Boden. Die 1. Mannschaft bräuchte noch ein wenig Zeit bis die ansgeschlagenen Spieler zurück sind und das Team unter dem neuen Trainer eingespielt ist, sagte nach dem zweiten Sieg in Folge Marco Wolfinger, mit dem wir das nachfolgende Interview geführt haben.
Interview: Herbert Oehri
Marco, beim FC Balzers läuft es nach Anfangsschwierigkeiten und nun nach dem zweiten Kantersieg diese Woche schon recht gut. Auf was führst du das zurück?
Marco Wolfinger: Wie bereits in den Interviews im August und September erwähnt, bedarf es bei grossen Umstellungen, wie einem Trainerwechsel und/oder grösseren Kadermutationen, an Zeit. Zeit für ge -
meinsame Trainingseinheiten, für das Einstudieren taktischer Konzepte und für viele Wiederholungen dieser Konzepte. Da wir diese Zeit zusammen auf dem Trainingsplatz bisher aus unterschiedlichen Gründen nicht im erforderlichen Masse zur Verfügung hatten, setzt das Trainerteam aktuell alles daran, das Beste aus den vorhandenen Trainingseinheiten rauszuholen. Wir sind auf einem guten Weg und können hoffentlich auch bald wieder auf unsere aktuell angeschlagenen Spieler setzen.
Trainer Gerardo Clemente sprach von Trainingsrückstand aufgrund von vielen Ferienabsenzen. Siehst du darin den einzigen Grund, dass der FCB noch nicht auf der Höhe seines Könnens angelangt ist?
Absolut. Ferienabsenzen in Kombination mit verletzungsbedingten Ausfällen sowie Abstellungen zur Nationalmannschaft liessen im bisherigen Verlauf der Saison nur sehr wenige reguläre Trainingseinheiten mit dem gesamten Kader zu. Dieser Herausforderung


stellt sich das gesamte Team aktuell sehr vorbildlich und als Einheit.
Ist der Kader in der Länderspielpause wieder grösser geworden, will heissen, sind die verletzten Spieler und Ferienabsenzen zurück im Training?
Die Verletzten tasten sich aktuell gerade über gezielte Belastungssteuerung wieder ans Mannschaftstraining heran und stehen uns hoffentlich bereits in dieser schwierigen englischen Woche über Teileinsätze zur Verfügung.
Wo siehst du den FC Balzers Ende der laufenden Vorrunde im November 2025?
Wir wollen die Vorrunde nutzen um als Mannschaft Sicherheit und Konstanz in taktischen Abläufen und unserem Auftreten zu erarbeiten und unsere Spiele dabei so erfolgreich wie möglich gestalten, ohne dabei zu vernachlässigen unseren jungen Talenten immer wieder wertvolle Minuten einräumen zu können.


Anzeige


Sichtbarkeit im Sportpark
Mit der Erneuerung des Kunstrasens (Fertigstellung Oktober 2025) und der geplanten Renovation des Hauptplatzes (2026) ergeben sich wieder attraktive Möglichkeiten für Bandenwerbung im Sportpark Eschen-Mauren.
Text: Philipp Meier

Unsere Angebote
• 5 m Hauptplatz: CHF 850.– pro Jahr
• Kombobande (Haupt- & Kunstrasen): CHF 1’150.– pro Jahr
Einzelbande Hauptplatz (2,5 m): CHF 450.– pro Jahr
• Einzelbande Kunstrasen (2,5 m): CHF 350.– pro Jahr
Laufzeit: 3 Jahre
Exklusive einmalige Herstellungskosten
Sichern Sie sich Ihre Präsenz im Sportpark
Erreichen Sie ein breites, sportbegeistertes Publikum –direkt vor Ort und im Herzen der Region.

Ansprechpartner:
Markus Kaiser Sponsoring marketing@usv.li
+423 371 17 00 www.usv.li

Fussball-Freundschaftstreffen
FC Schweizer Nationalrat vs.
FC Liechtensteiner Landtag in Bern
Erstmals traf sich der FC Liechtensteiner Landtag – eingekleidet in einem neuen Dress sowie angeführt vom Captain und Landtagspräsidenten Manfred Kaufmann – in Bern zu einem Fussball-Freundschaftstreffen gegen den FC Schweizer Nationalrat.
Der FC Nationalrat kann aus dem Vollen schöpfen – 200 Nationalräte und 46 Ständeräte – und behielt als Gastgeber gegen den Fussballz werg FC Landtag mit 6:1 Toren die Oberhand und wurde somit seiner Favoritenrolle gerecht.
Beim anschliessenden Beisammensein bei kulinarischer Verwöhnung wurde nicht nur das Fussballspiel analysiert, es stand ein sehr freundlicher und informativer Gedankenaustausch im Zentrum. Ein herzliches Dankeschön an die Schweizer Parlamentarierfreunde des FC Nationalrat für diesen sehr sympathischen Event. Danke auch dem Liechtensteiner Fernsehen für die Begleitung und TV-Aufnahmen über diese Premiere dieses ersten Fussball-Freundschaftstreffens des FC Schweizer Nationalrat & FC Liechtensteiner Landtag in Bern.
FUSSBALL IST TEAMGEIST.
MBPI. In Liechtenstein. Für Liechtenstein. Landstrasse 105, Postfach 130, 9495 Triesen Telefon + 423 399 75 00, info @ mbpi.li, www.mbpi.li

Historisches

Eisenbahn Feldkirch-Buchs vor 80 Jahren
Nach dem Zweiten
Weltkrieg
fährt das «Züglein» wieder
Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 hatte auch auf Liechtenstein Auswirkungen. Einerseits wurde das Land ein direkter Nachbarstaat Hitler-Deutschlands, andererseits wurden die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ein Teil der Deutschen Reichsbahn. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erfolgte die Schliessung der Zugverbindung von Feldkirch nach Buchs. Ein bekränztes «Züglein» am 19. September 1945 kündigte die Wiederaufnahme des Zugverkehrs an.
Text: Günther Meier
Das «Züglein» Feldkirch-Buchs, das durch Liechtenstein ratterte, habe Kranz- und Blumenschmuck getragen, berichtete das «Liechtensteiner
Volksblatt». Schon der erste Zug habe ein lautes Signal bei den Bahnhöfen gegeben, wohl um anzuzeigen, dass wieder neues Leben auf dieser Verkehrsader beginnt. Die Bahngesellschaft
hatte für die Wiedereröffnung der Bahnlinie am 19. September 1945 beim Bahnhof in Schaan eine Feier organisiert. Der um 9.23 Uhr eintreffende Zug aus Österreich war mit den Fahnen
von Liechtenstein, Österreich und der Schweiz geschmückt und ausserdem bekränzt worden. Vertreter der drei Länder trafen sich zu einem kleinen Festakt, um das Ereignis zu würdigen. Bei den Gesprächen sei es aber auch um die Bahn selbst gegangen, konnte das «Volksblatt» in Erfahrung bringen. Im neuen Fahrplan sei kein Halt des Arlberg-Express beim Bahnhof Schaan-Vaduz mehr vorgesehen gewesen, was für Liechtenstein einen Nachteil bedeutet hätte. Regierungschef Alexander Frick habe darüber mit den zuständigen Vertretern der ÖBB gesprochen und sogleich die Zusicherung erhalten, der Arlberg-Express werde künftig wieder einen Halt in Schaan einlegen.
Spionage schon während des Ersten Weltkriegs
Die Bahnlinie von Feldkirch nach Buchs, die durch einen Teil des Liechtensteiner Unterlandes und über Schaaner Gemeindegebiet führt, ist zwar nur knapp 20 Kilometer lang. Aber auf dieser Strecke verkehrten seit der Eröffnung im Jahr 1872 die internationalen Züge von West nach Ost und umgekehrt. Schon während des Ersten Weltkriegs (1914–1918) kam es auf dieser Strecke zu Störungen, weil Österreich die Kontrollen für den Grenzübertritt in die neutrale Schweiz massiv verschärft hatte. Laut Berichten in den Zeitungen kam es immer wieder zu Behinderungen, manchmal gar zu längeren Unterbrüchen von mehreren Tagen. Der Bahnkorridor ist offensichtlich intensiv für Spionagetätigkeiten benützt worden, die man zu unterbinden versuchte. All diese Einschränkungen hatten teilweise negative Auswirkungen auf das Leben in Liechtenstein: in Form von Behinderungen beim Warenaustausch, bei der Fahrt zu den Arbeitsplätzen in Österreich, letztlich auch für persönliche Besuche über die Grenze hinweg.
In der Zwischenkriegszeit kehrte wieder Ruhe ein, doch im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs erregte die Bahnstrecke erneut das Interesse unterschiedlicher Personengruppen, wie der Historiker Peter Geiger in einer Abhandlung über den Eisenbahnverkehr in Liechtenstein geschrieben hat. Viele Freiwillige, die im Spanischen Bürgerkrieg die republikanisch-sozialistische Seite unterstützten, seien ursprünglich von Österreich über die «grüne Grenze» nach Liechtenstein gekommen und anschliessend in die Schweiz weitergezogen. Ab Oktober 1937 hätten diese Spanienkämpfer einen bequemeren Weg gewählt, nämlich die Eisenbahn von Feldkirch nach Buchs. Um das eigentliche Ziel ihrer Reise zu kaschieren, hätten sie eine Fahrkarte nach Paris gekauft, um die Weltausstellung zu besuchen. In Wirklichkeit aber reisten die Freiwilligen von der französischen Hauptstadt direkt nach Spanien, um im Bürgerkrieg zu kämpfen.
Entlang der Bahnlinie hatte es am meisten Nationalsozialisten
Bei seinen Recherchen über Liechtenstein im Zweiten Weltkrieg fand Peter Geiger heraus, dass die Bahnlinie eine gewisse Rolle auch beim Einfliessen von Nazi-Gedankengut spielte. «Es fällt auf», schrieb Geiger darüber, «dass gerade in den Ortschaften entlang der Bahnlinie verhältnismässig am meisten Nationalsozialisten zu finden waren, nämlich in Schaan, in Nendeln und in Schaanwald.» Die Schienen hätten offensichtlich einen doppelten Zweck erfüllt, einmal für die Eisenbahn selbst, aber ebenso als Schienen «für den Import von NS-Ideen und NS-Einfluss». Etliche Liechtensteiner waren in dieser Zeit bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) beschäftigt, die – wie bereits erwähnt – ab
1938 zur Deutschen Reichsbahn wurde. Selbstverständlich seien nicht alle «Bähnler» aus Liechtenstein «braun» gewesen, schränkt Geiger ein, aber eine Reihe von ihnen habe eine bedeutende Rolle in der «Volksdeutschen Bewegung» gespielt, die den Anschluss Liechtensteins an Hitler-Deutschland zum Ziel erklärt hatte. Eine Statistik aus dem Jahr 1942 registrierte 347 Arbeitskräfte aus Liechtenstein, die täglich zu einem Arbeitsplatz nach Vorarlberg mit der Bahn fuhren: Davon waren 136 bei der Deutschen Reichsbahn beschäftigt.
Nach dem Anschluss Österreichs verfügte Deutschland mit der Bahnlinie durch Liechtenstein über eine Bahnstrecke, die direkt ins neutrale Ausland führte – nach Buchs. Sowohl die Bahnlinie als auch der Bahnhof Buchs wurde offenbar intensiv von deutscher Seite für militärische, wirtschaftliche und politische Spionage benutzt. Wie die Schweizer nach dem Krieg feststellten, sei vor allem der Bahnhof Buchs ein ständiger Treffpunkt für Spione gewesen, die für Deutschland arbeiteten. Ins Visier der Agenten gelangten offenbar auch Grenzgänger, die für Kurierdienste zugunsten Deutschlands angeworben wurden.
Carl Zuckmayer flieht über Liechtenstein in die Schweiz
Aber nicht nur der Arbeit der Spione und Agenten diente die Bahnlinie, auch Flüchtlinge und vom Deutschen Reich Verfolgte gelangten mithilfe der Bahn und der Bahnstrecke über Liechtenstein ans Ziel ihrer Hoffnung – in die neutrale Schweiz. Nach Darstellung von Peter Geiger überschritten viele jüdische Flüchtlinge ohne Ein- und Durchreisepapiere die «grüne Grenze» nach Liechtenstein. Manche im Schutz der Dunkelheit von Feldkirch oder Tisis dem Bahndamm entlang nach Schaanwald: Einmal in Liechtenstein angekommen, war es nicht mehr schwierig, in die Schweiz zu gelangen.
Im Buch «Krisenzeit – 1928 – 1939» schildert Peter Geiger die Flucht des Schriftstellers Carl Zuckmayer über Liechtenstein in die Schweiz. Zuckmayer (1896–1977), der mit seinem Roman «Der Hauptmann von Köpenick» einen literarischen Erfolg hatte, war im Deutschen Reich wegen seiner Opposition gegen die Nationalsozialisten in Ungnade gefallen. Anfang der 1930er-Jahre floh Zuckmayer nach Österreich, wo er sich aber nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 nicht mehr sicher fühlte und den Weg in die Freiheit wählte. Zuckmayer setzte sich am 16. März 1938 in Wien in den Zug nach Feldkirch – und von dort durch Liechtenstein in die Schweiz. Geiger schreibt, Zuckmayer sei dem «Wiener Hexenkessel im letzten Augenblick entronnen». Im Bahnhof Feldkirch habe der Schriftsteller in der Nacht ausführliche Kontrollen durch die Gestapo über sich ergehen lassen, die er «dank köpenickscher Kaltblütigkeit» aber überstehen konnte. Der Frühzug transportierte Zuckmayer durch Liechtenstein, wie er in einem seiner Werke beschrieb, sei der Himmel «glasgrün und wolkenlos» gewesen – und «die Sonne flimmerte auf dem Fernschnee». Auf dem Weg in die Freiheit sei ihm trotzdem ein Gedanke gekommen: «Ich werde mich nie mehr freuen!» Ein Jahr nach seiner Flucht in die Schweiz reiste Zuckmayer nach Amerika aus und nahm dort die US-Staatsbürgerschaft an, kehrte aber 1946 nach Europa zurück. Die Zeit von 1957 bis zu seinem Tod 1977 lebte Carl Zuckmayer in Saas-Fee in der Schweiz. Liechtenstein, das er bei seiner Flucht kurz gestreift hatte, geriet bei ihm aber nicht in Vergessenheit: Er war befreundet mit dem in Liechtenstein lebenden Verleger Henry Goverts, den er gelegentlich besuchte.

So sah die Wirtschaft «Zum Gänsenbach» aus. Das Bild zeigt eine Prozession im Jahr 1921, die von der Kirche herkommend um den Weiherring zog. Das Haus steht heute noch.
Alte Wirtshäuser von Mauren
In der Gemeinde Mauren gab es vor der vorletzten Jahrhundertwende deutlich mehr Gasthäuser und Restaurants als heute. Die Zahl der Restaurants, Hotels, Gasthäuser und Cafés hat sich vor allem in den vergangenen 20 Jahren merklich zurückentwickelt. Heute gibt es in Mauren-Schaanwald nur noch fünf Restaurants bzw. Cafés. Der Rückgang vollzog sich nicht nur in der Gemeinde Mauren, sondern weit darüber hinaus. Ein Grund für das Gastronomiesterben war die dreijährige Pandemie von 2020 bis 2023.
Text: Herbert Oehri
Einst standen im Bereich der Maurer Pfarrkirche vier Gasthäuser, die nur etwa 200 Meter voneinander entfernt waren: Die Wirtschaft zum Gänsenbach, die Wirtschaft zur Sonne, die Wirtschaft zur Krone und das Gasthaus Rössle. Auch auf dem Rennhof im sogenannten «Wissle-Huus», später «Haberler-Huus», war eine Schenke untergebracht, die den Namen Wirtschaft zur Tanne trug.
Wirtschaft zum Gänsenbach
Folgend eine Vorstellung der ältesten Maurer Gastbetriebe, deren Ursprung teils bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, und einiger neuerer:
Im sogenannten «Philippa Andreias» oder auch «Mechele-Huus» des Urban Meier (1905–1958) befand sich die ehemalige Wirtschaft zum Gänsenbach. Diese Stätte wurde vielfachen baulichen Veränderungen unterzogen, die mehr dem Modernen entsprachen. Erhalten geblieben ist

noch ein Bild vor der Renovation sowie das Wirtschaftsschild, eine gemalte Holztafel in der Grösse 130 × 30 Zentimeter. Das Wirtshausschild war lange Zeit bei Gustav Alfons Matt in Zug und kam später zur Verwahrung ins Liechtensteiner Landesmuseum nach Vaduz.
Zeichnungen und Bildern zufolge muss die Wirtschaft zum Gänsenbach ein stattliches und grosses Doppelhaus mit vielen Fenstern gewesen sein. Die Schankstätte ist der Überlieferung
zufolge (Notizen Pfr. Tschugmell) bis etwa in die Zeit um 1870 betrieben worden. Ehemals wurde es «s Klosa-Michel-Franza-Huus» genannt. Das Haus Nr. 78 alt im Gänsenbach gehört den Nachkommen von Eduard Meier.
Die Namen der Wirtsleute der ehemaligen Gänsenbach-Wirtschaft sind uns nicht alle bekannt. Es ist nur überliefert, dass die Tiefenthalers und später die Mündles dort gewirtet haben. Das Geschlecht der Tiefenthaler ist

in Mauren ausgestorben. Nach einer weiteren Überlieferung von Pfarrer Tschugmell sei in der Zeit der «Kilbe» im oberen Stock so wild getanzt worden, «dass der Boden nur so knarrte». Man bevorzugte den damals in der Region aufkommenden «Raspatanz», heisst es in Tschugmells Überlieferung. Der Raspatanz besteht u. a. auch aus Elementen des Stampfens. So wurde es jedes Jahr zur Kilbe gefährlich. Nicht nur wegen des übermässigen Alkoholkonsums, dem sich insbesondere die jungen Dorfburschen hingaben, sondern weil die Holzböden bei der wilden Tanzerei bisweilen gefährlich ins Wanken gerieten und in die unteren Stockwerke durchzubrechen drohten. Wann die Schenke aufgelöst wurde, ist nicht bekannt.
Wirtschaft zur Sonne
Die Wirtschaft zur Sonne in Mauren (Haus Nr. 84 alt) stand nur wenige Meter unterhalb der Maurer Pfarrkirche, direkt an der hart abschüssigen Strassenabzweigung Peter-und-Paul-Strasse/Kirchenbot (früher Sennereistrasse). Bartholomäus Meier (1811–1876) war Wirt in der Wirtschaft zur Sonne, die 1930 ein Opfer der Flammen wurde. Angebaut ans Wirtshaus zur Sonne war die sogenannte Thisa-Hans-Burg, ein Haus mit dicken Grundmauern. Die Wirtschaft zur Sonne ist das Stammhaus der «Sunnawürtles». Es leben im Land noch viele Nachkommen. Das Haus steht nicht mehr. Es wurde von der Gemeinde gekauft und abgebrochen.



Wirtschaft zur Krone
Früher standen drei Wirtschaftshäuser in unmittelbarer Nähe zur Kirche: Wirtschaft und Torkel zur «Krone», Wirtschaft «Rössle» und Wirtschaft «Sonne». Das «Rössle», vormals «Zum weissen Rösslein», der Familie Büchel-Batliner, welche die Gastschenke am 1. Mai 1998 auflöste, ist heute im Besitz der Gemeinde Mauren, die daraus mit grosser Unterstützung privater Spender (vor allem von DDr. Herbert Batliner) das «Kulturhaus Rössle» errichtet hat. Es ist in den vergangenen Jahren zu einem kulturellen Mittelpunkt im Unterland geworden.
Der Gasthof Krone (älteren Menschen noch unter dem Begriff «Franz-Sepp-Kieber-Huus» bekannt) befand sich ungefähr beim Eingang zum unteren Friedhof (Friedhofskapelle). Im Jahr 1916 kaufte die Gemeinde Mauren das ganze Anwesen für die Erweiterung des Friedhofes. 1922 wurde das Haus zur Krone abgerissen.

Haberler-Huus, früher Stammhaus der «Rennhof-Wissle» und Geburtshaus von Franz-Josef Oehri, Generalauditor in der österreichischen Militärjustiz der kk. Monarchie ÖsterreichUngarn. Im Haus war früher der Gasthof zur Tanne untergebracht.
Die Wirtschaft zur Tanne
In Mauren gab es durch die Jahrhunderte viele Wirtschaften, von denen praktisch alle aus dem Dorfbild verschwunden sind. Eine der ältesten dieser Kneipen befand sich auf dem Rennhof, im Geburtshaus der Maurer Oehri («Wissle-Oehri», «Rennhof-Oehri», «Strumpf-Oehri»), dem späteren Haberler-Haus. Der Gasthof, bei dem viele Wanderer aus dem Raum Feldkirch einkehrten, hiess Wirtschaft zur Tanne und wurde von Johann Oehri (1792–1869) betrieben. Er war zudem alleiniger Eigentümer der Schaanwälder Mühle (Hs. Nr. 1½ alt). Für die Wirtschaft zur Tanne erhielt Oehri am 16. Dezember 1835 das Schankrecht, direkt von Wien. Es ist mündlich überliefert, dass er dafür hart kämpfen musste, wobei ihm sein Bruder Franz-Josef Oehri, der als Generalauditor in der österreichischen Militärjustiz grossen Einfluss auf die Hofkanzlei des Fürsten in Wien hatte, geholfen habe. (Aussage Andreas Oehri, 1924– 2003 gegenüber Herbert Oehri, Präsident des Ahnenforschungsvereins Mauren am 20.Juni 2002 bei der Befragung über die Familie der Rennhof-Wissle).
Die Wirtschaft zu Tanne war in das bis heute noch bestehende «Haberler-Huus» auf dem Rennhof integriert. Der Wirtskasten steht heute in der Kulturgütersammlung der Gemeinde Mauren. Das Haus der «Rennhöfler-Oehri» mit der Nummer 101/120/60 wurde laut Vertrag vom 22. Januar 1884 an Dr. Franz von Haberler verkauft.
Das Geburtshaus und Lehenhof der «Rennhöfler-Wissle-Oehri» (später Haberler-Huus) ist auch deshalb interessant, weil darin Franz-Josef Oehri (1793–1864) geboren und aufgewachsen ist (siehe Bild). Franz Josef war k.k. Generalauditor und bekleidete damit den höchsten Rang in
der österreichischen Militärjustiz. Er hat zusammen mit anderen, allen voran Peter Kaiser aus dem Haus Nr. 74 im Weiherring (Haus Metzgerei Hersche), die Verfassung Liechtensteins von 1849 masgeblich geprägt. Oehri war studierter Jurist und hat in dieser Funktion Einfluss auf den Verfassungstext genommen.
Gasthaus zum Rössle (früher Rösslein) Der erste Wirt des Gasthofs zum weissen Rösslein (später Gasthaus Rössle bei der Kirche) hiess Franz-Josef Batliner (1809–1897). Er war Eschner Bürger und liess sich im Jahr 1835 in Mauren einbürgern. Meus Batliner (1893–1966) übernahm am 29. Februar 1940 durch Erbschaft die Liegenschaft des Gasthaus Rössle mit grossem Umschwung samt Landwirtschaftsbetrieb. Das Gasthaus erlebte in den Jahren 1930–1975 seine Blütezeit, als Meus‘ freundliche und zuvorkommende Ehefrau Resi Batliner-Matt Wirtin war. Die Ehe von Meus und Resi Batliner war mit drei Kindern gesegnet: Margrit (1934–2016), Josef (1936 – 1936) und Maria (1940–2006). Margrith heiratete 1966 den Schellenberg Bürger Josef Büchel (1922–2004) und war viele Jahre lang Wirtin im Gasthaus Rössle. Das Wirtshaus (Baujahr 1833) wurde am 1. Mai 1998 geschlossen, an die Gemeinde Mauren verkauft und umgebaut. Das ehrwürdige Gebäude konnte dank den Anstrengungen der Gemeinde, der Denkmalpflege und von Privaten vor dem Abbruch gerettet werden. Nach aufwendigen Umbau-und Renovierungsarbeiten dient es heute als denkmalgeschütztes Kulturhaus mit einem hervorragenden Ruf weit über die Gemeindegrenzen hinaus.
Gasthaus Hirschen
Das heutige Gasthaus Hirschen im Zentrum
von Mauren ist im Jahr 1911 von Rosina Oehri, geb. Jäger (1865–1942), erbaut worden. Denn am 19. März 1911 brannten sowohl die alte Taverne des Johann Matt, also das «Irle-Hansa-Huus», als auch das neue, gegenüberliegende Gasthaus zum Hirschen im Ortsteil Werth bis auf die Grundmauern nieder.
Vorgeschichte: Am 18. Dezember 1889 ging das Anwesen Nr. 70 auf dem Werth von den Matt in den Besitz der Öhri («Wenzel-Öhri») über. Franz Josef Öhri (1853–1917) kaufte es an diesem Datum und überschrieb eslaut Vertrag von 1. August 1903 seiner Gattin Rosina Öhri. Wie eingangs erwähnt, widerfuhr dem «Hirschen» am 19. März 1911 dasselbe Schicksal Gasthaus dem der anderen Strassenseite, der alten «Taverne», beide gingen in Flammen auf.
Die Verlagerung des Verkehrs, der damals über den Werth / die Binza in Richtung Vorarlberg führte, auf andere Strassen und Bezirke, liess einen Neubau für ein Gasthaus auf dem Werth als nicht günstig erscheinen. Rosina Öhri liess daher einen Neubau im besser gelegenen Ortsteil Gänsenbach erstellen.
Ein Sohn von Rosina Öhri, Rudolf (1889–1952), übernahm den Gasthausbetrieb und führte ihn zusammen mit seiner Ehefrau Ottilie, geb. Mündle (1896–1986), mustergültig, sodass das Wirtshaus recht bald zu einem Begriff wurde. Als ihr Sohn Andreas Öhri 1948 starb, nahmen sie an Kindesstatt einen Knaben an, den sie auf den Namen Andreas tauften. Andreas Klein (1935–2001) heiratete 1959 Germana Öhri vom Familienstamm der «Hanseles».Auch sie beide waren hervorragende Wirtsleute.
Sie verkauften den «Hirschen» später an Felix Marxer («Hemmerle»), der den Gasthof samt Umschwung seinem Sohn Arno Marxer hinterliess. Pächter kamen und gingen. Arno Marxer verkaufte die «Hirschen»-Liegenschaft 1998 an die Gemeinde Mauren, die sie weiterverpachtet hat.
Der «Hirschen» zählt zu den wenigen heute noch existierenden Gastbetrieben in der Gemeinde Mauren und im Ortsteil Schaanwald.

Weiter Gasthäuser in Mauren-Schaanwald
Weitere noch bekannte Namen von Gasthäusern, Hotels oder Cafés sind: «Freihof», «Freiendorf», Café Matt, «Alter Zoll» und die Ethno Café/Bar sowie «Linde», Restaurant Derby und der «Waldhof» Schaanwald
Geschlossen respektive aufgelöst
• Freihof
• Krone
• Freiendorf
• Linde
• Derby
• Waldhof
In Betrieb:
• Café Matt
• Alter Zoll
• Ethno
• Mai Thai Restaurant
• Hirschen
Gasthaus Freihof 1920/21 erbaute Josef Kaiser (1885–1970), von Beruf Lehrer, ein grosses Wohnhaus, das er zu einer Gaststätte ausbauen liess. Das Haus wurde auf den Namen seiner Ehefrau Eugenia, geb. Öhri, (1891–1947) im Grundbuch eingetragen, weil ein Lehrer als Staatsbeamter neben dem Unterrichten keine weitere berufliche Tätigkeit ausüben durfte. Später übernahm sein Sohn Kurt Kaiser (1923–1997) den Gasthof, der mit Mina, geb. Feyersinger aus Kitzbühel, (1927–2016) verheiratet war. Sie war weit über die Grenzen als tüchtige und beliebte Wirtin des «Freihofs» bekannt.
Am 9. Dezember 1987 übernahm der Sohn Josef Kaiser (*1958) den Gastbetrieb. Er liess sich zum Koch ausbilden und galt bis zur Schliessung als tüchtiger Vertreter seiner Zunft. Josef trat in die Fusstapfen seiner Mutter. Er war als Wirt und Koch äusserst beliebt, gesellig und kontaktfreudig. Zu seiner Pensionierung schloss Josef im Dezember 2020 das Gasthaus, das fast 100 Jahre die Gastronomie in Mauren belebt hatte und liess es am 8./9. März 2021 abreissen.
Restaurant Freiendorf
Früher trug das spätere Gasthaus Freiendorf die Hausnummer 26/29 und blieb bis zum Jahre 1926 ein typisches Bauernhaus. Es zählte zu den ältesten Häusern in Mauren. Erster Besitzer laut Grundbucheintrag war Fidel Matt (1767–1834), der es am 8. März 1814 im Rahmen einer Konkursverhandlung kaufte. Am 23. April 1926 wurde das Haus von Arnold Ritter (1889–1938, «Hans-Boli») gekauft und zusammen mit seinem Schwager, dem Schreinermeister Eugen Meier (1889–1953, «Bartola-Joggeles») zu einem Café umgebaut. Es erhielt den Namen Café Freiendorf in Anlehnung an die mündliche Überlieferung der «Freien Dörfler». Drei Jahre führten Arnold Ritter und seine Frau Veronika das Restaurant, ehe sie die Liegenschaft am 19. Juli 1929 an Hubert und Theresia Schreiber-Matt verkauften. Theresia sagte, dass sie als Käuferin des Cafés aufgetreten sei, weil ihr Mann Hubert Lehrer und Staatsbeamter war, die keine Nebengeschäft tätigen durften. Sie führte das Café Freiendorf zehn Jahre lang.
Am 28. Februar 1939 verkauften sie das Anwesen an Engelbert Schreiber (1905–1958, im Volksmund auch «Kino-Schriber» genannt). Engelbert führte die Wirtschaft sieben Jahre und unterhielt im hinteren Teil des Gebäudes ein kleines Kino. Am 12. Februar 1946 verkaufte Engelbert Schreiber das Anwesen an Gebhard Öhri (1909–1993) und zog nach Vaduz, wo er als Kinobesitzer den Lebensunterhalt für seine Familie verdiente. Gebhard Öhri führte das Café Freiendorf und den Kinobetrieb zusammen mit seiner Frau bis zum Jahre 1954, ehe sie beides am 17. September 1957 an Anton (1927–1995) und Sofie Good-Malin (1925–1999) verkauften. Während Anton Good in einem Industriebetrieb arbeitete, machte sich seine Frau Sofie weit über die Grenzen Liechtensteins hinaus einen vorzüglichen Namen. Sie führte die Wirtschaft fast 40 Jahre lang, ehe sie 1999 verstarb. Der Betrieb wurde 2005 eingestellt, und die Liegenschaft, die an die vier Töchter von Anton und Sofie Good-Malin zu je einem Viertel übergeben wurde, im Jahre 2014 abgebrochen.
Nachtrag: Der Ortsteil heisst Freiendorf und das Gasthaus wurde nach diesem Dorfteil benannt. Im Freiendorf wohnten, wie Geschichtskundige erklären, die sogenannten Freien, also keine Leibeigenen des Landesherrn. Sie hatten sich durch Freikauf oder Verdienste von der Leibeigenschaft loslösen können und waren von der Zehntabgabe befreit. Die Leibeigenschaft wurde 1808, die Frondienstpflicht 1848 aufgehoben.

Gasthaus Linde
Das Vorgängerhaus Nr. 67 neu/110 alt gehörte dem Schmied Balthasar Marxer (1758–1811) und war eine Dorfschmiede auf dem Werth. Seine Nachkommen werden heute noch die «Balle-Schmeds» genannt. Beim Neubau des Schulgebäudes in Mauren im Jahr 1847 wurde das alte Schulhaus auf Abbruch versteigert und aus dem Abbruchmaterial baute man das Haus Nr. 110 alt/67 neu im Gampelütz.
Mit Vertrag vom 11. März 1947 kam Helena Meier-Marxer (1928–1978), eine Nachfahrin aus der «Balleschmed»-Linie und verheiratet

Das ehemalige Gasthaus Café Freiendorf in Mauren an der Hauptverbindungsstrasse nach Eschen. Diese Aufnahme entstand in den 1930er-Jahren. Das Café Freiendorf ist 2014 abgebrochen worden.
mit Franz Meier (1921–2015), in den Besitz des Hauses Nr. 67, das bereits Gasthaus zur Linde hiess. Es wurde von Albert Marxer (1884–1941), im Volksmund «Türk» genannt, im Jahre 1926 zu einem Wirtshaus umgebaut. Franz und Helena Meier-Marxer liessen das Gasthaus zu einem markanten Gebäude umbauen, indem sie anstelle der Scheune einen grossen Saal anbauten und praktisch alles erneuerten. Das Gasthaus zur Linde existierte von 1926 bis 1960. Im selben Jahr übersiedelte die Familie Meier in das zwischenzeitlich neue erstellte Hotel Waldhof in Schaanwald.

Discothek Derby, Schaanwald
Das «Derby» wurde 1966 vom Unternehmer Herbert Oehri erbaut, mit dem Gedanken ein Café daraus zu machen. Das Café wurde dann vom Mutter-Sohn-Gespann Anna und Ivo Oehri, dem Bruder des Erbauers, 1968
übernommen. Schnell wurde daraus ein Restaurant und später eine Disco, die erste in Liechtenstein und auch in weiten Teilen des Rheintals. Es war viele Jahre die erste Adresse für Nachtschwärmer. Anna und Ivo Oehri bekamen nach der Hochzeit von Ivo im Jahr 1975 Verstärkung durch dessen Ehefrau Erna (1953 – 2015). Alle drei arbeiteten viel, oft zu viel, sodass die Gesundheit darunter litt. Mutter Anna Oehri verstarb 2012, Erna 2025. Der Betrieb wurde 2013 geschlossen, ist aber an einen Club vermietet.
Hotel Waldhof, Schaanwald
Der ältere Sohn von Helene Meier-Marxer, Peter Meier (*1947), verheiratet seit 1970 mit Ruth Meier, geb. Nigg (*1945), ursprünglich Bürgerin von Balzers, erlernte den Beruf des Kochs im Hotel Real in Vaduz. Nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter Helena im Jahr 1978 übernahm er zusammen mit seiner Ehefrau das Hotel Waldhof, das die beiden mit viel Geschick viele Jahre leiteten. Das Hotel Waldhof stieg zu einer der renommiertesten Gaststätten auf und hatte weit über die Grenzen hinaus einen klingenden Namen. Im Jahr 2004 verkauften sie die Hotel-Liegenschaft samt Umschwung an eine Investorengesellschaft, die das Gebäude abbrach und dort Wohneinhieten erstellen liess. Peter und Ruth Meier eröffneten in Schellenberg das Gastlokal Weinlaube.
Das Haus Nr. 67 im Werth (ehemaliges Gasthaus Linde) wurde von Walter Meier, einem Sohn von Franz und Helena Meier, übernommen und zu einem schönen Wohnhaus umgebaut.
Café Matt
Das Café Matt ist in der Region ein Begriff. Es existiert seit bald 80 Jahren, Eröffnung wurde am 12. Dezember 1947 gefeiert, und ist bis heute im Besitz der Familie Matt aus der Sippe der «Beckas Matt».
Der heutige Besitzer, der das von seinen Eltern Kurt und Ella Matt 1947 erstellte Kaffeehaus geerbt hat,heisst Ivo Matt. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit der Regierung betreffend Konzessionsübertretungen – Bierverkauf war für das Café Matt erst ab Anfang der 1950er-Jahre erlaubt – entwickelte sich das Lokal zu einem der interessantesten Treffpunkte in Mauren. Die Preise in den 1950er-Jahren waren sehr niedrig. So kostetet ein Café Crème 50 Rappen, ein Milchkaffee 45 Rappen, ein 3-Deziliter-Glas Cola 40 Rappen, eine Flasche Elmer Citro oder Orangina 70 Rappen.

Ella Matt führte das Café Matt einige Jahre selbst, doch die Doppelbelastung Café und Kaufhaus Matt wurden ihr zu viel. Es folgten verschiedene Pächterinnen und Pächter, darunter Josi Merkle, Sonja Hobi, Albert Biedermann, Kurt Oehri, Hulda Olonczik, Hermann Bassi, Christine Bergamasco und einige mehr. Im Frühjahr 2000 übergab Ella die Liegenschaft ihrem Sohn Ivo, der sie wei-
terverpachtet hat. Sie ist aus der Maurer Gastronomie nicht wegzudenken.
Alter Zoll
Das Wirtshaus Alter Zoll in Schaanwald kann auf eine traditionsreiche Zeit zurückblicken. Wie der Maurer Geschichtsforscher Hans Jäger in seinem Buch «Die alten Häuser von Mauren 1800–1900» schrieb, stand an diesem Ort einst



eine herrschaftliche Mühle mit Taverne. Sie ist im Jahr 1483 als Erblehen urkundlich erwähnt. Im Erblehensbrief von 1483 wird Freiherr Sigmund von Brandis als Besitzer und Lehnsherr der Mühle und Taverne genannt. Sigmund von Brandis dürfte laut Hans Jäger auch der Erbauer der Mühle und der Taverne gewesen sein. Das Gebäude war das Stammhaus der Schaanwälder-Jäger und der Schaanwälder-Fehr. Franz Anton Jäger (1783–1853), Steinhauer aus Vaduz, zog nach Schaanwald und heiratete 1809 Maria Barbara Matt (1789–1865), die Tochter von Johann Georg Matt (1744–1816), Müller und Zoller in Schaanwald. Sie hatten mehrere Nachkommen. Franz Anton Jäger ist der Stammvater der Schaanwälder-Jäger, schreibt Hans Jäger in seinem im November 2001 veröffentlichten Buch. Das Gebäude war auch das Stammhaus der Schaanwälder-Fehr. Wilhelm Fehr (1860–1935) erbte das Gasthaus im Jahr 1878von seiner Mutter. Wilhelm Fehr heiratete 1889 Maria Franziska Burtscher aus Nüziders. Ihrer Ehr entsprossen zehn Kinder, sechs Söhne und vier Töchter. Wilhelm ist auch der Stammvater der Schaanwälder-Fehr.
Ingenieur Karl Schädler (1850–1907) übernahm das Gasthaus und die Mühle am 13. Oktober 1903. Das alte Wirtshaus Schaanwald Nr.1 alt/11 neu wurde im Jahr 1956 abgebrochen. Etwa an gleicher Stelle ist wieder ein neues Gasthaus erstellt worden, das an die ehemalige Mühle Nr. 1½ alt angebaut wurde. Die neue Gaststätte wurde «Zum alten Zoll» genannt.
In den zurückliegenden über 200 Jahren gab es
mehrere Besitzer und Pächter der Mühle und des Gastbetriebes. Alle sind im Grundbuch in Vaduz eingetragen. Seit dem 26.November 1991 ist die Gemeinde Mauren Besitzerin des Gasthauses zum alten Zoll in Schaanwald.
Mai Thai Restaurant
An der stark befahrenen Hauptverbindungsstrasse von Mauren nach Eschen, in der Peter-Kaiser-Strasse steht das seit 15 Jahren über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Mai-Thai-Restaurant, das vom Wirte-Ehepaar Thomas und Charalai Taravella geführt wird. Es ist für Liebhaber der thailändischen Küche mit ihren exotischen Spezialitäten zu einem Begriff geworden. Auch wurde das Restaurant im Jahr 2017 von der thailändischen Regierung durch das Konsulat in Wien für die hervorragende Küche mit dem Label «ThaiSelect» ausgezeichnet. Dieses Zertifikat besitzen weltweit nur 1300 Gastronomiebetriebe.
Früher war an der Stelle, an der sich das Restaurant befindet, ein Kolonialwarengeschäft, das viele Jahre von der Familie Ritter betrieben wurde.
ETHNO-Bar/Restaurant
Das Restaurant Ethno in Schaanwald ist seit dem 12. Februar 2014 im Besitz der Gemeinde Mauren. Das Gebäude war das Stammhaus der «Bäschele-Marxer»-Familien. Bis zu ihrem Tod war das Ehepaar Edi (1926–1997) und Ida Marxer-Beck (1926–2005) Inhaber des Bäschile-Huus Nr.121 an der Vorarlber-
gerstrasse. Dort war viele Jahre ein Lebensmittelgeschäft untergebracht, das Edi und Ida Marxer zusammen mit Edis Mutter Adelina geführt haben. Edi Maxer betrieb auch eine der ersten Tankstellen in Schaanwald.
Das Restaurant Ethno mit Barbetrieb ist seit neun Jahren an Svetlana Jankovic verpachtet, die es erfolgreich führt. Der Gastbetrieb ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und ein beliebter Treffpunkt. Wie bei den allermeisten Gastronomiebetriebe hat auch die mehrjährigen Corona-Zeit ihre Spuren hinterlassen, was Svetlana Jankovic nicht davon abhielt, die Ethno- Bar weiter zu führen. Die Pächterin wohnt seit rund 30 Jahren in Schaanwald und fühlt sich dort wohl.

Vor 85 Jahren erschien «Der Umbruch»
Das Kampfblatt der Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein
Am 5. Oktober 1940 herrschte hektische Aufregung in der Bevölkerung. Die erste Ausgabe der Zeitung «Der Umbruch» war verteilt worden. Herausgeber der neuen Zeitung war die Volksdeutsche Bewegung, die den Nationalsozialismus im Land einführen wollte. Das «Kampfblatt», wie sich die Zeitung nannte, erschien bis 1944, bis die Regierung die weitere Herausgabe verbot.
Text: Günther Meier
Das Deutsche Reich entfesselte am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg. Adolf Hitler erklärte im Reichstag, seine Geduld mit Polen sei zu Ende, seit 5 Uhr 45 werde zurückgeschossen. Ein Jahr später herrschte nach den kriegerischen Erfolgen der deutschen Wehrmacht grosse Unsicherheit in Europa, wie sich der Krieg entwickeln werde. Diese unsichere Situation nutzte die Volksdeutsche Bewegung aus, die seit ihrer Gründung im Jahr 1938 den Anschluss Liechtensteins an Hitler-Deutschland und die gesellschaftliche Umformung des Landes nach dem Vorbild des deutschen Nationalsozialismus forderte. Um die Bevölkerung über ihre Ziele zu informieren, gab die Volksdeutsche Bewegung ab dem 5. Oktober 1940 eine eigene Zeitung heraus. Schon der Zeitungskopf des neuen Blattes fasste die Botschaft zusammen, was Liechtenstein künftig von der Volksdeutschen Bewegung zu erwarten hatte: Umbruch der Gesellschaft, Kampf gegen die Regierung und die anderen Parteien, um ihre Ziele zu erreichen. Der Zeitungskopf enthielt ausserdem eine Symbolik durch die drei gewählten Farben. Der Titel «Der Umbruch» war in roter Farbe gedruckt und wurde ergänzt von der schwarzen Unterzeile «Kampfblatt der Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein». Schwarz-Weiss-Rot waren die drei Farben, die
von der NSDAP in Deutschland für die Hakenkreuzflagge verwendet wurden. Das Hakenkreuz selbst fehlte im Zeitungskopf, weil dessen Verwendung in Liechtenstein verboten war, aber später dennoch ab und zu bei der Illustration von Artikeln auftauchte.
Fette Schlagzeilen dominierten das Erscheinungsbild
Wer den «Umbruch» noch nicht erhalten oder gelesen hatte, erfuhr über den Auftritt der neuen Zeitung aus dem «Liechtensteiner Volksblatt», allerdings nur in einer kurzen Notiz: «Am Samstag ist eine neue Zeitung herausgekommen. Sie nennt sich «Der Umbruch». Martin Hilti, Schaan, zeichnet als Schriftleiter. Als Mitarbeiter werden genannt: Dr. Alfons Goop, Dr. Sepp Ritter und für Soziales Dr. Hermann Walser. Den Anzeigenteil besorgt Gottlieb Gassner, Vaduz, und der Druck ist von U. Göppel, Vaduz.» Inhaltlich setzten sich die Landeszeitungen «Volksblatt» und «Vaterland» noch nicht mit dem «Umbruch» auseinander: Vielleicht wollte man abwarten oder man war bei den Parteizeitungen so überrascht, dass man einige Zeit brauchte, um darauf zu reagieren.
Der Volksdeutschen Bewegung war mit dem «Umbruch» eine grosse Überraschung
gelungen. In zweifacher Hinsicht. Erstens hatte kaum jemand mit einer Zeitung der nazifreundlichen Bewegung gerechnet und zweitens hob sich das neue Blatt schon in der Gestaltung vom Erscheinungsbild einer traditionellen Zeitung der damaligen Zeit ab. Fette Schlagzeilen dominierten das Layout, wie der Titel «Umbruch und Neuordnung» oder «80 Millionen Deutsche mit uns». Was die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner bei der Erstausgabe, die nur vier Seiten umfasste, zu lesen bekamen, war keine Berichterstattung. Breit dargelegt wurde, welches Ziel sich die Volksdeutsche Bewegung gesetzt hatte, ein Bestandteil des Deutsches Reiches zu werden: «Seit Jahren hält die Welt den Atem an über das grosse innere und äussere Aufbauwerk des deutschen Volkes und seines Führers. Wir deutsche Menschen in Liechtenstein sind als Bestandteil der grossen Nation und als unmittelbare Nachbarn des Grossdeutschen Reiches um so mehr verpflichtet, dieser Neuwerdung unseres Volks innersten Anteil zu gewähren. Wir haben auch aus anderen Überlegungen heraus allen Grund, unsere Vogel-Strauss-Politik endlich aufzugeben und uns ernsthaft mit den bewährten Lehren der heutigen Wirtschaftsund Lebensauffassung überhaupt auseinanderzusetzen.»
Der «Umbruch» hetzt gegen die Schweiz
Was im «Umbruch» geschrieben und gefordert wurde, hatte sich in Umtrieben der Deutschfreundlichen schon im Sommer abgezeichnet. Die Volksdeutsche Bewegung drückte ihren Anhängern für die Mitgliederwerbung ein «Schulungsblatt» in die Hand, in dem unverhohlen die Abkehr von der Schweiz und die Zuwendung an Deutschland thematisiert wurde. Die Mitbürger sollten gefragt werden, ob Liechtenstein noch selbständig sei – und dann die Antwort geben: Nein, Liechtenstein habe keinen Einfluss auf Zollansätze und Warenpreise, besitze kein Recht zur Mitbestimmung. Die Schweiz als Wirtschaftspartner komme Liechtenstein nicht entgegen bei der Beschäftigung der Arbeitslosen, die Bauern könnten keine Produkte in die Schweiz verkaufen und die jungen Leute hätten keine Perspektiven zur Arbeitsaufnahme im Nachbarland. Ganz anders wäre es bei einer Ausrichtung nach Deutschland: Dort könne man auf eine neue Wirtschaftsordnung bauen, die gestaltet wurde «von einem der unsrigen», vom «Führer Adolf Hitler». Im Leitartikel hiess es in ähnlicher Art: «Als deutsche Menschen dürfen wir nie den Gleichschritt mit der übrigen Nation verlieren. Was würde um Gotteswillen aus uns, wenn wir versuchen sollten, uns vom grossen Baume der Nation loszulösen. Bleiben wir also, was wir immer waren: Deutsche!»
Umgestaltung des Landes nach deutschem Vorbild
Am 14. Dezember 1940 erschien der «Umbruch» mit zahlreichen Forderungen zur Umgestaltung Liechtensteins im nationalsozialistischen Sinne. Unter dem Titel «Wir stehen vor der Entscheidung» versuchten die Volksdeutschen den Eindruck zu verwischen, die Bewegung sei nur destruktiv eingestellt. Die Devise über dem sehr umfangreichen Forderungskatalog lautete: «Untergang und Verarmung unseres Volkes oder Nationalsozialismus!» Gefordert wurde ein «Neubau des Lebens», der einen festen Grund erfordere: «Dieser feste Grund kann aber nur unser deutsches Volkstum sein. Erst dann haben wir ein festes und dauerhaftes Fundament, wenn wir auf den ewigen Werten der deutschen Volksgemeinschaft aufbauen.» Der Katalog an Forderungen weist eine weitge -
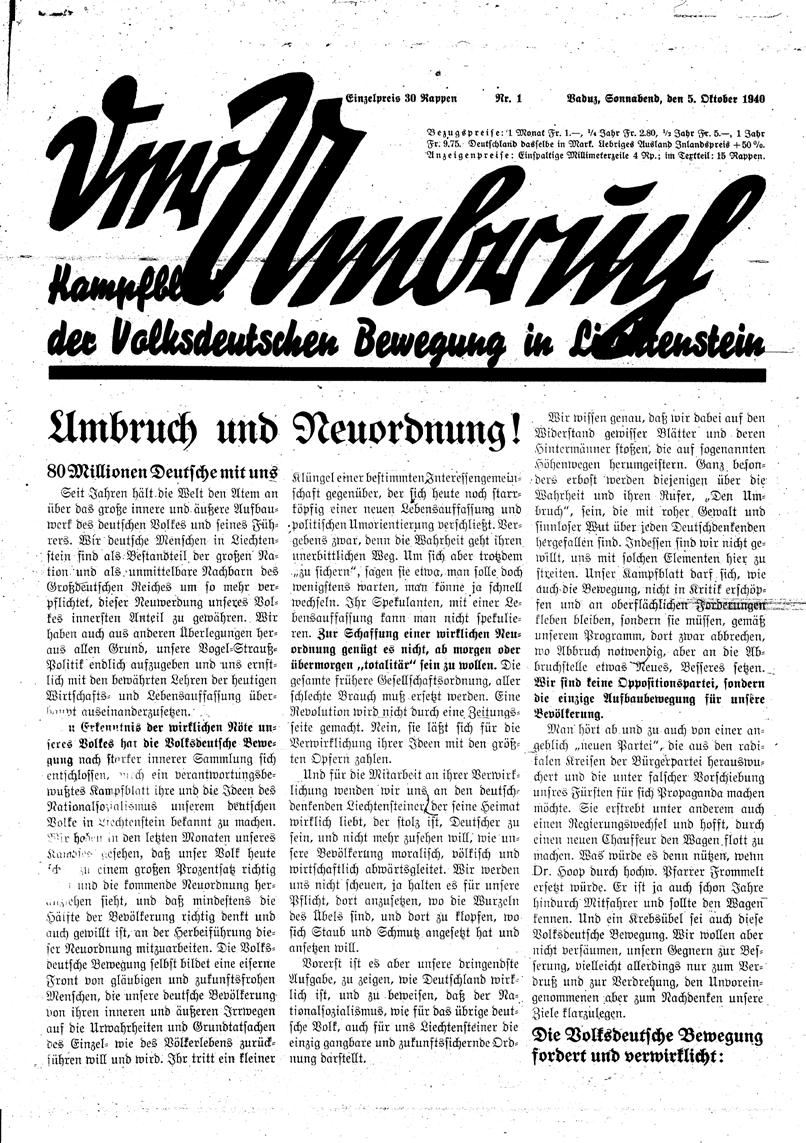
spannte Bandbreite auf: Gefordert wurde etwa das Studium an deutschen Hochschulen, die sofortige Auflösung des Pfadfinderkorps, die Freigabe der verbotenen deutschen Hoheitszeichen, des Hakenkreuzes und der deutschen Farben, das Verbot aller deutschfeindlichen ausländischen Zeitungen und die Mitarbeit der inländischen Presse am Volkstum. Unter den Forderungen befindet sich auch die «Bestrafung offensichtlich deutschfeindlicher Beamter», wobei unter solchen «verantwortungslosen Elementen» Regierungsbeamte, aber ebenso Lehrer und
Polizisten verstanden wurden. Für die Umgestaltung des Landes sollte ferner die Einführung einer Planwirtschaft nach deutschem Vorbild erfolgen.
Verbot des «Umbruch» oder mit politischen Mitteln bekämpfen?
Die Schlagzeilen im Umbruch setzten Regierung und Landtag unter starken Druck, nachdem die fettgedruckten Leitsätze gefordert hatten: «Freies Bekenntnis zu unserem deutschen Volke und freie Betätigung für
das Volkstum» oder «Deutsche Lebens- und Wirtschafts-Ordnung im Sinne des Nationalsozialismus». Der Landtag befasste sich mit der Frage, wie man sich gegenüber der Volksdeutschen Bewegung verhalten sollte. Regierungschef Josef Hoop erklärte im Landtag, in Anbetracht der staatsschädigenden Tätigkeit der Volksdeutschen müsse «etwas gemacht» werden. Hoop zeigte zwei Möglichkeiten auf: Entweder mit neuen Gesetzen die Bewegung und ihre Umtriebe verbieten oder auf ein Verbot verzichten und dafür die Bewegung mit «geistigen und politischen Mitteln» bekämpfen. Der Regierungschef wies auf die Konsequenzen hin, die sich aus allfälligen Massnahmen ergeben könnten. Wenn eine Bewegung unterdrückt werde, die ein enges Verhältnis zum Deutschen Reich anstrebe, so könnte dies «katastrophale Auswirkungen» haben, man müsse nur an Österreich, die Tschechoslowakei oder Polen denken. Auf der anderen Seite bestehe ein Dilemma gegenüber der Schweiz: Wenn die Bewegung an Mitgliederzahl weiter zunehme, werde die Schweiz misstrauisch und befürchte, in Liechtenstein bahne sich eine Abtrennung von der Schweiz an.
Eine «Allparteien-Konferenz» über die Medien
Auf die Landtagssitzung folgte am 11. Oktober 1940 eine «Allparteien-Konferenz»: Neben Vertretern von FBP und VU auch Vertreter der Volksdeutschen Bewegung sowie der «Nationalen Bewegung», früher die «Heimattreuen» geheissen, die sich für die «unbedingte Erhaltung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit unseres Heimatlandes» einsetzten. Für die Volksdeutschen gab Alfons Goop die Zusage ab, die Volksdeutsche Bewegung gehe verfassungsmässig ihren Weg, es sei Sache des Fürsten und des Volkes, die Zukunft des Landes zu gestalten. Was den «Umbruch» betreffe, betonte Goop weiter, sei eine Schädigung des Landes durch die dort verwendete Schreibweise nur möglich, wenn der «Inhalt falsch interpretiert» werde. Goop unterstrich ferner, die Volksdeutsche Bewegung sei «keine Putschpartei» und habe keinen «Sofortanschluss» an das Deutsche Reich gefordert. Regierungschef Josef Hoop ersuchte zum Schluss der Konferenz die Volksdeutsche Bewegung, «alles zu unterlassen, was eine Trübung des Verhältnisses zur Schweiz bedeuten könnte». Goop
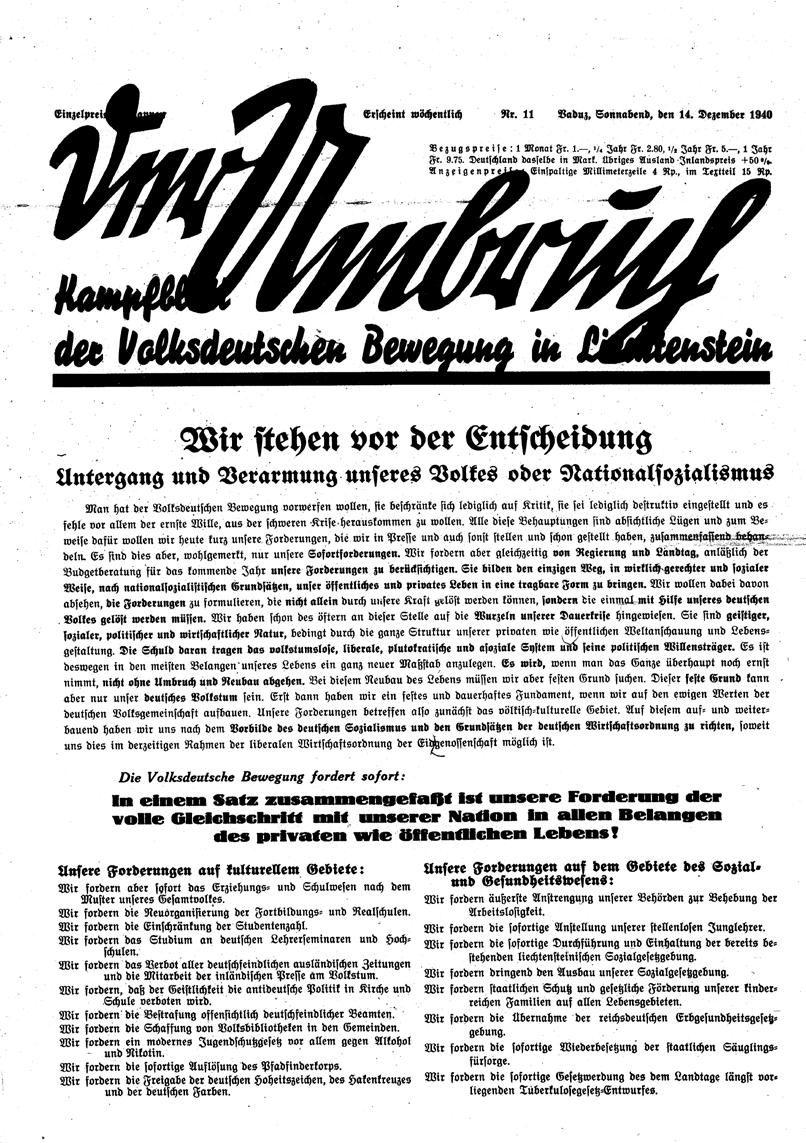
erklärte sich laut Protokoll damit einverstanden, fügte aber hinzu, die Zusicherung werden die Volksdeutsche Bewegung aber nicht daran hindern, «über die wahren Verhältnisse in Deutschland und Liechtenstein zu schreiben.»
Nummer 247 war die letzte Ausgabe
Der «Umbruch» erschien beinahe drei Jahre, bis die Regierung ein definitives Verbot verfügte. Meistens war die Zeitung der Volksdeutschen eine Wochenzeitung, wurde
zwischendurch aber auch zweimal pro Woche gedruckt. Von Dezember 1942 bis Ende Januar 1943 erliess die Regierung ein befristetes Verbot, das definitive Verbot folgte am 8. Juli 1943. Die Volksdeutsche Bewegung gab nach dem Verbot noch drei Ausgaben unter dem Titel «Aus Liechtenstein» heraus, aber auch das Nachfolgeblatt wurde von der Regierung verboten. Am 12. Februar 1944 erschien nochmals eine Ausgabe des «Umbruch», was sofort ein Verbot der Regierung zur Folge hatte: Die Nummer 247 war damit die allerletzte Ausgabe.
Hagenhaus Lie-Zeit 206x265 Okt 10 2.qxp_Layout 1 12.09.2025. 16:41 Page 1
Einzigartige Emotionen und unvergessliche Momente hautnah und intensiv
1. Okt
Resonanzen Tastenvirtuosi freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
7. Okt
Kammermusikkonzert
Klavierquintette freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
8. Okt
Resonanzen Klavierkunst freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

9. Okt
Donnerstag im Hagenhaus
Holz und Blech
Sophie Dervaux, Fagott und Selim Mazari, Klavier 45 CHF – 19 Uhr
21. Okt
Kammermusikkonzert Streichtrios freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
22. Okt
Resonanzen Geigenkunst freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr
Erleben Sie die Weltelite von heute und morgen bei über 100 Veranstaltungen im exklusiven Ambiente des Hagenhaus in Nendeln Tickets und/oder obligatorische Reservierung unter: T +423 262 63 52 oder hagenhaus@ticketing.li • Max. 100 Plätze bei freier Platzwahl • Feldkircherstrasse 18, FL-9485 Nendeln

23. Okt
Donnerstag im Hagenhaus
Unplugged – Ensemble Maxjoseph
Georg Unterholzner, Gitarre
Andreas Winkler, Steirische Harmonika
Nathanael Turban, Geige Florian Mayrhofer, Tuba 30 CHF – 19 Uhr
29. Okt
Resonanzen Violinvirtuosi freier Eintritt/Kollekte – 19 Uhr

30. Okt
Donnerstag im Hagenhaus
Unplugged
Michail Shishkin: „Briefsteller. Elegie“ Klaus Henner Russius, Schauspiel und Alexey Botvinov, Klavier 45 CHF – 19 Uhr
31. Okt

Nexus Konzert Feuer Isa Sophie Zünd, Klavier und Kleio Quartett
30 CHF/erm. 15 CHF – 19 Uhr

Vorausschauend für die nächste Generation investieren

Als Familienunternehmen ist uns eine langfristige und ganzheitliche Perspektive wichtig. So wählen wir für Sie die besten Anlagemöglichkeiten aus und stellen Ihr Portfolio zukunftstauglich auf. lgt.com/li
