

Das steilste Festival in den Bergen




Eröffnungsfest | Maria Superstar | Zéphyr Combo | Klingende Kirchen |
Duo Campanula | Lofoten Cello Duo | Austriņa Kokle-Jugendensemble |
Aufg’spielt & Aufkocht in Walser Scheune | Janusz Prusinowski
Kompania aus Polen | Radix Musikwerkstatt | Orivesi All Stars aus
Finnland | Heurigen mit SchrammelBach | Lehmschlickerbad |
Musikalische Wanderung zur Echowand | Ausstellungen | Prättigauer
Kunstschaffende | Scheune Lehen | Theresia Bickel | Margot Geiger |
Michael Salvadori | Vernissagenfahrt | Papierschnitt Workshop | Theater zur Blauen Stunde | Christine Lavants Wechselbälgchen |
Martha Laschkolnigs Waldwanderung und Baumzirkus | J. Saunders’
Wirklich schade um Fred | Bergkino


4 - 5
DAS GANZE, ERNSTHAFT LEICHT
Isabella Natter-Spets
5 - 6 TRÄUMEN
Günther Rösel
6 - 7 KULTUR OHNE GRENZEN
Josepha Yen
8 - 9 DIE SPRACHE, UNENDLICHE WEITEN
Gabriele Hampson
10 - 11 GEBURTSWUNDER VORARLBERG
Brigitta Soraperra
12 - 13 EIN LAND MIT BODENHAFTUNG
Simon Vetter
14 - 15 THEATER – EIN FEST
Michael Schiemer
15 - 16 INNOVATION KOMMT INS SPÜREN
Isabelle Goller
17 TROTZDEM
Hildegard Breiner
18 - 19 ARBEIT NEU DENKEN – BILDUNG NEU GESTALTEN
Eva Häfele
22 - 23 METHAN VO:ÜS, C-FIX!
Mátyás Scheibler
24 - 25 IMAGINE ALL THE PEOPLE LIVING A GOOD LIFE ALL TOGETHER
Nicole Klocker-Manser
26 - 27 MEDIZIN DER ZUKUNFT – TRAUM ODER ALBTRAUM?
Otto Gehmacher
28 - 29 ENKELTAUGLICH! EIN QUARTIER IN VORALRBERG 2045
Eva Lingg-Grabher
30 - 31 MEINE UTOPIE FÜR VORALRBERG
Lisabell Semia Roth
32 - 33 NICHT BESITZEN, SONDERN NUTZEN
Hubert Rhomberg
34 WORUM ES MEISTENS GEHT
Peter Mennel
36 - 37 WAS FÜR EIN LAND.
Martin Strele
38 - 39 BIBER-EINSATZ AM RHEIN
Daniela Egger
Mögest du in interessanten Zeiten leben – die Herkunft dieses Fluchs lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen (Wikipedia verweist auf das alte China), aber er wird derzeit häufig zitiert. Wir leben sicher in interessanten Zeiten, und auch wenn sie voller Herausforderungen sind, diese Zeiten – sie sind auch voller Chancen.
Diese marie Spezialausgabe dreht die Welt in Vorarlberg ein kleines Stück weiter – sie macht Projekte sichtbar, die in ganz unterschiedlichen Bereichen bereits Realität geworden sind. Fünfzehn Expertinnen und Experten aus Vorarlberg schreiben über ihr Metier oder ihr Thema mit dem Blick auf eine wünschenswerte Zukunft. Isabella Natter-Spets und Isabelle Goller von estuar haben den Anfang gemacht und ihre Sammlung wünschenswerter Zukünfte vor zwei Jahren begonnen: Die Publikation Futura – Die gute Amöbe wurde in der Mai-Ausgabe vorgestellt. In diesem Heft erweitern wir ihre Sammlung um Ideen und Utopien mit Fokus auf die Region. Manche dieser Texte sind wirklich Utopien, manche einfach Wünsche, andere sind bereits Realität und könnten unser Bundesland in eine Vorreiterrolle für nachhaltige und zukunftstaugliche Lösungen katapultieren – wenn wir sie skalieren. Sie zeigen auf, was wir uns so dringend vor Augen führen müssen: Die Welt ist voller Lösungen.
Wir sind in der Lage, die CO₂ Emissionen nicht nur zu reduzieren, wir können sie sogar in eine Minus-Bilanz bringen. Wir können Grundbesitz neu denken und damit Leichtigkeit und Leistbarkeit zurückerobern. Wir können (und sollten schleunigst) die Schule neu denken und alle jungen Menschen fördern, so dass auch die Arbeitswelt davon profitiert. Die Landwirtschaft lässt sich mit wenig Aufwand nachhaltig gestalten, unsere Grünzonen schützen, die Artenvielfalt wieder aufbauen ... und in allen Beiträgen scheint zwischen den Zeilen etwas Wesentliches durch: Wir müssen Verantwortung übernehmen. Gemeinsam.
Wir haben das Bewusstsein und das Wissen, um eine gute Zukunft für alle zu gestalten – werfen Sie mit uns einen Blick in diese mögliche Zukunft – und vielleicht machen wir in den kommenden Jahren einfach Vorarlberg zu einer interessanten Modellregion.
Daniela Egger
DAS GANZE, ERNSTHAFT LEICHT 2
Isabella Natter-Spets
GEARBEITET WIRD
FOKUSSIERT, AMBITIONIERT UND „AUSGESCHLAFEN“, MUSIK, BEWEGUNG UND MUSSEZEIT HABEN EINEN SELBSTVERSTÄNDLICHEN PLATZ BEKOMMEN. GEMEINSAM SCHAFFEN WIR SO MEHR GUTES, WEIL WIR WENIGER VERPLANT SIND.
044 macht die Begleitung von Innovationsprozessen richtig Spaß, denn vieles hat sich gut entwickelt in Vorarlberg. War vor 20 Jahren Innovation noch stark gebunden an den Wachstumsimperativ mit Zielsetzungen wie Umsatzsteigerungen und Marktanteilgewinn, haben sich als Kriterien für die Entwicklung von Neuem heute eine systemische Betrachtung, die Förderung von Vielfalt statt Einfalt, das Regenerationspotenzial für die Natur und das Lernpotenzial für die Gesellschaft durchgesetzt. 2040 war das Stichjahr für die Erreichung der EU-Klimaziele, und weil die Androhung der Kompensationszahlungen glaubwürdig genug war, hat Österreich in den 30er-Jahren viele Rahmenbedingungen komplett verändert – solche, die den „green change“ zum Abheben gebracht haben: Gesetze, Förderungen, greentech-Offensive, bürokratische Erleichterungen und nicht zuletzt die damals neue Logik, die weltverträgliche Lösung als den default-mode festzulegen. So konnte das Klimaziel gerade noch geschafft werden und wenn ich mich umschaue, stelle ich fest, dass die Landschaft vielfältiger geworden ist.
Weil die Menschen heute im Allgemeinen weitaus weniger arbeiten und Zeit haben, sich für ihren Lebensraum einzusetzen, ist viel Lust da am Mitgestalten und Beitragen: Wissen, Energie, Ideen, Erfahrung, Zeit, Gastgeberschaft, intensives Zuhören und Verstehen wollen.
In den 20er-Jahren gab es ja noch den weit verbreiteten Aktionismus mit einer Unzahl an Veranstaltungen, Themenwochen, Releases, Webinaren, Trainings und Networking-Blasen. Dieser Aktionismus kollabierte an seinem Zenit durch das völlige Ausbleiben von Resonanz – neben Luft zum Atmen blieben daraufhin vor allem jene Dinge übrig, die wesentlich sind für uns Menschen. Wir haben uns in dieser Zeit ein Stück weit „gesundentschleunigt“ und haben wieder etwas mehr Raum für Spiel, Spüren, Gemeinschaft, Humor und Empathie.
Heute haben Entwicklungsprozesse daher eine Leichtigkeit und zugleich Ernsthaftigkeit, die einfach nur schön ist. Gearbeitet wird fokussiert, ambitioniert und „ausgeschlafen“, Musik, Bewegung und Mußezeit haben einen selbstverständlichen Platz bekommen. Gemeinsam schaffen wir so mehr Gutes, weil wir weniger verplant sind.
Aktuell begleiten wir ein Innovationsprojekt für die Last-Mile-Mobilität* im Bregenzerwald, Klostertal, Großwalsertal und Montafon. Klarerweise ist nachhaltig dabei längst nicht mehr genug – die Lösung, die wir anstreben, soll regenerativ sein: so sollen die Energieströme der Mobilitätlösung (Abwärme, Reibung, Reflexion,

Fahrtwind, …) nutzbar werden für die umliegenden Permakultur-Ackerflächen – und umgekehrt. Das Projekt soll mit Materialien arbeiten, die biodiversitäts- und kreislaufwirtschaftsfit sind, die Lösung soll Menschen niederschwellig verbinden, soll sie Kultur erleben lassen und zum Mitdenken an komplexen Fragen einladen. Und sie soll verhaltensökonomische Erkenntnisse und bewegungspädagogische Empirie nutzen, damit die Fahrgäste beim Warten ihre Körper dehnen oder aktiv entspannen.
Das ganze Vorhaben ist ein Open-System-Innovations-Projekt, weswegen vor- und nachgelagerte Partner:innen wie Komponenten-Lieferanten und potenzielle Energie- und Materialstrom-Verwerter:innen ebenso im Entwicklungsteam sind wie andere Mobilitätsanbieter, potenzielle Nutzer:innengruppen sowie Kulturschaffende, Kommunen, Biodiversitätsexpert:innen, Klimawirkungs-Kalkulant:innen und Overall-Happiness-Index-Monitoring-Beauftragte.
Innovationsbegleiter:innen dürfen dabei vieles sein: Wir sind Gastgeber:innen sind Diversitäts- und Komplexitätsforschende sind Kulturschaffende sind Erntehelfer:innen sind Mittanzende sind KI-Prompting-Expert:innen sind SDG-Umsetzende sind Ein- und Ausatmende sind Ausschau-Haltende und Emergenz-Einladende. Wenn das kein schönes Arbeitsfeld ist!
* Last-Mile-Mobilität: Das letzte Wegstück beim Transport der Ware zur Haustüre des Kunden stellt Nachhaltigkeit vor Herausforderungen.

Isabella Natter-Spets Prozessbegleiterin und Gastgeberin für Kollaboration und Innovation www.estuar.at
ZWAS ICH IM LEBEN GELERNT
HABE: JEDER MENSCH IST EIN „SONDERFALL“.
TRÄUMEN…
uerst die Wirtschaftskrise, dann die Flüchtlingskrise. Und dann: Nach der Corona-Zeit mit all ihren gesellschaftlichen Spaltungen und destruktiven Entladungen entstand eine Graswurzelbewegung. Inmitten einer zunehmend beschleunigten digitalen Welt mit ihren sozial-asozialen Medien begannen wenige, dann immer mehr Menschen, sich Zeit zu nehmen. Die Freude am „Nachdenken“ wurde geradezu ansteckend. Menschen entdeckten mit Lust, dass im Nachdenken das „danach“ enthalten ist; nämlich die Zeit, für einen Moment still zu sein, gut bei sich zu bleiben, sich zu fragen: Welche Gedanken und Gefühle tauchen bei mir auf? Was bewegt mich? Bin ich einverstanden? Regt sich Widerständiges?
Und so ging ein Ruck durch die Gesellschaften, ja – durch viele Menschen. In den Kindergärten und Schulen entstanden Sitzkreise, in denen das Reden, Zuhören und Einfühlen geübt wurde. Das war wunderbar, manchmal aber auch ganz schön anstrengend. Das schöne deutsche Wort „Aus-einander-setzung“ wurde immer mehr verstanden. Es wurden „philosophische Cafés“ gegründet: Menschen begannen, über ihre Ängste und Wünsche zu sprechen, über ihre Biographie, über ihre Vorstellungen von einem „guten Leben“.
In einem dieser philosophischen Cafés wurde zum Beispiel eine Text-Passage des Computerpioniers und späteren Gesellschaftskritikers Joseph Weizenbaum diskutiert: „Was ich im Leben gelernt habe: Jeder Mensch ist ein ‚Sonderfall‘“. Es geht darum, sich bewusst zu freuen, bewusst zu lieben und bewusst zu trauern“. Ein Teilnehmer fragte nach: „Ich kann die Bedeutung der Freude und der Liebe verstehen. Aber warum „trauern“?“ Und der Psychoanalytiker, der dieses philosophische Café initiiert hatte, meinte darauf: „Wer nicht leiden und trauern will, muss verzweifeln >>
Günther Rösel
6 7 oder hassen. – Und von diesem Hass, dieser zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft haben wir seit der Hetze gegen Flüchtlinge und seit Corona doch mehr als genug… „Trauern“ heißt „Abschied nehmen“ und langsam neue Wege beschreiten.“
Menschen begannen, sich ihres Eigensinns zu erfreuen und sich für die „Andersartigkeit des Anderen“ zu interessieren. Diesmal war es nicht die Berliner Mauer, nicht der Eiserne Vorhang, die einstürzten. Nun waren es die Menschen selbst, die Mauern und Grenzen, vor allem zu „Fremden“ immer mehr hinterfragten. Man glaubt es kaum: Bei privaten Feiern wurde Kant zitiert: Jeder Mensch zählt so wie er in seinem So-Sein ist. Menschen sind immer Zwecke „an sich“, nie bloße Mittel; weil sie frei sind; weil sie Handelnde in der Welt sind.
Eine Politikerin sprach davon, dass „Gerechtigkeit“ und „Solidarität“ die Sonne einer Gesellschaft seien. Unglaublich, dieser Satz wurde immer wieder zitiert. Es wurde darüber gesprochen, worin die Grundlagen unseres Zusammenlebens bestehen, was uns verbindet, was uns trennt. Plötzlich konnte politisch durchgesetzt werden, was jahrelang desavouiert worden war: Vermögens-, Erbschafts- und Finanztransaktionssteuern stifteten die Basis für die umfassende Ökologisierung unserer Lebenswelt und für die Entwicklungshilfe, die Hilfe für arme Menschen auf der ganzen Welt. Die Finanzierung guter Kindergärten und Schulen in kleineren Gruppen war gesichert. In der neu konzipierten gemeinsamen Schule konnten ausländische und sozial schwache Schüler:innen umfassend gefördert werden. Davon profitierten auch all die anderen Kinder, ja – die ganze Schulgemeinschaft.
Phantastisch: Krankenhäuser, psychosoziale Einrichtungen, Alten- und Pflegeheime etc. wurden nicht mehr primär marktwirtschaftlich-gewinnfixiert gesehen. Es ging um die Menschen, um das Menschliche.
Inzwischen wurde in einem der philosophischen Cafés der Film „Shoah“ von Claude Lanzmann angesehen. Ein monumentaler Film, der – mittels unverschämt offener Interviews von Opfern, Tätern und Zusehern – das Erinnern an die Ermordung von sechs Millionen europäischer Juden einfordert. Im philosophischen Café wurde heftig über diesen Film diskutiert. Die Verstrickungen der eigenen Vorfahren, der Eltern und Großeltern wurden thematisiert. Psychoanalytisch betrachtet, wurde immer klarer, dass es einen „unmenschlichen Kern im Mensch-Sein“ gibt. Das, was geschehen ist, kann jetzt und in Zukunft wieder geschehen. Im Sinne der Freud’schen Todestrieb-Konzeption lässt sich sagen: „Mensch“ bin ich nicht. Mensch muss – bzw. könnte – ich WERDEN.
Ganz schön schön, ganz schön schwierig… Wie’s halt bei diesen Träumen so ist …

Dr. phil., Psychoanalytiker in freier Praxis in Dornbirn
KULTUR OHNE GRENZEN
Ich erinnere mich noch genau. Ich war ungefähr 17 Jahre alt und mein Vater, der sich zu der Zeit auch politisch in Vorarlberg einbrachte, nahm mich mit, um im Vorarlberger Landestheater Ödipus anzuschauen, was mir damals beides nicht besonders viel sagte. Es hat mich immer fasziniert, wenn Menschen Geschichten erzählen, aber unsere Theaterausflüge zu Schulzeiten hatte ich nicht gut in Erinnerung. Da war neben nackten Menschen mit Maschinenpistolen vor allem viel Geschrei vorgekommen. Dementsprechend betrat ich das Theater mit einer nicht allzu hohen Erwartungshaltung, wie es, denke ich, vielen Jugendlichen dieser Zeit ging. Im Saal angekommen, saßen mein Vater und ich ziemlich weit hinten am Rand, umgeben von älteren Menschen. Meine Eltern gehörten für mich damals auch schon zur Gattung „ältere Menschen“. Und dann begann das Stück und von rechts und links strömten die Schauspieler:innen in den Zuschauerraum. Sie waren bunt geschminkt und greifbar nahe. Ich war gefesselt von den tragischen Schicksalen der Figuren und hatte großes Mitgefühl mit Ödipus.

Mal erlebte ich Theater, das sich nahbar anfühlte, bei dem das Publikum Teil der Inszenierung wurde, da die Menschen auf der Bühne etwas von sich schenkten und preisgaben.
Heute sitze ich auf meinem Bregenzer Balkon im Jahr 2050. Die warme Sommerluft trägt Gelächter und Live-Musik einer ägyptischen Band zu mir herüber.
Gerade findet das „Kultur ohne Grenzen“-Festival statt. Durch die Entwicklung der letzten Jahre in der Kultur sind wir im engen Kontakt mit den unterschiedlichsten Ländern aus der ganzen Welt. Rassismus findet in unserer Gesellschaft keinen Zuspruch mehr, da die Menschen, dank des angeregten künstlerischen Austausches, die Vielseitigkeit der Menschheit und ihrer Lebensweisen als bereichernd und schützenswert erkannt haben. Die rechten Parteien versuchen verzweifelt, mit Puppenspielen über den angeblich drohenden Angriff der Aliens Zuspruch zu finden.
Meine Tochter, die gerade 15 geworden ist und damit in der vollen Pubertät, verbringt die meiste Zeit in der „Art Zone“, das ist ein Stadtteil im Zentrum, der völlig der Kunst gewidmet wurde. Man findet dort, neben einer hohen Dichte an Museen, Galerien und Kinos auch das Landestheater sowie Studios zum Verwirklichen eigener Projekte, Restaurants, die sich der kreativen Weiterentwicklung der Kulinarik verschrieben haben, kleine Bands und Solokünstler:innen am Straßenrand. Wenn meine Tochter dann doch mal nach Hause kommt, erzählt sie mit leuchtenden Augen von den Dingen, die sie erlebt hat. Die Art Zone ist zum Begegnungsort geworden, bei dem sich alle Gesellschaftsgruppen, aber besonders auch junge Menschen wiederfinden. Es ist ein Ort, an dem Politik auch für die Jüngsten erlebbar gemacht wird, man Unsicherheiten teilen darf, diskutieren, streiten und sich ausprobieren kann.
Damit Kultur für jede:n zugänglich wird, sind, neben der barrierefreien Architektur, auch jegliche Eintrittskarten sowie Workshops gratis. Das Land hat die Notwendigkeit der Kultur anerkannt, da sie den Zusammenhalt, die Zufriedenheit und Innovationskraft der Bevölkerung erheblich steigert. Durch diese Nahbarkeit der Kunst können sich die Menschen mit den behandelten Themen und Problemen identifizieren, es ist ein Zufluchtsort, an dem jede:r einen Platz hat, an dem man für kurze Zeit in Fantasiewelten eintauchen und sich verlieren kann. Die Last der „perfekten Welt“, wie sie im Internet inszeniert wird, wird den Jugendlichen durch diese Zufluchtsorte abgenommen. Sie lernen eine Welt kennen ohne Stereotype, in der Fehler gemacht werden müssen, um zu wachsen, eine Gesellschaft, die sich traut, frei zu denken und bei der Menschlichkeit und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen. Auch der Bühnenmeister des Landestheaters, Jörg Dettelbach, hat sich seinen Zukunftswunsch im Jahr 2050 endlich erfüllt: ein Theaterpony.
DIE LAST DER „PERFEKTEN WELT“, WIE SIE IM INTERNET INSZENIERT WIRD, WIRD DEN JUGENDLICHEN DURCH DIESE ZUFLUCHTSORTE ABGENOMMEN. SIE LERNEN EINE WELT KENNEN OHNE STEREOTYPE, IN DER FEHLER GEMACHT WERDEN MÜSSEN, UM ZU WACHSEN, EINE GESELLSCHAFT, DIE SICH TRAUT, FREI ZU DENKEN UND BEI DER MENSCHLICHKEIT UND ZUSAMMENHALT IM MITTELPUNKT STEHEN.

Schauspielerin Vorarlberger Landestheater
Günther Rösel
Josepha Yen
Josepha Yen
Gerne ein Theaterfoto
DIE SPRACHE, UNENDLICHE WEITEN
Gabriele Hampson
Wir schreiben das Jahr 2200 (oder so). Dies sind die Abenteuer der Menschen rund um einen Ort, der mit seiner gut 400 Frau und Mann starken Besatzung seit Jahren unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neue Sprachen und ein neues Miteinander.
es später ihrer Mutter zu schicken. Ihre Mutter hatte immer gesagt: wenn du die richtigen „Kelimeler“ findest, dann wird alles gut. İnşallah. Zweisprachig aufgewachsen zu sein ist ein Privileg, findet sie. Auch ihre Nachbarin sagt ihr immer, was für einen Schatz sie in die Wiege gelegt bekommen hat. Wie jedes Kind, das mit mehr als einer Sprache aufgewachsen ist. So sehr wünsche sie sich, dass auch sie ein paar Worte Türkisch sprechen könnte. Da erzählt ihr die Bürgermeisterin von ihren Tricks – dem Fladenbrot, den Händen und der Übersetzungs-KI. Außerdem gebe es jetzt einen Kurs – einen zweisprachigen, bei dem man Türkisch oder Deutsch lernen könne, je nach Bedarf. So funktioniere es auch mit anderen Sprachen.
ZWEISPRACHIG AUFGEWACHSEN ZU SEIN IST EIN PRIVILEG.
Die Geschichte begann in einer Zeit, in der viel möglich, aber auch viel vorgegeben war und Captain Kurt glaubte, dass ALLE Menschen ehrlich gehört werden müssen und sich eine Welt vorstellte, in der sie frei, mutig und glücklich sind und träumen dürfen. Dass sich Kinder in der Gesellschaft einbringen können, wenn sie die richtigen Worte, ihre Sprache finden und so zu selbstwirksamen Erwachsenen werden. Dass an diesem Ort Farblehre gelebt wird, dass schwarz, blau, grün, rot, türkis, pink und alle anderen Farben im Miteinander existieren. Gleich wie alle Regenbogenfarben, wie schwarz und weiß. Ein Ort, an dem Menschen Menschen sind. An dem sie miteinander reden. Sich zuhören. Gemeinsam an einem Tisch sitzen, ohne ein Parteibuch, ohne einen Pass vorweisen zu müssen. Wo Chancengleichheit nicht auf T-Shirts gedruckt oder in Elfenbeintürme gesperrt, vielmehr durch eine gemeinsame Haltung gelebt wird. Ansteckend ist.
Nun schreiben wir das Jahr 2200. Über dem Eingang dieses Ortes, der nirgendwo und überall und auf jeden Fall ein guter Ort ist, hängt ein Plakat mit der Aufschrift: „Passt auf euch auf und kämpft für das Gute. Tschüss!“ Im Büro von Simon und auch von Lisa, in der Küche von Nina, im Schlafzimmer von Felix, in der Schule von Demir, an der Tür von Bruno, über dem Sofa von Aman hängt dasselbe Plakat. Simon, Lisa, Nina, Felix, Demir, Bruno und Aman gehören zu den Ermöglicher:innen, die Menschen jeden Alters Raum bieten. Jenen Menschen, die Begegnung suchen und sich einbringen und austauschen wollen. Kinder, groß und klein, egal woher, egal warum, egal ob mit vielen oder mit wenigen Worten im Gepäck, lassen sich ein, bringen Ideen mit. Hören zu. Tauschen sich aus. Teilen – nicht immer die gleiche Meinung, doch den Kuchen, die Falafel, die Pizzaschnecken, den Chai. Einen Raum, der keine Wände hat, weil das Miteinander und die Haltung Rahmen genug sind.
Auch bei der Bürgermeisterin dieses Ortes hängt das Plakat. „Passt auf euch auf und kämpft für das Gute. Tschüss!“ Geboren in Istanbul, als Tochter eines Gastarbeiters in der heimischen Stickerei-Industrie aufgewachsen wird sie nie gefragt „Woher kommst du?“ Ihr wird nie gesagt, dass sie gut deutsch spricht. Gut, obwohl sie aus Istanbul kommt. Sie erlebt ihren Ort als Begegnungsort, an dem es keinen Begegnungszwang gibt, wenn einem nicht danach ist. An ihrem Ort trifft sie Menschen. Menschen, die die gleiche Sprache sprechen wie sie, und solche, die das nicht können. Wenn die Worte fehlen wird mit Fladenbrot, Händen und einer Übersetzungs-KI kommuniziert. In einem Schaufenster entdeckt sie ein Gedicht von Schüler:innen. Sie macht ein Foto, vom Wort „Kelime“, um

Am Wochenende ist Dorffest. Alle kommen. Jeder bringt etwas mit, es wird geteilt. Max ist gerade arbeitslos, hat nicht viel Geld. Er bringt seine Gitarre und mit ihr Musik und Atmosphäre. Keiner sagt, dass Max ein Schmarotzer ist, dass er doch Arbeit finden, dass er sich bemühen könnte. Alle freuen sich über sein Dabeisein, während die anderen Kuchen, Feuerholz und Konversation beitragen. Fladenbrot und die Übersetzungs-KI sowieso. Auch die Nachbarin der Bürgermeisterin ist dabei. Sie hat ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft, sieht das Dorf als ihre Familie und ist darum nie einsam. Am wenigsten an diesem letzten Freitag vor Schulbeginn, an dem jährlich schönes Wetter ist. Der Wettergott muss ortsansässig sein.
Die Schule beginnt, die Schlangen an der Kasse vom Papierwarengeschäft sind lang. Lehrer:innen, heute Ermöglicher:innen genannt, und Schüler:innen bereiten sich auf das neue Schuljahr vor. Während Papier und Notizbücher aufgrund von Bildschirmmüdigkeit der Renner sind, hat die Besitzerin aufgegeben Rotstifte zu bestellen. Seit einigen Jahren verkaufen sich diese nicht mehr wirklich. Was früher von den Schulen in Unmengen bestellt wurde, ist nun ein Ladenhüter. Dasselbe gilt für Schultaschen, in denen die Projekte der Kinder keinen Platz mehr finden. Die Projekte, die nun Schulalltag sind. Die Simon, Lisa, Nina, Felix, Demir, Bruno und Aman als Ermöglicher:innen begleiten. Denn die Kinder verbringen ihre Zeit im Seniorenheim und im Kindergarten, im Behindertenzentrum und in der Vereinsküche. Das sind ihre Lern- und Begegnungsorte, an denen neben den Hauptfächern Debattieren, Glück und Empathie auch die Fächer Mathe beim Berechnen der Windelrechnung und beim Kochen, Sprachen, Geographie und Geschichte im Austausch mit den vielsprachigen Bewohner:innen gelernt und geübt werden. Wenn die Senior:innen von der eigenen Schulzeit und von ihren Noten sprechen, dann schauen die Kinder verdutzt. Noten? Dieses Wort kennen sie nicht.
Damals war die Bürgermeisterin die Hüterin der Finanzen des Ortes. Nun wird das über einen Bürger:innenrat gemacht und gemeinsam entschieden, wohin das öffentliche Geld fließt. Die Qualitätskriterien für die Projekte, in die investiert wird, werden gemeinschaftlich ausgehandelt. Erhöhtes bürgerliches Engagement und verbessertes Gesellschaftsklima zeigen, ob der Einsatz der Ressourcen erfolgreich und zielführend ist. Die Bürgermeisterin und ihre Bürgerrät:innen gehen gerne zu den Veranstaltungen in ihrem Ort. Sie sind mittendrin und gehören zur Crowd, erwarten und bekommen keinen roten Teppich, keine Gratisgetränke, bringen ihre Lieblingsspeisen fürs Buffet, an dem sich die Kinder gratis bedienen. Man sieht sie hinter der Bar am Arbeiten, am Gläser einsammeln oder Pommes und Falafel frittieren. Mit Fladenbrot, Händen und Übersetzungs-KI im Einsatz.
Die Sprache, die endgültigen Weiten. Dies sind die Abenteuer der Menschen, die unterwegs sind, um neue Welten zu erforschen, neue Sprachen, neue „Kelimeler“ und ein neues Miteinander zu entdecken, um mutig dorthin zu gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist.
Kelime = Wort
Kelimeler = Wörter
İnşallah = so Gott will

Gabriele Hampson
Geschäftsführerin Verein FÜRW*ORT
GEBURTSWUNDER VORARLBERG
Wie aus einer Krise eine internationale Vorzeigeregion wurde
DZAHLREICHE STUDIEN BELEGEN: EIN GUTES GEBURTSERLEBNIS WIRKT SICH POSITIV AUF DIE PHYSISCHE UND PSYCHISCHE GESUNDHEIT VON MUTTER UND KIND AUS. KRANKHEITEN WIE ASTHMA, DIABETES, ALLERGIEN ODER AUCH ADHS UND BINDUNGSPROBLEME KÖNNEN IN ZUSAMMENHANG MIT BELASTENDEN GEBURTSERFAHRUNGEN GEBRACHT WERDEN.
ie Geburtshilfe in Vorarlberg ist im Jahr 2045 in vielerlei Hinsicht bemerkenswert – auch im internationalen Vergleich. Das westlichste Bundesland Österreichs verzeichnet nicht nur die höchste Geburtenrate des Landes, sondern auch besonders gesunde Kinder und zufriedene Eltern. Regelmäßig reisen Delegationen aus dem Ausland an, um sich über innovative Versorgungsmodelle, geburtshilfliche Architektur und den gesellschaftlichen Umgang mit Geburt zu informieren. Doch dieser Weg zur Vorreiterrolle war lang – und begann mit einer tiefgreifenden Krise. Ab den 1960er-Jahren wurde die Geburt zunehmend medikalisiert. Geburten verlagerten sich in Krankenhäuser, während außerklinische Einrichtungen – damals Entbindungsheime genannt – und Hausgeburten durch schlechte rechtliche und finanzielle Bedingungen für Hebammen zurückgedrängt wurden. Auch kleine, wohnortnahe Geburtsstationen in Krankenhäusern wurden aus Spargründen geschlossen. Diese Entwicklungen führten regelmäßig zu zivilgesellschaftlichen Protesten – doch die Stimmen der Betroffenen fanden wenig Gehör.
Der Wendepunkt kam 2025. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie hatten ein gewaltiges Loch in die Staatskasse gerissen. Zudem drohten im Gesundheitsbereich aufgrund des demografischen Wandels eklatante Kostenexplosionen und ein Versorgungsnotstand. Visionäre Strategien fehlten – das Vertrauen in die Politik war erschüttert. In dieser Situation erinnerte sich die damalige Gesundheitslandesrätin an eine interdisziplinäre Gruppe von Fachfrauen aus Geburtshilfe, Architektur, Psychologie und Kultur. Diese hatten bereits Jahre zuvor das Konzept einer „Geburtskultur“ vorgestellt: Geburt nicht nur als körperliches und medizinisches, sondern auch als kulturelles und gesellschaftliches Ereignis, das alle betrifft – und den Schlüssel zur langfristigen Gesundheit beinhaltet.
Zahlreiche Studien belegen: Ein gutes Geburtserlebnis wirkt sich positiv auf die physische und psychische Gesundheit von Mutter und Kind aus. Krankheiten wie Asthma, Diabetes, Allergien oder auch ADHS und Bindungsprobleme können in Zusammenhang mit belastenden Geburtserfahrungen gebracht werden. Besonders die hohe Kaiserschnittrate ist kritisch zu beleuchten. Investitionen in die Förderung der physiologischen Geburt können deshalb als „Primärprävention 1A“ eingestuft werden.
Die Landesrätin, die bereits Präventionsprogramme wie Bewegungs- und Ernährungskonzepte für Kinder eingeführt hatte, ließ daraufhin eine Studie zur Wirtschaftlichkeit einer Neuausrichtung der Geburtshilfe in Vorarlberg in Auftrag geben. Die Ergebnisse waren eindeutig: Die gesellschaftlichen Folgekosten schwieriger Geburtserfahrungen beliefen sich über einen Zeitraum von 40 Jahren auf Milliardenbeträge.
Spätestens als diese Zahlen öffentlich wurden, hatte die Landesrätin auch parteiübergreifend Rückhalt. 2026 beschloss der Landtag einstimmig, Vorarlberg zur „Modellregion Geburt 2.0“ zu machen. In einem breit angelegten Beteiligungsprozess wurden gemeinsam mit Fachleuten aus verschiedensten Disziplinen und geburtserfahrenen Menschen aus der Bevölkerung mittel- und langfristige Ziele entwickelt.
Kurzfristig bedeutete dies: Erhalt der vier geburtshilflichen Krankenhausstationen, personelle Aufstockung, Einführung eines Beleghebammensystems und Eins-zu-eins-Betreuung während der Geburt. Diese Maßnahmen führten rasch zu sinkenden Komplikations- und Kaiserschnittraten. Gleichzeitig wurden Hebammentarife jenen der Ärzt:innen angepasst – nach skandinavischem Vorbild, wo Hebammen seit jeher als primäre Geburtsfachpersonen gelten. Diese finanzielle Aufwertung belebte die Hausgeburtshilfe neu. Hebammenteams in allen Regionen des Landes konnten den gestiegenen Bedarf decken. Mittelfristig wurden mehr Ausbildungsplätze für Vorarlberger Hebammen geschaffen, aktuell entsteht ein eigener Studiengang „Hebammenwissenschaft“ an der Fachhochschule Vorarlberg, der ab 2050 starten soll.
Besondere Aufmerksamkeit galt im „Architekturland“ Vorarlberg auch den Geburtsräumen. Inspiriert vom Projekt „The First Room“, das eine Vorarlberger Hebamme und

Architektin 2025 präsentierte, entstanden kleine modulare Geburtseinheiten aus nachhaltigen, sensorisch wirkenden und gesundheitsfördernden Materialien wie Holz, Lehm und Kalkglätte. Diese rein hebammengeleiteten Einheiten für gesunde Schwangere wurden an allen Klinikstandorten eingerichtet – als Alternative zur klassischen Krankenhausgeburt und zur Entlastung der auf Pathologien und unvorhergesehene Verläufe spezialisierten Kreißsäle.
Auch dem Wochenbett wurde besondere Bedeutung beigemessen: In einem umgebauten Kurhotel im Bregenzerwald entstand auf Initiative des Vereins „Doulas Vorarlberg“ ein Wochenbetthotel, das schnell auch Jungeltern aus dem Ausland anzog. Ergänzend bot ein Start-up einen mobilen Wochenbettservice mit Stillberatung, Nachsorge, Körperbehandlungen und Essenslieferungen an.
Parallel zur strukturellen Verbesserung wurde der Begriff „Geburtskultur“ gesellschaftlich etabliert. Informationskampagnen, Fortbildungen für Fachpersonen und Laien, und gestärkte „Frühe Hilfen“ trugen dazu bei, die Bedeutung des Lebensstarts ins Bewusstsein zu rücken. Gratis Elternvorbereitungskurse und therapeutische Begleitung nach schwierigen Geburtserfahrungen wurden Standard. Ziel war es, die biologische, soziale und kulturelle Dimension von Geburt sichtbar zu machen und neben dem individuellen auch das gesellschaftliche Vertrauen in die Gebärfähigkeit der Frauen zu stärken.
Heute gilt Vorarlberg europaweit als „Geburtsparadies“. Immer mehr Paare aus dem In- und Ausland entscheiden sich für einen „Geburtsurlaub“ im Ländle. Die Maßnahmen haben sich bereits nach 20 Jahren bezahlt gemacht: Die Gesundheitskosten haben sich auf gleichbleibendem Niveau eingepegelt, die Bevölkerung ist resilienter und gesünder. Der politische Weitblick der damaligen Landesregierung wurde kürzlich im Rahmen eines „Kunst am Bau“-Projekts bei der nach den Kriterien der „Healing Architecture“ neu gestalteten und erweiterten Geburtenstation im Krankenhaus Dornbirn gewürdigt – als Symbol für eine Politik mit Weitblick und Herz.
BESONDERE AUFMERKSAMKEIT GALT IM „ARCHITEKTURLAND“ VORARLBERG AUCH DEN GEBURTSRÄUMEN


Brigitta Soraperra Regisseurin, Kulturvermittlerin, Projektleiterin IG Geburtskultur a-z
© Architektur: Anka Dür GmbH
Brigitta Soraperra
EIN LAND MIT BODENHAFTUNG
MWIR HABEN ALS GESELLSCHAFT BEGONNEN ZU ERKENNEN, DASS BODEN NICHT NUR RAUM IST, SONDERN VORAUSSETZUNG FÜR ERNÄHRUNG, WASSER, KLIMASCHUTZ, LEBENSQUALITÄT.
Simon Vetter
an sagt den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern nach, dass sie eine ganz besondere Beziehung zum Boden haben. Manche würden sagen: Sie ist emotional. Ich glaube, sie ist vor allem monetär. Denn Boden wurde bei uns vor allem als Verkehrswert gesehen und entsprechend behandelt: als sichere Anlage, als Spekulationsgut, als Besitzstand. In meiner Utopie hat sich dieser Blick verschoben. Wir haben als Gesellschaft begonnen zu erkennen, dass Boden nicht nur Raum ist, sondern Voraussetzung für Ernährung, Wasser, Klimaschutz, Lebensqualität. Und dass wir als Region dann stark sind, wenn wir ihn nicht verbrauchen, sondern gestalten. Diese Erkenntnis hat auch die Landesgrünzone in ein neues Licht gerückt. Sie ist nicht mehr eine Fläche, die man irgendwann „entwickelt“. Sie ist längst das, was unsere Region trägt – Tag für Tag. Die Landesgrünzone ist das landschaftliche Rückgrat unseres Talraums. Sie sichert frische Luft, Erholungsräume, regionale Versorgung, Artenvielfalt und offene Sichtachsen. Sie ist landwirtschaftlich genutzt, geprägt von hoher Leistungsfähigkeit und Pflege. Und sie ist ein Zukunftsraum – nicht im Sinne von Bauoption, sondern im Sinne von Generationenverantwortung. Der Großteil dieses Bodens gehört nicht landwirtschaftlich tätigen Personen. Und genau darin liegt eine Chance:
In meiner Utopie haben sich diese Eigentümer*innen organisiert – zum Beispiel in Form einer gemeinnützigen Stiftung, die die Nutzung dieser Flächen treuhänderisch verwaltet. Das Eigentum bleibt, wo es ist – aber die Verantwortung für die Nutzung wird gemeinsam getragen. Mit dem klaren Ziel, die Landesgrünzone langfristig zu sichern, agrarisch zu nutzen und gleichzeitig ökologisch aufwerten zu können. Daraus entstehen zusammenhängende Flächen, tragfähige Bewirtschaftungsmodelle und ein neuer Umgang mit Verantwortung. Besitz verpflichtet – und wird hier zum Ermöglicher, nicht zum Hindernis.
Auch gewidmete, aber unbebaute Flächen werden nicht länger ignoriert. Sie bleiben, was sie rechtlich sind – aber sie werden vorübergehend

VIELLEICHT IST DAS DER KERN DIESER UTOPIE: DASS WIR BEGONNEN HABEN, DEN BODEN NICHT ALS FRAGE DES BESITZES ZU SEHEN, SONDERN ALS TEIL EINER GEMEINSAMEN VERANTWORTUNG. NICHT, WEIL ES POPULÄR WAR. SONDERN, WEIL ES NOTWENDIG WAR. WEIL WIR ERKANNT HABEN, DASS UNSER UMGANG MIT DEM BODEN AUCH EIN SPIEGELBILD UNSERER HALTUNG ZUR ZUKUNFT IST.
ökologische Pufferzonen, Bildung, öffentliche Gärten. Nicht dogmatisch – sondern sinnvoll. Und dabei anpassungsfähig: Wenn auf einer dieser Flächen für fünf Jahre ein Spielplatz entsteht, dann ist das nicht bloß eine Zwischenlösung – sondern die ganze Kindheit eines Kindes, das dort aufwächst. Ein Stück Alltag, das bleibt. Und ein Beitrag, der oft mehr Wert hat als jeder Quadratmeterpreis. Viele dieser Grundstücke sind über Jahrzehnte kleinteilig geworden – so kleinteilig, dass sie weder agrarisch sinnvoll nutzbar sind noch eine zusammenhängende Entwicklung ermöglichen. Niemand wird mehr diese Flächen einzeln bewirtschaften können. Deshalb ist es auch aus ökonomischer Sicht klug, sich zusammenzuschließen und neue, gemeinsame Möglichkeiten zu schaffen.
Parallel dazu haben wir auch spannende Wege gefunden, wie wir bestehende Einfamilienhausquartiere sinnvoll weiterentwickeln können. Bereits heute – 2025 – leben zwei Drittel der Menschen im Rheintal in Ein- oder Zweipersonenhaushalten. Diese Realität ernst zu nehmen, heißt: Platz schaffen, ohne neu zu verbauen. Und das ohne Zwang, sondern mit Lust am Wohnen, mit durchdachter Gestaltung und mit Konzepten, die nicht nur funktionieren, sondern Freude machen. Es muss Spaß machen, dort zu leben. Dann gelingt auch Veränderung.
Gleichzeitig hat sich auch die Raumordnung verändert. Neue Betriebsgebiete entstehen kompakter, integrierter, mit Blick auf Bodenverbrauch und Flächenbindung. Dächer sind heute keine toten Flächen mehr: Sie tragen Photovoltaikanlagen, Begrünungen, Wasserretention –und auf manchen Hallen wird Fußball gespielt. Weil man erkannt hat: Fläche ist zu wertvoll, um sie nur einmal zu denken.
Die Industrie – besonders im Rheintal – hat gezeigt, dass verantwortungsvoller Umgang mit Boden möglich ist. Bestehende Areale werden weiterentwickelt, nicht einfach ersetzt. Verdichtung ersetzt Neuerschließung. Bodensparendes Bauen wird nicht gefordert – es wird praktiziert, weil es wirtschaftlich und strategisch klug ist.
In der Landwirtschaft selbst zeigt sich dieselbe Haltung: Kooperation statt Konkurrenz, Spezialisierung als Teil vernetzter Systeme, kurze Wege, hohe Qualität. Die Ernährung der Region ist vielfältiger geworden – nicht durch Zwang, sondern durch neue Möglichkeiten. Fermentation, Direktvermarktung, neue Verarbeitungsformen – all das trägt dazu bei, dass Menschen wieder näher an ihr Essen gerückt sind. Und an die, die es erzeugen.
Vielleicht radelt jemand morgens zur Arbeit durchs Ried. Weil es der schnellste Weg ist. Oder der schönste. Weil er in zehn Minuten mehr Eindrücke sammelt als anderswo in einer Woche. Weil er sieht, wie Landschaft, Arbeit und Alltag zusammenspielen. Diese Landschaft ist nicht Kulisse. Sie ist Standortfaktor.
Und vielleicht ist das der Kern dieser Utopie: Dass wir begonnen haben, den Boden nicht als Frage des Besitzes zu sehen, sondern als Teil einer gemeinsamen Verantwortung. Nicht, weil es populär war. Sondern, weil es notwendig war. Weil wir erkannt haben, dass unser Umgang mit dem Boden auch ein Spiegelbild unserer Haltung zur Zukunft ist.

Simon Vetter
THEATER – EIN FEST
EWIR HABEN ERKANNT, DASS UNSERE DIGITALE GESELLSCHAFT EIN ANALOGES GEGENGEWICHT BRAUCHT. DAS PERFEKTE GEGENGEWICHT IST UNSERES ERACHTENS THEATER. THEATER ZUM ANSCHAUEN, THEATER ALS WERKZEUG IM UNTERRICHT UND THEATER ZUM WIRKSAM WERDEN.
Michael Schiemer
ine Headline in allen wichtigen Tageszeitungen in Österreich am 23.6.2025 lautet:
„Zum 5. Mal findet in Vorarlberg das große Theaterfestival statt – 101 Schulen beteiligen sich an dem großangelegten Kreativfest in 47 Gemeinden in ganz Vorarlberg“.
Und es stimmt, Vorarlberg ist zum europäischen Vorreitenden in Sachen Schule und Theater geworden. Die vorletzte Schulwoche wurde fast flächendeckend zur Theaterwoche umfunktioniert. Jedes Jahr nehmen mehr Schulen an dem einwöchigen Event teil. Gezeigt werden Stücke von Lernenden, professionelle Stücke für Lernende. Es finden Workshops zum Thema Drama in Education statt. Die Schullandschaft ist komplett umgekrempelt. Mit Spaß und Freude gehen Lehrende und Lernende an komplexe Themen heran. Durch den intensiven Einsatz von theaterpädagogischen Methoden ist die Unterrichtsqualität explodiert. Die Mobbingraten sinken, Vorarlberg hat die niedrigste Dropoutrate über die gesamte OECD. Die Leistungen steigen und gegenläufig zum globalen Trend hat die Handynutzung einen Tiefstand erreicht. Grundlegende Änderungen im Lehrplan der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg haben bewirkt, dass Lehramtsstudierende aus ganz Österreich ihre Ausbildung in Feldkirch absolvieren wollen. Inzwischen haben die anderen Bundesländer reagiert und ebenfalls auf innovative Lehrpläne umgestellt in denen Theater und theaterpädagogische Methoden einen hohen Stellenwert einnehmen. Finnische und britische Erziehungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler haben großangelegte Bildungsreisen ins Ländle organisiert, um einen Wissenstransfer in den Norden zu ermöglichen. Die Vorarlberger Bildungsdirektion teilt bereitwillig ihre Erkenntnisse mit allen Interessierten und organisiert gemeinsam mit dem Vorarlberger Landestheater, IDEA Austria, der PH Vorarlberg unentwegt Fortbildungsreihen für die ungebrochen große Nachfrage aus der ganzen EU.
Nach dem Erfolgsgeheimnis befragt, antwortet der Vorarlberger Bildungsdirektor: „Wir haben erkannt, dass unsere digitale Gesellschaft ein analoges Gegengewicht braucht. Das perfekte Gegengewicht ist unseres Erachtens Theater. Theater zum Anschauen, Theater als Werkzeug im Unterricht und Theater zum wirksam werden.
Seit die PH Vorarlberg in der Ausbildung intensive theater- und dramapädagogische Elemente zum Einsatz bringt, hat sich alles in eine sehr positive Richtung entwickelt.“
Die Bildungslandesrätin ergänzt zu diesem Thema: „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin,

dass wir es geschafft haben, die Vorarlberger Bildungslandschaft komplett umzukrempeln und dass alle an einem Strang ziehen. Theater in der Schule hat einen Sog entwickelt, der alle in eine bessere Welt zu ziehen scheint. Vor allem der massive Ausbau der Schultheatercoaches hat dazu geführt, dass immer mehr Lehrkräfte von dem Angebot Gebrauch machen und im Zuge dessen auch immer öfter selbst aktiv werden und Theaterprojekte initiieren.“
„Seit dieser grundlegenden Veränderung haben wir kaum noch soziale Probleme in den Schulen, die Lese- und Schreibkompetenz – unser langjähriges Sorgenkind – hat sich geradezu dramatisch verbessert, wir haben in allen Bereichen positive Effekte festgestellt und endlich sind wir von einer belehrenden zu einer erfahrenden Pädagogik übergegangen, die freudvolles Lernen aus Eigeninteresse vor erzwungenes Leistungsdenken stellt.“ So schildert die pädagogische Leiterin der Bildungsdirektion ihre Erfahrungen.
Inzwischen sind die großen Kulturhäuser des Landes bis auf die letzten Plätze ausgebucht, weil die Qualität der Veranstaltungen längst über die Grenzen hinaus Schulen und andere Bildungseinrichtungen anzieht, die sich die großartigen Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler anschauen möchten. In Kooperationen mit diversen Kultureinrichtungen zeigt sich die Ganzheitlichkeit des Theaters. Das Vorarlberg Museum, das KUB, das jüdische Museum, das Literaturhaus Vorarlberg, das Architekturinstitut und viele weitere Institutionen bringen sich in die Gestaltung und Erarbeitung der Festivalbeiträge ein.
Vom Büro des Wirtschaftslandesrates kommen Lobeshymnen in Bezug auf das Konzept und die positive Entwicklung der Jugendlichen: „Egal, welches Unternehmen man fragt, der Tenor ist einhellig: Die Qualität der Lehrlinge hat sich in den letzten Jahren drastisch verbessert. Die anfängliche Skepsis, die in weiten Teilen der Vorarlberger Wirtschaftslandschaft vorherrschte, ist einer Begeisterung und Aufbruchstimmung gewichen, die so schon lange nicht mehr spürbar war.“
„Kinder in die Mitte“ war noch nie so wahr wie heute.

Michael Schiemer Pädagoge, Regisseur, Schauspieler Vorarlberger Landestheater info.junges@landestheater.org
INNOVATION KOMMT INS SPÜREN
Begonnen hat es Ende 2024 mit einer Revolution der Gedanken. Die Menschheit erlebte einen noch nie dagewesenen Entwicklungssprung des Geistes, der dazu führte, dass es alle rational verstehen konnten und die Klarheit erlangten: Wir sind alle miteinander verbunden, wir Menschen sind alle Teil EINER Menschheitsfamilie – in all ihrer Vielfalt.
Dies löste individuelle als auch gesellschaftliche Veränderungsprozesse aus und ein paar Jahre danach, als diese Verbundenheit dann auch emotional und spirituell begriffen wurde, fand die große Transformation statt. Wie von Zauberhand lösten sich alle verfahrenen Konstrukte wie Verteilung von Wohlstand, Schule oder Politik auf und das Neue, dass ja schon in den Startlöchern stand, durfte sich entfalten. Vorarlberg war eine der Regionen in der besonders >>
Isabelle Goller

DIE MENSCHEN SIND ANGEDOCKT AN DAS GROSSE GANZE, SIE HABEN GELERNT, HERAUSFORDERUNGEN ZUSAMMEN ANZUNEHMEN UND ALS CHANCE ZU SEHEN.
viel Neues Realität wurde. Die Innovationsprozesse in dieser Zeit wurden endlich zu dem, wovon zuvor schon einige wenige sprachen – iterative, lernende Prozesse mit einem guten Blick auf die Wirkung und das System.
Heute im Jahr 2044 ist das Spüren längst nicht mehr der Esoterik zugeordnet, sondern gleichwertig zum Denken und Tun, es ist integriert. Das Spüren wird überall eingesetzt, auch in Bereichen, wo es vor wenigen Jahren noch gar keinen Platz hatte, zum Beispiel in den Bürgerräten und dem Bürgerparlament, die als politisches System für Verbindung und Teilhabe sorgen oder in der Medizin, die nun ganzheitlich Körper, Emotionen und Geist wahrnimmt und alles verfügbare Wissen und Intuition miteinander verbindet.

Prozessbegleiterin und Gastgeberin für Kollaboration und Innovation
www.estuar.at
Die Menschen sind angedockt an das große Ganze, sie haben gelernt, Herausforderungen zusammen anzunehmen und als Chance zu sehen. Sie wissen, dass das Spüren hier einen wichtigen Beitrag leisten kann, denn nicht alles lässt sich „denken“, es braucht auch hier die Vielfalt der Zugänge. Überall üben die Menschen, diese neu entdeckte Wahrnehmungsebene weiterzuentwickeln und es gibt dazu zahlreiche Learning Communities, in denen Kinder und Erwachsene zusammenkommen. Im Bereich Innovation ist neben futures literacy und Ko-Kreation Sensing ein gefragtes neues Lernfeld. Unternehmen und Organisationen kollaborieren branchenübergreifend und arbeiten in Open Innovation Systemen gemeinsam an Innovationen für das große Ganze.
Spüren als die Sprache des Körpers und die Wahrnehmung innerer, intuitiver Ressourcen haben einen Shift erzeugt – weg vom Ego, hin zum Ganzen. 2044 ist die Verbindung zu uns, unseren Mitmenschen, den Lebewesen und der Erde in ihrer vollen Kraft.
TROTZDEM
MDER MENSCH FORMT SICH NACH DEM, WAS ER AUSDRÜCKT, UND EINE UTOPIE ZU FORMULIEREN BEDEUTET, EIN POSITIVES BILD ZU ERZEUGEN.


Hildegard Breiner Umweltikone und Obfrau Naturschutzbund Vorarlberg
ein Schlüsselwort ist das Wort Trotzdem. Auch wenn dringende Veränderungen auf sich warten lassen, muss man Geduld haben und darf nicht verbissen werden. Aber man muss dranbleiben. Der Mensch formt sich nach dem, was er ausdrückt, und eine Utopie zu formulieren bedeutet, ein positives Bild zu erzeugen. Das hat eine Sogkraft. In meiner Utopie haben die wirtschaftlich denkenden Menschen in den Vorarlberger Unternehmen irgendwann begriffen, dass der Klimawandel mit jeder Verzögerung teurer wird. Bei Nichthandeln würde daraus ein Fass ohne Boden. Im deutlichen Bemühen um die CO2-Neutralität sichern sie Arbeitsplätze, aber auch ihre Umsätze und ihren Gewinn. Sie gründeten Energiegemeinschaften und wirkten auf politisch Verantwortliche ein, um die damit zusammenhängende Bürokratie zu reduzieren. Dieser Weitblick kam von den Bürger*innen und den Unternehmer*innen. Sie realisierten irgendwann, dass sie einen großen Einfluss nehmen konnten, wenn sie nur aufhören würden, auf Veränderungen zu warten. Sie begannen diese Veränderungen selbst umzusetzen – freundlich, aber bestimmt. Sie blieben dabei, auch wenn bestimmte Prozesse nur langsam vorangingen. Sie gaben nicht auf und die Politik musste ihnen folgen. Ihre Ziele waren klar: Der Bodenverbrauch wird gestoppt und wo immer es geht, wieder rückgängig gemacht. Die versiegelten Böden gefährden die Nahrungssicherheit und der Grundwasserspiegel sinkt – das kann niemand wollen. Der Straßenbau wird ebenfalls gestoppt, Massentierhaltungen sind vorbei. Es wurde zu viel Fleisch gegessen, das spürten wohl die meisten Menschen schon seit langer Zeit. Sie stellten ihre Ernährung um, die Folge sind glückliche Tiere in einer tiergerechten Haltung. Man kehrt zurück zum Sonntagsbraten. Das ist gesünder für die Menschen, und für die Tiere allemal. Das Kochen zu Hause wurde zu einem Hype, was die Gesundheit der Kinder fördert – die der Erwachsenen natürlich ebenso. Jetzt sind es die Männer, die sich übertreffen mit dem Eigenanbau gesunder Lebensmittel und deren Verarbeitung. Ein Nebeneffekt ist, dass die Kinder wieder einen regelmäßigen gemeinsamen Mittagstisch erleben, ihre verbale Ausdrucksfähigkeit hat sich seither verbessert, so wie auch der Zusammenhalt in den Familien.
Dass sich die AKWs schon bei der ersten, noch relativ harmlosen Erderwärmung verabschiedeten, weil das Kühlwasser in den Flüssen zu warm war, sorgte sehr rasch für ein großangelegtes Umdenken. Plötzlich boomt die Entwicklung in Solar- und Windenergie – aber auch das ist noch lange nicht das Ende. Neue Arten der Energiegewinnung, die sowohl CO2-neutral sind, als auch die Natur schützen, kommen derzeit auf die Märkte. Vorarlbergs Grünzonen sind seither wirklich geschützt. Die früher üblichen Spezialwidmungen sind vom Tisch und vieles davon wird wieder renaturiert. Die Wildpflanzen und Wildtiere brauchen nicht lange, um sich diese Lebensräume zurückzuerobern. Und das alles, weil auch eine entscheidende Anzahl von Unternehmer*innen sich für das Wort „trotzdem“ entschieden und die nötigen Schritte einfach einleiteten. Der Umweltbeirat hat seither eine echte Bedeutung und tritt vehement auf, sobald ein politisch Verantwortlicher den Klimawandel nicht ernst nimmt. Dieser wird schnell wieder verabschiedet. Die Eigenverantwortung der Bevölkerung für den persönlichen CO2- Fußabdruck ist gestiegen, und man hört immer wieder, wie viel Lebensfreude entsteht, wenn man achtsamer mit dem eigenen Leben und der Mitwelt umgeht.
Isabelle Goller
Hildegard Breiner
ARBEIT NEU DENKEN –BILDUNG NEU GESTALTEN
Eva Häfele
Stellen wir uns ein Vorarlberg in der Zukunft vor, das seine Bewohner:innen niemals aufgibt, sondern lebenslang aktiv in die gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunft des Landes einbindet. In diesem Vorarlberg ist kein junger oder erwachsener Mensch „erwerbsfern“ – oder bleibt ein Leben lang niedrigqualifiziert. Alle haben Zugang zu sinnvoller, sozial nützlicher und langfristiger Arbeit, die den individuellen Fähigkeiten entspricht und die persönlichen Potenziale entfaltet. Das Ergebnis wäre ein strukturell, sozial und wirtschaftlich transformiertes Bundesland. Wie wäre der Weg dorthin?
Frühe Bildung – eine gemeinsame Aufgabe
ALLE HABEN ZUGANG ZU SINNVOLLER, SOZIAL NÜTZLICHER UND LANGFRISTIGER
ARBEIT, DIE DEN INDIVIDUELLEN FÄHIGKEITEN ENTSPRICHT UND DIE PERSÖNLICHEN POTENZIALE
ENTFALTET. DAS ERGEBNIS WÄRE
EIN STRUKTURELL, SOZIAL UND WIRTSCHAFTLICH TRANSFORMIERTES BUNDESLAND.
Bereits im Kindergarten werden Kinder altersgerecht an Berufswelten herangeführt. Unternehmen und Bildungseinrichtungen arbeiten eng zusammen, um kindliche Neugier auf handwerkliche, technische und soziale Berufe zu wecken. Die Schulen pflegen enge Lernpartnerschaften mit Betrieben – keine Schülerin und kein Schüler verlässt die Pflichtschule ohne konkrete Berufsorientierung oder schulische Übergangsperspektive.
Eine Kultur der Ermöglichung statt der Ausgrenzung
Anstatt jugendliche Schulabbrecher, Beschäftigungs- und Ausbildungsferne und Geringqualifizierte als Problemgruppe zu stigmatisieren, werden sie als Ressource anerkannt. Durch sozialwirtschaftlich sinnvolle Arbeitsfelder – wie soziale Landwirtschaft, gemeinwohlorientierte Dienstleistungen oder handwerklich-ökologische Projekte – haben diese Menschen ihre Würde, ihren Platz und ihre Perspektive gefunden.
Junge Menschen werden nicht mehr nur qualifiziert, sondern aktiv beteiligt: Sie bringen Ideen ein, gestalten Werkstätten, Farmprojekte, Reparaturzentren oder kreative Ateliers. Der Slogan „Neue Arbeit – Neue Kultur“ ist Realität geworden – mit Eigenverantwortung, Sinnorientierung und kooperativer Innovation.
Dank flächendeckender Brückenangebote und eines starken Übergangsmanagements zwischen Schule und Beruf gibt es kaum noch junge Menschen, die „durch das Raster fallen“. Die Zahl der Lehrabbrüche ist deutlich gesunken, weil Betreuungspersonen, Coaches und Betriebe gemeinsam Verantwortung tragen. Ein junger Mensch, der in Schwierigkeiten gerät, erhält rasch und niederschwellig Hilfe – auch vorsorglich, nicht erst im Krisenfall.
Berufliche Entwicklung und Bildung – lebenslang, modular und praxisnah Für Menschen zwischen 20 und 65 Jahren ist berufliche Weiterbildung ein selbstverständlicher Bestandteil ihres Erwerbslebens. Durch modularisierte, betriebsnahe Lernangebote, flexible Formate (z. B. Lerninseln, digitale Lernbegleitung, Coaching) und finanzielle Absicherung wird Lernen für alle Altersgruppen wieder zugänglich – selbst für jene, die im klassischen Bildungssystem scheiterten. Arbeitgeber fördern Weiterqualifizierung nicht nur, sie gestalten sie aktiv mit. Das Resultat: eine qualifizierte, motivierte Belegschaft und ein robuster, flexibler Arbeitsmarkt.
Auch die besonders schwer erreichbaren Gruppen – erwerbsferne Jugendliche, junge Eltern ohne Ausbildung, bildungsferne Migrant:innen – werden durch innovative Zugänge integriert: Sprachsensible Werbung, Role Models und Community-basierte Projekte machen Bildung sichtbar und greifbar. Die Zahl der „NEETs“ (Not in Education, Employment or Training) ist massiv gesunken.
Vorarlbergs Unternehmen gelten daher als Vorreiter in der Integration von Lernen in den praktischen Arbeitsalltag. Eine Unternehmenskultur der Verantwortung und der geteilten Wissensweitergabe hat sich etabliert. Weiterbildung ist betrieblicher Standard. Personalentwicklung schließt alle ein – vom Hilfsarbeitenden bis zur Führungskraft.
Neue Betriebstypen mit Gemeinwohlorientierung
Die wirtschaftliche Landschaft hat sich erweitert: Social Businesses und solidarökonomische Projekte sind in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen alltäglich geworden. Sie agieren unternehmerisch, aber mit sozialer Zielsetzung, gefördert durch regionale Fonds, kommunale Aufträge und steuerliche Anreize.

Die tiefgreifende Transformation hat auch auf die Gesamtwirtschaft positiv ausgestrahlt: Kleine Betriebe profitieren von neuen Fachkräften, große Unternehmen kooperieren mit Sozialfirmen, und alle erkennen: Eine gerechtere, nachhaltigere Beschäftigungspolitik ist langfristig auch ökonomisch klüger. Diversität der Beschäftigten wird als wirtschaftlicher Vorteil und Stärke gelebt.
Der zweite Arbeitsmarkt ist gleichwertig Ein stabiler „Arbeitsmarkt 2+“ wurde als gleichwertiger Teil der Wirtschaft etabliert. Der Arbeitsmarkt 2+ ist nicht wie der bisherige zweite Arbeitsmarkt ein befristetes Auffangbecken, sondern eine dauerhafte Einrichtung. Die Übergänge zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt sind durchlässig, sie sind begleitet von Qualifizierungsmodulen, Kompetenzzertifikaten und realen Entwicklungsmöglichkeiten.
Das „Integrationsleasing“ und andere innovative Beschäftigungsmodelle sind zum Herzstück aktiver Arbeitsmarktpolitik geworden – auch für ältere Erwerbstätige oder beispielsweise Wiedereinsteiger:innen. Unternehmen erhalten kalkulierbare Unterstützung, um vielfältige Erwerbsbiografien zu integrieren. Karenzzeiten gelten nicht mehr als Karrierekiller, sondern als Entwicklungspausen mit Anschluss. Das Existenzminimum wurde erhöht, Schuldenberatung ist entstigmatisiert, berufliche Neustarts sind jederzeit möglich.
Gemeinden als Impulsgeber
Die Städte und Gemeinden sowie die Landespolitik verstehen sich als aktive Gestalter: Sie schaffen Beschäftigungsfelder, geben selbst Aufträge und fungieren als Plattformen für Public-Private-Partnerships. Lokale Verantwortung ersetzt Verwaltungsroutine.
Ein Bundesland mit Modellcharakter
Mit seinem ganzheitlichen, biografieorientierten Ansatz hat sich Vorarlberg zu einer europäischen Modellregion für eine lebenslange und integrative Berufsbildung entwickelt. Das Land und die Gemeinden zeigen: Wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an einem Strang ziehen, dann können selbst strukturelle
Benachteiligungen überwunden werden – und das zum Vorteil aller. Vorarlberg wäre durch die Umsetzung dieser Maßnahmen nicht nur ein Vorreiter in der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Arbeitslosigkeit insgesamt, sondern ein wirkmächtiges Modell für eine inklusive, zukunftsorientierte Regionalentwicklung geworden – wirtschaftlich klug, sozial gerecht und kulturell innovativ. Ein Land, das selbst Arbeitsrealitäten schafft, die Menschen wachsen lassen.
EINE GERECHTERE, NACHHALTIGERE BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK IST LANGFRISTIG AUCH ÖKONOMISCH KLÜGER. DIVERSITÄT DER BESCHÄFTIGTEN WIRD ALS WIRTSCHAFTLICHER VORTEIL UND STÄRKE GELEBT. ©

Sozialwissenschafterin
Eva Häfele

Uto·pie/Utopié/
Substantiv, feminin [die]
Etwas, was in der Vorstellung von Menschen existiert, aber [noch] nicht Wirklichkeit ist – „eine soziale, politische Utopie“ Wörterbuch, Definitionen von Oxford Languages
Eine Utopie ist der Entwurf einer möglichen, zukünftigen, meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische historisch-kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist.
Das Wort geht zurück auf altgriechisch ού ou „nicht“ und τόπος tópos „Ort, Stelle“, gemeinsam „Nicht-Ort“, beziehungsweise den Titel Utopia eines lateinischen Romans des Thomas Morus aus dem Jahr 1516. Die in Utopien beschriebenen fiktiven Gesellschaftsordnungen resultieren häufig aus einer Kritik der jeweils zeitgenössischen Gesellschaftsordnung und können dann als positive Gegenentwürfe gelesen werden.
METHAN VO:ÜS, C-FIX!*
Mátyás Scheibler
Der Trick mit der CO2-Rückbildung.
VOR UNSEREN
AUGEN UND NASEN WURDEN JAHRZEHNTELANG WERTVOLLSTE ENERGIETRÄGER
„ENTSORGT“
ODER AUSSER LANDES GEKARRT, DIE BÖDEN ÜBER-
DÜNGT UND DIE LANDWIRTE
DAFÜR VERACHTET. DABEI
LAG GENAU IN DIESEN ROHSTOFFEN
DER WEG ZUR ENERGIE-UNABHÄNGIGKEIT – UND DAS WAR NICHT ALLES.
Die Sache mit der Gülle war natürlich nicht so einfach und es dauerte einen Moment, bis die Erzählung sich verändern ließ – und das war schon immer der Schlüssel: Die Erzählung bestimmt unsere Wahrnehmung. Sobald das Narrativ verändert wird, kommen Dinge in Bewegung. Vor unseren Augen und Nasen wurden jahrzehntelang wertvollste Energieträger „entsorgt“ oder außer Landes gekarrt, die Böden überdüngt und die Landwirte dafür verachtet. Dabei lag genau in diesen Rohstoffen der Weg zur Energie-Unabhängigkeit – und das war nicht alles. Es begann mit der Initiative von einigen Strom-Energiegemeinschaften, die sich auf den Weg machten, die natürlichen Gärprozesse von Bioabfallprodukten in landwirtschaftlichen Betrieben nicht nur mehr energetisch, sondern auch stofflich zu nutzen. Schnell war klar, dass Vorarlberg ausreichend Methangas erzeugen kann, um es vorrangig für die Industrie nutzbar zu machen, und dass es gleichzeitig einen Nährstoff- und Kohlenstoffkreislauf schließen kann – das bedeutet doppelter Klimaschutz.
In der veralteten Technologie von 2025 gingen rund 2/3 der durch teure Gaslieferungen erzeugten Energie verloren. Mit einigen Kunstgriffen waren gleich zu Beginn des Transformationsprozesses 110 GWh wirtschaftlich machbar – übersetzt hieß das: Die zwei Rohgas-Verbundregionen in Meiningen und Dornbirn und zwei von insgesamt zehn Bioressourcenparks begannen damit, Gülle-Pipelines und Biogas-Sammelleitungen zu installieren. Wo das nicht möglich war, dienten schicke e-Trucks den Hofdünger aus unzähligen Kleinbetrieben den Gemeinschafts-Biogasanlagen an. Sie sammelten im Milchwagen-Prinzip das Biomethan abgelegener Rohgaserzeuger ein und brachten es zu den Einspeisepunkten des vormaligen Erdgasnetzes. Letzteres wurde entweder rückgebaut oder für Biomethanlieferung an die Industrie umgenutzt.
Der Klärschlamm wurde in einem HTC-Verfahren ebenso einer Nährstoffrückgewinnung (Struvit) unterzogen, aber davor natürlich noch energetisch genutzt. Biomüll bekam wieder seine landeseigene Verwertungsschiene. Das CO₂ nach dieser Methangewinnung wurde dauerhaft von der Atmosphäre weggesperrt, beispielsweise in Recylingbeton-Werken. Von den Bioressourcenparks gelangte das vom Methan getrennte CO₂ via Stilllegungs-Erd-Gastrassen in neuartige Kohlenstoff-Fixierungsanlagen, und wurde so für die Ewigkeit ins Gestein bzw. in Beton fixiert.
Die Sache war natürlich weit komplexer, denn die Industrie arbeitete gleichzeitig an der Reduzierung des Gas-Bedarfs, um nur mehr ihre Hochtemperaturprozesse mit dem kostbaren Brennstoff zu betreiben. Ihr Ziel war, von 1.000 auf 290 GWh im Jahr zu
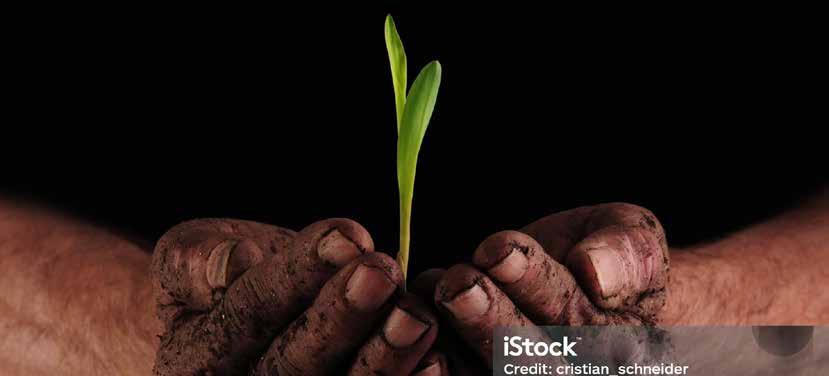
zahl der Vorarlberger Biogaswerke recht schnell eine Deckung des verbleibenden Gasbedarfs erreichen zu können. Das war machbar. Die CO₂-In-Wert-Setzung und eine grundlegende zivilgesellschaftliche Sehnsucht nach Selbstwirksamkeit in den Energie- und Klimawirren der 2020er brachten den Stein ins Rollen.
Die Bauern waren ermutigt, ihre Landwirtschaft zu diversifizieren, also neben Milch, Strom und Wärme auch eine hohe Produktvielfalt (sogar Reis!) für regionale Marktgärtnereien herzustellen, und Methan war bloß ein Nebenprodukt. Das Image der Landwirtschaft war so hoch angesehen wie nie zuvor – nicht nur produzierten sie gesunde heimische Lebensmittel und steigerten die Eigenversorgung von 30% im Sommer auf 47% im Winter mit neuen Gewächshäusern. Sie deckten auch den Energiebedarf des Industriestandortes mit dem Ausputz ihrer Agrarflächen sowie aus Futterresten der Qualitäts-Milchwirtschaft. Gärreste sind organische Qualitäts-Dünger, mit Co-Fermentation konnte ein Nährstoffplus ausgekoppelt werden, das den Kunstdünger ersetzen half und diesen qualitativ bei weitem übertrifft. Gott sei Dank war ab 2030 Schluss mit allen Versiegelungen, urban, gewerblich und agrarisch, sonst hätte es an kostbaren Photosyntheseflächen gemangelt.
Die Decarbonisierung der heimischen Industrie war so leicht umgesetzt, dass sich ganze Reisegruppen von Wissenschaftlern aufmachten, um die heimischen Bioressourcenparks zu besuchen. Die Landesräte für Landwirtshaft und Energie waren gerne bereit, diesen Gästen den Biogas-Hochlauf von 250 GWh/a zu schildern, denn so viel Biomethan kam zusammen, sobald endlich wieder der eigene Biomüll wie auch Altspeiseöl methanisiert wurden. Stolz präsentierten die Entwicklungsverantwortlichen, wie einfach und low-tech-mäßig Photosynthese Tierhaltung Kompost + Methanogenese + Pyrolyse (saubere Pflanzenkohle) in die Humuserzeugung übergingen.
Das Wort Terra preta ist heute in aller Munde, zumindest in Vorarlberg ist er zum stehenden Begriff für eine gesunde Humusschicht geworden – ein Produkt ebendieser Transformation in der Landwirtschaft. Für zahlreiche Exkursionsteilnehmende aus aller Welt ist das Verfahren, CO₂ aus der Atmosphäre in den Boden abzuleiten, noch ungewohnt, und auch sie müssen das Narrativ von Gülle, Futterresten und Bioabfällen erst ersetzen mit dem Blick auf die Energieressource und eine regenerative Beständigkeit, Fruchtbarkeit und die Wertschöpfung, die darin enthalten ist.
Vorarlberg bewegt sich seither langsam, aber stetig in eine CO₂-Minus-Bilanz (soll heißen: gut für das Klima). Ausländische Unternehmen staunten nur so, als sogar „THG-Zertifikate vo:üs“ den Weg auf internationale CO₂-Zertifikat-Märkte schafften, sich also das Blatt wendete, wir nicht auswärts bilanziell unseren CO₂Müll „deponierten“ und dafür „Ablass“ bezahlten, sondern wir es für andere taten.
Was geschah mit den Kühen? Sie blieben uns in weniger dichten Wohlfühlherden und-Ställen als Lieblinge erhalten. Unser Käse verdoppelte seinen Handelswert auf globalen Gourmetmärkten. Franzosen kamen wieder unsere Sennereien besuchen.
Das hat natürlich die gesamte Entwicklung noch mehr beschleunigt. Die anfänglich komplizierten Akkreditierungen unserer Bioressourcenparks wurden immer mehr standardisiert und vereinfacht. Auch kleinere Unternehmen und Dienstleister mit kleinen Sprit-Flotten kamen in die Lage, ihre CO₂-Rucksäcke im Riedboden qualitätsgesichert und dauerhaft zu versenken. Bioressourcenparks brachten mit ihren Methan-, Nährstoff und Kohlenstoffsenken praktisch neue Ressourcen und Geschäftsmodelle in Umlauf, grad so, als hätte man ein Ölfeld unterm Hohen Freschen gebohrt …
Und die anderen, die Leute, die sich einbringen wollten? Genau sie waren es, die diese Bioressourcenparks gründeten, so wie auch Bürger:innenkraftwerke und neue Beteiligungsmodelle. Sie wickelten es für ihre Landwirte organisatorisch ab. Organisatorisch, verwaltungstechnisch waren sie einfach stärker. Super Arbeitsteilung also!
* C-Fix: Abkürzung von Kohlenstoff(C)Fixierung.
DAS IMAGE DER LANDWIRTSCHAFT WAR SO HOCH ANGESEHEN WIE NIE ZUVOR – NICHT NUR PRODUZIERTEN SIE GESUNDE HEIMISCHE LEBENSMITTEL UND STEIGERTEN DIE EIGENVERSORGUNG VON 30% IM SOMMER AUF 47% IM WINTER MIT NEUEN GEWÄCHSHÄUSERN.

Biologe Technisches Büro und Beratung für Produkte und Projekte in der Energieund Agrarwende, Bregenz www.energiewenden.at
Mátyás Scheibler
IMAGINE ALL THE PEOPLE LIVING A GOOD LIFE ALL TOGETHER
HDIE ÄRZTIN NIMMT
SICH VIEL ZEIT FÜR
DIE FRAGEN VON HANNA UND ALEX UND ERKLÄRT SEHR AUSFÜHRLICH, WIE UNTERSCHIEDLICH ENTWICKLUNG GRUNDSÄTZLICH VERLAUFEN KANN UND, DASS SIE VOR ALLEM EINE WUNDERVOLLE
TOCHTER NAMENS
LUNA HABEN UND
DIE DIAGNOSE
NUR EIN TEIL
VON IHR IST.
Nicole Klocker-Manser
anna und Alex sind die Eltern von Luna. Luna lebt mit einem seltenen Gendefekt. Die Diagnose bekommen die Eltern als Luna eineinhalb Jahre alt ist. Die Zeit davor war oft von Zweifeln und Ängsten geprägt, warum sich das Mädchen nicht „normal“ entwickeln kann. Die Diagnose ist Erleichterung und Schock zugleich. Die Ärztin, die den Eltern die Diagnose überbringt, ist fachlich sehr kompetent und empathisch. Sie nimmt sich viel Zeit für die Fragen von Hanna und Alex und erklärt sehr ausführlich, wie unterschiedlich Entwicklung grundsätzlich verlaufen kann und, dass sie vor allem eine wundervolle Tochter namens Luna haben und die Diagnose nur ein Teil von ihr ist. Die Eltern sind überwältigt von der Vielzahl an Therapieund Fördermöglichkeiten für Luna, die ihnen eröffnet werden und nehmen gerne den Infofolder für sie als Eltern entgegen. Darin finden sie den Kontakt zu einer unabhängigen Beratungsstelle für Familien mit Behinderungen und Selbsthilfevereinen. Die Beratungsstelle hilft Hanna und Alex bei den Antragsstellungen, die nach der Diagnose notwendig sind und informiert sie über Unterstützungsangebote. Die Perspektiven, die sich in dieser Beratung auftun, geben Hanna und Alex Orientierung und zeigen, dass sich mit einem Kind mit Beeinträchtigung ganz neue Wege auftun.
Das Umfeld reagiert auf Lunas Diagnose mit „Hauptsache geliebt!“. Alle freuen sich über Luna und ihre besondere Art, die Welt zu erobern. Die Großeltern und auch Freund*innen der Familie sind da und helfen mit. Luna verbringt, seit sie ein Jahr alt ist, einmal im Monat ein Wochenende bei ihren Großeltern und einmal die Woche bringt die beste Freundin von Hanna die Kinder ins Bett, damit Alex und Hanna einen Paarabend verbringen können. Das tut allen gut.
Mit zwei Jahren besucht Luna die Spielgruppe gleich bei ihnen um die Ecke. Luna liebt die Spielgruppe. Auch wenn sie nicht überall mitmachen kann, schaut sie den anderen Kindern begeistert zu. Da Alex und Hanna beide berufstätig sind, brauchen sie für Luna an zwei Tagen eine Ganztagesbetreuung. Die Spielgruppe kann das intern regeln. Mittags kommt wer vom Mobilen Hilfsdienst und unterstützt die Gruppe, damit die Mittagssituation für alle Kinder entspannt abläuft. Luna macht enorme Entwicklungsfortschritte in der Spielgruppe. Es sind vielleicht nicht die üblichen Meilensteine, aber für Luna sind es ganz wesentliche Schritte.

Nach der Spielgruppe wechselt Luna in den Sprengelkindergarten. Der Übergang wird mit einem Unterstützungskreis vorbereitet und von allen Beteiligten gut begleitet. Die Therapeut*innen von Luna besuchen anfänglich regelmäßig den Kindergarten, um die Pädagog:innen zu unterstützen. So schreitet Lunas Entwicklung auch im Kindergarten stetig voran. Rosa, Tobias und Greta sind Lunas beste Freunde. Sie haben auch außerhalb vom Kindergarten viel Kontakt. Sie besuchen sich
gegenseitig und haben viel Spaß miteinander. Luna ist bei jeder Party dabei und Freundebücher gestaltet sie mit ihrer Mama besonders toll. Alex und Hanna können offen über Lunas Unterstützungsbedarf mit den Eltern der anderen Kinder sprechen, so dass Besuche von Luna kein Problem sind und wenn es mal notwendig ist, kommen Alex oder Hanna einfach mit.
Beim Einschulungsgespräch in der Sprengelschule zeigt die Schulleitung große Freude über Lunas Schulbesuch ab Herbst. Sie besucht Lunas Kindergarten mehrfach, um den Unterstützungsbedarf der Gruppe besser einschätzen und entsprechend planen zu können. Die pädagogische Beraterin organisiert Anfang Juni einen Unterstützungskreis für den Übergang Kindergarten –Schule. Der ressourcenorientierte Blick aller Anwesenden, die bereits zugesagten guten Rahmenbedingungen und die Definition von Lernen nach dem individuellen Entwicklungsplan für alle Kinder, lassen Freude auf den Schulanfang aufkommen. So steht entspannten Sommerferien nichts im Weg. Seit September besucht Luna mit Rosa, Tobias und Greta die Sprengelschule. Sie sind ein eingeschworenes Team und bei allen Kindern beliebt, da sie immer sehr coole Ideen haben und alle daran teilhaben lassen. Denn wenn alle Spaß haben, ist das überhaupt das Beste. Durch das offene Lernkonzept und die gute Begleitung, die an der Schule gegeben ist, herrscht insgesamt ein gutes Klima. Herausforderungen werden angenommen und gemeinsam gelöst. Es sind wunderbare Schuljahre für alle Kinder. Und auch die Ferienzeiten verbringt Luna ganz selbstverständlich in der Ferienbetreuung, wenn Hanna und Alex arbeiten müssen. Da es in Österreich die gemeinsame Schule gibt, trennen sich die schulischen Wege der vier Freunde erst mit 15 Jahren. Luna besucht mit Tobias eine Oberstufe für Soziales und wählt für sich das Wahlmodul Selbstständigkeitstraining. Rosa entscheidet sich für Grafik&Design und Greta für Naturwissenschaften.
Ein Jahr vor ihrem Schulabschluss macht Luna eine Persönliche Zukunftsplanung (PZP). Diese wird vom unabhängigen Netzwerk PZP moderiert. Alle wichtigen Menschen in Lunas Leben sind mit dabei: Eltern, Großeltern, ihre zwei Geschwister, Pat:innen, Freund:innen, Therapeut:innen, Lehrpersonen, Assistent:innen und die Hilfeplanung vom Land. Es ist ein großartiger Nachmittag und alle sind mit viel Engagement dabei. Es wird gemeinsam überlegt, wie und wo Lunas Weg nach der Schule weitergehen kann. Welche Ziele, Wünsche und Träume sie hat und wie diese erreicht werden können.
Mit 19 schließt Luna die Schule ab. Sie hat nun eine Anstellung bei der Gemeinde über das Arbeitsprojekt Spagat. Sie arbeitet zwei Tage im Sozialzentrum, wo sie dafür zuständig ist, dass die älteren Menschen eine gute Zeit haben. Sie spielt mit ihnen Gesellschaftsspiele, hört zu, nimmt sich Zeit und hilft beim Mittagessen. Einen Vormittag arbeitet sie in einer Gärtnerei und zwei weitere Vormittage in einem Hotel an der Rezeption. Ihre freien Nachmittage verbringt sie ehrenamtlich bei der Jugendgruppe einer Umweltschutzorganisation, sie spielt im örtlichen Sportverein Frisbee und singt im Chor. Gerne besucht sie mit ihren Freund:innen aus dem Selbstständigkeitstraining der Oberstufe den offenen Treff im Ort. Mit ihrem Gehalt leistet sie sich Gesangsstunden, Konzertbesuche und spart auf eine Reise nach Südamerika. Am Wochenende unternimmt sie oft was mit Greta, Rosa und Tobias oder ihren Geschwistern. Wo es notwendig ist, wird sie von einer Freizeitassistenz begleitet.
Der nächste Schritt für Luna ist es zuhause auszuziehen. Dafür organisiert sie gerade mit ihrer Freizeitassistenz eine Persönliche Zukunftsplanung. Sie hat sich mit ihren Eltern bereits ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in der Nähe angeschaut. Das wäre perfekt. Dort gibt es kleine Wohneinheiten und große Gemeinschaftsräume. Die Busanbindung ist ideal. Sie kennt einige Menschen, die dort wohnen. Und wenn Rosa, Greta und Tobias mal zu einer Party kommen, gibt es sogar Gästezimmer. Das klingt doch genial.
You may say I’m a dreamer, but i’m not the only one!
DURCH DAS OFFENE LERNKONZEPT UND DIE GUTE BEGLEITUNG, DIE AN DER SCHULE GEGEBEN IST, HERRSCHT INSGESAMT EIN GUTES KLIMA. HERAUSFORDERUNGEN WERDEN ANGENOMMEN UND GEMEINSAM GELÖST. ES SIND WUNDERBARE SCHULJAHRE FÜR ALLE KINDER.

Mag.a Nicole Klocker-Manser Erziehungswissenschaftlerin, Inkluencerin und Mutter
MEDIZIN DER ZUKUNFT –TRAUM ODER ALBTRAUM?
Otto Gehmacher
Wir schreiben das Jahr 2035. Die Digitalisierung in der Medizin hat eine Entwicklung eingeschlagen, welche das Gesundheitssystem unabhängig von fehlerhaftem menschlichem Verhalten macht. Auch wenn die Fortschritte und Errungenschaften für das Wohl der Gesellschaft unverzichtbar sind, werfen Medizinhistoriker und Ethiker gelegentlich einen nostalgischen Blick zurück in die Vergangenheit.
2025 war das letzte Jahr der sogenannten goldenen frühen 2020iger Jahre. Die Pandemie war überstanden und die Medizin war in Aufbruchstimmung: individuelle Genprofile, zielgerichtete Behandlungen und die ersten Schritte der Roboter Chirurgie verhießen schier unendliche Behandlungsmöglichkeiten.
DIE FOLGE DIESER „MEDIZIN OHNE GRENZEN“ WAR DIE ENTSTEHUNG EINER „LOST GENERATION“ IN DEN SPÄTEN 20IGER JAHREN, DEREN ARBEITSLEISTUNG IN DIE GESUNDHEITSFINANZIERUNG DER BABY BOOMER FLOSS, WAS ZU SOZIALEN UNRUHEN UND AUFSTÄNDEN FÜHRTE.
Noch hatte die KI das ärztliche Gespräch nicht gänzlich abgelöst. Obwohl die Kommunikation mit den Patient:innen vor fachlichen Fehlern strotze, meist empathielos erschien und gelegentlich sogar in emotionalen Ausbrüchen seitens der Ärzt:innen endete, zeigte sich doch mit wieviel Idealismus diese Berufsgruppe ihrer Arbeit nachging.
Ethische Diskussionen über die aktive Sterbehilfe, über soziale Gerechtigkeit, und den Wert des Lebens waren präsent. „Caring Communities“ als Überbegriff für eine Sorgekultur bildeten die Grundlage für ein gegenseitiges „Kümmern“, mit dem Ziel, auch Menschen am Rande der Gesellschaft zu integrieren.
Komplexe Operationen wurden bis ins hohe Alter durchgeführt. Die Verabreichung teurer medikamentöser Therapien war unabhängig von sozialem Status, Gebrechlichkeit oder Rentabilität Scores.
Die Folge dieser „Medizin ohne Grenzen“ war die Entstehung einer „Lost Generation“ in den späten 20iger Jahren, deren Arbeitsleistung in die Gesundheitsfinanzierung der Baby Boomer floss, was zu sozialen Unruhen und Aufständen führte.
Unvorstellbar, dass damals ein Gesetzesentwurf aus Holland, der vorschlug, die „Letzte Wille Pille“ an alle Senior:innen über 75 Jahre gratis zu verteilen (um ihnen die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden) zu hitzigen, emotional ausgetragenen Streitgesprächen führte.
Mittlerweile ist dieses EU-weite Gesetz die Grundlage für soziale Gerechtigkeit und Wohlstand. Über 90% der Bevölkerung entscheiden sich für einen selbstbestimmten Freitod mit 75 Jahren, um der Tatsache zu entgehen, dass für sie keinerlei medizinische Versorgung mehr vorgesehen ist. Somit beugen die Menschen freiwillig einer Zeit der Gebrechlichkeit und des Siechtums, die auf vergilbten Fotos der früheren Altersheime noch deutlich erkennbar sind, vor und leisten einen ehrenwerten Beitrag für die nachrückende Generation.
KI basierte Algorithmen, die aus den Lebenszielen Millionen junger Menschen errechnet werden, bilden die Grundlage dieses Wertesystems. Kombiniert mit dem persönlichen, komplett entschlüsseltem Gencode kann somit mit einer 97% Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden, wann die gesellschaftsrelevante Lebensqualität nicht mehr erreicht werden wird.
Zielwert ist die Pension mit 70 Jahren, und anschließend fünf gute, wohlverdiente Pensionsjahre mit optimaler Gesundheitsversorgung. Durch ein ausgeklügeltes Bonus-Malus-System lassen sich diese Grenzen individuell verschieben. So kann man Lebensmonate mit Anspruch auf medizinische Behandlung durch intensive ehrenamtliche Tätigkeit erwerben, umgekehrt durch Nikotin, Drogen und Alkoholkonsum, mangelnde sportliche Tätigkeit oder Übergewicht verlieren.
Operationen werden nur mehr von KI gesteuerten Robotern durchgeführt. Eine Nutzen- Risikoabschätzung mit Einbezug sämtlicher Lebensdaten hilft, unrentable Operationen, die nicht der Rückkehr zur Vollerwerbstätigkeit dienen, zu vermeiden.
AUFKLÄRUNGSGESPRÄCHE WERDEN VON AVATAREN DURCHGEFÜHRT, DIE IN PUNCTO FACHLICHER EXAKTHEIT, EMPATHIE UND KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEITEN DEN ÄRZT:INNEN VON FRÜHER HAUSHOCH ÜBERLEGEN SIND.
Aufklärungsgespräche werden von Avataren durchgeführt, die in puncto fachlicher Exaktheit, Empathie und Kommunikationsfähigkeit den Ärzt:innen von früher haushoch überlegen sind.
Ist eine häusliche Pflege notwendig, kann der Pflegeroboter nach individuellen Vorlieben programmiert und gestaltet werden: Geschlecht, Alter, Ethnie, Sprache, Kommunikationsstil etc.
Palliative Care, ein Zweig der Medizin der in den frühen zwanziger Jahren geboomt hatte, konnte abgeschafft werden, da durch die Errungenschaften der KI gesteuerten Medizin keine Symptomkontrolle und keine palliative Begleitung mehr nötig sind. Letzte Palliativpfleger:innen sind noch in den sogenannten Freitodhäusern zu finden, wo sie sterbewilligen Menschen „Letzte Wünsche“ erfüllen. Philosophen und Theologen argumentieren, dass Krankheit und Leid einen persönlichen Reifeprozess bewirken können und somit einen elementaren Teil des Menschseins darstellen. Andere vermuten, dass hinter der Verklärung der 2020iger Jahre eine gewisse menschliche Sehnsucht nach Zufällen, Unzulänglichkeiten, und nicht vorhersehbaren Wendungen steckt. Die Sehnsucht an ein Zeitalter, in dem ungenaue Prognosen der „Hoffnung bis zuletzt“ Platz ließen, ein Zeitalter, in dem soziale, kulturelle und spirituelle Aspekte in der Medizin noch berücksichtigt wurden.

Dr. Otto Gehmacher Oberarzt Palliativstation Hohenems www.palliative-care-vorarlberg.at

Eva Lingg-Grabher
ENKELTAUGLICH! EIN QUARTIER IN VORARLBERG 2045
Für den Blick in die Zukunft schaue ich zuerst einmal 20 Jahre zurück. 2004 startete das Projekt Vision Rheintal. In einem zweijährigen Prozess entstand ein Leitbild zur räumlichen Entwicklung und der regionalen Kooperation im Rheintal. In der Umsetzungsphase wurde versucht, die Vision ins Konkrete zu bringen – etwa durch das Denken in „Quartieren“: als alltagsnaher Maßstab für die Menschen, als praktikable Ebene für die Planung. Ob nun im ländlicheren Raum auf der noch grünen Wiese oder im ehemaligen Industriegebiet – Quartier ist da wie dort ein guter Maßstab. Es wurden Denkanstöße entwickelt – vom Erkennen von Potenzialen und Vielfalt über den Umgang mit Zwischenräumen bis zur Frage, wie Wandelbarkeit gelingen kann. Das „Quartier“ übrigens, mittlerweile auch in Vorarlberg ein gängiger Begriff, war Anfang der 2000er als Begriff hier noch nicht etabliert. Man kannte das eher aus Wien (Gräzl), Hamburg oder Berlin (Kiez).
Ich selbst durfte an der einen oder anderen Stelle mitwirken. Wie haben unsere Visionen und Denkanstöße gewirkt? Wie wird es sein in 20, 40 Jahren? In welchen Quartieren leben wir als Ältere, unsere Kinder als Erwachsene, unsere Enkel – und jene, die neu hierherziehen?
Ich stelle mir vor, ich wohne in einem dieser Quartiere – irgendwo zwischen Bodensee und Arlberg. Es ist das Jahr 2045. Es gibt Wohnungen für verschiedene Lebenslagen und Lebensmodelle – für junge Menschen, für Alleinerziehende, für Ältere. Eigentum ist nicht mehr die einzige Lösung. Miete ist sicher. Genossenschaft ist erprobt. Einst noch neue Wohnformen sind kein Experiment mehr, sondern Alltag. Wohnen ist hier leistbar. Die Preise haben sich stabilisiert, weil rechtzeitig gegengesteuert wurde: mehr gemeinnütziger Wohnbau, aktiviertes Bauland, neue Finanzierungsmodelle.
Ich sehe Kinder, es gibt viel Grün und Spielplätze. Nicht alles ist durchprogrammiert. Ein gut gestalteter Quartiersplatz ist belebt – mal wird er für ein Fest genutzt, mal verkauft wer was, er ist Treffpunkt ohne Programm. Es gibt Sitzgelegenheiten, große Schattenbäume, Wasserflächen. Jugendliche sind sichtbar, sie dürfen hier sein, haben ihre Räume, können mitbestimmen. Gutes Aufwachsen ist möglich – es gibt eine Kinderbetreuung in der Nähe, der Kindergarten ist zu Fuß erreichbar. Die Gemeinsame Schule sorgt

Ich sehe auch ältere Menschen, den Alltag bewältigen viele noch selbstständig, zum Teil werden sie schon betreut. Im Außen gibt es bequeme, schattige Sitzmöglichkeiten. Die gemeinschaftlich genutzten Räume werden aktiv bespielt – mal organisiert, mal spontan. Natürlich gibt es auch Spannungen unter Nachbar:innen. Aber es gibt jemanden, der hilft: Der Community Manager kennt die Leute, organisiert ein wöchentliches Café, vermittelt bei Bedarf.
Die alten „Lädele“, wie wir sie früher kannten, gibt’s nicht mehr – Onlinehandel und große Einkaufszentren haben sie verdrängt. Aber die Läden stehen nicht leer: Heute findet man dort eine kleine Fahrradwerkstatt, ein Lern-Café, eine Eltern-Kind-Gruppe oder eine Ausstellung der Schule. Nicht alles ist direkt im Quartier – und das ist in Ordnung. Vieles spielt sich im nächsten Zentrum ab. Der Alltag funktioniert hier aber, das Wichtigste ist nah, praktisch, belebt.
ICH SEHE KINDER, ES GIBT VIEL GRÜN UND SPIELPLÄTZE. NICHT ALLES IST DURCHPROGRAMMIERT. EIN GUT GESTALTETER QUARTIERSPLATZ IST BELEBT – MAL WIRD ER FÜR EIN FEST GENUTZT, MAL VERKAUFT WER WAS, ER IST TREFFPUNKT OHNE PROGRAMM. ES GIBT SITZGELEGENHEITEN, GROSSE SCHATTENBÄUME, WASSERFLÄCHEN. JUGENDLICHE SIND SICHTBAR, SIE DÜRFEN HIER SEIN, HABEN IHRE RÄUME, KÖNNEN MITBESTIMMEN.
Die Wege sind generell kurz, zu Fuß oder mit dem Rad, man nimmt gerne den Bus oder Zug. Der öffentliche Verkehr ist zuverlässig, die Takte sind dicht, Radwege gut geführt. In einer nahen Garage parken die Autos. Die Straßen sind nicht mehr nur Verkehrsräume, sondern öffentliche Räume. Sicher zu Fuß und mit dem Rad, attraktiv für die Kleinsten, klimafit ausgestattet.
Aufgrund klammer Gemeindefinanzen in den 2020ern gab es ein Umdenken: Räume und Flächen werden mehrfach genutzt, vom Gemeinschaftsraum über den Fußballplatz bis zur Vereinshalle. Eine Kümmererin sorgt für eine optimale Belegung der Räume.
Nicht alles im Quartier ist neu gebaut worden. Vieles wurde umgenutzt, umgebaut. Ein Teil der Fassaden und sogar die Küche im Gemeinschaftsraum stammen aus dem Bauteillager, das es seit einigen Jahren in Vorarlberg gibt. Einige Nutzungen sind erstmal auf Zeit, man probiert mal was aus. Aneignung ist erlaubt, nicht alles wird reglementiert. Das Unfertige auszuhalten hat ein wenig Übung gebraucht. In Vorarlberg war man es lange gewohnt, dass alles „suber“, „ufgrummt“ und „ghörig“ sein muss. 2045 gilt: Räume müssen aneigenbar sein, wandelbar, offen für unterschiedliche Nutzungen.
Dafür ist einiges passiert: Leerstand wurde aktiv angegangen. Baulandreserven wurden mit klaren Regeln mobilisiert. Das Bauen im Bestand hat Vorrang bekommen, es wurde gefördert und eingefordert. In der Bevölkerung wurde das Bewusstsein für neue Wohnformen gestärkt – nicht über Kampagnen, sondern über das Zeigen guter Praxis. Es gibt andere Optionen zum Wohnen als das Einfamilienhaus oder die Wohnung im „Blöckle“. Es gab Eigentümer:innen von Liegenschaften, die mitgemacht haben und offen waren für Neues. Und es gibt eine Sensibilität bei Planung und Politik für die Lebensrealitäten der Menschen in Vorarlberg. Was sie brauchen. Was sie sich leisten können. Ein enkeltaugliches Quartier entsteht nicht von selbst. Es wird gemacht –Schritt für Schritt, mit vielen Beteiligten, die planen, bewohnen, sich einbringen. Der Schriftsteller Robert Musil schrieb 1952: „Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, dann muss es auch einen Möglichkeitssinn geben.“ Musil beschreibt den Möglichkeitssinn als die Fähigkeit, sich nicht nur mit dem abzufinden, was ist, sondern offen zu bleiben für das, was sein könnte – ohne die Wirklichkeit zu verdrängen. Vielleicht ist das eine gute Orientierung für die Quartiere der Zukunft: Dass sie nicht alles vorwegnehmen, sondern etwas offenlassen. Dass sie Wandel aushalten. Und dass sie Menschen ermutigen, sich einzubringen.

Eva Lingg-Grabher Planerin und Raumforscherin www.raumlink.at
VIELFALT VERBINDET
Als ich gefragt wurde, ob ich eine Utopie für Vorarlberg schreiben möchte, sagte ich sofort ja. Nicht, weil ich eine perfekte Lösung parat habe, sondern weil in mir eine Sehnsucht aufflammt. Ich spürte das Bedürfnis, meine Wünsche auszusprechen, nicht nur für mich, sondern für viele. Für alle, die hier leben und trotzdem immer wieder spüren: Wir sind dabei, aber nicht gemeint.
FÜR ALLE, DIE HIER LEBEN UND TROTZDEM IMMER WIEDER SPÜREN: WIR SIND DABEI, ABER NICHT GEMEINT.
Meine Utopie ist kein idealistischer Rückzug, sondern ein realistischer Entwurf für ein anderes Jetzt. Sie beginnt dort, wo oft über andere gesprochen wird, aber zu selten mit ihnen. Und ja, sie richtet sich auch an jene, die politische Verantwortung tragen. An jene, die meinen, Probleme entstünden durch die Sichtbarkeit von Minderheiten statt durch deren systematische und institutionelle Benachteiligung. An jene, die lieber Schuldige suchen als Lösungen.
Ich stelle mir ein Vorarlberg vor, in dem sich niemand rechtfertigen muss, nicht für seinen Namen, seine Hautfarbe, seine Herkunft oder seine Religion. In dem Zugehörigkeit nicht an Akzent, Kleidung, Mülltrennung oder Papiere geknüpft ist, sondern am Mitgestalten und Mitfühlen gemessen wird. In dem niemand gefragt wird: „Woher kommst du wirklich?“, sondern: „Was brauchst du, um hier gut zu leben?“ Ich wünsche mir eine Politik, die schützt statt abschreckt.
Die Menschen nicht in Kategorien presst, sondern ihnen Raum zum Leben gibt. Wo Ankommen nicht Warten heißt, sondern Teilhaben. Weil Schutz ein Recht ist und kein Privileg.
Ein Vorarlberg, das Gleichstellung nicht als Ausnahme duldet, sondern als Selbstverständlichkeit gestaltet, in der Politik, am Arbeitsplatz, im Elternhaus. In dem Väter Elternzeit nehmen können, ohne belächelt zu werden. In dem Mütter arbeiten, ohne sich erklären zu müssen. In dem Frauen das Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper, ihre Geburten und ihre Reproduktionsentscheidungen haben, ohne dass andere meinen, sie müssten sie an den moralischen Pranger stellen und ihnen absichtlich (!) Schuld, Trauer oder psychische Gewalt auferlegen.
Ich wünsche mir eine Bildungspolitik, die nicht nur verwaltet, sondern befähigt.
Eine, die endlich Formate zulässt wie jene zur Demokratieförderung und politischem Verständnis, diskriminierungssensiblen Unterricht, schon in den Volksschulen und eigentlich schon im Kindergarten. Eine Bildung, die vermittelt, was es heißt, miteinander zu leben, in einer gelebten Nachbarschaft. Die das Potenzial von Mehrsprachigkeit erkennt, statt sie als Defizit zu behandeln. In der Kinder nicht vorsortiert werden, nach Noten, Pass, Meldeanschrift etc. sondern in ihrer Individualität gefördert werden. Ich wünsche mir Schulhöfe, in denen Vielfalt gelebt und Diskriminierung klar benannt wird. Wo Lehrpläne durchdrungen sind von feministischen, antirassistischen, antisemitismuskritischen und antidiskriminierenden Perspektiven.
Meine Utopie ist intersektional. Sie erkennt Diskriminierung und wirkt nie isoliert. Eine Frau wird anders bewertet und behandelt als ein Mann. Eine schwarze Mutter anders behandelt als eine weiße. Und trotzdem – alle haben das gleiche Recht auf Würde, Sicherheit und Sichtbarkeit. Das muss sich auch in Vorarlbergs Verwaltungen, Kliniken, Medienhäusern und Rathäusern widerspiegeln, nicht nur in Symbolpolitik, sondern in konkreten Zugängen und Strukturen.
Ich wünsche mir Betreuungseinrichtungen, die kulturelle und familiäre Vielfalt mitdenken. Ich wünsche mir, dass Eltern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, als Partner:innen gesehen werden, nicht als Problemfälle. Dass Genderfragen, queere Lebensrealitäten und Behinderungen keine Randthemen sind, sondern selbstverständlicher Bestandteil jeder pädagogischen und sozialen Ausbildung.

Ich träume von einem Vorarlberg, in dem Rassismus und Antisemitismus ernst genommen werden. In dem es keine verstohlenen Blicke mehr braucht, wenn jemand „Ramadan“ sagt. In dem sich niemand für die Sprache seiner Eltern entschuldigen muss. In dem schwarze Frauen nicht automatisch für „Integrationsthemen“ zuständig sind, sondern ganz selbstverständlich über Kultur, Stadtentwicklung oder Verkehrspolitik sprechen.
DASS GLEICHBERECHTIGUNG UND -STELLUNG KEINE BEDROHUNGEN SIND, SONDERN DIE VORAUSSETZUNG FÜR EIN FRIEDLICHES ZUSAMMENLEBEN. VORARLBERG IST MEHR ALS SEIN ÄUSSERES ERSCHEINUNGSBILD. ES IST EIN LEBENSRAUM FÜR VIELE.
Ich wünsche mir Mobilität, die gerecht ist. Ich wünsche mir, dass Kinder sicher zur Schule kommen – ohne dass morgendliche Landstraßen zur Gefahr werden. Ich wünsche mir eine Stadtentwicklung, die inklusiv denkt – barrierefrei und menschenfreundlich.
Und ich wünsche mir eine politische Kultur, die Verantwortung übernimmt.
Eine, die Antisemitismus nicht verharmlost. Die Queerfeindlichkeit nicht duldet. Die Rassismus nicht relativiert und so vieles mehr. Diese Utopie ist feministisch, weil sie gerechte Verhältnisse für alle Geschlechter einfordert. Sie fragt: Wer profitiert, wenn andere dauerhaft ausgeschlossen bleiben?
Sie ist antirassistisch, weil sie erkennt, wie tief Diskriminierung in Strukturen eingeschrieben ist, auch hier in Vorarlberg. Und sie ist realistisch. Sie beginnt im Zuhören, im Hinsehen, im Widersprechen. Sie beginnt bei der Anerkennung, dass jede:r ein Recht auf Selbstverwirklichung hat. Dass eine Gesellschaft nur dann stark ist, wenn sie auch ihre vermeintlich Schwächsten schützt. Dass Gleichberechtigung und -stellung keine Bedrohungen sind, sondern die Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben. Vorarlberg ist mehr als sein äußeres Erscheinungsbild. Es ist ein Lebensraum für viele.
Diese Utopie beginnt nicht irgendwann. Sie beginnt jetzt. In Klassenzimmern, Kindergärten, Landtagssitzungen, Redaktionsstuben, Bewerbungsgesprächen etc..
Vielleicht ist meine Utopie nicht fertiggedacht und keine, die je vollkommen Wirklichkeit wird. Aber sie kann und ist zumindest für mich mein persönlicher Maßstab. Und vielleicht, ganz vielleicht, schreiben wir sie dann irgendwann gemeinsam weiter.

Lisabell Semia Roth, BSc Arch Politische Bildnerin in der Jugend- und Erwachsenenbildung mit Schwerpunkt auf Rassismus & Antisemitismus
Lisabell Semia Roth
NICHT BESITZEN, SONDERN NUTZEN
Wie der Vorarlberger Bausektor heute aussehen würde, wenn schon gestern die richtigen politischen Entscheidungen dafür getroffen worden wären. Hubert Rhomberg, CEO der Rhomberg Gruppe, formuliert ein fiktives Interview
GEBÄUDE WIE
SCHULEN, PFLE-
GEHEIME ODER WOHNANLAGEN
WERDEN ALS SKALIERBARE
PRODUKTE
GEPLANT UND GEBAUT. DURCH
DIESEN WANDEL WURDEN
DIE BAUZEIT
HALBIERT, DIE KOSTEN
GESENKT UND DIE QUALITÄT
GESTEIGERT.
Wir brauchen einen Systemwechsel“, forderte Hubert Rhomberg zu Beginn des Jahrhunderts. Heute ist dieser in Vorarlberg quasi vollzogen, an vielen Stellen und in umgesetzten Projekten bereits Realität. Die Region hat sich vom „Beton der Vergangenheit“ gelöst, setzt konsequent auf ein ressourcenschonendes, intelligentes Bauen – und hat damit eine Vorreiterrolle im DACHRaum eingenommen. „Gebäude müssen wie Produkte funktionieren, nicht wie Abenteuer“, so Rhomberg. „Das Prinzip lautet: nicht besitzen, sondern nutzen – modular, digital vernetzt und nachhaltig.“
Die Politik hat den Wandel aktiv unterstützt und Vorarlberg zur Modellregion für eine neue Baukultur gemacht. Innerhalb weniger Jahre entstand ein neues System mit klar definierten Bauprodukten und zertifizierten Anbietern dieser Produkte und Bauleistungen, die sich alle auf einer nutzerfreundlichen, zentralen Plattform versammelt haben. Die Wertschöpfung ist regional verankert, d.h., die Bauprodukte werden von den Schreinereien und Handwerkern vor Ort und mit heimischen Materialien produziert.
„Das passiert, wenn politische Vision auf unternehmerische Umsetzungskraft trifft“, sagt Rhomberg heute. „Was vorher als unmöglich galt, ist nun erlebbar: schneller, besser und günstiger bauen – mit mehr Sinn.“ Gebäude wie Schulen, Pflegeheime oder Wohnanlagen werden als skalierbare Produkte geplant und gebaut. Durch diesen Wandel wurden die Bauzeit halbiert, die Kosten gesenkt und die Qualität gesteigert. „Wenn ich heute eine Immobilie bestelle, weiß ich genau, was ich bekomme“, erklärt Rhomberg. „Ich stelle mir auf der zentralen Plattform mein Wunschprojekt per Mausklick am Rechner zusammen – Größe, Ausstattung, technologische Features und nach neun Monaten kann ich einziehen.“

Politische Hebel wurden gesetzt
Das Land hat Genehmigungsverfahren für Typenbauten vereinfacht, Produktstandardisierung erlaubt und Innovationspartnerschaften gefördert. Die Online-Plattform ermöglicht Gemeinden den einfachen Zugriff auf geprüfte Lösungen. Regionale Wertschöpfung bleibt dabei zentraler Bestandteil. Rhomberg betont: „Endlich ist es egal, ob eine Wand in Feldkirch, in Lustenau oder sogar in München steht. Wenn sie einmal genehmigt wurde, gilt das überall. Das spart Zeit, Nerven und Geld.“
Die öffentliche Hand verzichtet mittlerweile größtenteils auf klassische Ausschreibungen im Hochbau. Stattdessen wurden Zielkostenmodelle und Partnerschaftsverträge zum Regelfall. Gemeinden arbeiten mit vertrauensvollen Partnern zusammen und profitieren von Planungssicherheit. „Wir haben die Branche von innen nach außen gedreht. Heute ist nicht mehr der billigste Anbieter gefragt, sondern der fairste Partner,“ so Rhomberg.
Streitfreie Baustellen und motivierte Teams
Der systemische Wechsel hat die Streitkultur der Vergangenheit abgelöst. Mit fertig geplanten, digitalen Modellen und klaren Abläufen herrscht heute Koordination statt Konfrontation auf den Baustellen. „Wir schicken keine Bauleiter mehr in juristische Grabenkämpfe“, sagt Rhomberg. „Wir arbeiten miteinander statt gegeneinander. Das hat die Stimmung und die Qualität dramatisch verbessert.“ Junge Talente kommen wieder gerne in die Branche.
Digitalisierung als Fundament des Erfolgs
Digitale Zwillinge, 5G-Netze und KI-gesteuerte Plattformen sind heute auf den meisten Vorarlberger Baustellen Standard. Selbstverwaltete Gebäude informieren ihre Eigentümer über Wartungsbedarfe oder erledigen automatisiert die Vermietung. Standardmodule mit integriertem Betriebssystem sind in der Serienproduktion. Rhomberg: „Das Haus weiß heute mehr über sich selbst als der Hausmeister früher. Und es spricht mit dir. Wenn der Lift steht, ruft das Haus automatisch den Monteur.“

Die gebaute Umwelt in Vorarlberg ist heute rückbaubar, integral geplant und kreislauffähig. Holz-Hybrid-Konstruktionen dominieren. Mängel und Nachträge sind selten, Deponien überflüssig geworden. Planungskosten sind stark gesunken. Nachhaltigkeit ist kein Add-on mehr, sondern Grundbedingung.
Ein europäisches Vorbild
Dieses Vorarlberger Modell zieht weite Kreise: Inzwischen wird ein relevanter Anteil am Wohnbau in der DACH-Region auf diese Weise realisiert. Wichtig: Dafür wurde das Wissen exportiert, nicht die Bauleistung als solche! Die regionale Wertschöpfung blieb erhalten, während gleichzeitig europäische Standards mitgestaltet wurden. Rhomberg: „Wir exportieren nicht Wände, sondern Wissen. Das ist der eigentliche Wert der Plattformidee.“
Die Baukultur in Vorarlberg ist heute geprägt von Vertrauen, Kooperation und geteiltem Wissen. Der Systemwechsel ist gelungen – auch weil man nicht mehr vom Mangel, sondern vom Möglichkeitsraum ausgeht. Was als Idee begann, ist Realität geworden: Vorarlberg zeigt, wie Zukunft gebaut wird – ressourcenschonend, digital, menschlich. Der politische Rückenwind war der entscheidende Hebel. Wie Hubert Rhomberg einst voraussagte: „Wenn der Kunde das einmal erlebt hat, will er nie wieder zurück.“
So wird die Vision zur Wirklichkeit
1. Mitbewerber: Mittelstandsunternehmen suchen die Partnerschaft im System. Sie profitieren dann vom geteilten Know-how und können ihre Produktivität steigern, ohne ihre Identität zu verlieren.
2. Politik: Standards harmonisieren, Genehmigungen vereinfachen und Investitionen in digitale Plattformen forcieren – dann wird Europa Vorarlberg als Innovationsmotor im Bauwesen sehen.
3. Planer:innen: Architekturbüros fokussieren sich wieder mehr auf Gestaltung und nutzen bestehende Systemlösungen. Ingenieurbüros profitieren dann ebenfalls von klaren digitalen Modellen und effizienteren Abläufen.
DIE GEBAUTE UMWELT IN VORARLBERG IST HEUTE RÜCKBAUBAR, INTEGRAL GEPLANT UND KREISLAUFFÄHIG. HOLZ-HYBRID-KONSTRUKTIONEN DOMINIEREN. MÄNGEL UND NACHTRÄGE SIND SELTEN, DEPONIEN ÜBERFLÜSSIG GEWORDEN. PLANUNGSKOSTEN SIND STARK GESUNKEN. NACHHALTIGKEIT IST KEIN ADD-ON MEHR, SONDERN GRUNDBEDINGUNG.

Hubert Rhomberg CEO der Rhomberg Gruppe www.rhomberg.com
©
Stefan
Joham
Hubert Rhomberg
WORUM ES MEISTENS GEHT
IPeter Mennel
n Beziehungen, Begegnungen und Gesprächen gesehen, verstanden und ernst genommen zu werden sowie Sicherheit, Geborgenheit und Verbundenheit zu spüren sind menschliche Grundbedürfnisse über alle Zeiten, in allen Kulturen, in allen Altersstufen. Einerseits erfahren wir in ihrer Erfüllung tiefe Freude, andererseits leiden wir als Einzelne und als Gesellschaft, wenn wir sie verfehlen, einander verwehren und immer wieder darum kämpfen müssen. Aufgrund der Sehnsucht nach ihrer Erfüllung, der Angst vor ihrer Verwehrung und der Erfahrung von diesbezüglichen Kränkungen blasen wir unser Ego auf und handeln und kommunizieren „böse“ – das Wort entstammt der indoeuropäischen Wurzel „Bhou“: aufblasen.
Meine Vision ist, dass sich eine Haltung etabliert hat, die eine wertschätzende, empathische und offene Kommunikation lebt.
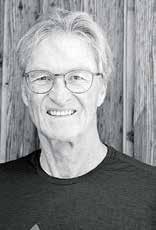
Diese Haltung wird in den verschiedenen Kontexten angeboten und gepflegt – zum Beispiel durch dialogische Gesprächsformen wie den Kreisdialog, durch Dyaden, durch Praktizieren der Gewaltfreien Kommunikation.
Der Kreisdialog nach David Bohm und Martin Buber eröffnet als Alternative zu frustrierenden Diskussionen, in denen es ums Gewinnen, Rechthaben und den Kampf um das Wort geht, einen Raum, der uns ermöglicht, zuzuhören, ruhiger und tiefer zu denken. Im gegenseitigem Respekt miteinander Neues zu erforschen und einen Sinn zu entdecken, der uns verbindet. Die Dyaden sind eine besondere Form von Zweiergesprächen, sie schaffen einen erweiterten Raum für bewusstes Wahrnehmen und Erforschen unserer Empfindungen, Gedanken und Gefühle, in tieferer Verbundenheit mit uns selbst und mit dem Anderen. Die Haltung und Praxis der Gewaltfreien Kommunikation lehrt uns, die Gefühle als Hinweise auf unsere Bedürfnisse zu verstehen, die unser Menschsein zutiefst prägen und deren Erfüllung inneren und äußeren Frieden und tiefe Freude fördert.

Impressum
Grundlegende Richtung
Die Straßenzeitung marie versteht sich als Sprachrohr für die Anliegen von Randgruppen unserer Gesellschaft. marie ist ein Angebot zur Selbsthilfe für Menschen an oder unter der Armutsgrenze, die ihren Lebensmittelpunkt in Vorarlberg haben. Ziel ist die Förderung des Miteinanders von Menschen am Rande der Gesellschaft und der Mehrheitsgesellschaft. Die Hälfte des Verkaufspreises von 3,40 Euro verbleibt den Verkäufer:innen. marie ist ein parteiunabhängiges, soziales und nicht auf Gewinn ausgerichtetes Projekt.
Redaktion
marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung, Graf-Maximilian-Straße 18, 6845 Hohenems Telefon: 0677 615 386 40, eMail: redaktion@marie-strassenzeitung.at Internet: www.marie-strassenzeitung.at Redaktion: Frank Andres, Simone Fürnschuß-Hofer, Daniela Egger
Mitarbeiter:innen dieser Ausgabe: Hildegard Breiner, Hubert Rhomberg, Brigitta Soraperra, Nicole Klocker, Isabella Natter-Spets, Isabelle Goller, Eva Lingg-Grabher, Lisabell Semia Roth, Otto Gehmacher, Eva Häfele, Matyas Scheibler, Michael Schiemer, Martin Strele, Josepha Yen, Gabi Hampson, Peter Mennel, Simon Vetter, Günther Rösel
Zeitungsausgabestellen:
Dornbirn Kaplan Bonetti Sozialwerke, Kaplan-Bonetti-Straße 1, Montag, Mittwoch und Freitag von 7.15 bis 9 Uhr Bregenz: dowas, Sandgrubenweg 4, Montag bis Freitag: 8.30 bis 13 Uhr Feldkirch Caritas-Café, Wohlwendstraße 1, Montag bis Freitag 8.30 bis 14 Uhr
Bludenz do it yourself, Kasernplatz 5-7/3b, Montag und Donnerstag 9 bis 11.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Dienstag 13 bis 14.30 Uhr, Freitag 9 bis 11.30 Uhr und 13 bis 14 Uhr
Anzeigen
Kontakt: anzeigen@marie-strassenzeitung.at Medieninhaber und Herausgeber Verein zur Förderung einer Straßenzeitung in Vorarlberg, ZVR-Zahl 359044778, 6833 Klaus, eMail: redaktion@marie-strassenzeitung.at Vorstand
Frank Andres, Obmann, Christina den Hond-Vaccaro, Obmann-Stellvertreterin, Schriftführerin, Oliver Mössinger, Kassier Gabriele Hörl-Anselmi, Daniel Mutschlechner
Druck: Russmedia Verlag GmbH, Schwarzach
Auflage: 8.000 Exemplare, Erscheinungsweise monatlich Layout/DTP/Bildbearbeitung
:TAGWERK Grafik|Design Monika Dür Bankverbindung & Spendenkonto
Raiffeisenbank im Rheintal, IBAN: AT94 3742 0000 0648 3580, BIC: RVVGAT2B420
© 2025 marie. Alle Rechte vorbehalten.
Inserat halbe Seite hoch
Bezahlte Anzeige
Peter Mennel Lehrer; dipl. Paar-, Familienund Lebensberater
WAS FÜR EIN LAND
Martin Strele
Schön ist es geworden. Mitte der 2020er Jahre hat die Bauwirtschaft kaum mehr neue Häuser errichtet. Die meisten Bauträger haben sich auf die Sanierung von Gebäuden spezialisiert. Das ist viel Arbeit. Darum arbeiten nicht weniger, sondern mehr Menschen in diesem Bereich. Für etwas weniger Lohn zwar, aber dafür sind die Kosten fürs Wohnen in Vorarlberg die niedrigsten in ganz Österreich. Der Leerstand ist verschwunden. Die alten Häuser sind wieder bewohnt. Die Mieten sind niedrig, das Vermieten aber ein schwieriges Geschäft geworden. Darum sind viele Häuser auf den Markt gekommen und zu erschwinglichen Preisen verkauft worden. Ein Land der Eigentümer und Eigentümerinnen halt, so kennt man Vorarlberg.
WARUM IST DAS SO GEKOMMEN? NACH AUSSEN SIEHT ALLES WIE FRÜHER AUS, NUR BESSER. ABER EIN BLICK INS GRUNDBUCH ZEIGT, WAS EIGENTLICH PASSIERT IST. JEDES GRUNDSTÜCK IN GANZ VORARLBERG HAT DENSELBEN EIGENTÜMER. DIESER NEUE EIGENTÜMER JEDER EINZELNEN GRUNDPARZELLE IN VORARLBERG IST DIE GEMEINNÜTZIGE BÜRGERINNEN- UND BÜRGERSTIFTUNG VORARLBERG.
DER LEERSTAND IST VERSCHWUNDEN. DIE ALTEN HÄUSER
SIND WIEDER BEWOHNT. DIE MIETEN SIND NIEDRIG, DAS VERMIETEN ABER EIN SCHWIERIGES GESCHÄFT GEWORDEN.
DARUM SIND
VIELE HÄUSER
AUF DEN MARKT GEKOMMEN UND ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN VERKAUFT WORDEN. EIN LAND DER EIGENTÜMER UND EIGENTÜMERINNEN HALT, SO KENNT MAN VORARLBERG.
Viele der früher unbebauten Grundstücke in den Zentren unserer Gemeinden sind jetzt bebaut. Familien leben in Ein- und Mehrfamilienhäusern, ältere Menschen in barrierefreien Wohnungen, in denen sie Betreuung je nach ihren Wünschen in Anspruch nehmen können. Nicht alle Häuser wurden saniert. Gebäude in schlechtem Zustand und außerhalb unserer Siedlungen wurden abgerissen. Unsere Dörfer und Gemeinden beginnen, einen klaren Rand zu den umgebenden Freiflächen zu bekommen.
Die Unternehmen sind dort zu finden, wo sie am besten hinpassen. Fabriken neben Einfamilienhäusern gibt es keine mehr. Leere Hallen und hektarweise schlecht genutzte Parkplätze und Lagerflächen für allerlei Stahlplatten, Schrott und Baumaterial sind heute gut genutzt, mehrstöckig überbaut. Entlang der Straßen in unseren Dörfern und Gemeinden sind die Erdgeschoss-Zonen mit Büros und Geschäftslokalen gut ausgelastet. Niemand muss mehr an der Landesstraße im Erdgeschoss wohnen.
Die Leute sind fleißig, engagiert in Vereinen, helfen sich gegenseitig und – vor allem –blicken optimistisch in die Zukunft. Ein wenig wie das Bilderbuchvorarlberg der 1950 und 60er Jahre. Dazu aber weltoffen, tolerant, mutig und wissbegierig. Warum ist das so gekommen? Nach Außen sieht alles wie früher aus, nur besser.
Aber ein Blick ins Grundbuch zeigt, was eigentlich passiert ist. Jedes Grundstück in ganz Vorarlberg hat denselben Eigentümer. Dieser neue Eigentümer jeder einzelnen Grundparzelle in Vorarlberg ist die gemeinnützige Bürgerinnen- und Bürgerstiftung Vorarlberg. Die Stiftung wurde Ende der 20er Jahre gegründet, gleich nach dem richtungsweisenden Entscheid aller Bürgerinnen und Bürger, dass mit dem Jahr 2080 kein privates Grundeigentum mehr in Vorarlberg möglich ist. Dass sämtliches Grundeigentum an die Vorarlberg-Stiftung übertragen wird. Eine Stiftung, die uns allen gehört.
Sie hat ihren Sitz in Bregenz. Da, wo früher der Landtagssaal war. Eine Zeit lang war dort eine Bank. In jeder unserer 96 Gemeinden gibt es einen Ansprechpartner, in einigen Gemeinden sitzen mehrere Leute. Das, was früher die Raumplanung war, wird heute von der Stiftung erledigt. Die Stiftung vergibt nämlich Nutzungsrechte an Grundstücken an Bürgerinnen und Bürger und Menschen, die hier leben. An Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe.
Wer früher ein Haus hatte, dem gehört das weiterhin. Wer es vermietet oder bewohnt – also eine Nutzung dafür hat, bekommt von der Stiftung auch ein Nutzungsrecht. Wer keinen Nutzen hat – weil das Haus leer ist, die Wohnung schlecht genutzt, wer eine Halle hat, aber keine Firma mehr darin arbeitet, der verliert das Nutzungsrecht. Der kann sein Haus dann an jemanden verkaufen, der eins braucht. Oder zu einem vernünftigen Preis an die Stiftung abtreten.
Wer Gemüse anbauen will, der bekommt ein passendes Nutzungsrecht. Bauern erhalten so viel Fläche, wie sie für ihre Bewirtschaftung brauchen. Wer nicht mehr Landwirtschaft betreibt, verliert das Nutzungsrecht. Das Land wird dann neu aufgeteilt und an aktive Landwirte verpachtet.
Die Gründungsphase war nicht einfach. Verständlicherweise waren die Eigentümer von Grund und Boden anfangs schockiert und überhaupt nicht bereit, ihre Grundstücke abzugeben. Die Grundidee, nachdem sie 2025 das erste Mal formuliert wurde, wurde verlacht, verunglimpft und mit allen Mitteln bekämpft.
Es war ein Vorschlag einer Gruppe von vorausschauenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, der dann den Ausschlag gab: Die Umsetzung der Idee sollte einfach 50 Jahre verzögert erfolgen. Alle Besicherungen von Krediten im Grundbuch wären bis dann getilgt, viele Eigentümerinnen und Eigentümer bereits nicht mehr am Leben. Die Phase bis dorthin wurde begleitet von intensivem Austausch mit allen Bürgerinnen und Bürgern in allen Gemeinden. Es wurde gestritten, Konzepte wurden erarbeitet, wieder verworfen, Studien gemacht, Veranstaltungen organisiert. Die Bauern waren ein harter Brocken. Verständlich. Grund und Boden ist die Lebensgrundlage der Landwirtschaft. Wo kommen wir da hin, wenn jemand anders über diese Grundlage verfügt? Eine Gruppe von jungen Landwirten organisierten in der Landwirtschaftsschule Veranstaltungen und holten nach und nach ihren Berufsstand ab. Vor allem zeigten sie, dass schon damals mehr als 2/3 des gesamten landwirtschaftlichen Grundes eben nicht im Eigentum von Landwirten war. Und sie zeigten auf, wie die nichtlandwirtschaftlichen Eigentümer immer mehr spekulierten auf den Bau neuer Betriebsgebiete und Siedlungen, wie die Preise für landwirtschaftlichen Boden in die Höhe schnellten und sie selbst völlig an den Rand gedrängt wurden.
Entscheidend war dann, dass im großen Kreis vereinbart wurde, dass die landwirtschaftlich nutzbare Fläche Vorarlbergs nicht mehr kleiner werden wird.
Heute sind viele Bauern froh. Hofnachfolgen sind einfacher, ein „Hinaus zahlen“ von Geschwistern gibt es nicht mehr. Wer nicht mehr in der Landwirtschaft arbeitet, bekommt ein Nutzungsrecht einer Fläche für Wohnen oder Gewerbe. Das war alles 2025. Da wurde die Entscheidung getroffen. Die Umsetzung aber 50 Jahre später vereinbart. Trotzdem zeigten sich die Folgen sofort. Wer noch Fläche hatte, brachte sie sofort auf den Markt, die Preise für Grund und Boden fielen auf einen Wert, der 1970 üblich war. Wer einen Leerstand hatte oder eine unbebaute Fläche mitten im Zentrum, errichtete Wohnraum, vermietete und verkaufte. Die Preise sanken auch hier, aber nur auf ein Niveau, wie wir es aus den 90er Jahren kannten. Eine Zeit, in

Martin Strele Obmann des Vereins Bodenfreiheit, der 2011 gegründet wurde und Flächen oder Rechte an Flächen erwirbt, um diese dauerhaft frei und zugänglich zu erhalten. www.bodenfreiheit.at

BIBER-EINSATZ AM RHEIN
Daniela Egger
Die Renaturierung des Rheins und die damit einhergehende Modernisierung des Hochwasserschutzes hatte jahrzehntelang die Gemüter bewegt. Die Pläne sahen eine umfassende Umgestaltung des Flussverlaufs vor, bedingte eine Investition in Milliardenhöhe und hatte deshalb Grundbesitzer:innen wie auch Finanzminister auf beiden Seiten des Rheins verängstigt. Tausende Verhandlungsstunden mit den Schweizer Nachbarn führten schließlich am 24. Mai 2024 zur Unterzeichnung eines Staatsvertrags mit der Schweiz, es war in Wahrheit der vierte in Folge. Aber dieser war der entscheidende und schon bald begann die erste Bauetappe. Die Renaturierung der 26 Kilometer zwischen Illmündung und Bodensee sollte geschätzte 2,1 Milliarden kosten – aufgeteilt zwischen der Schweiz und Österreich. Gerechnet wurde mit einer 20-jährigen Bauzeit. Man hatte gerade angefangen, die Betonwände aufzubrechen, als die ersten Spuren einer Biber-Familie entdeckt wurden … dünne Baumstämme fanden auf unerklärliche Weise ihren Weg in das Flussbett. In nahegelegenen Wäldchen ragten plötzlich spitze Baumstümpfe aus dem Boden. Wie die kleinen Tiere diese weit entfernt geernteten Hölzer in die Tiefe transportierten, war unklar. Klar war aber, dass die Biber sehr genau wussten, was zu tun war. Innerhalb kürzester Zeit staute sich das Wasser an Stellen, die in den Rhesi-Plänen gar nicht vorgesehen waren – sie erwiesen sich aber als sehr durchdacht. Woher die Tiere kamen, bleibt bis heute ein Rätsel, aber als sie mit ihrer Arbeit begannen, jubelten Naturschutz-Expert:innen und verhinderten mit persönlichem Einsatz jede Einmischung von Seiten der skeptischen Bauträger. Man beschloss, die Tiere ihre Arbeit machen zu lassen. Die Bagger kamen kaum hinterher, um die alte betonierte Einfassung aufzubrechen –jede Nacht begannen die Biber, die neu gewonnenen Räume zu nutzen und den Wasserlauf zu verändern. Der Rhein sprudelte bald in einem breit angelegten Becken Richtung Bodensee, er staute sich an unerwarteten Stellen und verlangsamte seine Fließgeschwindigkeit. In kürzester Zeit wuchsen wieder Pflanzen, die man lange nicht mehr gesehen hatte – an den begradigten Ufern der Rheins hatte jahrzehntelang die blanke Ödnis geherrscht. Von oben betrachtet konnte man ihn kaum vor der nahegelegenen Autobahn unterscheiden, und selbst die Vegetation entlang der Autobahn war lebendiger als die an den Ufern. Aber das änderten die fleißigen Tiere rasch, ihre Arbeit sorgte für kleine und größere Stauzonen. Aufgelockerte Erde lockte eine ganze Armada von Amphi-

an, die diese neuen Lebensräume in Besitz nahmen und ihrerseits damit begannen, das Werk der Biber zu vollenden. Sumpfgebiete boten Nischen für Teichfrösche und Kröten, was eine ganze Kolonie von Störchen dazu brachte, sich in der Nähe anzusiedeln. Der Fischbestand kehrte zurück, die Wasserqualität wurde verbessert. Die Biber fanden bald keine Baumstämme mehr in der näheren Umgebung, weshalb ein findiger Naturschützer die Idee hatte, Bäume in Ufernähe nur zu ihrer Verwendung zu pflanzen. In einer beispiellosen Aktion fanden sich hunderte Freiwillige, die entlang der beiden Uferseiten Bäume und Sträucher pflanzten, groß genug für die Arbeit der Biber, klein genug, um sie transportieren und eingraben zu können. So arbeiteten die Menschen den fleißigen Tieren zu – ein einziger Biber kann über 200 Bäume im Jahr fällen. Man brachte also eine große Anzahl von Jungpflanzen an Ort und Stelle, manche ließen die Biber stehen, andere fanden sich alsbald als Staumaterial im Wasser.
DIE URSPRÜNGLICH GEPLANTE BAUZEIT VON 20 JAHREN WAR IN NUR SECHS JAHREN ERLEDIGT, UND DAS WEIT PRÄZISER, ALS DIE MENSCHEN ES JE HÄTTEN PLANEN KÖNNEN.
Die ursprünglich geplante Bauzeit von 20 Jahren war in nur sechs Jahren erledigt, und das weit präziser, als die Menschen es je hätten planen können. Die Kosten waren nicht der Rede wert und die bereits budgetierte Milliarde für die Umsetzung des Projektes konnte anderweitig genutzt werden. Das Geld wurde nach heftigen Protesten der beteiligten Bürgerinnen und Bürger dem Naturschutz gewidmet, und ganz gezielt auch der Erhaltung von Lebensräumen für Biber. Beinahe wären diese Gelder in den Straßenbau geflossen, aber das wussten die Vorarlberger:innen diesmal zu verhindern.
Die Flut an Sedimenten, die der Rhein seit 130 Jahren in den Bodensee geschwemmt hatte, lagert sich seither in den Seitenarmen ab und entlastet die Flussmündung im See – der Rheindamm wächst nur noch marginal. Das neu angelegte Feuchtgebiet brachte eine Artenvielfalt zurück, die europaweit für Aufsehen sorgt. Und als kürzlich das erste Hochwasser auftrat, bewährte sich die Baukunst der Biber – auch wenn noch nicht alles ganz fertig gestellt war, versickerte die Wasserflut ohne großes Aufsehen, füllte die Grundwasserpegel wieder auf und floss harmlos und langsam in den Bodensee. Die neuen Feuchtgebiete funktionieren wie ein Schwamm und halten auch langanhaltendes Hochwasser aus, ohne die Artenvielfalt einzubüßen.
Anfragen aus allen möglichen EU-Ländern, ob man diese klugen Tiere eventuell ausleihen könnte, beantworteten die Biber damit, dass sie längst verschwunden sind. Niemand weiß, wo sie sich derzeit aufhalten, aber kürzlich erschien der Bericht in einer Naturschutzzeitschrift, dass erste Wartungsarbeiten im Bereich der Illmündung notwendig seien. Es dauerte nicht lange und ein V-Heute Bericht zeigte die typischen Nagetier-Spuren, dort, wo neue Stauarbeiten festgestellt werden konnten. Ob die Biber langfristig zu ihrem Erfolgsprojekt zurückkehren, bleibt abzuwarten. Die Schweiz hat jedenfalls ein ausgedehntes Auswilderungsprogramm für Biber gestartet – ein derart günstiger Bautrupp erhält sogar in der Schweiz den Aufenthaltsstatus.
Biber hatten ihre Fähigkeiten in der Vergangenheit bereits an vielen Orten unter Beweis gestellt, ein beeindruckendes Beispiel findet sich in den von Menschen verlassenen Gebieten rund um Tschernobyl. 2024 sorgten sie für Schlagzeilen, weil sie in Tschechien eine teure Sanierung kostenlos bewerkstelligt hatten. Quelle: https://www.zdfheute.de/politik/ ausland/biber-damm-tschechien-social-media-naturschutz-100.html

Daniela Egger
Autorin und Leiterin der Aktion Demenz www.daniela-egger.at www.aktion-demenz.at
4. – 6.9.25
Feldkirch
Soffie Iris Gold Malaka Hostel MiA. RUHMER
TheOsloBig Bees
Bezahlte Anzeige
