
9. Dezember 2025






Sie können selbst oder durch eine bevollmächtigte Person im Saal mitbieten.
Reservieren Sie eine Telefonleitung, wir rufen Sie an: office@imkinsky.com, +43 1 532 42 00


9. Dezember 2025






Sie können selbst oder durch eine bevollmächtigte Person im Saal mitbieten.
Reservieren Sie eine Telefonleitung, wir rufen Sie an: office@imkinsky.com, +43 1 532 42 00
Lassen Sie die Sensalin für Sie bieten, per schriftlichem Auftrag oder am Telefon. Monika Uzman: +43 1 532 42 00-22, +43 664 421 34 59, monika.uzman@gmail.com
Mit einem schriftlichen
Über die Kaufauftrag
Sollten Sie nicht persönlich an der Auktion teilnehmen können, nehmen wir gerne Ihr schriftliches Gebot entgegen. Sie finden das Formular am Ende des Katalogs.
Über unsere

2. Dezember
Gemälde des 19. Jahrhunderts 15 Uhr
Moderne Kunst 17 Uhr
3. Dezember
Zeitgenössische Kunst 15 Uhr
9. Dezember
Antiquitäten 14 Uhr
10. Dezember
Schmuck 14 Uhr
Uhren 16 Uhr
Jugendstil & Design 17 Uhr

Judith Kuthy, BA BEd Cert GA T +43 1 532 42 00-19 kuthy@imkinsky.com
| Assistance

Magdalena Muth, BA T +43 1 532 42 00-21 muth@imkinsky.com

Miriam Bankier, BA MA T +43 1 532 42 00-66 bankier@imkinsky.com

Michael Kovacek T +43 1 532 42 00 M +43 664 24 04 826

Prof. Kristian Scheed Uhren
Wir bedanken uns für die Mitarbeit bei Anna Blecha-Stippl, Anja Wolf-Reyer und Rosa Dotzer.
Zustandsberichte & Beratung | Condition Reports & Consultation
antiquitaeten@imkinsky.com, T +43 1 532 42 00-19
Kaufaufträge | Order Bids
T +43 1 532 42 00, office@imkinsky.com
Sensalin | Broker
Monika Uzman, T +43 1 532 42 00-22, M +43 664 421 34 59

3001
Römer
Deutsch, 17. Jahrhundert
grünes Glas; der Fuß mit aufgeschmolzenem Glasfadendekor; Abrissnarbe am hochgestochenen Boden; H. 21,5 cm
€ 1.000–2.000

Deutsch, 17. Jahrhundert
farbloses Glas; Abrissnarbe am Boden; konische Kuppa mit aufgeschmolzenem, rundumlaufendem Glasfaden; kleinere Fehlstellen; H. 22,2 cm
€ 700–1.400
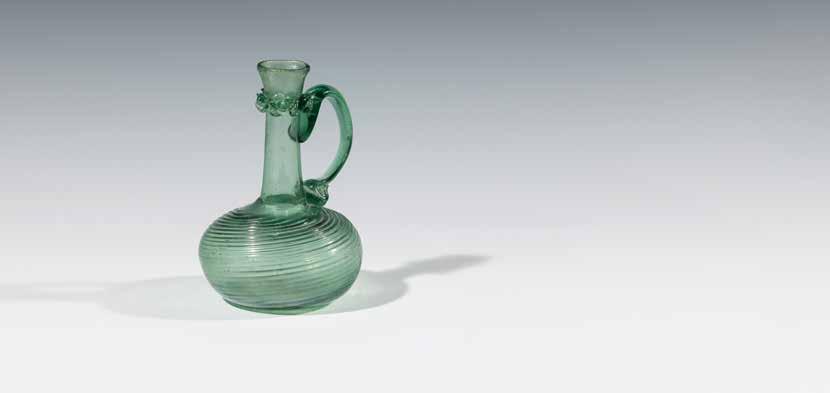
Deutsch, 17./18. Jahrhundert
grünes Glas; bauchige Form, die Wandung mit schrägliegendem, aufgeschmolzenem Glasfadendekor, leicht geschwungener Röhrenhals mit Henkel, unter der Mündung mit gewelltem Glas umsponnen; Abrissnarbe am Boden; H. 12 cm
▲ € 500–1.000
Kugelflasche
Alpenländisch, 17. Jahrhundert blaues Glas; die Wandung mit vertikalen Paralellrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 12,7 cm
€ 3.500–7.000



3005
Alpenländisch, 18. Jahrhundert blaues Glas; bauchige Form, mittig eingezogen, die Wandung mit strukturierten, schrägliegenden Parallelrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 22 cm
€ 2.500–5.000

Unterseite

3006
Alpenländisch, 18. Jahrhundert hellgrünes Glas; bauchige Form, mittig eingezogen, die Wandung mit strukturierten, schrägliegenden Parallelrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16 cm
€ 1.000–2.000

Unterseite
Neunpassige Branntweinflasche
Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert blaues Glas; Neunpassige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 23,5 cm
▲ € 10.000–20.000


Unterseite
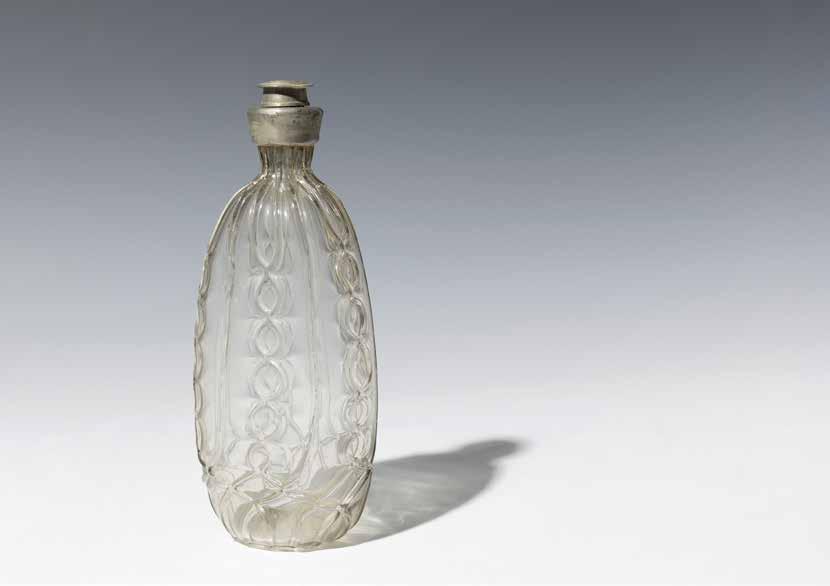
Alpenländisch, 18. Jahrhundert farbloses Glas; die Wandung mit aufgeschmolzenem Glasfadendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 21,2 cm
▲ € 3.500–7.000

Unterseite

Alpenländisch, 18. Jahrhundert grünes Glas; die Wandung unten mit strukturierten Parallelrippen, darüber mit umlaufendem Blütendekor, rückseitig abgeflachte Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 24,5 cm
▲ € 5.000–10.000

Unterseite
Achtpassige Branntweinflasche
Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert
bernsteinfarbenes Glas: Achtpassige Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 13,6 cm
▲ € 10.000–20.000



Alpenländisch, 18. Jahrhundert
blaues Glas, weiß gekämmt; aufgeschmolzener Fuß; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 8 cm
▲ € 1.500–3.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert
weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; aufgeschmolzener Fuß; Sammlungsetikett am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 7,2 cm
€ 1.500–3.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert
weißes Milchglas, kobaltblaue Einschmelzungen; aufgeschmolzener Fuß; Zinnschraubverschluss mit Trinköffnung; H. 8,1 cm
€ 1.000–2.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert weißes Milchglas, kobaltblaue Einschmelzungen; aufgeschmolzener Fuß; Abrissnarbe am Boden; Silberschraubverschluss; H. 7 cm
€ 1.500–3.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; Sammlungsetikett am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 6,8 cm
€ 1.500–3.000

3016
Miniaturflakon
Alpenländisch, 18. Jahrhundert
weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; Zinnschraubverschluss; H. 6,7 cm
▲ € 1.500–3.000

Branntweinflasche
Alpenländisch, 18. Jahrhundert weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; viereckige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 14,2 cm ▲ € 8.000–16.000

Sechspassige Branntweinflasche
Alpenländisch, 18. Jahrhundert
weißes Milchglas, kobaltblau gekämmt; sechspassige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16,4 cm
€ 10.000–20.000


Unterseite

Branntweinflasche
Alpenländisch, 18. Jahrhundert dunkelblaues Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form, die Wandung mit flachem Nuppendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 12,5 cm ▲ € 3.500–7.000
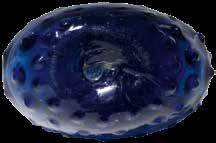
Unterseite
Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert dunkelblaues Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form, mittig eingezogen, die Wandung mit Nuppendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 15,8 cm
▲ € 6.000–12.000



Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert bernsteinfarbenes Glas; oktagonale Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16,7 cm
▲ € 3.500–7.000

Unterseite

Alpenländisch, 18. Jahrhundert blaues Glas; bauchige Form, mittig eingezogen, die Wandung mit strukturierten, schrägliegenden Parallelrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 22 cm
€ 2.500–5.000

Unterseite
Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert
blaues Glas; hexagonale Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; auf der Unterseite mit alten Sammlungsetiketten; Zinnschraubverschluss; H. 15 cm
€ 8.000–1.600


Unterseite
Branntweinflasche
Schweiz/Frankreich, 18. Jahrhundert violettfarbenes Glas; doppelkugelige, mittig eingeschnürte Form, die Wandung mit schrägliegendem, aufgeschmolzenem Glasfadendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 14,7 cm
Literatur
vgl. Ausstellungskatalog, Reine Formsache. Deutsches Formglas 15. bis 19. Jahrhundert, Sammlung Birgit und Dieter Schaich, München 2007, S. 308–309, Abb. 454
▲ € 5.000–10.000



Branntweinflasche
Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert bernsteinfarbenes Glas; oktagonale Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 17,8 cm ▲ € 7.000–14.000

Unterseite

Neidfeige
Alpenländisch, 18. Jahrhundert
weißes Milchglas, kobaltblaue und rotbraune Einschmelzungen; Zinnschraubverschluss; mittig mit Bruchstelle, fachgerecht restauriert; L. 10,5 cm
€ 2.500–5.000

Neidfeige
Alpenländisch, 18. Jahrhundert
weißes Milchglas, Emailmalerei; mit gewelltem, farblosem Glas umsponnen, umlaufend mit bemaltem Blütendekor; Zinnschraubverschluss; L. 9,7 cm
▲ € 1.500–3.000

Neidfeige
Alpenländisch, 18. Jahrhundert
weißes Milchglas, kobaltblaue gekämmte Fadeneinschmelzungen; Zinnschraubverschluss; L. 8,5 cm
▲ € 2.500–5.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert himmelblaues Milchglas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 19,3 cm ▲ € 5.000–10.000


Alpenländisch, 17./18. Jahrhundert farbloses, blass grünliches Glas, der obere Abschluss mit blauem Glas; Abrissnarben am Boden; H. 9 bzw. 9,5 cm
▲ € 1.000–2.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert farbloses, blass grünliches Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form, die Wandung mit schrägliegenden Parallelrippen; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 7,8 cm
▲ € 1.000–2.000

Alpenländisch, 19. Jahrhundert farbloses Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form, die Wandung mit strukturiertem Wabendekor; Abrissnarbe am Boden; H. 17 cm
€ 500–1.000
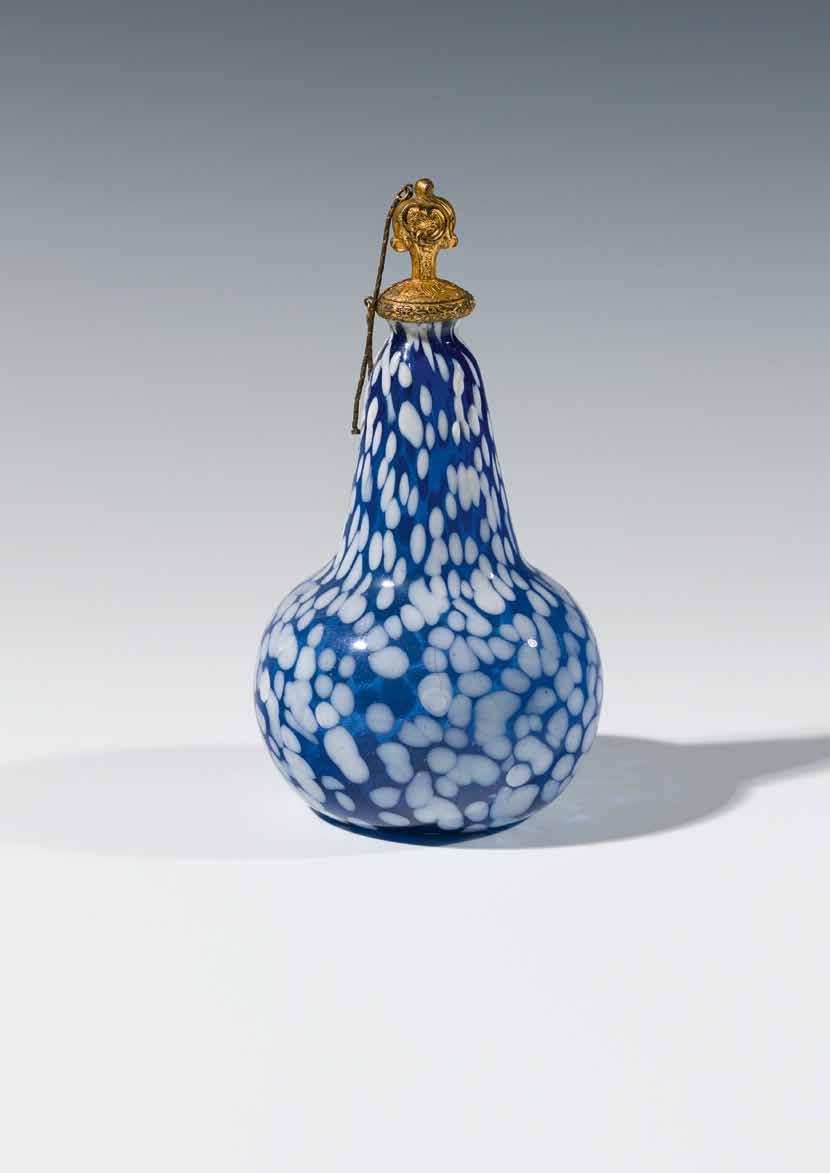
Tropfenflasche
Alpenländisch, 18. Jahrhundert blaues Glas, weiße Milchglaseinschmelzungen; kugelige Form mit konischem Hals; Abrissnarbe am Boden; vergoldeter Metallverschluss; H. 16 cm ▲ € 5.000–10.000

Unterseite

3034
Gekämmte
Branntweinflasche
Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert dunkelblaues Glas, weiß gekämmt; oktogonale Form; auf dem Boden mit altem Sammlungsetikett; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 20,7 cm
€ 1.200–2.400

3035
Gekämmter Becher
Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert blaues Glas, weiß gekämmt; Abrissnarbe am Boden; H. 7,2 cm
▲ € 500–1.000

3036
Gekämmte
Branntweinflasche
Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert dunkelblaues Glas, weiß gekämmt; oktogonale Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 18,7 cm
€ 1.200–2.400
Gekämmte Branntweinflasche
Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert
violettes Glas, weiß gekämmt; zylindrische Form mit konischem Hals; Abrissnarbe am Boden; vergoldeter Metallverschluss; H. 24 cm
Literatur
vgl. Ausstellungskatalog, Reine Formsache. Deutsches Formglas 15. bis 19. Jahrhundert, Sammlung Birgit und Dieter Schaich, München 2007, S. 317–18, Abb. 489
▲ € 7.000–14.000


Unterseite
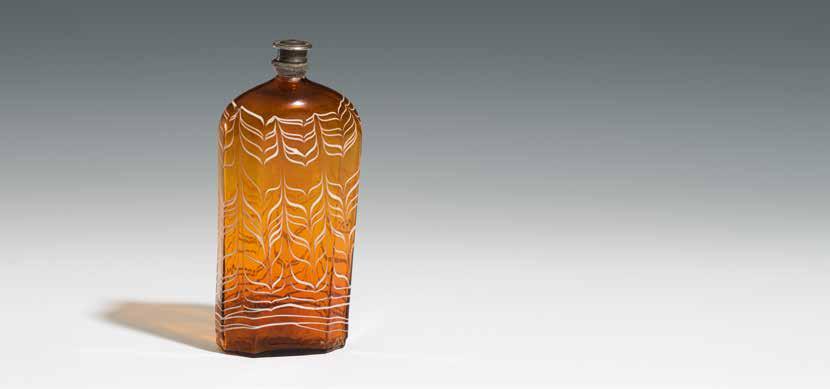
3038
Gekämmte
Branntweinflasche
Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert
bernsteinfarbenes Glas, weiß gekämmt; oktogonale Form; auf dem Boden bezeichnet „G24“; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16,3 cm
€ 1.200–2.200

Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert
bernsteinfarbenes Glas, weiß gekämmt; Abrissnarbe am Boden; H. 11,5 cm
▲ € 500–1.000

3040
Gekämmte
Branntweinflasche
Frankreich/Schweiz, 18. Jahrhundert
bernsteinfarbenes Glas, weiß gekämmt; oktogonale Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 19,5 cm
€ 1.200–2.400
Zunftflasche „Schuster“
Alpenländisch, datiert „1708“ bernsteinfarbenes Glas, Emailmalerei; hexagonale Form, die Wandung auf der Vorderseite mit Stiefel und Schusterwerkzeug, rückseitig mit floralem Dekor, bezeichnet „Schenck mir / doch Sinn“ und datiert „1708“; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 12,7 cm
€ 5.000–10.000



3042
Zwei Becher
Alpenländisch, 18. Jahrhundert farbloses Glas, Emailmalerei; die Wandungen jeweils mit 2 Tauben auf Herz; Abrissnarben am Boden; H. 7,4 bzw. 8,7 cm
€ 500–1.000

3043
Hofkellereibecher mit dem Wappen von Johann Georg Herzog von Sachsen-Weißenfels
Sachsen, um 1700 farbloses Glas, Emailmalerei; die Wandung auf der Vorderseite mit bekrönter Hermelin-Wappendecke mit dem sächsischen Kurwappen und Monogramm „JG“, darüber bezeichnet „I.G.D.D.S.Q.“ (Johann Georg Dei Dux Saxoniae Querfurtensis); Abrissnarbe am Boden; H. 10,8 cm
€ 500–1.000

3044
Vier Branntweinflaschen
Alpenländisch, 18. Jahrhundert farbloses Glas bzw. Milchglas, Emailmalerei; die Wandungen jeweils mit Blumendekor und Hund, Vogel bzw. Bäuerinnendarstellung, 1 Flasche datiert „1736“; Abrissnarben am Boden; 2 Flaschen mit versilbertem Metalldeckel; die Milchglasflaschen mit leichten Ausbrüchen am Hals; H. 11 bis 14 cm
€ 1.000–2.000
Deutsch, datiert „1726“ farbloses Glas, Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Familiendarstellung, alle Mitglieder bezeichnet mit Namen, rückseitig mit Inschrift „Gott dem alles unverborgen, wird gefreulich für mich Sorgen“, darunter datiert „1726“; Abrissnarbe am Boden; H. 18,9 cm ▲ € 5.000–10.000

Abrollung


Norddeutsch, 17./18. Jahrhundert
grünes Glas; viereckige Form; Abrissnarbe am Boden; H. 22,8 cm
Literatur
vgl. Thomas Dexel, Gebrauchsglas. Gläser des Alltags vom Spätmittelalter bis zum beginnenden 20. Jahrhundert, Braunschweig 1977, S. 228, Abb. 271
€ 1.000–2.000
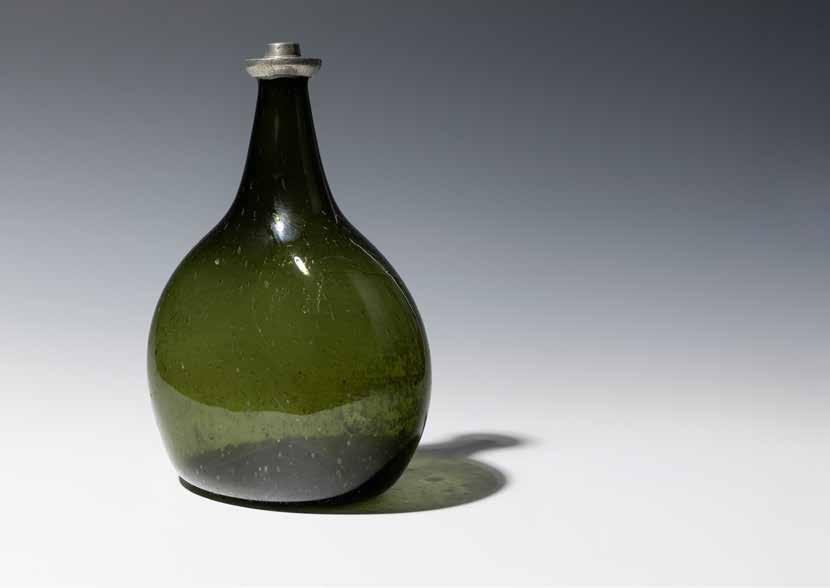
Alpenländisch 18. Jahrhundert
grünes Glas; bauchige, beidseitig abgeflachte Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 28,5 cm
€ 1.500–3.000

3048
Branntweinflasche
Alpenländisch, 18. Jahrhundert rosafarbenes Glas; viereckige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 16 cm
€ 1.200–2.400

3049
Große Branntweinflasche
Alpenländisch, 18. Jahrhundert grünes Glas; viereckige Form; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 29 cm
€ 1.200–2.400
Branntweinflasche
Alpenländisch, 19. Jahrhundert hellblaues Glas; bauchige Form, die Wandung mit Parallelrippen aus Milchglas; Abrissnarbe am Boden; Zinnschraubverschluss; H. 21,5 cm
€ 800–1.600


Große Branntweinflasche
Alpenländisch, 18. Jahrhundert grünes Glas; oktogonale Form; Abrissnarbe am Boden; H. 31 cm
€ 1.000–2.000

3052
Glaswalke „Vergissmeinnicht“
England, 19. Jahrhundert
dunkelblaues Glas, Emailmalerei; auf der Vorderseite bezeichnet „FORGET ME NOT“ und „The loss of gold is great. The loss of time is more. But losing christ is such a loss, that no man can restore“; Stoffband; L. 44,5 cm
€ 300–600

Alpenländisch, 18. Jahrhundert
farbloses und rotes Glas; die Wandung mit strukturierten Parallelrippen, angeschmolzene und teilweise mit der Zange geformte Beine, Mund, Ohren, Fell und Schwanz; Abrissnarbe an der Brust; L. 19 cm
€ 1.500–3.000

Alpenländisch, 18. Jahrhundert rosafarbenes Glas; mittig eingezogen, angeschmolzene und teilweise mit der Zange geformte Beine, Mund, Ohren und Schwanz; Abrissnarbe an der Brust; L. 22 cm
€ 1.500–3.000

Potsdam, um 1700
Goldrubinglas, geschliffen; Silberschraubverschluss, Reste alter Vergoldung; der Deckel innen gemarkt mit verschlagenem Beschauzeichen mit Festung und Meistermarke „ICS“; H. 16,6 cm
▲ € 1.500–3.000

Schlesien, um 1760
farbloses Glas, geschliffen, graviert, Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Landschaftsdarstellungen; minimal bestoßen; H. 13 cm
€ 500–1.000

Böhmen, um 1730
farbloses Glas, geschliffen, radierte Gold- und Silberfolie; im Boden ein Zwischengoldmedaillon mit einem gekrönten Herz auf rotem Grund; facettierte Außenwandung, umlaufende Darstellung einer Jagdgesellschaft, Akanthusfries in Silber; eine kleine Scharte am Lippenrand und Feuchtigkeitsspuren am Boden; H. 8,2 cm
€ 500–1.000
3058
Johann Sigismund Menzel (Schlesien um 1745–1810 Warmbrunn)
Portraitpokal
Warmbrunn, Schlesien, um 1800 farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon mit radierter Goldfolie; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit Silhouettenportrait auf Goldgrund; Vergoldung an Randbordüre stellenweise berieben; H. 15,7 cm
€ 1.000–2.000


3059
Pokal mit Goldmalerei
Potsdam, um 1720
farbloses Glas, graviert, Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Darstellung einer Flusslandschaft; Abrissnarbe am Boden; H. 17,5 cm
€ 800–1.600

3060
Friedrich Winter
(tätig 1685–1712 Hermsdorf)
Becher Hemsdorf, Schlesien, um 1700 farbloses Glas, geschliffen, geschnitten; die Wandung umlaufend mit drei Bildfeldern mit Putti bei der Traubenernte, Traubenübergabe und Schlossansicht; H. 13,8 cm Literatur
vgl. Ausstellungskatalog, Glassammlung Liaunig. Schnitt und Farbe, Wien 2015, S. 108 vgl. Glasgalerie Kovacek, Glas aus 5 Jahrhunderten, Wien 1990, S. 51 vgl. Brigitte Klesse, Hans Mayr, Veredelte Gläser aus Renaissance und Barock. Sammlung Ernesto Wolf, Wien 1987, Abb. 104
€ 8.000–16.000
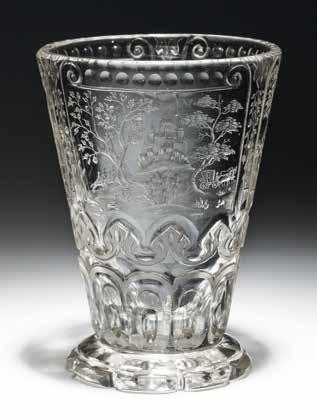


Böhmen, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten; die Wandungen mit Wildtierdarstellungen; Abrissnarben am Boden; H. 13,6 bis 14,1 cm
€ 500–1.000


Niederländisch/Deutsch, 17./18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten; die Wandungen mit Wabendekor bzw. 1 Glas mit Reiterdarstellung, gewidmet dem Sieg Wilhelms III. von Oranien bei der Schlacht am Boyne am 1. Juli 1690, bezeichnet „THE GLORIOUS MEMORY OF KING WILLIAM/NO SURRENDER“, signiert „T.C.S.C“, 1 Glas mit Hasendarstellung und Inschrift und 1 Glas mit bekrönter Wappendarstellung; Abrissnarben am Boden; H. 13,4 bis 16 cm
€ 500–1.000
3063
Pokal „Carl van Loteringen“
Deutsch, Ende 17. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit Reiterdarstellung, bezeichnet „CARL VAN LOTERINGEN/VIVAT PRINS“; Abrissnarbe am Boden; H. 20,3 cm
€ 400–800


3064
Pokal „Jagd“
Deutsch, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten geblänkt; die Wandung mit Jagddarstellung; Abrissnarbe am Boden; H. 23,3 cm
€ 400–800
3065
Deutsch, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschnitten, Goldmalerei; die Wandungen mit Blütendarstellung und rotem und weißem spiralförmigen Glasfaden im Schaft bzw. mit Hirschdarstellung; Abrissnarben am Boden; H. 13,9 bzw. 16,3 cm
€ 500–1.000


3066
Konvolut aus fünf Gläsern
Deutsch, 18. Jahrhundert
farbloses und violettes Glas, geschnitten, geblänkt; die Wandungen mit Wappen-, Vogel- und Traubenranken und spiralförmigem Glasfaden im Schaft bzw. Flammenherzendarstellung, bezeichnet „gethreu ver bunden alle Stunden“; Abrissnarben am Boden; H. 16 bis 19,4 cm
€ 500–1.000
3067
Pokal „Amor“
Böhmen, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit zwei Bogenschützenputten und rotem, spiralförmigem Glasfaden im Schaft; Abrissnarbe am Boden; H. 21,5 cm
€ 400–800


3068
Pokal „Treue und Falschheit“
Böhmen, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit Vogel- bzw. Schlangendarstellung, bezeichnet „Ich liebe die Treu/Falschheit ich scheu“; der Schaft und rotem, spiralförmigem Glasfaden im Schaft; Abrissnarbe am Boden; H. 22,5 cm
€ 400–800

3069
Pokal mit Genreszene
Niederländisch, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit der Darstellung eines Paares bei Tisch, die Gläser, rückseitig bezeichnet
„BEY SCHONE DAMEN EN GLAES/WYN WIEL EN ELCKER/DIENAER SYN“ und rotem, spiralförmigem Glasfaden im Schaft; Abrissnarbe am Boden; H. 20,2 cm
€ 400–800
Konvolut aus fünf Gläsern
Englisch, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, Goldmalerei; 1 Glas mit spiralförmigem Glasfaden im Schaft; Abrissnarben am Boden; H. 14,5 bis 19 cm
€ 500–1.000


Englisch, 18. Jahrhundert
farbloses Glas; jeweils mit spiralförmigem Glasfaden im Schaft; 1 Glas mit Bruchstelle am Boden; Abrissnarben am Boden; H. 15,6 bis 18,3 cm
€ 500–1.000
3072
Pokal
Schlesien, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung umlaufend mit Darstellung eines Schlosshofs mit Figuren bei Freizeitaktivitäten; Abrissnarbe am Boden; H. 18,4 cm
€ 1.000–2.000


3073
Pokal
Schlesien, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit Darstellung eines Paares; Abrissnarbe am Boden; H. 20,5 cm
€ 1.000–2.000
Wappenpokal
Böhmen, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit bekröntem Wappen des russischen Zarenreiches mit sechs kleinen Nebenwappen russischer Fürstentümer und der Ordenskette des Andreasorden; Abrissnarbe am Boden; H. 22,5 cm
€ 400–800


Konvolut aus fünf Gläsern
Deutsch, 1. Hälfte 18. Jahrhundert farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt, Goldmalerei; die Wandung mit Blumendarstellung, bezeichnet „ dank schön“, Vogeldarstellungen, 1 davon bezeichnet „uns allein“, Pferdedarstellung, bezeichnet „La Caprice perd“ bzw. Hermesdarstellung; Abrissnarben am Boden; H. 14,2 bis 16,2 cm
€ 500–1.000
3076
Wappenpokal
Böhmen, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit bekröntem Wappen mit zwei flankierenden Löwen, darunter bezeichnet; Abrissnarbe am Boden; H. 23 cm
€ 400–800


3077
Pokal
Böhmen, um 1700
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten; die Wandung mit Reiterdarstellung, bezeichnet „Das regiment/ besteht nicht aus ge/waldt sondern aus weisheitt“; Abrissnarbe am Boden; H. 22,7 cm
€ 400–800

3078
Pokal „Westindische Compagnie“
Niederländisch, 18. Jahrhundert
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung mit Darstellung eines Dreimasters, bezeichnet „HET WEL WEES ENDE/WESTINDISCHE COMPAGNIE“ und Wappen mit Schwertern und Fahnen; Abrissnarbe am Boden; H. 23 cm
€ 400–800
Johann Joseph Mildner (Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)
Apothekerbecher
Gutenbrunn, datiert „1793“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon und Randbordüre mit Goldradierung auf rotem und schwarzen Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit Monogramm „JTS“, umgeben von griechisch bezeichneten Behältern und einem Mörser; rückseitig bezeichnet mit „Gewidmed/ Ihrem Freunde/ WG/ 1793“; geschliffener Bodenstern; Originaletui; H. 10,4 cm
€ 2.500–5.000
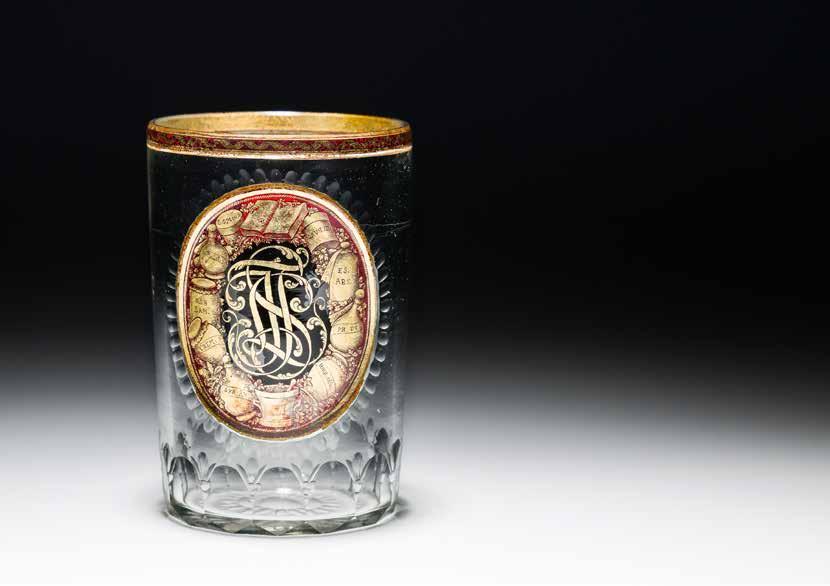
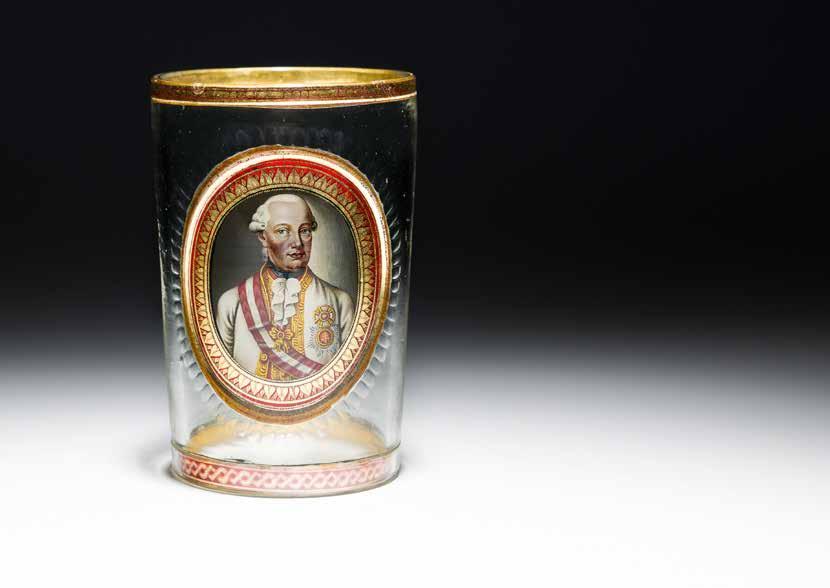
Johann Joseph Mildner (Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)
Portraitbecher „Kaiser Leopold II.“ Gutenbrunn, datiert „1791“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon und Randbordüre mit Goldradierung und Emailmalerei auf rotem Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit Portrait des Kaiser Leopold II., rückseitig bezeichnet mit „Verfertiget/ zu Gutenbrunn/ im Fürnbergischen grossen/ Weinspergwald./ 1791/ Von Mildner“; Boden mit Sprungbildung; H. 12,5 cm
€ 1.000–2.000
Johann Joseph Mildner
(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)
Monogramm-Deckelkrug
Gutenbrunn, datiert „1790“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon und Deckelknauf mit Goldradierung auf rotem Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit bekröntem Monogramm „JG“, rückseitig bezeichnet mit „Verfertiget/ zu Gutenbrunn/ im Fürnbergischen Grossen/ Weinspergwald./ 1790/ Von Mildner“; geschliffener Boden, originaler Deckel; H. 15,4 cm
€ 1.000–2.000


Johann Joseph Mildner
(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)
Monogrammbecher
Gutenbrunn, um 1785
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon mit Goldradierung auf rotem Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit bekröntem Monogramm „JS“, rückseitig bezeichnet mit „Verfertiget/ zu Gutenbrunn/ im Fürnbergischen grossen/ Weinspergwald./ Von Mildner“; geschliffener Bodenstern; Originaletui; H. 11,1 cm
€ 2.500–5.000


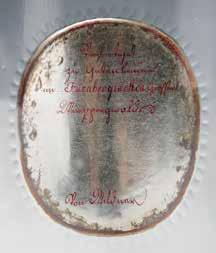
3083
Johann Joseph Mildner
(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)
Becher „S. Katharina“ Gutenbrunn, datiert „1798“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon, Boden und Randbordüre mit Gold- und Silberradierung auf rotem Lackgrund, Diamantriß; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit Darstellung der Heiligen Katharina, rückseitig mit Wappendarstellung, die Wandung umlaufend mit Diamantriß-Girlandendekor, die Randbordüre auf der Vorder- und rückseitig bezeichnet „Mildner fec. a Gutenbrunn 1798“ und „Unschuld ist die schönste Tugend, sie erhält ein reines Herz, und befreut die liebe Jugend, von gefährlich geylen Scherz“, Einsatzmedaillon im Boden innen mit Monogramm „KL“, außen mit radiertem Stern; Originaletui; H. 10,9 cm
€ 5.000–10.000



Johann Joseph Mildner
(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)
Becher „Winter“ Gutenbrunn, datiert „1795“ farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, Einsatzmedaillon mit Goldradierung auf rotem Lackgrund; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit am Feuer sitzendem Knaben, darunter auf dem Holz bezeichnet „WINTER“, rückseitig bezeichnet mit „Verfertiget/ zu Gutenbrunn/ im FürnbergS grossen/ Weinspergwald./ 1795/ Mildner“; H. 12 cm
€ 3.500–7.000
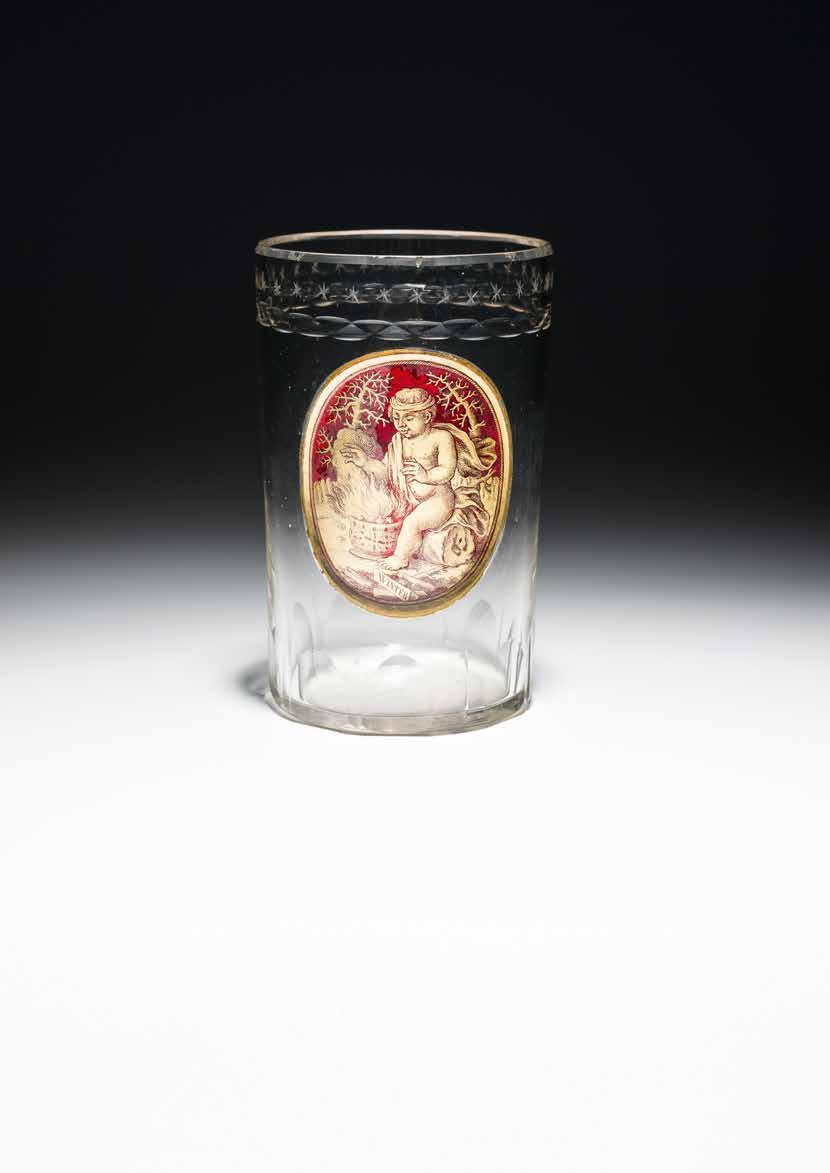
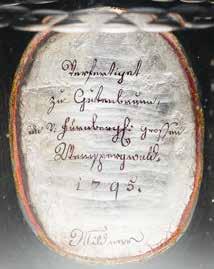
Johann Joseph Mildner
(Kaltenberg 1765–1808 Gutenbrunn)
Doppelwand-Wappenbecher
Gutenbrunn, datiert „1806“ farbloses Glas, die Wandung umlaufend doppelwandig mit goldradiertem Sterndekor auf dunkelblauem Grund, Einsatzmedaillon, Boden und Randbordüren mit Gold- sowie Silberradierung und Emailmalerei auf rosa bzw. rotem Lackgrund, innen vergoldet; das Einsatzmedaillon auf der Vorderseite mit bekröntem Wappen, darunter bezeichnet „Mildner fecit a Gutenbrunn“; Einsatzmedaillon im Boden innen mit Treueschwur vor Flamme und bezeichnet „Diese dankbahre Flamme seye hier und jenseits unsern Wohlthätter und Vater gewidmet 1806“, außen mit radiertem Stern; rückseitig im dunkelblauen Lackgrund mit Fehlstelle; H. 11,4 cm
Literatur
vgl. Gustav Pazaurek, Gläser der Empire und Biedermeierzeit. Leipzig 1923, S. 338
€ 5.000–10.000




(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Stiefmütterchen/pensée“
Wien, um 1820
farbloses Glas, geschliffen, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Stiefmütterchenbordüre und Steinelschliff, umlaufend der Sinnspruch „Mes pensées Vous suivent, Et le souvenir me reste.“ (Meine Gedanken folgen Dir und die Erinnerung bleibt mir.); H. 10,5 cm
Literatur
vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 450
€ 3.500–7.000

(Wien 1769–1851 Wien)
Freundschaftsbecher
Wien, um 1825 farbloses Glas, geschliffen, teilweise gelb gebeizt, Transparent- und Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Blumengirlanden, auf der Vorderseite bezeichnet „Souvenir d‘amitie“; am Bodenrand signiert „AK“; Vergoldung leicht berieben; H. 10,8 cm
Literatur
vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 464
€ 2.500–5.000

Detail Signatur

(Wien 1769–1851 Wien)
Becher „Ehret die Frauen“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt und vergoldet, Gold- und Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Rosenbordüre und Steinelschliff, umlaufend mit Sinnspruch „Ehret die Frauen! sie flechten und weben, himmlische Rosen ins irdische Leben.“; H. 9,9 cm
Literatur
vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 449
€ 5.000–10.000

(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher mit Blumenakrostichon „MARIE“ Wien, um 1820 farbloses Glas, geschliffen, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; die Wandung umlaufend mit Blumenbordüre und Steinelschliff, mittig bezeichnet „Ranunkel. Iris. Eglantine. Mohn. Aurikel.“; gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 10,5 cm
Literatur vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 474
€ 5.000–10.000

(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Ehret die Frauen“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; die Wandung umlaufend mit Blumenbordüre, umlaufend der Sinnspruch „Ehret die Frauen! sie flechten und weben, himmlische Rosen ins irdische Leben.“; H. 11 cm
€ 2.500–5.000

(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Ehret die Frauen“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; die Wandung umlaufend mit Blumen- und Rankenbordüre, umlaufend der Sinnspruch „Ehret die Frauen! Sie flechten und weben, himmlische Rosen ins irdische Leben...“; H. 10,3 cm
Literatur
vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 448
€ 5.000–10.000

Anton Kothgasser
(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Rosenengel“ Wien, um 1825
farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit der Darstellung eines Engels in einer Rosenblüte sitzend; gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 10,9 cm € 5.000–10.000

Anton Kothgasser
(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Blumenkorb“ Wien, um 1830
farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit der Darstellung eines Blumenkorbes; am Bodenrand signiert „AK“; H. 11,2 cm € 6.000–12.000

3094
(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Heiliger Stephan mit ungarischen Wappen“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung des Heiligen Stephan mit ungarischem Wappen, rückseitig bezeichnet „Mindent á Nemzetért‘‘ (alles für die Nation); gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 10,9 cm
€ 1.500–3.000

3095
Anton Kothgasser
(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Prag“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung der Karlsbrücke und der Prager Burg, darunter bezeichnet „Die Brücke mit einem Theil des Schlosses gegen Mitternacht“, gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 12,2 cm
€ 1.500–3.000

(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher Wien, um 1815 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung eines Kindes mit Blumenkorb, darunter bezeichnet „Ich bin nicht laut, mein Dank ist still, Ich kann nicht Wünsche schreiben: Der beste Wunsch ist mein Gefühl, Und wird es ewig bleiben...“; H. 10,5 cm
Literatur vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 387
€ 5.000–10.000

(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Wiener Stephansdom“ Wien, um 1820 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung des Stephansdoms, rückseitig bezeichnet „Domkirche zu St Stephan in Wien“, gelb gebeitzer Bodenschliffstern; H. 10,8 cm
Literatur
vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 286–287
€ 2.500–5.000

Anton Kothgasser
(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Karlsbad“ Wien, um 1825
farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Emailmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung von Karlsbad, im Vordergrund Figurenstaffage, darunter bezeichnet „Der Sprudel in Karlsbad.“; gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 12 cm € 5.000–10.000

(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Josephsplatz“ Wien, um 1825 farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung des Josephsplatzes, darüber bezeichnet „Place de la Bibliotheque Imp le et Roy le et la Statue Joseph II à Vienne“; am Bodenrand signiert „AK“; H. 11,9 cm
Literatur
vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 308
€ 7.000–14.000
Anton Kothgasser
(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher „Trull“ Wien, datiert „1821“ farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt; Gold- und Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Spielkartendeck, eine Karte zweifach signiert mit „Anton Kothgasser in Wien 1821“; Bodenschliffstern; H. 11,8 cm
Literatur
vgl. Paul von Lichtenberg, Mohn & Kothgasser. Transparent bemaltes Biedermeierglas, München 2009, S. 394
€ 5.000–10.000

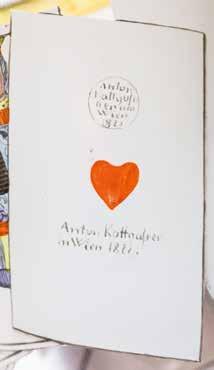
Detail Signatur

Anton Kothgasser
(Wien 1769–1851 Wien)
Ranftbecher
Wien, um 1825
farbloses Glas, teilweise gelb gebeizt, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Darstellung einer Wienansicht, darunter bezeichnet „Vienna en Austria baxa“; gelb gebeizter Bodenschliffstern; H. 12,1 cm
€ 7.000–14.000
Becher „Schneekoppe“
Böhmen, um 1830
farbloses Glas, weiß und rosalin überfangen, geschliffen, Gold- und Emailmalerei; die Wandung auf der Vorderseite mit Darstellung der St. Laurentiuskapelle, darunter bezeichnet mit „Schneekoppe.“; H. 13 cm
€ 500–1.000
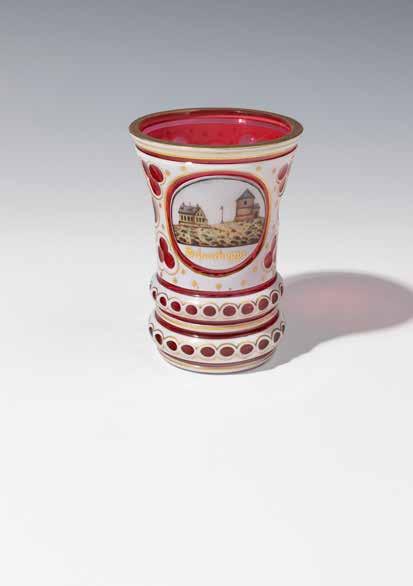

Becher
Böhmen, datiert „1847“
Uranglas, Email-, Gold- und Silbermalerei; die Wandung umlaufend mit Blütendekor; auf der Unterseite mit graviertem Monogramm und datiert „1847“; H. 14,3 cm
€ 300–600

Fußbecher
Böhmen, um 1840 farbloses Glas, gelb gebeizt, geschliffen, geschnitten, Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Rankendekor, auf der Vorderseite mit Pferdedarstellung, rückseitig mit Verkleinerungslinse; H. 14 cm
€ 500–1.000

Pokal „Kurier zu Pferd“
Böhmen, um 1840 farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, rot gebeizt; die Wandung auf der Vorderseite mit Kurierdarstellung zu Pferd; geschliffener Boden; H. 15,3 cm
€ 1.000–2.000
Pokal „Kreuzabnahme Christi“
Böhmen, um 1835
farbloses Glas, geschliffen, geschnitten, geblänkt; auf der Vorderseite mit Darstellung der Kreuzabnahme Christi, rückseitig mit Verkleinerungslinse; auf der Unterseite mit altem Sammlungsetikett; H. 18 cm
Provenienz
ehemals Sammlung Franz Trau, Wien
€ 1.000–2.000


Anton Simm (Kukau/Böhmen 1799–1873 Gablonz)
Pokal „Abendmahl“
Böhmen, datiert „1855“
farbloses Glas, gelb gebeizt, geschliffen, geschnitten, geblänkt; die Wandung auf der Vorderseite mit Abendmahldarstellung, rückseitig mit Verkleinerungslinse, Monogramm und bezeichnet „Zur Erinnerung am 10 April 1855“; geschliffener Boden; H. 19,2 cm
€ 1.000–2.000

Atelier Friedrich Egermann
(Schluckenau 1777–1864 Haida)
Sockelbecher
Monstranz mit Madonna
Harrach´sche Glashütte, Neuwelt, um 1830 farbloses Glas, geschliffen, Porzellanpaste; Strahlenkranz mit eingeschmolzener Porzellanpaste mit Darstellung der Madonna mit Kind; H. 27,5 cm
€ 500–1.000

3110
Becher
Böhmen, Mitte 18. Jahrhundert farbloses Glas, geschliffen, Emailmalerei; die Wandung auf der Vorderseite mit sitzender Herrscherin in orientalischer Kleidung, rückseitig eine Blüte; H. 12,6 cm
€ 300–600

Böhmen, um 1835 farbloses Glas, geschliffen, teilweise gelb gebeizt, Transparentmalerei; die Wandung mit acht Medaillons im Steinelschliff; bemalter Bodenschliffstern; H. 13,4 cm
Literatur
vgl. Rudolf von Strasser, Walter Spiegel (Hg.), Dekoriertes Glas. Renaissance bis Biedermeier, Meister und Werkstätten. München 1989, S. 366, Abb. 279
€ 1.000–2.000
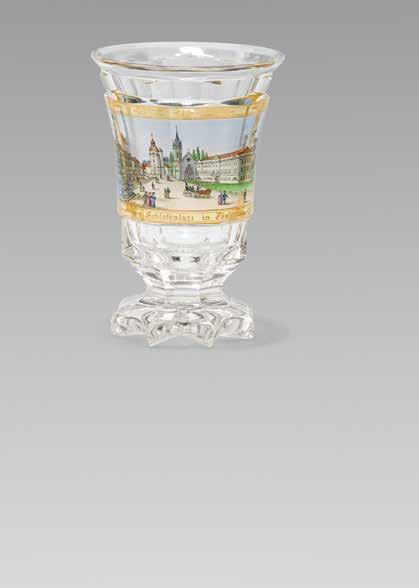
Fußbecher „Der Schlossplatz in Töplitz“
Wien, um 1835
farbloses Glas, Gold- und Transparentmalerei; auf der Vorderseite mit Ansicht von Teplitz, darunter bezeichnet „Der Schlossplatz in Töplitz“; H. 13,6 cm
€ 800–1.600

Karaffe „Arabischer Stil“ Wien, 2. Hälfte 19. Jahrhundert farbloses Glas, grün irisiert, Gold- und Emailmalerei; die Wandung umlaufend mit Reitern, Tier- und Ornamentdekor; seitlich auf dem Fuß gemarkt mit Lobmeyr-Signet; H. 30,5 cm € 3.000–6.000

Briefbeschwerer
St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Dhalie, im Zentrum mit Millefiori-Canes, umgeben von Girlande aus Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 4,8 cm, Dm. 6,4 cm
€ 800–1.600

Briefbeschwerer
Clichy, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 5 cm, Dm. 6,7 cm
€ 800–1.600

Briefbeschwerer
Clichy, Mitte 19. Jahrhundert
blauer Glaspolster, Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 4,6 cm, Dm. 6,8 cm
€ 800–1.600
Briefbeschwerer
Pietro Bigaglia, Venedig, datiert „1846“ farbloser Glaspolster, diverse Fadenglasstäbchen, Millefiori-Canes, Silhouettenstäbchen mit Tieren und Aventurineinschlüsse; seitlich monogrammiert und datiert „P.B. / 1846“, farblos überschmolzen; H. 5,2 cm, Dm. 7,6 cm
Literatur vgl. Glasgalerie Kovacek, Glas aus 4 Jahrhunderten. Wien 1985, S. 281
€ 3.500–7.000


Briefbeschwerer
Baccarat, datiert „1848“
Glaspolster aus Millefiori-Canes, Silhouettenstäbchen mit Frosch, Pferd, Vogel, Hahn, Steinbock, Hund, signiert und datiert „B / 1848“, farblos überschmolzen; H. 5,4 cm, Dm. 8 cm
€ 1.000–2.000



Briefbeschwerer
Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert
Glaspolster aus Millefiori-Canes auf Musselingrund, farblos überschmolzen; H. 6 cm, Dm. 8,3 cm
€ 800–1.600
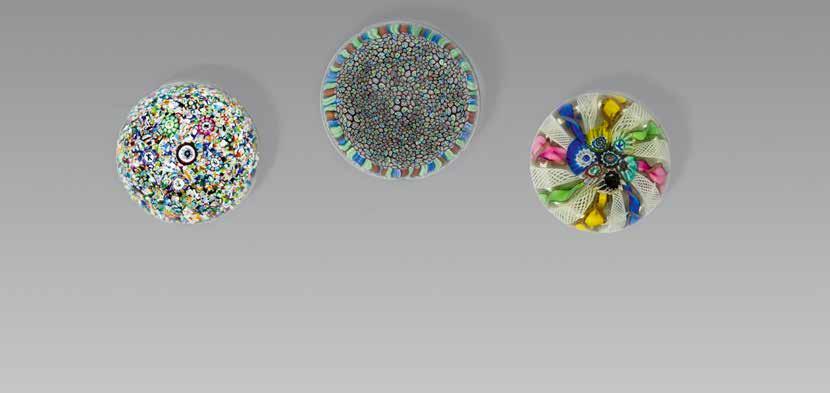
3119
Drei Briefbeschwerer
Murano bzw. Perthshire, 20./21. Jahrhundert
Glaspolster aus spiralförmigen Fadenglasstäbchen und Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; 1 Briefbeschwerer signiert und datiert „P P / 1990“; H. 4,7 bis 5,3 cm, Dm. 7 bis 8 cm
€ 250–500



Briefbeschwerer
St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Blumenbouquet, umgeben von blauen spiralförmigen Fadenglasstäbchen, farblos überschmolzen, die Wandung umlaufend mit Schlifflinsen; H. 5 cm, Dm. 7 cm
€ 1.000–2.000
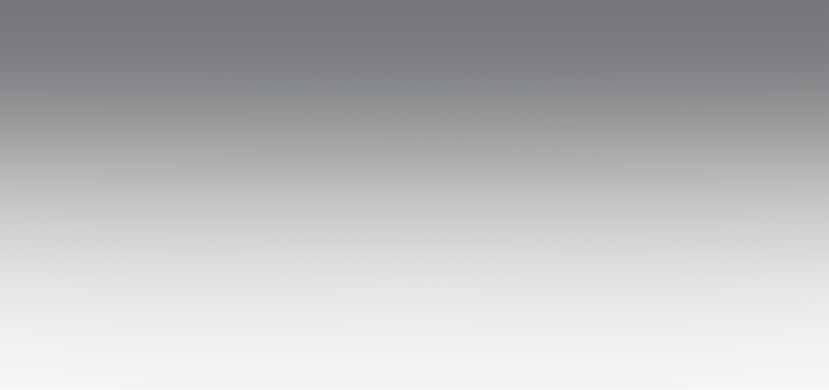
Briefbeschwerer
St. Louis, 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, alternierend weiße und blau-rote spiralförmige Fadenglasstäbchen, im Zentrum Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 4 cm, Dm. 6,5 cm
Literatur
vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 71, Nr. 54
€ 1.000–2.000

Briefbeschwerer
St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert
Glaspolster aus weißen, blauen, rosa, grünen und gelben spiralförmigen Fadenglasstäbchen, farblos überschmolzen; H. 4,5 cm, Dm. 6,3 cm
€ 800–1.600
Briefbeschwerer
Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Wildrose, im Zentrum mit MillefioriCanes, farblos überschmolzen; H. 3,5 cm, Dm. 5,3 cm
Literatur
vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 47, Nr. 24
€ 500–1.000


3125
Briefbeschwerer
Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Stiefmütterchen, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 5 cm, Dm. 6 cm
Literatur
vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 32, Nr. 2
€ 500–1.000

Briefbeschwerer
Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Anemone, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 5,7 cm, Dm. 6 cm
€ 500–1.000

Briefbeschwerer
Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Stiefmütterchen, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 4,5 cm, Dm. 6 cm
Literatur
vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 32, Nr. 2
€ 500–1.000

Briefbeschwerer
St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert farbloser Glaspolster, Dhalie, umgeben von Girlande aus Millefiori-Canes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 3,8 cm, Dm. 6 cm
€ 500–1.000

Briefbeschwerer
Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert farbloser Glaspolster, 7 Ringe aus Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 3,6 cm, Dm. 6 cm
Literatur vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 56, Nr. 37
€ 500–1.000
Briefbeschwerer
Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Blumenbouqet, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 4 cm, Dm. 5 cm
€ 300–600



3130
Briefbeschwerer
Clichy, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, alternierend weiße und rosa Glasstäbe, im Zentrum mit Millefiori-Canes, farblos überschmolzen; H. 3,4 cm, Dm. 4,4 cm
Literatur
vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 90, Nr. 76
€ 500–1.000
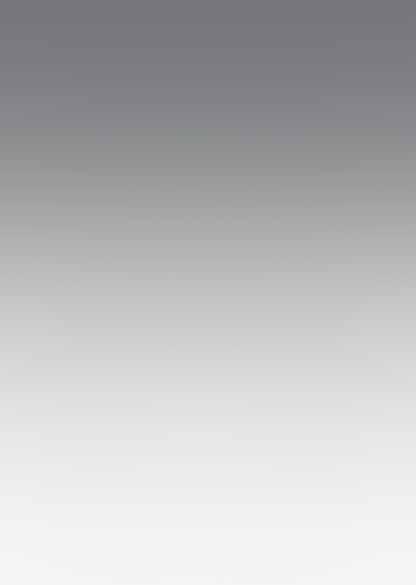
3131
Briefbeschwerer
Baccarat, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Clematis, im Zentrum mit MillefioriCanes, farblos überschmolzen, Bodenschliffstern; H. 5 cm, Dm. 6,5 cm
€ 500–1.000

3132
Briefbeschwerer
St. Louis, Mitte 19. Jahrhundert
farbloser Glaspolster, Früchtedekor auf weißem Gitter, farblos überschmolzen; H. 5 cm, Dm. 7 cm
Literatur
vgl. Glasgalerie Kovacek, Briefbeschwerer, Wien 1987, S. 71, Nr. 55
€ 800–1.600
3133
Briefbeschwerer „Nicolas I.“
Baccarat, um 1825
farbloser Glaspolster, Pastenbildnis, bezeichnet „Nicolas.I.“, farblos überschmolzen; H. 6 cm, Dm. 8 cm
€ 500–1.000


3135
Miniaturbüste „Franz I.“
Wien, 19. Jahrhundert
Bronze, gegossen; wohl grüner Chalcedonsockel; rückseitig signiert „bei F Glanz in Wien“; H. 15,5 cm (inkl. Sockel)
€ 300–600

Bertrand Andrieu (1761–1822)
Pastenplakette „Alexander I“ Baccarat, um 1801 farbloses Glas, geschliffen, Pastenbildnis, Messingmontierung; am Hals signiert mit „Andrieu F.“; Dm. 9 cm
Literatur vgl. Victoria & Albert Museum, Ceramics Collection, Online Accesion-Nr. C.793–1936
€ 1.000–2.000

3136
Paar Miniaturbüsten „Kaiser Franz Joseph“ und „Kaiserin Elisabeth“
Josef Riedel, Polaun, Böhmen, Ende 19. Jahrhundert farbloses Pressglas, mattiert; schwarzer Steinsockel, mit Füllmasse gefüllt; jeweils auf der Unterseite mit Sammlungsetikett; H. 13,3 bzw. 13,8 cm
€ 500–1.000
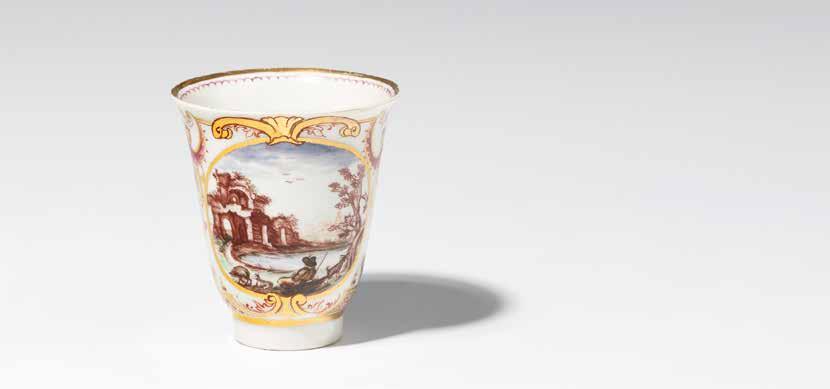
Du Paquier, Alt-Wien, um 1730
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung vorder- und rückseitig mit Landschaftsdarstellungen; am Mündungsrand restauriert; H. 7,3 cm, Dm. 6,9 cm
€ 800–1.600

Du Paquier, Alt-Wien, um 1730
Porzellan, farbig glasiert und staffiert; die Wandung vorder- und rückseitig mit Chinoiseriedarstellungen, 2 Henkel; H. 6,7 cm
Literatur
vgl. Claudia Lehner-Jobst, Ewig schön. 300 Jahre Wiener Porzellan. Salzburg 2018, S. 6 Abb. 2.
€ 500–1.000

Du Paquier, Alt-Wien, um 1725
Porzellan, farbig glasiert und staffiert, Schwarzlot- und Goldmalerei; die Wandung auf der Vorderseite mit Soldaten und Reitern vor Festungsarchitektur und Landschaft; auf der Unterseite mit unleserlicher Ritzmarke; an der Lippe minimal bestoßen; H. 7,5 cm
Literatur
vgl. Metropolitan Museum of Art, New York, Inv.Nr. 1995.268.307, 308.
€ 500–1.000

Zuckerdose
Du Paquier, Alt-Wien, um 1725
Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Wandung und der Deckel umlaufend mit Chinoiserie Landschaftsdarstellungen, der Knauf als vollplastisch ausgeformter Zapfen; fachgerecht restauriert; 18 × 13 × 10 cm
Literatur
vgl. Meredith Chilton & Claudia Lehner-Jobst (Hg.), Fired by Passion. Barockes Wiener Porzellan der Manufaktur Claudius Innocentius Du Paquier. Band 3, Stuttgart 2009, S. 1.244
€ 2.500–5.000
Trembleuse für Schokolade
Du Paquier, Alt-Wien, 1. Hälfte 18. Jahrhundert
Porzellan, farbig staffiert und glasiert; Tasse und Untertasse jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unleserlicher eingeritzer Marke; H. 7,5 cm (Tasse), Dm. 11,7 cm (Untertasse)
Literatur
vgl. Claudia Lehner-Jobst, Ewig schön. 300 Jahre Wiener Porzellan. Salzburg 2018, S. 53, Abb. 37
€ 500–1.000


Schale und zwei Figuren
Alt-Wien, 1744–1749 bzw. 2. Hälfte 18. Jahrhundert
Porzellan, manganfarben staffiert und glasiert, Goldmalerei, Bronze; auf der Unterseite mit eingeritztem bzw. unterglasurblauem Bindenschild; Figuren jeweils am Sockel restauriert; H. 5,8 cm, Dm. 9,5 cm (Schale), H. 9,8 cm (Figuren)
€ 300–600

Trembleuse für Schokolade
Du Paquier bzw. Alt-Wien, 18. Jahrhundert
Porzellan, farbig glasiert und staffiert; die Tasse ungemarkt, die Untertasse gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, Nr. „5“ und Malernr. „51“; H. 7,3 cm (Tasse), Dm. 13,2 cm (Untertasse)
Literatur
vgl. Veljko Marton, The Viennese Porcelain. Cups and Saucers, S. 24, Abb. 4
€ 500–1.000
Koppchen mit Untertasse
Alt-Wien, um 1750
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung mit Bataillenszenen in Landschaft; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägtem „O“, Nr. „12“ und „6“; H. 4,4 cm (Koppchen), Dm. 13,4 cm (Untertasse)
€ 500–1.000

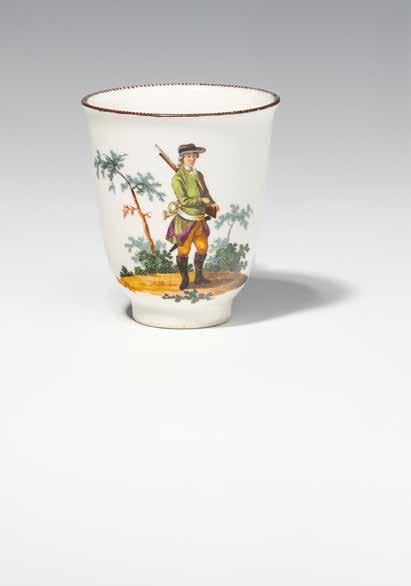
Schokoladentasse mit Jagddarstellung
Alt-Wien, um 1760
Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Wandung auf der Vorderseite mit Darstellung eines Jägers mit Horn und Flinte; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägter Nr. „5“ und Malernr. „10“; H. 7,1 cm
€ 500–1.000

Du Paquier, Alt-Wien, um 1730
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Schwarzlot- und Goldmalerei; der Deckel und die Wandung mit Kartuschen mit Figurendarstellungen; auf der Unterseite gemarkt mit geprägtem „O“; Malerei stellenweise berieben bzw. restauriert; H. 11 cm, Dm. 13 cm
€ 500–1.000

Zwei Schokoladentassen
Alt-Wien, um 1785
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf den Unterseiten jeweils gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Nr. „5“ bzw. geprägter Jahreszahl „(17)85“ und Nr. „29“; H. 7,5 cm bzw. 7,6 cm
€ 500–1.000

Paar Schokoladentassen
Alt-Wien, um 1750
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und geprägtem „O“, sowie Nr. „10“, „13“ und „14“; H. 6,3 cm (Tasse), Dm. 13,7 cm (Untertasse)
Literatur
vgl. Claudia Lehner-Jobst, Ewig schön. 300 Jahre Wiener Porzellan. Salzburg 2018, S. 53 Abb. 37.
€ 1.000–2.000

Paar Kaffeetassen
Alt-Wien, um 1760
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägtem „M“ und Malernr. „31“; H. 6,2 cm (Tasse), Dm. 13,3 cm (Untertasse)
Literatur
vgl. Veljko Marton, The Viennese Porcelain, cups and saucers. Samobor 2007, S. 26 Abb. 6.
€ 1.000–2.000
Terrine
wohl Thüringen, um 1765
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung mit Blütenund Landschaftsdarstellungen, vollplastisch ausgeformter Knauf in Form einer Zitrone; auf der Unterseite gemarkt mit „S“; restauriert; 28,5 × 39 × 24 cm
€ 500–1.000


Drei Messer
wohl Meissen, 18./19. Jahrhundert
Stahlklingen, Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Griffe jeweils mit Soldaten auf der Rast; L. 21 cm
€ 300–600
Blumenmädchen
Alt-Wien, um 1750
Porzellan, glasiert; auf der Rockunterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; H. 12,5 cm
€ 500–1.000


Kerzenleuchter
Alt-Wien, um 1750
Porzellan, glasiert; Kerzenleuchter in Form eines Füllhorns mit plastischem Rankwerk und Blüten, von 2 Putten auf Rocaillensockel gehalten; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; im hinteren Bereich 1 fehlende Dekoration; H. 22 cm
Literatur
vgl. MAK, Wien, Inv.-Nr. KI 7577–262
€ 500–1.000

3153
Mutter mit Kind
Alt-Wien, um 1755
Porzellan, glasiert; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägtem „O“ und geritztem „X“; auf der Unterseite mit Sammlungsetikett; H. 14,8 cm
Literatur vgl. Auktionshaus für Altertümer Wien, Wiener-Porzellan Sammlung Karl Mayer im November 1928. Wien 1928, Tafel 92, Abb. 302
€ 500–1.000

3155
Porzellankorb
Wien, um 1770
Porzellan, glasiert; die Wandung durchbrochen gearbeitet, seitlich 2 Handhaben; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; 20,3 × 16.6 × 12,6 cm
€ 500–1.000

Pagode als Räucherfigur
Alt-Wien, um 1850
Porzellan, glasiert; die Ohrlöcher als Rauchöffnung, auf der Innenseite mit unterglasurblauem Bindenschild; H. 9,6 cm
€ 500–1.000

Du Paquier, Alt-Wien, um 1740
Porzellan, glasiert; restauriert; H. 12,8 cm
Literatur vgl. Meredith Chilton & Claudia Lehner-Jobst (Hg.), Fired by Passion. Barockes Wiener Porzellan der Manufaktur Claudius Innocentius Du Paquier. Band 2, Stuttgart 2009, S. 896 bzw. 899
€ 500–1.000

3158
Kaiserin Maria Theresia
Alt-Wien, 1744–49
Porzellan, glasiert; auf der Unterseite gemarkt mit geprägtem Bindenschild und geprägtem „N“; auf der Unterseite mit Sammlungsetikett; H. 14,7 cm
€ 500–1.000
Figurengruppe
Alt-Wien, um 1760
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; kleine fachgerechte Restaurierungen; H. 29 cm
€ 800–1.600

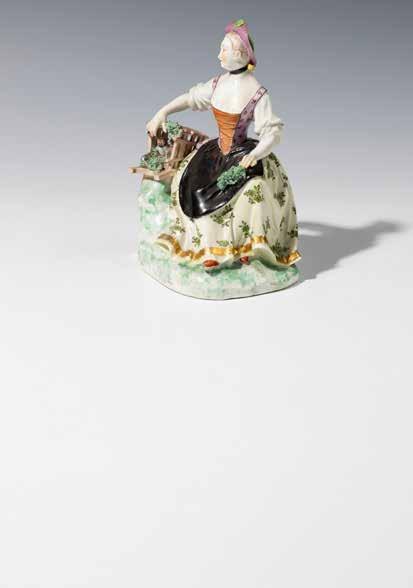
Alt-Wien, um 1755
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; vollplastische Darstellung einer Dame mit Hut und Vogelkäfig; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und „Q“ und unleserlicher Malernr.; Hut, Käfig und Schürze restauriert; H. 18 cm
Literatur
vgl. Anette Ahrens, Sammlung Faltus. Wiener Porzellanfiguren des Rokoko. Wien 2017, S. 269
€ 500–1.000

Alt-Wien, 18./19. Jahrhundert
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Nr. „796“; H. 22,5 cm
€ 800–1.600
Nymphe mit Faun
Alt-Wien, 19. Jahrhundert
Biskuitporzellan; Figurengruppe mit Amor und Psyche auf abnehmbarem
Sockel; auf der Unterseite und dem Sockel gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild; 27,5 × 23 × 26 cm
€ 500–1.000
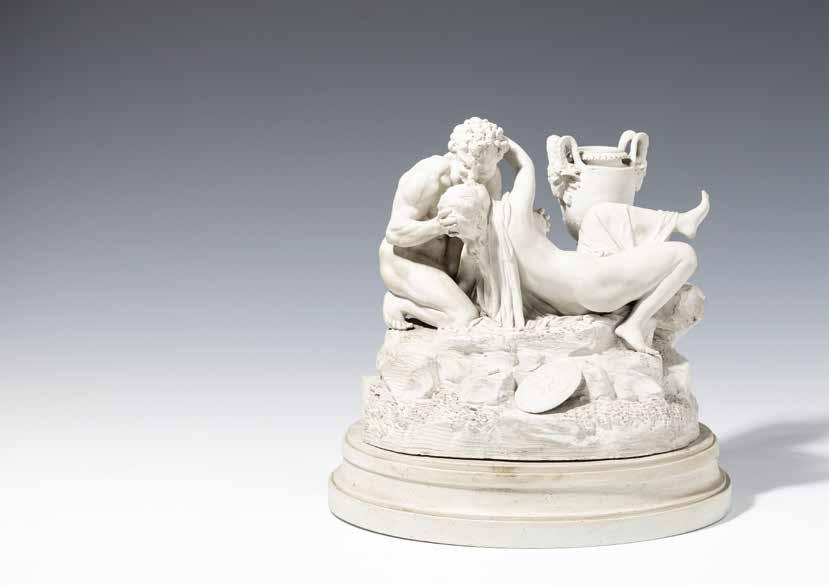

Zwei Figuren „Flora und Herkules“
Nymphenburg, Anfang 20. Jahrhundert
Porzellan, glasiert; jeweils seitlich und auf der Unterseite gemarkt mit Schildmarke und Nr. „39.“ bzw. „42.“; oberer Teil des Spinnrockens fehlt, 1 Schleife am Kleid der Flora restauriert; H. 31,4 bzw. 30,9 cm
€ 1.000–2.000
Meissen, u.A., 18. Jahrhundert
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei, Gold- bzw. Messingmontierung; 1 Flakon gemarkt mit unterglasurblauer Schwertermarke; 1 Stöpsel fehlt, 1 Flakon restauriert; H. 6,5 bis 8 cm
€ 500–1.000


Paris/Alt-Wien, Ende 19. Jahrhundert/um 1770
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; 2 kostümierte Amoretten und 1 bärtige Büstenfigur als Allegorie des Winters; jeweils gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Malernr. „15“, Amoretten zusätzlich mit Samson-Marke mit Kreuz; H. 8,5 bis 12 cm
€ 600–1.200

Porzellanmanufaktur
Meissen
Zwei Figürchen im Jägerkostüm
Entwurf: Johann Joachim Kändler, 18. Jahrhundert
Ausführung: Meissen, 19. Jahrhundert
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; Dame mit Flinte und Fasan, Herr mit Dreispitz und Flinte; jeweils gemarkt mit unterglasurblauer Schwertermarke; jeweils fachgerecht restauriert; H. 7 cm
€ 500–1.000
Alt-Wien, 1822
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf der Unterseite mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägter Jahreszahl „(1)822“, Nr. „15“ und bezeichnet „Pelargonium“; Dm. 24,5 cm
€ 500–1.000

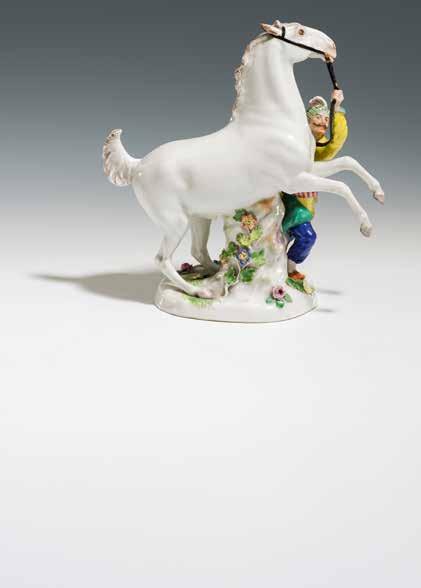
Türke mit Pferd
Entwurf: Johann Joachim Kändler, 1765
Ausführung: Meissen, 1918–1933
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; auf ovaler Plinthe stehender Mann mit sich aufbäumenden Hengst, auf der Unterseite mit unterglasurblauer Schwertermarke; Zügel und Schwert restauriert; H. 26 cm
€ 500–1.000

Alt-Wien, 19. Jahrhundert
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung umlaufend mit Weinreben, der Schaft als 3 vollplastisch ausgeformte Sphinge, durchbrochen gearbeiteter Deckel; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Nr. „24“; H. 19 cm
€ 500–1.000

Alt-Wien, um 1780
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung seitlich mit Kartuschen mit Blumenbouquets; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und geritztem „V“; H. 10,5 cm
€ 500–1.000

Tasse mit Untertasse mit Engels-Lithophanie
Schlaggenwald, Mitte 19. Jahrhundert
Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Wandung und die Untertasse mit Früchtedekor, der Tassenboden mit einer Lithophanie mit Engel; auf der Unterseite gemarkt mit „S“-Marke für Schlaggenwald, Malernr. „61“ und Nr. „51“ bzw. „22“; H. 11,8 cm (Tasse), Dm. 15,5 cm (Untertasse)
€ 300–600

Tasse und Untertasse „pâte-sur-pâte“
KPM, Berlin, 19/20. Jahrhundert
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei, pâte-sur-pâte-Technik; die Wandung auf der Vorderseite der Tasse mit Pantherdarstellung; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauer Zeptermarke mit Reichsapfel mit „KPM“ und Nr. „105/41“; H. 5 cm (Tasse), Dm. 11,8 cm (Untertasse)
€ 2.200–4.400

Alt-Wien, um 1800
Porzellan, farbig staffiert und glasiert; die Wandung und die Untertasse mit Landschaftsansicht mit Schloss; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild und Nr. „3“; H. 6 cm (Tasse), Dm. 13,5 cm (Untertasse)
€ 500–1.000

3174
Paar Tassen mit Untertassen „Ferdinand I und Maria Anna von Savoyen“
Alt-Wien, 1833
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; die Wandung mit Darstellungen des Ferdinand I bzw. Maria Anna von Savoyen; jeweils auf der Unterseite gemarkt mit geprägtem Bindenschild, Jahreszahl „(1)833“, Malernr. „137“ für Josef Geyer und Tassen mit Nr. „25“; H. 11 cm (Tassen), Dm. 17,7 bzw. 17,8 cm (Untertassen)
€ 3.500–7.000
Alt-Wien, Sorgenthal-Periode, 1801/1802
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; jeweils mit chamoisfarbener Fond und gerahmten Bildfeldern mit Ansichten Italiens; Dejeuner bestehend aus: ovaler Anbieteplatte, 2 zylindrischen Kannen mit Deckeln, 2 Tassen mit Untertassen, Zuckerdose mit durchbrochenem Deckel, getragen von 3 goldenen Sphingen auf einem Sockel; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägten Jahreszahlen „(1)801“ und „(1)802“, Nr. „12“, „26“, „5“, „11“ und „47“, „P“ und Nr. „78009“; Schnabel 1 Deckelkanne restauriert; L. 41,8 cm (Anbieteplatte), H. 12,5 cm bzw. H. 14 cm (Deckelkannen), H. 5,8 cm (Tassen), Dm. 13,3 cm (Untertassen), H. 20,5 cm (Zuckerdose)
Literatur
vgl. Mrazek/Neuwirth, Wiener Porzellan. 1718–1864, Wien, Nr. 625 vgl. Niederösterreichische Landessammlung, Fotografie Vitrine mit Porzellansammlung, Inv.-Nr. LK1888/2
€ 15.000–30.000
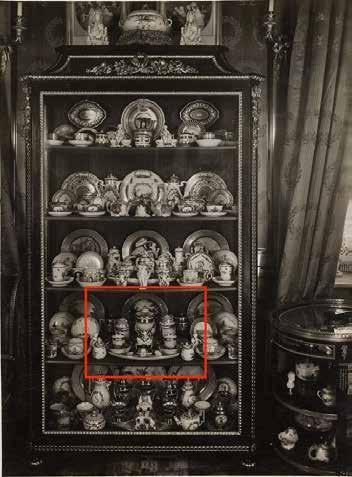
Vitrine mit Porzellansammlung der Katharina Schratt, Inv.-Nr. LK1888/2
© Landessammlungen NÖ
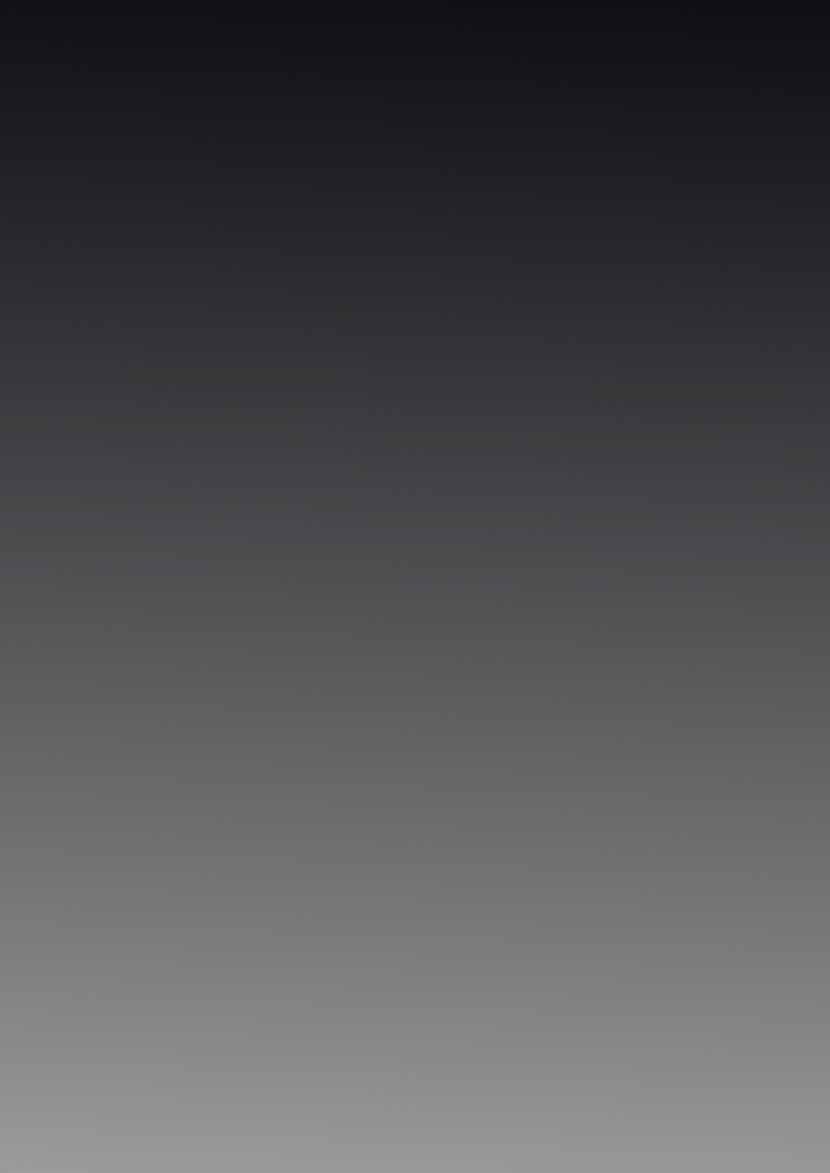
Bei der Aufnahme der Vitrine mit Porzellansammlung handelt es sich um ein zeitgenössisches Foto aus der Privateinrichtung der Katharina Schratt. Unser Dejeuner ist in der vierten Etage der Vitrine erkennbar und war somit Teil der Sammlung der Katharina Schratt, die zu großen Teilen im Jahr 1931 versteigert wurde.
Die Abbildungen zeigen italienische Ansichten aus dem Vorlagenwerk „Voyage pittoresque“: auf der Anbieteplatte „Le Lac de Perouse“, den Trasimenischen See von Perugia; auf der kleineren Kanne „Vue d‘une Rampe ou vaste Escalier taillé dans les Laves de l‘Etna“, die Treppe am Fuße des Ätna in Sizilien; auf der großen Kanne „Restes d‘un antique Monument élevé par les Syracusains“, die Ruine eines Denkmals der Syrakusaner in Sizilien; auf einer Tasse „Le pont et le château Saint-Ange à Rome“, die Engelsbrücke und Engelsburg in Rom; auf der Untertasse „Vue de la ville d‘Assise“, die Stadt Assisi; auf der anderen Tasse „Il ponte vecchio à Florence“, die Ponte-Vecchio-Brücke in Florenz; auf der Untertasse „Vue de la ville de Florence“, die Stadt Florenz.

Deckelvase
Frankreich, Ende 19. Jahrhundert
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Messingmontierung; die Wandung mit Darstellungen einer Flusslandschaft bzw. einer Reiterszene, seitlich 2 Handhaben; im Deckel gemarkt mit apokrypher Sévres-Marke; H. 95 cm
€ 3.500–7.000



Kaffeeservice
Alt-Wien, um 1795–96
Porzellan, staffiert und glasiert, Goldmalerei; 6-teiliges Service, bestehend aus: 1 Mokkakanne, 1 Milchkanne, 1 Zuckerschale, 1 Tasse mit Untertasse und 1 Tablett; jeweils gemarkt mit unterglasurblauem Bindenschild, geprägten Jahreszahlen „95“ und „96“, „X“, „XI“, „Z“ und Nr. „32“, „39“ und „23“; Vergoldung leicht berieben, fachgerecht restauriert; H. 16,5 cm (Mokkakanne), H. 13 cm (Milchkanne), H. 5,9 cm (Zuckerschale), H. 6 cm (Tasse), Dm. 13,3 cm (Untertasse)
Literatur
vgl. K.K. Österreichisches Museum für Kunst und Industrie, Geschichte der K.K. Wiener Porzellan-Manufaktur. Wien 1907, S. 89
€ 1.500–3.000
Klappmedaillon mit Miniaturmalerei
18. Jahrhundert
vergoldetes Silber, Glas, Ölmalerei auf Malgrund; seitlich am Glas 1 Chip; H. 6,2 cm
€ 500–1.000


3180
Miniatur mit Haarlocke von Johann Strauß Vater
1. Hälfte 19. Jahrhundert
Silber, Gouache auf Papier, Haarlocke; rückseitig bezeichnet mit „HAARLOKE Johan Strauss † Sept. WIEN 1849“ und gemarkt mit Tremolierstrich im Herz; H. 5,9 cm
€ 1.000–2.000

Klappmedaillon mit Miniaturmalerei
18. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet, Ölmalerei auf Holz, Spiegelglas; Medaillon mit 2 Klappdeckeln; H. 6,5 cm
€ 1.000–2.000
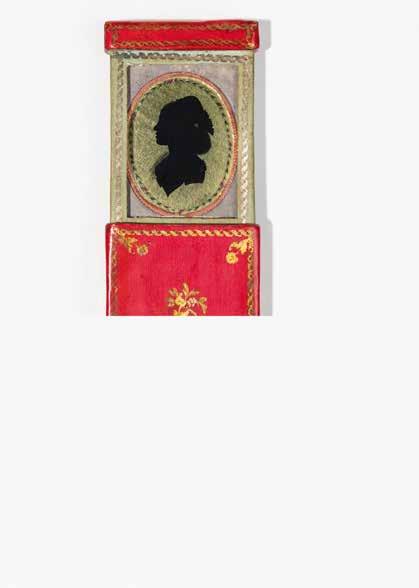
Silhouettenminiatur im Lederetui um 1800
Silhouettenportrait auf Goldgrund, gold geprägtes Leder; unten rechts signiert mit „G. Schrott“; 7,2 × 4,9 cm (inkl. Etui)
Literatur
vgl. Ulrich Thieme (Hg.)/Felix Becker (Hg.)/Hans Vollmer (Hg.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bände 30, München 1992, S. 301
€ 500–1.000
Sammelbild
18./19. Jahrhundert
Messing, Silber, Porzellan, bemalt, Email auf Kupfer, Perlmutt, Muschel, Papier, Stoff, Edelsteine, u. A. Diamanten, Rubin, Smaragd und Granate; Konvolut, bestehend aus 13 Plaketten, Kameen und Miniaturen, auf Samtrahmen befestigt; verglaster vergoldeter Holzrahmen; Muschel teilweise später ergänzt; 37 × 27 cm
€ 1.500–3.000

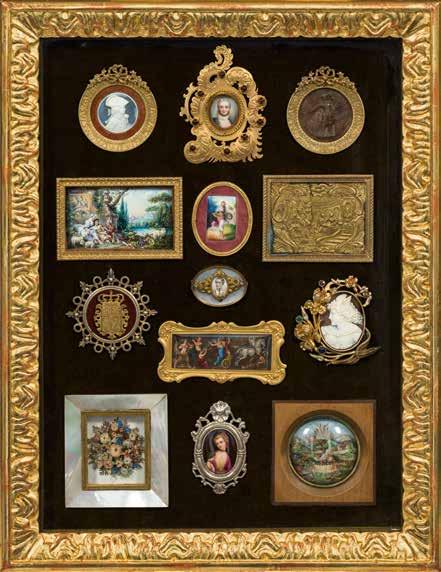

Vier Silhouettenminiaturen 18./19. Jahrhundert
Sillhouettenportraits auf unterschiedlichem Grund; 2 signiert mit „Fecit Schmid Viennae 1796“ bzw. „J Holzer 1834“; teilweise gerahmt, 1 Miniatur als Anhänger; H. 6,3 bis 13,2 cm
€ 1.000–2.000
Anton Grassi (Wien 1755–1807 Wien)
Portraitminiatur „Kaiser Joseph II.“ um 1780
Biskuitprozellan, Holzrahmen; reliefierte Darstellung des Kaiser Josef II. auf blauem Grund; 12,1 × 13,1 cm
€ 500–1.000


19. Jahrhundert
Biskuitporzellan, Holzrahmen; reliefierte Darstellung einer Herrenbüste im Profil auf dunklem Grund; Dm. 16 cm
€ 500–1.000

3186
Fedot Iwanowitsch Schubin (1740–1805)
Zwei Portraitminiaturen
Russland, 2. Hälfte 18. Jahrhundert Alabaster, geschnitzt, durchbrochen gearbeitet, Holzrahmen; 2 Profildarstellungen, wohl Katharina II. mit ihrem Liebhaber Grigori Orlow auf Samtgrund; 11,1 × 12,4 cm
€ 1.000–2.000
Necessaire
18. Jahrhundert
Heliotrop, Messing; die Wandung aus Blut-Jaspis, Messingbeschläge; 6-teiliges Necessaire, davon 3 Teile vorhanden; auf der Unterseite mit Bruchstelle, 3 Teile fehlen; H. 11 cm
€ 400–800


Necessaire um 1780
Email, Goldmalerei, Messing; Klappdeckel und Wandung mit Blumenbzw. Portraitdarstellungen; 6-teiliges Service; H. 10,8 cm
€ 300–600

3189
Ludwig Hans Fischer (Salzburg 1848–1915 Wien) und Erwin Pendl (Wien 1875–1945 Wien)
Schatulle „Wienansichten“ Schwarz & Steiner, Wien, um 1905 vergoldetes Silber, Lederbox, innen mit Stoff bezogen; Schatulle umlaufend, vorne und innen mit Malereien in Aquarell auf Papier, auf dem Deckel mit Blick über Wien vom Palais Lanckoroński; vorne auf dem Beschlag gemarkt mit Dianakopfpunze, Meistermarke drei Kreise und „SCHWARZ & STEINER“; Box gestempelt „SCHWARZ & STEINER/JUWELIERE/WIEN KÄRTNERSTR. 10.“; 13 × 35,9 × 28,8 cm (Box), 9,3 × 27 × 19,8 cm (Schatulle)
€ 10.000–20.000

Auf der Box sind folgende Namen aufgelistet: Géza u. Dada Andrássy, Franz u. Willy Auersperg, Rosa Croy, Irma Esterházy, Paula Esterházy, Tassilo u. Mary Festetics, Leontine Fürstenberg, Agenor u. Anna Goluchowski, Anna Harrach, Hans u. Marie Harrach, Marizza Hohenlohe, Karl u. Lily Kinsky, Marie Kinsky-Liechtenstein, Henriette Liechtenstein, Karl u. Meggy Lanckoroński, Heini u. Yetta Larisch, Rudolf Liechtenstein, Alfred u. Fanny Montenuovo, Karl u. Erni Öttingen, Sándor u. Irma Pallavicini, Betka Potocka, Erwein u. Gegina Schlick, Poldo u. Fanny Sternberg, Adolf Schwarzenberg, Johann u. Therese Schwarzenberg, Nanni Trauttmansdorff, Karl u. Josl Trauttmansdorff, Alfred u. Gabriele Windischgraetz, Josef Windischgraetz, Leo Paar.

Werkstatt Balthasar Wigand
(Wien 1771–1846 Felixdorf bei Baden)
Briefbeschwerer „Karlskirche“
Wien, 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Perlmutt, Holz, Messing- und Bronzebeschläge, Gouache auf Papier; Holzkorpus mit Lade, rundum mit Perlmutt funiert, oben mit Bildfeld, am unteren Bildrand bezeichnet „Die Karlskirche“; innen mit Gewicht; 10,8 × 7,9 × 2,6 cm
€ 700–1.400
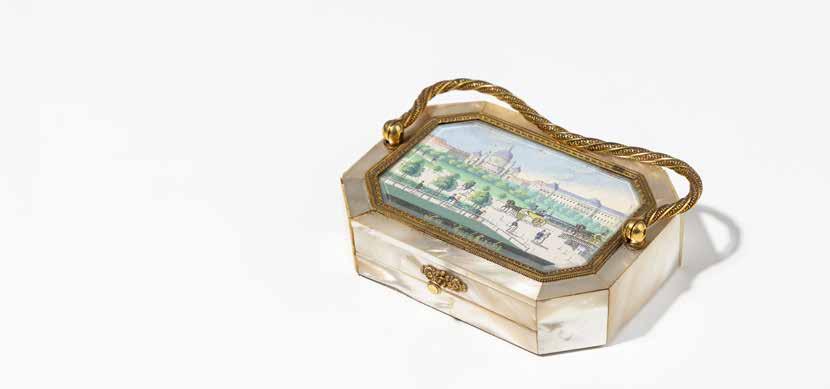

Werkstatt Balthasar Wigand
(Wien 1771–1846 Felixdorf bei Baden)
Dose „Laxenburg“
Wien, 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Perlmutt, Holz, Metallbeschläge, Gouache auf Papier, Leder; Holzkorpus, rundum mit Perlmutt funiert, auf dem Deckel mit Bildfeld, am unteren Bildrand bezeichnet „Laxenburg“; 12,8 × 8,2 × 4 cm
€ 500–1.000

3192
Balthasar Wigand
(Wien 1771–1846 Felixdorf bei Baden)
Nähkassette „Spinnerin am Kreuz“
Wien, um 1810
Perlmutt, Holz, Messingbeschläge, Gouache auf Papier, Samt, Seide, Spiegelglas; Holzkorpus, rundum mit Perlmutt funiert, auf dem Deckel mit Bildfeld, am unteren Bildrand bezeichnet „Spinnerin am Kreuz“ und signiert „Wigand“; 7-teiliges Perlmuttnähzeug; 12,4 × 7,8 × 4 cm
Literatur
vgl. Dr. Marianne Hussl-Hörmann, Dr. Christian Kuhn, Balthasar Wigand. 1770–1846. Sammlung Kuhn, Wien 2021, S. 70–71
€ 1.000–2.000
(Wien 1771–1846 Felixdorf bei Baden)
Briefkassette „Wienansichten“ Wien, um 1825
Perlmutt, Leder, Metallbeschläge, Gouache auf Papier, Seide; Lederkorpus, rundum mit Perlmutt furniert, im Deckel mit Bildfeldern mit Ansichten von Curtys Kaffeehaus auf der Bastei, Schönbrunn, Weilburg und Spinnerin am Kreuz; innen originaler Seidenbezug mit Wochentagsfächern und 2 Taschen am inneren der Deckellaschen; mit Schlüssel; Leder teilweise brüchig und längsseitig gerissen; 2,1 × 32,1 × 25,1 cm (geschlossen), 11 × 50,2 × 41 cm (geöffnet)
€ 7.000–14.000


geöffnete Ansicht

2. Hälfte 18. Jahrhundert
Weichholz, vergoldet, Eisensäge; Emailzifferblatt; Eisengehäuse, Werk mit Spindelgang und Vorderpendel; Spindelhemmung gehört adaptiert, reinigungs- und überholungsbedürftig, Zifferblatt beschädigt; H. 74,4 cm
€ 1.500–3.000

Tischuhr
2. Hälfte 18. Jahrhundert
Metall, teilweise vergoldet; Messingwerk, Spindelgang mit Kette und Schnecke, Vietertelstundenrepetition auf Glocke, kein Selbstschlag; H. 32,2 cm
€ 1.500–3.000

Kaminuhr
Paris, Mitte 19. Jahrhundert
Bronze, Mamorsockel; Emailzifferblatt bezeichnet „CHARPENTIER/BRONZIER“, „A PARIS/ RUE CHARLOT 8“; Messingwerk mit Schlossscheiben, Stunden- und Halbstundenschlag auf Glocke; Schlag auf Glocke; gefähig, mit Schlüssel; H. 53 cm
€ 2.500–5.000
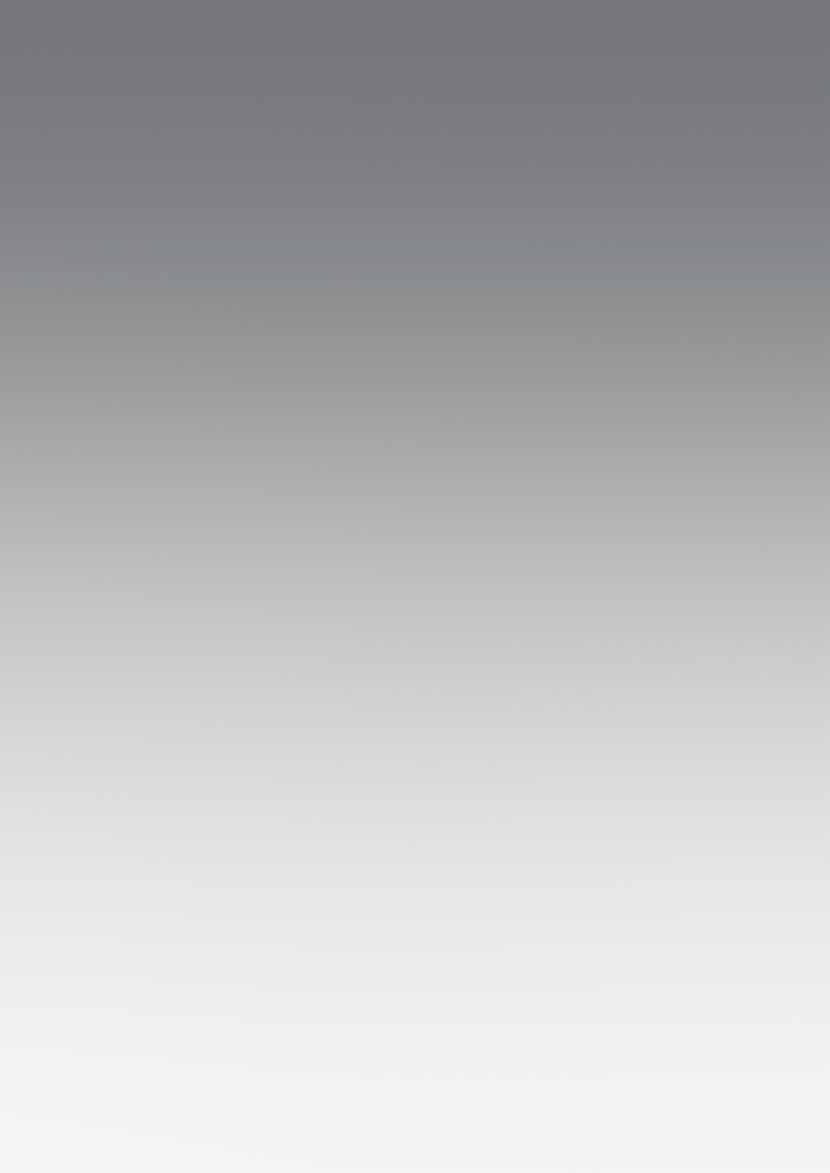
(Wien 1798–1877 Wien)
Laterndl-Jahresuhr
Wien, um 1840
Mahagoni furniertes Gehäuse mit Ahornadern, innen teilweise Ahorn furniert; Emailzifferblatt, signiert „MARENZELLER / IN WIEN“, breite feuervergoldete Lünette, gebläute Stahlzeiger, Springsekunde; Grahamgang, massive Platinen mit verschraubten Werkpfeilern, Seiltrommel mit Rillen für das saubere Aufwickeln der Gewichtsschnur, kardangelagerte Schneideaufhängung, Messing-StahlSekundenkompensationspendel, Gangdauer 400 Tage; Gehäuse restauriert; H. 150 cm
Literatur
Stephan Andréewitch, Die Wand- und Bodenstanduhren der Habsburgermonarchie 1780–1850, Band I, Stuttgart, 2023, S. 521, Nr. 185
€ 25.000–50.000
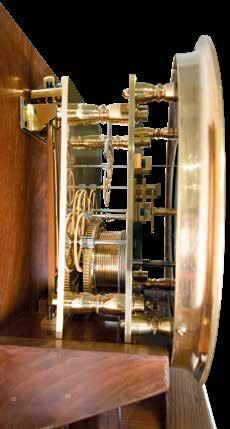
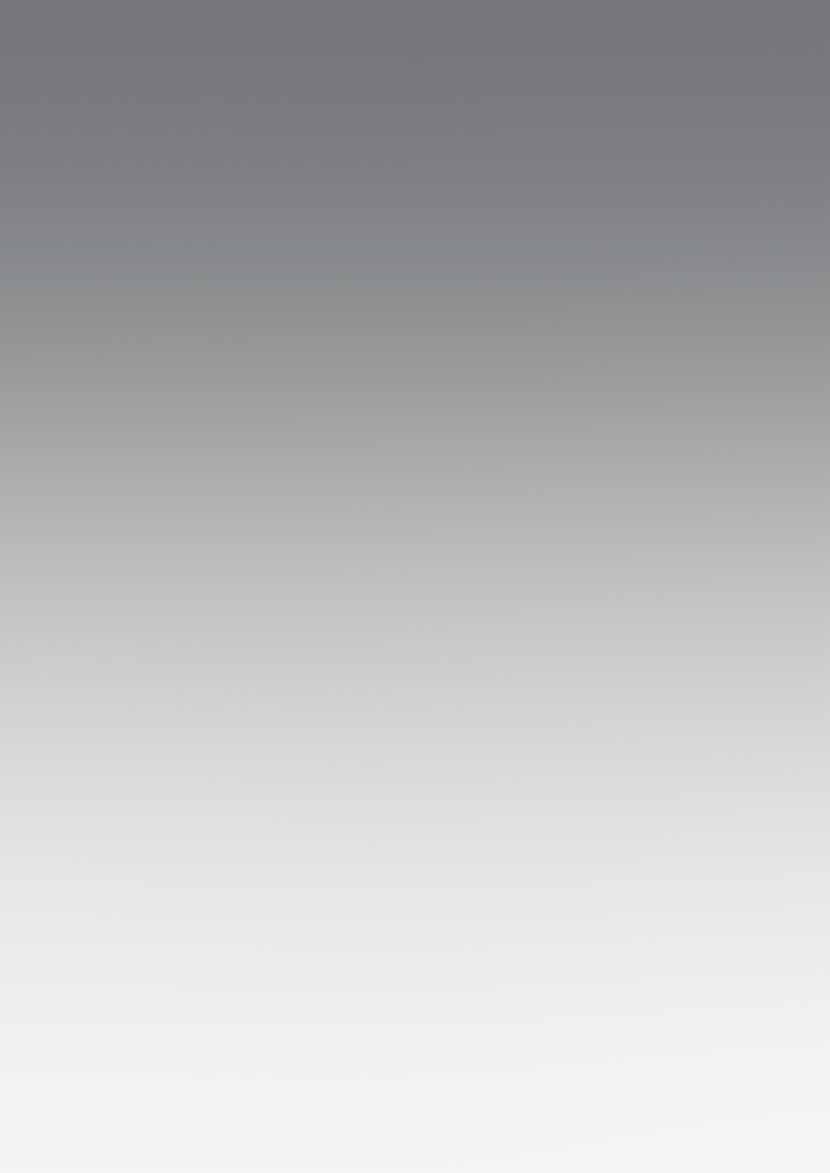

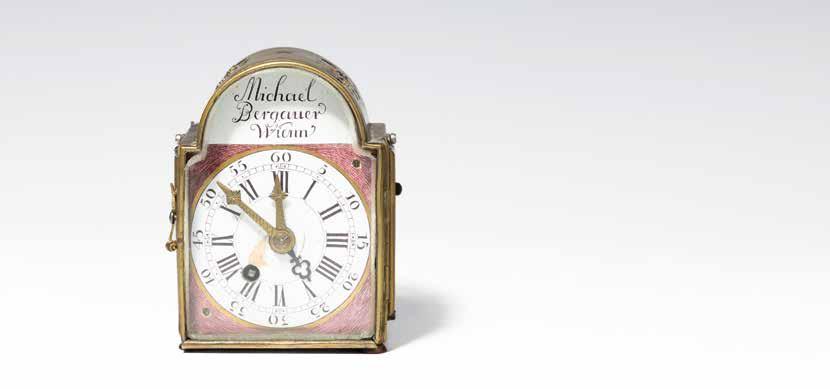
Ende 18. Jahrhundert
Messing; Emailzifferblatt, darüber bezeichnet „Michael/Bergauer/Wienn“; Messingwerk, Spindelgang mit Kette und Schnecke, Schlag auf Glocke, Weckvorrichtung; nicht gehfähig; H. 8,4 cm
Literatur
vgl. Jürgen Abeler, Meister der Uhrmacherkunst. Wuppertal 1977, S. 67
€ 1.000–2.000

Frankreich, Anfang 19. Jahrhundert
Bronze, dunkel patiniert, teilweise vergoldet; vollplastischer Hermes, die Uhr tragend; Emailzifferblatt, vergoldetes Gehäuse, Taschenuhrwerk, bezeichnet „Le Roy, Paris“, Schlüsselaufzug, Spindelgang; mit Schlüssel; H. 19,1 cm
€ 1.000–2.000

2. Hälfte 19. Jahrhundert
Messing, Repoussé-Fronton mit Darstellung von Napoleon auf einem Pferd; Emailzifferblatt; Messingwerk mit Röllchengang; originaler schwarz gebeizter Holzsockel mit Glassturz; reinigungsbedürftig; H. 12,2 cm (inkl. Sturz)
€ 300–600

Frankreich, 2. Hälfte 19. Jahrhundert
Bronze, vergoldet; Emailzifferblatt, Messingwerk, Ankergang, Halbstundenschlag auf Glocke; nicht gehfähig, Schlagfeder gebrochen, Vergoldung teilweise berieben; H. 30,6 cm
€ 800–1.600

Wien, 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Obstholz, furniert, schwarz gebeitzt, 4 Alabaster Säulen; Wiener Messingwerk, mit Wiener Viertelstundenschlag auf Tonfedern, Repetition, skelettiertes Zifferblatt, in der mitte 3 Automaten, 3 Hilfszifferblätter mit Datums-, Wochentags- und Monatsanzeige, am Emailzifferring signiert „P. Rau in Wien“; gehfähig; Feder des Viertelstundenschlages defekt, reinigung- und überholungsbedürftig, 1 Säule beschädigt, Schmied, Schleifer und Augenwender nicht funktionsfähig; H. 53,5 cm
Literatur vgl. Jürgen Abeler, Meister der Uhrmacherkunst. Wuppertal 1977, S. 503
€ 1.000–2.000

Schiffspokal
Nürnberg, um 1620
Silber, teilweise vergoldet; schiffsförmige Kuppa mit vollplastisch ausgeformter Figur der Venus Maritima, der hochgewölbte Fuß mit getriebenem Wellendekor mit 2 Delphinen, der Schaft mit Blattranken; seitlich gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen und Meistermarke „TW“ für Tobias Wolff; H. 19 cm, 179 g Literatur
vgl. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868, S. 458, MZ0989 (Punze) vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868. Goldglanz und Silderstrahl, 2, Nürnberg 2007, S. 747
€ 8.000–16.000



Traubenpokal
Nürnberg, um 1660
Silber, teilweise vergoldet; Fuß, Wandung und Deckel mit getriebenem Traubendekor, der Schaft als vollplastisch ausgeformte Traubenrispe mit Blätterdekor; am Mündungsrand, Deckel und Fuß gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen, Tremolierstich und Meistermarke „RR“ für Reinhold Rühl; H. 16,2 cm, 113 g
Literatur
vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 366, Abb. MZ0769a (Punze)
vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868. Goldglanz und Silderstrahl, 2, Nürnberg 2007, S. 869
€ 2.000–4.000


3205
Kokosnussdose
Wien, Mitte 17. Jahrhundert
Silber, Kokosnusskuppa; 2 Handhaben, der Knauf in Form einer vollplastischen blattverzierten Knospe; seitlich gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen, Meistermarke „IK“, wohl für Georg Kreisenweis und Repunze; H. 14,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 341 g
€ 2.000–4.000
Kokosnuss-Gefäße zählten bereits im Mittelalter zu begehrten Sammlerobjekten und waren bis ins 17. Jahrhundert seltene und beliebte Sammlungsstücke. Die Kokosnuss wurde zu einem reich verzierten Trinkgefäß verarbeitet, da ihr eine schützende Kraft zugesagt wurde. Objekte wie diese bildeten den Grundstock für die kurfürstlichen Kunstund Wunderkammern Europas.

3206
Kluftbecher „Maurer“
Siebenbürgen, datiert „1673“
Silber, teilweise vergoldet; die Wandung in der Sockelzone mit umlaufender getriebenen Jagddarstellung, auf der Vorderseite mit Zunftzeichen der Maurer umlaufend bezeichnet und datiert „K.L. M.V L.M PA/ICH BIN DER ERZAMER VAGNER
GEH/ ANNO 1673 VEREHRET HANNES KLVT/DISEN BECHER CZUM GEDAECHTNIS SEIN“; auf der Unterseite mit Tremolierstich; H. 14,4 cm, 126 g
Literatur
vgl. Siebenbürgische Goldschmiedearbeiten. XV. – XIX. Jahrhundert, Sammlung Dr. Jürgen Fischer, S. 131
€ 2.500–5.000
3207
Nürnberg, um 1705
Silber, teilweise vergoldet; die Wandung mit Schlangenhautpunzierung, glatte Lippe; auf der Unterseite gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen, Tremolierstich und Meistermarke „IP“ mit Stern für Jacob Pfaff; H. 8,6 cm, 119 g
Literatur
vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 307, MZ0641, S. 507, B31 (Punze)
€ 500–1.000

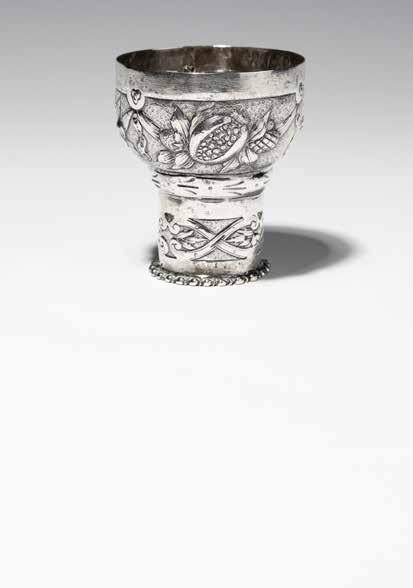
Nürnberg, Mitte 17. Jahrhundert
vergoldetes Silber; die Wandung mit zisliertem Ornamentdekor; auf der Unterseite gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen, Tremolierstich und Meistermarke „FP“ für Filipp Plapert; H. 8 cm, 104 g
Literatur
vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 313, MZ0655 bzw. S. 504, BZ18 (Punze)
€ 500–1.000

3209
Römer
Hanau, 19. Jahrhundert
Silber; die Wandung mit getriebenem Früchtedekor, auf der Unterseite mit graviertem Löwen; außen am Mündungsrand gemarkt mit Neresheimer Marke, „N“ und Feingehaltspunze „13“; H. 8,3 cm, 124 g
Literatur
vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 491, MZ1109, S. 520, FZ13a (Punze)
€ 500–1.000

3210
Kugelfußbecher
Augsburg, 17. Jahrhundert
Silber; die Wandung mit Liliendekor; auf der Unterseite gemarkt mit Augsburger Beschauzeichen, verschlagenen Marken und Importpunze; H. 6,5 cm, 83 g
€ 400–800

wohl 19. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet; filigrangearbeitete Wandung mit Silberperlen, Klappdeckel mit Henkel, innen 1 großes und 1 kleineres Fach, seitlich 2 Handhaben; auf der Unterseite gemarkt mit niederländischer Importpunze für ausländische Gold- bzw. Silbergegenstände; 10,5 × 9 × 14,6 cm, 432 g
Literatur
vgl. Helmut Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529–1868. Meister, Marken, Werke, Bd. II, München 1980, Abb. 133 (Vorbild)
€ 2.500–5.000
Tablett mit Reliefdarstellung
Augsburg, um 1630 oder später
Silber, teilweise vergoldet; der Spiegel mit Bildfeld mit getriebener Landschaftsdarstellung, seitlich 2 Handhaben; am Rand gemarkt mit Augsburger Beschauzeichen, österreichischer Repunze und Meistermarke „BW“ für Johann Baptist Weinold; 22 × 14,8 × 1,5 cm, 97g
Literatur
vgl. Helmut Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529-1868, III, Nr. 1443, S. 256 (Punze)
€ 1.000–2.000


Große Weinprobierschale
Nürnberg, 19. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet; die Wandung und der Spiegel mit getriebenem und teilweise ziseliertem Früchtedekor, seitlich 2 Handhaben; am Rand gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen, österreichischer Importpunze und 2 verschlagenen Marken; 36 × 22,7 × 6,2 cm, Bruttogesamtgewicht: 496 g
€ 500–1.000
3214
Buchrücken
Wien, Anfang 18. Jahrhundert
vergoldetes Silber; auf der Vorderseite mit getriebenem Rankendekor, oben mittig ein Knabengesicht, darunter ein leeres Feld; seitlich gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „171?“ und Meistermarke „CRZ“, wohl für Caspar Zacharias Raimann Ratsherr; 20 × 12 × 1,9 cm, 257g
€ 1.000–2.000
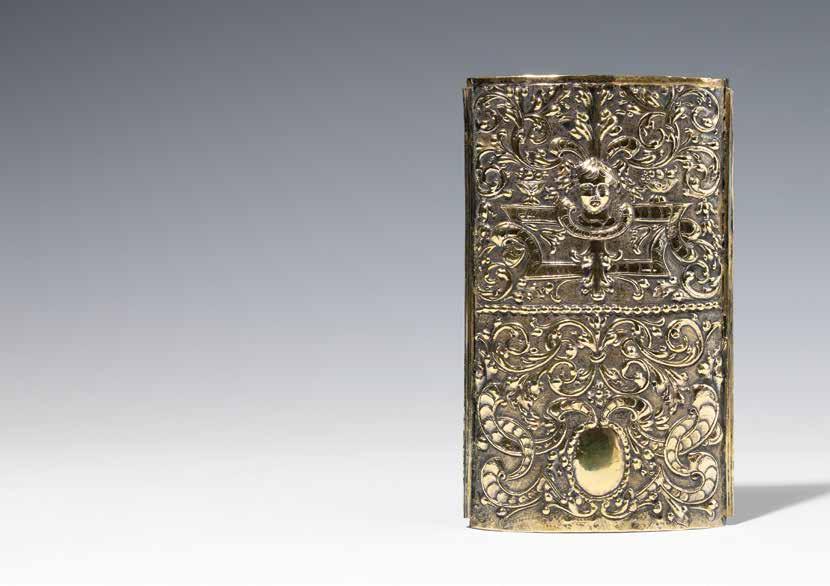

3215
Weinprobierschale
19. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet; der Spiegel mit getriebenem Blütendekor, seitlich 2 Handhaben; am Rand gemarkt mit unidentifiziertem Beschauzeichen und Meistermarke „KP“; 15, 7 × 14,8 × 4,9 cm, 155 g
€ 500–1.000

3216
Weinprobierschale
Ingolstadt, 18. Jahrhundert
vergoldetes Silber; der Spiegel mit getriebenem Früchtedekor, seitlich 2 Handhaben; außen bezeichnet mit „A.R.T.“ und „T.T.“; am Rand gemarkt mit Ingolstädter Beschauzeichen und verschlagener Meistermarke mit „B“; 12,4 × 14,1 × 3,1 cm, 83 g
€ 500–1.000
Paar Reliefportraits „Kaiserpaar“
18. Jahrhundert
Silber, vergoldetes Messing und Kupfer; Kaiserpaar mit Heiligenattributen, u.A. Kreuz und Waage; H. 17,5 bzw. 19,5 cm; Bruttogesamtgewicht: 273 g
€ 700–1.400


3218
Paar Reliefportraits „Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Franz I. Stephan“
18. Jahrhundert
Bronze; Kaiserpaar auf Samtgrund; H. 12,5 bzw. 12,9 cm
€ 1.000–2.000

Relief „Heiliger Andreas“
Sebastiano Avitabile, Neapel, 1. Hälfte 18. Jahrhundert
Silber; Heiliger Andreas mit Kreuz und Fisch; rückseitig mit Tremolierstich; laut Gutachten eine Arbeit des Silberschmieds Sebastiano Avitabile; H. 38,5 cm, 1.290 g
Gutachten von Luigi A. Ronzoni, Wien 1981 liegt vor.
€ 3.500–7.000
Zwei Bücher mit Silbereinband 17./18. Jahrhundert
Silber, Papier mit Goldschnitt; 1 Gebetsbuch bzw. 1 Notizbuch, jeweils mit zweifachem Klappriegelverschluss; das Gebetsbuch mit Sammlungsetikett; H. 9,1 bzw. 12,3 cm, Bruttogesamtgewicht: 580 g
€ 1.000–2.000
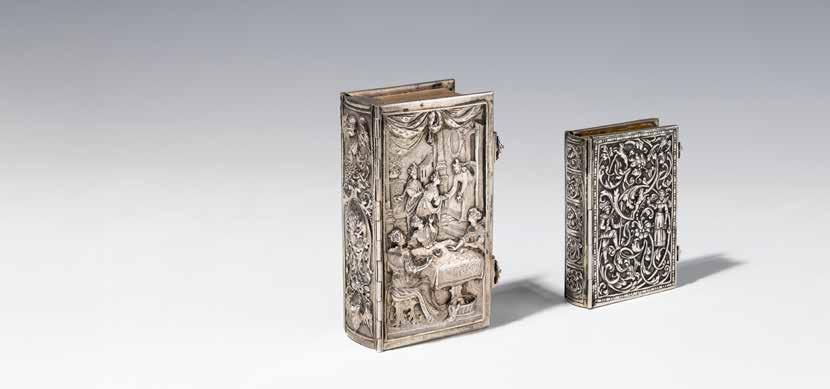
Zwei Gewürzschälchen bzw. Eierbecher
Augsburg, um 1735
vergoldetes Silber; Fuß und Schale mit getriebenem und ziselierten Rankendekor; 1 Becher am Fuß gemarkt mit Augsburger Beschauzeichen, Meistermarke „GM“ für Gottlieb Menzel und Repunze; H. 4 bzw. 4,5 cm, 100 g
Literatur
vgl. Helmut Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529–1868, III, Nr. 2022, S. 310 (Punze)
€ 500–1.000


3222
Eine Deckeldose und drei Flakons 17./18. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet; 1 Deckeldose auf der Unterseite gemarkt mit Augsburger Beschauzeichen und Meistermarke „EH“, wohl für Esaias Hofmann, 1 Flakon gemarkt mit Repunze; 1 Verschluss aus Metall, 1 Flakon mit zusätzlichen Schraubverschlüssen am Fuß und an der Deckelspitze; Dm. 5 cm (Dose), H. 4 bis 4,8 cm (Flakons); Bruttogesamtgewicht: 122 g
Literatur
vgl. Helmut Seling, Die Augsburger Gold- und Silberschmiede 1529–1868. Meister Marken Werke, München 2007, S. 491, Abb. 2041
€ 500–1.000
Kassette
Deutsch, um 1710
Holz, Silberfolie, Goldrubinglas, Spiegelglas, mamoriertes Papier; silberfolierte Kassette mit getriebenem Dekor, gravierte Goldrubinglasmedaillons und -säulen; mit Schlüssel; 23,5 × 17 × 12 cm
€ 2.500–5.000


geöffnete Ansicht

3224
Sechs Petschafte, eine Schere und ein Portemoinnaie
18./19. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet, Metall, Leder, Halbedelstein; 6 Petschafte, davon 3 Silber, 3 Metall; mehrfach gemarkt, u.A. mit Londoner Beschauzeichen; L. 4,5 bis 9,3 cm, Bruttogesamtgewicht: 201 g
€ 500–1.000

3225
Acht Döschen
18./19. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet, Metall, Rubine, Email; mehrfach gemarkt, u.A. mit russischem Beschauzeichen; L. 1,8 bis 6 cm, Bruttogesamtgewicht: 153 g
€ 500–1.000
Kopenhagen, 2. Hälfte 18. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet, Bergkristall; die Wandungen mit getriebenem Dekor, jeweils mit Klappdeckel und zusätzlicher Klappe am Boden; 1 Riechdose mit vollplastisch ausgeformtem Vöglein auf dem Deckel und 1 mit foliertem Bergkristall; 2 Dosen im Deckel gemarkt mit verschlagener Marke bzw. unidentifizierter Meistermarke „AI“ und „78“; 1 Dose am Deckel mit Besitzermonogramm und datiert „1778“; H. 6 bis 7,7 cm, Bruttogesamtgewicht: 95 g
Literatur
vgl. Anni Wagner, Gefäße für den Duft. Handwekliche Kostbarkeiten aus der Drom Schatzkammer, Baierbrunn 1981, S. 67
€ 800–1.600


London/Paris, 18./19. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet; die Wandungen mit getriebenem Dekor; 2 Dosen innen gemarkt mit bekröntem „Z“ und Exportpunze bzw. 1 Dose gemarkt mit Londoner Beschauzeichen, Tremolierstrich und Meistermarke „TG“; 2,7 × 6,6 × 5,4 bis 3 × 8 × 6,6 cm, 249 g
€ 600–1.200

Tschechien/Ungarn, 18. Jahrhundert
Silber; die Wandungen mit getriebenem bzw. ziseliertem Dekor; 2 Dosen innen gemarkt mit Meistermarken „R“, Handpunze, verschlagenem ungarischem Beschauzeichen bzw. tschechischer Meistermarke „CA“; 3 × 6,3 × 5,5 bis 2,9 × 7,5 × 5,6 cm, 215 g
€ 600–1.200

Fisch-Nähnecessaire und zwei Fischdosen
19./20. Jahrhundert
Silber, Email, rotes Glas; 3 Gefäße in Fischgestalt, davon 1 Etui für Nähzubehör und 2 Dosen, 1 Deckel verschraubt, 1 Flosse wohl gebrochen; 7-teiliges Nähnecessaire in originalem Etui; teilweise gemarkt; L. 7 bis 12,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 124 g (exkl. Etui, inkl. Nähutensilien)
€ 500–1.000

wohl 19. Jahrhundert, im Stil von Sebald Schwarz
Silber; auf der Vorderseite mit Ritter mit Wappen, rückseitig mit bekröntem Monogramm; auf dem Deckel ein Uhrwerk, Schlüsselaufzug, Spindelgang mit Saite und Schnecke; auf der Platine bezeichnet „Seb. Schwarz/NVRNBERG“; seitlich punziert mit Meistermarke Imitation „Thomas I. Stör“ und Nürnberger Beschauzeichen; Werk korrodiert, rep. bed.; 6,7 × 7,6 × 5,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 232 g
Literatur
vgl. Jürgen Abeler, Meister der Uhrmacherkunst. Wuppertal 1977, S. 577 vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 497, Abb. MZ1146b (Punze)
€ 500–1.000

3231
Besamimturm
19. Jahrhundert
Silber; durchbrochen gearbeitete Wandung, 2-teiliger Turmaufbau, die unterste Etage mit Türchen, Spitzdach innen mit Glöckchen; Türchen innen gemarkt mit „ST 925“; H. 18,1 cm, 125 g
€ 250–500

Besamimturm
19. Jahrhundert
Silber; durchbrochen gearbeitete Wandung, 2-teiliger Turmaufbau, die unterste Etage mit Türchen und 4 Fahnen; innen mit Lötstelle; H. 19 cm, 75 g
€ 250–500

Besamimturm
19. Jahrhundert
Silber; durchbrochen gearbeitete Wandung, 2-teiliger Turmaufbau, die unterste Etage mit Türchen und 3 Fahnen; 1 Fahne fehlt; H. 19,5 cm, 74 g
€ 250–500

Becher
Moskau, datiert „1775“
Silber; die Wandung mit getriebenem Ranken- und Adlerdekor; auf der Unterseite gemarkt mit Moskauer Beschauzeichen, Beschaumeistermarke „1775“, Qualitätsgütepunze und Meistermarke „TѲ*“ für Timofej Filippow; am Fuß verbeult; H. 8,5 cm, 96 g Literatur vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold- und Silbermarken, S. 55 (Punze)
€ 500–1.000

3235
Zwei Sockelbecher
Wien/Moskau, um 1850
Silber; die Wandungen mit getriebenem bzw. ziseliertem Ranken- und Ornamentdekor; jeweils seitlich gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „1840“ und Meistermarke „FT“ bzw. Meistermarke „IИ“, verschlagener Beschaumeistermarke „1855“, Silberfeingehalt „84“ und Moskauer Beschauzeichen; H. 10,1 bzw. 12,4 cm, 164 g
€ 300–600

Drei Becher
Wien/Moskau/Ohlau, 18./19. Jahrhundert
Silber, innen vergoldet; die Wandungen mit getriebenem bzw. ziseliertem Trauben-, Blumen- bzw. Rankendekor mit Vögeln; seitlich und auf der Unterseite gemarkt mit Wiener, Moskauer, bzw. Neusohler Beschauzeichen und Meistermarken; H. 7,4 bis 10,1 cm, Bruttogesamtgewicht: 246 g
€ 1.000–2.000
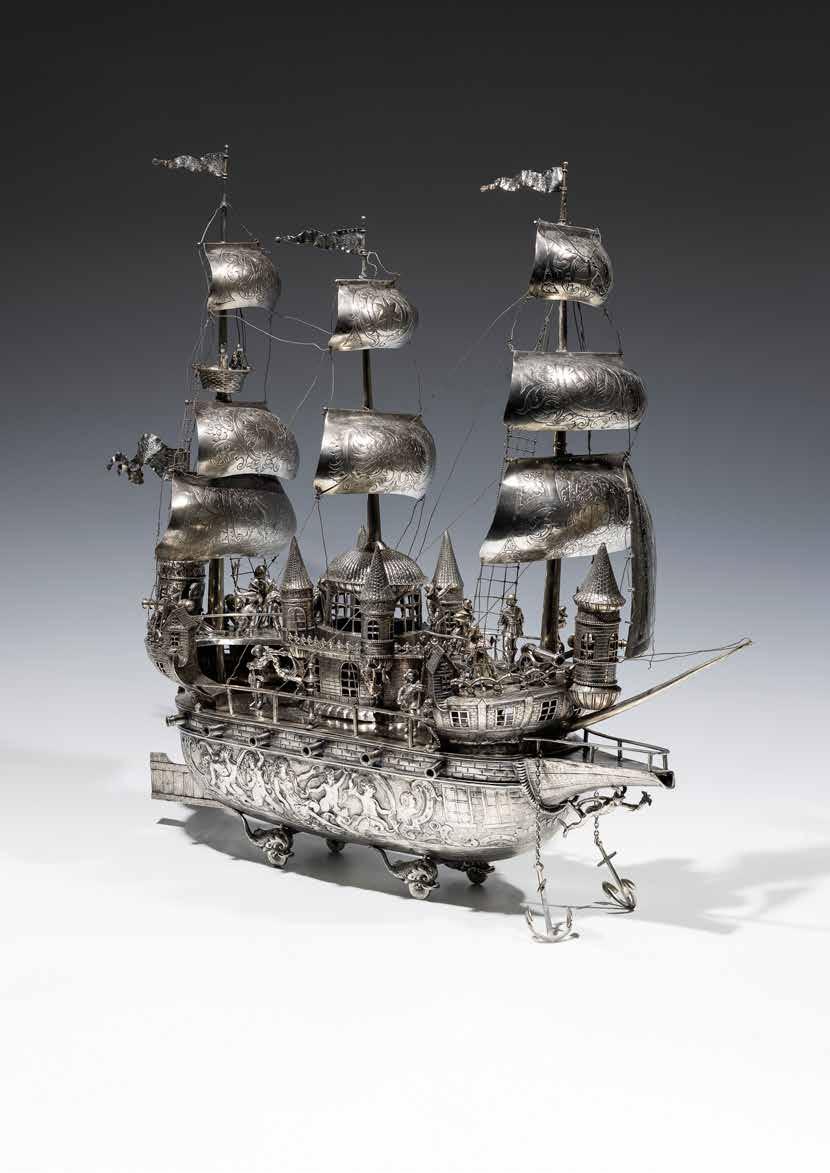
Großes Trinkschiff
Hanau, 19. Jahrhundert
Silber; Dreimaster Segelschiffsmodell mit vollplastisch ausgeformten Figuren, Kanonenläufen und Ankern; das Schiffsdeck öffenbar, der Bug als Ausguss, auf 4 Rädern; ca. 63,5 × 66 × 22 cm, 5.016 g
€ 10.000–20.000
Löffel

St Petersburg, datiert „1841“ Silber, teilweise vergoldet, Niello-Technik; die Laffe mit Darstellung des Palastplatzes in St. Petersburg, darunter mit Monogramm „AM“ und datiert „1841“; innen gemarkt mit Silberfeingehalt „84“ und verschlagenen Marken; L. 16,9 cm, Bruttogesamtgewicht: 66 g
€ 1.000–2.000
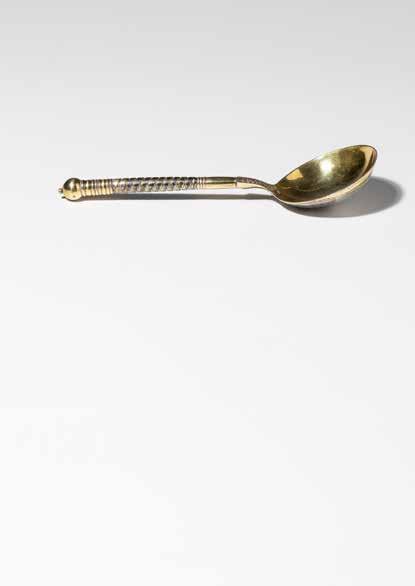

Moskau, 1827
Silber, teilweise vergoldet, Niello-Technik; der Deckel und die Wandung mit Darstellungen einer Kutschfahrt bzw. eines musizierenden Knabens; innen und im Deckel mehrfach gemarkt mit Moskauer Beschauzeichen, Meistermarke „A.A“, Beschaumeistermarke „H.A/1827“, und Silberfeingehalt „84“; H. 13,4 cm, 16 g
€ 1.000–2.000

Sechs
Russland, 2. Hälfte 19. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet, Niello-Technik; die Kellenlaffe mit Dorfdarstellung; die Griffe jeweils gemarkt mit Moskauer Beschauzeichen, Beschaumeistermarke „BC/1873“ für Viktor Saweinikow, Silberfeingehalt „84“, Meistermarke „ИД“ und österreichischer Importpunze; H. 13,7 bzw. 16,6 cm, 153 g
Literatur
vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold- und Silbermarken, S. 42 (Punze)
€ 800–1.600

St. Petersburg, 1799
Holz, bemalt, Silberoklad; im Zentrum mit Madonnendarstellung, umgeben von Jüngern und kyrillisch bezeichneten Medaillons; auf der Unterseite gemarkt mit St. Petersburger Beschauzeichen, Beschaumeistermarke „1799“ und Meistermarke „KH“; 35,5 × 29,5 cm
€ 5.000–10.000


Russland, 19. Jahrhundert
Bronze, Email; außen graviert mit Kreuzdarstellung vor Stadtansicht, Tryptichon innen mit Christus- und 2 Heiligendarstellungen, kyrillisch bezeichnet; 16,4 × 13,6 cm (geschlossen)
€ 500–1.000

3243
Paar Kowsch
Moskau, Anfang 20. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet, Email in Cloisonné-Technik; auf der Unterseite gemarkt mit Beschaumeistermarke mit Silberfeingehalt „84“ und Meistermarke „ИP“ für Ilka Iwanow Romanow; L. 7,2 cm, Bruttogesamtgewicht: 88 g
Literatur
vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold- und Silbermarken, S. 21 und S. 95 (Punzen)
€ 1.000–2.000

Münzbehälter
Moskau, Anfang 20. Jahrhundert vergoldetes Silber, Email in CloisonnéTechnik; die Wandung gemarkt mit Beschaumeistermarke mit Silberfeingehalt „84“; jeweils oben eindrückbar; L. 6,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 40 g
Literatur
vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold- und Silbermarken, S. 95 (Punzen)
€ 1.000–2.000

3245
Kowsch
wohl Moskau, 1. Hälfte 20. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet, Email in Cloisonné-Technik; auf der Unterseite gemarkt mit verschlagener Beschaumeistermarke mit Silberfeingehalt „84“ und Meistermarke wohl „MC“; L. 7 cm, Bruttogesamtgewicht: 47 g
€ 800–1.600

3246
Humpen
Moskau, 1888
vergoldetes Silber, Email in Cloisonné-Technik; der Deckel bezeichnet mit „Um freundliche Gedenken bitten in Dankbarkeit“ und „Prof. C. Lovis u. Frau Riga 1894“; auf der Unterseite gemarkt mit Moskauer Beschauzeichen, Beschaumeistermarke „BC/1888“ für Viktor Sawinkow, Silberfeingehalt „84“ und Meistermarke „GK“; H. 19 cm, Bruttogesamtgewicht: 524 g
Literatur
vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold- und Silbermarken, S. 42 (Punze)
€ 5.000–10.000

Schale
Moskau, Anfang 20. Jahrhundert
Silber, Email in Cloisonné-Technik; auf der Unterseite gemarkt mit Beschaumeistermarke mit Silberfeingehalt „84“, Meistermarke „ДH“; Dm. 6,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 52 g
Literatur
vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold- und Silbermarken, S. 47 (Punze)
€ 500–1.000

Löffel
Russland, 19./20. Jahrhundert
vergoldetes Silber, Email in CloisonnéTechnik; seitlich gemarkt mit Silberfeingehalt „84“ und verschlagenen Marken; L. 19,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 60 g
€ 1.000–2.000

Moskau, 1886
vergoldetes Silber, Email in CloisonnéTechnik; auf der Unterseite gemarkt mit Beschaumeistermarken „BC/1886“ für Viktor Sawinkow, Silberfeingehalt „84“ und Meistermarke „ИC“ für Pawel Fedorowitsch Sasikow; H. 6,7 cm, Bruttogesamtgewicht: 64 g
Literatur
vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold- und Silbermarken, S. 42 und S. 54 (Punzen)
€ 800–1.600

3250
Becher mit Untertasse
Moskau, 1877
Silber, teilweise vergoldet, Niello-Technik; die Wandung und Untertasse mit Darstellung des Moskauer Kreml bzw. der Basiliuskathedrale, umlaufend kyrillisch bezeichnet; auf der Unterseite gemarkt mit Moskauer Beschauzeichen, Beschaumeistermarken „BC/1877“, „BC“ für Viktor Sawinkow bzw. „NK/1877“, Silberfeingehalt „84“ und verschlagene Marken; H. 13,2 cm, Dm. 13,9 cm, Bruttogesamtgewicht: 308 g
Literatur
vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold- und Silbermarken, S. 42 (Punze)
€ 3.500–7.000
Mitte 18. Jahrhundert
vergoldetes Kupfer, Stahl; 18-teiliges Tafelbesteck, bestehend aus: 6 Gabeln, 6 Messern und 6 Löffeln; originales Lederetui mit Samtbezügen, außen datiert „1624“; L. 17 bis 22 cm, Bruttogesamtgewicht: 1.405 g (exkl. Etui)
€ 1.000–2.000


Mitte 18. Jahrhundert
vergoldetes Kupfer, Stahl; 7-teiliges Reisebesteck bestehend aus: 1 Gabel, 1 Messer, 1 Suppen- und 1 Dessertlöffel, 1 Fleischgabel, 1 Salz und Pfeffer Dose sowie 1 Gewürzschälchen bzw. Eierbecher; originales Lederetui mit Samtbezügen; L. 13,5 bis 24,5 cm (Besteck), L. 5,2 cm (Dose), H. 4,1 cm (Eierbecher), Bruttogesamtgewicht: 496 g (exkl. Etui)
€ 1.000–2.000
3253
Paar Weinbecher
Lemberg, 18. Jahrhundert
vergoldetes Silber; die Wandungen mit ziseliertem Dekor; seitlich auf der Wandung und am Fuß gemarkt mit wohl Lemberger Beschauzeichen, Repunze und Taxfreistempel; H. 14,3 cm, 293 g
€ 700–1.400


3255
Krügerl
Nürnberg, um 1720
Silber; glatte Wandung, schnabelförmiger Ausguss; auf der Unterseite gemarkt mit Nürnberger Beschauzeichen, Tremolierstich und Meistermarke „CR“ mit Stern für Conrad Klein; H. 13 cm, 200 g
Literatur
vgl. Germanisches Nationalmuseum (Hg.), Nürnberger Goldschmiedekunst 1541–1868 Teil I. Textband, 1, Nürnberg 2007, S. 220, MZ0438 bzw. S. 507, BZ34 (Punze)
€ 500–1.000

Fußbecher
18. Jahrhundert
vergoldetes Silber; die Wandung mit ziseliertem Dekor; auf der Unterseite gemarkt mit nicht identifizierbarer Wappenpunze und Meistermarke; H. 10,8 cm, 224 g
€ 500–1.000

Ohlau, 18. Jahrhundert
Silber, innen vergoldet; die Wandung mit ziseliertem Dekor; auf der Unterseite gemarkt mit Ohlauer Beschauzeichen, Tremolierstich und Meistermarke „WSP“; H. 12,2 cm, 111 g
€ 500–1.000
3257
Godendose
Wien, 1740
Silber, innen vergoldet; godronierte Wandung, seitlich 2 Handhaben, am Deckel 4 Ringe, die als Füße dienen; auf der Unterseite und seitlich am Deckel gemarkt mit AltWiener Beschauzeichen „1740“ und Meistermarke „ILM“; 15 × 15 × 7,6 cm, 312 g
€ 500–1.000


3259
Godendose
Augsburg, um 1770
Silber, innen vergoldet; godronierte Wandung, seitlich 2 Handhaben, am Deckel 4 Steher, die als Füße dienen, auf der Unterseite und seitlich am Deckel gemarkt mit Tremolierstich, Meistermarke „ACH“ für Adolf Carl Holm und Augsburger Beschauzeichen „T“; auf der Unterseite mit Monogramm „MH“; 19,1 × 12,5 × 8 cm, 289 g
Literatur
vgl. Helmut Seling, Die Augsburger Gold- und Silberschmiede 1529–1868. Meister Marken Werke, München 2007. S. 798, Nr. 2434
€ 500–1.000

3258
Zuckerdose
Moskau, 1743
Silber; geschwungene Wandung mit ziseliertem Dekor; auf der Unterseite und dem Deckel gemarkt mit Moskauer Beschauzeichen „1743“, Meistermarke „AK“ wohl für Ankudin Artamonow Koptew, Beschaumeistermarke „AR“, für Afanasij Rybakow und Tremolierstich; auf der Unterseite mit Widmung; 13,5 × 10,5 × 8,5 cm, 272 g
Literatur
vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold und Silbermarken, S. 41 bzw. S. 44 (Punze)
€ 700–1.400

Wien, 1741
Silber, innen vergoldet; godronierte Wandung, seitlich 2 Handhaben, am Deckel 4 Ringe, die als Füße dienen; auf der Unterseite gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „1741“ und Meistermarke „BK“ im Herz; 13,5 × 17 × 7 cm, 298 g
€ 700–1.400

Augsburg und Moskau, 18. Jahrhundert Silber, teilweise vergoldet; Stand mit godroniertem Rand und getriebenem Akanthusblattdekor, gedrehter Schaft; seitlich und auf der Unterseite gemarkt mit Moskauer Beschauzeichen, Meistermarke „AA“ für Andrej Andrejew, Beschaumeistermarke „AӨП“ für Petrow Alderman und Tremolierstich, der Fuß gemarkt mit Augsburger Beschauzeichen und Meistermarkte „IM“; auf der Unterseite bezeichnet „SEFVS“; Fuß und Schaft später zusammengefügt; H. 21,3 cm, 907 g
Literatur
vgl. Slawisches Institut München, Verzeichnis der russischen Gold und Silbermarken, S. 41 bzw. 43 (Punze)
€ 500–1.000

Wien, 1783
Silber; Rocaillendekor mit ornamentalem Blattwerk; jeweils am Fuß gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „1783“ und Meistermarke „AW“ für Anton Wittmann; H. 21 cm, 393 g
Literatur
vgl. Waltraud Neuwirth, Wiener Goldund Silberschmiede und Ihre Punzen, 1781–1822, II, S. 143 (Punze)
€ 500–1.000

18. Jahrhundert
Silber; glatte bzw. teilweise getriebene Wandung, seitlich am Rand gemarkt mit unidentifizierten und verschlagenen Marken; seitlich bezeichnet „B.A.I.“; H. 19 cm, 607 g
€ 500–1.000

Deutschland, 19. Jahrhundert
Silber; die Wandungen durchbrochen gearbeitet; die große Schale mit Monogramm „SM“; jeweils gemarkt mit Halbmond, Krone, Silberfeingehalt „800“ und „SCHWARZER & STEINER“; H. 5,2 bis 12,8 cm, 1.164 g
€ 1.000–2.000

3265
Samowar Garnitur
Berlin/London, um 1900
Silber; Samowar-Garnitur, bestehend aus: 1 Heißwasserkanne, 1 Stövchen, 1 Kocher, 1 Zuckerdose und 1 Milchkanne; Heißwasserkanne, Stövchen und Kocher jeweils auf der Unterseite gemarkt mit „J.H.WERNER/BERLIN“, Halbmond, Krone und Silberfeingehalt „925“, die Zuckerdose seitlich gemarkt mit verschlagenem Londoner Beschauzeichen und Meistermarke „TB“ für Thomas Bradbury & Sons; Knäufe teilweise später bzw. nicht fixiert; H. 8 cm bis 34,3 cm, Bruttogesamtgewicht: 1.796 g
€ 1.000–2.000
Tafelbesteck für zwölf Personen
Josef Carl Klinkosch, Wien, um 1900
Silber; 86-teiliges Besteck, bestehend aus: 6 × 12 Tafelbestecken, 1 × 10 Teelöffel und 4 Vorlegern; jeweils gemarkt mit „JCK“ für Josef Carl Klinkosch, Dianakopfpunze, Hoflieferantenzeichen und Meistermarke „MS“; die einzelnen
Teile wie folgt: 12 Vorspeisengabeln, 12 Vorspeisenmesser, 12 Suppenlöffel, 12 Menügabeln, 12 Menümesser, 10 Teelöffel, 12 Mokkalöffel, 1 Suppenschöpfer, 2 Salatvorleger, 1 Vorlegemesser; Bruttogesamtgewicht: 5.007 g
€ 1.500–3.000


Zwölf Teelöffel, eine Zuckerzange und ein Spieß
Wien, um 1900
Silber, teilweise vergoldet, Metall; Löffel und Zuckerzange jeweils gemarkt mit Dianakopf- bzw. Windhundpunze, Meistermarke „SW“ bzw. „GK“ und verschlagene Marken; L. 10, 7 bis 11,6 cm, 135 g (exkl. Spieß)
€ 300–600

Wien, um 1860
Silber, teilweise vergoldet, Samt, Leder; 6-teiliges Reisebesteck, bestehend aus: 1 Messer, 1 Gabel, 1 Suppen- und 1 Teelöffel, 1 Becher und 1 Dose; jeweils gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen und Meistermarke wohl „PIS“; originales Lederetui mit Samtbezügen, geprägt bezeichnet „Andenken an DADJEVO.“; L. 15,6 bis 21,2 cm (Besteck), H. 10 cm (Becher), 5,6 × 4,6 × 2 cm (Dose), Bruttogesamtgewicht: 464 g (exkl. Etui)
€ 1.000–2.000

Zuckerdose
Wien, um 1820
Silber; teilweise durchbrochen gearbeitete Wandung, seitlich 2 Handhaben, der Deckelknauf als vollplastisch ausgeformte Blumenranke; auf der Unterseite gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen, Vorratspunze und „GB“; H. 15 cm, 259 g
€ 500–1.000

Zuckerstreuer und zwei Becher
Wien, 19./20. Jahrhundert
Silber, teilweise innen vergoldet; Zuckerstreuer mit Schraubverschluss und Balusterschaft, mittig mit Monogramm „SM“; jeweils im Deckel bzw. seitlich gemarkt mit Dianakopfpunze und Meistermarke „IH“ bzw. Tukankopf-, Kleeblattpunze und Silberfeingehalt „800“; H. 7,9 bzw. 14,1 cm, 289 g
€ 500–1.000
Tafelbesteck für zwölf Personen
Wien, um 1900
Silber; 105-teiliges Besteck, bestehend aus: 7 × 12 Tafelbestecken und 21 Vorlegern; jeweils gemarkt mit Dianakopfpunze und unterschiedlichen Meistermarken; Kassette mit Lade; die einzelnen Teile wie folgt: 12 Vorspeisengabeln, 12 Vorspeisenmesser, 12 Suppenlöffel, 12 Menügabeln, 12 Menümesser, 12 Teelöffel, 12 Mokkalöffel, 1 Suppenschöpfer, 1 kleiner Schöpfer, 2 Salatvorleger, 1 Saucenlöffel, 1 große Vorlegegabel, 1 kleine Vorlegegabel, 1 Zuckerstreulöffel, 1 Vorlegemesser, 1 Tortenheber, 1 Zuckerzange, 4 Salzschälchen, 4 Salzlöffelchen, 2 Schälchen; Bruttogesamtgewicht: 6.189 g
€ 8.000–16.000


Besteckauswahl
Zwei Gewürzschälchen
Wien, 19. Jahrhundert
Silber; godronierte Wandungen, die Schäfte als vollplastisch ausgeformte Schwäne, 1 Flügel wohl fehlend; am Fuß gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen, „ICZ“ und Meistermarke „IW“ im Wappen; H. 8 cm, 95 g
€ 400–800


Gewürzschälchen
wohl Lyon, 2. Hälfte 18. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet; muschelförmige Schale mit Hippokamp, der Schaft als vollplastisch ausgeformter Faun; seitlich gemarkt mit wohl Lyoner Beschauzeichen, Tremolierstich und weiteren Marken; H. 14 cm, 183 g
Literatur
vgl. Jan Divis, Silberstempel aus aller Welt. Augsburg 1992, S. 179, Abb. 1422 (Punze)
€ 300–600

Tintenfass und Streusandbehälter 18./19. Jahrhundert
Silber; godronierte Wandung, jeweils mit Einsatz, davon 1 durchbrochen gearbeitet; mehrfach gemarkt mit unidentifizierter Engelspunze und Meistermarke „PG“; H. 8 cm, 348 g
€ 400–800
Tafelbesteck für zwölf Personen
Wien, 19. Jahrhundert
Silber; 52-teiliges Besteck, bestehend aus: 4 × 12 Tafelbestecken und 4 Vorlegern; jeweils gemarkt mit AltWiener Beschauzeichen „1818“ und Doppeladlerpunze; jeweils mit Monogramm „JT“; Kassette mit zwei Etagen; die einzelnen Teile wie folgt: 12 Suppenlöffel, 12 Menügabeln, 12 Menümesser, 12 Teelöffel, 1 Suppenschöpfer, 1 kleiner Schöpfer, 2 Vorlegelöffel; 4.621 g
€ 4.000–8.000


Besteckauswahl

Konfektbesteck für zwölf Personen
Wien, 19. Jahrhundert
Silber; 24-teiliges Besteck, bestehend aus: 12 Konfektgabeln und 12 Konfektmessern; jeweils gemarkt mit Dianakopfpunze und Meistermarke „RO“ für Rudolf Oswald; jeweils mit bekröntem Monogramm „Z“; 698 g
Literatur vgl. Neuwirth, Wiener Gold und Siberschmiede und ihre Punzen, II, S. 90 (Punze)
€ 500–1.000

Fischbesteck für sechs Personen
Wien, um 1900
Silber, vergoldet; 12-teiliges Besteck, bestehend aus: 6 Fischgabeln und 6 Fischmessern; jeweils gemarkt mit Dianakopfpunze und Meistermarke mit Vase für Heinrich Ecker; jeweils mit Monogramm „FS“; 797 g
Literatur
vgl. Neuwirth, Wiener Gold und Siberschmiede und ihre Punzen, I, S. 161 (Punze)
€ 500–1.000
Obstbesteck für 12 Personen
Karlsruhe, um 1900
Silber, teilweise vergoldet; 24-teiliges Besteck, bestehend aus: 12 Obstgabeln und 12 Obstmessern; jeweils gemarkt mit Halbmond, Krone und Silberfeingehalt „800“; 620 g
€ 1.000–2.000


Fischbesteck für zwölf Personen
Mannheim, um 1900
Silber; 24-teiliges Besteck, bestehend aus: 12 Fischgabeln und 12 Fischmessern; jeweils gemarkt mit Silberfeingehalt „800“, jeweils mit bekröntem Monogramm „EB“; 1.341 g
€ 1.500–3.000

Mayerhofer und Klinkosch, Wien, 1853
Silber; glatte und teilweise getriebene Wandung; jeweils am Fuß gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „1853“ und Meistermarke „M&K“; H. 23,3 cm, 526 g
Literatur vgl. Sonja Reisch, Die Gold-, Silberund Metallwarenfabrik J.C. Klinkosch. Wien 1997, S. 150 (Punze)
€ 700–1.400

Wien, 1807
Silber; glatte Wandung; jeweils am Fuß gemarkt mit teilweise vergschlagenem Alt-Wiener Beschauzeichen „1807“, Repunze, Taxfreistempel und Meistermarke „FW“; H. 24,5 cm, 756 g
€ 500–1.000

Wien, 1860
Silber; die Schäfte als vollplastisch ausgeformte Figuren; jeweils auf dem Fuß gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen und Meistermarke „MAYER“; H. 21,1 cm, 355 g
€ 1.000–2.000
Tafelbesteck für zwölf Personen
wohl Mayerhofer & Klinkosch, Wien, um 1900 Silber; 92-teiliges Besteck, bestehend aus: 7 × 12 Tafelbestecken und 8 Vorlegern; jeweils gemarkt mit Dianakopfpunze, Meistermarke „MS“ und weiteren Marken; jeweils mit Monogramm „JC“; Kassette mit 2 Etagen; die einzelnen Teile wie folgt: 12 Vorspeisengabeln, 12 Vorspeisenmesser, 12 Suppenlöffel, 12 Menügabeln, 12 Menümesser, 12 Teelöffel, 12 Mokkalöffel, 1 Suppenschöpfer, 1 kleiner Schöpfer, 2 Salatvorleger, 2 Salzschälchen mit Glaseinsatz, 2 Salzlöffelchen; Bruttogesamtgewicht: 5.161 g (exkl. Glaseinsätze)
€ 7.000–14.000


Besteckauswahl

3284
Eisbesteck für zwölf Personen
Ladislaus Jarosinski, Wien, 19. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet; 13-teiliges Besteck, bestehend aus: 12 Eislöffeln und 1 Servierlöffel; jeweils gemarkt mit Dianakopfpunze und Meistermarke „LJ“; 357 g
€ 300–600

Olmütz, 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Silber; jeweils gemarkt mit Olmützer Beschauzeichen und verschlagener Meistermarke, wohl „EW“; 6 Löffel mit Monogramm „AL“; 227 g
€ 300–600

3286
Tafelbesteck für sechs Personen
Vincenz Carl Dub, Wien, um 1900
Silber; 39-teiliges Besteck, bestehend aus 6 × 6 Tafelbestecken und 3 Vorlegern; jeweils gemarkt mit Tukankopfpunze, Feingehaltspunze „800“ und Meistermarken; Kassette, 2 Schlüssel liegen bei; die einzelnen Teile wie folgt: 6 Menümesser, 6 Menügabeln, 6 Suppenlöffel, 6 Vorspeisenmesser, 6 Vorspeisengabeln, 6 Dessertlöffel, 1 Suppenschöpfer, 1 Vorlegelöffel und 1 Vorlegegabel; Bruttogesamtgewicht: 2.586 g
€ 1.000–2.000
3287
Wien, 19. Jahrhundert
Silber; die Wandung umlaufend mit getriebenem Dekor; am Mündungsrand seitlich gemarkt mit AltWiener Beschauzeichen und verschlagener Meistermarke; H. 19,4 cm, 371 g
€ 400–800


Wien, 1846
Silber, innen vergoldet; die Wandung und der Deckel mit getriebenem Dekor; auf der Vorderseite mit Monogramm „KW“, auf der Unterseite datiert „4/11 1853“; die Wandung seitlich und im Deckel gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „1846“ und Meistermarke „IW“; H. 17,6 cm, 212 g
€ 500–1.000

3289
Wien, 19. Jahrhundert
Silber; die Fahnen mit godroniertem bzw. getriebenem Dekor, 1 Schale seitlich mit 2 Handhaben und kugelförmigen Füßen; jeweils gemarkt mit „WB“ für Wenzel Blaschka bzw. Alt-Wiener Beschauzeichen und Meistermarke wohl „KM“ für Karl Michalik; L. 34,7 bzw. 37 cm, Bruttogesamtgewicht: 1.171 g
Literatur
vgl. Waltraud Neuwirth, Wiener Gold- und Silberschmiede und ihre Punzen, 1781–1866, S. 49 bzw. S. 66 (Punzen)
€ 600–1.200
3290
Silberkanne
Wien, 1776
Silber; godronierte Wandung, Klappdeckel und -ausguss; im Deckel und seitlich auf der Wandung gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „1776“ und Meistermarke „TME“; H. 22 cm, 459 g
€ 300–600


Wien/Iglau, 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Silber; glatte Wandung, Becher mit 6 Kaffeelöffeln in Halterung; seitlich auf dem Fuß und auf den Löffeln gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen „182?“ und verschlagener Meistermarke bzw. Iglauer Beschauzeichen „1834“ und Meistermarke „KK“; H. 17 cm (inkl. Löffel), 388 g
€ 500–1.000

der Kaiserin Maria Theresia 18. Jahrhundert
Perlmutt, Aquarellmalerei, vergoldete Silber- oder Metallmontierung; am Deckel 1 Familienportrait der Kaiserin Maria Theresia mit ihren Kindern, nach einem Gemälde von Martin van Meytens, unten rechts kaum leserlich signiert „Antonio Bencini“; 8,1 × 6 × 3,3 cm
€ 500–1.000

3293
Muschelschale
USA, um 1820
Silber, teilweise vergoldet; muschelförmige Schale, 3 Füße in Fischgestalt; seitlich, auf der Unterseite gemarkt mit Meistermarke „J.W.B“ für Joseph W. Boyd, Nr. „15“ und Importpunze; 15,5 × 15 × 6,3 cm, 224 g
Literatur
vgl. Jan Divis, Silberstempel aus aller Welt. Augsburg 1992, S. 73, Abb. 304 (Punze)
€ 150–300
Wien, um 1860 Silber; glatte Wandung, seitlich 2 Handhaben, der Deckelknauf als vollplastisch ausgeformte Blüte; im Deckel und auf der Unterseite gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen, Meistermarke „ES“ für Eduard Schiffer und Hoflieferantenmarke mit „Schiffer“; H. 16,3 cm, 512 g
€ 500–1.000


Rozet und Fischmeister, Wien, um 1860
Silber; godronierte Fahne, auskragender Fuß; auf der Unterseite gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen und Meistermarke „R&F“ für Rozet und Fischmeister; Dm. 23,5 cm, 479 g
Literatur
vgl. Waltraud Neuwirth, Wiener Goldund Silberschmiede und ihre Punzen, II, S. 159–164 (Punze)
€ 300–600

Wien/Hamburg, 19. Jahrhundert
Silber, teilweise vergoldet; 1 Schale mit durchbrochen gearbeiteter Wandung mit 2 Fächern, seitlich 2 Handhaben bzw. 1 Schale auf 4 Füßen und seitlich 2 Handhaben; jeweils auf der Unterseite und seitlich gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen und Meistermarke „IW“ mit Doppeladler bzw. Hamburger Beschauzeichen, Herstellermarke „PETERS“ und Silberfeingehaltspunze „12 LÖTH.“; L. 31 bzw. 33 cm, 814 g
€ 600–1.200
Bartolomeo Bellano oder Umkreis
(Padua um 1435-um 1497 Padua)
Marmorfries „Primus Dolor“ Florenz, 2. Hälfte 15. Jahrhundert Marmor, patiniert; die Vorderseite mit 5 naturalistisch dargestellten Personen in Profilansicht, einen Knaben ansehend, darunter bezeichnet „PRIMUS DOLOR“; 30 × 66,5 × 12,5 cm
Expertise von Univ.-Prof. i.R. Dr. Horst Schweigert, Graz 1978, liegt in Kopie vor.
€ 10.000–20.000

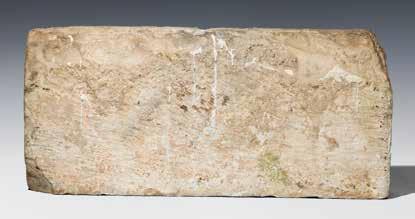

Die Bezeichnung „primus dolor“ (lat. „erster Schmerz“) bezieht sich im Kontext des christlichen Glaubens oft auf den Leidensweg Christi. Es ist vorstellbar, dass der Knabe Jesus darstellt, der von fünf Personen mit naturalistischer Physiognomie in reich ornamentierter Kleidung betrachtet wird. Womöglich handelt es sich bei dem Fries um eine Anbetung der Könige. Ein weiterer Hinweis, dass es sich bei dem Knaben um Jesus handeln könnte sind die beiden Tauben, die er in seinen Händen hält und an seinen Körper presst. Diese finden sich immer wieder in Darstellungen und weisen – passend zur Bezeichnung „primus dolor“ auf die Passion Christi, seinen zukünftigen Leidensweg, hin.

in der Art des Pompeo Leoni, um 1600 vergoldete Bronze; Reliefdarstellung einer Frau mit prunkvollem Schmuck und höfischer Kleidung, wohl die barfüßige Maria von Spanien; rückseitig mit Lötstelle und gravierter Nummer, der Ständer mit rotem Samt bezogen; H. 26,6 cm (exkl. Ständer)
€ 1.500–3.000
Maria von Spanien (1528–1603) war die Schwester von König Philipp II. von Spanien und die Ehefrau von Kaiser Maximilian II. Der Legende nach zog sie sich nach dem Tod ihres Mannes als Witwe in ein Kloster der barfüßigen Klarissinnen zurück – ein Orden, der für seine strenge Armut und Frömmigkeit bekannt ist. Wegen ihrer besonders frommen Lebensweise wurde sie bald als heiligmäßige Frau verehrt. Einer Überlieferung zufolge soll ihr Leichnam auch noch zwölf Jahre nach ihrer Exhumierung unversehrt gewesen sein – ein Zeichen von Heiligkeit, wie es in der katholischen Tradition öfter beschrieben wird.

nach Conrad Meit, um 1530, wohl 19. Jahrhundert
Terrakotta, bemalt; jeweils auf der Unterseite mit alter Sammlungsnummer; 1 Arm des Adams geklebt; H. 27 bzw. 28 cm
Literatur
vgl. Kunsthistorisches Museum, Wien, Inv.-Nr.: Kunstkammer, 9889
€ 1.000–2.000
3300
Gotisches Kreuz um 1430 vergoldetes Kupfer; auf der Vorderseite mit ziseliertem Gekreuzigtem, rückseitig mit den 4 Evangelisten; H. 27,3 cm
€ 3.500–7.000


3301
Paul Hübner (1582–1614)
Zwei Plaketten Augsburg, um 1600 vergoldetes Kupfer; jeweils mit reliefierter Darstellung einer Stadt mit Hirsch bzw. mit 2 Löwen; auf Samtbezug mit durchbrochen gearbeiteter Kupferbordüre; 16,2 × 13,4 cm
€ 1.000–2.000


Mitte 18. Jahrhundert
Marmor; im Zentrum mit Darstellung der Marienkrönung, die Putti oben rechts sowie der Schafhirte unten links appliziert, ansonsten aus der Masse gearbeitet; Ecken mit fachgerecht restaurierten Bruchstellen; bemalter und vergoldeter Holzrahmen; Äderung wohl stellenweise gemalt; 61,5 × 48,5 cm
€ 5.000–10.000
3303
Knabenkopf
wohl 19. Jahrhundert
Marmor, Metallmontierug; Steinsockel später; H. 29,5 cm
€ 1.500–3.000


3304
Weihwasserbecken
17./18. Jahrhundert
roter Marmor; muschelförmiges Becken mit Voluten; rückseitig mit Montagestein; 30 × 23,7 × 12,3 cm
€ 1.000–2.000

3305
Victor Tilgner (Preßburg 1844–1896 Wien)
Büste der Burgschauspielerin
Charlotte Wolter als Sappho Wien, um 1875
Gips, gefasst; auf der Brust signiert mit „Tilgner“; dunkel gebeizter Holzsockel; H. 68 cm
Literatur
vgl. Wien Museum Archiv, Wien, Inv.-Nr. 43208/2 (Fotografie)
vgl. Wien Museum Archiv, Wien, Inv.Nr. 32967 (gefasste Büste der Charlotte Wolter)
€ 1.000–2.000

3306
Bacchus-Szene 19. Jahrhundert
Bronze, dunkel patiniert; Marmorsockel mit vergoldetem Bronzering; H. 69 cm
€ 3.500–7.000

Frederic Remington (Canton (New York) 1861–1909 Ridgefield (Connecticut))
Die Klapperschlange
Anfang 20. Jahrhundert Bronze, dunkel patiniert; Marmorsockel; auf der Plinthe bezeichnet „Copyright by Frederic Remington“; H. 60,3 cm € 5.000–10.000

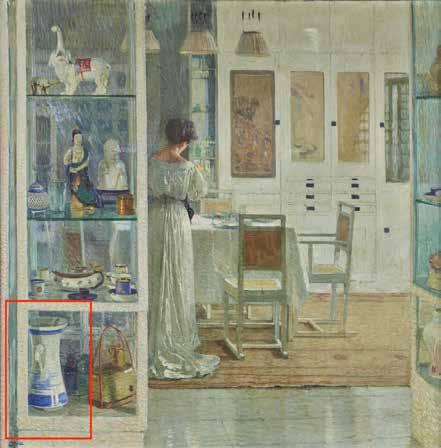
Berta Zuckerkandl, geborene Szeps (1864–1945) war über Jahrzehnte eine der prägendsten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens in Wien – als Schriftstellerin, Kunstkritikerin und Gastgeberin eines der einflussreichsten Salons der Stadt. 1886 heiratete sie den Anatomen Dr. Emil Zuckerkandl, einen leidenschaftlichen Sammler von Wiener Porzellan und ostasiatischer Kunst. Nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 musste Berta Zuckerkandl Wien fluchtartig verlassen.
Das Ehepaar Berta und Emil Zuckerkandl besaß eine umfassende Sammlung asiatischer Kunst- und Kunstgewerbeobjekte. Diese war in deren Wohnräumen ausgestellt und wurde zweifach von Carl Moll gemalt. Auf seinem Gemälde „Weißes Interieur“ ist in der Vitrine unten links eine Große japanische Vase (Lot 3308) erkennbar. Auf dem Gemälde „Interieur in Döbling“ ist in der rechten Vitrine ein bei uns zur Versteigerung angebotenes Rauchgefäß (Lot 3309) sichtbar.
Die im Laufe ihres Lebens – durch Einkäufe, Geschenke und Erbschaft – zusammengetragene Kunstsammlung Berta Zuckerkandls ist von ihren Erben im Wesentlichen bis zum heutigen Tag in ihrem ursprünglichen Umfang erhalten worden. Jetzt erstmals haben sie sich entschlossen, ausgewählte Objekte aus der Sammlung Zuckerkandl abzugeben und in einer Auktion in der Heimatstadt Bertas neuen Kunstliebhabern zu überlassen. Wir im Kinsky sind froh und stolz darauf, dass die Wahl der Erben Berta Zuckerkandls auf uns gefallen ist. Denn jedes von uns im Folgenden beschriebene Stück erzählt von einer bewegten Vergangenheit und trägt eine einzigartige Geschichte in sich.

Große Vase
Hirado, Japan, Meiji-Periode (1868–1912)
Porzellan, blau staffiert und glasiert; die Wandung umlaufend mit Koi-Dekor, 1 davon leicht reliefiert, 2 vollplastisch ausgeformte Handhaben in Form von Löwenköpfen; alte restaurierte Rissbildungen; H. 40,5 cm
€ 1.000–2.000
Rauchgefäß
„Nelkenkessel (chōji-buro)“
Japan, Edo-Periode (1603–1868)
Keramik aus hellem Scherben, cremefarben glasiert und farbig staffiert; die Wandung umlaufend mit Craquelé und mit Blütendekor, Aufsatz abnehmbar, auf der Unterseite des Aufsatzes mit Resten alter Sammlungsetiketten; minimale Ausbrüche am Rand; H. 26,3 cm
Literatur
vgl. Metropolitan Museum of Art, New York, Inv.-Nr. 2015.500.9.40a-c
€ 1.000–2.000


Gefäße dieser Art, sogenannte „Nelkenkessel“, wurden vor allem in wohlhabenden Haushalten verwendet. In ihnen erhitzte man Nelken und andere Gewürze, damit sich ihr Duft im Raum verbreitete. Dieses Stück ist ein Beispiel für Kiyomizu-Keramik – eine traditionelle japanische Keramikart aus Kyōto, die besonders während der Edo-Zeit (1603–1868) große Bedeutung hatte.
Claire-de-lune Vase
China, Qing-Dynastie (1644–1912)
Porzellan, claire-de-lune Glasur; auf der Unterseite mit unterglasurblauer Khangxi Artemisia Marke; H. 17 cm
€ 500–1.000


Krabbe
Japan, 19. Jahrhundert
Bronze, dunkel patiniert; auf der Unterseite mit eingeritzten Zeichen; L. 21,5 cm
€ 300–600


3312
Vase
Japan, 19. Jahrhundert
Bronze, dunkel patiniert; durchbrochen gearbeitete Wandung; H. 16,3 cm
€ 300–600

3313
Netsuke „Maske auf Reisstrohmatte“
Japan, 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Buchsbaumholz, geschnitzt; 4,2 × 2,9 cm
€ 500–1.000

3314
Netsuke „Okame Maske“
Japan, 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Buchsbaumholz, geschnitzt; rückseitig mit Signatur des Schnitzers
Masamitsu; 5 × 4,2 cm
€ 500–1.000

Detail Signatur

3315
Netsuke „Muschel mit Fischerhütte“
Japan, 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Buchsbaumholz, geschnitzt, Perlmuttintarsien; auf der Unterseite signiert; 4 × 3,6 × 3,6 cm
€ 500–1.000

Detail Signatur

Figur „Bijin“
Japan, um 1700
Porzellan, farbig staffiert und glasiert, Goldmalerei; seitlich 2 Entlüftungslöcher für den Brennvorgang; H. 17 cm
€ 500–1.000

Zwei Teekellen „Jasmin“
wohl 19. Jahrhundert
Silber; durchbrochen gearbeitete
Laffen jeweils in Form einer geöffneten Jasminblüte, der Griff mit vollplastisch ausgeformter Jasminknospe; jeweils rückseitig gemarkt mit asiatischer Marke; L. 12,5 cm, 99 g
€ 300–600

Detail Marken
Paar Cloisonné Leuchter
China, 19./20. Jahrhundert
Messing, Email; die Wandung in Cloisonné-Technik; auf der Unterseite mit gemalten Nummern; H. 36 cm
€ 2.000–4.000


Paar Cloisonné Kannen und Schale
China, 19./20. Jahrhundert
Kupfer, Email; die Wandung in Cloisonné-Technik, die Henkel der Kannen in Form von Drachen; Schale auf Holzsockel; Holzsockel mit Bruchsstelle; H. 23 cm (Kannen), Dm. 21 cm (Schale)
€ 1.500–3.000

China, 17./18. Jahrhundert
vergoldete Bronze; Darstellung des buddhistischen Gottes Manjushri, in der rechten Hand mit Schwert; auf der Unterseite mit Ying und Yang Symbol; H. 17,5 cm
€ 1.500–3.000

Tibet, 19. Jahrhundert
vergoldete Bronze; Darstellung Dhamaraja Yamas, hinduistischer Gott des Todes und der Göttin Yami, seiner Zwillingsschwester, auf einem Stier und einem Leichnam stehend; 1 Rubin am Bauch des Gottes, Türkis am Handgelenk, 1 Türkis fehlt; Götter jeweils abnehmbar; H. 18,8 cm
€ 1.500–2.000
China, Qing-Dynastie (1644–1912)
Keramik aus hellem Scherben, weiß glasiert und farbig staffiert; die Wandung umlaufend mit Craquelé und chinesisch bezeichnet, seitlich 2 Handhaben in Form von vollplastisch ausgeformten Tierköpfen; auf der Unterseite mit unterglasurblauer Khangxi Artemisia Marke; H. 35,5 cm
€ 1.000–2.000
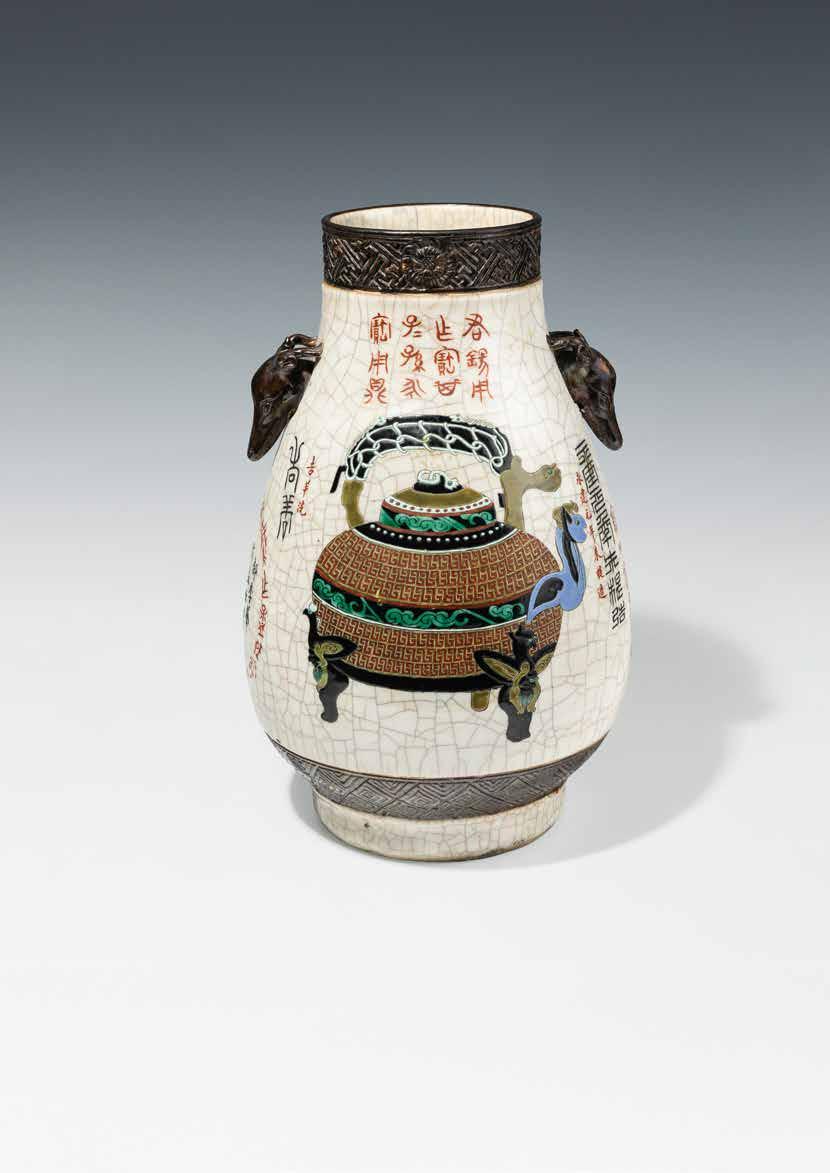

3323


Mosaikbild „Petersdom“
19. Jahrhundert
schwarzer Schiefer, farbige Mikromosaiksteine; Darstellung des Petersplatzes in Rom; vergoldeter Holzrahmen; 31,5 × 28 cm (inkl. Rahmen)
€ 1.000–2.000
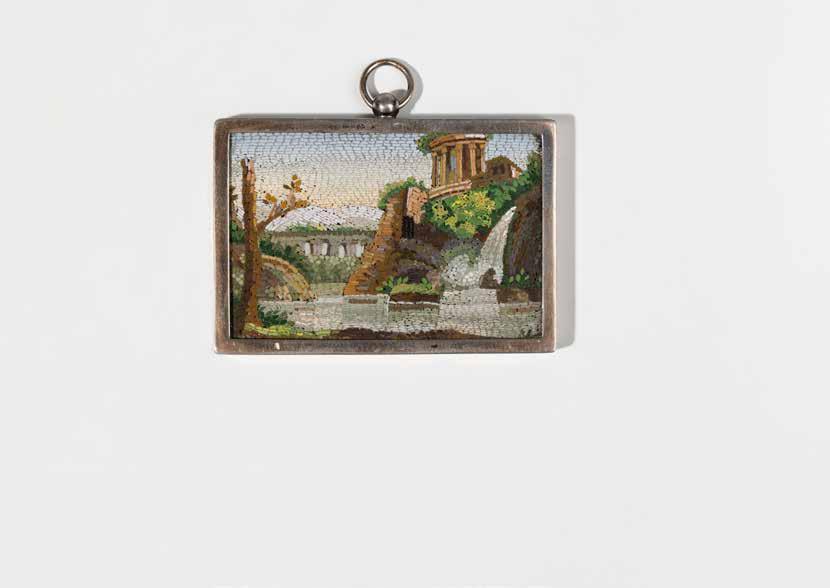
3324
Mikromosaikbild „Tempelarchitektur“
um 1800
farbige Mikromosaiksteine, Silber, Metall; Darstellung einer italienischen Landschaft mit Tempelarchitektur; 6,2 × 4,2 cm
€ 500–1.000

Limoges, 13. Jahrhundert
Kupfer, Reste alter Vergoldung, Email in Champlevé-Technik; Email stellenweise ausgebrochen; H. 20 cm
Literatur
vgl. Louvre, Paris, Inv.-Nr. MR 2664
vgl. Metropolitan Museum of New York, Enamels of Limoges 1100–1350, 1996, S. 380 € 7.000–14.000

(Limoges nach 1505–1575 ebd.)
Teller „Moses, wohl vor dem hebräischen Sklaven“ Limoges, um 1560
Email auf Kupfer, Grisaille-Malerei mit Gold- und Kupferhöhungen; auf der Vorderseite mit wohl Mosesdarstellung vor hebräischem Sklaven, rückseitig mit Profilportrait des Kaisers Nero, bezeichnet „AVG GER PM TRP IMP PP NERO CLAVD CAESAR“; Email teilweise beschädigt; Dm. 22,5 cm
Literatur
vgl. Musée du Louvre, Paris, Inv. Nr. OA 985 1, OA 985 2 bzw. OA 12102
€ 3.500–7.000

Léonard Limosin zugeschrieben
(Limoges nach 1505–1575 ebd.)
Teller „Moses vor dem brennenden Dornbusch“ Limoges, um 1560
Email auf Kupfer, Grisaille-Malerei mit Gold- und Kupferhöhungen; auf der Vorderseite mit Mosesdarstellung vor dem brennenden Dornbusch, rückseitig mit Profilportrait des Kaisers Vitellius, bezeichnet „A VITELLIVS GERMAN IMP AVG P M TR P“; Email teilweise beschädigt und restauriert; Dm. 22,5 cm
Literatur
vgl. Musée du Louvre, Paris, Inv. Nr. OA 985 1, OA 985 2 bzw. OA 12102
€ 3.500–7.000

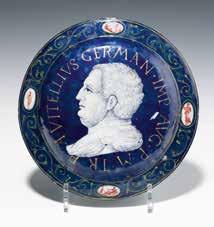
Rückseite
Neapel, Mitte 18. Jahrhundert
Schildpatt, Gold- und gravierte Perlmutteinlagen; umlaufend mit Darstellung in Piqué-Technik; H. 2,9 cm
Literatur
vgl. Alexis Kugel, Piqué. Gold, Tortoiseshell and Mother-of-Pearl at the Court of Naples, Paris, 2018
€ 500–1.000


Neapel, Mitte 18. Jahrhundert
Schildpatt, Gold- und gravierte Perlmutteinlagen; umlaufend mit Darstellung in Piqué-Technik, der Deckel mit gravierter Metallmontierung; 1 Perlmutteinlage im Deckel fehlt; H. 7 cm, Dm. 8,9 cm
Literatur
vgl. Archiv d. Metropolitan Museum of Art, New York, Nr. 2008.543.11
vgl. Archiv d. Rothschild Sammlung, Waddesdon, Buckinghamshire, Nr. 2427
vgl. Alexis Kugel, Piqué. Gold, Tortoiseshell and Mother-of-Pearl at the Court of Naples, Paris, 2018
€ 2.000–4.000

Neapel, Mitte 18. Jahrhundert Schildpatt, Gold- und gravierte Perlmutteinlagen; auf der Vorderseite mit Darstellung in Piqué-Technik, auf 4 Füßen; rückseitig mit Sammlungsetikett; 2,3 × 21,8 × 17 cm
Literatur
vgl. Archiv d. Metropolitan Museum of Art, New York, 1974.356.236
vgl. Alexis Kugel, Piqué. Gold, Tortoiseshell and Mother-of-Pearl at the Court of Naples, Paris, 2018
€ 7.000–14.000

Minnekästchen
Nürnberg oder Augsburg, um 1620 vergoldetes Messing, Email; der Deckel mit Henkel; 6,3 × 6,3 × 4,3 cm
Provenienz
ehemals Sammlung Thurn & Taxis
Literatur vgl. Ewald Berger, Prunkkassetten. Meisterwerke aus der Hanns Schell Collection, Stuttgart 1998, Abb. 129, S. 127
€ 3.500–7.000

wohl 16./17. Jahrhundert
Achat, Bronze; Schale, Schaft und Fuß aus Bandachat, ziselierte Bronzefassung mit Perlstabdekor; H. 10,9 cm
€ 1.000–2.000

Eisenkassette „Jagd“ 16./17. Jahrhundert
Eisen, Gold und Silber tauschiert; Klappdeckel mit Henkel und Nietenbeschlag, innen 3 Fächer; die Wandung umlaufend mit Jagddarstellungen und floralem Dekor; Schloss mit Schlüssel; 20,2 × 12 × 8 cm € 1.500–3.000

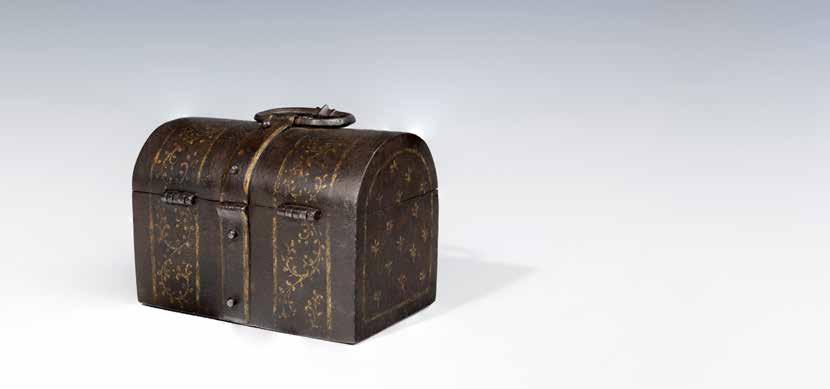
Frankreich, 16. Jahrhundert
Eisen, Goldmalerei; auf der Vorderseite mit Scheinscharnieren und verstecktem Schloss; 15,7 × 10,2 × 11 cm (exkl. Öse)
Literatur vgl. Ewald Berger, Prunkkassetten. Meisterwerke aus der Hanns Schell Collection, Stuttgart 1998, S. 212
€ 700–1.400

Alpenländisch, 16. Jahrhundert
Eisen; kugelförmiges Vorhängeschloss mit Schlüssel; 9 × 10,7 × 11,3 cm
Literatur vgl. Bergbaumuseumsverein Leogang (Hg.), Gotik. Entdecken und Bewahren, Ausstellungskatalog, Leogang 2009, S. 97, Abb. 91
€ 900–1.800

16. Jahrhundert
Eisen, graviert, Reste alter Goldmalerei; auf der Vorderseite mit Scheinscharnieren und verstecktem Schloss; 9,2 × 7,2 × 6,6 cm
€ 1.000–2.000

3337
Gotische Holzkassette
Alpenländisch, datiert „1585“
Holz, Eisen, grün und rot lackiert; 3 Handhaben; der Deckel innen datiert „1585“; graviertes Schloss mit Schlüssel; 46,8 × 28,7 × 31 cm
€ 2.000–4.000
3338
Barockspiegel
17. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, originale Vergoldung; oben und an den Seiten mit 3 Putten; das Spiegelglas später, altersbedingte Abplatzung; 42 × 46 cm
€ 1.000–2.000


Mitte 18. Jahrhundert
Weichholzkorpus, Nussholz intarsiert; 3 Laden, jeweils innen mit Papier tapeziert; auf der Unterseite mit Zentralsperre; 13,8 × 25,3 × 12,3 cm
€ 800–1.600
3340
Miniaturaltar mit Baldachin
18. Jahrhundert
Holz, geschnitzt; dreigliedriger Altar mit Nische und Baldachin, auf der Stufe mit griechischem Kreuz; der Aufsatz abnehmbar; H. 69,5 cm
€ 1.000–2.000


3341
2. Hälfte 17. Jahrhundert
Nussholz, Eisen; seitlich 2 Handhaben, Deckel oben mit Schiebefach, innen mit verriegelbarer Lade, auf der Vorderseite mit verschiebbarer Schlüssellochabdeckung; graviertes und getriebenes Schloss mit Schlüssel; 29,5 × 49 × 35 cm
€ 2.000–4.000

Wismutkästchen
Alpenländisch, 17. Jahrhundert
Holz, Farbmalerei auf Kreidegrund und Leim-Wismutpulverschicht; auf dem Deckel mit Darstellung eines Herren mit ausgetrecktem Zeigefinger, seitlich bemalt mit Zierfries, Blumen- und Rankendekor; Klappdeckel, Riegelschloss mit Schlüssel; 29,9 × 21,2 × 12,9 cm
€ 1.500–3.000

3343
Wismutkästchen
Alpenländisch, 17. Jahrhundert
Holz, Farbmalerei auf Kreidegrund und Leim-Wismutpulverschicht; auf dem Deckel mit Darstellung eines Hochzeitspaars, seitlich bemalt mit Zierfries, Blumen- und Rankendekor; Schloss, 1 Leiste später; 23 × 17 × 10 cm
€ 1.000–2.000

3344
Wismutkästchen
Alpenländisch, 17. Jahrhundert
Holz, Farbmalerei auf Kreidegrund und Leim-Wismutpulverschicht; auf dem Deckel mit Darstellung eines Herren mit Stock und Schwert, seitlich bemalt mit Zierfries, Blumen- und Rankendekor, innen verkleidet mit Marmorpapier; Klappdeckel; Schloss mit Schlüssel; 30,8 × 21 × 13,1 cm
€ 1.500–3.000
Wismut-Kabinettkästchen
Alpenländisch, 17. Jahrhundert
Holz, Farbmalerei auf Kreidegrund und Leim-Wismutpulverschicht; auf dem Deckel und seitlich bemalt mit verschiedenen Stadtansichten, Darstellungen einer Burg mit Fluss und Booten, innen teilweise bemalt, mit Marmorpapier verkleidet und bezeichnet „ICW/KH“; Klappdeckel, auf der Vorderseite mit zwei Klappen, dahinter 1 großes Fach, 9 kleine Laden und 1 große Lade; Schloss mit Schlüssel; 36 × 27 × 25,8 cm
€ 2.500–5.000


geöffnete Ansicht

3346
Wismutkästchen
Alpenländisch, 17. Jahrhundert
Holz, Farbmalerei auf Kreidegrund und Leim-Wismutpulverschicht; bemalt mit Zierfries, Blumen- und Rankendekor; Klappdeckel mit Handhabe, Scharnieren und Eckbeschlägen; Schloss mit Schlüssel; 30,5 × 23,5 × 12,9 cm
€ 1.500–3.000

3347
Wismutkästchen
Alpenländisch, 17. Jahrhundert
Holz, Farbmalerei auf Kreidegrund und Leim-Wismutpulverschicht; auf dem Deckel mit Darstellung der Justitia mit Schwert und Waage, seitlich bemalt mit Zierfries, Blumen- und Rankendekor; Klappdeckel; Schloss, der Schlüssel fehlt; 26,6 × 18,3 × 11,4 cm
€ 1.500–3.000

3348
Wismut-Kabinettkästchen
Alpenländisch, 17. Jahrhundert
Holz, Farbmalerei auf Kreidegrund und Leim-Wismutpulverschicht; innen und außen bemalt mit Handtreue, Zierfries, Blumen- und Rankendekor; Klappdeckel und -front, dahinter 3 Laden und 1 Fach mit zusätzlichem Fach; Schloss mit Schlüssel; 23,1 × 15,2 × 15 cm
€ 1.200–2.400
3349
Wismut-Runddeckeltruhe
Alpenländisch, 17. Jahrhundert
Holz, Farbmalerei auf Kreidegrund und Leim-Wismutpulverschicht; auf dem Deckel mit Darstellung eines musizierenden Kasperl, seitlich bemalt mit Zierfries, Blumen- und Rankendekor; Runddeckel mit Scharnieren im Zierbandbeschlag, seitlich 2 Handhaben; Schloss mit Schlüssel; 29,5 × 18 × 22 cm
€ 3.000–6.000

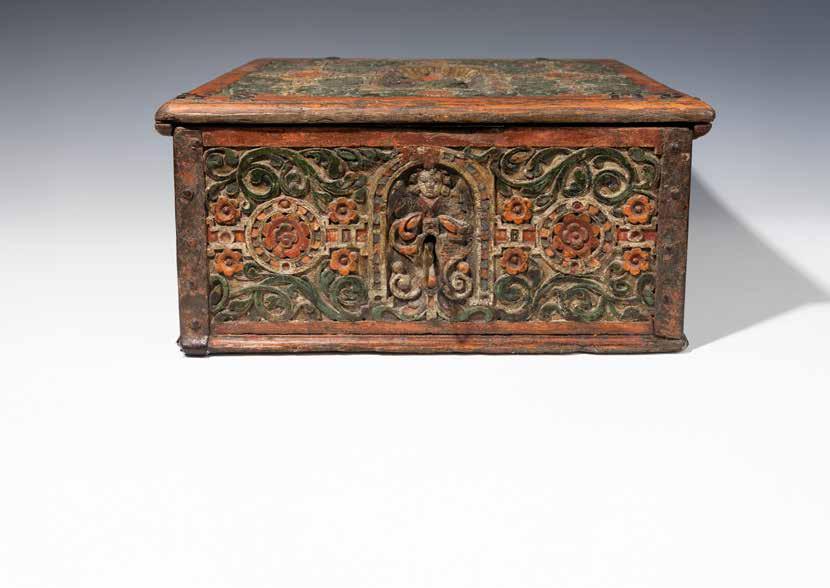
3350
Reliefiertes Wismutkästchen
Alpenländisch, 17. Jahrhundert
Holz, Farbmalerei auf Kreidegrund und Leim-Wismutpulverschicht; auf dem Deckel mit Heiligendarstellung und eisenbeschlagenem „HS“ und „MS“, umlaufend reliefiert und bemalt mit Zierfries, Blumen- und Rankendekor; innen verkleidet mit Leder und Stoff, teilweise beschädigt; Klappdeckel mit facettierten Scharnieren, seitlich 2 Handhaben; graviertes Schloss mit Schlüssel; 39 × 44,5 × 22,5 cm AWR
€ 2.000–3.000
3351
Madonna mit Kind
um 1500
Lindenholz, geschnitzt; alte Fassung und Vergoldung; H. 65 cm
€ 3.500–7.000


Cortina d‘Ampezzo, Italien, 16. Jahrhundert
Lindenholz, geschnitzt; originale Fassung und Vergoldung; H. 67 cm
€ 2.000–4.000

3353
Gotisches Relief „Heiliger Andreas“
Tirol, um 1500 Lindenholz, geschnitzt; originale Fassung und Vergoldung, stellenweise übergangen; H. 118,5 cm
€ 6.000–12.000

Erzengel Michael
Tirol, um 1500
Lindenholz, geschnitzt; originale Fassung und Vergoldung, stellenweise übergangen; H. 84 cm
€ 10.000–20.000

Niklaus Weckmann
(tätig in Ulm 1481–1526)
Heiliger Georg Ulm, um 1480
Lindenholz, geschnitzt; originale Fassung; H. 67cm (exkl. Lanze)
€ 10.000–20.000

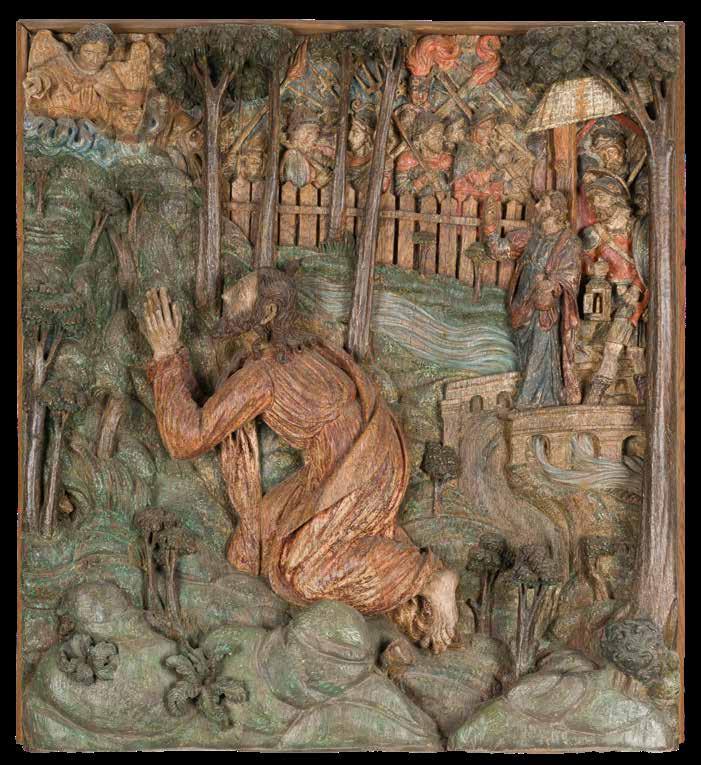
Jesus am Ölberg
Donauschule, um 1520
Lindenholz, geschnitzt; originale Fassung; Holzrahmen später; H. 79 cm
€ 5.000–10.000

Madonna mit Kind
Cortina d‘Ampezzo, Italien, 16. Jahrhundert Lindenholz, geschnitzt; originale Fassung und Vergoldung, stellenweise übergangen; H. 67 cm
€ 5.000–10.000

3358
Jörg Zürn Umkreis
(Waldsee (Württemberg) um 1584–1635 Überlingen)
Heiliger Sebastian Anfang 17. Jahrhundert
Lindenholz, geschnitzt; H. 86 cm
€ 2.500–5.000

3359
Robert von Molesme (auch Robert von Cîteaux) 15./16. Jahrhundert
Stein; H. 67 cm
€ 3.500–7.000

3360
Ferdinand Dietz (Koblenz/Trier um 1743–1780 Bamberg/Würzburg tätig)
Erzengel Michael um 1500
Lindenholz, geschnitzt; H. 82,5 cm
€ 5.000–10.000


Süddeutschland, um 1660
Lindenholz, geschnitzt; alte Fassung und Vergoldung; H. 80,5 cm (exkl. Stab)
€ 2.500–5.000
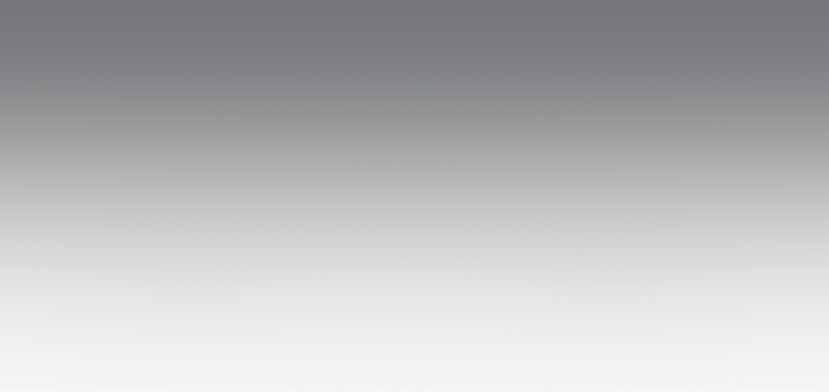
Relief „Christus und die Samariterin am Brunnen“
Deutsch, Anfang 18. Jahrhundert
Buchsbaumholz, geschnitzt; 26,6 × 21,6 cm (inkl. Rahmen)
€ 500–1.000
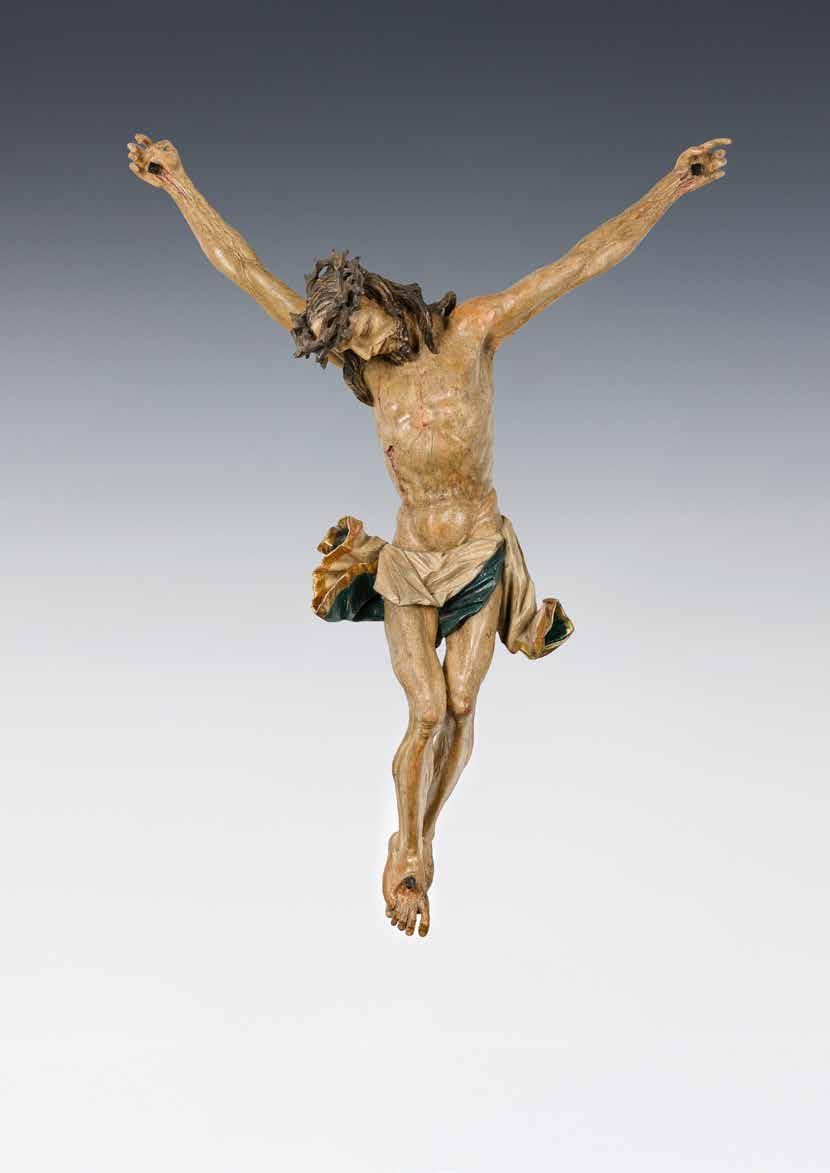
Große Christusfigur
1. Hälfte 17. Jahrhundert
Lindenholz, geschnitzt, originale Fassung, stellenweise übergangen; Nägel und 2 Zehen später; L. 122 cm
€ 5.000–10.000


3364
Johann Franz Schwanthaler (Oberösterreich 1683–1762 Oberösterreich)
Madonna mit Kind Oberösterreich, um 1720–40
Lindenholz, geschnitzt, alte Fassung und Vergoldung; H. 57 cm
€ 5.000–10.000
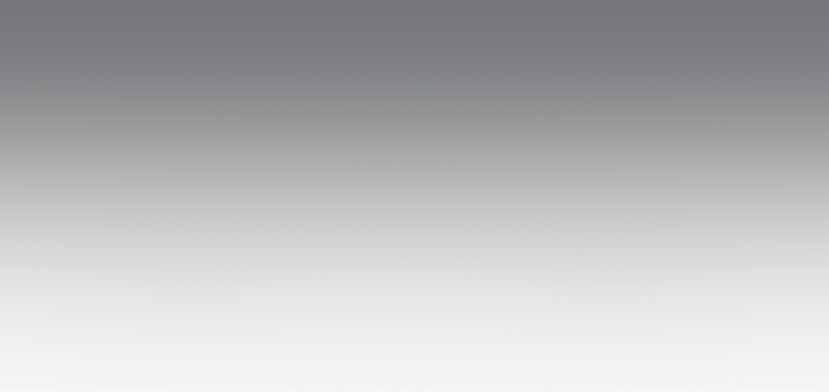
3365
Paar Engelsköpfe
18. Jahrhundert
Lindenholz, geschnitzt; alte Fassung und Vergoldung; H. 23,5 cm
€ 500–1.000
Lusterweiberl 17./18. Jahrhundert
Lindenholz, geschnitzt, originale Fassung und Vergoldung, Geweih, Eisenkette, -kerzenhalter und -deckenkonsole; auf der Unterseite mit Wappenkartusche; H. 37 cm (Figur)
€ 5.000–10.000


Handtuchhalter
19. Jahrhundert
Lindenholz, geschnitzt, originale Fassung und Vergoldung; 1 Finger abgebrochen; 35 × 54 × 10 cm
€ 1.000–2.000


3368
Reliefbild
„Kaiser Ferdinand“
19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, alte Fassung, vergoldeter Holzrahmen; Darstellung Kaiser Ferdinands im Relief, rückseitig bezeichnet mit „Ferdinand V“ und „Hainfeld“; 61,5 × 51,5 × 5,5 cm
€ 2.500–5.000

Heilige Notburga
18./19. Jahrhundert
Lindenholz, geschnitzt, originale Fassung; 1 Heiligenattribut fehlt; H. 105 cm € 5.000–10.000
3370
Fastnachtsmaske
Tirol, 19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, bemalt; rückseitig mit geschnitzter Nummer „4“; H. 25,5 cm
€ 500–1.000
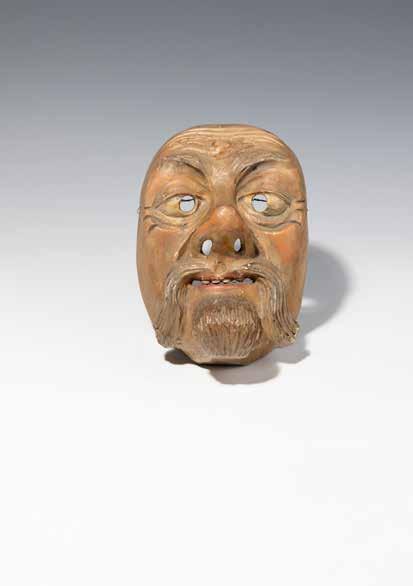
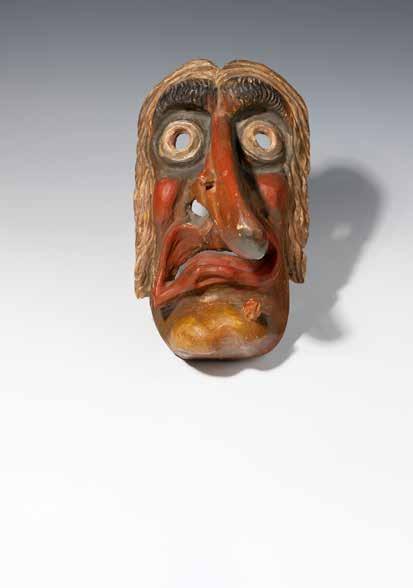
3372
Fastnachtsmaske
Steiermark, 20. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, bemalt; rückseitig bezeichnet „gemacht von/Hänsel Oberhuber/aus Schöder/Stmk 1950“; H. 33 cm
€ 500–1.000

3371
Fastnachtsmaske
Tirol, 19. Jahrhundert
Ton, bemalt; H. 18,5 cm
€ 500–1.000
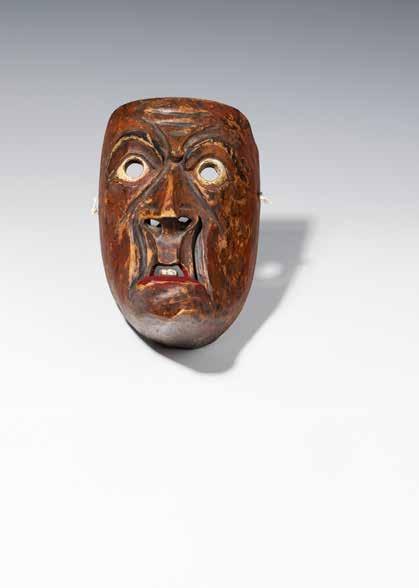
3373
Fastnachtsmaske
Tirol, 19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, bemalt; H. 23 cm
€ 500–1.000

Fastnachtsmaske
Tirol, 19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, bemalt; vertikale Rissbildung, restauriert; rückseitig bezeichnet mit Nummer „1358.“; H. 20 cm
€ 500–1.000

Fastnachtsmaske
Tirol, 19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, bemalt; vertikale Rissbildung, restauriert; rückseitig bezeichnet mit Nummer „1364.“; H. 20 cm
€ 500–1.000

3376
Fastnachtsmaske
Tirol, 19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, bemalt; vertikale Rissbildung, restauriert; H. 20,5 cm
€ 500–1.000
3377
Großes Schaf
19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, originale Fassung; H. 26,7 cm
€ 500–1.000
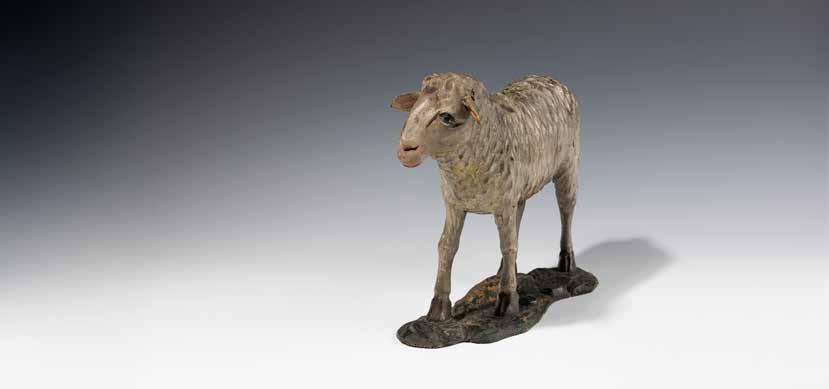

3378
Zwei Ochsen
19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, originale Fassung, Glasaugen; H. 23 bzw. 24,2 cm
€ 700–1.400

3379
Fünf Schafe
19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, originale Fassung; H. 16 bis 20 cm
€ 1.500–3.000
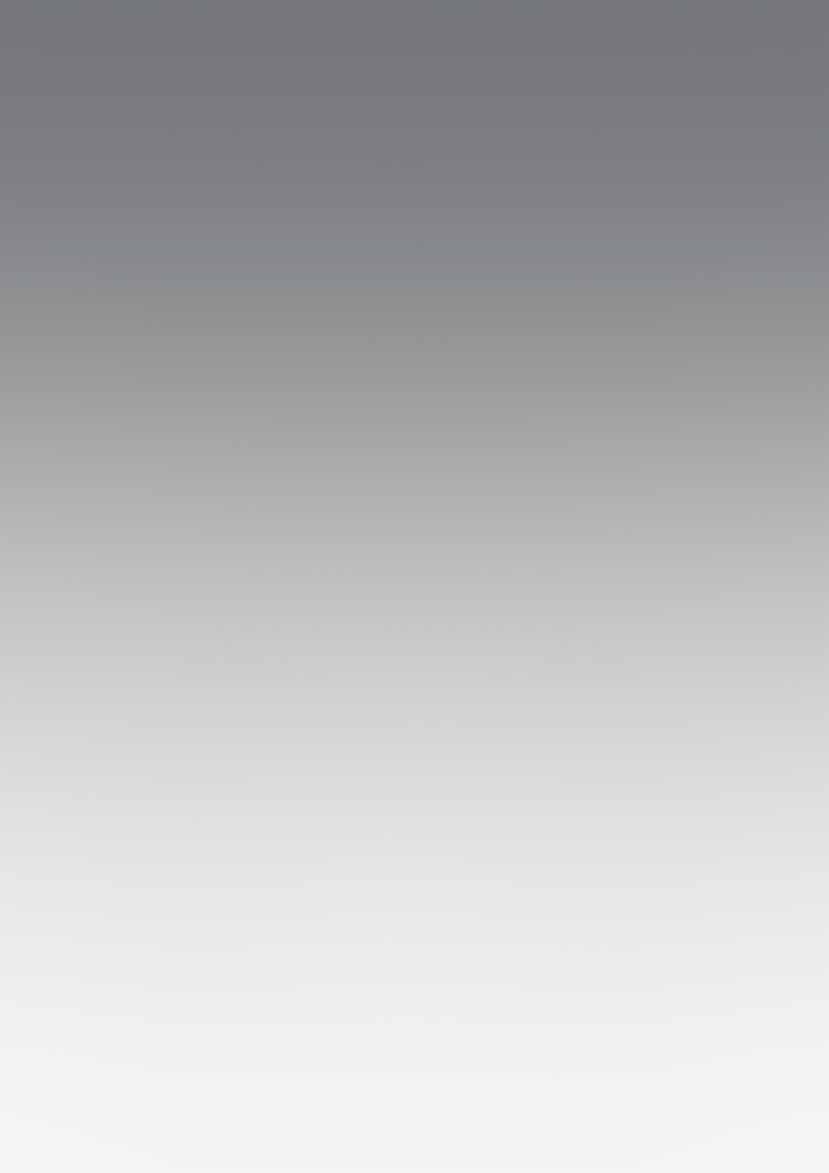
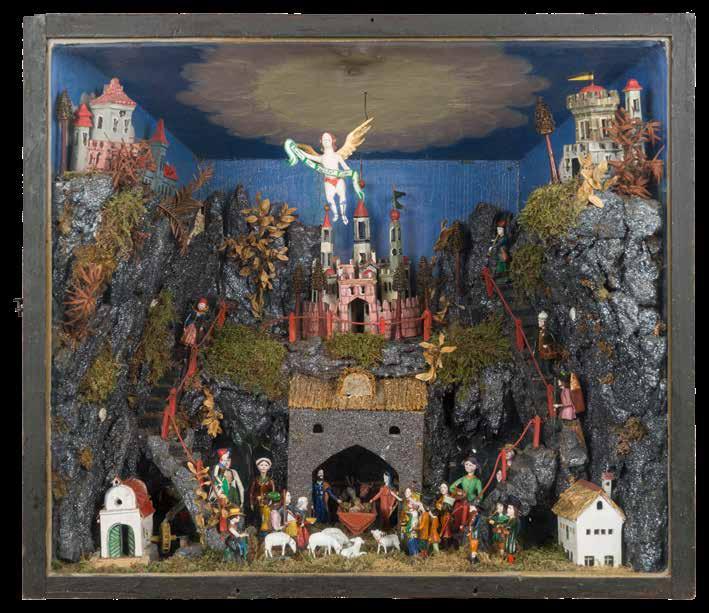
3380
Krippe
datiert „1854“
Holz und Karton, bemalt; Berglandschaft mit Stadtansicht und Figuren, im unteren Bereich die Anbetung der Könige, oben im Zentrum ein Gloriaengel mit Schriftband; rückseitig mit altem Klebeetikett, datiert „1854“; in HolzSchaukasten mit Glasfront; 56,5 × 49 × 31 cm
€ 2.500–5.000

3381
Schützenscheibe
datiert „1843“
Holz, bemalt; im Zentrum die Darstellung einer Schießveranstaltung, darunter bezeichnet „Prämienschiessen der L. Schützen Division am 9. October 1842“, der Rand mit Namen der Teilnehmer und datiert „1843“; 1 Einschussloch; Dm. 62 cm
€ 1.500–3.000

3382
Schützenscheibe zur Geburtsfeier Kaiser
Franz Josef I.
datiert „1853“
Holz, bemalt; auf der Vorderseite mit 2 musizierenden Engeln und einer zentralen Kartusche, bezeichnet „Zur Feier des allerhöchsten Geburtstagsfest S.k.k. apostolischen Majestät unser allergnädigster Kaiser und König Franz Josef I“ und „Schnell wie aus dem Rohr das Blei Fliegt dir unser Herz entgegen. Las es Dir in Lieb und Treu Herr in Deine Wiege legen“; mehrere Einschusslöcher, jeweils bezeichnet mit dem Namen des Schützen; Dm. 76 cm
€ 1.500–3.000
19. Jahrhundert

Holz und Karton, bemalt; Berglandschaft mit Burg- und Dorfansicht und Figuren; in bemaltem Holz-Schaukasten mit Glasfront; 77,7 × 58 × 10 cm
€ 1.500–3.000


datiert „1857“
Holz, bemalt; auf der Vorderseite mit Schützen und Dame, bezeichnet „Doppel Nagel Schuß des Unterschützen Meisters/Dr. Alex Peplovszky/am 9ten August 1857“ und „Wer mein Sträußchen heute haben will./Der Treffe zweimal nacheinnand daß Ziel.“; 83,7 × 83,2 cm
€ 2.500–5.000
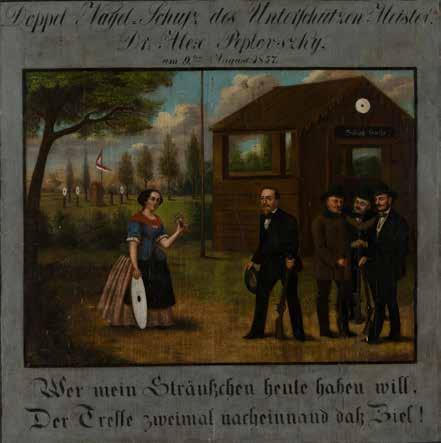

3385
Zunftzeichen der Bäcker datiert „1724“
Eisen, bemalt; durchbrochen gearbeitet, vorder- und rückseitig mit Zunftzeichen der Bäcker, darüber datiert „1724“; H. 46,5 cm
€ 2.500–5.000

3386
Zunftzeichen der Schneider datiert „1699“
Eisen, bemalt; durchbrochen gearbeitet, vorder- und rückseitig mit Zunftzeichen der Scheider, darunter bezeichnet „Ein ehrsames Schneider=Handwerk.1699.“; 41,5 × 39,5 cm (Aushängeschild); H. 60,5 cm (inkl. Hängevorrichtung)
€ 2.500–5.000
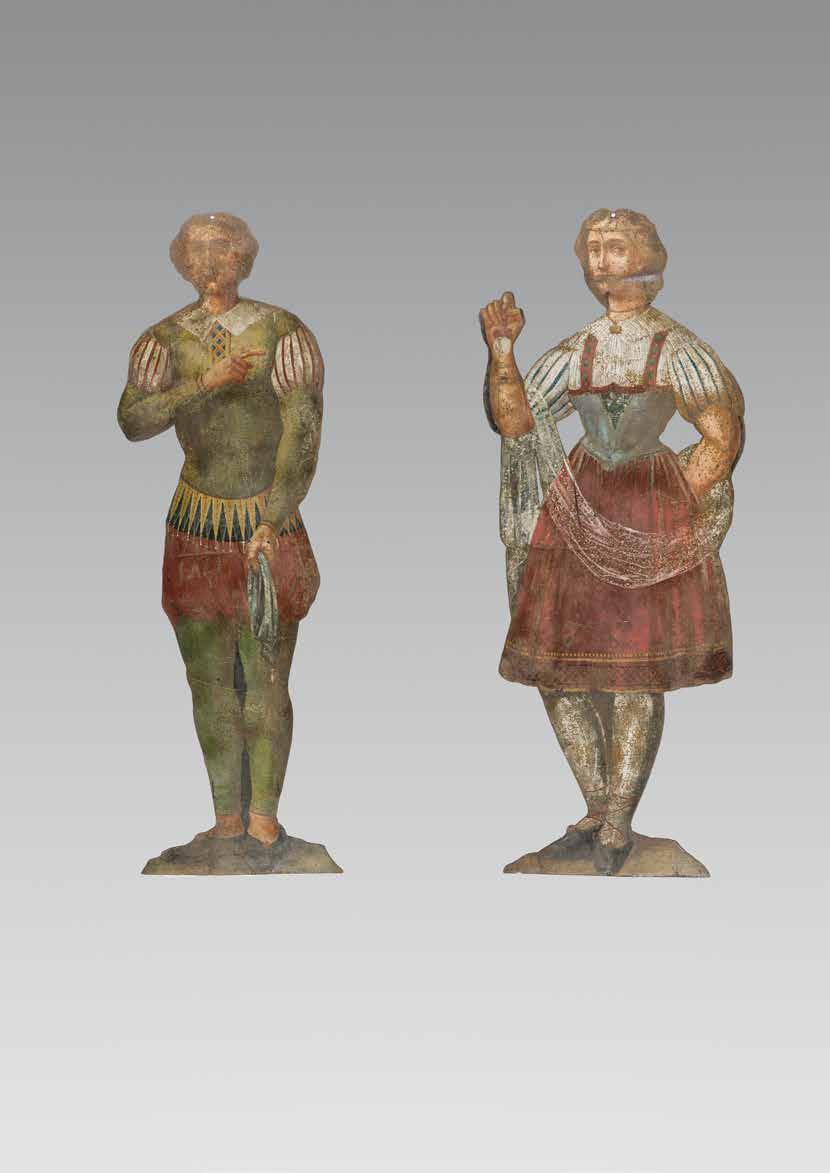
3387
Großes Paar wohl Aushänger oder Schützenscheiben
1. Hälfte 19. Jahrhundert
Eisen, bemalt; H. 160 bzw. 161,5 cm
€ 5.000–10.000
3388
Aushänger der Hufschmiede
Österreich, 19. Jahrhundert
Eisen; Hufeisen mit dazugehöriger Wandhalterung; H. 52,5 cm (inkl. Halterung)
€ 500–1.000

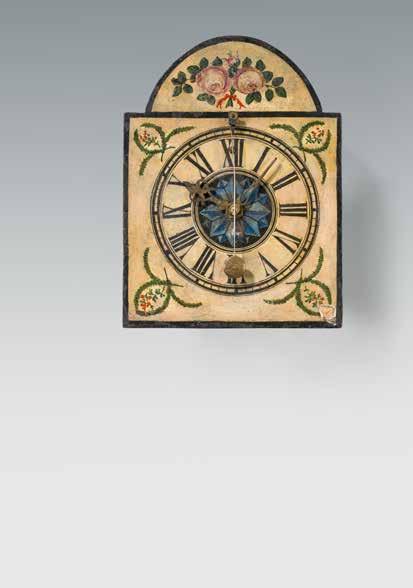
3390
Eisenuhr um 1800
Eisen, bemalt; Zifferblatt mit Blumendekor; Eisenwerk, Spindelgang mit Vorderpendel, Stundenschlag auf Glocke; Gewichte teilweise ergänzt, möglicherweise nicht vollständig; wohl reinigungsbedürftig;
31 × 23,5 × 12 cm
€ 300–600

3389
Aushängeschild „Hirsch“
18./19. Jahrhundert
Eisen, bemalt; Hirsch mit dazugehöriger Wandhalterung; H. 34,6 cm (Aushängeschild), L. 39 cm (Halterung)
€ 1.000–2.000


3391
Eisenuhr
1. Hälfte 18. Jahrhundert
Eisen, bemalt; Zifferblatt mit Darstellung des Heiligen Georg; Eisenplatine mit Eisenrädern; Spindelgang mit Vorderpendel, Stundenschlag auf Eisenglocke; Gewichte teilweise ergänzt, möglicherweise nicht vollständig; reinigungsbedürftig; 28,5 × 22 × 12 cm
€ 500–1.000

3392
Zunftzeichen verschiedener Zünfte
18. Jahrhundert
Eisen, bemalt; auf der Vorderseite mit Zunftzeichen verschiedener Zünfte; H. 45,5 cm
€ 1.000–2.000


3393
Zunftzeichen der Hufschmiede
18. Jahrhundert
Eisen, bemalt; auf der Vorderseite mit Darstellung eines Pferdes, dem Heiligen Leonhard von Limoges und Antonius von Padua, datiert „1704“ sowie „1842“ und bezeichnet „R.V./M17 391“; H. 31,2 cm
€ 1.500–3.000
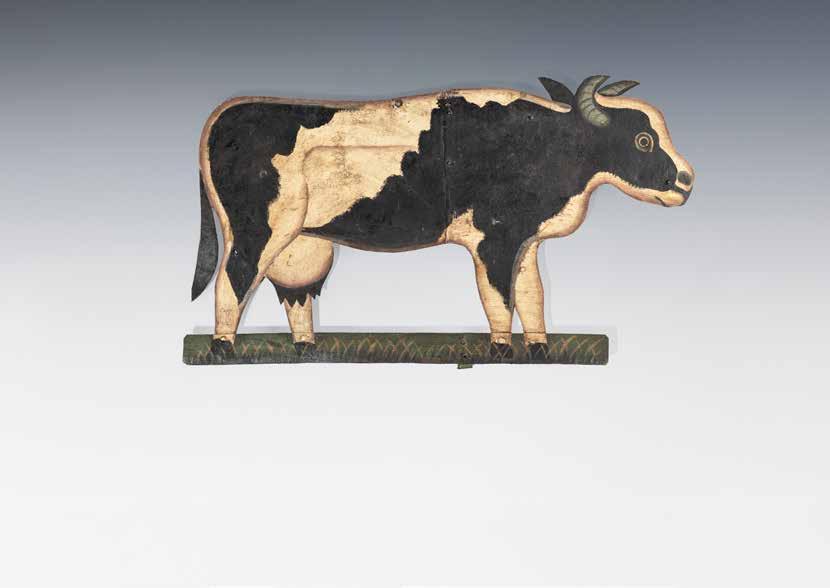
3394
Großes Aushängeschild „Kuh“ 18./19. Jahrhundert
Eisen, bemalt; auf der Vorderseite und rückseitig mit Darstellung einer Kuh; 99 × 60 cm
€ 2.000–4.000

wohl Schweiz, datiert „1575“
Glas, bemalt und rückseitig farbig überfangen, Bleifassung; zentrales Wappen, umgeben von Tier- und Puttendarstellungen, teilweise mit Schriftbändern; unten rechts datiert „1575“; 1 Glas mit Bruchstelle; 42,3 × 31 cm
€ 1.000–2.000
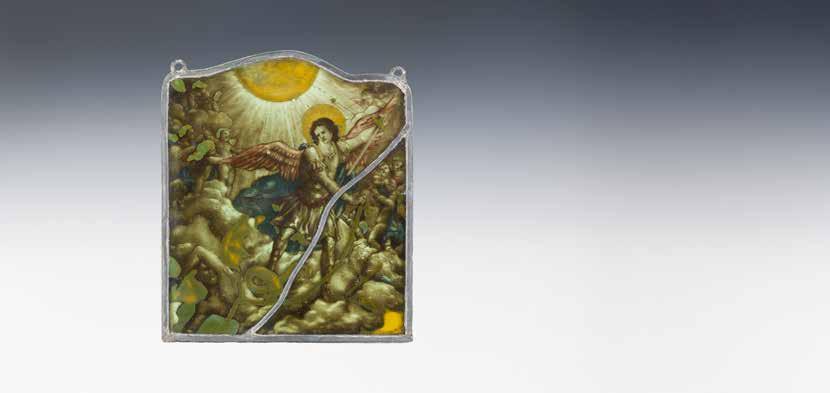

18. Jahrhundert
Glas, bemalt, Bleifassung; Darstellung des den Teufel bekämpfenden Erzengel Michael; die Bleifassung später; Bruchstelle; 33,7 × 29,2 cm
€ 500–1.000
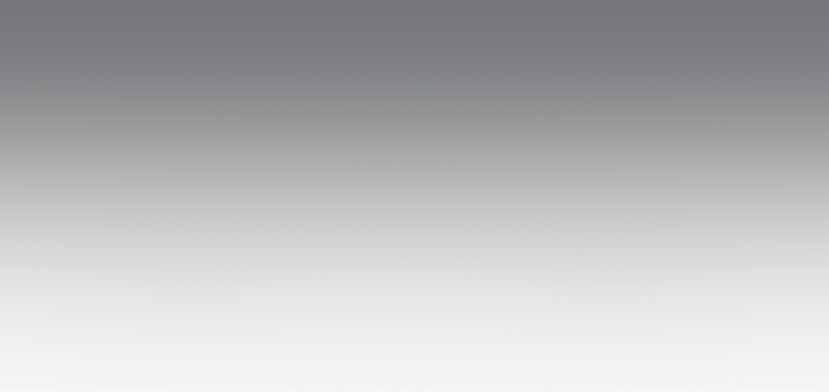
Appenzell, datiert „1606“, wohl 19. Jahrhundert
farbiges und farbloses Glas, bemalt, Bleifassung; zentrales Wappen, umgeben von 2 Herren; unten am Schriftband bezeichnet „Daß Land Apenzell 1606“; 1 Glasteil ausgebrochen; 31,5 × 26,6 cm
€ 600–1.200

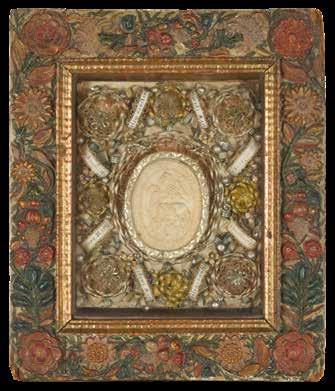
Zwei Klosterarbeiten
18. Jahrhundert
Holzrahmen, geschnitzt, bemalt; jeweils ein zentrales Wachsmedaillon mit der Darstellung des Lamm Christi, umgeben von Schriftbändern, silbernen Kugeln und Gold- und Silberdraht; 1 Wachsmedaillon gebrochen; 40,4 × 34,1 × 5,7 cm
€ 1.500–3.000


3399
Zwei Klosterarbeiten
19. Jahrhundert
Blechrahmen, mit Papier und Stoffband überzogen; jeweils ein zentrales Bild mit Heiligendarstellungen, umgeben von Schriftbändern und Silberdraht; H. 11,2 cm
€ 300–600
19. Jahrhundert
Leder, Federkielstickerei; Ranzen mit 2 Schnallen und integrierter Geldtasche; Bundweite: 80 cm
Literatur vgl. Helmut Nemec, Alpenländische Volkskunst. Wien 1980, S. 152 ff.
€ 400–800


19. Jahrhundert
Leder, Federkielstickerei; 2 Ranzen, jeweils mit 3 Schnallen und integrierter Geldtasche; Bundweite: 85 bzw. 92 cm
Literatur vgl. Helmut Nemec, Alpenländische Volkskunst. Wien 1980, S. 152 ff.
€ 1.000–2.000
3402
Hochzeitslader
18. Jahrhundert

Holz, geschnitzt, bemalt, Spiegelglas; die Wandung mit ornamentalen Dekor; im unteren Bereich mit Monogramm „KR“; einige Holzapplikationen fehlen; H. 201 cm
€ 1.000–2.000


3403
Brettsessel
18./19. Jahrhundert
Holz, geschnitzt, bemalt; die Rücklehne und die Sitzfläche mit Fischdarstellung; H. 98,5 cm
€ 1.500–3.000

3404
Löffelrehm
Alpenländisch, datiert „1851“
Holz, geschnitzt, teilweise rot bemalt; Löffelrehm für 6 Löffel, vorne mit reliefierter Darstellung einer bäuerlichen Szene, die Rückwand datiert „1851“; 27,2 × 26 × 5,2 cm
€ 500–1.000

Zwei Spielsteine „Belagerung Wien“
Wien, Ende 17. Jahrhundert
Holz, geprägt; 1 Spielstein mit Darstellung der Schlacht am Kahlenberg 1683 bzw. des belagerten Wiens, bezeichnet „A DOMINO VENIT PAX & VICTORIA“ (vom Herrn kommt Frieden und Sieg) bzw. 1 Stein mit Darstellung eines Gefesselten bzw. Doppelportrait Josephs I. und Wilhelmine Amalie von Braunschweig, bezeichnet „VICTOR VICIT/ SCHAU WAS SICH ERGEBEN MUSST/ UNSERM RÖMER REICHSAUGUST“; Dm. 5,5 bzw. 7,2 cm
€ 500–1.000

3406
Sechs Viechtauer Löffel
Oberösterreich, 19. Jahrhundert
Holz, bemalt; jeweils im Spiegel mit floralem Dekor, 1 Löffel mit Monogramm „CAB“; 1 Löffel rückseitig mit Ausbruch; L. 17,6 bis 21,7 cm
Literatur
vgl. Helmut Nemec, Alpenländische Bauernkunst. Wien 1966, S. 96
€ 1.000–2.000
3407
Tellerrehm „Jagd“
Oberösterreich, 1. Hälfte 19. Jahrhuhndert
Holz. bemalt; durchbrochen gearbeitet, die Rückwand sowie vorne mit Jagddarstellungen, zentraler Doppeladler, links und rechts davon mit Monogramm „JM“ und „WM“; teilweise mit Bruchstellen, 1 Holzapplike fehlt; L. 87 cm
€ 2.500–5.000


Drei Viechtauer Krösendosen
Oberösterreich, Mitte 19. Jahrhundert
Holz, bemalt; die Wandungen jeweils mit floralem Dekor, die Deckel jeweils bezeichnet mit „Nani“, „IHS“ bzw. „INRI“; jeweils mit Schraubverschluss; H. 5,2 bis 6,5 cm
Literatur
vgl. Helmut Nemec, Alpenländische Bauernkunst. Wien 1966, S. 105
€ 500–1.000
18. Jahrhundert
Horn, Silber, Stahl; 2-teiliges Besteck, bestehend aus: 1 Gabel und 1 Wetzstahl; geprägte Lederscheide; L. 16,5 cm bzw. L. 17 cm
€ 300–600


Salzburg, 18. Jahrhundert
Steinbockhorn, Metall, Stahl; 2-teiliges Besteck, bestehend aus: 1 Messer und 1 Gabel; auf der Messerklinge gemarkt mit Herstellermarke „SCHARTINGER“; Lederscheide; L. 19,5 bzw. 21,3 cm
Literatur
vgl. Ausstellungskatalog, Geschnitztes Steinbockhorn., Salzburg 1990, S. 135, Abb. 69
€ 800–1.600
Südtirol, 19. Jahrhundert
Horn, graviert und bemalt; vorder- und rückseitig mit Wildtier- sowie Doppeladlerdarstellung und bezeichnet „SUR SU M“; Schieber fehlt; L. 17,8 cm
€ 1.000–2.000


Sterzinger
Südtirol, 19. Jahrhundert
Horn, graviert; die Laffe rückseitig mit Dorf- und Blumendarstellung; L. 23,4 cm
€ 500–1.000

Südtirol, datiert „1843“
Horn, graviert und bemalt, Messingmontierung, Stahlklinge; vorder- und rückseitig mit Wildtierdarstellungen und bezeichnet „ID“; die Stahlklinge gemarkt mit 9 Kreuzen und 9 Mondnachen, datiert „1843“ und mit Inschrift; L. 12,5 cm (geschlossen) bzw. 22 cm (geöffnet)
€ 500–1.000

Südtirol, 19. Jahrhundert
Horn, graviert; der Deckel mit Vogel- und Rankendarstellung, seitlich bezeichnet „Wer mich nicht um erlaubnis fragt/den gib ich keinen Schnupftaback“, auf der Unterseite mit Darstellung einer Berghütte mit Wanderer; L. 8 cm
€ 400–800

Fünfzehn Votivgaben
19. Jahrhundert
Silber- und Messingblech; 15 Votivgaben in unterschiedlichen Ausführungen; L. 6 bis 21 cm
€ 1.000–2.000 3416
Zehn Anhänger
19. Jahrhundert
Silber, Metall; 10 Anhänger in unterschiedlichen Ausführungen, davon 1 mit Filigranarbeit und 4 mit eingefassten Münzen, teilweise mit Besitzermonogrammen; teilweise gemarkt mit Alt-Wiener Beschauzeichen, Dianakopfpunzen, österreichischen Kontrollpunzen und Meistermarken; L. 6,5 bis 14 cm, Bruttogesamtgewicht: 494 g
€ 500–1.000

Herrengrund, 18. Jahrhundert
Kupfer; die Wandung mit Schlangenhautdekor, oben und unten mit Sinnspruch; H. ca. 9,8 cm
€ 600–1.200


Schraubflasche
datiert „1750“
Kupfer, innen verzinnt; hexagonale Form, die Wandung mit floralem Dekor und datiert „1750“; Zinnschraubverschluss; H. 30 cm (inkl. Öse)
€ 500–1.000

Drei Tummler
Herrengrund, 18. Jahrhundert
Kupfer, teilweise vergoldet; die Wandung Schlangenhautdekor, jeweils mit Sinnspruch; H. 4,4 bis 4,9 cm
€ 600–1.200

3420
Zwei Serpentinfässchen
Zöblitz, Sachsen, 17./18. Jahrhundert
Serpentin; jeweils mit Serpentin- bzw. Zinndeckel; H. 6,3 bzw. 14,4 cm
€ 1.000–2.000

3421
Paar Scheibenleuchter 16./17. Jahrhundert
Bronze; H. 52,5 cm
€ 1.500–3.000
3422
Trinkgefäß „Zunftschuh“
datiert „1783“
Zinn; die Wandung mit graviertem floralem Dekor, bezeichnet „Ein Ehrsambs Handwerk der Schuhmacher der Zunftmeister“ und datiert „1783“; an der Schuhspitze ein Zinnschraubverschluss; im Verschluss mit Sammlungsetikett; L. 24,7 cm
€ 1.000–2.000


3423
Backmodel „Zunftschuh“
18./19. Jahrhundert
Zinn; seitlich 2 Handhaben, öffenbar; L. 22,5 cm
€ 500–1.000

3424
Schraubflasche „Buch“
17./18. Jahrhundert
Zinn; die Wandung vorder- und rückseitig mit gravierten Heiligendarstellungen; Zinnschraubverschluss; im Verschluss ein Sammlungsetikett; H. 22 cm
€ 1.000–2.000



3425
Bergkristall-Totenkopf Anhänger
wohl 19. Jahrhundert
Bergkristall, vergoldetes Silber, Email, Granat, Perlen; L. 8 cm
€ 1.000–2.000

3426
Bergkristall-Anhänger
wohl 18./19. Jahrhundert
Bergkristall, vergoldetes Silber; H. 7,3 cm
€ 500–1.000

3427
Email-Anhänger um 1600
Email, vergoldetes Kupfer; Barockrahmen mit Putten, Plakette vorder- und rückseitig mit Mariendarstellung bzw. Christus als Guter Hirte; L. 9,2 cm
€ 1.000–2.000
3428
Rosenkranz
wohl 19. Jahrhundert
Amethyst, vergoldetes Silber; L. ca. 70 cm
€ 1.200–2.400


3429
Rosenkranz
wohl 19. Jahrhundert
Granat, Bergkristall, vergoldetes Silber; L. ca. 78 cm
€ 1.200–2.400

3430
Rosenkranz
wohl 19. Jahrhundert
Nephrit, vergoldetes Silber; L. ca. 58 cm
€ 1.200–2.400
3431
Rosenkranz
wohl 19. Jahrhundert
roter Jaspis, Bergkristall, vergoldetes Silber; L. ca. 74 cm
€ 1.200–2.400


3432
Rosenkranz
wohl 19. Jahrhundert
18kt Gold, Bernstein; L. ca. 59 cm
€ 1.200–2.400

3433
Rosenkranz
wohl 19. Jahrhundert
wohl brauner Jaspis, vergoldetes Silber; L. 102 cm
€ 1.200–2.400

3434
Rosenkranz wohl 19. Jahrhundert
18kt Gold, Email, Amethyst; L. ca. 68 cm
€ 1.200–2.400

3435
Rosenkranz wohl 19. Jahrhundert
Moosachat, vergoldetes Silber; L. ca. 94 cm
€ 1.200–2.400
3436
Doppelpetschaft mit Treueschwur
wohl 19. Jahrhundert
Perlmutt, Messing, Karneol; Petschaft mit 2 gravierten Siegeln; L. 8 cm
€ 600–1.200


3438
Anhänger „Heilige Familie“
1. Hälfte 19. Jahrhundert
Perlmutt, Metall; Dm. 4,6 cm
€ 200–400

3437
Korallen-Amulett
16./17. Jahrhundert
Koralle, vergoldetes Metall; L. 9,5 cm
Literatur vgl. Liselott Hansmann, Lenz Kriss-Rettenbeck, Amulett und Talisman. München 1977, S. 54, Abb. 9
€ 1.500–3.000

3439
Hand-Amulett
wohl 18./19. Jahrhundert
Gold, orangefarbener Quarz, Diamant; L. 1,5 cm, Bruttogesamtgewicht: 4 g
€ 250–500

Hausaltar „Heilige Margarethe“
Augsburg, 17. Jahrhundert
Holz, Koralle, Metall, teilweise vergoldet und bemalt, Glas; zentrale
Darstellung der Heiligen Margarethe aus Koralle; H. 29 cm
Literatur
vgl. Philippovich, Eugen von. Kuriositäten, Antiquitäten: ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. Braunschweig: Klinkhardt & Biermann, 1966, S. 131 € 1.500–3.000
Fächerplatte
Gmunden, 18. Jahrhundert
Keramik aus hellem Scherben, weiß und grün glasiert; stellenweise mit Glasurfehlern; 29,4 × 25 cm
€ 1.000–2.000


3442
Doppelschüssel
Gmunden, 18. Jahrhundert
Keramik aus hellem Scherben, gelb und grün glasiert; Teller mit integrierter Schale, seitlich 2 Handhaben; Dm. 34,5 cm (exkl. Handhaben)
Literatur
vgl. Bayerisches Nationalmuseum, Sammlung Online, Inv.-Nr. 11/244
vgl. Irmgard Gollner, Gmundner Keramik. Töpfertradition einst und jetzt, Linz 1989, S. 80
€ 2.500–5.000
Jakob Pisotti d. Ältere, Salzburg, 2. Hälfte 18. Jahrhundert
Keramik aus ockerfarbenem Scherben, farbig staffiert und glasiert; oktagonale Form, vorder- und rückseitig mit Tierdarstellung; Zinnschraubverschluss; auf der Unterseite mit Sammlerstempel; H. 29 cm (exkl. Ring)
▲ € 3.000–6.000



3444
Walzenkrug
„Katzen und Hund“
Gmunden, 18. Jahrhundert
Keramik aus hellem Scherben, farbig staffiert und glasiert; auf der Vorderseite 2 Katzen und 1 von ihnen gequälter Hund; Zinnmontierung und -deckel; auf der Unterseite gemarkt mit „P“; 1 Baum mit Glasurfehler; H. 20 cm
€ 500–1.000

3445
Birnkrug „Weinlese“
18./19. Jahrhundert
Keramik aus hellem Scherben, farbig staffiert und glasiert; die Wandung auf der Vorderseite mit der Darstellung eines Weinbauers; Zinnmontierung und -deckel; H. 26,5 cm
€ 500–1.000

3446
Walzenkrug
„Mann im Stiefel“
Gmunden, 18. Jahrhundert
Keramik aus hellem Scherben, farbig staffiert und glasiert; auf der Vorderseite mit Darstellung eines Mannes im Stiefel; Zinnmontierung und -deckel, der Deckel mit Monogramm „TP“; H. 22 cm
€ 500–1.000

Gmunden, 18. Jahrhundert
Keramik aus ockerfarbenem Scherben, farbig staffiert und glasiert; die Wandung umlaufend mit Jagddarstellungen; Zinnmontierung und -schraubverschluss; H. 20 cm
€ 1.500–3.000

Georg Asam, Gmunden, datiert „1789“
Keramik aus ockerfarbenem Scherben, farbig staffiert und glasiert; die Wandung auf der Vorderseite mit Heiliger Familie, wie sie am Brunnen Wasser holen; unter der Henkelschnecke mit Malermonogramm „GA“ für Georg Asam und datiert „1789“; Zinnmontierung und -deckel, der Deckel mit Monogramm „MK“; H. 31,7 cm
Literatur vgl. Langer, Österreichische Fayencen, München 1988, S. 232 (Marke)
€ 3.500–7.000
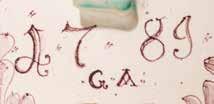
Detail Signatur
Krug „Kreuzigung Christi“
datiert „1775“
Keramik aus hellem Scherben, farbig staffiert und glasiert; die Wandung auf der Vorderseite mit Kreuzigungsdarstellung, umgeben von Arma Christi sowie Maria Magdalena, Maria, Hl. Johannes, Hl. Petrus, Hl. Michael, Hl. Joseph und Hl. Andreas; unter dem Henkel mit Besitzermonogramm „MF“ und datiert „1775“, auf der Unterseite mit Malermonogramm „IL“; H. 26 cm
€ 5.000–10.000
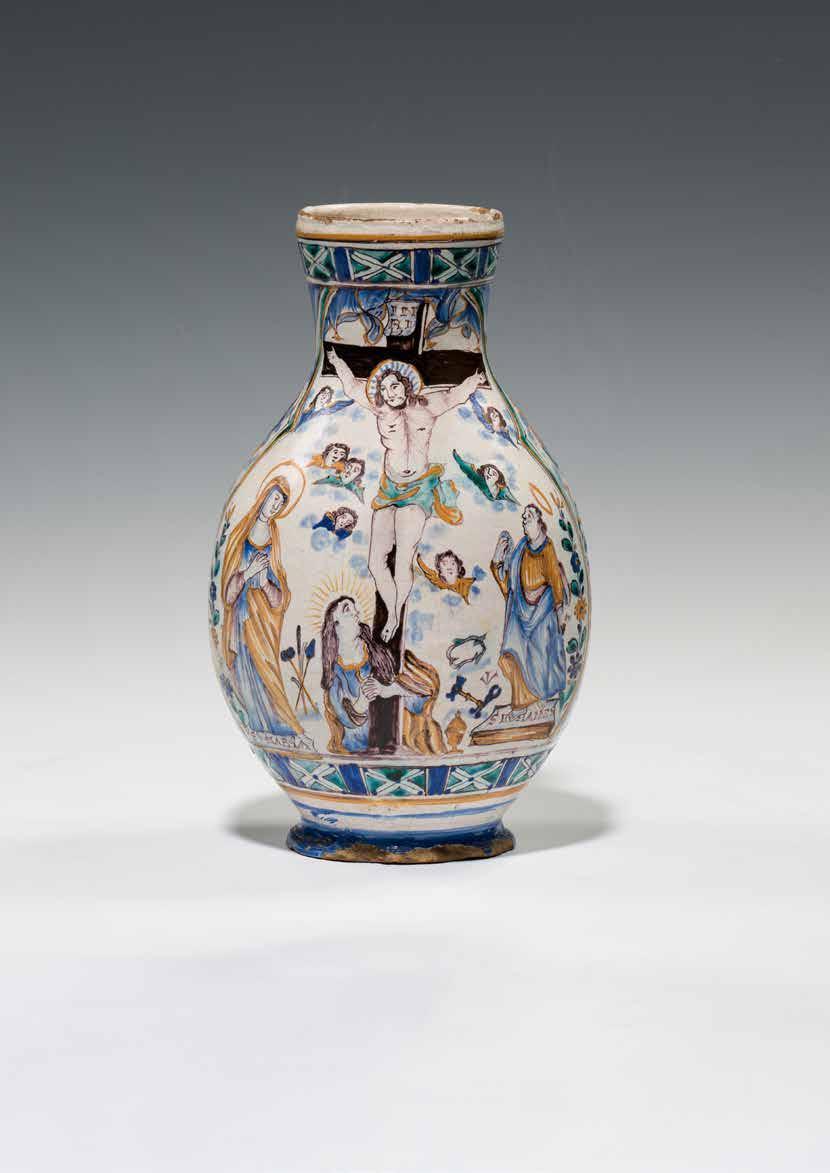

Detail Signatur
Krug „Kreuzigung Christi“ datiert „1757“
Keramik aus hellem Scherben, farbig staffiert und glasiert; die Wandung auf der Vorderseite mit Kreuzigungsdarstellung, umgeben von Hl. Petrus, Hl. Matthias, Hl. Paulus und Hl. Matthäus im Oval; auf der Unterseite mit Malermonogramm „MM“ und datiert „1757“; H. 24 cm
€ 5.000–10.000
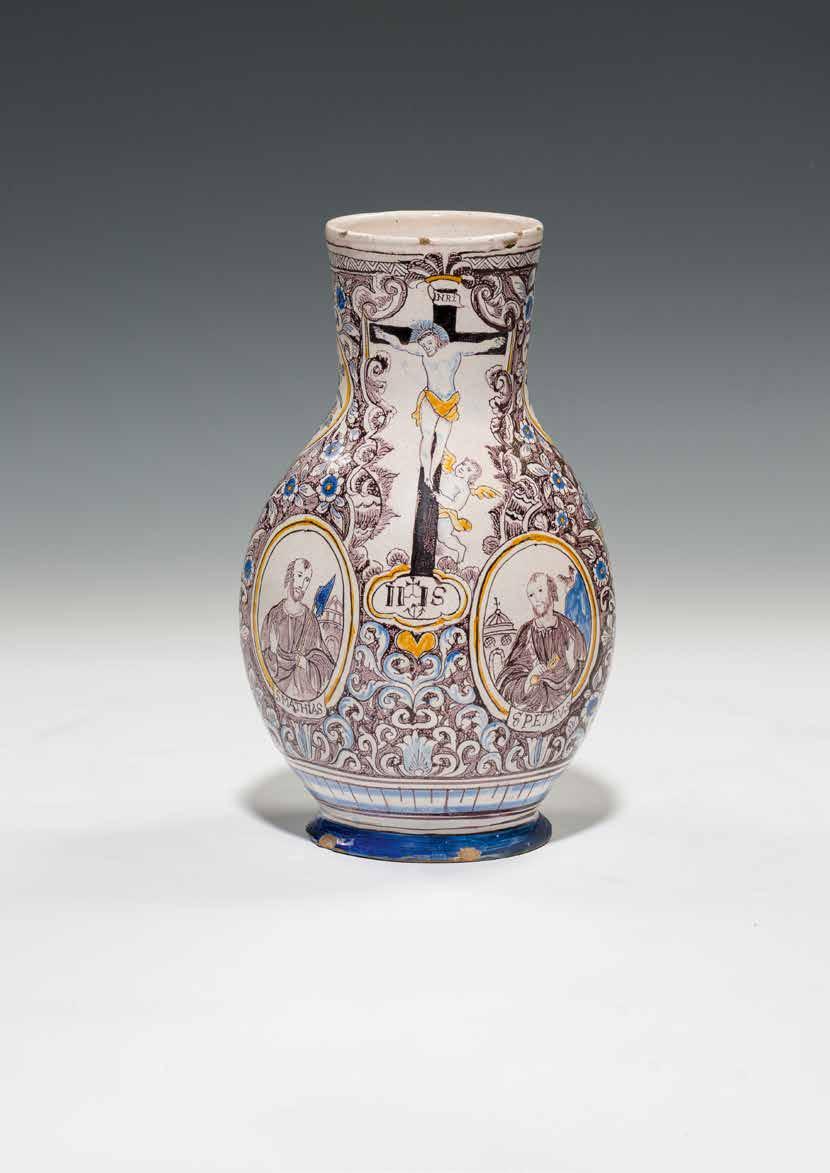


Posthabaner Krug
Slowakei, datiert „1824“
Keramik aus hellem Scherben, farbig staffiert und glasiert; die Wandung auf der Vorderseite mit Kutscherdarstellung, darüber bezeichnet „KOPACIK KAROL 1824“; auf der Unterseite mit Malermonogramm „GK“; H. 33 cm
€ 1.000–2.000

3452
Fächerteller
wohl Haban, Slowakei, 18. Jahrhundert
Keramik aus hellem Scherben, weiß glasiert, blau, manganfarben und gelb staffiert; der Spiegel mit Vogeldarstellung, die Fahne mit Sterndekor; Dm. 26,5 cm
€ 1.500–3.000

Haban, um 1710
Keramik aus hellem Scherben, weiß glasiert, blau, türkis, und gelb staffiert; die Wandung mit zwei Vögeln und Blattranken, schnabelförmiger Ausguss; Zinnmontierung und -deckel, der Deckel mit verschlagener Zinnmarke; H. 21 cm
Literatur
vgl. Diana Radvanyi, Laszlo Reti, Ceramic art of the Habans. the ceramic art of the Carpathian Basin, Budapest 2011, S. 99, Abb. 111 und S. 316, Abb. 477
€ 3.500–7.000

Enghalskrug „Blütendekor“
Hanau, um 1700
Keramik aus hellem Scherben, weiß glasiert blau staffiert; die Wandung umlaufend mit Blütendekor; auf der Unterseite gemarkt mit unterglasurblauer Malermarke; Zinnmontierung und -deckel; der Fuß mit Rissbildung; H. 27,9 cm
€ 800–1.600

Paar Apothekergefäße
Holíč, Slowakei, 18. Jahrhundert
Keramik aus hellem Scherben, weiß glasiert und manganfarben staffiert, vergoldete Bronze; auf den Vorderseiten mit Kranzdekor, seitlich jeweils 2 Handhaben; auf der Unterseite gemarkt mit „HP“ und Nr. „4.“ bzw. „6.“; H. 19 cm
€ 1.500–3.000

Paar Delfter Deckelvasen
Delft, 18./19. Jahrhundert
Keramik aus hellem Scherben, weiß glasiert und blau staffiert; die Wandung umlaufend mit floralem Dekor, die Deckelknäufe in Form von Hunden; jeweils auf der Unterseite gemarkt, wohl mit Malermarke; H. 50,5 cm
€ 1.000–2.000

Hans Hilgers, Siegburg, datiert „1573“ weißes Steinzeug; die Wandung umlaufendes Relief mit 3 allegorischen Darstellungen, jeweils darüber bezeichnet „DER GHE LOF DE LEIFTDE DE GERICHTIGEIT“ (wohl für der Gelobte leistete Gerechtigkeit), auf der Vorderseite mit Monogramm „HH“ und datiert „1573“; Zinnmontierung und -deckel; H. 30,5 cm
Literatur
vgl. Siegburger Steinzeug. Köln 1987, S. 224
€ 1.000–2.000

Creussen, 17./18. Jahrhundert
Steinzeug, dunkelbraun glasiert und farbig staffiert; die Wandung umlaufendes Relief mit Apostelmodeln, jeweils bezeichnet „S.PETRVS“, „S. ANDREAS“, „S. IAKOB MAIOR“, „SALVATOR“, „IOHANNES“, „S. PHILLIPVS“, „S. THOMAS“, „S. MATTEVS“, Zinnmontierung und -deckel, der Deckelknauf als vollplastisch ausgestalteter Löwe; H. 17,5 cm
Literatur
vgl. Joachim Kröll, Creussener Steinzeug. Braunschweig 1980, S. 168, Abb. 107 (Dekor) und S. 175, Abb. 113 (Form)
€ 1.000–2.000

3459
Beret
wohl 16. bis 19. Jahrhundert
Samt, geflochtene Metallkordel und Straußenfedern; ca. 5 × 30 × 19 cm
Provenienz Sammlung Figdor, Wien
€ 1.000–2.000

3460
Haube
wohl 16. bis 19. Jahrhundert
Seidensamt, Metallkordel und Quasten, Wachsperlen- und Metallfadenstickerei, Fransenborte; ca. 9,5 × 22,5 × 22,5 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
€ 1.000–2.000

3461
Paar Miniatur-Schuhe
wohl Türkei, 19. Jahrhundert
rotes Leder, teilweise mit Metallstickerei, Seidenquasten; L. 13,9 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
€ 500–1.000
3462
Schaupuppe „Heinrich VIII“
16. oder 19. Jahrhundert
Kopf aus Komposit-Material, bemalt, diverse Textilien mit Silberund Metallfäden, Perlen und Glassteinen bestickt, Pelz; auf Samtständer; H. 34,5 cm
€ 1.000–2.000


Bei unserer 132. Auktion, im Juni 2020, konnten wir zwei vergleichbare Schaupuppen „Heinrich VIII.“ und „Elisabeth I.“ für ein Meistbot von 210.000 € zuschlagen.
Heinrich VIII. Tudor (1491–1547) war von 1509 bis zu seinem Tod im Jahr 1547 König von England. Ab 1541 trug er auch den Titel König von Irland. Seine Herrschaft prägte die englische Geschichte tiefgreifend – politisch, gesellschaftlich und religiös.
Besonders bedeutsam war seine Rolle in der englischen Reformation: Heinrich trennte England von der römisch-katholischen Kirche und gründete die anglikanische Staatskirche, deren Oberhaupt er selbst wurde.
Heinrich VIII. war der erste englische König mit einer Ausbildung im Geiste der Renaissance. Er sprach mehrere Sprachen, schrieb Gedichte, komponierte Musik und interessierte sich stark für religiöse Fragen.
Auch sein Privatleben sorgte für viel Aufsehen: Heinrich war sechs Mal verheiratet. Zwei Ehen wurden annulliert, zwei Ehefrauen ließ er aufgrund des Hochverrats und Ehebruchs hinrichten, eine Frau starb im Kindbett und seine letzte Ehe endete mit seinem eigenen Tod.
Nach seinem Tod ging die Krone zunächst an seinen neunjährigen Sohn Eduard VI.. Nach dessen frühem Tod folgte seine älteste Tochter Maria I., und schließlich bestieg seine Tochter Elisabeth I. den Thron. Mit ihrem Tod im Jahr 1603 endete die Herrschaft des Hauses Tudor.

England, um 1840–50
Holz, Elfenbein, geschnitzt, Glasperlenstickerei, Emailknauf; Dm. 39 cm, H. 48 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
CITES-Bescheinigung liegt vor.
€ 500–1.000

3464
Frankreich/England, Mitte 19. Jahrhundert
Elfenbein, geschnitzt, Seidenstickerei, Fransen; L. 59 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
CITES-Bescheinigung liegt vor.
€ 1.000–2.000

Kleidmodell
wohl 16. bis 19. Jahrhundert violett und gelbtöniges Lampas-Gewebe, Wachsperlen, Metallfäden, aufgenähte Samtbänder, die Kragenpartie und Einsätze der Ärmel aus fein gefaltenem Leinenbatist, Stehkragen mit aufgenähter Metallborte mit Wachsperlen, von innen mit Leinwand-Gewebe und Drähten gestärkt; spätere Ausbesserungen; ca. 52 × 48 × 20 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
€ 3.500–7.000

3466
Goldhaube
wohl Niederösterreich, um 1800
Metallstickerei in Gold, halbkugel- und rautenförmige Metallelemente; ca. 20 × 13 × 23 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
€ 1.500–3.000

3467
Dreistückshaube
Nordwestdeutschland, um 1800
Goldspitze, Glassteine, Metallpailletten, Metallfolie, rückseitig Schlaufen aus Metallfäden; Futterstoff fehlt; ca. 11,5 × 26 × 8 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
€ 1.000–2.000

3468
Haarnetz-Calotte in Puppengröße
wohl 16. bis 19. Jahrhundert
Goldfäden in Schlingtechnik, Wachsperlen, gerahmt mit Seidengewebe mit Metallfäden und seidener Fransenborte, verstärkt mit Drähten; ca. 9 × 10 × 10,5 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
€ 700–1.400

wohl 16. bis 19. Jahrhundert
Kopf aus Komposit-Material, bemalt, Körper aus Leder, Gliedmaßen teilweise aus gefasstem Holz, geflochtener Zopf teilweise aus Echthaar, Unterkleid aus hellem Seidendamast, Kleid aus Samt, Metallborten, applizierten „Röschen“ aus Seide und Metallfäden, Rüschenkragen aus Leinen und Klöppelspitze, Unterärmel und Haube aus Seide und Metall, Wachsperlen; Kleid mit Karton verstärkt; ca. 34 × 19,5 × 9 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
€ 2.500–5.000

wohl 16. bis 19. Jahrhundert
Samt, Goldstickerei mit Arabesken, Puffärmel mit reichem Goldbortendekor, Unterärmel aus gewebten Seidenbändern mit Metallbroschierung, Ärmelrüsche aus Seide mit Klöppelspitzenbesatz und eingearbeiteten Metallfäden; gefüttert mit blassblauem Seidenpongis, teilweise verstärkt mit Drähten und Schaumgummi; H. 41 cm
Provenienz
Sammlung Figdor, Wien
€ 2.500–5.000
Auszug aus der Geschäftsordnung
Den Wortlaut der gesamten Geschäftsordnung können Sie unserer Homepage www.imkinsky.com entnehmen.
Auf Wunsch senden wir Ihnen die Geschäftsordnung auch zu.
Geschäftsordnung
Die Auktion wird nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung der Auktionshaus im Kinsky GmbH durchgeführt. Die Geschäftsordnung liegt im Auktionshaus zur Einsicht auf, kann von jedermann per Post oder E-mail (office@imkinsky.com) angefordert werden und ist im Internet unter www.imkinsky.com abrufbar.
Mindestverkaufspreis (Limit)
Oft beauftragen Verkäufer das Auktionshaus, das ihnen gehörende Kunstwerk nicht unter einem bestimmten (Mindest-)Verkaufspreis zuzuschlagen. Dieser Preis (= „Limit“) entspricht meist dem in den Katalogen angegebenen unteren Schätzwert, er kann aber in Ausnahmefällen auch darüber liegen.
Echtheitsgarantie
Die Schätzung, fachliche Bestimmung und Beschreibung der Kunstobjekte erfolgt durch Experten des Auktionshauses. Das Auktionshaus steht innerhalb von zwei Jahren gegenüber dem Käufer für die Echtheit und somit dafür ein, dass ein Kunstobjekt tatsächlich von dem im Katalog genannten Künstler stammt.
Katalogangaben
Angaben über Technik, Signatur, Material, Zustand, Provenienz, Epoche der Entstehung usw. beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die Experten ausgeforscht haben. Das Auktionshaus leistet jedoch für die Richtigkeit dieser Angaben keine Gewähr.
Ausrufpreis und Zuschlag
Der Ausrufpreis wird vom Auktionator festgesetzt. Gesteigert wird um ca. 10 % des Ausrufpreises bzw. vom letzten Angebot ausgehend. Den Zuschlag erhält der Meistbietende, sofern der Mindestverkaufspreis erreicht ist. Der Käufer hat den Kaufpreis binnen 8 Tagen nach dem Zuschlag zu bezahlen.
Gerichtsstand, Rechtswahl
Die zwischen allen an der Auktion Beteiligten bestehenden Rechtsbeziehungen unterliegen österreichischem materiellem Recht. Als Gerichtsstand wird das für den 1. Wiener Gemeindebezirk örtlich zuständige Gericht vereinbart.
Versicherung
Die Kunstobjekte sind versichert. Versicherungswert ist der Kaufpreis. Die Haftung des Auktionshauses besteht bis zu dem auf die Auktion folgenden 8. Tag. Danach ist ein Kunstobjekt nur versichert, wenn der Käufer dies dem Auktionshaus aufgetragen hat.
CITES-Genehmigungen
Das Objekt (im Katalog mit l gekennzeichnet) erfordert eine Genehmigung nach dem Artenhandelsgesetz.
Die für einen Verkauf benötigten Dokumente liegen uns vor. Für den Export in Nicht- EU- Staaten sind womöglich (weitere) CITES Genehmigungen erforderlich, die durch den Käufer zu beschaffen sind. Gerne übernimmt das Auktionshaus im Auftrag und auf Kosten die Antragstellung.
Einfuhr, Ausfuhr
Für die Ausfuhr von Kunstgegenständen aus Österreich ist unter Umständen eine Genehmigung des Bundesdenkmalamtes nötig. Das Auktionshaus beschafft solche Genehmigungen nur auf besonderen Wunsch des Käufers und gegen Bezahlung der damit verbundenen Kosten. Bei Objekten, die dem Artenschutz unterliegende Bestandteile toter Lebewesen aufweisen, können wir keine Gewähr dafür übernehmen, dass sie aus Österreich exportiert oder in andere Länder importiert werden dürfen. Wir sind aber auf Wunsch unserer Kunden und gegen Kostenersatz bereit, für sie Verfahren zur Genehmigung der Ausfuhr/Einfuhr zu führen.
Allgemeine Hinweise
Das Auktionshaus behält sich vor, eine Sicherheit in Höhe von 10 % des oberen Schätzwertes in Form einer Bankgarantie oder einer vergleichbaren Besicherung zu verlangen. Sämtliche Überweisungen sind spesenfrei für das Auktionshaus durchzuführen. Das Auktionshaus übernimmt keine Haftung für etwaige Mängel, technische Dienstleistungen, Störungen oder Ausfälle der Internet- und Telefonverbindung.
Käuferprovision
Bei Differenzbesteuerung beträgt die Käuferprovision für den unter € 500.000 gelegenen Teil des Meistbots 30 % für den € 500.000 übersteigenden Teil des Meistbots bis € 5.000.000 25 % für den € 5.000.000 übersteigenden Teil des Meistbots 17 % Im Aufgeld ist eine 20 %ige Umsatzsteuer enthalten.
Bei Normalbesteuerung (im Katalog mit ▲ gekennzeichnet, oder im Fall einer Ausfuhr in Nicht-EU Staaten) beträgt die Käuferprovision für den unter € 500.000 gelegenen Teil des Meistbots 25 % für den € 500.000 übersteigenden Teil des Meistbots bis € 5.000.000 20,8 % für den € 5.000.000 übersteigenden Teil des Meistbots 14,2 % Zuzüglich 13 % Umsatzsteuer bei Gemälden und 20 % bei Antiquitäten. Im Falle eines Exports ist die Einfuhrumsatzsteuer des Empfängerstaates nicht enthalten.
Werden die Kunstwerke ins Nicht-EU Ausland verbracht und Exportpapiere werden vorgelegt, ist der Kauf umsatzsteuerfrei.
Gebote nach der Auktion (Nachverkauf)
Käuferprovision 35 % Mit der Übermittlung des Kaufauftrags sind Sie 14 Tage an diesen gebunden.
Folgerecht
Bei Kunstobjekten, die im Katalog mit einem * gekennzeichnet sind, wird zusätzlich zum Kaufpreis die Folgerechtsabgabe verrechnet. Sie beträgt 4 % von den ersten € 50.000 des Meistbotes, 3 % von den weiteren € 150.000, 1 % von den weiteren € 150.000 und 0,25 % von allen weiteren, also € 500.000 übersteigenden Meistboten, jedoch insgesamt nicht mehr als € 12.500. Bei Meistboten von weniger als € 2.500 entfällt die Folgerechtsabgabe.
Gekaufte aber nicht abgeholte Kunstwerke werden vier Wochen nach der Auktion auf Gefahr und Kosten des Käufers, unversichert, eingelagert oder an eine Spedition ausgelagert.
Verzugszinsen 12 % pro Jahr des Meistbotes Verrechnung ab dem 9. Tag nach der Auktion für Inländer, ab dem 31. Tag für Ausländer. Die Verpackung, Versendung und Versicherung ersteigerter Objekte erfolgt nur auf Anweisung des Käufers und auf seine Kosten und Gefahr.
Sensalgebühr 1,2 % vom Meistbot
Für Verkäufer
Verkäuferprovision nach Vereinbarung
Katalogkostenbeiträge für Abbildungen Mindestpreis € 100
Vorschusszinsen 12 % pro Jahr
Katalogabonnement
Jahres-Gesamt-Abonnement (inkl. Versandkosten) Österreich € 130 Europa € 150 Übersee € 200

The wording of the complete rules of procedure can be viewed on our homepage www.imkinsky.com. By request we will also send the rules of procedure to you.
Rules of business
Auctions are conducted according to the conditions of sale as set down by Auktionshaus im Kinsky GmbH. The rules of business are available for viewing at the auction house, and can be requested by post or email (office@imkinsky.com), they can also be found on our website: www.imkinsky.com.
Reserve price (Limit)
Sellers quite often appoint the auction house, not to sell their object beneath a certain price. This price (= reserve/limit) usually matches the lower estimate, but in special situations can also surpass it.
Guarantee of authenticity
The valuation, as well as technical classification and description of the art objects is carried out by the specialists of Auktionshaus im Kinsky. Auktionshaus im Kinsky guarantees the purchaser the authenticity for two years – i.e. that the authorship of the art object is as set out in the catalogue.
Catalogue descriptions
Catalogue information concerning techniques, signatures, materials, condition, provenance, period of origin or manufacture etc. are based on the current knowledge determined by the experts. Auktionshaus im Kinsky cannot be held responsible for the verification of these descriptions.
Starting price & hammer price
The starting price is determined by the auctioneer. The bidding rises in approximate increments of 10% from the starting price, or from the last bid. The highest bidder acknowledged by the auctioneer will be the purchaser as long as it has reached the reserve price.
Governing law and jurisdiction
The site for the dealings between Auktionshaus im Kinsky and the purchaser is the address of Auktionshaus im Kinsky. All legal dealings or conflicts between persons involved in the auctions are governed by Austrian law, place of jurisdiction shall be the courts for the First District of Vienna.
Insurance
All the art objects are insured. The insurance value is the purchase price. The responsibility of the auction house lasts until the eighth day after the auction. After that, each art object is only insured if there is an order from the purchaser to do so.
CITES permits
The item (marked with “l” in the catalogue) requires a permit under the Species Trade Act.
We have all the necessary documents for the sale. Additional CITES permits may be required for export to non-EU countries, and these must be obtained by the buyer. However, the auction house would be happy to submit the application on the buyer’s behalf and cover the cost.
Import/Export
Some works of art may be exported from Austria with the permission of the Federal Monuments Office only. The auction house shall obtain such permissions only by special request of the buyer and after payment of the costs involved. In the case of objects containing components of dead organisms that are subject to species protection, we cannot guarantee that they may be exported from Austria or imported into other countries. However, at the request of our customers and against reimbursement of costs, we are prepared to conduct export/ import licensing procedures on their behalf.
General information
The Auction House reserves the right to request a deposit, bank guarantee or comparable other security in the amount of 10% of the upper estimate. All bank transfers are to be made free of charge for the Auction House. The Auction House assumes no liability for any errors, technical services, breakdown, or failure of the Internet and Telephone connection.
Buyer’s commission
Subject to differential taxation the buyer’s commission is on the hammer price up to € 500.000
on the part of the hammer price in excess of € 500.000 up to € 5.000.000
on the part of the hammer price in excess of € 5.000.000
including 20% sales tax
Subject to normal taxation (marked with “▲” or intended for export to non-EU countries) on the hammer price up to € 500.000
on the part of the hammer price in excess of € 500.000 up to € 5.000.000
on the part of the hammer price in excess of € 5.000.000
plus 13% VAT with paintings or 20% VAT with antiques Please note that these fees exclude any import VAT in the state of destination in case of an export.
If the works of art are transported to non-EU countries and export papers are provided, the purchase is VAT-exempt.
Bids after the auction (post-auction sale)
Buyer’s commission 35%
Please note that you are bound to this offer for a term of 14 days.
Droit de suite
Objects marked with an asterisk * in the catalogue are subject to droit de suite in addition to the purchase price. Droit de suite is calculated as a percentage of the highest bid as follows: 4% of the first € 50.000, 3% of the next € 150.000, 1% of the next € 150.000, 0.5% of the next € 150.000 and 0.25% of the remaining amount (i.e. over € 500.000), but not exceeding a total sum of € 12.500. Droit de suite does not apply to highest bids below € 2.500.
Collection of items bought at auction
Items which have not been collected within 4 weeks after the auction are stored at the expense and risk of the buyer, even outside our business premises, without insurance.
Interest on late payments
12% per annum from the purchase price
Applied from the 9th day after the auction for nationals, from the 31st day for buyers from outside.
Packaging, shipping and insurance of auctioned objects only take place upon the buyer’s request and at his expense at risk.
Broker fee
1,2% of the hammer price
Seller’s commission by agreement
Catalogue fees for images
Minimum price: € 100
Advance payment interest 12% per annum
Catalogue subscription
Annual subscription (including shipping costs):
Austria € 130
Europe € 150
Overseas € 200


Monika Uzman T +43 1 532 42 00-22 Außerhalb der Öffnungszeit: M +43 664 421 34 59 monika.uzman@gmail.com Service
Mag. Elisabeth Skofitsch-Haas M +43 676 450 67 50 skofitsch@imkinsky.com im Kinsky Graz, A-8010 Graz, Kaiser Josef Platz 5 / Eingang Ecke Mandellstraße Alle Sparten Steiermark & Kärnten

Mag. Claudia Schneidhofer T +43 1 532 42 00-48 schneidhofer@imkinsky.com

Heidi Hofmann, BA T +43 1 532 42 00-16 hofmann@imkinsky.com


Michael Kovacek T +43 1 532 42 00 Geschäftsführer, Sachverständiger für Gemälde & Antiquitäten
Dr. Ernst Ploil T +43 1 532 42 00 Geschäftsführer, Gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Jugendstil & Design Client Advisory & Private Sale

Mag. Roswitha Holly M +43 699 172 922 33 holly@imkinsky.com
Client Advisory, Gerichtlich zertifizierte Sachverständige

Gallus Pesendorfer, MA M +43 699 172 922 43 pesendorfer@imkinsky.com
Client Advisory, Private Sale

Lilith Waldhammer, BA T +43 1 532 42 00-31 waldhammer@imkinsky.com

Paulina Panhofer T +43 1 532 42 00-11 panhofer@imkinsky.com

Mag. Valerie Gaber, BA Bakk. phil. T +43 1 532 42 00-24 gaber@imkinsky.com

Robert Mayr T +43 1 532 42 00-18 mayr@imkinsky.com
Transport

Thomas Cerny T +43 1 532 42 00-36 cerny@imkinsky.com

Mag. Kareen M. Schmid
T +43 1 532 42 00-20 schmid@imkinsky.com
Alte Meister, Spartenleitung, Gerichtlich zertifizierte
Sachverständige

Mag. Monika Schweighofer T +43 1 532 42 00-10 schweighofer@imkinsky.com Gemälde des 19. Jh., Spartenleitung

Mag. Astrid Pfeiffer T +43 1 532 42 00-13 pfeiffer@imkinsky.com
Zeitgenössische Kunst, Spartenleitung

Judith Kuthy, BA BEd Cert GA T +43 1 532 42 00-19 kuthy@imkinsky.com Schmuck, Antiquitäten, Jugendstil & Design

Maximiliane Seng, MA T +43 1 532 42 00-33 seng@imkinsky.com
Alte Meister, Gemälde des 19. Jh.

Dr. Hansjörg Krug Alte Grafik, Zeichnungen und Bücher

Mag. Claudia Mörth-Gasser T +43 1 532 42 00-14 moerth-gasser@imkinsky.com
Moderne Kunst, Spartenleitung, Gerichtlich zertifizierte
Sachverständige

Barbara Berger, BA T +43 1 532 42 00-43 berger@imkinsky.com
Moderne Kunst

Miriam Bankier, BA MA T +43 1 532 42 00-66 bankier@imkinsky.com Uhren, Antiquitäten, Jugendstil & Design

Kimberley Fetko, MA T +43 1 532 42 00-28 fetko@imkinsky.com
Alte Meister, Gemälde des 19. Jh.

Valerie Pauß, BA BA T +43 1 532 42 00-26 pauss@imkinsky.com
Moderne Kunst

Melissa Huber, MA T +43 1 532 42 00-17 huber@imkinsky.com Zeitgenössische Kunst

Dr. Herbert Schullin Schmuckexperte



1010 Wien, Freyung 4 office@imkinsky.com

Katharina Fischer T +43 1 532 42 00-41 fischer@imkinsky.com
Zeitgenössische Kunst

Magdalena Muth, BA T +43 1 532 42 00-21 muth@imkinsky.com
Antiquitäten, Jugendstil & Design, Schmuck & Uhren

Lukas Schullin Gemmologe
Prof. Kristian Scheed Uhren
Michael Bernaschek Armbanduhren
Gallus Pesendorfer, MA Private Sale & Client Advisory +43 699 172 92 243 pesendorfer@imkinsky.com

Wir sind Ihr richtiger Ansprechpartner für den diskreten und professionellen Umgang mit Kunst.



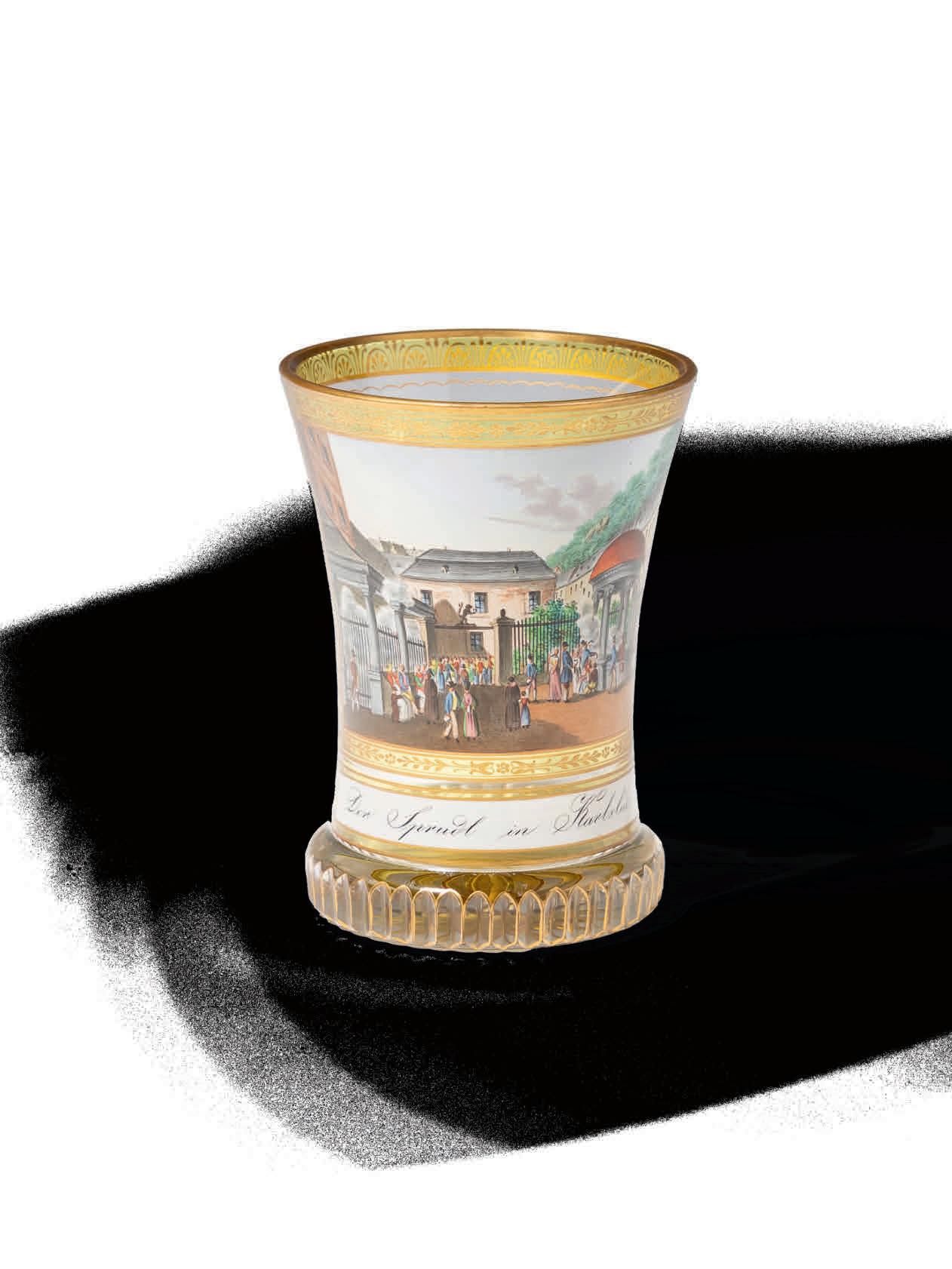
Bitte beachten Sie, dass es nach Druck des Katalogs zu Änderungen oder Ergänzungen kommen kann. Eine Liste solcher Änderungen finden Sie auf unserer Webseite oder in unseren Geschäftsräumen.
Please note that there may be changes or additions after printing the catalogue. A list of such changes can be found on our website or in our business premises. !
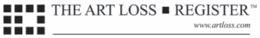
„Auktionshaus im Kinsky ist Partner von Art Loss Register. Sämtliche Gegenstände in diesem Katalog, sofern sie eindeutig identifizierbar sind und einen Schätzwert von mind. EUR 5.000 haben, wurden vor der Versteigerung mit dem Datenbankbestand des Registers individuell abgeglichen.“
“Auktionshaus im Kinsky is a member of the Art Loss Register. All works in this catalogue, as far as they are uniquely identifiable and have an estimate of at least EUR 5,000 have been checked against the database of the Register prior to the auction.”
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, A-1010 Wien, Freyung 4, FN 34302 w Handelsgericht Wien, UID Nr. ATU 37293905. Für den Inhalt verantwortlich:
Michael Kovacek & Dr. Ernst Ploil, A-1010 Wien, Freyung 4, T +43 1 532 42 00, F +43 1 532 42 00-9, office@imkinsky.com. Digitalfotografie:
Peter Griesser, Ines Schranz, Auktionshaus im Kinsky GmbH Satz, Druck, Bindung: Print Alliance HAV Produktions GmbH, A-2540 Bad Vöslau, Druckhausstraße 1, T +43/2252/402-0, office@printalliance.at, www.printalliance.at Design: Alexander Rendi — Florian Cerny

An / To Auktionshaus im Kinsky GmbH
Palais Kinsky Freyung 4 A-1010 Wien
n durchzuführen durch das Auktionshaus n durch Frau Sensal Monika Uzman carried out by the auction house by Broker Mrs. Monika Uzman n durchzuführen durch telefonisches Mitbieten* bidding by telephone*
office@imkinsky.com www.imkinsky.com
Ich kenne die auf der Rückseite wiedergegebene Geschäftsordnung** der Auktionshaus im Kinsky GmbH sowie die Gebühren für Käufer und akzeptiere sie. Auf deren Grundlage beauftrage ich Sie, folgende Gebote für mich abzugeben.
I know the rules of procedure (on the reverse)** of Auktionshaus im Kinsky GmbH as well as the fees for buyers and I accept them. On the basis of the included terms and conditions of auction I give the order to submit the following bids for me.
Katalog-Nr.
Lot-No.
Künstler/Titel (Stichwort)
Artist/Title (description)
Gebot bis Euro (€)
Top Limit of Bid in Euro (€)
n Erhöhen Sie bei Notwendigkeit mein Gebot um ein weiteres (ca. 10 %) If required please increase my bid by one call (approx. 10%)
n Sollten Sie mich telefonisch nicht erreichen können, soll das Auktionshaus bis zu einem Preis von € für mich mitbieten. Should you not be able to reach me by phone during the auction sale, the auction house shall bid on behalf of me up to the price of €
Name
Straße / Street
Telefon / Phone
Telefax
PLZ, Ort / Zip Code, City Land / Country
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. / Place of fulfilment and jurisdiction is Vienna.
* Sie sind damit einverstanden, dass Ihre Telefongespräche von uns aufgezeichnet werden. / By using our services, you agree that we may record your telephone calls. ** Die vollständige Geschäftsordnung können Sie unserer Webseite www.imkinsky.com entnehmen. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Geschäftsordnung auch zu. / The entire rules of procedure can be viewed on our website www.imkinsky.com. We can also send you the rules of procedure upon request.
Ort, Datum / Place, Date
Unterschrift / Signature
Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, A-1010 Wien, Freyung 4, T +43 1 532 42 00, F +43 1 532 42 00-9 office@imkinsky.com, www.imkinsky.com, UID-Nr. ATU37293905, Firmenbuch: 34302w HG Wien
1) Preise:
Die angegeben Schätzpreise stellen die unteren und oberen Schätzpreise der Objekte dar. Sie stellen die Meistboterwartungen der zuständigen Experten dar.
2) Schriftlich mitbieten:
Sie können schriftliche Gebote abgeben. Tragen Sie für das gewünschte Kunstobjekt die Katalognummer und Ihr maximales Gebot ein. Wir werden in der Auktion bis zu diesem Betrag für Sie bieten. Sie erhalten das von Ihnen gewünschte Objekt zum geringstmöglichen Preis.
3) Telefonisch mitbieten:
Sie können an der Auktion telefonisch teilnehmen und Gebote abgeben. Bitte senden Sie uns Kaufund Telefongebote bis spätestens 24 Stunden vor der Auktion zu. Tragen Sie die Katalognummer und Ihre Telefonnummer, unter der Sie während der Auktion erreichbar sind, ein. Wir werden Sie anrufen. Dafür, dass eine telefonische Verbindung zustande kommt, können wir aber keine Haftung übernehmen.
4) Bieten durch einen Sensal:
Wenn Sie das Kästchen „Durch einen Sensal“ am Kaufauftrag markieren, geben wir Ihre Gebote an den Sensal weiter. Wenn zwei gleich hohe Gebote vorliegen, hat der Sensal Vorrang. Zum Kaufpreis fällt zusätzlich eine Sensalgebühr von 1,2 % vom Meistbot an.
Senden Sie Ihre Kaufaufträge bitte rechtzeitig per Fax (+43 1 532 42 00-9) oder Email (office@imkinsky.com).
5) Online Bieten: Sie können an der Auktion auch online teilnehmen. Ihr Gebot wird dabei wie eines aus dem Saal behandelt. Sie müssen sich dazu unter dem Link auction.imkinsky.com registrieren. Klicken Sie auf „Registrieren“ und Sie erhalten eine Bestätigungsmail. Das Mitbieten ist erst nach Bearbeitung durch uns möglich.
6) Rechnung:
Ihre Rechnung wird anhand der von Ihnen bekanntgegebenen Daten ausgestellt. Auch eine UID-Nummer bitten wir Sie vor der Auktion zu nennen.
7) Kaufpreis:
Der Kaufpreis setzt sich aus dem Meistbot und der Käuferprovision zusammen.
Käuferprovision:
Bei Differenzbesteuerung beträgt die Käuferprovision für den unter € 500.000 gelegenen Teil des Meistbots
für den € 500.000 übersteigenden Teil des Meistbots bis €
für den € 5.000.000 übersteigenden Teil des Meistbots
Im Aufgeld ist eine 20 %ige Umsatzsteuer enthalten.
Bei Normalbesteuerung (im Katalog mit ▲ gekennzeichnet, oder im Fall einer Ausfuhr in Nicht-EU Staaten) beträgt die Käuferprovision für den unter € 500.000 gelegenen Teil des Meistbots
für den € 500.000 übersteigenden Teil des Meistbots bis € 5.000.000
für den € 5.000.000 übersteigenden Teil des Meistbots
Zuzüglich 13 % Umsatzsteuer bei Gemälden und 20 % bei Antiquitäten. Im Falle eines Exports ist die Einfuhrumsatzsteuer des Empfängerstaates nicht enthalten.
8) Gebote nach der Auktion (Nachverkauf)
Käuferprovision 35 % Mit der Übermittlung des Kaufauftrags sind Sie 14 Tage an diesen gebunden.
9) Zahlungsbedingungen:
Die Bezahlung ersteigerter Kunstobjekte hat innerhalb von 8 Tagen zu erfolgen – entweder bar oder mit Bankomatkarte – während unserer Öffnungszeiten oder durch Überweisung. Sie können die ersteigerten Kunstwerke auch mit Ihrer Kreditkarte bezahlen. In diesem Fall verrechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 2 % des Kaufpreises.
10) Folgerecht: Bei Kunstobjekten, die im Katalog mit einem * gekennzeichnet sind, wird zusätzlich zum Kaufpreis die Folgerechtsabgabe verrechnet. Sie beträgt 4 % von den ersten € 50.000 des Meistbotes, 3 % von den weiteren € 150.000, 1 % von den weiteren € 150.000, 0,5 % von den weiteren € 150.000 und 0,25 % von allen weiteren, also € 500.000 übersteigenden Meistboten, jedoch insgesamt nicht mehr als € 12.500. Bei Meistboten von weniger als € 2.500 entfällt die Folgerechtsabgabe.
11) Gerichtsstand:
Sämtlichen Rechtsbeziehungen zwischen Bietern und dem Auktionshaus liegt die Geschäftsordnung der Auktionshaus im Kinsky GmbH zugrunde. Mit einem Gebot erklärt der Bieter, die Geschäftsordnung zu kennen und zu akzeptieren. Die Geschäftsordnung kann der Webseite www.imkinsky.com entnommen werden; sie wird auf Wunsch auch zugesandt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. Es gilt österreichisches Recht.
12) Allgemeine Hinweise:
Das Auktionshaus behält sich vor, eine Sicherheit in Höhe von 10 % des oberen Schätzwertes in Form einer Bankgarantie oder einer vergleichbaren Besicherung zu verlangen. Sämtliche Überweisungen sind spesenfrei für das Auktionshaus durchzuführen. Das Auktionshaus übernimmt keine Haftung für etwaige Mängel, technische Dienstleistungen, Störungen oder Ausfälle der Internet- und Telefonverbindung.

1) Prices:
In the catalogues the lower and upper estimated values are indicated and represent the approximate bid expectations of the responsible experts.
2) Written bids:
You can place written bids. Enter the catalogue number and your maximum bid for the work of art you wish to buy. At the auction we will bid for you up to this price. You will receive the requested item at the lowest possible price.
3) Telephone bids:
You may also participate in the auction via telephone. In this case, written notification shall be sent to the auction house at least one day before the auction takes place. Such written announcement shall contain the item and the catalogue number, as well as the bidder’s name, address and telephone number. The auction house shall make every effort to provide the telephone connection in the best possible manner, but will not assume any warranty for its execution.
4) Bids by a Broker:
If you tick the box “By a Broker” on the order bid, we will hand your bids over to a Broker. If two bidders make the same bid, the bid by the Broker takes precedence. A Broker fee of 1.2% of the highest bid is due in addition to the purchase price.
Please send your order bids in time by fax (+43 1 532 42 00-9) or email (office@imkinsky.com).
5) Online Bidding:
You can also participate in the auction online. Your bid will be handled as if it came from the auction room. Simply register at auction.imkinsky.com by clicking on “register” and you will receive a confirmation email. You will be able to bid as soon as we have processed your application.
6) Invoice:
Your invoice will be issued based on the data you have provided. Also, if you have a VAT-ID number, please tell us before the auction.
7) Purchase price:
The purchase price is composed of the highest bid and the buyer’s commission.
Buyer’s Commission:
Subject to differential taxation the buyer’s commission is on the hammer price up to € 500.000
Subject to normal taxation (marked with “▲” or intended for export to non-EU countries) on the hammer price up to € 500.000
on the part of the hammer price in excess of
on the part of the hammer price in excess of
plus 13% VAT with paintings or 20% VAT with antiques Please note that these fees exclude any import VAT in the state of destination in case of an export.
8) Bids after the auction (post-auction sale)
Buyer’s commission 35%
Please note that you are bound to this offer for a term of 14 days.
9) Terms of payment:
Items purchased in an auction are payable within 8 days – either in cash or debit card – during our opening hours or by transfer. You can also use your credit card to pay for the works you bought at the auction. We charge an administrative fee of 2% of the purchase price for credit card payments.
10) Droit de suite:
Objects marked with an asterisk * in the catalogue are subject to droit de suite in addition to the purchase price. Droit the suite is calculated as a percentage of the highest bid as follows: 4% of the first € 50,000, 3% of the next € 150,000, 1% of the next € 150,000, 0,5% of the next € 150,000 and 0.25% of the remaining amount (i.e. over € 500.000), but not exceeding a total sum of € 12,500. Droit de suite does not apply to highest bids below € 2,500.
11) Jurisdiction:
All privities of contract between the bidder and the auction house underlie the rules of procedure of Auktionshaus im Kinsky GmbH. In making a bid the bidder confirms to know and to accept the rules of procedure. The rules of procedure can be viewed on our Website www.imkinsky.com. We can also send you the rules of procedure upon request. Place of fulfilment and of jurisdiction is Vienna. Austrian law applies.
12) General information
The Auction House reserves the right to request a deposit, bank guarantee or comparable other security in the amount of 10% of the upper estimate. All bank transfers are to be made free of charge for the Auction House. The Auction House assumes no liability for any errors, technical services, breakdown, or failure of the Internet and Telephone connection.


