Julian Perrenoud

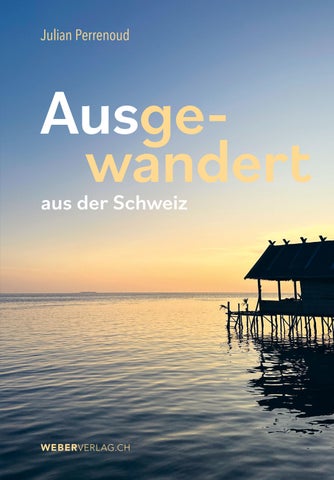
Julian Perrenoud































































































































































































Impressum
Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor/Autorin nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und von ihm/ihr und vom Verlag mit Sorgfalt geprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor/Autorin noch Verlag übernehmen Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.
Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2025 Weber Verlag AG, 3645 Thun/Gwatt
Weber Verlag AG
Idee und Texte: Julian Perrenoud
Verlagsleitung: Annette Weber-Hadorn
Projektleitung: Madeleine Hadorn
Gestaltung Cover: Sonja Berger
Gestaltung Inhalt und Satz: Aline Veugel
Bildbearbeitung: Adrian Aellig
Korrektorat: Laura Spielmann
Der Weber Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
ISBN 978-3-03818-784-4
www.weberverlag.ch mail@weberverlag.ch
Auslieferung EU
Brockhaus Commission GmbH
Postfach 1220
D-70803 Kornwestheim info@brocom.de
Für all jene, die sich ins Unbekannte wagen.
Das Leben lässt sich nicht verlängern, nur verdichten. Wo ginge das besser als auf Reisen? Wir sind unruhiger, wacher, erleben intensiver. Ständig müssen wir uns anpassen, neu orientieren. Reisen ist weit mehr als Urlaub, es ist Seelenwellness, befreit den Geist. Was wir unterwegs erleben, macht uns entspannter, empathischer – und mutiger. Vielleicht sogar kreativer. Auf jeden Fall aber glücklicher.
Gehen wir also in die Welt hinaus und riskieren, verwandelt zurückzukehren.
000 Kilometer, 9 Monate und 10 Kilo
Mein Laptop im Basar und der Fuss im Röntgengerät
sich Träume leben lohnt
1 «Die dicke Karre hat mich einfach nicht glücklich gemacht»
Ein Schwyzer in Schweden
2 «Zuhause drehen sich manche Leute noch immer nach mir um» Eine Nidwaldnerin in London
3 «Früher konnte ich nicht mal einen Salat pflanzen» Eine Baslerin in Marokko
4 «In der Sahara begann ich als Sans-Papier»
Eine Thurgauerin in Mauretanien
5 «Ich habe all meine Krawatten verbrannt – und plötzlich war mir vögeliwohl»
6 «Ich hätte schon so viele Male sterben können»
7 «Das Leben hier? Man liebt es oder man hasst es»
Eine Freiburgerin auf Mauritius
8 «Seit ich hier bin, ist mein Sonntagsblues verflogen»
Eine Bündnerin auf den Seychellen
9 «Ich habe kein Problem, in Krisenländern zu arbeiten»
Ein Waadtländer in Kirgistan
10 «Habe ich die Wahl, nehme ich den schwierigeren Weg»
Eine Neuenburgerin in Indien
11 «Ich fühle mich so richtig lebendig»
Ein Glarner in Indonesien
12 «Ich habe meinen Bubentraum verwirklicht: Ich kann so tun, als wäre ich Bauer»
Ein
13 «Wenn die Erde bebt, stelle ich mir sofort drei Fragen»
Eine Ausserrhödlerin in Neuseeland 135
14 «Vertrauen ist für mich der wahre Luxus»
Eine Luzernerin in Singapur 155
15 «Ich lasse mir mein Sackmesser nicht wegnehmen»
Ein Aargauer in Japan 165
16 «Für meinen neuen Pass bin ich eine Woche unterwegs»
Ein Zürcher in Mikronesien 175
17 «Ich mag die Risikofreude der Menschen hier»
Ein Walliser in Kanada 185
18 «Ich habe das Privileg, den Mars und die Erde zu erforschen»
Eine Urnerin in den USA 195
19 «Im Zweifel wähle ich im Leben das Risiko»
Ein Berner in Costa Rica 205
20 «Die finanzielle Sicherheit? Fehlt mir hier oben nicht»
Ein Genfer in Peru 215
21 «Ich hatte schon einmal eine Kugel im Kopf»
Ein Appenzeller in Kolumbien 225
22 «Ob ich Angst in der Luft habe? Klar, die ganze Zeit»
Ein Tessiner in Surinam 235
23 «Ich habe sechs Pferde mit dem Flugzeug gezügelt»
Ein Schaffhauser in Argentinien 247
24 «Für guten Käse bin ich schon mal 16 Stunden unterwegs»
Ein Obwaldner in Brasilien 259
25 «Notfalls schütze ich den Papst mit meinem Leben»
Ein Solothurner im Vatikan 269
26 «Heute bin ich meiner Mutter nicht mehr böse» Eine St. Gallerin in der Türkei

Hand aufs Herz: Haben Sie schon einmal ans Auswandern gedacht? Damit sind Sie nicht allein.
Der Traum vom Glück in der Ferne ist in der Schweiz weit verbreitet. Heute leben über 800 000 Menschen mit rotem Pass im Ausland – und es werden immer mehr. Manche bleiben nur kurz, andere für immer. Die fünfte Schweiz trägt ihren Namen zu Recht, denn viele Ausgewanderte halten den Kontakt in die Heimat und verfolgen das Geschehen dort genau.
Auch mich hat es einmal weggezogen: In Toronto lernte ich das Multikulturelle und Diverse dieser Welt kennen, die Hindernisse und Schwierigkeiten. Ich genoss die internationale Küche und verzweifelte an den öffentlichen Verkehrsmitteln.
In Kanada engagierte ich mich im Swiss Club Toronto. Solche Clubs gibt es weltweit. Sie feiern den 1. August oder führen Theater auf – als Brücke zur Heimat. Die Menschen, die ich dort traf, hatten spannende Auswanderungsgeschichten zu erzählen. Mich faszinierte der Mut, die eigene Komfortzone zu verlassen und etwas Neues im Leben zu wagen. Darüber wollte ich schreiben.
Doch wie lassen sich über 800 000 Menschen in einem Buch zusammenfassen? Sogar auf kleinsten Inseln findet sich eine Person aus der Schweiz. Was uns hierzulande eint oder trennt, ist der Kantönligeist. Mit diesem habe ich die perfekte Lösung gefunden: ein Buch über Auslandschweizer, das 26 Porträts umfasst – aus jedem Kanton eine Person in einem anderen Land. Ihre Geschichten, Hürden und Erfolgserlebnisse sollen eine Plattform erhalten.
Die neunmonatige Recherche brachte mich über die Kontinente zu 26 Persönlichkeiten, deren Leben und Umfeld unterschiedlicher nicht hätte sein können. Ich reiste in pulsierende Städte und auf tropische Inseln. Ich ritt durch die Sahara, fuhr durch die Steppe, flog über den Dschungel und blickte in den Vatikan. Kurz: Ich reiste in 26 Kantonen um die Welt.

Es ist die eine Frage, die mir zu meinem Buchprojekt bis heute am häufigsten gestellt wird: «Wie hast du all diese Schweizerinnen und Schweizer gefunden?» 26 Menschen – aus jedem Kanton eine Person – in 26 Ländern mit ebenso vielen unterschiedlichen Lebenswegen. Ja, wie macht man das?
Die Recherche und Planung waren aufwändig. Auf meine ersten Ausgewanderten stiess ich zufällig. In einem Zeitungsartikel, am Radio oder durch einen Hinweis von Freunden. Ich sammelte Artikel in einem Klarsichtmäppchen, später Namen in einer Excel-Tabelle. Die Felder benannte ich mit: Kanton, Land, Ort, Name, Beruf, Kontaktangaben und Datum. Alle geeigneten Personen, die ich finden konnte, trug ich hier ein – am Ende waren es über 120. Jene, die ich favorisierte, färbte ich grün; sobald sie zusagten und der Termin fixiert war, wechselte ich auf gelb.
Ein Jahr vor Beginn der Reise schärfte ich meinen Blick. Jede Spur nahm ich auf, recherchierte nach Leuten, von denen ich irgendwo mal flüchtig gehört hatte, konsultierte Listen über die im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer beim Bundesamt für Statistik, trat Facebook-Gruppen bei, in denen sich Auslandschweizer organisieren, und suchte bei Swiss Community, einem Netzwerk der Auslandschweizer-Organisation. In einigen Fällen googelte ich so lange, bis ich eine Person mit einem spannenden Beruf gefunden hatte.
Ich fokussierte mich auf kleine Kantone wie Appenzell oder Uri, um passende Leute zu finden. In Zürich, Bern oder der Waadt ist die Auswahl deutlich grösser. Die gewählten Personen sollten sich über den ganzen Globus verteilen. Was nach Sisyphusarbeit klingt, machte mir Spass; Schritt für Schritt kam ich meinem Ziel näher. Die Anfragen für einen Besuch vor Ort verschickte ich über Facebook, Instagram, E-Mail oder, falls
ich eine Handynummer finden konnte, über WhatsApp. Ich erhielt fast nur Zusagen.
Mit einigen telefonierte ich, um ein besseres Bild der Lebenssituationen zu erhalten. Mit meinem Vorgehen konnte ich beeinflussen, wohin mich meine Weltreise führen sollte. Ein paar Wunschländer hatte ich im Kopf: Ich wollte unbedingt die Polarlichter erleben, die Strände auf den Seychellen sehen, zurück nach Japan reisen sowie in die Föderierten Staaten von Mikronesien und in die Anden.
Auch wollte ich nicht nur für Ausgewanderte beliebte Berufe im Tourismus oder in der Landwirtschaft abdecken. Unter meinen 26 Personen waren alle möglichen Jobs: von der Schauspielerin bis zum Fleischproduzenten, vom Buschpiloten bis zur NASA-Wissenschaftlerin. Als mir noch wenige Personen fehlten, machte ich einen letzten Aufruf bei allen Zeitungen von Tamedia und bei Anzeiger-Redaktionen in verschiedenen Kantonen. Geschafft: Ich hatte 26 gelb eingefärbte Zeilen in meiner Excel-Tabelle.
Nun folgten die schwierigen Fragen: Wie besuche ich diese Menschen, damit es zeitlich und reisetechnisch Sinn macht? Und wie finanziere ich das alles?
Letzteres löste ich, indem ich meine Anstellung bei der Berner Zeitung auf 50 Stellenprozente reduzierte und mich verpflichtete, von unterwegs zu arbeiten. Zudem konnte ich mit Spenden aus einem Crowdfunding fast alle Transportkosten decken. An der ersten Frage rätselte ich dagegen lange herum. Erst wollte ich die Reise in mehrere Etappen aufteilen, entschied mich dann aber, die Recherche innerhalb von neun Monaten an einem Stück zu bewältigen. Von Anfang Februar bis Ende Oktober 2023.
Ich druckte eine A3-Weltkarte aus, um eine geeignete Route zu finden, und zeichnete ganz analog mit dem Filzstift quer durch die Länder. Ich pröbelte, verwarf und korrigierte. Ich wollte aus ökologischen Gründen möglichst kurze Distanzen zwischen meinen Besuchen und musste die Verfügbarkeit der jeweiligen Personen berücksichtigen. Genauso wie die Jahreszeiten auf der Nord- und Südhalbkugel.
Nach Wochen des Zeichnens und darüber Schlafens blickte ich zufrieden auf meine Weltkarte. Die gezogene Linie gefiel mir – so könnte es funktionieren.

Der Autor kann überall arbeiten, wie in diesem Café in Larnaca, Zypern. Hauptsache, das WLAN ist stabil und der Kaffee gut.

Der Schwyzer Max Hensler zog mit seiner Familie der Ruhe wegen nach Lappland. Diese fand er dort nur bedingt. Sowieso kam alles anders als gedacht.
Die Schneedecke funkelt im gleissenden Sonnenlicht, als wäre sie mit Diamanten übersät. Eine Winteridylle wie aus dem Märchenbuch.
Dann durchbricht Motorenlärm, einer heulenden Kettensäge gleich, die Stille. Aus der Ferne braust ein Schneemobil heran. Das Gefährt schwenkt bedrohlich stark aus. Die Balance verliert es nicht, Max Hensler steuert die schwarze Maschine stehend und einkufig durch den Pulverschnee. Mal links, mal rechts, links, rechts.
Schlanke Birken und Kiefern stehen an der Waldlichtung Spalier. Die Siebenergruppe auf ihren Schneetöffs schaut dem Spektakel zu, staunt und versucht sich selbst daran. Der Reiseleiter gibt seinen Gästen Ratschläge, applaudiert Manövern, lacht. Mit einer Touristengruppe seiner Lodge ist er an diesem sonnigen Februarmorgen in Richtung Norden aufgebrochen –40 Kilometer hoch zum Polarkreis.
Die Fahrt führt über den gefrorenen schwedisch-finnischen Grenzfluss, durch verschneite Wälder und weite Felder. Am arktischen Zirkel verlieren sich einige wenige rot bemalte Holzhäuser in der Landschaft. Eine Konstruktion aus Metallstangen symbolisiert die Breitenkreise. Darüber wehen die Fahnen der Anrainer: USA, Kanada, Finnland, Island, Norwegen, Schweden und Grönland. An der achten Stange fehlt die russische Flagge.
Videos, Panoramaaufnahmen, Gruppenfotos und Selfies – der Schwyzer hat es wieder einmal geschafft: Er hat seine Gäste in Staunen versetzt. Das muss er auch, schliesslich will er ihnen «a fantastic time» bieten. Der Spruch ist seine oberste Maxime, die er gern repetiert.
Während sich die Tourgruppe zurück in der Lodge eine Pause gönnt, geht für Max Hensler, den alle Mäx nennen, die Arbeit weiter: Er bespricht sich mit seinem etwa zehnköpfigen Helferteam, kümmert sich um Bestellungen, wickelt Buchungen ab, begrüsst und verabschiedet Gäste.
Als die Dämmerung hereinbricht, steht der 54-Jährige in der Küche und paniert Pouletbruststücke. Für ihn ist das selbstverständlich: «Meine Mutter hat immer gesagt: ‹Du musst kochen können›.» In seiner Küche hat er auch schon Elche ausgenommen, die er vom hiesigen Urvolk geschenkt bekommen hat. Einmal in der Woche laden er und sein Team zum Abendessen in die Sami-Lounge auf dem Gelände, ein Holzhaus aus dem 18. Jahrhundert mit Après-Ski-Charme, und servieren Raclette. Dafür lässt Mäx ganze Käselaibe aus der Schweiz herbeischaffen. Im Verlauf des Abends wird er zum DJ, spielt Mundartlieder ab – zur Freude seiner Gäste. Zu später Stunde steht er selbst noch hinter der Bar, serviert Getränke oder zeigt seinen Helfern, wie sie einen guten Zwätschge Luz anrühren. Daneben überredet er Gäste zu einem Schnupftabak, den er aus seinem Döschen auf die Handrücken pudert. Oder er prostet mit ihnen ein Gläschen Edelbrand weg. Die meisten Touristen aus der Schweiz und Deutschland bleiben für eine Woche. Eine Woche «Halligalli-Vollgas – für Mäx auch», beschreibt er sein Angebot. Danach gehen die Gäste und es kommen neue. Mäx bleibt.
Seit sechs Jahren ist er schon im hohen Norden als Gastgeber und Tätschmeister. Der Dirigent eines Ensembles, das sich ständig verändert. Denn um das Hotel und die Ferienhäuschen unterhalten zu können, benötigt er freiwillige Helferinnen und Helfer, die bei ihm für Kost und Logis arbeiten. Viele von ihnen waren einmal seine Gäste. «Das ist das schönste Kompliment überhaupt», sagt Mäx in einer der wenigen ruhigen Minuten,


Abends ist Mäx in der Küche fleissig, die Gäste geniessen derweil das Chalet.


Schlittenhunde und Schneemobil: zwei der Höhepunkte am Polarkreis.
die er hat. Um gleich wieder aufzustehen und auf Schwedisch einen Anruf am Handy entgegenzunehmen. Eine seiner Helferinnen meint: «Ich glaube, Mäx braucht diese ständige Herausforderung.» Eine andere antwortet auf die Frage, was ihre Faszination für Lappland ausmache: «Es ist die Kombination aus Landschaft und Mäx. Ohne ihn würde diese Lodge nicht funktionieren.» In Einsiedeln im Kanton Schwyz aufgewachsen, zeichnet sich bei ihm früh eine Faszination für den Norden ab. Als er 13-jährig mit seiner Schwester die norwegische Hauptstadt Oslo besuchen darf, fühlt er sich sofort zu Hause.
Skandinavien muss aber vorerst warten. Mäx lässt sich in der Feinmechanik ausbilden, arbeitet als Ingenieur und in der IT. Er nimmt haufenweise interimistische Jobs an, überwacht etwa Lieferketten von Schweizer Unternehmen im Ausland. In 28 Ländern ist er beruflich unterwegs. Er steigt zum Direktor auf. «Doch die dicke Karre hat mich nicht glücklich gemacht.» Mäx ist ausgebrannt, fällt in ein Loch, muss in die Therapie.
Dabei stellt er sich auch die Daseinsfrage. «Ich merkte, dass meine Aufgabe nicht darin besteht, für irgendwelche Firmen zu arbeiten, sondern darin, andere Menschen glücklich zu machen.» Als er mit seiner Frau Yasmine von einer Rundreise in Skandinavien nach Einsiedeln zurückkehrt, fragt sie ihn, was er davon halte, im Norden eine Ferienanlage zu kaufen. Mäx weiss Dutzende Gründe, die dagegensprechen. «Zumal ein Gastro- und Hotellerieprojekt nach einem Burn-out wohl die dümmste Idee ist», sagt er an der Rezeptionstheke seiner Lodge und lacht herzhaft. Wer dem kräftigen Mann mit Vollbart und schalkhaften Augen gegenübersteht, kann sich kaum vorstellen, dass dieser einmal komplett energielos war.
Trotzdem lässt ihn die Projektidee nicht mehr los. Im Dezember 2017 reist er nach Lappland und schaut sich leer stehende Hotelanlagen an. Je weiter nördlich er kommt, desto besser gefällt ihm die Idee. Schliesslich gelangt er nach Övertorneå, ein Dorf in der gleichnamigen Kommune, die nur 4500 Einwohnende zählt, aber fast dreimal so gross ist wie der Kanton Schwyz. Dort findet er eine zum Verkauf ausgeschriebene Ferienanlage mit mehreren Häusern direkt am Torne-Fluss, der die Grenze zu Finnland markiert.
Als Mäx in die Schweiz zurückfliegt, hat er den Kaufvertrag bereits in der Tasche. In nur zwei Monaten bricht die Familie ihre Zelte ab und reist nach Nordschweden. «Wir haben viele Fehler gemacht», gesteht er rückblickend ein. Sie hätten den Aufwand des Umbaus komplett unterschätzt und mussten für viel Geld die ganze Infrastruktur renovieren.
Wenn im Winter die Nacht hereinbricht, die Sterne über der Norrsken Lodge sichtbar werden und die kalte Luft in den Nasenlöchern beisst, verdichten sich mit etwas Glück am Horizont weissliche Schwaden, die sich in helles Grün verfärben und in immer neuen Formen lautlos über den Himmel tanzen. In Momenten wie diesen hält auch Mäx inne und blickt nach oben. «So schön wie dieses Mal waren sie noch nie», pflegt er dann augenzwinkernd zu sagen. Es ist eine Redensart hier oben. Und auch eine Ehrerbietung an die magischen Nordlichter.
Mäx und seine Familie haben sich durch schwierige Jahre gekämpft, ihr Projekt mit 70 Gästebetten hat auch Corona überstanden. Das Ehepaar hat sogar expandiert und diversifiziert: So führt es unter dem geschützten Namen Arctika die Lodge, einen Shop und ein neues Restaurant in Zürich mit nordischen Spezialitäten und eigens entwickelten Lapas (Tapas aus Lappland). Dieses leitet ein Freund des Ehepaars. Ebenfalls rief dieses ein eigenes Reiseunternehmen für die Region ins Leben.
Mäx hat weitere Ideen: ein eigenes Kleiderlabel etwa, Uhren mit Horn und Leder vom Elch. In Finnland hat er Land für Blockhäuser gekauft. Doch das Vorhaben verzögert sich, die Bauofferte ist mittlerweile viel teurer. Nun will er das Grundstück abstossen. Woher hat er die vielen Ideen? Mäx überlegt kurz und sagt: «Sie fallen mir zu.» Er sehe sofort das Bild im Kopf, wie eine Idee in Realität aussehen könnte. «Es ist schwierig, diese Bilder zu erklären.» Deshalb setze er sie einfach um. «Ich bringe verrückte Ideen auf den Boden.» Falls er zu lange fliegt, holt ihn seine Frau wieder runter.
Seit einem Jahr lebt der Familienvater allein hier oben. Yasmine und die beiden Kinder (7- und 10-jährig) sind in die Schweiz zurückgekehrt. Mäx und Yasmine mochten das Schulsystem in Schweden nicht, ihre beiden
Söhne hätten zu wenig eigenständig denken dürfen, sagen sie. Mäx, der

Nachts erhellen die geisterhaften Nordlichter den Himmel.
fast immer gut gelaunt scheint, wird ernst und sagt: «Es ist ein Seich, wenn die Familie so weit weg ist.» Eigentlich will er ja nur seine Gäste glücklich machen. Gleichzeitig ist er seinen Liebsten fern. Seine Frau habe ihn auch schon gefragt: «Brauchst du das wirklich?» Obwohl Mäx aus seiner Arbeit viel Kraft und Befriedigung schöpft, sind ihm seine endlichen Energiereserven bewusst. Kennt er seine Grenzen? «Mehr oder weniger», entgegnet er. Ist er rastlos? «Wahrscheinlich schon ein bisschen.»
Er spürt, dass die Zeit kommt, in der er wieder mehr auf seine eigenen Bedürfnisse hören muss. Daran hängt auch die Zukunft seiner Lodge. Bereits hat er einen Geschäftsführer gefunden, den er einführen möchte. Im Frühling will Mäx in die Schweiz zurückkehren – und dortbleiben.
Noch steht die Norrsken Lodge nicht zum Verkauf. Es scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein. Künftig wollen er und seine Frau sich vor allem mit der strategischen Leitung ihrer Angebote beschäftigen. Nach Övertorneå plant Mäx dann nur noch über Weihnachten, Neujahr und in der Winterhauptsaison sowie im Sommer zurückzukehren.
Die Zeit hier oben habe ihn reifer und ehrlicher gemacht. Und sie brachte ihn zur Erkenntnis, dass er keinen Besitz mehr benötigt. So übertrug er sämtliche Rechte und Habseligkeiten seiner Frau. Einzig seine Golftasche hat er behalten.
Ein neuer Tag im Winterwunderland. Mäx bricht zu einer Schneemobiltour auf. Spektakel für die Gäste ist garantiert. Als Mäx über den Vorplatz schreitet, sagt er, dass er sich gar nicht erinnere, wann er das letzte Mal in den Ferien gewesen sei. Wenn er es sich wünschen könnte, was würde er tun? Ohne zu überlegen, entgegnet Mäx mit einem breiten Grinsen: «Ich möchte zwei Wochen Golf spielen gehen – ganz für mich allein.»
Was ist Ihr Lieblingsessen hier?
Elch und Rentier, direkt aus dem Wald. Die Tiere kommen hier zur Welt, fressen viele gesunde Kräuter und sterben in diesen Wäldern – mehr bio geht nicht.
Und welches Gericht mögen Sie überhaupt nicht?
Eigentlich nichts. Sogar Rentierblut-Pancakes esse ich, aber eher selten.
Was vermissen Sie aus der Schweiz?
Ab und zu das Essen, einen Cervelat zum Beispiel. Die Freunde und meine Familie.
Welche Aktivität begeistert Sie hier?
Fahrten mit meinem Schneemobil.
Was muss man in Ihrer Region gesehen haben?
Eine Rentiermarkierung. Diese Zeremonie darf man aber nur auf Einladung des Sami-Volks sehen.
Was ist in diesem Land komplett anders als in der Schweiz?
Die Menschen sind weniger zuverlässig.
Was ist das Aussergewöhnlichste, das Ihnen hier passiert ist?
Als ich mir ein neues Schneemobil kaufte, versank ich mit diesem beim ersten Versuch im Schnee. Ich musste den Mechaniker der Garage rufen, um das Gerät rauszuholen. Das war mir peinlich. Ich wollte das nicht auf mir sitzen lassen und fuhr am selben Tag erneut raus – und versank ein zweites Mal. Ich rief erneut den Mechaniker. Aber einen anderen.

Eine Nidwaldnerin in London
Jasmine Imboden arbeitet als Schauspielerin in London. In der Metropole fühlt sie sich wohl, in der Schweiz ist das nicht immer der Fall.
«And – ACTION!» Die Generaldirektorin klammert sich am Rednerpult fest, räuspert sich. Dann beginnt sie mit der einstudierten Entschuldigung. In ihrer Firma, Potentia, sei man tief besorgt über die Entwicklung der letzten Tage. Zu ihrer Linken steht Jasmine Imboden. Dezenter Schmuck, graues Jackett, das Handy griffbereit in den gefalteten Händen. Sie ist die PR-Verantwortliche des Pharmakonzerns, der sich vor versammelter Presse wegen Medikamentenpfuschs erklären muss.
Doch: Alles ist nur gespielt. Wir befinden uns an einem Filmset in einem Sitzungszimmer eines Hotels im Osten Londons. Jasmine Imboden hat ihren Auftritt, als ein «Journalist» nachbohren will. Sie unterbricht ihn: «Stellen Sie Fragen bitte erst nachher.» Sie wiederholt den Text in Take 2 und Take 3. Mal filmt die Crew aus dieser Perspektive, mal aus jener, mal mit mehr künstlichem Licht, mal mit weniger.
An diesem verregneten Morgen muss Jasmine Imboden früh ihre Wohnung verlassen, um mit der Underground ans andere Ende der Stadt zu gelangen. Es ist Drehtag, der fünfte und letzte für diesen Kurzfilm, der für die London Film School produziert wird. Die 32-Jährige steht als Hauptdarstellerin vor der Kamera.
Das 30-köpfige Filmteam dreht bis tief in den Abend. Während der halbstündigen Mittagspause essen Kameraleute und Schauspielerinnen hastig Pizzas aus Pappkartons. Stress für Jasmine? Sie schüttelt den Kopf. Schliesslich werde sie dafür bezahlt, ihre Leidenschaft auszuüben. «Ich bin noch nie schlecht gelaunt zur Arbeit erschienen.» Arbeit, das heisst: Werbefilmdrehs, TV-Serien, Fotoshootings und Stimmaufzeichnungen.
Wer sich im Internet ihr Schauspielerinnenprofil anschaut, findet folgende Beschreibung:
• Spielalter: 24-30 Jahre
• Ethnie: Schwarz-Afrikanisch, Schwarz/andere Gebiete, Latina
• Haare: blond, rasiert
• Stimmqualität: weich
• Musik und Tanz: Gitarre, Ukulele, R&B, afrikanisch-traditioneller Tanz
• Sport: Fussball, Leichtathletik, Snowboard und Ski
Von der Agentur, die Jasmine Imboden vertritt, hat sie ein klares Profil erhalten. Wird sie gebucht, dann oft wegen ihres Hauttons und ihrer extrovertierten Art. Doch eigentlich möchte sich die Nidwaldnerin nicht in ein Schema pressen lassen – zumindest nicht privat. Das war schon früher so.
Als Kind einer Kenianerin und eines Nidwaldners in Fürigen NW aufgewachsen, einem Nicht-mal-400-Seelen-Dorf und heute Ortsteil von Stansstad, fällt Jasmine aus dem Rahmen. Ihre ältere Schwester, ihr älterer Bruder und sie sind die einzigen farbigen Kinder. Im Klassenzimmer und beim Sportunterricht wird sie auch mal «Äffli» oder «Negerli» gerufen. Gross Gedanken darüber macht sie sich damals nicht.
In ihrer Freizeit rennt sie stets zum Schulhaus, um rechtzeitig auf dem Fussballplatz zu sein. Wobei Fussballspielen in Fürigen gar nicht so einfach ist: Das Dorf liegt am Hang zum Vierwaldstättersee, wenn die Kinder nicht aufpassen, rollt der Ball plötzlich «ds Tobel ab». Doch Jasmine findet sich zurecht, spielt bald besser als ihre Gspänli – und tritt dem FC Hergiswil bei. Zum Probetraining erscheint sie in Wanderschuhen. Die Jungs lachen sie aus. «Da hab ich mir gesagt: Denen zeig ichs!» Beeindrucken will sie aber in erster Linie die Mädchen. «Wenn ich so zurückdenke, merkte ich schon damals, dass ich an Jungs kein Interesse hatte.»

In der Maske für den Auftritt. Jasmine schlüpft in verschiedene Rollen.

Kamera läuft. Die Nidwaldnerin mit anderen Protagonisten im Einsatz.
Mit 14 wird sie ins nationale Fussball-Ausbildungszentrum im bernischen Huttwil aufgenommen. Dafür verlässt sie das Elternhaus und lebt bei einer Gastfamilie. Mit 16 macht sie in Luzern das Sportler-KV. Die Nati wird auf die Jungspielerin aufmerksam. Sie erhält ein Aufgebot für die U-17 der Frauen. Talent und Willen bringt sie mit, ihr Weg zeigt nach oben, vielleicht liegt sogar eine Profilaufbahn drin? Dann verletzt sie sich mit 23 schwer: Kreuzband und Meniskus sind kaputt – frühes Karriereende.
Jasmine hat noch ein anderes Talent: Sie schauspielert fürs Leben gern, bereits früher in Schulaufführungen, immer in den Hauptrollen. Also packt sie erneut ihre Sachen und reist in die USA nach Los Angeles. Zwei Jahre kämpft sie sich durch die Schauspielschule. «Ich hatte grosse Pläne», sagt sie. Doch in Kalifornien wird ihr das Gefühl gegeben, sie genüge nicht. Ihr fehle die «Leading Actress Energy», die Energie also, die eine Hauptfigur ausstrahlen sollte. Als ihr Visum ausläuft, kehrt Jasmine nach Hause zurück. Sie versucht sich in der Schweiz als Schauspielerin, doch über ein Jahr lang erhält sie keinen einzigen Auftrag. Sie ist frustriert, verunsichert. Vielleicht wären die Chancen in London oder Berlin besser? Sie entscheidet sich für London. Auch, weil sie dort bei einer Kollegin unterkommen kann: Ramona Bachmann, Profifussballerin, spielt damals bei Chelsea.
2019 findet Jasmine einen neuen Agenten, der mit ihrem Profil eine Nische besetzen will. Sie soll Charaktere spielen, die kantig sind, aus dem Rahmen fallen. Sie verpasst sich einen neuen Look: raspelkurze, gebleichte Haare, bunte Klamotten, Nasenring, Tattoos. So fühlt sie sich wohl. Sie zieht in eine eigene Wohnung, hat eine Freundin, hilft in der Freizeit in einem Theater aus, wird Teil der Queer-Community. Sie singt, schreibt Songtexte. Sie fühlt sich zwar von Männern angezogen. «Verliebt habe ich mich bis jetzt aber nur in Frauen und non-binäre Personen», sagt sie.
Einen Tag nach ihrem Drehtermin treffen wir uns auf einem Spaziergang durch SoHo. Das Viertel ist das Zentrum der LGBTQIA+. Kleine Cafés, Boutiquen und Restaurants säumen die Fussgängerzone, an einzelnen Balkonen flattern Regenbogenfahnen. Abends besucht Jasmine fast wöchentlich Quiz-Nights, Konzerte, Poetry-Slams und Musicals. Sie liebt «Lion King», würde alles dafür tun, um einmal in dieser Bühnenproduktion mitzuwirken. «Selbst wenn ich nur einen Grashalm im Hintergrund spielen dürfte», sagt sie und lacht.