
18 minute read
Der längste Krieg

TIPP
Advertisement
Ein weiteres Narrativ ist das der „westlichen Befreier“, die den Frauen zu mehr Rechten verholfen haben. Auch das eine Mär? Das ist eine sehr beliebte Erzählung, die auch in diesen Tagen immer wieder aufgerollt wird. Abgesehen von den massiven militärischen Operationen seitens der Amerikaner, die nicht nur afghanische Männer, sondern auch Frauen getötet haben, ist die Annahme grundlegend falsch, dass die Regierungsbildung, auf die man sich 2001 fokussiert hat, eine von progressiven Demokraten war. Viel eher haben sich die Amerikaner und die NATO mit brutalen Kriegsverbrechern und fragwürdigen Persönlichkeiten verbündet. Mit Warlords und bekannten Drogenbaronen, die in den 90er Jahren zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begangen haben und sehr frauenfeindlich eingestellt waren. Also jene, die Frauen massakriert und vergewaltigt haben, sollten plötzlich die Guten sein, nur, weil sie auch zufällig gegen die Taliban waren. Die Ermächtigung der Taliban, so schreiben Sie in Ihrem Buch, ist auf die Kriegsführung der Amerikaner zurückzuführen. Ja. Was Ende 2001 passiert ist, war einer der fundamentalsten Fehler: Da sind westliche Akteure einmarschiert, die sich einerseits mit Menschenrechtsverbrechern verbündet haben, um eine neue Regierung zu gründen und dabei andrerseits die massiv geschwächten und verhandlungsbereiten Taliban von allen Gesprächen ausgeschlossen haben. Das hat dazu geführt, dass sich die Taliban neu formieren und aufstellen konnten. Und weil zusätzlich die NATO-Sicherheitskräfte zur Radikalisierung in Regionen beitrugen, die zuvor komplett talibanfrei waren, ging das umso einfacher. Die NATO? Wie darf man das verstehen? Man hat sich den Feind wiedergeschaffen, weil der „War on Terror” hauptsächlich Zivilisten traf. Hier im Westen wollte man uns weismachen, dass man mit bewaffneten Drohnen die Terroristen ausschaltet, dabei können Drohnenpiloten weder Kinder von Erwachsenen noch Soldaten von Zivilisten unterscheiden. So hat man die Menschen durch die vielen zi- VIEW vilen Opfer, die sie zu beklagen hatten, durch Folter, Mord und nie geahndete Massaker in die Arme der Radikalisierung getrieben. Jetzt ist eine Talibanregierung an der Macht, von der zwei Regierungsmänner zu einem brutalen Zweig der Gruppierung gehören und in den letzten zwei Jahrzehnten mehrfach durch Drohnenangriffe für tot erklärt wurden, bis sie jedes
Emran Feroz bei den „Neuen Spielräumen“ am Spielboden in Dornbirn: 18.11.2021, 19:30 Uhr „Afghanistan nach dem Sieg der Taliban“ Vortrag und Diskussion Mal wieder lebendig auftauchten. Nie hat man die Frage gestellt, wer denn an deren Stelle getötet wurde. Sie weisen in ihren Artikeln auch immer wieder auf das Stadt-Land-Gefälle hin und kritisieren pauschalisierende Afghanistan-Porträts. Richtig. Es gibt nicht dieses eine Afghanistan, das in den letzten 20 Jahren medial reproduziert wurde. Was medial gezeigt wird, ist ein extrem verzerrtes Bild, weil es nicht repräsentativ ist. Wenn man zum Beispiel eine intellektuelle Künstlerin aus Kabul zeigt, die erfolgreich war und jetzt flüchten musste, fehlt die Kontextualisierung. Es ist einfach nicht ehrlich, wenn man nicht dazusagt, dass es sich dabei um einen ganz spezifischen Stadtteil von Kabul handelt, wo sich eine urbane Elite herangebildet hat. Oft reichen zwanzig Minuten Autofahrt, um einen anderen Alltag zu erleben. Selbst innerhalb von Großstädten wie Kabul. Ist es das, was Sie auch mit eurozentrischer Haltung meinen? Oder anders gefragt: Woran lässt sich diese festmachen? Viele Beobachter:innen in westlichen Staaten suchen etwas in Ländern wie Afghanistan, mit dem sich identifizieren können und heben das dann entsprechend hervor. Ein gutes Beispiel sind die Bilder der Minirock tragenden Frauen aus den 70er Jahren. Da könnte man sich denken, damals war doch alles superliberal, die waren doch eigentlich wie wir... Stimmt. ...und jetzt sind sie nicht mehr wie wir. Der Kontrast dazu ist die Burka tragende Frau. Der Punkt ist, dass auch hier der Kontext fehlt, dass auch die Bilder der 60er und 70er eine Stadt-Elite zeigen und nicht die Mehrheit. Auch aus den 80ern gibt es Fotos von rauchenden Student:innen aus der kommunistisch regierten Zeit. Seitens linker Beobachter wird dann nur allzu gerne versucht, die Zeit vor den Amerikanern als gut zu verklären, gerade so, als wäre alles eine progressive Demokratie gewesen. Dabei gab es auch damals Frauen, die vom Regime drangsaliert wurden, im Gefängnis saßen, gefoltert und getötet wurden. Je nachdem, welchem Spektrum man sich zuordnet, so unterschiedlich fallen dann halt die Analysen aus. Werden Sie wegen ihres Buches und Ihrer Artikel angefeindet? Eher erreichen mich positive Reaktionen. Es gibt das Bedürfnis, zu verstehen, weil man sich bewusst geworden ist, dass viele Erzählungen falsch waren. Emran Feroz, 1991 in Innsbruck geboren, arbeitet als freier Journalist mit Fokus auf Nahost und Zentralasien, unter anderem für Die Zeit, taz, Al Jazeera und die New York Times. Feroz ist Gründer von „Drone Memorial" (www.dronememorial.com, virtuelle Gedenkstätte für zivile Drohnenopfer) und Concordia-Preisträger in der Kategorie Menschlichkeit.
Und wie geht es Ihnen ganz persönlich mit der aktuellen Situation? Viele Freunde, Verwandte und Kollegen leben in Afghanistan und viele von ihnen wollten im August und September auch aus dem Land raus. Wenn man es dann nicht schafft zu helfen, wenn man sich irgendwann eingestehen muss, dass man nichts mehr machen kann, ist das schon sehr belastend.
Was erzählen Ihnen Ihre Freunde aus Afghanistan? Ich nehme einen breiten Pessimismus wahr. Die Leute verhalten sich unterschiedlich. Die Ortskraft versteckt sich, Studenten werden nicht drangsaliert, aber keiner weiß, wie es weitergeht. Es steht ein harter Winter bevor, eine humanitäre Katastrophe. Ohne ausländische Gelder werden viele Menschen nicht überleben können. Deshalb versuchen immer noch viele, das Land zu verlassen. Ein leiser Pessimismus erreichte mich auch als Leserin Ihres Buches. Dennoch gibt es Hoffnungsschimmer, beispielsweise angesichts der von ihnen skizzierten Bewegungen „von unten“. Wie sehen Sie das unter den aktuellen Eindrücken? Ich verstehe, dass man bei der Lektüre pessimistisch werden kann, aber ich denke, dass genau diese Graswurzelbewegungen Hoffnung geben dürfen. Auch in diesen Tagen, auch unter dem Talibanregime, werden es diese Bewegungen sein, die den Akteuren an der Macht die Stirn bieten, während sie gleichzeitig konstruktiv ihre Arbeit in den verschiedenen Feldern wie zum Beispiel im Bereich der Bildung durchsetzen. Ich glaube, dass auf dieser Ebene der Bürger:innen bereits viel Dialog, Aufarbeitung und Versöhnung stattgefunden hat. Am Ende wird es auch diese Ebene sein, die hoffentlich das Ruder zur Gestaltung des Landes übernehmen wird.
Wir danken für das Gespräch.
Aktuelles Buch und Spiegel-Bestseller: „Der längste Krieg: 20 Jahre War on Terror“ (Westend Verlag)
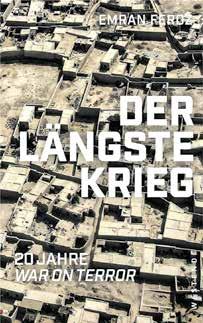
info@efz.at www.efz.at +43 5522 74139
Wie geht´s weiter?
Kostenlose Rechtsberatung bei Trennung & Scheidung Bezirksgericht Feldkirch
Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Bezirksgericht Bregenz
Dienstag 8:30 - 10:30 Uhr
Ohne Voranmeldung möglich!
Mit freundlicher Unterstützung von
.com/eheundfamilienzentrum
Mit dem Leben zufrieden
Die Kindheit von Georg Moosbrugger aus Bizau würde man aus heutiger Sicht nicht unbedingt als schön bezeichnen. Im Gegenteil. Das sieht der heute 62-Jährige aber ganz anders. Über sein Aufwachsen als Bergbauernsohn hat er nun ein Buch geschrieben. Er nimmt die marie auf eine Reise in seine Vergangenheit.
Text: Frank Andres Fotos: privat, Frank Andres

Georg Moosbrugger ist mit sich und der Welt zufrieden. Er sitzt in der guten Stube mit Kachelofen und lässt seinen Blick aus dem Fenster schweifen. Seit eineinhalb Jahren ist er in Pension. Er war davor Hauptschul- und Sonderschullehrer, Schreiner und neun Jahre Bürgermeister in Langenegg. Während der Corona-Zeit habe er viel Zeit gehabt, um nachzudenken. Vor allem darüber, was er in Zukunft machen will. Dabei sei die Idee entstanden, ein Buch über seine Kindheit zu schreiben. Für seine Kinder und Enkel, wie er sagt. Der heute 62-jährige, dreifache Familienvater beginnt zu erzählen und nimmt uns mit in eine scheinbar längst vergangene Zeit.
Immer nur „schaffa“
Georg Moosbrugger, Jahrgang 1958, wuchs gemeinsam mit sieben Geschwistern in Bizau auf. Sein Vater Jakob war Bergbauer. Die Lebensverhältnisse waren bescheiden. „Bei uns gab es nur ‚schaffa‘. Heute würde man Kinderarbeit dazu sagen. Ich habe es aber nie als solche aufgefasst“, betont er. Bereits mit sieben Jahren hieß es für Klein-Georg um 5.30 Uhr Tagwache. Täglich. Danach ging es in den Stall. Nach getaner Arbeit gab es als Stärkung Riebel aus der Pfanne. Danach folgte der Gottesdienst in der Kirche und dann ging es in die Schule. Die Wegstrecke: drei Kilometer. Nach dem Unterricht hieß es aber nicht ausruhen, sondern wieder arbeiten. Bis zum Abend. „Freizeit hatten wir eigentlich keine“, gibt er offen zu. Mitschüler, deren Eltern Handwerker waren, hatten es leichter. „Die konnten zu Hause ausruhen und im Winter skifahren gehen.“ Georg Moosbrugger schnallte stattdessen einen Schlitten auf den Rücken, stapfte im Schnee auf das Vorsäß, lud eine Fuhr Heu auf und transportierte das Futter für die Tiere ins Tal. Das sei ihm aber nicht negativ in Erinnerung geblieben. „Ich bin mit den Dingen, die damals passiert sind, im Reinen.“
Oben: Georg Moosbrugger in jungen Jahren. Rechts: Erste Klasse Gymnasium – eine Bubenmeute aus ganz Vorarlberg Links: Georgs ältere Geschwister Marlis, Josef, Katharina, Alois und Maria mit Mama Theresia zu Besuch auf Fegg Unten: Mama und Däta am Tag ihrer Hochzeit



Gefühl, gebraucht zu werden
Haupterzieherin im Hause Moosbrugger war Georgs Mutter Theresia. Der Vater arbeitete den ganzen Tag außer Haus. Die Aufgaben für die Kinder waren klar verteilt. Vom Geschirrabwaschen, übers Abtrocknen bis zum Milchholen. Da gab es keine großen Diskussionen. „Wenn du blöd geredet hast, gab es mit der Kelle einen auf die Finger“, erinnert sich Georg Moosbrugger. Das sei aber auch die einzige Form von körperlicher Gewalt gewesen, die er erfahren habe. „Das gehörte dazu und war nach meinem Empfinden nicht negativ.“ Er sehe es heute als Geschenk an, als Kind Aufgaben zugeteilt bekommen zu haben. „Du hast Erfolgserlebnisse und kommst nicht vor lauter Langweile auf blöde Gedanken. Ich war zum Beispiel zuständig, dass das Mutterschwein und seine 15 Ferkel überleben.“ Und bereits mit acht Jahren durfte Georg Moosbrugger auch zum ersten mal Traktor fahren. „Das hat mich richtig stolz gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass man mich braucht.“ Er habe in seiner Großfamilie vor allem gelernt, was Zusammenhalt und Miteinander bedeuten. „Es war ein tolles Gefühl, wenn wir er es geschafft haben, die letzte Fuhr Heu vor dem Gewitter ins Trockene zu bringen“, erzählt er.
Prägende Schulzeit
Die Schulzeit prägte das weitere Leben von Georg Moosbrugger nachhaltig. In den ersten zwei Jahren hatte er eine Lehrerin. Jung, liebevoll und schneidig sei sie gewesen. Er könne sich noch gut daran erinnern, wie er die ersten Buchstaben gelernt, daraus Wörter geformt und zu lesen begonnen habe. Doch in der dritten und vierten Klasse bekam Georg Moosbrugger einen Lehrer. Er war extrem gewalttätig. „Wenn du beim Lesen einen Fehler gemacht hast, gab er dir mit einem Rohrstock einen auf die Finger, zog dich an den Nackenhaaren oder du musstest auf einem Holzscheit knien, bis dir die Tränen kamen. Es war pure Gewalt“, sagt der heute 62-Jährige, der trotzdem später selbst Lehrer geworden ist.
Zum ersten Mal in der Stadt
Mit zehn Jahren kam Georg Moosbrugger nach Bregenz ins Marianum, einem Buben-Gymnasium. Und er war in der Stadt völlig überfordert. Er sah zum ersten Mal Häuser, die größer waren als ein Bauernhof. Und im Unterschied zu seinem Heimatdorf Bizau wimmelte es in Bregenz von Straßen. Eine Begebenheit ist ihm dabei in diesem Zusammenhang ganz besonders in Erinnerung geblieben. „Zusammen mit >>
Oben Mitte: Däta als junger Fuhrmann auf der Dorfstraße Oben: Die drei großen Schwestern Marlis, Katharina und Maria mit ihren kleinen Brüdern auf „Schwanoweords Hostatt”


Oben: Mama, Josef, Marlis und Ihne mit Helfer vor einem formschönen Heuschochen am Gopf Links: „Die klinno Zwio” – Richard und Georg
einem Mitschüler musste ich ins Marianum, um eine Aufnahmeprüfung zu machen. Wir haben uns nicht ausgekannt und sind einfach den Menschen auf der Straße nachgelaufen. Dann kamen wir schließlich bei einem großen Haus an. Dort standen viele Menschen in weißer Kleidung und ich fragte: „Ist das das Marianum?“ Wie sich herausstellte, war das ein großer Irrtum. Wir standen vor dem Krankenhaus. Ich fing an zu weinen.“
Zwei Welten
In der Anfangszeit im Internat war Georg Moosbrugger völlig überfordert. Da prallten für ihn gänzlich unterschiedliche Welten aufeinander. Auf der einen Seite gab es Unternehmer-Kinder, die im Sommer nach Amerika in den Urlaub geflogen sind und auf der anderen Seite ihn, den Bergbauernsohn, der nach der Zeugnisverteilung nach Hause in den Bregenzerwald gefahren ist und bei der Heuernte geholfen hat. „Es war einfach schwierig, mich zurechtzufinden. Ich hatte schreckliches Heimweg. Für mich war jahrelang alles viel zu groß.“ Mit der Zeit legte sich dieses Unbehagen. Er zog das Gymnasium bis zur Matura durch.
Gehorsam als oberster Wert
Seine Kindheit, so sagt Georg Moosbrugger heute, sei durch die Erwachsenenwelt bzw. die bäuerliche Gesellschaft klar geregelt gewesen. „Gehorsam war der oberste Wert. Das ist heute vielfach nicht mehr der Fall. Da geht es vielmehr um Selbstverwirklichung“, betont er. Die Klarheit und Bescheidenheit in seiner Kindheit schätze er noch heute. „Wenn du so aufwächst, dann bist du auch schneller zufrieden“, ist er überzeugt. Heute jung bzw. Kind zu sein, sei viel schwieriger wie früher. „Wenn du einen Beruf oder ein Studium wählen sollst, dann ist die Auswahl schier unerschöpflich. Bei mir war das ganz einfach. Mit zehn Jahren gab es die Wahl, entweder in ein Gymnasium zu gehen oder eine Oberstufe zu besuchen und danach Handwerker zu werden. Ich möchte bei der heutigen Fülle von Angeboten nicht mehr jung sein. Ich wäre völlig überfordert“, gibt er offen zu. Aus seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung wisse er zudem, wie sehr Kinder heute unter dem Druck der sozialen Medien leiden würden. Wo einerseits jeder Fehler, jede Schwäche in Sekundenschnelle einer breiten Öffentlichkeit preisgegeben und andererseits hohe Ideale hinsichtlich Aussehen oder Auftreten für selbstverständlich dargestellt würden. „Das Handy ruft in vielen Kindern das Gefühl hervor, zu den Verlierern zu gehören. Diesen Druck hatten wir damals in unserer medienlosen Zeit in keinster Weise. Dafür bin ich sehr dankbar.“
Nichts versäumt
Das Gefühl etwas nachholen zu müssen, habe er nie gehabt. Sein jüngerer Bruder, der ebenfalls das Marianum besucht hatte und danach studieren ging, reiste beruflich nach Australien und Afrika. „Viele haben ihn besucht. Ich bin ihm kein einziges Mal nachgereist. Ich war mit meinem Leben zufrieden.“ Statt auf große Reise zu gehen, kehrte Georg Moosbrugger nach der Lehrer-Ausbildung in seine Heimat
zurück. „Es war nach den Erfahrungen im Internat klar, dass ich zurück in den Bregenzerwald will. Ich wollte dort unterrichten, wo ich mit meinen Schülern in deren Muttersprache reden kann.“ Aber so ganz ohne Änderungen ist das Leben von Georg Moosbrugger aber dann doch nicht verlaufen. Mit 40 Jahren hängte er seinen Lehrberuf an den Nagel. Er erfüllte sich einen Kindheitstraum und wurde Schreiner. Er ging nach England, um dort die Sprache zu lernen und lief einen Marathon. Da war er 45 Jahre alt. Mit 47 wurde er Bürgermeister in Langenegg, der Heimatgemeinde seiner Frau Erika. Er blieb es neun Jahre.
Keine Langeweile
Mit 62 Jahren fühlt sich Georg Moosbrugger noch zu jung und vor allem zu fit, um sich auf sein Altenteil zu setzen. Auch wenn er, wie er selbst betont, stundenlang dem Müßiggang frönen und einfach nur dasitzen könne. Und er hat auch schon Pläne. „Ich will wahrscheinlich noch ein Buch schreiben. Da soll es um mein geistiges Vermächtnis gehen. Um das, was ich erlebt habe. Das ist aber noch zu früh.“ Bis dahin, so viel scheint klar, wird es eines bei Georg Moosbrugger sicherlich nicht geben: Langeweile. Das Buch: Georg Moosbrugger: Heimat auf Zeit – Geschichten meiner Heimat 152 Seiten 25 Euro ISBN: 978-3754312704

„Wir KINDER VORarlbergs!“
... heißt eine Initiative zum 70. Geburtstag des Vorarlberger Kinderdorfes. Unter großer Einbeziehung der Bevölkerung soll vor allem eines erreicht werden: Kinder und ihre Bedürfnisse in den Fokus zu stellen. 70 Persönlichkeiten – querbeet durch alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens – erzählen, wer ihnen in ihrer Kindheit Perspektiven geschenkt und so ihren Werdegang geprägt hat. Den Worten sollen auch Taten bzw. konkrete Projekte folgen, die neue Chancen für Kinder eröffnen. Mit der Bewegung ruft das Vorarlberger Kinderdorf dazu auf, sich gemeinsam stark für Kinder zu machen – für ein kindgerechtes Vorarlberg und eine Zukunft, die so bunt ist wie der Blick durch ein Kaleidoskop. Jede:r kann unter dem Motto „Kinder vor!“ zum/r Perspektivengeber:in werden: kinder-vor@voki.at, 05574 499 201 Blog mit Geschichten und Projekten: www.wir-kinder-vorarlbergs.at Alle Infos: www.vorarlberger-kinderdorf.at
LEIDEN IST MANCHMAL EINFACH SINNLOS
Marie-Luisa Frick ist Professorin am Institut für Philosophie in Innsbruck. Die marie sprach mit der gebürtigen Osttirolerin über das neue Sterbehilfe-Gesetz, die Rolle der Kirche dabei und ob sie sich vorstellen kann, selbst aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen.
Interview: Frank Andres, Foto: Andreas Friedle Mit 1. Jänner 2022 kippt der Verfassungsgerichtshof den Strafbestand der „Hilfeleistung zum Selbstmord“. Wie sehr hat Sie dieses Urteil überrascht? Marie-Luisa Frick: Der Paragraph 78, Mitwirkung am Selbstmord, stand schon lange aus rechts-ethischer, rechtsphilosophischer Sicht in der Kritik. Mich hat das Urteil deshalb nicht überrascht. Das absolute Verbot der Mitwirkung am Suizid war wirklich eine problematische Bestimmung in unserem Strafgesetzbuch und nicht vereinbar mit unserer liberalen Demokratie. Der Gesetzgeber darf aber weiterhin Handlungen unter Strafe stellen, wo Menschen dazu verleitet bzw. manipuliert werden, sich selbst zu töten. Das ist klar. Wenn aber jemand den aufgeklärten Wunsch hat, unter Mitwirkung eines anderen aus dem Leben zu scheiden, dann sollte das Strafrecht schweigen. Deshalb ist das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes in meinen Augen richtig.
Welche Rolle hat die Kirche in diesem ethischen Diskurs gespielt? Aus der Sicht vieler Religionen ist die Selbsttötung nicht legitim. Wir sind aber kein Religions-, sondern ein säkularer Staat. Das Recht muss daher nicht Rücksicht darauf nehmen, was eine noch so große und einflussreiche Religionsgemeinschaft für richtig hält. Die Regierung hat aus Anlass des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes ein „Dialogforum“ eingerichtet. Da waren die Vertreter der Religionsgemeinschaften deutlich überrepräsentiert. Die Zeit drängt, denn am 1. Jänner wird die betreffende Bestimmung schlichtweg außer Kraft treten. Es ist aber fast typisch österreichisch, dass man sich bei solchen Dingen bis zum Schluss Zeit lässt.
Bis auf die Ankündigung, dass das neue Sterbehilfe-Gesetz mit 1. Jänner in Kraft tritt, herrschte lange Zeit Funkstille. Man hatte das Gefühl, das Thema sollte totgeschwiegen werden. Täuscht dieser Eindruck? Ich bin auch der Meinung, dass die öffentliche Debatte bisher viel zu kurz gekommen ist. Viele Experten waren bei den Diskussionen nicht mit am Tisch. Da meine ich vor allem die philosophischen Ethiker, die im Unterschied zu Juristen und Theologen im „Dialogforum“ der Regierung so gut wie nicht vertreten waren. Das ist schade, weil Philosophen versuchen, diese Fragen möglichst ohne Ideologie zu klären und auch zwischen verschiedenen Standpunkten vermitteln können. Für pluralistische Gesellschaften ist die Philosophie daher die Disziplin, die hier am meisten anzubieten hat. Die Grundfragen des Lebens und des Sterbens gehen uns alle an und sind keine Domäne der Religionen.
In der Schweiz und in den Niederlanden ist der assistierte Suizid schon seit langem legal. Warum hat sich Österreich in dieser Frage bislang so schwergetan? Es gab bei uns keine Lobby von Men-
schen, die sich dafür ausgesprochen haben. Nur die Gegner einer Liberalisierung, allen voran die katholische Kirche, haben ihre Lobby-Arbeit gemacht. Es fehlte die Dynamik einer breiten Bevölkerung, die sich dagegengestemmt hat. Man nimmt halt oft Dinge einfach schweigend hin, auch wenn viele Menschen insgeheim der Meinung waren, dass das bisherige Gesetz zu weit geht. Es gibt ähnliche Diskrepanzen etwa beim Suchtmittelgesetz. Da würden auch viele sagen, es sei unverhältnismäßig, Cannabis-Konsumenten mit dem Strafrecht zu behelligen. Und trotzdem gehen sie dafür nicht akkordiert auf die Straße. Man sollte daher immer im Kopf behalten, dass laute Lobbys nicht immer die meisten Menschen hinter sich haben.
Ein Arzt verpflichtet sich durch den hippokratischen Eid zum Erhalt des Lebens. Was aber passiert, wenn ein todkranker Patient seinen Arzt bittet, ihn beim Suizid zu helfen? Es kann niemand gezwungen werden, bei einem suizidwilligen Menschen irgendeine Form der Mitwirkung zu Marie-Luisa Frick, Jahrgang 1983, ist habilitierte Philosophin und arbeitet als Assoziierte Professorin am Institut für Philosophie an der Universität Innsbruck. Mehr Infos unter marieluisafrick.net

leisten. Das gilt auch für Ärzte. Ihr ethisches Dilemma lässt sich aber eingrenzen. Der Kernsatz des hippokratischen Eides verpflichtet Ärzte dazu, dem Patienten nicht zu schaden. Was ein Schaden ist, kann man durchaus unterschiedlich betrachten. Ist es ein Schaden, einen zum Suizid entschlossenen Menschen allein zu lassen? Ist es ein Schaden, jemanden nicht aufzuklären, wie man sich möglichst schmerzfrei und schnell aus dem Leben bringt? Oder ist es ein größerer Schaden, wenn Menschen selbst mit Giftstoffen experimentieren oder sonst auf grausame Weise aus dem Leben scheiden? Ein Arzt könnte auch sagen, es ist zum Vorteil und zum Wohl meines Patienten, wenn ich ihn gut berate und ihn wirklich bis zum Schluss begleite.
Die Zahl der assistierten Suizide hat sich laut Institut für Medizinische Anthropologie in der Schweiz mit 1176 Fällen im Jahr 2018 gegenüber 2010 mehr als verdreifacht. Macht diese Entwicklung nicht nachdenklich? Die Gefahr besteht immer: Man führt etwas mit einem guten Grundsatz bzw. Gedanken ein und es kommt etwas Schlechtes heraus. Das meint auch das Schiefe-Bahn-Argument. Natürlich muss man einer solchen Entwicklung vorbeugen und darf sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gilt aufzupassen, dass es nicht zu einer Dynamik kommt, die sich niemand wünscht. Dass zum Beispiel Angehörige Druck auf Hochbetagte ausüben, aus dem Leben zu scheiden. Im Zusammenhang mit den steigenden Zahlen beim assistierten Suizid muss man auch die gleichzeitig steigende Zahl von älteren Menschen in unserer Gesellschaft berücksichtigen. Wir wissen, dass das Alter ein Lebenszeitraum ist, wo man häufig von vielseitigen Beschwerden geplagt wird. Das Alter ist nicht per se ein Segen. Es ist ein Glück, wenn man möglichst gesund altern kann. Wenn das Leben aber zu einer unerträglichen Last wird, muss die Möglichkeit bestehen, selbst zu entscheiden, ob jemand seinem Leben ein Ende setzen und dabei andere Menschen an seiner Seite will. Mit dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes werden Beistand leistende Angehörige oder beraten- >>



