JAHRESBERICHT 2024








„Unsere
Mission ist es, Küstenmeere in ihrer Gesamtheit zu verstehen und durch wissenschaftliche Erkenntnisse, innovative Methoden und den Dialog mit der Gesellschaft zur Lösung regionaler und globaler Herausforderungen beizutragen.”
AUS DEM LEITBILD DES IOW

ich freue mich, Ihnen mit diesem Jahresbericht einen kompakten Überblick über die Arbeit des LeibnizInstituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) im Jahr 2024 zu geben. Nach einer Phase der Zweijahresberichte kehren wir nun zu einem jährlichen Format zurück, um aktueller, kontinuierlicher und näher an den Entwicklungen berichten zu können.
Das Berichtsjahr 2024 begann mit dem neuen, auf zehn Jahre angelegten IOW-Forschungsprogramm „Perspektiven der Küstenmeere“. Es bündelt die wissenschaftliche Arbeit in drei interdisziplinären Bereichen: Erforschung skalen- und systemübergreifender Schlüsselprozesse, Küstenmeere im Wandel sowie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien in der Küstenforschung. Damit schaffen wir eine klare thematische Ausrichtung und verknüpfen Grundlagenforschung mit Fragestellungen, die für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gleichermaßen relevant sind. Als neues flexibles Instrument haben wir 2024 die Baltic Challenges eingeführt.

Sie ermöglichen es, innerhalb der Forschungsbereiche gezielt aufkommende Themen mit hoher Bedeutung für die Ostsee schnell und koordiniert zu bearbeiten.
Einen besonderen Schwerpunkt bildet der seit 2023 finanzierte Sondertatbestand Flachwasserprozesse (S2B – shore to basin). 2024 wurden dafür Seminare, Forschungsfahrten und Workshops durchgeführt, erste Publikationen veröffentlicht und Qualifikationsarbeiten gestartet. Die ersten Ergebnisse bestätigen die zentrale Rolle dynamischer, landbeeinflusster Prozesse für das Verständnis der Ostsee.
Auch unsere Langzeitbeobachtung und das Monitoring im Auftrag des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wurden neu strukturiert. Damit verbessern wir die Koordination der Arbeiten im Rahmen des Helsinki-Abkommens (HELCOM). Auf der Forschungsfahrt EMB 340 mit unserem Schiff Elisabeth Mann Borgese konnten wir dabei das Beobachtungsgebiet bis in den Bottnischen Meerbusen ausdehnen.
Im Jahr 2024 hat das IOW zahlreiche neue Projekte eingeworben – von Grundlagenstudien bis zu internationalen Verbundvorhaben. Eine Auswahl der Projekte finden Sie im Kapitel „Neue Projekte“ und eine vollständige Liste aller 2024 bearbeiteten Projekte im Anhang. Insgesamt wurden 166 Beiträge in begutachteten Fachzeitschriften veröffentlicht, darunter vielbeachtete interdisziplinäre Studien wie beispielsweise die Entdeckung mutmaßlicher Jagdstrukturen im Ostseeraum, publiziert in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Näheres dazu lesen Sie im Kapitel „ForschungsHighlights“. Zudem erhielten unsere Wissenschaftler:innen mehrere Auszeichnungen und Preise.
Die internationale Vernetzung wurde durch Workshops mit Partnern aus dem In- und Ausland und durch aktive Beteiligung an Konferenzen weiter ausgebaut, zum Beispiel bei der Baltic Earth Conference in Jurmala (Lettland). Der Dialog mit der Öffentlichkeit, der Praxis und
der Politik ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher wurden im Jahr 2024 gleich mehrere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit durchgeführt bzw. wieder aufgenommen. Besonders hervorzuheben sind das Open Ship auf den beiden Forschungsschiffen Maria S. Merian und Elisabeth Mann Borgese, die Beteiligung an der Langen Nacht der Wissenschaften und die Wiederaufnahme der Warnemünder Abende.
Das IOW blickt damit auf ein inhaltlich starkes und erfolgreiches Jahr zurück – mit wissenschaftlichen Fortschritten, neuen Kooperationen und einem intensiven Austausch weit über die Forschungsgemeinschaft hinaus. Ich lade Sie ein, auf den folgenden Seiten selbst zu entdecken, was uns 2024 bewegt und vorangebracht hat.
Herzlich

OLIVER ZIELINSKI DIREKTOR

Forschungsprogramm:
Perspektiven der Küstenmeere (2024-2025) 9
FB1: Skalen- und systemübergreifende Schlüsselprozesse 10
FB2: Küstenmeere im Wandel 14
FB3: Neue Technologien in der Küstenforschung 18
Forschungsschwerpunkt:






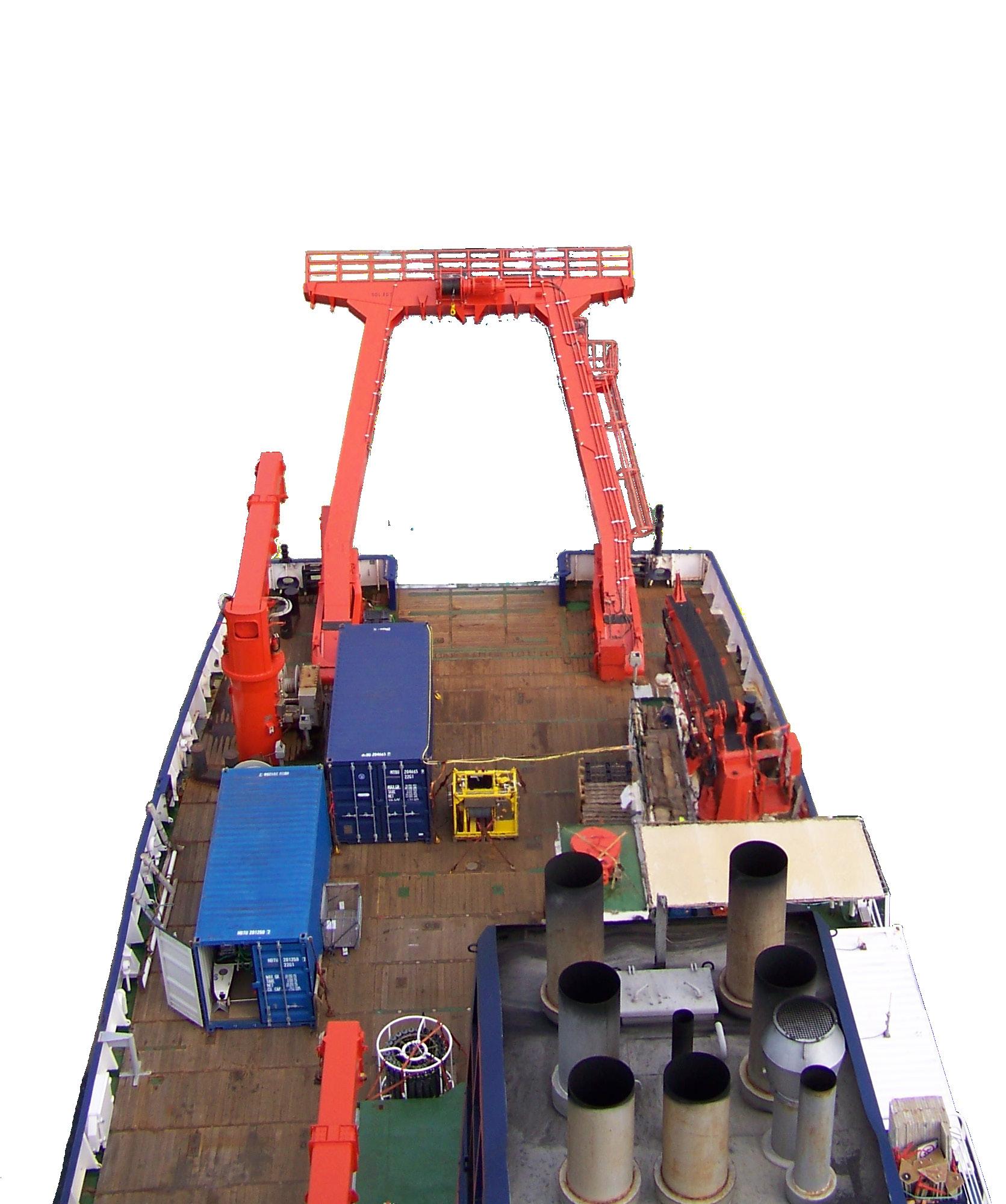

Am IOW arbeiten die vier Sektionen „Meeresgeologie“, „Meereschemie“, „Biologische Meereskunde“ und „Physikalische Ozeanographie“ sowie die neue Forschungseinheit „Meeresbeobachtung“ interdisziplinär an dem auf 10 Jahre angelegten Forschungsprogramm „Perspektiven der Küstenmeere“(2024–2033). In drei Forschungsbereichen (FB) sind die Aktivitäten gebündelt. Sie widmen sich der Erforschung skalen- und systemübergreifender Schlüsselprozesse (FB 1), der Küstenmeere im Wandel (FB 2) und neuen Technologien in der Küstenforschung (FB 3).
Unser neues Forschungsprogramm „Perspektiven der Küstenmeere“ (2024–2033) ist in drei Forschungsbereiche (FB) gegliedert (siehe Abbildung), die sich mit offenen Fragen in den Bereichen „Skalenund systemübergreifende Schlüsselprozesse“ (FB 1), „Küstenmeere im Wandel“ (FB 2) und „Neue Technologien in der Küstenforschung“ (FB 3) befassen. Eine wichtige Neuerung gegenüber dem Vorgängerprogramm ist die zusätzliche Ausrichtung auf die Flachwasserprozesse zwischen der Küstenlinie und einer Wassertiefe von etwa 10–20 m. Alle wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitenden, die an der Entwicklung der für die küstennahe Ozeanbeobachtung erforderlichen Messstrategien und technologischen Ausrüs-
tung beteiligt sind, sind in der neu eingerichteten Forschungseinheit „Meeresbeobachtung“ (OBS) gebündelt. Die Gesamtstruktur des 10-jährigen IOW-Forschungsprogramms folgt dem bewährten Matrixkonzept, bei dem alle Sektionen und die neue Forschungseinheit OBS zu den drei Forschungsbereichen beitragen. Als neues Instrument, um spezifische Themen auf agile Weise und in kürzeren Zeiträumen anzugehen, führen wir die so genannten Baltic Challenges ein. Sie bündeln Forschungsaktivitäten innerhalb der drei Forschungsbereiche, die geeignet sind, Fortschritte bei aufkommenden gesellschaftlich relevanten Themen von Interesse für die Ostsee zu erzielen.
FORSCHUNGSBEREICHE
SKALEN- UND SYSTEMÜBERGREIFENDE
SCHLÜSSELPROZESSE
THEMENBEREICHE
Hydrodynamische Auswirkungen
Biogeochemische Kreisläufe
Dynamik der Biologischen Prozesse
KÜSTENMEERE IM WANDEL
Ostseesystem in der Gegenwart
Ostseesystem in der Vergangenheit
NEUE TECHNOLOGIEN IN DER KÜSTENFORSCHUNG
Neue Technologien der Meeresbeobachtung
Modellentwicklung
Die Zukunft der Küstenmeere Datenintegration
Projektionen unter Klimawandel und menschlicher Nutzung
VOLLSTÄNDIG INTEGRIERT: STB* „ FLACHWASSERPROZESSE UND LAND-OZEAN-ÜBERGÄNGE ZUR OSTSEE“
STAND: 16.10.2024 *Sondertatbestand
SEKTIONEN
MEERESGEOLOGIE (GEO)
MEERESCHEMIE (CHE)
BIOLOGISCHE MEERESKUNDE (BIO)
PHYSIKALISCHE OZEANOGRAPHIE (PHY)
FORSCHUNGSEINHEITEN
KÜSTENMEER: MANAGEMENT UND PLANUNG
MEERESBEOBACHTUNG (OBS)
Um die Funktionsweise von Meeressystemen wie der Ostsee zu verstehen und deren Ökosysteme zu erhalten, bedarf es sowohl präziser Beobachtungen als auch profunder Kenntnisse der Prozesse auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen. Besondere Herausforderungen stellen Prozesse dar, die über Systemgrenzen und mehrere Größenordnungen hinweg wirken. Sie erfordern das Fachwissen mehrerer Disziplinen und einen gemeinsamen Forschungsansatz, um die aktuellen Fragestellungen in unserer Forschung zu bewältigen.
ENERGIEKRISE BEI DORSCH UND CO.: WIE ÜBERDÜNGUNG UND KLIMAWANDEL DIE NAHRUNGSNETZE DER OSTSEE VERÄNDERN
Der Dorschbestand in der Ostsee ist seit Jahren in der Krise. Trotz historisch niedrigem Fischereidruck erholt sich der Bestand nicht. Bislang gab es hierfür keine schlüssige Erklärung. Forschende des IOW und des Thünen-Instituts für Ostseefischerei konnten nun erstmals nachweisen, dass sich in Ostseeregionen mit großflächigen Blüten fädiger Blaualgen, die durch Überdüngung und Klimawandel verstärkt auftreten, das Nahrungsnetz für den Dorsch verlängert hat. Dadurch steht der Population deutlich weniger Energie zur Verfügung als in Gebieten ohne Blaualgenblüten. Verbessert sich das Nährstoffregime nicht, kann sich der Dorsch der Ostsee nicht erholen.
Das marine Phytoplankton ist der Energielieferant für alle Meeresökosysteme: Diese winzig kleinen, im Meerwasser schwebenden Pflanzen binden mittels Photosynthese Energie in Form von Biomasse, die dann Schritt für Schritt in den marinen Nahrungsnetzen weitergereicht wird, bis hin zu unterschiedlichen Arten von Fischen und Fischfressern. Wieviel Energie bei den unterschiedlichen Lebewesen ankommt, hängt von der Position ab, die sie im Nahrungsnetz einnehmen. Man weiß, dass von einer Ebene zur nächsten rund 90 Prozent der Energie als Wärme verloren gehen.
Je mehr Ebenen ein Nahrungsnetz hat, umso weniger Energie kommt bei den Lebewesen mit den höchsten Positionen, wie etwa Raubfischen an.
In der Ostsee führt das Überangebot an Nährstoffen, die über abfließendes Oberflächenwasser und Flüsse in die Ostsee eingeschleust werden, und die zum überwiegenden Teil (86 %) aus der Landwirtschaft stammen, zur Blüte von Blaualgen, die es dort in dieser Menge nicht geben dürfte. Andere Mikroalgenarten werden durch sie verdrängt. Aufgrund ihrer Form und Größe können fädige Blaualgen nicht von den kleinen Krebsen gefressen werden, die in marinen Nahrungsnetzen eine wichtige Nahrungsquelle darstellen. Statt sich vegetarisch zu ernähren, fressen die kleinen Krebse Mikroben/Bakterien, die sich von Ausscheidungen oder Abbauprodukten der Blaualgen ernähren.
„Diese Art der Nahrungsnetzverlängerung bei Fischen wird schon länger theoretisch diskutiert. Wir können sie nun erstmals direkt messen und eindeutig dem Blaualgen-geprägten Nahrungsnetz zuordnen“
DR. NATALIE LOICK–WILDE
Damit entsteht eine komplette zusätzliche Ebene im Nahrungsnetz, die zwangsläufig zu hohem Energieverlust bei den Tieren auf nachgeschalteten Nahrungsnetzpositionen führt. „Diese Art der Nahrungsnetzverlängerung bei Fischen wird schon länger theoretisch diskutiert. Wir können sie nun erstmals direkt messen und eindeutig dem Blaualgen-geprägten Nahrungsnetz zuordnen“, sagt Natalie Loick-Wilde. Sie hat am IOW eines der wenigen marinen Forschungslabore weltweit etabliert, in dem stabile Isotope von Stickstoff in 13 verschiedenen Aminosäuren für diese Zwecke gemessen werden. Für den Dorsch aus der zentralen Ostsee ermittelte ihr ehemaliger Doktorand Markus Steinkopf trophische Positionen zwischen 4.8 bis 5.2, statt von 4.1 wie in gesunden Nahrungsnetzen. Das bedeutet einen Energieverlust von 60 bis 99 %, denn das Zooplankton soll kleinere Lebewesen und Fische in großer Anzahl ernähren, ist aber aufgrund der schlechten Nahrung sehr dezimiert. So wird auch die Nahrung für den Dorsch –den ehemals wichtigsten Fisch der Ostsee aus Sicht der Fischerei – begrenzt. Diese Energiekrise beim Ostseedorsch zeigt, dass Einschränkungen bei der Fischerei für eine Bestandserholung allein nicht mehr ausreichen. Vielmehr muss das Nahrungsnetz an sich wiederhergestellt werden. Das gelingt aber nur, wenn man länderübergreifend alle Möglichkeiten ausschöpft, um die Überdüngung der Ostsee in den Griff zu bekommen. Auch andere Arten sind betroffen. Die Ostseefischerei ist heute kaum mehr eine Lebensgrundlage für die dort ansässigen Fischereibetriebe und der Nachweis, dass
Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft zu diesem Zustand geführt haben, ist erbracht. Natalie Loick-Wilde resümiert: „Dass sich etwas Grundlegendes im Ökosystem verändert hat, merkt der Mensch meist erst, wenn am Ende der Nahrungskette nicht mehr 90 Prozent der Energie ankommen, sondern nur noch zehn Prozent. Dann brechen ganze Fischereien wie die Dorschfischerei in der Ostsee oder die Stintfischerei in der Tide-Elbe zusammen. Die trophische Position von Schlüsselarten bietet sich als neuer Goldstandard zur Bestimmung der Gesundheit von Nahrungsnetzen in aquatischen Ökosystemen an.“
Die Studie wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt im Rahmen des Projektes BluEs (kurz für: Blue_Estuaries – Nachhaltige Ästuar-Entwicklung unter Klimawandel und anderen Stressoren) gefördert.
ANSPRECHPERSON
Dr. Natalie Loick–Wilde
PUBLIKATION
M. Steinkopf, U. Krumme, D. Schulz- Bull, D. Wodarg, N. Loick- Wilde (2024): Trophic lengthening triggered by filamentous, N2-fixing cyanobacteria disrupts pelagic but not benthic food webs in a large estuarine ecosystem, Ecology and Evolution. doi.org/10.1002/ece3.11048

Vom Forschungsschiff „Meteor“ durchfahrene Algenstraße in der Ostsee © Raeke, DWD

Um sicherzustellen, dass Computersimulationen die Realität hinreichend wiedergeben, sind vergleichende Messungen vor Ort nötig, wie hier nahe der Elbmündung in der Deutschen Bucht. © Holtermann, IOW
Ästuare, also Gewässer wie Flussmündungen, in denen Süßwasser vom Land auf Salzwasser aus dem Meer trifft, spielen eine wichtige Rolle für den Lebensraum Küste. Sie dienen z. B. als Kinderstube für Fische, transportieren Sedimente vom Land zur Küste und können wie ein Filter den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen regulieren. Ihre Dynamik wird von den Dichteunterschieden zwischen Süß- und Salzwasser bestimmt: Das dichtere Salzwasser aus dem Meer fließt am Boden stromaufwärts, also zum Land. Darüber strömt seewärts weniger dichtes Süßwasser, das sich nach und nach mit dem darunterliegenden Salzwasser vermischt und somit zu einem brackigen Ausstrom ins Meer führt. In der Warnow, die in die gezeitenlose Ostsee mündet, können wir diese sogenannte ästuarine Zirkulation direkt beobachten, in Gewässern mit Gezeiteneinfluss wie der Elbmündung oder dem chinesischen Pearl River-Ästuar wird sie erst nach einer Mittelung über die Gezeiten sichtbar.
Ob mit oder ohne Gezeiten, es ist die ästuarine Zirkulation, die die Transportprozesse in Ästuaren regelt. Um zu verstehen, wie Sedimente, Nähr- und Schadstoffe, aber auch Fischlarven und Plankton in Ästuaren verbreitet werden, müssen wir also die ästuarine
Zirkulation kennen und verstehen, welche Faktoren sie beeinflussen. Dabei spielen Zeit, Ort und Mechanik der Vermischung von Süß- und Salzwasser zu Brackwasser eine Schlüsselrolle, denn wenn die beiden Wassermassen nicht miteinander vermischt werden, gibt es keine Zirkulation und keinen Austausch zwischen Ästuar und Meer.
Um die Beziehung zwischen Vermischung und ästuariner Zirkulation zu untersuchen, müssen Größen wie Salzgehalt, Strömungen und Turbulenz – die für die Vermischung sorgt – zeitlich und räumlich hoch aufgelöst bekannt sein. Da Messungen allein diesen Anspruch nicht erfüllen können, nutzten Forschende der Arbeitsgruppe „Prozesse in Ästuaren und Küstenmeeren“ am IOW hoch aufgelöste Computersimulationen von Warnow, Elbe und Pearl River, um Karten zu erstellen, die wiedergeben, wo im Ästuar der Wasseraustausch mit dem Meer stattfindet. Es zeigte sich, dass dieser eine zweischichtige Struktur hat: Auf jeder Fläche konstanten Salzgehalts (d. h. „Isohaline“) findet ein Einstrom Richtung Land nahe des Bodens, im stromaufwärts gelegenen Teil dieser Fläche, statt. Am anderen Ende, also seewärts nahe der Oberfläche, strömt Wasser durch die Isohaline in Richtung Meer.
Der Wasseraustausch durch einzelne Isohalinen, der eng mit der Vermischung zusammenhängt, hat damit die gleiche Struktur wie die gewässerweite, oben beschriebene ästuarine Zirkulation und konnte nun durch Herleiten einer mathematischen Gleichung auch direkt mit dieser in Beziehung gesetzt werden. Aus den Karten geht aber auch hervor, dass der Wasseraustausch nicht überall gleich stark ist. Es gibt Regionen, in denen er erhöht ist, was in direktem Zusammenhang mit topografischen Besonderheiten steht. In der Elbe etwa sind dies die turbulenten Ränder der Fahrrinne, die besonders effektiv vermischen.
Auch die Ostsee mit ihren vielen Süßwasserquellen und den salzigen Einströmen aus der Nordsee kann als Ästuar verstanden werden, für das ebenfalls die räumliche Struktur des Wasseraustauschs gezeigt wurde. Hier fanden sich Hotspots entlang der Grenzen der einzelnen Becken sowie um Inseln herum.
Aktuelle Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft nutzen das gewonnene Wissen nun, um der ästuarinen Zirkulation zugrunde liegende, einzelne Prozesse der lokalen Vermischung zu identifizieren, wie etwa die konkreten Mechanismen entlang der Elbfahrrinne.
ANSPRECHPERSON
Dr. Lloyd Reese
PUBLIKATION
Reese, L., U. Gräwe, K. Klingbeil, X. Li, M. Lorenz and H. Burchard (2024). Local mixing determines spatial structure of diahaline exchange flow in a mesotidal estuary: A study of extreme runoff conditions. J. Phys. Oceanogr. 54: 3-27, doi: 10.1175/ JPO-D-23-0052.1

Längsschnitt durch ein Ästuar (Meer links, Fluss rechts). Die Pfeile stellen die ästuarine Zirkulation dar, in der sich das einströmende Salzwasser (magenta) mit dem Süßwasser (blau) vermischt und zu einem brackigen Ausstrom führt.
© Reese, IOW
Nur wenn wir die natürliche Variabilität unserer Küstenmeere mit allen Implikationen kennen, können wir die vom Menschen verursachten Veränderungen identifizieren. Disziplinenübergreifend forschen wir zum Verständnis des gegenwärtigen Zustands der Ostsee sowie der Rekonstruktion vergangener Ökosystembedingungen und erstellen Zukunftsprojektionen unter veränderten Klimabedingungen und menschlichem Einfluss. Der Mensch als Akteur mit Werkzeugen zur Wiederherstellung eines guten ökologischen Zustands muss die Zukunft des Küstenmeeres gestalten.
OSTSEE ENTDECKT
Eigentlich wollte das Forschungsteam Mangankrusten an einem Mergelrücken untersuchen, der etwa 10 km vor Rerik am Grund der Mecklenburger Bucht liegt. Dabei wurden sie auf eine 970 m lange, regelmäßige Steinstruktur aufmerksam. Diese besteht aus bis zu 1.500 tennis- bis fußballgroßen Steinen, die einige große Findlinge zu einem bis zu 1 m hohen Wall verbinden. Die Ostsee ist an der Fundstelle heute 21 Meter tief. Der Steinwall muss also errichtet worden sein, bevor der Wasserspiegel nach dem Ende der letzten Eiszeit stark anstieg. Dies geschah zuletzt vor etwa 8.500 Jahren. Wissenschaftler:innen des IOW, des interdiszip-

linären Zentrums „Kiel Marine Science“ der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel, der Universität Rostock, des Zentrums für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA-ZSBA), des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) und des Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (LAKD) Mecklenburg-Vorpommern haben mit modernen geophysikalischen Methoden ein detailliertes
3D-Modell der Mauer erstellt und die Struktur des umgebenden Untergrundes rekonstruiert. Anhand von Sedimentproben aus dem südlich angrenzenden Becken ließ sich das mögliche Entstehungsalter der linearen Struktur eingrenzen. „Die Untersuchungen haben bestätigt, dass eine natürliche Entstehung ebenso unwahrscheinlich ist wie eine Errichtung in
„Die Untersuchungen haben bestätigt, dass eine natürliche Entstehung ebenso unwahrscheinlich ist wie eine Errichtung in moderner Zeit[...]“
DR. JACOB GEERSEN
3D-Modell eines Abschnitts des Steinwalls (Maßstab, unterer Bildrand: 50 cm). Gut zu erkennen sind die tennis- bis fußballgroßen Steine, die den etwa 1 km langen Wall bilden.
@ Auer, LAKD M-V

moderner Zeit, etwa durch Baumaßnahmen zur Verlegung von Seekabeln oder Steinfischerei. Dafür sind die Steine zu planvoll und regelmäßig angeordnet“, erläutert Dr. Jacob Geersen. Schließt man eine natürliche oder moderne Entstehung aus, kommt für die Errichtung der Steinmauer nur die Zeit nach Ende der letzten Eiszeit (vor etwa 12.000 Jahren) in Betracht, als die Landschaft noch nicht von der Ostsee überflutet war. Wahrscheinlich diente der Wall dazu, die Rentiere am Rande eines Sees in die Enge zu treiben, so dass sie von den steinzeitlichen Jägern mit Jagdwaffen erlegt werden konnten“, erläutert Dr. Marcel Bradtmöller von der Universität Rostock. Da vor etwa 11.000 Jahren, als das Klima wärmer wurde und sich Wälder ausbreiteten, mit den letzten Rentieren auch die letzten wandernden Herdentiere aus unseren Breiten verschwanden, dürfte die Steinmauer nicht nach diesem Zeitpunkt errichtet worden sein. Die Steinmauer wäre damit das älteste jemals in der Ostsee entdeckte menschliche Bauwerk.
Die 2021 entdeckte Steinreihe ist nun Ausgangspunkt weiterer Forschung. Ausgehend von der Fundstelle in der Mecklenburger Bucht sollen mit Hilfe von geophysikalischen, geologischen und unterwasserarchäologischen Untersuchungen die damaligen Umweltbedingungen rekonstruiert und die Frage nach dem menschlichen Ursprung und der kulturellen Funktion
dieser Anlage geklärt werden. Aber auch potenzielle Megastrukturen in der Flensburger Förde und im Fehmarnsund, die bislang wissenschaftlich kaum erschlossen sind, sollen durch hochauflösende Kartierung eingehend analysiert werden. Ziel ist es, ein umfassenderes Bild der vormals terrestrischen Kulturlandschaften am Grund der heutigen Ostsee zu rekonstruieren und so neue Einblicke in die Lebensweise der frühsteinzeitlichen Jäger und Sammler zu gewinnen und damit auch neue Perspektiven auf die frühgeschichtliche Entwicklung Nordeuropas eröffnen.
ANSPRECHPERSON
Dr. Jacob Geersen
PUBLIKATION
J. Geersen, M. Bradtmöller, J. Schneider von Deimling, P. Feldens, J. Auer, P. Held, A. Lohrberg, R. Supka, J. J. L. Hoffmann, B. V. Eriksen , W. Rabbel , H.-J. Karlsen, S. Krastel, D. Brandt, D. Heuskin, H. Lübke (2024): A submerged Stone Age hunting architecture from the Western Baltic Sea Proceedings of the National Academy of Sciences: doi.org/10.1073/pnas.2312008121
MARINE HITZEWELLEN IN DER OSTSEE: URSACHEN
Es zeigt sich deutlicher denn je, dass sich das Klima immer weiter aufheizt. Die Erderhitzung macht auch vor den Meeren nicht Halt und insbesondere die Ostsee zählt mit einer Erwärmung von mehr als 1 °C in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten zu den sich am schnellsten erwärmenden Meeresregionen der Welt. Neben der allgemeinen Ozeanerwärmung machen marine Hitzewellen den Meeresökosystemen zu schaffen. Dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte Perioden, in denen die Temperatur der oberen Meerwasserschichten einen für die jeweilige Region und Jahreszeit typischen Schwellenwert für mindestens fünf Tage überschreitet. Im letzten Jahrhundert wurden weltweit vermehrt solche Hitzewellen registriert: Eine internationale Studie belegt, dass sie seit 1925 häufiger auftreten und länger andauern, was örtlich zu über 50 % mehr marinen Hitzewellentagen pro Jahr führt.
Um das Auftreten von Hitzewellen in Rand- und Binnenmeeren allgemein und speziell in der Ostsee zu verstehen, wertete ein IOW-Forschungsteam um die Ostseeklimaexperten Matthias Gröger und Markus Meier enorm große meteorologische Datensätze aus über drei Jahrzehnten aus. Dabei identifizierten sie Auffälligkeiten in den großen Luftdruck-
mustern und in Windsystemen über dem Nordatlantik und Europa, die zu Hitzewellen in der Ostsee führen.
In den Sommermonaten sind es die stabilen Hochdrucklagen über Skandinavien, bei der die Hitzewellen entstehen – nicht nur durch starke Sonneneinstrahlung und hohe Lufttemperaturen, sondern vor allem auch durch die außergewöhnlich schwachen Winde unter solchen Bedingungen. Letzteres verhindert, dass sich das immer stärker erwärmende Oberflächenwasser mit kaltem Wasser aus der Tiefe vermischen kann, wodurch sich die Hitze in den oberen Wasserschichten aufstaut. Aber auch im Winter sind Hitzewellen in der Ostsee möglich. Sie treten immer dann auf, wenn länger anhaltende starke Westwinde feucht-warme Luftmassen vom Atlantik nach Europa transportieren und die Ostsee dadurch im Winter weniger stark auskühlt als sonst um diese Jahreszeit. Die in der Studie ausgewerteten Daten zwischen 1980 und 2016 zeigen auch, dass sowohl sommerliche als auch winterliche Hitzewellen in der Ostsee häufiger werden, länger andauern und zunehmend größere Flächen betroffen sind.
Mittlere jährliche Oberflächenausdehnung mariner Hitzewellen in der Ostsee. Gelb: moderate Hitzewellen. Rot: starke Hitzewellen. @ IOW

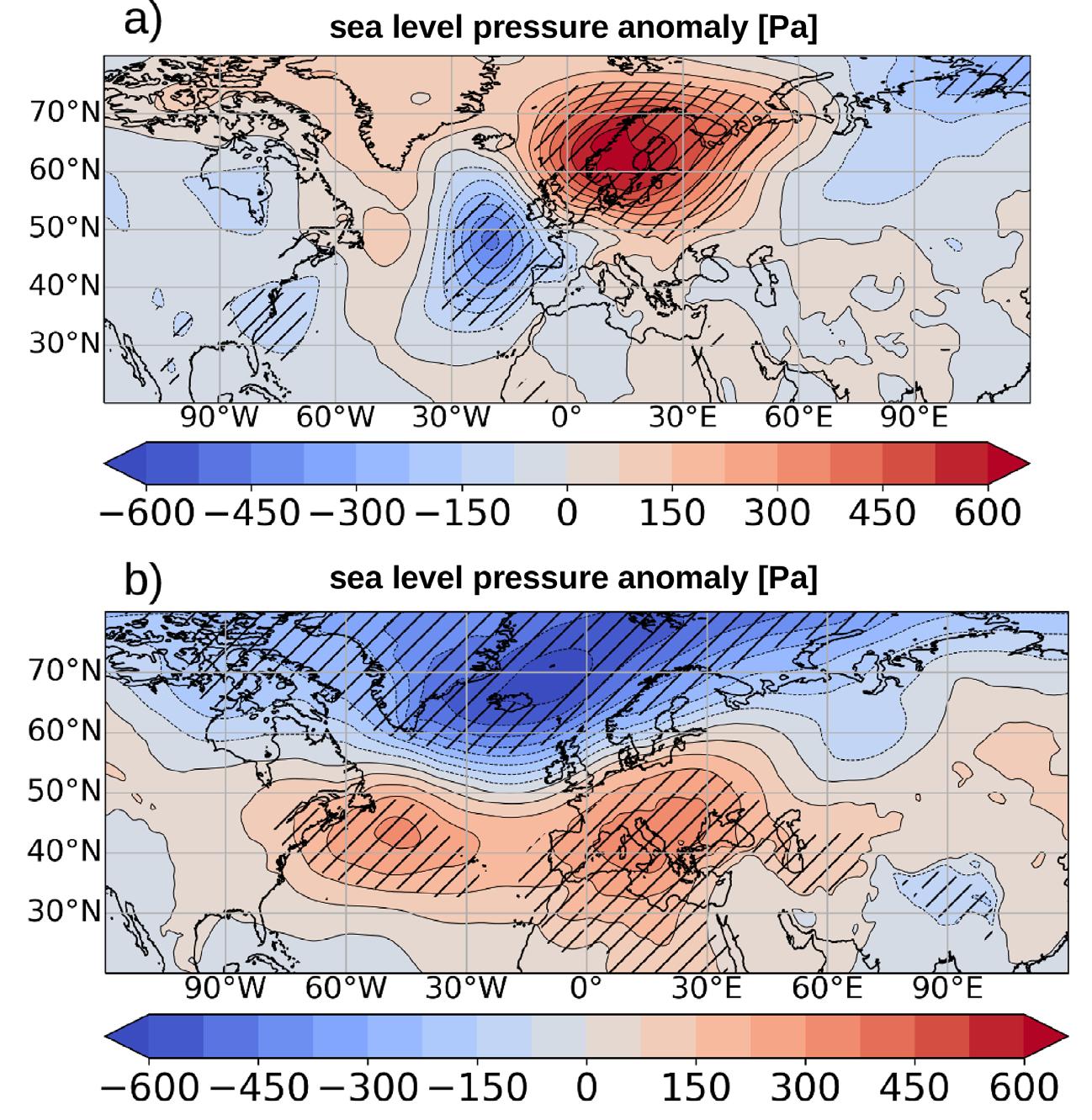
Dass sich Hitzewellen konkret auf lebenswichtige Umweltparameter auswirken können, zeigt eine weitere Studie des IOW. Dazu analysierten Forschende Modelldaten aus fünf Jahrzehnten (1970 bis 2020). Dabei untersuchten sie erstmals auch, inwieweit sich sommerliche Hitzewellen in die Tiefe ausbreiten, mit besonderem Fokus auf den flachen Küstengebieten der Ostsee, die eigentlich als dauerhaft gut „durchlüftet“ und damit robust gegen Sauerstoff-Defizite gelten. Das Ergebnis dieser Untersuchung war überraschend und alarmierend. Es zeigt, dass Hitzewellen im Sommer häufig bis in eine Wassertiefe von etwa 20 Metern zum Meeresboden vordringen und dort den Sauerstoffgehalt des Wassers lokal senken. Die sommerlichen Sauerstoffkonzentrationen können im küstennahen Bereich am Meeresgrund generell sehr niedrig sein und unterschreiten nun mitunter 2 ml/Liter, einen kritischen Grenzwert, ab dem das Leben für viele höher entwickelte Organismen wie Muscheln, Würmer, Krebse und Fische nicht mehr möglich ist. Da die Ostsee zu den sich am schnellsten erwärmenden Regionen des Weltmeeres zählt, besteht hier ein hohes Risiko, dass die
a) Luftdruckanomalie während mariner Hitzewellen während der Sommermonate (Juni-Oktober) @ IOW
b) Luftdruckanomalie während mariner Hitzewellen während der Wintermonate (Dezember-März) @ IOW
marinen Hitzewellen zusammen mit weiterer Klimaaufheizung immer häufiger kritische SauerstoffDefizite für die Bodenfauna verursachen, mit weitreichenden Folgen für das gesamte Ökosystem.
ANSPRECHPERSONEN
Prof. Dr. Markus Meier, Dr. Matthias Gröger
PUBLIKATIONEN
Gröger, M., Dutheil, C., Börgel, F., Meier, H. E. M. (2024): Drivers of marine heatwaves in a stratified marginal sea. Climate Dynamics 7062, DOI:10.1007/s00382-023-07062-5
Safonova, K., Meier, H. E. M., Gröger, M. (2024): Summer heatwaves on the Baltic Sea seabed contribute to oxygen deficiency in shallow areas. Commun Earth Environ 5, 106. doi.org/10.1038/ s43247-024-01268-z
Innovative Technologien sind eine treibende Kraft für zukunftsorientierte Wissenschaft. Neue Möglichkeiten, heterogene Forschungsdaten zu verknüpfen, steigende Rechenleistung, neue molekularbiologische Ansätze oder die Anwendung von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz zur Auswertung von ‚big data‘ bestätigen die Wichtigkeit der Methodenforschung für die Umwelt- und Meereswissenschaften. Mit diesem Potenzial neuer Technologien Spitzenforschung zu ermöglichen, strebt das IOW danach, den gesellschaftlichen Wandel zur Nachhaltigkeit voranzutreiben. In diesem Zuge wurden 2024 die zwei neuen Arbeitsgruppen „Bioinformatics and ’omics data science“ und „Integrated Optical Remote Sensing“ etabliert.
VERMINDERUNG VON ALGENBLÜTEN FÜHRT ZUR REDUZIERUNG KRANKHEITSERREGENDER VIBRIONEN IN DER OSTSEE
Der Klimawandel führt zu einer verstärkten Vermehrung des krankheitserregenden Bakteriums Vibrio vulnificus an Brackwasserküsten. V. vulnificus Infektionen verlaufen häufig tödlich, was eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit bzw. für Offshore-Aquakulturen darstellt und dem Tourismus schaden kann. Im Rahmen des von Prof. Dr. Matthias Labrenz (Leiter der Arbeitsgruppe Umweltmikrobiologie am IOW) geleiteten EU-Projekts “Pathogene Vibrio-Bakterien in den heutigen und zukünftigen Gewässern der Ostsee: Entschärfung des Problems” (BaltVib) wurde untersucht, ob bereits vorgeschlagene Regulierungsmaßnahmen zur Verringerung des Vorkommens von V. vulnificus, wie z. B. die Renaturierung von Seegraswiesen, auch für die Ostsee angewendet werden können. Das Forschungsteam bestand aus Expert:innen verschiedener Forschungseinrichtungen der Ostseeanrainer-Staaten Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Litauen und Polen, die gemeinsam Strategien zur Reduzierung der Gesundheitsrisiken und zum Schutz der marinen Ökosysteme entwickelten.
Im Sommer 2021 nahm ein Team von Forscher:innen um Prof. Dr. Matthias Labrenz und seinem Doktoranden David Riedinger Feldproben innerhalb und außerhalb von Seegraswiesen, entlang der Salzgehalts- und Nährstoffgradienten der Ostsee, einem der größten Brackwassergebiete weltweit. Dabei wurden physikalische, biologische und hydrochemische Parameter gemessen. Mittels maschinellen Lernens konnten anschließend jene Größen identifiziert werden, die das Auftreten von V. vulnificus erklären. Die besten Vorhersagevariablen für V. vulnificus waren eutrophierungsbezogene Merkmale wie partikulärer organischer Kohlenstoff und Stickstoff sowie das Auftreten potenzieller Algenblüten und damit verbundener Arten. Überraschenderweise variierte das Auftreten von V. vulnificus nicht signifikant zwischen Seegraswiesen und Seegras-freien Gebieten. Diese Ergebnisse legen nahe, dass insbesondere die weitergehende Verringerung des Nährstoffeintrags in die Ostsee eine wirksame Methode zur Kontrolle der V. vulnificus Populationen an nährstoffreichen Brackwasserküsten sein könnte. Mit dieser Studie (Riedinger et al. 2024) wurde somit eine wissenschaftliche Grund-
lage für zukünftige Regulierungsstrategien geschaffen (siehe Abbildung), die nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung schützen, sondern auch die ökologischen und wirtschaftlichen Folgen minimieren können.
Das Projekt BaltVib wurde von der Europäischen Union im Rahmen des Förderpogramms BiodivERsA für drei Jahre bis Frühjahr 2024 gefördert und zielte darauf ab, die Verbreitung und Kontrolle des pathogenen Bakte riums Vibrio vulnificus
Schematische Übersicht der Wege, über die Eutrophierung sich auf die Vermehrung von strom anorganischer Nährstoffe vom Land induziert Algen blüten, die das für die Vermehrung von organisches Material bereitstellen und ebenfalls Fraßschutz vor bakterivorem Plankton bieten. Organismen, die vermutlich eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielen, sind namentlich erwähnt und potenzielle Interaktionen durch Pfeile darge stellt. © Riedinger, IOW
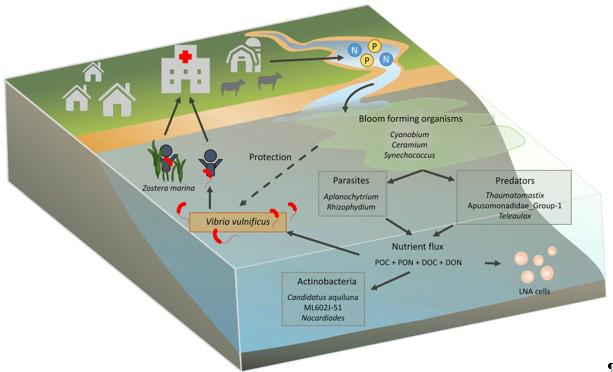
Bloom forming organisms
Ceramium
Synechocccos
Cyanobium
Parasites
Aplanochytrium
Rhizophydium
Actinobacteria
Condidatus aquiluna
ML602J-51
Nocardiodes
Predators
Thaumatomastix
Apusomonadidae_Group-1
Teleaulax
Nurtient flux POC + PON + DOC + DON
LNA cells
FORTSCHRITTE IN DER NUMERISCHEN MODELLIERUNG ERMÖGLICHEN GENAUERE
Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der international verwendeten Modelle für Ozeanturbulenz (GOTM, gotm.net), Ökosystem (ERGOM, ergom.net) und Hydrodynamik (GETM, getm.eu) legt das IOW die Grundlage für seine Expertise in regionaler Ozeanmodellierung und für eine Vielzahl darauf basierender Publikationen. Dabei ist die Modellentwicklung nicht nur ein Service für Forschung und Gesellschaft, sondern stellt eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin dar. Im Jahr 2024 konnte das IOW entscheidende Entwicklungsarbeiten erfolgreich abschließen und in renommierten Fachjournalen veröffentlichen.
Für regionale Klimastudien entwickelten Dr. Sven Karsten aus der Arbeitsgruppe „Dynamik regionaler Klimasysteme“ und Kolleg:innen ein gekoppeltes Erdsystemmodell, dessen Kern eine neuartige Komponente zur modularen Kopplung von Modellen für Ozean, See-Eis, Wellen und Atmosphäre darstellt (Karsten et al. 2024). Die Kopplungskomponente ermöglicht die konsistente Berechnung von Masse-, Impulsund Wärmeflüssen zwischen Ozean und Atmosphäre auf einem hochaufgelösten Austauschgitter und somit realistischere regionale Klimaprojektionen (siehe Abbildung Gitter).
Des Weiteren leitet das IOW im Rahmen des DFGSonderforschungsbereichs TRR 181 zu Energietransfer in Atmosphäre und Ozean mehrere Teilprojekte, in denen die energetische Konsistenz von Ozeanmodellen verbessert wird. Insbesondere teilt das IOW seine Expertise in der Entwicklung numerischer Methoden für hydrodynamische Modellkerne. In diesem Forschungsfeld konnte Dr. Knut Klingbeil aus der Arbeitsgruppe
„Prozesse in Ästuaren und Küstenmeeren“, zusammen mit Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut, HelmholtzZentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) das nationale Klimamodell FESOM maßgeblich verbessern. Es wurden ein neuer Lösungsalgorithmus mit höherer Genauigkeit und besserer Leistung (Banerjee et al. 2024, GMD) sowie eine neue Analysemethode zur Quantifizierung von falscher Mischung und Wassermassentransformation in Ozeanmodellen (Banerjee et al. 2024, OCEMOD) implementiert.
ANSPRECHPERSONEN
Dr. Sven Karsten, Dr. Knut Klingbeil
PUBLIKATIONEN
Karsten, S., H. Radtke, M. Gröger, H. T. M. Ho-Hagemann, H. Mashayekh, T. Neumann and H. E. M. Meier (2024). Flux coupling approach on an exchange grid for the IOW Earth System Model (version 1.04.00) of the Baltic Sea region. Geosci. Model Dev. 17: 1689-1708, doi: 10.5194/ gmd-17-1689-2024.
Banerjee, T., S. Danilov, K. Klingbeil and J.-M. Campin (2024). Discrete variance decay analysis of spurious mixing. Ocean Model. 192: 102460, doi: 10.1016/j.ocemod.2024.102460
Banerjee, T., P. Scholz, S. Danilov, K. Klingbeil and D. Sidorenko (2024). Split-explicit external mode solver in the finite volume sea ice–ocean model FESOM2. Geosci. Model Dev. 17: 7051-7065, doi: 10.5194/gmd-17-7051-2024
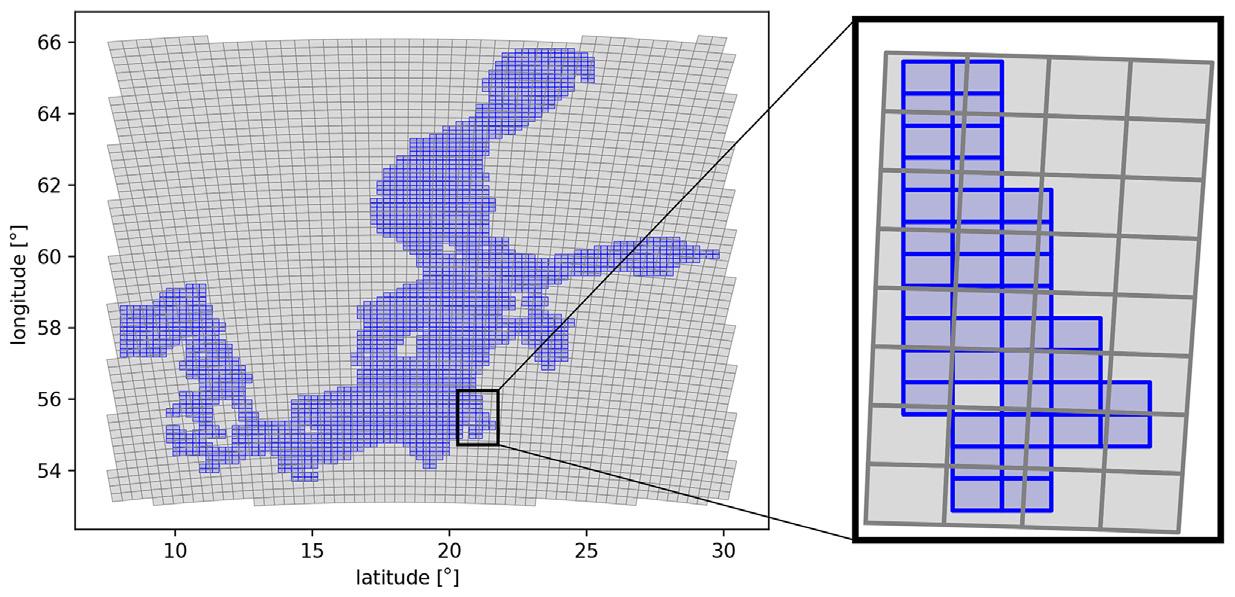
Ein grundlegendes Problem regionaler Erdsystemmodelle besteht in der unterschiedlichen Gitterauflösung der Modellkomponenten (Atmosphäre, Ozean, Land, Eis, etc.), die gekoppelt werden müssen, um ihre jeweiligen Zustände miteinander zu kommunizieren und Flüsse realistisch berechnen zu können. © Quelle: https://gmd.copernicus.org/ articles/17/1689/2024/.
Mit dem 2023 als „kleine Institutserweiterung“ eingerichteten Forschungsschwerpunkt wird das Forschungsportfolio des IOW um die Flachwasserprozesse und deren Relevanz für die gesamte Ostsee erweitert. Die unter der Bezeichnung „Shallow Water Processes and Transitions to the Baltic Scale“ (kurz S2B = „shore to basin“) zusammengefassten Forschungsarbeiten werden in allen drei Forschungsbereichen des IOW-Forschungsprogramms integriert und sind inhaltlich in dem bislang wenig betrachteten Gebiet der Schnittstelle zwischen Land und Meer angesiedelt.
TECHNIKENTWICKLUNG UND BEPROBUNG IM FLACHWASSERBEREICH
Der Start des neuen Forschungsschwerpunktes ins erste richtige Arbeitsjahr ist erfolgreich und vielseitig gelungen. Seminare, Ausfahrten, Workshops und weitreichende Planungen wurden durchgeführt. Die neuen Mitarbeitenden haben Projekte erfolgreich eingeworben und Master- sowie Doktorarbeiten wurden begonnen. Erste Ergebnisse bestätigen die Erwartung dynamischer und landbeeinflusster Prozesse.
Der neue Forschungsschwerpunkt startete mit einem offiziellen Kick-off Meeting im IOW am 22. Januar 2024. Eine neu eingerichtete Vortragsreihe des S2B wurde an jedem ersten Montag im Monat mit Vorträgen von Gästen oder internen Berichten von Mitarbeitenden eingerichtet. Daneben gab es monatliche Beprobungsfahrten zum Riff Nienhagen vor der Küste des Ostseebades Nienhagen bei Rostock sowie zahlreiche Diskussionen zur Entwicklung einer geeigneten Technik für die Flachwasserbereiche: Zum Beispiel wurde eine Verankerung für das Flachwasser mit Messsonden in sehr engen Abständen von 3-4 Metern und
Forschungskatamaran Limanda der Universität Rostock im Hafen von RostockMarienehe, kurz vor der Abfahrt zur Messkampagne im Oktober 2024. Zu sehen sind der neuentwickelte STB-Lander (links) sowie der Kammerlander. © Holtermann, IOW
Tests und Inbetriebnahme der komplexen Systeme des bildgebenden Durchflussgerätes zur Phytoplanktonerfassung (Imaging Flow Cytobot, IFC) und des eDNA Samplers für die automatisierte Probennahme genetischen Materials erprobt. Die regelmäßige Unterstützung durch die Tauchgruppe war ein Rückgrat für die Probengewinnung von Sedimenten und das Aussetzen der Lander am Riff Nienhagen.
Zeitgleich hat die Gruppe der biogeochemischen Modellierung begonnen, erste Sensitivitätsexperimente zur Rolle der Küsten in einem grobaufgelösten Ozeanmodell aufzusetzen sowie die Modellinfrastruktur ROBOELF zu entwickeln, die es erstmals ermöglichen soll, mithilfe sog. Graphical Processing Units (GPUs) in großer Anzahl Parameterstudien von komplexen biogeochemischen Modellen auszuführen.

Teilnehmer:innen des Stakeholder Workshops am 13.11.2024 im Saal des IOW. © von Thenen, IOW
Ein Ziel des S2B ist es, die Ergebnisse nutzbar für die Praxis zu machen. Daher werden von Beginn an Stakeholder-Workshops durchgeführt. Der erste fand am 13. November 2024 zum Thema „Herausforderungen in flachen Küstengewässern“ statt. Eingeladen waren Vertreter:innen von Landesämtern und Landesbehörden, aus der Wissenschaft sowie zivilgesellschaftliche Interessensgruppen. Der von Miriam von Thenen (Stellvertretende Leiterin der Arbeitsgruppe „Küstenmeere und Gesellschaft“ am IOW) organisierte Workshop strukturierte sich in die drei Arbeitsblöcke „Erfassen“ und „Verstehen“ der Flachwasserzone und „Extrapolieren“ von Modellanwendungen auf größere Bereiche der Ostsee.
Vier wissenschaftliche Arbeitsbereiche werden im Folgenden repräsentativ für den S2B vorgestellt:
(1) Im Frühjahr 2024 haben Ingrid Sassenhagen, Daniel Herlemann und Jörg Dutz ein Laborexperiment konzipiert und durchgeführt, um die Auswirkungen der Sedimentaufwirbelung in flachen Gewässern auf die Rekrutierung von Mikroorganismen aus Ruhestadien in die Wassersäule und die Veränderungen in der Planktongemeinschaft zu untersuchen. Dieses vielschichtige

Experiment zeigte signifikante Veränderungen bei mehreren Organismen und biochemischen Bedingungen als Reaktion auf die experimentelle Behandlung.
(2) Natürliches organisches Material (NOM) ist ein wichtiger Kohlenstoffspeicher, den Jann Müller und Helena Osterholz untersuchen. Es wurden ein Jahr lang wöchentlich Proben genommen und mittels optischer Methoden charakterisiert. Auch soll der Einfluss von terrestrischem und marinem NOM auf den Photoabbau neuer Schadstoffe geklärt werden.
(3) Ein Jahresgang zu den Stickstoffumsätzen in Küstengewässern wurde fortgeführt und erste vorläufige Ergebnisse sehen sowohl den Prozess der Denitrifizierung als auch den der dissimilativen Reduktion von Nitrat zu Ammonium (DNRA) als wichtige Umsätze, wobei DNRA bisher kaum regelmäßig erfasst wurde.
(4) Eine Messkampagne mit dem Forschungskatamaran „Limanda“ der Universität Rostock konnte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine plötzlich auftretende sauerstoffarme Wassermasse am Boden bei Nienhagen vermessen (siehe Abbildung). Dieses Phänomen sowie alle weiteren Arbeiten, die im Fokus der Untersuchungen des S2B stehen, werden in den nächsten Jahren intensiv weiter untersucht.

Daten der Sauerstoffsättigung entlang eines Transekts am Riff Nienhagen (westlich von Warnemünde vor dem Ostseebad Nienhagen) an zwei aufeinander folgenden Tagen, die eine hohe Dynamik im Bodensauerstoff zeigen.
© Holtermann, IOW
Langzeitdaten sind eine wichtige Grundlage um Entwicklungen, Trends und Prozesse in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu erkennen und zu prognostizieren. Das IOW erfasst seit Jahrzehnten von der westlichen bis zur zentralen Ostsee und neuerdings auch bis in den Norden verschiedene biologische, chemische, physikalische und geologische Daten vom Meeresboden und in der Wassersäule. In der westlichen Ostsee wird das IOW-Langzeitbeobachtungsprogramm überwiegend im Auftrag des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) im Rahmen des deutschen Beitrags zur Überwachung der Meeresumwelt der Ostsee im Rahmen des Helsinki-Abkommens (HELCOM) durchgeführt. Die Daten sind frei verfügbar in der institutseigenen Datenbank und werden zusätzlich in die einschlägigen nationalen Datenbankportalen eingestellt. Dadurch verfügt das IOW über ein einzigartiges Archiv mit hoher räumlich-zeitlicher Auflösung der Ostsee.
Kaltwasser- und Eis-assoziierte Diatomeen und Dinoflagellaten dominieren das Phytoplankton (Gemeinschaft der Mikroalgen) während der Frühjahrsblüte in den nördlichen und östlichen Becken der Ostsee. Wie in polaren Gebieten, können einige dieser Arten bereits im und unter dem Meereseis große Blüten ausbilden. Die Diatomee Pauliella taeniata kommt sogar nur bei einer Wassertemperatur um den Gefrierpunkt vor. Eisbedeckung und die Oberflächentemperatur des Wassers spielen demnach für diese Arten eine entscheidende Rolle.
In der zentralen und südlichen Ostsee treten Kaltwasseralgen seltener und mit unregelmäßiger Dynamik in der Biomasse auf. Der Anstieg der Oberflächentemperatur des Wassers um bis zu 1,5 °C im Frühjahr innerhalb der letzten Jahrzehnte und ein zunehmender Rückgang der Eisbedeckung im Winter bedingt durch den Klimawandel, lassen vermuten, dass sich das Auftreten vieler Kaltwasseralgen bereits deutlich verändert hat. Um diese Frage zu beantworten, wurden im Rahmen eines DFG-Projektes die Langzeit-Monitoringdaten der letzten 20 bzw. 40 Jahre der südlichen und zentralen Ostsee für fünf typische Kaltwasseralgen
analysiert: die Diatomeen Pauliella taeniata, Thalassiosira baltica, Thalassiosira levanderi, Melosira spp. und den Dinoflagellaten Peridiniella catenata. Dazu wurden die Datensammlungen des IOW und des ICES (HELCOM) sowie die BED Datenbank (Baltic Environmental Database) genutzt.
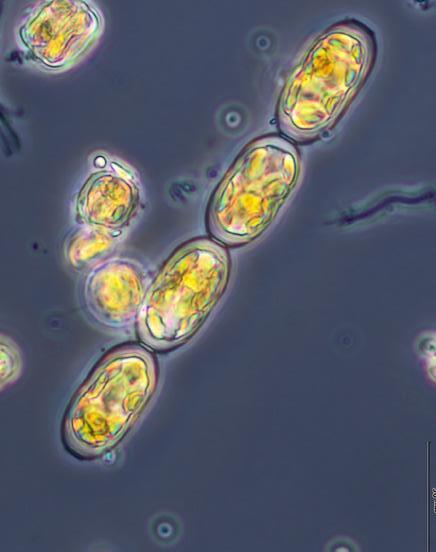
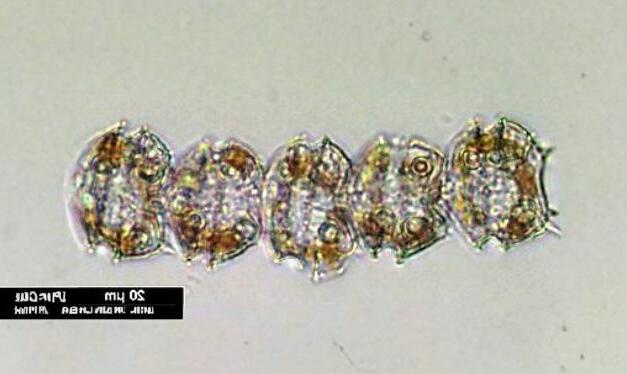

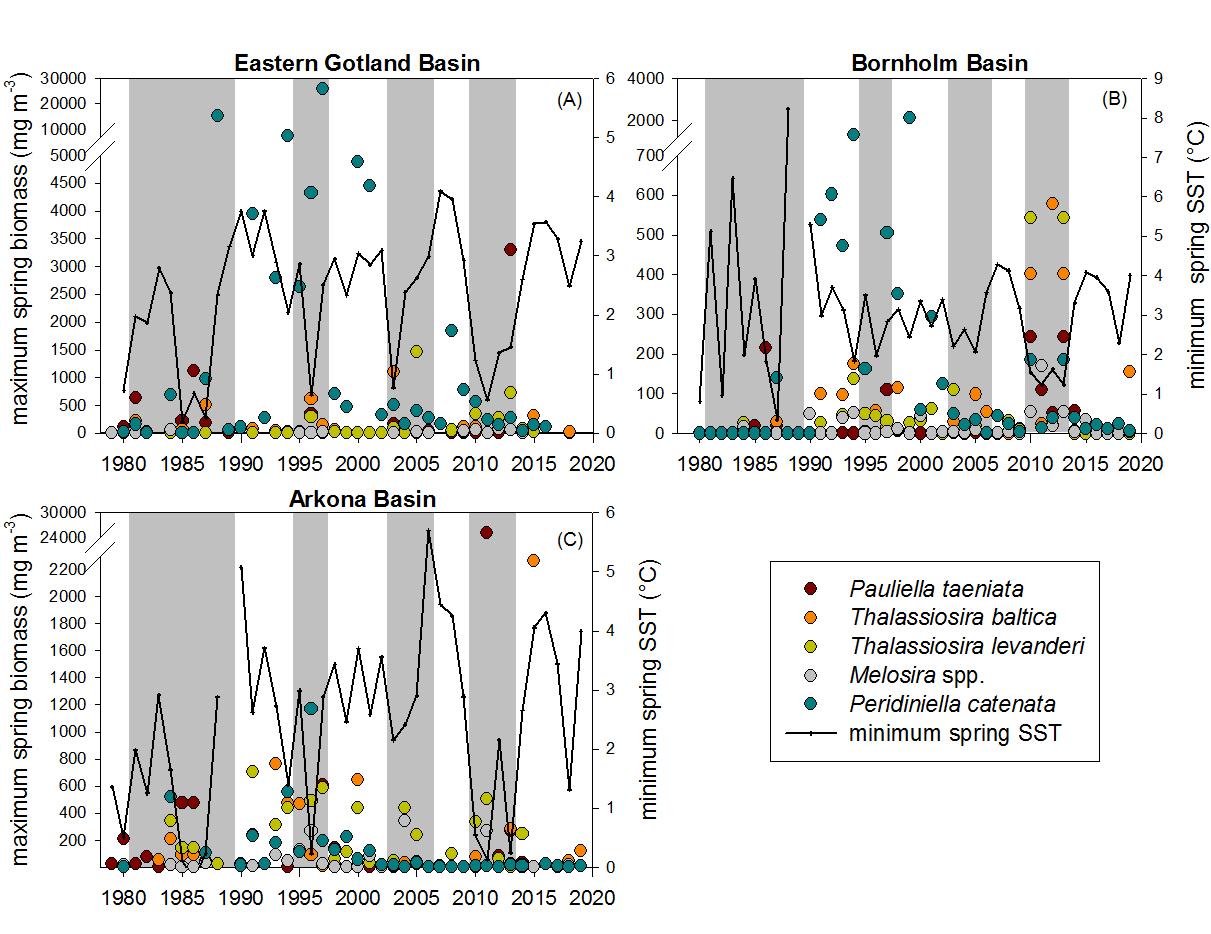
Es konnte gezeigt werden, dass in den 1980ern sowie in Perioden von 1995 – 1997, 2003 – 2006 und 2010 – 2013 die Diatomeen in allen Gebieten in hohen Biomassen auftraten, wie in der nebenstehenden Abbildung ersichtlich wird. Diese Zeiten korrelierten mit langanhaltender Eisbedeckung in der gesamten Ostsee und geringen Wassertemperaturen im Winter und Frühjahr. Seit 2013 ist insbesondere die Biomasse der Kaltwasserdiatomeen in allen untersuchten Gebieten stark zurückgegangen und größere Blüten traten überhaupt nicht mehr auf, was mit dem deutlichen Anstieg der Wassertemperatur korreliert. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass diese Arten bald vollständig aus den südlicheren Becken verschwunden sein könnten. Der Rückgang des Dinoflagellaten Peridiniella catenata indes bleibt rätselhalt, da dessen Dynamiken weniger stark an diese Umweltfaktoren gekoppelt zu sein scheinen. Um die vermutlich komplexen Ursachen aufzuklären, ist weitere Forschung nötig.
Doch wie werden größere Blüten der Kaltwasseralgen in der zentralen Ostsee eigentlich gebildet? Ähnlich wie Pflanzen bilden viele Phytoplanktonarten Dauerstadien, die nach der Blüte ins Sediment absinken und unter bevorzugten Umweltfaktoren wieder auskeimen. Die zentrale Ostsee ist jedoch zu tief, um Blüten auf diese Weise ausbilden zu können und ist zudem selten und nur in den Küstenbereichen von Eis bedeckt. Die Modellanalysen konnten zum ersten Mal nachweisen, dass der Ursprung für Kaltwasseralgenblüten in der zentralen Ostsee im Golf von Finnland bzw. im Golf von Riga liegt. Nach kalten, eisreichen Wintern wird ein erheblicher Anteil des Schmelzwassers und damit
Maximale Biomasse (mg m-3) der Kaltwasseralgen pro Jahr während der Frühjahrsblüte sowie die dazugehörige minimale Oberflächentemperatur des Wassers (sea surface temperature, SST). Graue Bereiche im Hintergrund symbolisieren identifizierte Perioden mit hohen Biomassen von Kaltwasseralgen in der südlichen und zentralen Ostsee. © Paul, IOW
auch größere Mengen an Kaltwasseralgen mit der Oberflächenströmung weit nach Süden transportiert. Diese bilden dann den Ursprung für die Blüten im östlichen Gotlandbecken und beeinflussen in einigen Jahren sogar auch die Blüten im Bornholmbecken und Arkonabecken.
ANSPRECHPERSON
Dr. Carolin Paul
PUBLIKATION
Paul, C., U. Gräwe and A. Kremp (2023). Long-term changes in bloom dynamics of Southern and Central Baltic cold-water phytoplankton. Front. Mar. Sci. 10: 1212412, doi: 10.3389/fmars.2023.1212412
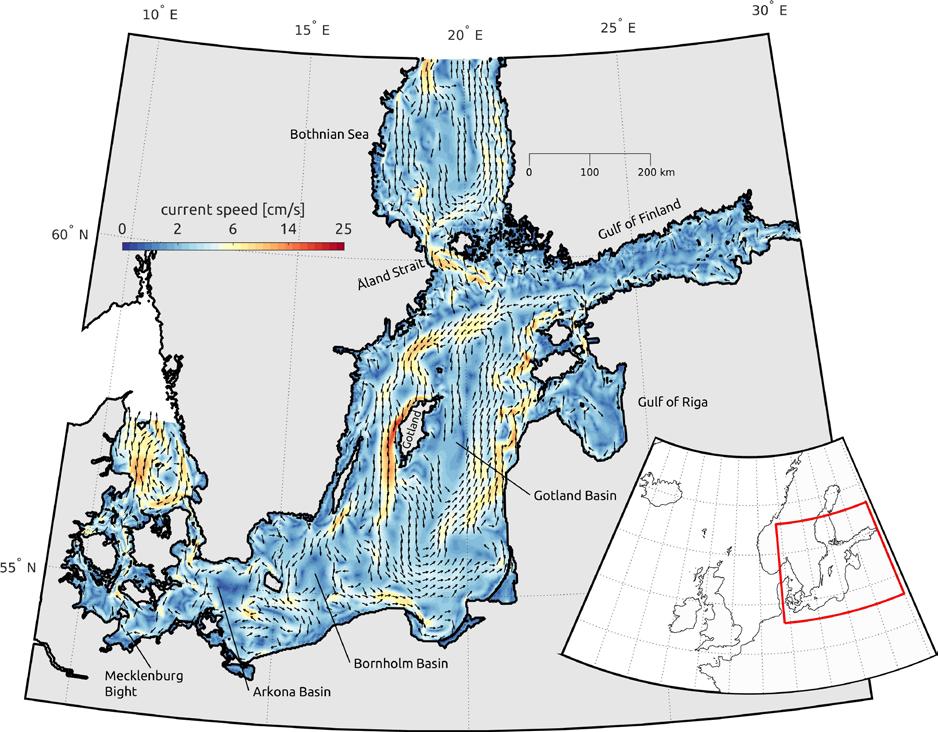
Forschungsdaten sind die Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens. Sie basieren am IOW auf Messungen oder Beobachtungen aus der Luft, auf See oder im Labor sowie auf Modellsimulationen. Essentiell ist dabei ein sorgfältiges Forschungsdatenmanagement, durch das die Validierung der Daten, die sichere Speicherung und langfristige Archivierung, die öffentliche Zugänglichkeit und Zitierbarkeit sowie die inhalts- und kontextgenaue Nutzung der Daten gewährleistet werden.
Am IOW arbeiten Akteur:innen aus dem Bereich IT & Datenmanagement, der Wissenschaft und der Bibliothek eng zusammen und unterstützen die Forschenden bei deren Datenmanagement. In Informationsveranstaltungen werden die Grundlagen zum Umgang mit Forschungsdaten nach den international geltenden FAIR-Prinzipien aufgezeigt, Möglichkeiten für die Speicherung, Langzeitarchivierung oder das Teilen von Daten in Kooperationen vorgestellt sowie Tipps zum Datenpublizieren mit persistenten Identifikatoren (wie DOI) gegeben. Insbesondere wird dabei auf die hausinternen Infrastrukturen eingegangen, wie z. B. auf die ozeanographische Datenbank IOWDB, das Datenbankrecherche-Tool ODIN oder den Metadatenkatalog IOWMETA.
Das Datenmanagementteam des IOW ist auf nationalen und internationalen Konferenzen und Tagungen präsent. Derzeit wird zudem das zentrale Datenmanagement der Forschungsmission CDRmare der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) personell vom IOW organisiert und koordiniert. Damit verbunden ist ein reger, produktiver Austausch mit allen Beteiligten, insb. dem DAM-Kernbereich „Datenmanagement und Digitalisierung“, den weiteren DAM-Forschungsmissionen sustainMare und mareXtreme sowie dem Datenrepositorium PANGAEA.
Darüber hinaus hat sich das IOW im September 2024 erfolgreich um eine Mitgliedschaft in NFDI4Earth, dem Konsortium für Erdsystemforschung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), beworben. Konkret wird bei dieser Aktivität das „User Support
Network“ von NFDI4Earth unterstützt, über welches Nutzeranfragen zu Aspekten des FAIRen Umgangs mit Forschungsdaten und zugehörigen Infrastrukturen beantwortet werden. Hier kann das IOW insbesondere seine Expertise mit ozeanographischen Datenbanken, Datenkuratierung und Modelldaten-Serverlösungen einfließen lassen. Ebenso hat sich das IOW bei der Beantragung einer zweiten Förderphase von NFDI4Biodiversity, dem NFDI-Konsortium zur gemeinschaftlichen Nutzung von Biodiversitäts- und Umweltdaten, eingebracht. Dort wird es zukünftig an der Verbesserung der Verfügbarkeit und FAIRness von Daten zur marinen Biodiversität beitragen.
ANSPRECHPERSONEN
Dr. Susanne Feistel, Dr. Manja Placke
PUBLIKATION
Höring, F., Boxhammer, T., Feistel, S., Felden, J., Heins, A., Hoppe, K., Krüger, M., Mehrtens, H., Placke, M., Terzijska, D., Wiemer, G., & Wittmann, A. C. (2025). Empfehlungen zum Forschungsdatenmanagement für DAM-Forschungsmissionen und Verbünde (Version 3). Zenodo. https://doi.org/10.5281/ zenodo.15430225




Die schwimmende Offshore Windanlage (DemoSATH) liegt vor der Küste von Bilbao und stellt, zusammen mit den „Life Boosting Units“, (o. re. , gegenüberliegende Seite) eine von vier hybriden blau-grauen Infrastrukturen dar, die in TRANSEATION genutzt werden. © saitec

Im Jahr 2024 begann die Laufzeit von 33 Drittmittelprojekten (darunter teils in koordinierender Rolle). Fördermittelgeber sind unter anderem die Europäische Union (insb. im Rahmen des EUForschungsrahmenprogramms Horizon Europe), die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sowie weitere Bundesressorts. Im folgenden Kapitel werden ausgewählte Projekte vorgestellt. Eine vollständige Liste aller 2024 bearbeiteten Projekte befindet sich im Anhang.
Advancing Ecosystem-Based Management through Hybrid Blue-Grey Infrastructures in Marine and Coastal Areas
Im EU-Projekt TRANSEATION erforscht das IOW mit Partnern aus acht Ländern, wie technische Küsteninfrastrukturen wie Wellenbrecher, Offshore-Windparks oder Aquakulturanlagen ökologisch aufgewertet und in Meeresökosysteme integriert werden können. Ziel ist ein Managementansatz, der naturbasierte Lösungen mit Technik und Digitalisierung verbindet, um Biodiversität und Ökosystemleistungen zu schützen. In vier Fallstudien in Spanien, Frankreich und Israel werden hybride Anlagen untersucht, ihre Wirksamkeit evaluiert und ihre Übertragbarkeit geprüft. Das IOW bringt dazu das System Approach Framework (SAF) ein – einen strukturierten, partizipativen Ansatz zur Planung, Umsetzung und Bewertung ökosystemgerechter Lösungen.

LAUFZEIT
01/2024 – 06/2027
FÖRDERUNG
EU – Horizon Europe
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Dr. Johanna Schuhmacher, Dr. Ibrahim Boubekri
WEBSITE
https://transeation-europeanproject.eu/
Modellprojekt Moorklimaschutz an der Ostseeküste
Im Projekt werden an der vorpommerschen Ostseeküste 12 degradierte Küstenpolder (insgesamt ca. 850 ha) durch Wiedervernässung ökologisch reaktiviert, um ihre Funktion als Kohlenstoffsenken zu untersuchen. Forschende am IOW um Prof. Dr. Maren Voß und Dr. Sophie Kache untersuchen in Kooperation mit der Universität Greifswald und der Ostseestiftung (Koordination) die Stoff- und Gasflüsse – vor allem Stickstoffverbindungen – mittels langjähriger Monitoringdaten. Vier ausgewählte Polder entlang der Küste werden beprobt, die auf unterschiedliche Weise renaturiert und mit der angrenzenden Küste verbunden werden. Die zehnjährige Projektlaufzeit ermöglicht Beobachtungen vor, während und nach der Renaturierung und bietet somit eine einmalige Chance, Emissionen und Stoffumsatzprozesse zu analysieren. Die Ergebnisse dienen der Entwicklung fundierter Strategien für nährstoff- und treibhausgas-emissionsarme Renaturierungsmaßnahmen. Das Modellvorhaben ist Teil des nationalen „Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz“(ANK).
Projekt-Kick-off (von links): Maren Voß (IOW), Georg Nikelski (OSTSEESTIFTUNG), Steffi Lemke (Bundesumweltministerin), Balázs Baranyai (OSTSEESTIFTUNG), Till Backhaus (Umweltminister MecklenburgVorpommern), Gerald Jurasinski (Universität Greifswald) © Krone, OSTSEESTIFTUNG

LAUFZEIT
03/2024 – 03/2034
FÖRDERMITTEL
Bundesamt für Naturschutz (Förderprogramm Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz)
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Prof. Dr. Maren Voß
WEBSITE
https://www.io-warnemuende.de/ projekt/338/moorklimaschutz.html
Energietransfer in der Atmosphäre und im Ozean
TRR 181 „Energietransfer in der Atmosphäre und im Ozean“ ist ein von der DFG geförderter Sonderforschungsbereich, der von der Universität Hamburg koordiniert wird und seit 2016 die Energietransporte zwischen Ozean und Atmosphäre untersucht – ein Schlüsselaspekt für die Weiterentwicklung klimarelevanter Modelle. In der dritten Förderphase bringt das IOW seine langjährige Expertise insbesondere im Bereich physikalischer Ozeanografie ein. Es erforscht, wie sich interne Wellen, Strömungen und Wirbel auf Durchmischungsprozesse auswirken und wie diese Prozesse die Energiebilanz im Ozean beeinflussen. Die Ostsee dient dabei als Modellsystem für gezielte Messungen und Simulationen. Ziel ist es, die physikalische Konsistenz von Klimamodellen zu verbessern, um kleinste Energie-Ungleichgewichte besser abzubilden – denn gerade diese können global weitreichende Folgen haben.
LAUFZEIT
07/2024 – 06/2028
FÖRDERUNG
Deutsche Forschungsgemeinschaft
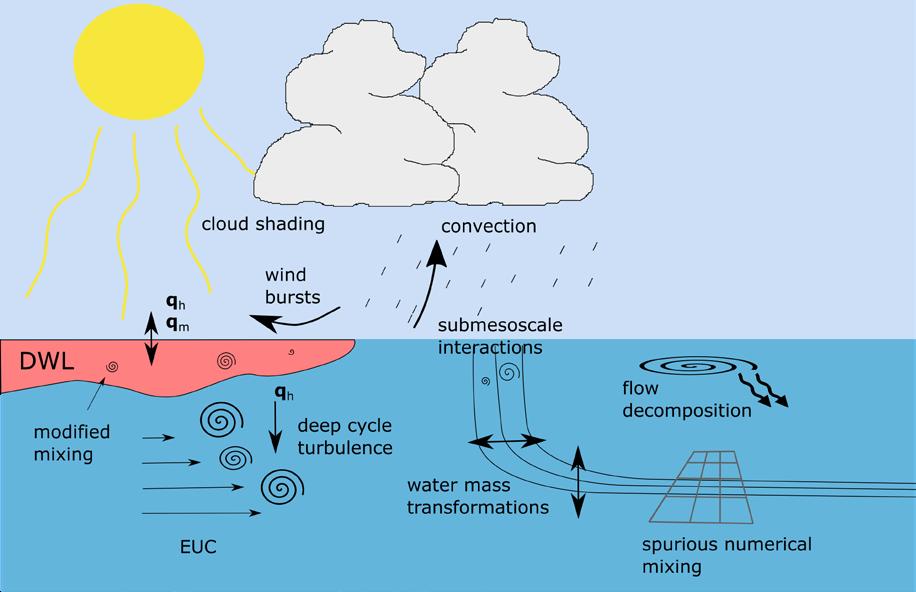

Graphische Darstellung der Forschung des IOW in der dritten Förderphase des TRR 188 „Energietransfer in der Atmosphäre und im Ozean“ (DWL: Diurnal Warm Layer / tägliche warme Deckschicht; EUC: Equatorial Undercurrent / Äquatorialer Unterstrom, qh: Wärmefluss durch die Oberfläche, qm: Impulsfluss durch die Oberfläche)
© Umlauf, IOW
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Prof. Dr. Hans Burchard
WEBSITE
https://www.trr-energytransfers.de
Status der Funktionen biogener Riffe in der Ostsee mit Schwerpunkt auf die Kohlenstoff-Fixierung
Sublitorale Muschelbänke und biogene Riffe in der deutschen Ostsee werden hinsichtlich ihres BlueCarbon-Potenzials in diesem Projekt untersucht – also ihre Fähigkeit, Kohlenstoff in marinen Lebensräumen dauerhaft zu binden. Ziel ist es, diese Strukturen systematisch zu kartieren, ihren Beitrag zur CO₂-Speicherung zu quantifizieren und in aktuellen sowie zukünftigen Bilanzmodellen darzustellen. Es kommen Feldstudien, Fernerkundung, Labor- und Mesokosmenexperimente zum Einsatz, um Stoffflüsse und Kalzifikation zu erfassen. Die Ergebnisse tragen dazu bei, zentrale Wissenslücken zu naturbasiertem Klimaschutz in marinen Ökosystemen zu schließen und unterstützen das
Bundesamt für Naturschutz (BfN) bei der Entwicklung effektiver Schutz- und Managementstrategien für biodiversitätsrelevante Riffstrukturen.
LAUFZEIT 10/2024 – 09/2027
FÖRDERUNG
Bundesamt für Naturschutz
PROJEKTLEITUNG
Dr. Michael L. Zettler
WEBSITE
https://www.io-warnemuende.de/ projekt/350/status.html
Sozial-ökologische Analysen und Modelle für den digitalen Ozeanzwilling
In dem europäischen Verbundprojekt werden in Zu sammenarbeit mit Endnutzern Analysemethoden und -instrumente entwickelt, um den Ausbau des europäischen digitalen Ozeanzwillings (European DTO) zu einer umfassenden Plattform bis 2030 zu unterstützen. Das Vorhaben integriert ökologische und sozioökonomische Daten in Modellen, um Entscheidungsträger:innen in Küsten- und Binnengewässern praxisnah zu unterstützen. In Partizipationsprozessen entstehen „Was-wäre-wenn“Szenarien und Indikatoren für Umweltveränderungen, Politik-Alternativen und Managemententscheidungen. Der IOW-Beitrag umfasst die Co-Design-Workshops mit Stakeholdern im Fallstudiengebiet, unterstützt die Entwicklung integrierter Modelle und beinhaltet die Leitung des Arbeitspakets zu Fallstudien mit Schwerpunkt auf die Fallstudie im Greifswalder Bodden (Gewässerqualität). SEADITO erzeugt FAIR-konforme Entscheidungshilfesysteme sowie Lernmaterialien für Forschende, Behörden und Öffentlichkeit bis 2027.
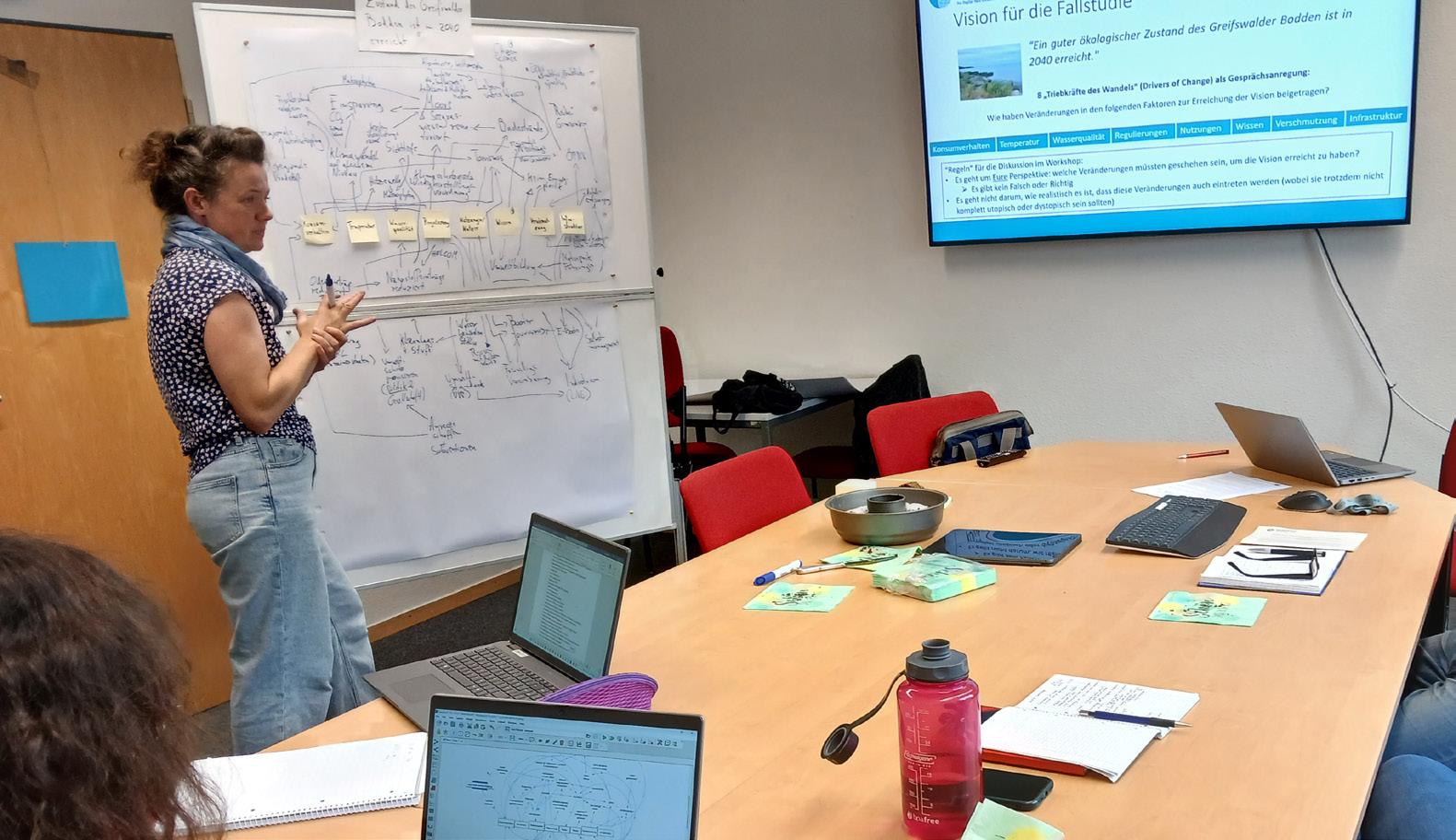

LAUFZEIT
09/2024 – 08/2027
FÖRDERUNG: EU – Horizon Europe
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Dr. Miriam von Thenen
WEBSITE https://seadito.eu
Carbon capture/release processes in bivalve beds

Air-sea Carbon flux
Uptake to tissue Calcification
Schematische Darstellung des Kohlenstoffbudgets von biogenen Muschelriffen (Mytilus sp.) in der Ostsee basierend auf den Studien von Kent et al. (2017), Jansen und van den Boogart (2020), Lee et al. (2020) und Sea et al. (2022). © IOW
Versunkenen Landschaften auf der Spur
Der IOW-Beitrag zum ERC Synergy Grant zielt darauf, neue Methoden zur Rekonstruktion versunkener Landschaften und menschlicher Siedlungen zu entwickeln. Im Fokus steht, wie nacheiszeitliche Meeresspiegelanstiege die Küstenregionen an Nord- und Ostsee veränderten und welche Folgen dies für prähistorische Gesellschaften hatte. Dazu kombinieren Forschende geophysikalische Messungen, Sedimentanalysen, Dendrochronologie und KI-basierte Modellierung. In vier ausgewählten Regionen werden Küstenlandschaften des Holozäns systematisch untersucht. Ziel ist ein integrativer methodischer Ansatz, der archäologische, geowissenschaftliche und ökologische Erkenntnisse vereint. SUBNORDICA will ein neues Kapitel in der Vorgeschichte der Menschheit aufschlagen, ein welt-
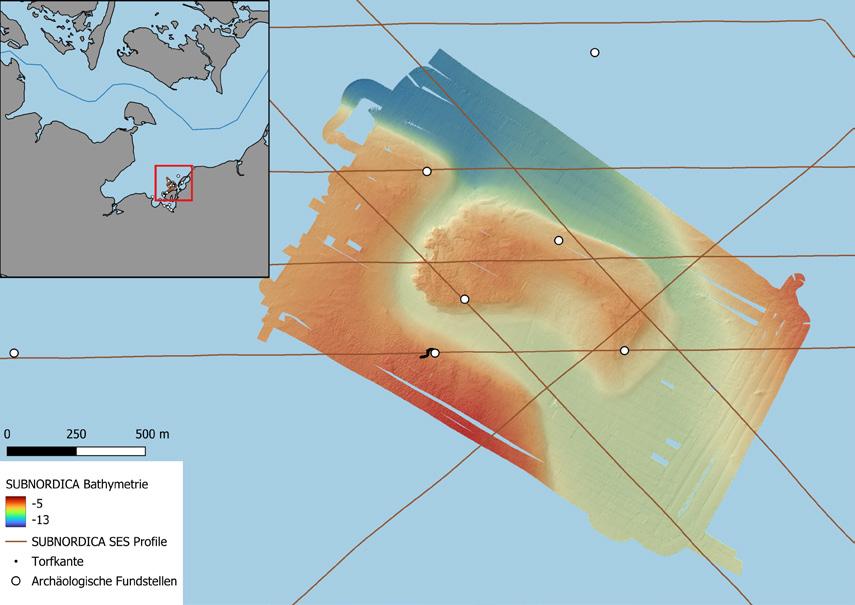
weit führendes Modell für die Untersuchung versunkener Landschaften liefern und verbesserte politische Leitlinien für die Verwaltung des Unterwasser-Kulturerbes bieten.
LAUFZEIT
10/2024 – 03/2030
FÖRDERUNG
EU – ERC Synergy Grant
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Dr. Jacob Geersen
WEBSITE
https://projects.au.dk/subnordica/about
Sediment Echolot Profile und Bathymetrie sowie kartierte Torfkanten (Aufnahmedaten März/Mai 2025) und archäologische Fundstellen aus früheren Projekten (SINCOS Projekt 2002 - 2009) © Geersen/Feldens, IOW

Das IOW in den Verbundprojekten der Forschungsmissionen der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM)
Das IOW ist in Projekten aller drei Forschungsmissionen der Deutschen Allianz Meeresforschung aktiv. Auf den folgenden Seiten werden ausgewählte Projekte vorgestellt.


Zu Beginn des Jahres 2024 ist die Forschungsmission mareXtreme „Wege zu einem verbesserten Risikomanagement im Bereich mariner Extremereignisse und Naturgefahren“ und mit ihr die beiden folgenden Projekte unter Beteiligung des IOW gestartet:
Auswirkungen physikalisch-ozeanographischer Extremereignisse auf Ökosystemdienstleistungen im Elbe-Ästuar-Küstensystem; Vorhaben: SzenarioStudien als Grundlage von Ökosystem-Risiken
Im Projekt wird ein hochaufgelöstes, hydrodynamischökologisches Modell für das Elbeästuar entwickelt, um die Auswirkungen extremer Ereignisse wie Sturmfluten, Hitzeperioden oder Hochwasser besser vorhersagen und bewerten zu können. Das bestehende Modell mit kurvilinearen Koordinaten wird deutlich verfeinert und mit dem General Estuarine Transport Model (GETM) umgesetzt. Durch die Kopplung mit modularen Ökosystemkomponenten über MOSSCO lassen sich auch ökologische Extremereignisse wie Sauerstoffmangel oder Algenblüten realitätsnah simulieren. Szenarienanalysen helfen dabei, sowohl historische als auch mögliche zukünftige Extremereignisse abzubilden und deren Risiken für das sensible Ästuarökosystem wissenschaftlich fundiert zu analysieren.
LAUFZEIT
01/2024 – 12/2026
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
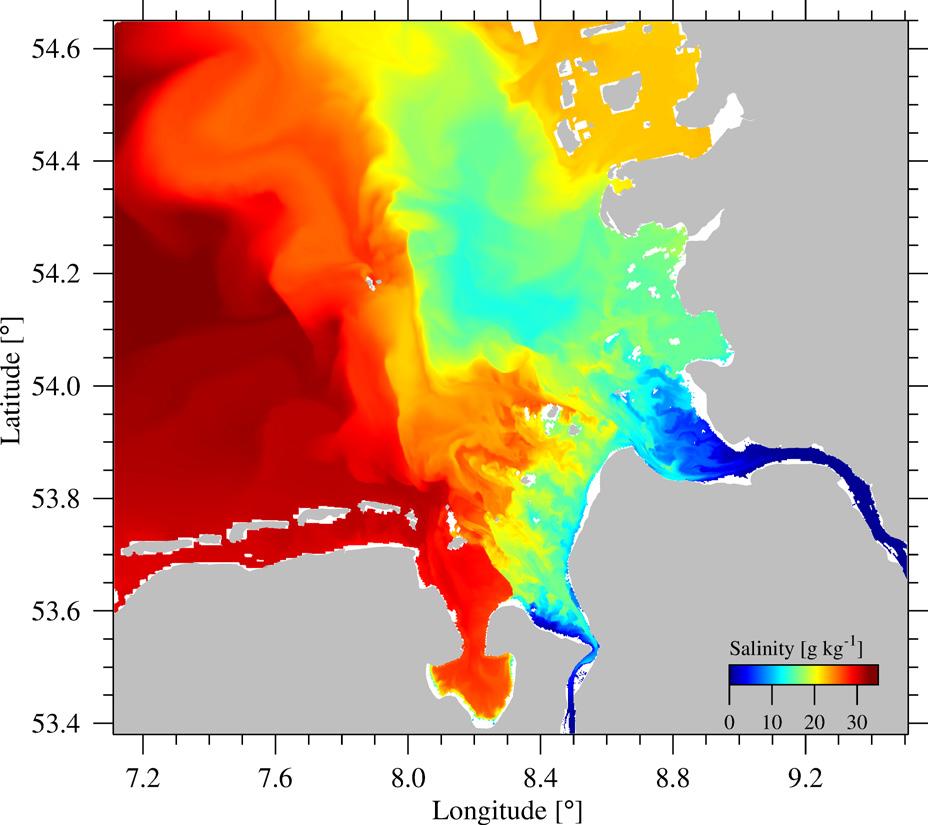
Oberflächensalzgehalt in der inneren Deutschen Bucht am 2. Februar 2011 um 0:00 h, abgeschätzt durch eine hochaufgelöste numerische Simulation mit GETM (General Estuarine Transport Model). Man erkennt sehr schön, wie sich das Süßwasser (blau) aus der Weser (westlich) und der Elbe (östlich) miteinander und mit dem Salzwasser der Nordsee (rot) vermischt und eine gemeinsame Flussfahne (hellblaugelb) bildet, die nordwärts strömt. © Li, IOW
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Prof. Dr. Hans Burchard
WEBSITE
https://www.io-warnemuende.de/ projekt/331/elbextremehydro.html

Vorhersage mariner biologischer Gefahren zur Verhinderung sozioökonomischer Auswirkungen; Vorhaben: Überwachung, Modellierung und Bewertung von Extremwetterereignissen auf biologische Meeres gefahren in der westlichen Ostsee
Zunehmende marine Gefahren wie krankheitserregen de Vibrionen, potenziell giftige Cyanobakterien oder Sauerstoffmangel stellen eine wachsende Bedrohung für Gesundheit, Fischerei, Tourismus oder Biodiversität in der westlichen Ostsee dar. PrimePrevention entwickelt innovative Frühwarnsysteme, die auf vernetzten, modularen Messsystemen sowie hochauflösenden Modellen basieren. So sollen Risiken frühzeitig erkannt und präventive Maßnahmen ermöglicht werden. Das IOW analysiert vergangene Extremereignisse und mögliche Kaskadeneffekte unter steigenden Temperaturen. Dies fließt in Untersuchungen zu Auswirkungen auf Ökosystemleistungen aufgrund von Extremereignissen ein. Die Ergebnisse des DAM-Verbundprojektes werden am Ende zu verbesserten Frühwarnsystemen, wie auch praxisnahen Strategien für ein nachhaltiges Gefahrenmanagement und Monitoring führen.

Sommerliche, potenziell toxische Blaualgenbüte in inneren Küstengewässern der Ostsee (Kurische Nehrung) mit der Konsequenz von Badeverboten und eingeschränkter Tourismusentwicklung
© Schwernewski, IOW
LAUFZEIT
01/2024 – 12/2026
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Dr. René Friedland
WEBSITE
https://www.io-warnemuende.de/ projekt/332/dam_primeprevention.html
In der zweiten Förderphase der Forschungsmission CDRmare „Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur Dekarbonisierung“ ist das IOW weiterhin in folgenden Projekten aktiv:
Ausschluss mobiler grundberührender Fischerei in marinen Schutzgebieten der Ostsee; Vorhaben: Entwicklungsszenarien benthischer Lebensgemeinschaften und Sedimentfunktionen
Das Projekt MGF-Ostsee II untersucht, wie sich der Ausschluss mobiler grundberührender Fischerei auf benthische Lebensgemeinschaften und Sedimentfunktionen in marinen Schutzgebieten der Ostsee auswirkt. Aufbauend auf Phase I wird mithilfe von Zeitserienbeprobungen erfasst, wie sich die Biodiversität, Biomasse und Funktion des Meeresbodens verändert. Ergänzend wird in einem gezielten Experiment der direkte Einfluss von Grundschleppnetzen auf Lebensgemeinschaften analysiert. Ziel ist es, belastbare wissenschaftliche Grundlagen für ein wirksames Management mariner Schutzgebiete zu schaffen.
LAUFZEIT
03/2023 – 02/2026
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Prof. Dr. Klaus Jürgens
WEBSITE
https://www.io-warnemuende.de/ projekt/318/mgf-ostsee_ii.htmlprojekt/ 308/cofies.html

CO2-Entnahme durch Alkalinitätserhöhung – Potenzial, Nutzen und Risiken; Vorhaben: Potenzielle Effekte benthischer Karbonatlösung auf das Ökosystem der Ostsee
In der zweiten Förderphase von RETAKE wird das Potenzial der CO₂-Entnahme durch Alkalinitätserhöhung in der Ostsee weiter erforscht. Das IOW untersucht mittels Modellierungen und Feldmessungen die Auswirkungen von Kalkzugabe auf CO₂-Aufnahme, biogeochemische Prozesse und Meeresökologie. Ziel ist es, Unsicherheiten aus Phase I zu reduzieren und die ökologische Verträglichkeit großskaliger Anwendungen besser zu bewerten.
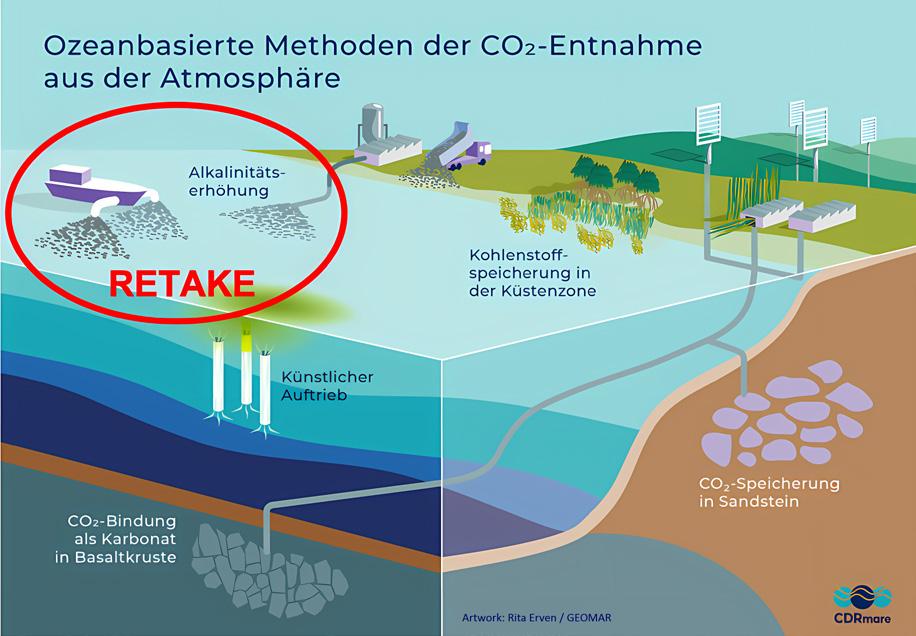
LAUFZEIT
08/2024 – 07/2027
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
PROJEKTLEITUNG AM IOW Dr. Hagen Radtke
WEBSITE https://www.io-warnemuende.de/ projekt/345/retake_2.htmlprojekt/326/ arkobi.html
Darstellung der im Projektverbund CDRmare untersuchten Methoden mit Hervorhebung des Fokus von RETAKE © Erven, GEOMAR

In der Forschungsmission sustainMare „Meere schützen und nachhaltig nutzen“ ist das IOW auch in der zweiten Förderphase wieder in folgenden Projekten aktiv:
Konzepte zur Reduzierung der Auswirkungen anthropogener Drücke und Nutzungen auf marine Ökosysteme und die Artenvielfalt; Vorhaben: Erstellung eines Ostsee-Bioarchivs
Das IOW etabliert mit dem Projekt eine harmonisierte Langzeitarchivierung von Umwelt-DNA (eDNA) für die deutsche Ostsee. Ziel ist es, eine umfassende digitale Datenbank sowie eine physische Probensammlung aufzubauen. Diese dienen der Forschung, dem Biodiversitätsschutz und der Bereitstellung von Informationen für Behörden und Öffentlichkeit. Ergänzend entsteht ein Fact Sheet mit Standards zur Probenentnahme, -lagerung und -analyse, das eine einheitliche Archivierung von eDNA-Proben unterstützt.
LAUFZEIT
12/2024 – 11/2027
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Prof. Dr. Matthias Labrenz
WEBSITE
https://www.io-warnemuende.de/projekt/352/dam_create-2.html

Das Projektteam beim Kick-off Treffen © Halbach, HIFMB
Konzepte zur Sanierung konventioneller Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee; Vorhaben: Modellierung der Verdriftung sprengstoff-typischer Verbindungen (STV) im Küstenozean und Untersuchungen von Räumungsstrategien

LAUFZEIT
12/2024 – 11/2027
Die Verbreitung, der Zustand und die Umweltauswirkungen von rund 1,6 Millionen Tonnen versenkter Munition in Nord- und Ostsee werden im Projekt untersucht. Ziel ist es, bestehende und neue Datensätze zu Kampfmittelaltlasten zu integrieren, um ein umfassendes Verständnis über die Freisetzung, Ausbreitung und ökologische Wirkung sprengstofftypischer Verbindungen zu erlangen. Das IOW analysiert mithilfe von Modellierungen und Messdaten die Verdriftung dieser Substanzen im Küstenozean und bewertet verschiedene Räumungsstrategien..
Zukunftsszenarien zur Förderung einer nachhaltigen Nutzung mariner Räume
Im Projekt wird ein Modellsystem für Nord- und Ostsee entwickelt, das die Auswirkungen von Klimawandel und menschlicher Nutzung auf marine Ökosysteme analysiert. Mithilfe dieser virtuellen Umgebung werden Managementmaßnahmen in den Sektoren OffshoreEnergie, Fischerei, Küstenschutz/Sandmanagement sowie Nährstoff- und Schadstoffeinträge bewertet. Das IOW bringt seine Expertise in der physikalisch-biogeochemischen Modellierung ein und untersucht mögliche Zukunftsszenarien mit Blick auf Ökosystemleistungen, Resilienz und Nutzungskonflikte. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte, praxisnahe Handlungsempfehlungen für ein nachhaltiges, integriertes Management mariner Räume zu liefern.
LAUFZEIT
12/2024 – 11/2027
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Dr. Ulf Gräwe
WEBSITE https://conmar-munition.eu/de/
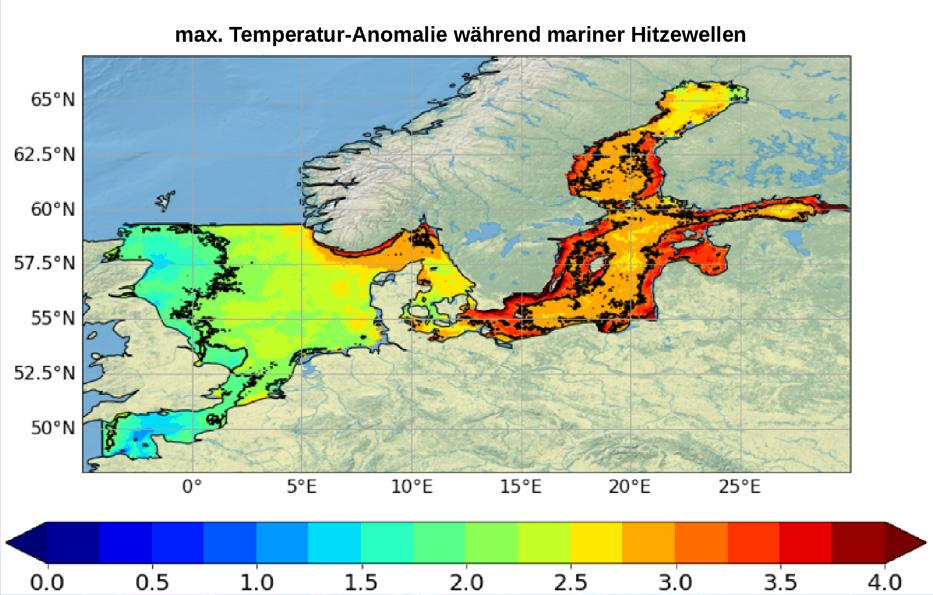
Maximale Temperatur Anomalie während einer Hitzewelle © Gröger, IOW
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Prof. Dr. Markus Meier
WEBSITE https://www.coastalfutures.de/
Die zweite Förderphase des Ocean Technology Campus (OTC), das durch das BMFTR im Rahmen der Förderlinie Clusters4Future gefördert wird, wurde 2024 bewilligt. Drei Projekte des OTC II begannen am IOW im Berichtsjahr. Ein viertes Projekt läuft im Jahr 2025 an.

Living Probabilistic Twins
Im Projekt DaTA2Model-E werden die Messgeräte zur Vermessung eines Meeresgebiets optimiert: Durch die Erstellung eines digital-räumlich-zeitlich hochaufgelösten „wahren Zustands“ mittels eines Modells wird untersucht, welche Sensor-Strategien und Platzierungen die Rekonstruktion dieses Zustands, unter Berücksichtigung von Messunsicherheiten am besten ermöglichen.
LAUFZEIT
10/2024 – 09/2027
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Dr. Ralf Prien
WEBSITE https://www.io-warnemuende.de/ projekt/356/otc-data2model-e.html
Methodenentwicklung zur Umweltüberwachung aquatischer Lebensräume mittels eDNA
Neue Methoden, um das Leben in Gewässern mithilfe von Umwelt-DNA (eDNA) zu überwachen, werden im Projekt entwickelt. Dabei analysiert man winzige Spuren von Erbmaterial im Wasser und wertet diese mit moderner Computertechnik und künstlicher Intelligenz aus. So sollen Verschmutzungen oder andere Veränderungen früh erkannt werden. Ziel ist ein leicht anwendbares Werkzeug mit klaren Standards, das auch Startups nutzen können und ab 2027 von Behörden getestet wird.

Messung der Temperaturdynamik im Gotlandbecken über fünf Tage mit hoher zeitlicher Auflösung. Welche Kombination von Instrumenten reicht aus, um diese Dynamik aufzulösen? Die weißen Linien stellen Isopyknalen dar. © Prien, IOW
LAUFZEIT
11/2024 – 10/2027
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Prof. Dr. Matthias Labrenz
WEBSITE https://www.io-warnemuende.de/ project/358/otc-genomics2.htmll-e.html
Doktorand Conor Glackin bei der Wasserprobenahme am Ostseestrand © Nietz, IOW

Diversität, Fachkräftegewinnung und Nachwuchsarbeit in Ocean Technology
PromOcean verknüpft Fachkräftegewinnung und Chancengerechtigkeit im maritimen Bereich am Ocean Technology Campus Rostock. Es setzt auf innovative Formate wie Camps, Summer Schools und MentoringProgramme, um Nachwuchs über alle Bildungswege, Nationalitäten und Geschlechter zu begeistern. Ziel ist es, strukturelle Barrieren abzubauen, den internationalen Campus zu stärken und insbesondere weibliche sowie internationale Talente zu fördern.
LAUFZEIT
10/2024 – 09/2027
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Zusammenarbeit an Deck macht Spaß © Kastell, IOW
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Dr. Regine Labrenz
WEBSITE
https://www.oceantechnologycampus.com/ projekte/otc-promocean
Smarte Marine-Daten-Analyse in Real Time
Im Projekt OTC-SMART wird eine KI-gestützte Assistenzsoftware entwickelt, die autonome hydroakustische Sensorplattformen in Echtzeit steuert und Daten auswertet. So lässt sich der Meeresboden großflächig und kosteneffizient erfassen. Das System verbessert direkt im Feldeinsatz die Datenqualität. Ab 2027 soll es auf unbemannten Fahrzeugen zum Einsatz kommen.
LAUFZEIT
01/2025 – 12/2027
FÖRDERUNG
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
PROJEKTLEITUNG AM IOW
Dr. Svenja Papenmeier
WEBSITE
https://www.io-warnemuende.de/ project/354/otc-smart.html


DR. VOLKER MOHRHOLZ, PROF. DR. HANS BURCHARD
Stellvertretende Leitung der Sektion „Physikalische Ozeanographie und Messtechnik“
Im Juni übernahm Dr. Volker Mohrholz, Experte für Küsten- und Ozeanbeobachtung, die stellvertretende Leitung der Sektion „Physikalische Ozeanographie und Messtechnik“. Sein Vorgänger Prof. Dr. Hans Burchard gab die stellvertretende Leitung der Sektion ab, um sich verstärkt der Forschung in seiner Arbeitsgruppe widmen zu können.


Der Wissenschaftliche Rat (WR) berät Direktor und Kuratorium in wichtigen wissenschaftlichen Angelegenheiten – etwa bei Berufungen von Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats oder der Erstellung des Forschungsprogramms. Dem Gremium gehören die Sektionsleiter:innen, ihre Stellvertretungen sowie vier gewählte wissenschaftliche Mitarbeitende aus den Sektionen an. 2024 wurden Dr. Isabell Klawonn, Dr. Henry Bittig, Dr. Jacob Geersen und Dr. Florian Börgel für drei Jahre von den wissenschaftlichen Beschäftigten gewählt.

DR. HENRY BITTIG
Sektion Meereschemie (Sprecher des Wiss. Rates)


DR. ISABELL KLAWONN
Sektion
Biologische Meereskunde

© Beck, IOW

DR. FLORIAN BÖRGEL

Sektion Physikalische Ozeanographie & Messtechnik
© Amm, IOW © Jessin, LOV

DR. JACOB GEERSEN
Sektion
Marine Geologie

© Beck, IOW
Das neue IOW-Forschungsprogramm 2024 – 2033 „Perspektiven der Küstenmeere“ gliedert sich in drei Forschungsbereiche (vgl. Kapitel Forschungs-Highlights). Sie stärken die interdisziplinäre und sektionenübergreifende wissenschaftliche Zusammenarbeit. Im Oktober wurden die Sprecher:innen durch die IOW-Wissenschaftler:innen gewählt. Wir freuen uns, dass wir sechs Personen für diese Rollen gewinnen konnten.
FORSCHUNGSBEREICH 1: SKALEN- UND SYSTEMÜBERGREIFENDE SCHLÜSSELPROZESSE

DR. NATALIE LOICK-WILDE
Sektion Biologische Meereskunde

DR. VOLKER MOHRHOLZ
Sektion Physikalische Ozeanographie & Messtechnik
FORSCHUNGSBEREICH 3: NEUE TECHNOLOGIEN

DR. BRONWYN CAHILL
Forschungseinheit
Meeresbeobachtung

DR. CHRISTIANE HASSENRÜCK
Sektion Biologische Meereskunde
FORSCHUNGSBEREICH 2: KÜSTENMEERE IM WANDEL

DR. JÉRÔME KAISER
Sektion Marine Geologie
DR. HELENA OSTERHOLZ
Sektion Meereschemie
PROF. DR. KATJA FENNEL
Beiratsvorsitz
Prof. Dr. Katja Fennel von der Dalhousie University, Halifax (Kanada) ist seit Beginn 2024 neue Vorsitzende des derzeit neunköpfigen Wissenschaftlichen Beirats am IOW. Die renommierte Ozeanografin bringt internationale Expertise ein und unterstützt das Institut strategisch bei der Weiterentwicklung seiner Forschung.
© Fennel


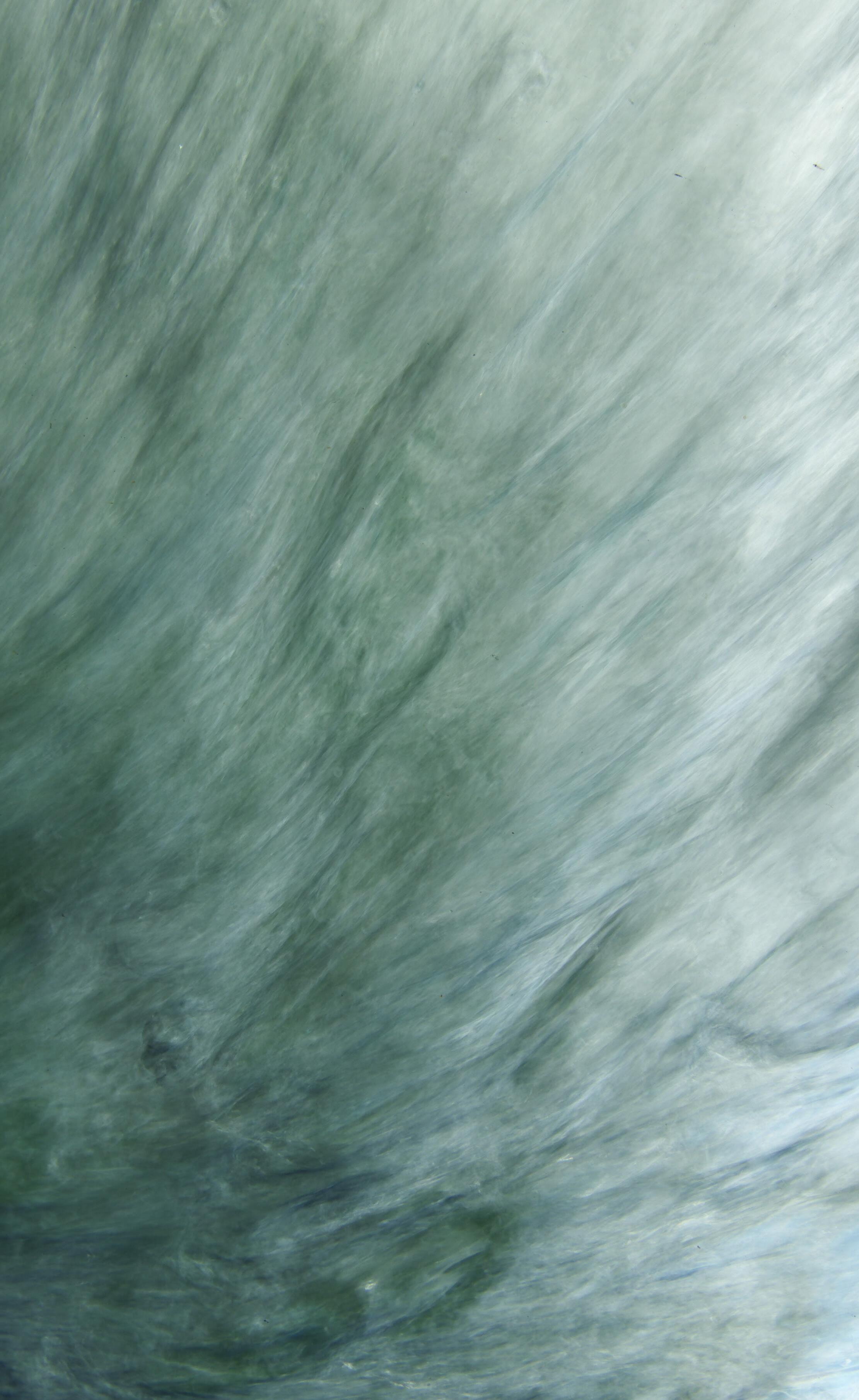



DES SCIENTIFIC COMMITTEE ON OCEANIC RESEARCH (SCOR)
Seit Anfang 2024 ist das Zukunftsforum Ozeanographie (ZFO) offizieller deutscher Landesausschuss des Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR), einem internationalen Netzwerk für Ozeanforschung. Als Vorstandssprecher des ZFO übernimmt Prof. Dr. Hans Burchard zugleich den Vorsitz. Der Ausschuss bewertet SCOR-Anträge aus aller Welt und gibt Förderempfehlungen.
LINK
https://www.deutsche-meeresforschung.de/ das-zukunftsforum-ozean-waehlt-einen-neuen-sprecher/

(im Ruhestand) wurde 2024 für seine führende Rolle bei der Entwicklung des internationalen Meerwasserstandards TEOS-10 mit dem renommierten Gibbs Award der International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS) ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt seinen maßgeblichen Beitrag zur thermodynamischen Beschreibung von Meerwasser.
https://www.io-warnemuende.de/short-news-archivdetails/items/gibbs-award-2024-fuer-rainer-feistel.
Für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der physikalischen Ozeanographie und der Modellierung sowie der Berechnung von Auswirkungen des Klimawandels auf den Schutz der Ostsee wurde Prof. Dr. Markus Meier mit der renommierten Professor-KazimierzDemel-Medaille der Polnischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt damit sein langjähriges wis senschaftliches Engagement.
LINK
https://www.io-warnemuen de.de/short-news-archivdetails/items/markusmeier-erhaelt-kazimierz-demelmedaille.html
Prof. Mariusz Sapota (Institute of Oceanography at the University of Gdansk), Prof. Dr. Markus Meier (IOW) und Dr. Piotr Margoński (National Marine Fisheries Research Institute) bei der Preisverleihung in Gdynia, Polen (v.r.n.l.). © Meier



Ins DFG-Fachkollegium Geologie/Paläontologie wurde Prof. Dr. Helge Arz gewählt. Dort begutachtet er für vier Jahre Förderanträge und trägt zur Qualitätssicherung im DFG-Bewertungsverfahren bei – ein Engagement, das einen wichtigen Beitrag für die wissenschaftliche Gemeinschaft darstellt.
LINK
https://www.io-warnemuende.de/short-news-archive-details/items/helge-arz-in-dfg-fachkollegium-gewaehlt.html
ANERKENNUNGSPREIS BEIM NORDDEUTSCHEN WISSENSCHAFTSPREIS

Das SEASCAPES-Team bei der Preisverleihung © SEASCAPES
INTERNATIONALE EHRENÄMTER FÜR SPURENGASFORSCHUNG
Seit Oktober 2024 vertritt Prof. Dr. Gregor Rehder die Spurengaskom ponente in zwei internationalen Gremien: Als Vorsitzender der Ocean Marine Station Assembly im Integrated Carbon Observation System (ICOS) koordiniert er Qualitätsstandards und den fachlichen Austausch. Im Steer ing Board des International Ocean Carbon Coordination Project (IOCCP) setzt er sich dafür ein, neben CO₂ auch N₂O und CH₄ weltweit als Messstandard zu etablieren.
LINK
https://www.icos-cp.eu
Für das Projekt SEASCAPES erhielt das IOW gemeinsam mit Partnern einen mit 10.000 Euro dotierten Anerkennungspreis beim Norddeutschen Wissenschaftspreis 2024. Das Projektteam aus MecklenburgVorpommern und Schleswig-Holstein wurde damit für die Forschung zu steinzeitlichen Unterwasserstrukturen in der westlichen Ostsee ausgezeichnet.
LINK
https://www.io-warnemuende.de/short-news-archiv-details/items/ norddeutscher-wissenschaftspreis2024-anerkennung-fuer-seascapes. html

Prof. Dr. Gregor Rehder © Rehder
https://www.ioccp.org
Der Direktor des IOW wurde im Berichtsjahr gleich in vier Beiräte bzw. Vorstände berufen.
VORSITZ DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS
WUPPERTAL-INSTITUT
Prof. Dr. Oliver Zielinski wurde 2024 zum Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie berufen. Der Beirat begleitet die strategische Forschungsausrichtung des renommierten Nachhaltigkeitsinstituts.
LINK
https://wupperinst.org/en/the-institute/ organisation/international-advisory-board
FÜHRUNGSKRÄFTE


2024 wurde Prof. Dr. Oliver Zielinski in den Beirat der Leibniz Akademie für Führungskräfte berufen. Die Akademie unterstützt Führungskräfte an Leibniz-Instituten durch praxisnahe Programme und strategische Kompetenzentwicklung.
LINK
https://www.leibniz-fuehrungskraefte.de/fileadmin/user_upload/Akademie/3_Programme/Beirat_Leibniz-Akademie_f%C3%BCr_F%C3%BChrungskr%C3%A4fte_2025.pdf
BALTIC EARTH SENIOR ADVISORY BOARD (BESAB)
Als neues Mitglied des Baltic Earth Senior Advisory Board (BESAB) berät Prof. Dr. Oliver Zielinski das internationale Forschungsnetzwerk zu Klimaprozessen im Ostseeraum. Baltic Earth fördert interdisziplinäre Forschung zur nachhaltigen Entwicklung der Region.
LINK
https://baltic.earth/organisation/advisory_ board
ERWEITERTER VORSTAND DES KONSORTIUMS DEUTSCHE MEERESFORSCHUNG
Prof. Dr. Oliver Zielinski gehört seit 2024 dem erweiterten Vorstand des Konsortiums Deutsche Meeresforschung (KDM) an. Die KDM bündelt die meereswissenschaftliche Expertise Deutschlands und koordiniert Forschungsstrategien auf nationaler Ebene.
LINK
https://www.deutsche-meeresforschung.de/ neuer-vorstand-von-kdm-nimmt-seine-arbeitauf/

Wissenschaft ist gelebte Kooperation mit nationalen und internationalen Partner:innen und Netzwerken. Das IOW ist Mitglied in nationalen Netzwerken. Hervorzuheben sind die Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM) und das Konsortium Deutsche Meeresforschung (KDM). International arbeitet das IOW im Ostseeraum unter dem Dach des Baltic Earth Netzwerks, einem Netzwerk erdsystemwissenschaftlicher Institute in den Anrainerstaaten der Ostsee. Darüber hinaus unterhält es zahlreiche strukturelle Kollaborationen mit meereswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und Hochschulen im Ausland (z. B. Dalhousie University, Halifax, Kanada). Das IOW baut seine Zusammenarbeit mit strategisch wichtigen Partnern kontinuierlich aus.
Im Januar 2024 unterzeichneten das IOW, die Universität Rostock und die Dalhousie University in Halifax, Kanada, ein Memorandum of Understanding. Die bereits bestehenden engen Kontakte werden dadurch vertieft. Ziel ist es, möglichst umfassende akademische Beziehungen zu entfalten und mit der gemeinsamen Vereinbarung einen Rahmen für den Ausbau weiterer gemeinsamer Aktivitäten zwischen den Einrichtungen zu schaffen. Ein Schwerpunkt liegt auf den Gebieten der Meereswissenschaften und Meerestechnik. Als Auftakt fand im Februar 2024 ein erster trilateraler Online-Workshop statt.


Heide Schulz-Vogt, Stellvertretende Direktorin des IOW, Matthew Hebb, Vizepräsident der Dalhousie University in Halifax, Kanada, sowie Elizabeth Prommer, Rektorin der Universität Rostock, bei der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding. © Universität Rostock

Oliver Zielinski, Direktor des IOW unterzeichnete im April 2024 mit der litauischen Universität Klaipėda ein Memorandum of Understanding. Damit eröffnen sich für die bereits bestehende Zusammenarbeit weitere Optionen. Im Fokus stehen der Ausbau der gemeinsamen Küstenmeerforschung u. a. im Bereich der Fernerkundung, die möglichst effiziente Nutzung von vorhandener Forschungsinfrastruktur und innovativer Meeresforschungstechnologie. Ein wichtiges, bereits bestehendes gemeinsames Forschungsfeld ist eine vom IOW in Klaipėda etablierte Forschungsgruppe zum Thema Küsten- und Meeresmanagement.
Oliver Zielinski, Direktor des IOW (l.) und Artūras Razbadauskas (r.), Rektor der Universität Klaipeda, bei der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding in Klaipeda. © IOW
Mit der Universität Greifswald gibt es eine langjährige Zusammenarbeit u.a. durch gemeinsame Berufungen. Daneben bestehen enge projektbasierte Kollaborationen. Im November kam eine Delegation von Wissenschaftler:innen und unterschiedlicher Fachbereiche der Universität Greifswald ans IOW zu einem Kooperationsworkshop. Die Zusammenarbeit soll in verschiedenen Bereichen, etwa der marinen Mikrobiologie intensiviert werden.

Die Kolleginnen und Kollegen der Universität Greifswald zu Besuch am IOW im Rahmen eines Kooperationsworkshops. © Premke-Kraus, IOW

Transfer heißt für das IOW, wissenschaftsbasierte Fakten für Gesellschaft, Politik und Praxis aufzubereiten und zu kommunizieren. Das Kapitel zeigt anhand von ausgewählten Beispielen, wie Forschungsergebnisse in den Dialog mit verschiedenen Zielgruppen gelangen – von Veranstaltungen wie Open Ship, den Warnemünder Abenden oder der Hanse Sail bis hin zu Aktionstagen. Junge Menschen erhalten über Camps und Freiwilligendienste Einblicke in die Meeresforschung. Patente und Förderanträge für Ausgründungen zeigen, dass das IOW seine Innovationskraft verstärkt und den Austausch mit Partnern aus der Wirtschaft ausbaut. So wird Wissen greifbar, verständlich und wirksam.
Open Ship 2024
Zum doppelten „Open Ship“ lud das IOW im Mai ein. Die beiden Forschungsschiffe MARIA S. MERIAN und ELISABETH MANN BORGESE lagen in Warnemünde, bereit für neugierige Besucher:innen. Brücke, Labore und Wohnbereiche konnten auf spannenden Rundgängen entdeckt werden. An zehn Infoständen präsentierten Forschende Themen wie Klimawandel in der Ostsee, Plastikmüll, Küstenschutz, Sedimentforschung, Artenvielfalt, Schadstoffe, Sauerstoffmangel, moderne Messtechnik, Digitalisierung der Meeresforschung und nachhaltige Schifffahrt. Ergänzend boten neun Vorträge faszinierende Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten. Mehrere hundert Gäste nutzten die seltene Gelegenheit, beide Schiffe gleichzeitig im Heimathafen zu erleben. So wurde das Meer vor unserer Haustür für Groß und Klein greifbar und Wissenschaft erlebbar gemacht.
ANSPRECHPERSON
Dr. Matthias Premke-Kraus
Lange Nacht der Wissenschaften 2024
Großen Zulauf erlebte das IOW bei der Langen Nacht der Wissenschaften im April. Gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn (IAP) präsentierte sich das Institut im Technikum des Leibniz-Instituts für Katalyse (LIKAT). Am Stand gab es viel Technik zum Ausprobieren: Strömungen am Touch-Tisch simulieren, die Geräte-Boje der Flachwasserforschung begutachten, eine Drohne bestaunen oder das Ostseemodell entdecken. Auch das kleine
Wissenschaftler des IOW präsentieren Meerestechnik © IOW

Demonstration von Messgeräten an Bord des Forschungsschiffs ELISABETH MANN BORGESE beim Open Ship 2024 © Beck, IOW
Forschungsboot „Klaashahn“ vor der Halle zog viele Blicke auf sich. Die Resonanz war durchweg positiv und die gemeinsame Präsentation dreier Leibniz-Institute wurde zum idealen Ort für spannende Gespräche mit einem neugierigen Publikum.
ANSPRECHPERSON

Das IOW auf der Hanse-Sail
Im August präsentierte sich das IOW auf dem Science @Sail-Campus im Rostocker Stadthafen. Am Infostand konnten Besucher:innen live Daten aus der Ostsee und der Warnow abrufen und dabei mit Forschenden ins Gespräch kommen. Gezeigt wurden unter anderem Messgeräte des Ostseemonitorings und die vom IOW entwickelte „Warnow-Sonde“. Mit Vorträgen über ungewöhnlich warme Bodentemperaturen der Ostsee sowie der Teilnahme an Diskussionsrunden wie „Zukunft im Fluss?!“ brachte das IOW aktuelle Forschungsthemen in die öffentliche Debatte ein. Erlebbare Wissenschaft präsentierte sich so – direkt am Wasser und mitten im Hanse-Sail-Trubel.
ANSPRECHPERSON
Dr. Sven Hille

Bettina Martin, Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten im Gespräch am Stand des IOW © Dahlhaus, INP

Das IOW-Team konnte sich am Infostand über interessierten Zuspruch der Science@Sail-Besucher:innen freuen. © Labrenz, IOW
Einheitsfeier in Schwerin
Anlässlich der bundesweiten Feier zum „Tag der Deutschen Einheit“ präsentierte sich das IOW im Oktober auf der Mecklenburg-Vorpommern-Meile am Schweriner Pfaffenteich. Drei Tage lang betreuten Kolleg:innen den Stand gemeinsam mit weiteren Leibniz-Instituten aus dem Bundesland. Der Touch-Tisch, an dem Phänomene der Ostsee spielerisch erlebt werden können, zog viele Besucher:innen an und bot einen idealen Gesprächseinstieg. Zahlreiche Interessierte informierten sich über aktuelle IOW-Forschung, darunter die Erwärmung der Ostsee durch den Klimawandel und die Belastung durch Nährstoffe. Auch Wissenschaftsministerin Bettina Martin aus Mecklenburg-Vorpommern nutzte die Gelegenheit, um mehr über die Arbeit des Instituts zu erfahren.
ANSPRECHPERSON
Dr. Matthias Premke-Kraus
Warnemünder Abende 2024
Die „Warnemünder Abende“ sind eine Vortragsreihe des IOW, die aktuelle Forschungsthemen für ein breites Publikum öffnet. Nach fünfjähriger Pause wurden sie 2024 mit großem Erfolg neu aufgelegt. Rund 500 Gäste nahmen insgesamt teil, viele von ihnen mehrmals. Im voll besetzten IOW-Saal standen Themen im Mittelpunkt, die die Ostsee und darüber hinaus betreffen: die Geschichte der Meeresforschung in Warnemünde, die Verdunkelung der Meere, der Klimawandel und seine Folgen, Mikroplastik, Vibrionen und Weltkriegsmunition im Meer sowie acht Millionen Jahre Klimageschichte, erschlossen durch Tiefbohrungen im Südpazifik. Damit wurde Wissen greifbar gemacht und Neugier auf die Forschung vor unserer Haustür geweckt.
ANSPRECHPERSON
Dr. Matthias Premke-Kraus

Der voll besetzte Saal des IOW bei einem der Vorträge an den Warnemünder Abenden © Premke-Kraus, IOW
Aktionstag „StrandVision“ am IOW
Die Expedition „Save the Baltic Sea“ machte im April 2024 Station am IOW. Eine Gruppe von zehn litauischen Umweltaktivist:innen umrundeten zu Fuß die gesamte Ostsee, um auf drängende Probleme wie Klimawandel, Eutrophierung, Munitionsaltlasten und Mikroplastik aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern und der Küsten Union Deutschland e.V. (EUCC-D) lud das IOW aus diesem Anlass zum Aktionstag „StrandVision“ ein. Rund 90 Schüler:innen, Bürger:innen und Fachleute aus Tourismuswirtschaft, Verwaltung sowie Wissenschaft diskutierten in Workshops Klimaanpassungsstrategien für Küstenregionen und beteiligten sich an einer Strandmüll-Erfassung in
Sichtung der ca. 1.000 gefundenen Teile Plastik im Saal des IOW © Beck, IOW
Warnemünde. Trotz Regen sammelten 40 Freiwillige in nur 45 Minuten über 1.000 Teile Plastik-Abfall. So verband die Veranstaltung Wissenschaft, Engagement und Praxis.
ANSPRECHPERSON
Dr. Sven Hille

Erfinderinnen-Camp 2024
Zwölf Schülerinnen aus Rostock, Berlin und Hannover tauchten im Juli 2024 in die Welt der Meeresforschung ein. Im Erfinderinnen-Camp, Teil des Ocean Technology Campus (OTC)-Projekts „Ocean Gender“, erlebten sie, wie Hightech und Meeresschutz zusammengehen. Sie untersuchten Salzgehalt, Wind und Strömungen, entdeckten Artenvielfalt im Kescher, steuerten einen Unterwasserroboter und bauten eine eigene Messstation. Dabei lernten sie aktuelle Forschungsfragen des OTC Rostock kennen und die Herausforderungen der Arbeit unter Wasser. Das Camp weckte bei allen Teilnehmerinnen spürbar Neugier für den marinen Bereich. So wurde Zukunftsorientierung mit Forschergeist verbunden und Wissenschaft auf besondere Weise erlebbar gemacht.
ANSPRECHPERSON
Dr. Kirstin Kastell
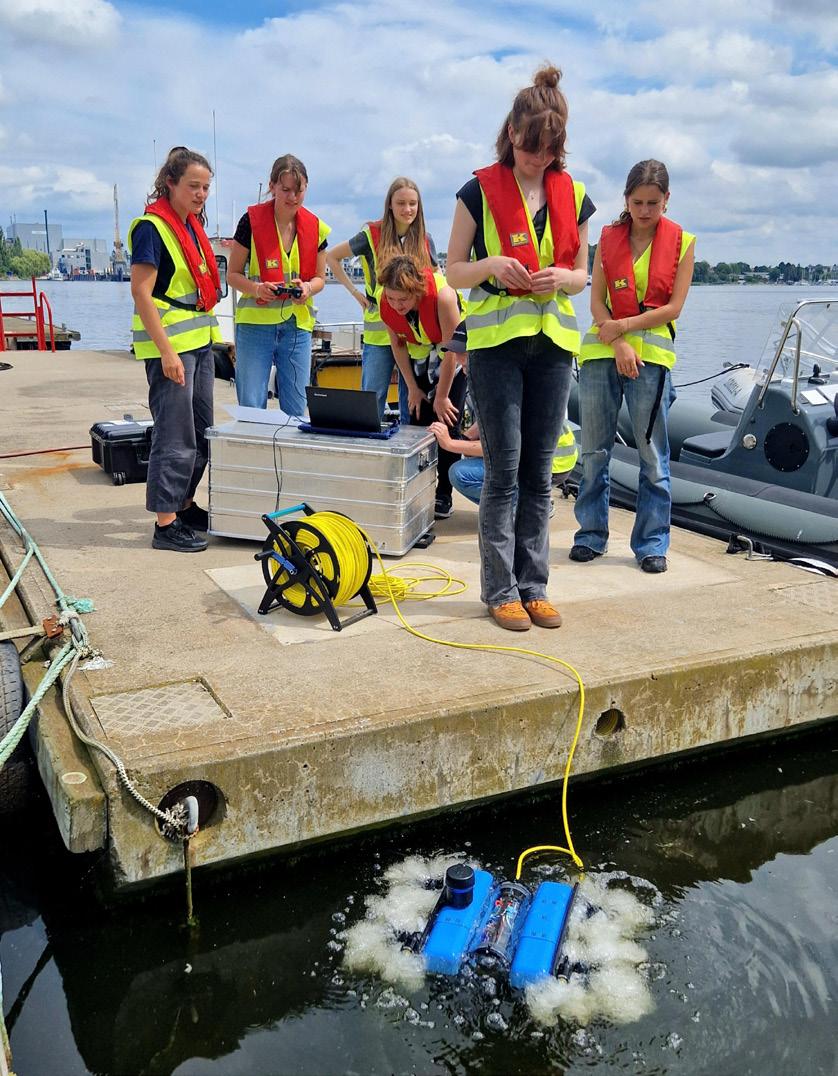
Die Schülerinnen beim Steuern eines Unterwasserroboters © Kastell, IOW
Freiwillige und Azubis 2024/25
Seit vielen Jahren nimmt das IOW junge Menschen im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) sowie im Freiwilligen Sozialen Jahr in Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit (FJN) auf. Im September 2024 starteten sieben neue Freiwillige und Auszubildende am Institut. Sie arbeiten in fast allen Abteilungen mit, von Biologischer Meereskunde über Meereschemie bis zu Meeresgeologie, Physikalische Ozeanographie und Wissenschaftsmanagement. Durch ihren Dienst erhalten sie Einblicke
in wissenschaftliche Praxis und gewinnen wertvolle Orientierung für ihre Studien- oder Berufsentscheidung. Zugleich profitiert das IOW vom persönlichen Einsatz: Die Freiwilligen unterstützen Projekte, bringen frische Perspektiven ein und helfen mit, Forschung erlebbar zu machen – eine echte Win-Win-Situation.
ANSPRECHPERSON
Dr. Sven Hille

Die Freiwilligen des Jahrgangs 2024/25 © Labrenz, IOW
Neue Patente für das IOW
Im Winter 2024 konnte das IOW gleich zwei Patenterfolge verzeichnen. Ende Februar wurde ein Patent zur SPR-Sensoreinheit erteilt, mit dem sich Brechungsindex und Dichte von Probenmedien erfassen lassen. Im März folgte das Patent zur Messung von Messgrößen unter Wasser, das neue Wege für präzise Untersuchungen im marinen Umfeld eröffnet. Zusätzlich begleitete das IOW einen Förderantrag im Rahmen des EXIST-Forschungstransfers. Diese Entwicklungen vertiefen die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.
ANSPRECHPERSON
Dr. Regine Labrenz
Bewertungsrahmen für marine CO₂-Entnahme
Im Rahmen der Mission Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur Dekarbonisierung (CDRmare) der Deutschen Allianz Meeresforschung wurde unter Beteiligung von Wissenschaftler:innen aus dem IOW ein Bewertungsrahmen für marine CO₂-Entnahmemethoden entwickelt. Dieser integriert technische, ökologische, rechtliche, wirtschaftliche, politische, ethische und Gerechtigkeitsaspekte. Während bisherige Bewertungsansätze oft nur einzelne Aspekte (z. B. Biodiversität) fokussieren oder hauptsächlich die technische Machbarkeit betrachten, setzt der neu entwickelte Bewertungsrahmen auf Gleichwertigkeit der Dimensionen – auch um Gerechtigkeits- und ethische Fragestellungen zu berücksichtigen. Somit liefert der Bewertungsrahmen eine Grundlage für die Abschätzung, welche marine CO₂-Entnahmemethode technisch realisierbar sind und unter welchen Bedingungen sie gesellschaftlich erwünscht sein könnten. Das ist ein wichtiger Beitrag zur fundierten Entscheidungsfindung im Klimaschutz.
ANSPRECHPERSON
Prof. Dr. Gregor Rehder
WEBSITE
https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/61540/1/ ASMASYS_SynthesisReport_Juli24deutsch.pdf

Die Titelseite der Veröffentlichung
Climate Change in the Baltic Sea 2024 Fact Sheet
Wie verändert der Klimawandel die Ostsee? Antworten gibt die aktualisierte Faktenübersicht „Climate Change in the Baltic Sea 2024 Fact Sheet“, die Baltic Earth und HELCOM veröffentlicht haben. Rund 90 Forschende, darunter auch IOW-Expert:innen, haben daran mitgearbeitet. Das Faktenblatt bündelt neueste Erkenntnisse zu 38 Parametern – von Temperatur, Meeresspiegel und Nährstoffkreisläufen bis zu Biodiversität, Ökosystemleistungen und menschlichen Aktivitäten. Neu aufgenommen wurden u. a. Versauerung, schädliche Algenblüten und Meeresmüll. Deutlich wird: Die Ostsee erwärmt sich, der Meeresspiegel steigt, Winter ohne Eis werden wahrscheinlicher – mit weitreichenden Folgen für Natur und Küstenbewohner:innen.
ANSPRECHPERSON
Prof. Dr. Markus Meier
WEBSITE
https://helcom.fi/wp-content/uploads/2024/10/ Baltic-Sea-Climate-Change-Fact-Sheet_2024.pdf
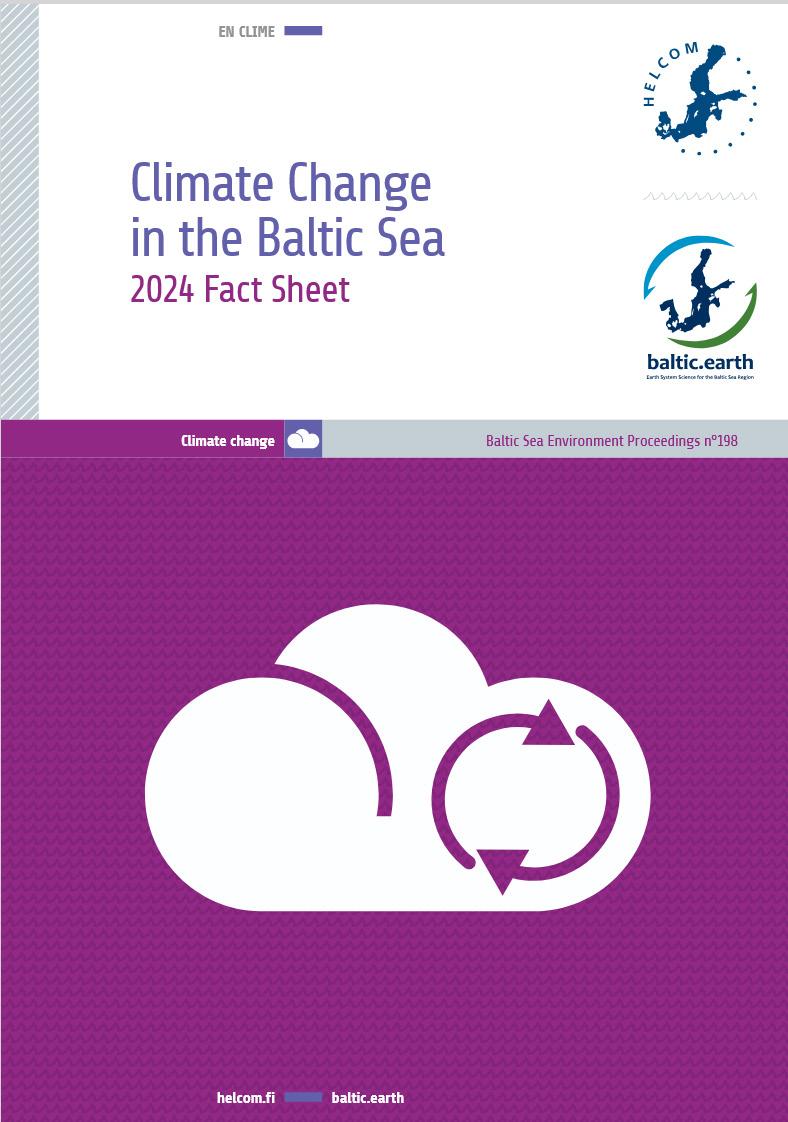
Die Titelseite der Veröffentlichung


SEKTION E
https://zenodo.org/ records/10794362
Das IOW ist Mitglied der Sektion E (Umweltwissenschaften) der Leibniz-Gemeinschaft und engagiert sich in vielen Gremien, Initiativen und gemeinsamen Veranstaltungen mit Beiträgen oder in koordinierender Rolle. Für das IOW ist die Vernetzung in der Gemeinschaft von strategischer Bedeutung. Im Folgenden werden ausgewählte Beispiele vorgestellt.
Der rasante Verlust an Biodiversität und anhaltender Klimawandel sind auch Folge intensiver Landwirtschaft. Gleichzeitig gefährden sie die Landwirtschaft und eine sichere Ernährung. Das Leibniz-Lab „Systemische Nachhaltigkeit“ führt zu dieser elementaren Herausforderung maßgebliches Wissen in Wissenschaft und Gesellschaft zusammen, um die Entwicklung und Umsetzung systemischer Lösungen voranzutreiben. Das Leibniz-Lab trägt diesem Bedarf gezielt Rechnung, indem es die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Handlungsfeld Biodiversität, Klima, Landwirtschaft und Ernährung systematisch integriert und Innovationen identifiziert. Durch die Bündelung der Expertise von 41 Forschungseinrichtungen und 11 Forschungsclustern der Leibniz-Gemeinschaft, zudem auch das IOW als Partner beiträgt, entsteht ein zentraler Hub für die Bündelung von Wissen und Beratung im Handlungsfeld.


Die Teilnehmenden des Strategieworkshops „Küste & Meer bei Leibniz“ © Premke-Kraus, IOW
GASTGEBER DES STRATEGIEWORKSHOPS
„KÜSTE
In der Leibniz-Gemeinschaft gibt es mehrere Institute bzw. Forschungsgruppen, die sich mit Themen der Meeres- und Küstenforschung beschäftigen. Im Oktober 2024 lud das IOW diese erstmals ein zum StrategieWorkshop „Küste & Meer bei Leibniz“. Der Einladung folgten Vertreter:innen von Senckenberg am Meer der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN), des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT), des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (TROPOS) und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Ziel der gemeinsamen Initiative ist eine stärkere Vernetzung der Leibniz-Institute mit Forschungsprofil in der Meeres- und Küstenforschung bspw. zu strategischen und fachlichen Themen.
IOW-EXPERTISE IN „10 MUST-KNOWS AUS DER BIODIVERSITÄTSFORSCHUNG 2024“ DES LEIBNIZ-FORSCHUNGSNETZWERKS „BIODIVERSITÄT“
Das IOW ist Mitglied in den Leibniz-Forschungsnetzwerken „Biodiversität“, „Earth & Society“ und „Mathematische Modellierung und Simulation“. Im März 2024 hat das Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität die „10 MustKnows aus der Biodiversitätsforschung 2024“ herausgegeben. Es ist ein Politikberatungspapier mit evidenzbasierten Handlungsempfehlungen als Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft. Christiane Hassenrück und Klaus Jürgens aus dem IOW haben sich daran in zwei Handlungsempfehlungen beteiligt.
WEBSITE
https://zenodo.org/records/10794362

Titelseite der Veröffentlichung © Alexandra
Der Arbeitskreis Chancengleichheit und Diversität (AKCD) der Leibniz-Gemeinschaft vereint die Gleichstellungsbeauftragten der Einrichtungen der LeibnizGemeinschaft sowie die für Diversität zuständigen Personen. Hendrikje Wehnert aus dem IOW ist seit 2020 die gewählte Sprecherin für Diversität des AKCD.
Beim Vernetzungstreffen der mit Diversität beschäftigen Personen der Leibniz-Einrichtungen © Herbot-von-Loeper, Leibniz-Gemeinschaft


des AK Kommunikation zu Besuch im IOW © Premke-Kraus, IOW
KOMMUNIKATION
Der AK Kommunikation dient dem Erfahrungsaustausch zu Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Er entwickelt Konzepte sowie Maßnahmen für die interne und externe Kommunikation der Leibniz-Gemeinschaft. Im Juni 2024 trafen sich auf Einladung des IOW rund 60 Teilnehmende aus den Instituten der Leibniz-Gemeinschaft zum Frühjahrstreffen in Warnemünde. Themen wie Chancen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz bzw. der Austausch zu neuen Entwicklungen der Medienarbeit standen im Vordergrund.
ARBEITSKREIS
Ziel des Leibniz-Arbeitskreis Nachhaltigkeitsmanagement ist es, durch die Bereitstellung von Informationen und durch Erfahrungsaustausch die Vernetzung von Nachhaltigkeitsakteur:innen innerhalb der Leibniz-Gemein schaft zu fördern und die Mitglieder dabei zu unterstützen, ein Nachhaltigkeitsmanagement zu entwickeln und zu implementieren. Matthias Premke-Kraus ist Mitglied im Sprecher:innenkreis des Arbeitskreises. Am IOW selbst wurden im Jahr 2024 erstmals zwei E-Autos sowie ein Lastenrad für den Fuhrpark des IOW angeschafft.
Das Lastenrad des IOW © Premke-Kraus, IOW


Das IOW fördert Chancengleichheit – also tatsächlich gleiche Erfolgschancen für alle Mitarbeitenden. Einen Schwerpunkt bildet die Gleichstellung der Geschlechter bspw. durch Frauenförderung. Ziel ist unter anderem die Erhöhung des Frauenanteils in allen Positionen/Gehaltsstufen, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind und des Anteils von Frauen in Führungspositionen. Darüber hinaus war das IOW im Berichtsjahr in den Feldern Förderung von Graduierten und internationalen Beschäftigten tätig. In der LeibnizGemeinschaft ist das IOW im Arbeitskreis Chancengleichheit und Diversität engagiert.

ANSPRECHPERSONEN
Gleichstellungsbeauftragte
Dr. Marion Kanwischer Dr. Svenja Papenmeier
Diversitätsbeauftragte Hendrikje Wehnert
Die Diversitätsbeauftragte des IOW ist erneut zur Sprecherin für Diversität der Leibniz-Gemeinschaft gewählt worden
Im November 2024 wurde Hendrikje Wehnert erneut zur Sprecherin für Diversität des Arbeitskreises Chancengleichheit und Diversität der Leibniz-Gemeinschaft gewählt. In dieser Funktion setzt sie sich dafür ein, die Rahmenbedingungen für gleiche Erfolgschancen in allen Leibniz-Einrichtungen weiter zu stärken und die Diversitätsarbeit innerhalb der Gemeinschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln.


Umsetzung der Gleichstellungsstandards der Leibniz-Gemeinschaft
Die Leibniz-Gemeinschaft hat Standards für die Gleichstellung von Mann und Frau festgelegt. Sie betreffen u. a. die Förderung von Frauen in Führungspositionen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie zur Verankerung von Gleichstellung als Leitprinzip. 2024 fragte die Leibniz-Gemeinschaft ihre 96 Mitgliedseinrichtungen zur Umsetzung der Standards an. Das IOW steht exemplarisch für das hohe Niveau in der Leibniz-Gemein-
Deutschkurse für internationale Mitarbeitende
Englisch ist die Sprache der Wissenschaft. Um sich jedoch auch an nicht-fachlichen Gesprächen beteiligen zu können, bietet das IOW kostenlose Deutschkurse für internationale Beschäftigte im IOW an. So können sie ihre Sprachkenntnisse am Arbeitsort erweitern und abteilungsübergreifend mit anderen internationalen Beschäftigten in Austausch kommen. Die Sprachkurse sind Teil der Willkommenskultur des IOW.

schaft. Überdurchschnittlich wurde die Verankerung von Gleichstellung und familienfreundlichen Regelungen bewertet. Beim Frauenanteil in Leitungsfunktionen sieht die Geschäftsstelle noch Entwicklungspotenzial. Das IOW möchte hier besser werden. Eine Maßnahme ist die Sichtbarmachung und Förderung der dritten Führungsebene (AG-Leitungen) ab dem Jahr 2025.
Postdocs im Programm „Führung entwickeln“
Eine leitende Wissenschaftlerin und ein leitender Wissenschaftler wurden 2024 vom IOW erfolgreich in das Programm „Führung entwickeln“ der LeibnizAkademie für Führungskräfte entsandt. Die Teilnahme fördert die Auseinandersetzung mit Führungsrollen in der Wissenschaft. Damit unterstützt das IOW gezielt die nächste Generation von Wissenschaftler:innen, schafft Perspektiven für zukünftige Leitungstätigkeiten und stärkt Diversität in Führungspositionen.
AUFTAKT FÜR DEN STB
Zu einem Kick-off trafen sich im Januar die Kolleg:innen, die zukünftig im neuen Forschungsschwerpunkt „Shallow Water Processes and Transitions to the Baltic Scale (STB)“, der seit 2023 umgesetzt wird, interdisziplinär zusammen arbeiten werden. Vorgestellt wurden die neuen Kolleg:innen, die Ziele und Arbeitspakete. Im Mittelpunkt standen das Kennenlernen untereinander und die wissenschaftlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Arbeitspakete für die kommenden Jahre.

ÜBERWÄLTIGENDE MEDIENRESONANZ
AUF PRESSEMITTEILUNG
METEOR-EXPETITION M200
Auf der Seereise erforschte das IOW mit Partnern aus Aarhus, Bremen und den USA erstmals detailliert, wie Mangan-, Stickstoff-, Kohlenstoff- und Jodkreisläufe in sauerstoffarmen Ostseebecken zusammenwirken. Neu waren hochauflösende Tiefenprofile und komplexe Inkubationsversuche an Bord.

Mitte Februar sorgte die Veröffentlichung der IOW-Pressemitteilung „Spuren der Eiszeitjäger in der Ostsee entdeckt“ über gut einen Monat hinweg – in Print, Online, Radio und TV – für eine sehr große internationale Sichtbarkeit des IOW und der beteiligten Partner. Rund 700 Medienbeiträge in 30 Ländern erschienen, darunter CNN, The Guardian, Science, New Scientist und La Stampa

LANGE NACHT DER
Bei der Langen Nacht der Wissenschaften im April präsentierte sich das IOW erstmals wieder auf dem Gelände des Campus-Süd in Rostock gemeinsam mit weiteren LeibnizInstituten. Am IOW-Stand im Technikum des Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT) lockten Modelle, Messgeräte und das Forschungsboot „Klaashahn“ zahlreiche Besucher:innen an und boten Raum für spannende Gespräche.
OPEN SHIP 2024
Im Mai lud das IOW gleich auf zwei Forschungsschiffe: die MARIA S. MERIAN und die ELISABETH MANN BORGESE. Mehrere hundert Gäste erkundeten Brücke, Labore und Kabinen. An zehn Infoständen und in neun Vorträgen zeigten Forschende Themen wie Klimawandel, Plastikmüll, Küstenschutz und nachhaltige Schifffahrt – Wissenschaft zum Anfassen für alle.

AKTIONSTAG „STRANDVISION“

Im April war die litauische Umweltinitiative “Save the Baltic Sea” am IOW zu Gast. Der Einladung zum Aktionstag „StrandVision“ folgten ca. 90 Personen. Ein wichtiger Programmpunkt war ein systematisches Strandmüll-Monitoring: Dabei wurden innerhalb einer Stunde 1.025 Müllteile gesammelt, fast die Hälfte davon stammte vom Strandtourismus.

BRIESE-PREIS FÜR
MEERESFORSCHUNG
Der BRIESE-Preis 2023 wurde im Mai 2024 an Dr. Hagen Buck-Wiese vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie Bremen verliehen. Die Jury würdigte, dass er erstmals nachgewiesen hat, wie Braunalgen langlebige Zuckerpolymere ausscheiden, die kaum abgebaut werden und als Kohlenstoffsenke im Meer wirken.

ROSTOCKER FIRMENLAUF
Zum wiederholten Mal beteiligte sich das IOW am Rostocker Firmenlauf. Die 3 Teams à 4 Läufer:innen wurden auf der 3,5 Kilometer langen Strecke von Kolleg:innen angefeuert.
SCIENCE@SAIL
Im August präsentierte sich das IOW auf dem Science@SailCampus zur Hanse Sail. Besucher:innen informierten sich am IOW-Stand über Forschungsthemen rund um die Ostsee. Unter dem Motto „Mit Wissenschaft Zukunft bewegen“ bot die Veranstaltung vielfältige Einblicke in aktuelle Meeresforschung.

DIE WARNEMÜNDER ABENDE
Nach einer Pause lud das IOW 2024 wieder zu den „Warnemünder Abenden“ ein – und rund 500 Gäste folgten der Einladung. Das etablierte Sommerformat bietet allgemeinverständliche Vorträge von Wissenschaftler:innen des IOW und lädt zum Austausch ein. Themen reichten von Klimawandel über Mikroplastik bis zu Tiefenbohrungen im Südpazifik.


ERFINDERINNEN-CAMP
Beim Erfinderinnen-Camp des Ocean Technology Campus im Juli tauchten zwölf MINT-begeisterte Schülerinnen in die Welt der Meeresforschung ein. In Experimenten, Workshops und Exkursionen steuerten sie Unterwasserroboter, bauten eigene Messstationen und erfuhren, wie Ozeantechnologie zum Meeresschutz beitragen kann.


NEUE FREIWILLIGE UND AZUBIS 2024/25
Seit vielen Jahren nimmt das IOW junge Menschen im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) sowie im Freiwilligen Jahr in Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit (FJN) auf. Im September 2024 starteten sechs Freiwillige und ein Auszubildender. Sie arbeiten in fast allen Abteilungen des IOW mit und bringen neue Perspektiven in den Forschungsalltag.

DAS IOW-LANGZEITBEOACHTUNGSPROGRAMM IN DER UN DEKADE
Das Langzeitmonitoring des IOW wurde im Berichtsjahr als Projekt der UN-Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung (2021 – 2030) ausgezeichnet. Dies ist eine Anerkennung der jahrzehntelangen Datenerhebung zum Zustand der Ostsee.

BUNDESWEITE FEIER ZUM TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT

© Ruickholdt, IOW
Auf der Feier in Schwerin präsentierte sich das IOW im Oktober am Gemeinschaftsstand der Leibniz-Institute. Drei Tage lang informierten Forschende über aktuelle Ostseeforschung. Der Touch-Tisch zu marinen Phänomenen zog viele Gäste an – auch Wissenschaftsministerin Bettina Martin.

© Premke-Kraus, IOW


Laufende Projekte
Seereisen
Veröffentlichungen
Gremien
Abschlüsse
Eckdaten
Organigramm
PROJEKTTITEL
SFB-TRR 181: Energietransfer in der Atmosphäre und im Ozean
LEGRA: Leben am Gradienten: Analyse des Einflusses von Umweltparametern auf Verbreitung, Diversität und Funktion benthischer Gemeinschaften und deren Lebensräume in der südlichen Ostsee und deren Implikationen bei der Umsetzung europäischer Meeresschutzrichtlinie
NOTION: Stickstoff-Fixierer strukturieren die Phytoplankton-Biodiversität im Ozean unter dem Klimawandel
FunPhy: Pilzinfektionen auf Phytoplankton – unbekannter Störfaktor für das Wachstum von Phytoplankton, sowie für Recycling- und Sedimentationsprozesse
MeN-ARP: Metabolismus des Stickstoffs in der Amazonasfahne und dem westlichen, tropischen Nordatlantik
CoTrans: KüNO Dachprojekt – Koordination und Transfer; Leitantrag; Vorhaben: Koordination
BluEs: Blue_Estuaries – Nachhaltige Ästuar-Entwicklung unter Klimawandel und anderen Stressoren; Leitantrag; Vorhaben: Funktionelle Diversität und Netzwerkanalyse Oder- und Elbästuar
CYA-REMo: Cyanobakterien im Klimawandel: Ein Blick in die Vergangenheit – Prognosen für die Zukunft
FINO II 2021-2024: Betrieb der FINO-Datenbank, ozeanographische Messungen Plattformen FINO2
NArrFix: Stickstoff und Argon Messungen zur Quantifizierung der Stickstofffixierung im Oberflächenwasser der Ostsee
CREATE: Konzepte zur Reduzierung der Auswirkungen anthropogener Drücke und Nutzen auf marine Ökosysteme und die Artenvielfalt; Vorhaben: Habitatvariabilität und Bioarchive als Maß für die Habitatintegrität am Beispiel des Reallabors Eckernförder Bucht
1 Deutsche Forschungsgemeinschaft
2 Bundesamt für Naturschutz
3 Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
4 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
5 Deutsche Allianz Meeresforschung
FÖRDERMITTELGEBER
DFG1
BfN2
ZEITRAUM
01.07.2016 –30.06.2024
01.01.2019 –31.12.2024
PROJEKTLEITUNG IM IOW
Hans Burchard
Michael L. Zettler
Fondation BNP Paribas
15.04.2020 –31.12.2025
DFG Emmy Noether Gruppe
01.08.2020 –31.07.2026
DFG 01.11.2024 –31.01.2024
BMFTR3 01.11.2020 –29.02.2024
BMFTR 01.11.2020 –29.02.2024
Maren Voß
Isabell Klawonn
Natalie Loick-Wilde
Ulrich Bathmann
Maren Voß
DFG
01.05.2021 –31.03.2025
BSH4 01.09.2021 –30.11.2024
DFG 01.10.2021 –30.09.2024
BMFTR/ DAM5 01.12.2021 –30.11.2024
Anke Kremp
Erik Stohr
Oliver Schmale
Svenja Papenmeier
PROJEKTTITEL
CONMAR: Konzepte zur Sanierung konventioneller Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee; Vorhaben: Modellierung der Verdriftung sprengstoff-typischer Verbindungen (STV) im Küstenozean und Untersuchungen von Räumungsstrategien
SESPOD: Spätmiozäne bis pleistozäne Dynamik des Oberflächenozeans im subantarktischen östlichen Südpazifik (IODP Expedition 383)
MicroMeth: Methanproduktion durch Mikrophytobenthos und dessen Beitrag am benthischen Methanfluss in der Küstenzone der Ostsee
FÖRDERMITTELGEBER
ZEITRAUM PROJEKTLEITUNG IM IOW
BMFTR/ DAM 01.12.2021 –30.11.2024
BaltChron: Platzierung der Ostsee Sedimentstratigraphie in einem präzisen chronologischen Rahmen: Verbesserte Paläoumweltstudien und 14C Reservoiralter Kalibrierung DFG
SALINE: Salzintrusion in der Tideweser als wissenschaftliche Unterstützung bei der geplanten Weseranpassung BAW6
FunSeq: Unbekannte mikrobielle Interaktionen: Die Auswirkungen von Pilzparasitismus auf PhytoplanktonBakterien-Interaktionen, aufgedeckt durch Genom- und Transkriptomprofiling
OCEAN CITIZEN: Marine forest coastal restoration: an underwater gardening socio-ecological plan
CofiEs: Filterfunktion des Küstenwasserbereichs bei Umweltstress
Hurri: Reaktionen eines Seesystems auf Hurrikan-Aktivitäten in der Karibik – Eine Kalibrationsstudie über Ostrakoden (Paläo-)biologie und Geochemie (Lago Enriquillo, Dominikanische Republik)
Pelagische Hab II: Innovatives Monitoring pelagischer Habitate zur Einschätzung ihrer Ökosystemfunktion im sich wandelnden Klima
ArKoBi: Untersuchungen zum Beitrag der Islandmuschel (Arctica islandica) zur Kohlenstoffspeicherung und Biodiversität in der Ostsee
DUAL-CLUMP: Das duale Karbonat-,clumped-isotopeThermometer. Differenzierung zwischen Temperatur, kinetischen und diaginetischen Effekten zur genauen Rekonstruktion von Erdoberflächentemperaturen
DFG
EU – Horizon Europe
Björn Carlson Preis
DFG
UBA7
MnION: Untersuchung der Verknüpfungen des Mangan(Mn)-Kreislaufes mit Redoxkreisläufen anderer Elemente in den sauerstofffreien Becken der Ostsee (Ausfahrt M200) DFG
6 Bundesanstalt für Wasserbau
7 Umweltbundesamt
01.01.2022 –31.07.2024
01.10.2022 –31.12.2028
05.12.2022 –04.09.2025
01.01.2023 –30.04.2026
01.01.2023 –31.12.2024
01.01.2023 –31.12.2026
01.02.2023 –31.01.2026
13.03.2023 –30.11.2024
01.09.2023 –31.01.2026
01.12.2023 –30.09.2026
01.01.2024 –31.12.2025
Ulf Gräwe
01.02.2024 –30.06.2025
Jerome Kaiser Helge Arz
Oliver Schmale
Markus Czymzik
Hans Burchard
Isabell Klawonn
Peter Feldens
Maren Voß
Michael E. Böttcher
Carolin Paul
Michael L. Zettler
Michael E. Böttcher
Volker Mohrholz
PROJEKTTITEL
SEA-Quester: Blue Carbon production, export and sequestration in emerging polar ecosystems
Moorklimaschutz: Modellprojekt Moorklimaschutz an der Ostseeküste; TP 1: Reduktion von Stickstoffemissionen aus Küstenmooren
SeaStore II: Schutz und Wiederansiedlung von Seegraswiesen in der südlichen Ostsee; Vorhaben: Integrative Betrachtung der Treibhausgasbilanz bei Wiederansiedlung von Seegraswiesen
PICASSO: Prozesseinblicke in die Quellen und Senken von Methan im Auftriebsgebiet von Concepción
BALTICMAGX: Ökologische Auswirkungen von magnetotaktischen Bakterien in Redoxgradienten in der Ostsee
FÖRDERMITTELGEBER
EU – Horizon Europe
ZEITRAUM PROJEKTLEITUNG IM IOW
01.02.2024 –31.01.2028
BfN 15.03.2024 –14.03.2034
BMFTR 01.08.2024 –31.07.2027
DFG 01.09.2024 –28.02.2026
DFG 01.12.2024 –30.11.2027
PROJEKTTITEL
Baltic Transcoast: Graduiertenkolleg "Die deutsche Ostseeküste als terrestrisch-marine Schnittstelle für Wasser- und Stoffflüsse"
Baltic Proper spring bloom: Kann das Micro- und Mesozooplankton die Frühjahrsblüte des Phytoplanktons in der Zentralen Ostsee infolge der Klimaerwärmung kontrollieren?
JERICO-S3: Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, Sustainability
MeN-ARP: Metabolismus des Stickstoffs in der Amazonasfahne und dem westlichen, tropischen Nordatlantik
COOLSTYLE: Ozeane unter Stress: CARBOSTORE – Stabilität, Verwundbarkeit und Perspektiven verschiedener Kohlenstoffspeicher in Nord- und Ostsee; Vorhaben: Biogeochemie, chemische Ozeanografie und Modellierung von C im Nord-Ostsee-Kontinuum
BaltVib: Aktuelle und künftige Entwicklung von pathogenen Vibrio-Bakterien in Küstengewässern der Ostsee –TP1: Koordination, Datenmanagement, Problemlösungskonzepte
PaintSed: Farbpartikel in Meeressediment: Wechselwirkungen mit Mikrobiota und Auswirkungen auf Sedimentprozesse
FÖRDERMITTELGEBER ZEITRAUM
DFG 01.01.2016 –31.12.2024
DFG 01.09.2019 –31.05.2025
EU – Horizon 2020 01.02.2020 –31.07.2024
DFG 01.11.2020 –31.01.2024
BMFTR 01.04.2021 –31.07.2024
Jörg Dutz
Maren Voß
Gregor Rehder
BMFTR EU BiodivERsA 01.04.2021 –31.03.2024
DFG 01.05.2021 –31.07.2024
Lars Umlauf Oliver Schmale Klaus Jürgens
Heide Schulz-Vogt
PROJEKTLEITUNG IM IOW
Maren Voß
Carolin Paul
Gregor Rehder
Maren Voß
Michael E. Böttcher
Matthias Labrenz
Alexander Tagg
PROJEKTTITEL
PHYTOARK: Vorhersage der Zukunft anhand von Signaturen aus der Vergangenheit: Nutzung von lebenden Sedimentarchiven und alter DNA zum Verständnis der Reaktionen von marinen Primärproduzenten auf Umweltveränderungen
LABPLAS: Land-Based Solutions for Plastics in the Sea; Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of plastics pollution
HyFiVe: Hydrographie auf Fischereifahrzeugen – Entwicklung eines innovativen Systems zum Einsatz auf Fischereifahrzeugen zur autonomen Erfassung, Übertragung und Auswertung hydrografischer Messdaten für die Fischereiforschung
AMMOTRACe: Erkundung mariner AMMunitiOn-Mülldeponien durch ober- und unterwasserbasierte lasermassenspektrometrische TRACing-Technologie
DynaDeep: Forschungsgruppe Spurenelemente und Metallisotope: Transformation und Fraktionierung
FÖRDERMITTELGEBER
LeibnizWettbewerbsverfahren (SAW)
EU – Horizon 2020
BLE8
ZEITRAUM PROJEKTLEITUNG IM IOW
01.05.2021 –30.04.2025
Anke Kremp
01.06.2021 –31.05.2025
Juliana Assuncao Ivar do Sul
01.07.2021 –30.09.2024
BMWE9
NArrFix: Stickstoff und Argon Messungen zur Quantifizierung der Stickstofffixierung im Oberflächenwasser der Ostsee DFG
OTC DaTA: Ocean Technology Campus Rostock: Digital Twin & analytics-Einbettung semantischer Visual Analytics Verfahren in die Multisensor-Datenauswertung für funktionelle Assistenzsysteme im industriellen Kontext
OTC Stone: Ocean Technology Campus Rostock: Automatische Lokalisierung und Vermessung von Steinen in akustischen Datensätzen mit neuronalen Netzwerken
GESIFUS II: Die genetische Struktur Mikrobieller Gemeinschaften als Signatur ihrer funktionellen Stabilität
OTC-Genomics: Ocean Technology Campus Rostock: Innovative Analyseverfahren für die Umweltüberwachung aquatischer Lebensräume auf der Grundlage von Nukeinsäurerequenzierung
Coastal Futures I+II: Zukunftsszenarien zur Förderung einer nachhaltigen Nutzung mariner Räume; Vorhaben: Szenarien für Ökosystemleistungen
01.09.2021 –31.08.2024
01.09.2021 –31.08.2025
01.10.2021 –30.09.2025
BMFTR 01.10.2021 –30.09.2024
Detlef Schulz-Bull
Michael E. Böttcher
Oliver Schmale
Martin Kolbe
BMFTR 01.10.2021 –30.09.2024
DFG
01.11.2021 –15.11.2025
BMFTR 01.11.2021 –31.01.2025
BMFTR/ DAM 01.12.2021 –30.11.2027
BacDMS: Bakterielle Umwandlungen von Dimethylsulfoniumpropionat im Weddelmeer DFG
MAPUCHE: Auswirkungen der pelagischen Anoxie im Auftriebsgebiet vor Concepción und in einem unberührten anoxischen Fjord sowie die postglaziale Entwicklung der patagonischen Fjordregion in Chile
8 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
9 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BMFTR
01.08.2022 –30.06.2025
01.08.2022 –31.10.2024
Svenja Papenmeier
Sara Beier
Matthias Labrenz
Markus Meier
Judith Piontek
Heide Schulz-Vogt
PROJEKTTITEL
PlumeBaSe: Charakterisierung von Schiffsemissionen und ihr Eintrag ins Meer
MGF-Ostsee II: Ausschluss Mobiler Grundberührender Fischerei in marinen Schutzgebieten der Ostsee; Leitantrag; Vorhaben: Entwicklungsszenarien benthischer Lebensgemeinschaften und Sedimentfunktionen
EFFECTIVE: Enhancing social well-being and economic prosperity by reinforcing the eFFECTIVEness of protection and restoration management in Mediterranean MPAs
UBA-MoSEA: Anwendung von Modellwerkzeugen zur Charakterisierung der Eutrophierungssituation der westlichen Ostsee
COP: Circular Ocean-bound Plastic
ICEstuaries: Austauschströmung und Vermischung in Ästuaren mit Eisbedeckung
TRANSEATION: Verbesserung des ökosystembasierten Managements durch blau-graue Infrastrukturen in Meeres- und Küstengebieten
ElbeXtremeHydro: Extreme hydrodynamische Ereignisse im Elbe-Ästuar: Szenario-Studien als Grundlage von Ökosystem-Risiko-Analyse
PrimePrevention: Vorhersage mariner biologischer Gefahren zur Verhinderung sozioökonomischer Auswirkungen; Vorhaben: Überwachung, Modellierung und Bewertung von Extremwetterereignissen auf biologische Meeresgefahren in der westlichen Ostsee
E-POLIO: Neue Schadstoffe und Mikroplastik im Oberflächenwasser des Indischen Ozeans; Vorhaben: Mikroplastik, Schadstoffe & Koordination
RETAKE II: CO2-Entnahme durch Alkalinitätserhöhung – Potenzial, Nutzen und Risiken; Vorhaben: Potentielle Effekte benthischer Karbonatlösung auf das Ökosystem der Ostsee
Pockmarks: Quantitative Morphologische Analyse von Pockmarks am Barkley Canyon (Nord-Ost Pazifik): räumliche und zeitliche Entwicklung und Entstehungsmechanismen
SEADITO: Sozial-ökologische Analyse und Modelle für den digitalen Zwilling des Ozeans
KomSO: Studie zur Kohlenstoffspeicherkapazität mariner Sedimente in der deutschen Ostsee
FÖRDERMITTELGEBER
ZEITRAUM PROJEKTLEITUNG IM IOW
DFG 01.09.2022 –31.05.2026
BMFTR/ DAM 01.03.2023 –28.02.2026
EU – Horizon Europe 01.06.2023 –31.05.2027
UBA 01.08.2023 –31.12.2025
EU – Interreg South Baltic 01.09.2023 –31.08.2026
DFG 01.11.2023 –30.11.2026
EU – Horizon Europe
01.01.2024 –30.06.2027
BMFTR/ DAM 01.01.2024 –31.12.2026
BMFTR/ DAM 01.01.2024 –31.12.2026
Helena Osterholz
Klaus Jürgens
BMFTR 15.03.2024 –31.07.2026
BMFTR/ DAM 01.08.2024 –31.07.2027
Ibrahim Boubekri
Sarah Piehl
Mirco Haseler
Hans Burchard
Ibrahim Boubekri
Hans Burchard
René Friedland
DFG 01.08.2024 –30.04.2026
Joanna J. Waniek
Hagen Radtke
Jacob Geersen
EU – Horizon Europe 01.09.2024 –31.08.2027 Miriam von Thenen
BfN 15.09.2024 –14.11.2027
Peter Feldens
PROJEKTTITEL
NAPOLY: Zeitliche und räumliche Verteilung von Mikroplastik in der Tiefe des Nordatlantiks (2.000 m) in Relation zu Umweltfaktoren und Konzentrationen persistenter organischer Schadstoffe (POPs)
STATUS: STATUS der Funktionen biogener Riffe in der Ostsee mit Schwerpunkt auf die Kohlenstoff-Fixierung
SUBNORDICA: Beyond submerged landscapes –defining human response to postglacial sea-level rise and climate change
South Pacific: Ozeanänderungen auf orbitalen und Jahrtausend-Zeitskalen im pazifischen Südozean seit dem Mittel-Pleistozänen Klimaübergang (IODP 383)
CONMAR II: Konzepte zur Sanierung konventioneller Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee; Vorhaben: Modellierung der Verdriftung sprengstofftypischer Verbindungen (STV) im Küstenozean und Untersuchungen von Räumungsstrategien
FÖRDERMITTELGEBER
DFG
ZEITRAUM PROJEKTLEITUNG IM IOW
01.10.2024 –30.09.2027
BfN
EU – Horizon Europe, Part of ERC-Synergy Grant
DFG
BMFTR/ DAM
01.10.2024 –30.09.2027
01.10.2024 –31.03.2030
01.11.2024 –31.10.2026
01.12.2024 –31.10.2027
Joanna J. Waniek
Michael L. Zettler
Jacob Geersen
Helge Arz
Ulf Gräwe
PROJEKTTITEL
CRASSOBIOM: Die Funktion von Interaktionen zwischen der Pazifischen Auster und ihrer Mikrobiota in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Auster in extremen Habitaten
ECAS-BALTIC: Strategien des ökosystem-verträglichen Küstenschutzes und der ökosystem-fördernden Küstenanpassung für die Deutsche Ostseeküste; Vorhaben: Modelluntersuchungen zur Variabilität und Veränderungen von Sturmfluten in der westlichen Ostsee
C-SCOPE: Analyse der CO2-Aufnahme und -Dynamik unter dem Einfluss von Eutrophierung durch Erweiterung des CO2-Messnetzes in der Ostsee
TouMaLi: Meeresmüll und nachhaltiges Abfallmanagement in nordafrikanischen Küstentourismus-Regionen
ASMASYS: Bewertungsrahmen für marine CO2-Entnahme und Synthese des aktuellen Wissenstandes
RETAKE I: Quantifizierung der Potentiale, Machbarkeit und Nebenwirkungen atmosphärischer CO2-Entnahme durch Alkalinitätserhöhung (AE); Vorhaben: Direkte und indirekte Effekte hypothetischer bodennaher Alkanisierung in der Ostsee
FÖRDERMITTELGEBER
DFG
ZEITRAUM PROJEKTLEITUNG IM IOW
01.10.2020 –31.12.2024
BMFTR 01.11.2020 –29.02.2024
Matthias Labrenz
Ulf Gräwe
BMFTR 01.01.2021 –31.12.2024
BMUKN10 01.05.2021 –31.12.2025
BMFTR/ DAM 01.08.2021 –31.07.2024
BMFTR/ DAM 01.08.2021 –31.07.2024
10 Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz, nukleare Sicherheit
Henry Bittig
Gerald Schernewski
Gregor Rehder
Hagen Radtke
PROJEKTTITEL
CTD_II: Unterwegsdaten 2; Vorhaben: Entwicklung des CTD-Frameworks
GEORGE: Next generation multiplatform Ocean observing technologies for research infrastructures
ATMO-SHIP: Schiffsgestützte Messung der Konzentrationen von CO2 und CH4 in der atmosphärischen Grenzschicht (ITMS Modul Q&S II)
BALTWRECK: Preventing massive marine waters chemical pollution from the leaking wrecks and munition/ weapon dumps in the South Baltic
HABBAL: BiodivGesundheit II: Auswirkungen schädlicher Algenblüten in der Ostsee, verursacht durch untypisches Auftreten bestimmter Algenarten – Biodiversität und HAB Toxizität
O2-MCA: Die Auswirkungen der mittelalterlichen Klimaanomalie auf die Hypoxie in der Ostsee: Ein gekoppelter benthisch-pelagischer Modellierungsansatz
OTC-DaTA2Model-E: Ocean Technology Campus Rostock: Living Probabilistic Twins
OTC-Genomics II: Ocean Technology Campus Rostock: Methodenentwicklung zur Umweltüberwachung aquatischer Lebensräume mittels eDNA
CREATE II: Konzepte zur Reduzierung der Auswirkungen anthropogener Drücke und Nutzungen auf Marine Ökosysteme und die Artenvielfalt; Vorhaben: Erstellung eines Ostsee-Bioarchivs
FINO II: Betrieb der FINO-Datenbank, ozeanographische Messungen auf den Plattformen FINO2 2024-2026
PROJEKTTITEL
OTC-Gender: Ocean Technology Campus Rostock: Förderung der Geschlechter-Gerechtigkeit und -Parität in den Berufsgruppen der Unterwassertechnik
OTC Ocean Talents: Ocean Technology Campus Rostock: Talenteförderung entlang des Bildungsweges
OTC-PromOcean: Ocean Technology Campus Rostock: Diversität, Fachkräftegewinnung und Nachwuchsarbeit in Ocean Technology
FÖRDERMITTELGEBER ZEITRAUM PROJEKTLEITUNG IM IOW
BMFTR/ DAM
EU – Horizon Europe
01.01.2023 –31.12.2025
01.01.2023 –30.06.2027
BMFTR 01.07.2024 –30.06.2027
EU – Interreg South Baltic 01.07.2024 –30.06.2027
BMFTR 01.08.2024 –31.07.2027
DFG 01.09.2024 –31.08.2027
BMFTR 01.10.2024 –30.09.2027
Martin Kolbe
Henry Bittig
Gregor Rehder
Ralf Prien
Ingrid Sassenhagen
Jurjen Rooze
Ralf Prien
BMFTR 01.11.2024 –31.10.2027 Matthias Labrenz
BMFTR/ DAM 01.12.2024 –30.11.2027
BSH 01.12.2024 –30.11.2026
Matthias Labrenz
Franz Jendersie
FÖRDER MITTELGEBER
ZEITRAUM PROJEKTLEITUNG IM IOW
BMFTR 01.10.2021 –30.09.2024
BMFTR 01.10.2021 –30.09.2024
BMFTR 01.10.2024 –30.09.2027
Oliver Zielinski
Regine Labrenz
Regine Labrenz
NR. FAHRTBEZEICHNUNG ZEITRAUM FAHRTGEBIET FAHRTLEITER SEKTION
EMB356 BLMP + Langzeitbeobachtung
EMB335 MARNET
06.02. – 21.02.2024
26.02. – 01.03.2024
EMB336 Geo-Praktikum 12.03. – 15.03.2024
EMB337 BLMP + Langzeitbeobachtung 19.03. – 03.04.2024
M200 MnION 22.03. – 09.04.2024
EMB338 MARNET 06.04. – 10.04.2024
EMB339 OTC-Stone
13.04. – 22.04.2024
EMB340 BLMP + Langzeitbeobachtung 25.04. – 15.05.2024
EMB341 MARNET 27.05. – 01.06.2024
EMB342 MFG II
EMB343 LEGRA24
10.06. – 17.10.2024
Ostsee Mohrholz Physik
Westl. Ostsee Mars Messtechnik
Westl. Ostsee Arz Geologie
Ostsee Kuss Chemie
Ostsee Mohrholz Physik
Westl. Ostsee Mars Messtechnik
Westl. Ostsee Papenmeier Geologie
Ostsee Naumann Physik
Westl. Ostsee Mars Messtechnik
deutsche AWZ Gogina Biologie
21.06. – 02.07.2024 deutsche AWZ Romoth Biologie
EMB344 MARNET 04.07. – 09.07.2024
EMB345 MFG II TE 16.07. – 03.08.2024
SO305/2 E-POLIO
EMB346 BLMP + Langzeitbeobachtung
EMB347 Plume
EMB351 MARNET
EMB353 BLMP + Langzeitbeobachtung
EMB354 PaleoScapes
Westl. Ostsee Mars Messtechnik
deutsche AWZ Jürgens Biologie
16.07. – 05.08.2024 Indischer Ozean Waniek Chemie
06.08. – 20.08.2024
24.08. – 31.08.2024
01.11. – 05.11.2024
Ostsee Dutz Biologie
Südwestl. Ostsee, Kattegatt Osterholz Chemie
Westl. Ostsee Mars Messtechnik
07.11. – 22.11.2024 Ostsee Kube Biologie
26.11. – 03.12.2024
EMB355 MARNET 09.12- – 14.12.2024
Forschungsschiffe: EMB – Elisabeth Mann Borgese | SO – Sonne | M – Meteor BLMP – Bund-/Länder-Messprogramm
Westl. Ostsee Geersen Geologie
Westl. Ostsee Mars Messtechnik
STAND 31.07.2025
Ahmerkamp, S., C. O. Pacherres, M. Mosshammer, M. Godefroid, M. Wind-Hansen, M. Kuypers, L. Behrendt, K. Koren and M. Kühl (2024). Novel Approach for Lifetime-Proportional Luminescence Imaging Using Frame Straddling. ACS Sensors 9: 5531 – 5540, doi: 10.1021/acssensors.4c01828
Andrews, A. H., J. P. Eveson, C. Welte, K. Okamoto, K. Satoh, K. Krusic-Golub, B. C. Lougheed, J. I. Macdonald, F. Roupsard and J. H. Farley (2024). Age validation of yellowfin and bigeye tuna using post-peak bomb radiocarbon dating confirms long lifespans in the western and central Pacific Ocean. ICES J. Mar. Sci. 81: 1137 – 1149, doi: 10.1093/icesjms/fsae074
Anschütz, A.-A., M. Maselli, C. Traboni, A. R. Boon and W. Stolte (2024). Importance of integrating mixoplankton into marine ecosystem policy and management – Examples from the Marine Strategy Framework Directive. Integr. Environ. Assess. Manag. 20: 1366 – 1383, doi: 10.1002/ieam.4914
Banerjee, T., P. Scholz, S. Danilov, K. Klingbeil and D. Sidorenko (2024). Split-explicit external mode solver in the finite volume sea ice–ocean model FESOM2. Geosci. Model Dev. 17: 7051 – 7065, doi: 10.5194/gmd-17-7051-2024
Banerjee, T., S. Danilov, K. Klingbeil and J.M. Campin (2024). Discrete variance decay analysis of spurious mixing. Ocean Model. 192: 102460, doi: 10.1016/j.ocemod.2024.102460
Bange, H. W., P. Mongwe, J. D. Shutler, D. L. Arévalo-Martínez, D. Bianchi, S. K. Lauvset, C. Liu, C. R. Löscher, H. Martins, J. A. Rosentreter, O. Schmale, T. Steinhoff, R. C. Upstill-Goddard, R. Wanninkhof, S. T. Wilson and H. Xie (2024). Advances in understanding of air-sea exchange and cycling of greenhouse gases in the upper ocean. Elem. Sci. Anth. 12: 1, doi: 10.1525/elementa.2023.00044
Bellon, G., H. Middel, C. Chicco and J. N. Rempel (2024). Changes in cetacean occurrence in Faxaflói Bay, Iceland, as observed from whale watching vessels. NAMMCO Scientific Publications 13, doi: 10.7557/3.7386
Bergman, I., E. S. Lindström and I. Sassenhagen (2024). Ciliate Grazing on the bloom-forming microalga Gonyostomum semen. Microb. Ecol. 87: 33, doi: 10.1007/s00248-024-02344-9
Bick, A. and M. L. Zettler (2024). Description of three new species of Amphitritides Augener, 1922 (Terebellida, Annelida) from the coast of Namibia (South West Africa). Zootaxa 5446: 42 – 64, doi: 10.11646/zootaxa.5446.1.2
Bittig, H. C., E. Jacobs, T. Neumann and G. Rehder (2024). A regional pCO2 climatology of the Baltic Sea from in situ pCO2 observations and a model-based extrapolation approach. Earth Syst. Sci. Data 16: 753 – 773, doi: 10.5194/essd-16-753-2024
Bordbar, M. H., A. Nasrolahi, M. Lorenz, S. Moghaddam and H. Burchard (2024). The Persian Gulf and Oman Sea: Climate variability and trends inferred from satellite observations. Estuar. Coast. Shelf Sci. 296: 108588, doi: 10.1016/j.ecss.2023.108588
Botterell, Z. L. R., F. Ribeiro, D. AlarcónRuales, E. Alfaro, J. Alfaro-Shigueto, N. Allan, N. Becerra, L. Braunholtz, S. Cardenas-Diaz, D. de Veer, G. Escobar-Sanchez, M. V. Gabela-Flores, B. J. Godley, I. Grønneberg, J. A. Howard, D. Honorato-Zimmer, J. S. Jones, C. Lewis, J. C. Mangel, M. Martin, J. P. M. Pérez, S. E. Nelms, C. Ortiz-Alvarez, A. Porter, M. Thiel and T. S. Galloway (2024). Plastic pollution transcends marine protected area boundaries in the eastern tropical and south-eastern Pacific. Mar. Poll. Bull. 201: 116271, doi: 10.1016/j.marpolbul.2024.116271
Böttner, C., C. J. Stevenson, R. Englert, M. Schönke, B. T. Pandolpho, J. Geersen, P. Feldens and S. Krastel (2024). Extreme erosion and bulking in a giant submarine gravity flow. Sci. Adv. 10: eadp2584, doi: 10.1126/sciadv.adp2584
Böttner, C., J. J. L. Hoffmann, D. Unverricht, M. Schmidt, T. Spiegel, J. Geersen, T. H. Müller, J. Karstens, K. J. Andresen, L. Sander, J. Schneider von Deimling and C. Schmidt (2024). The Enigmatic Pockmarks of the Sandy Southeastern North Sea. Geochem., Geophys., Geosyst. 25: e2024GC011837, doi: 10.1029/2024GC011837
Boukheloua, R., I. Mukherjee, H. Park, K. Šimek, V. Kasalický, M. Ngochera, H.-P. Grossart, A. Picazo-Mozo, A. Camacho, P. J. Cabello-Yeves, F. Rodriguez-Valera, C. Callieri, A.-S. Andrei, J. Pernthaler, T. Posch, A. Alfreider, R. Sommaruga, M. W. Hahn, B. Sonntag, P. Lopez-Garcia, D. Moreira, L. Jardillier, C. Lepère, C. Biderre-Petit, A. Bednarska, M. Ślusarczyk, V. R. Tóth, H. L. Banciu, K. Kormas, S. Orlic, D. Šantić, G. Muyzer, D. P. R. Herlemann, H. Tammert, S. Bertilsson, S. Langenheder, T. Zechmeister, N. Salmaso, N. Storelli, C. Capelli, F. Lepori, V. Lanta, H. Henriques Vieira, F. Kostanjšek, K. Kabeláčová, M.-C. Chiriac, M. Haber, T. Shabarova, C. Fernandes, P. Rychtecký, P. Znachor, T. Szőke-Nagy, P. Layoun, H. L. Wong, V. S. Kavagutti, P.-A. Bulzu, M. M. Salcher, K. Piwosz and R. Ghai (2024). Global freshwater distribution of Telonemia protists. ISME J. 18: wrae177, doi: 10.1093/ismejo/wrae177
Breznikar, A., D. L. Pönisch, M. Lorenz, G. Jurasinski, G. Rehder and M. Voss (2024). Rewetting effects on nitrogen cycling and nutrient export from coastal peatlands to the Baltic Sea. Biogeochemistry 167: 967 – 987, doi: 10.1007/s10533-024-01149-9
Brink, A. M., A. Kremp and E. Gorokhova (2024). Quantitative real-time PCR assays for species-specific detection and quantification of Baltic Sea spring bloom dinoflagellates. Front. Microbiol. 15, doi: 10.3389/fmicb.2024.1421101
Bruhns, T., C. Sánchez-Girón Barba, L. König, S. Timm, K. Fisch and I. M. Sokolova (2024). Combined effects of organic and mineral UV-filters on the lugworm Arenicola marina. Chemosphere 358: 142184, doi: 10.1016/j.chemosphere.2024.142184
Burchard, H., M. Alford, M. Chouksey, G. Dematteis, C. Eden, I. Giddy, K. Klingbeil, A. Le Boyer, D. Olbers, J. Pietrzak, F. Pollmann,
K. Polzin, F. Roquet, P. S. Saez, S. Swart, L. Umlauf, G. Voet and B. Wynne-Cattanach (2024). Linking ocean mixing and overturning circulation. Bull. Amer. Meteorol. Soc. 105: E1265 – E1274, doi: 10.1175/BAMS-D-24-0082.1
Cabral, A., G. M. S. Reithmaier, Y. Y. Y. Yau, L. C. Cotovicz Jr., J. Barreira, B. Viana, J. Hayden, S. Bouillon, N. Brandini, V. Hatje, C. E. de Rezende, A. L. Fonseca and I. R. Santos (2024). Large Porewater – Derived Carbon Outwelling Across Mangrove Seascapes Revealed by Radium Isotpes. Journal of Geophysical Research - Oceans 129: e2024JC021319, doi: 10.1029/2024JC021319
Cabral, A., Y. Y. Y. Yau, G. M. S. Reithmaier, L. C. Cotovicz, J. Barreira, G. Broström, B. Viana, A. L. Fonseca and I. R. Santos (2024). Tidally driven porewater exchange and diel cycles control CO2 fluxes in mangroves on local and global scales. Geochim. Cosmochim. Acta 374: 121-135, doi: 10.1016/j.gca.2024.04.020
Cahill, B., E. Chrysagi, R. Vortmeyer-Kley and U. Gräwe (2024). Deconstructing co-occurring marine heatwave and phytoplankton bloom events in the Arkona Sea in 2018. Front. Mar. Sci. 11: 1323271, doi: 10.3389/fmars.2024.1323271
Chang, Y., X. Li, Y. P. Wang, K. Klingbeil, W. Li, F. Zhang and H. Burchard (2024). Salinity mixing in a tidal multi-branched estuary with huge and variable runoff. J. Hydrol. 634: 131094, doi: 10.1016/j.jhydrol.2024.131094
Chielle, R. S. A., R. V. Marins, M. S. Cavalcante and L. C. Cotovicz Jr. (2024). Seasonal and spatial variability of CO2 emissions in a large tropical mangrove-dominated delta. Limnol. Oceanogr.: online, doi: 10.1002/lno.12471
Chielle, R., T. Meziane, C. E. Rezende, L. C. Cotovicz Jr., G. Abril and R. V. Marins (2024). Fatty acids and stable isotopes distribution in the mangrove dominated Parnaíba River Delta. Estuar. Coast. Shelf Sci. 308: 108934, doi: 10.1016/j.ecss.2024.108934
Choisnard, N., J. Umbricht, M. Araujo, M. E. Böttcher, C. Burmeister, I. Liskow, I. Schmiedinger and M. Voss (2024). Nitrogen assimilation and nitrification in surface waters of the Amazon and Pará estuaries. J. Geophys. Res. Oceans 129: e2024JC021004, doi: 10.1029/2024JC021004
Choisnard, N., N. N. Duprey, T. Wald, M. Thibault, F. Houlbrèque, A. D. Foreman, P. Cuet, M. M. M. Guillaume, H. Vonhof, D. M. Sigman, G. H. Haug, J.-F. Maguer, S. L’Helguen, A. Martínez-García and A. Lorrain (2024). Tracing the fate of seabird-derived nitrogen in a coral reef using nitrate and coral skeleton nitrogen isotopes. Limnol. Oceanogr. 69: 309 – 324, doi: 10.1002/lno.12485
Choisnard, N., T. Sperlea, I. Liskow and M. Voss (2024). Nitrification in the Amazon River plume. Mar. Ecol. Prog. Ser. 730: 1 – 14, doi: 10.3354/meps14530
Cosme De Esteban, M., P. Feldens, R. Haroun, F. Tuya, A. Gil and F. Otero Ferrer (2024). Habitat mapping of the Vila Franca do Campo marine reserve (Azores) and recommendations for its improvement. Estuar. Coast. Shelf Sci. 303: 108809, doi: 10.1016/j.ecss.2024.108809
Cotovicz Jr., L. C., B. Cahill, B. Sabbaghzadeh, J. M. Lencina-Avila and G. Rehder (2024). Increase in marginal sea alkalinity may impact air–sea carbon dioxide exchange and buffer acidification. Limnol. Oceanogr. 69: 2332-2347, doi: 10.1002/lno.12672
Cotovicz Jr., L. C., G. Abril, C. J. Sanders, D. R. Tait, D. T. Maher, J. Z. Sippo, C. Holloway, Y. Y. Y. Yau and I. R. Santos (2024). Methane oxidation minimizes emissions and offsets to carbon burial in mangroves. Nat. Clim. Chang. 14: 275-281, doi: 10.1038/s41558-024-01927-1
Czymzik, M., M. Christl, O. Dellwig, R. Muscheler, D. Müller, J. Kaiser, M. J. Schwab, C. K. M. Nantke, A. Brauer and H. W. Arz (2024). Synchronizing the Western Gotland Basin (Baltic Sea) and Lake Kälksjön (central Sweden) sediment records using common cosmogenic radionuclide production variations. Holocene 34: 1128-1137, doi: 10.1177/09596836241247311
Das, S. K., N. Mahanta, B. Sahoo, R. K. Singh, C. A. Alvarez Zarikian, M. Tiwari, N. Vats, Nihal, F. Lamy, G. Winckler, J. L. Middleton, H. W. Arz, J. Gottschalk, C. Basak, A. Brombacher, O. M. Esper, J. R. Farmer, L. C. Herbert, S. Iwasaki, L. Lembke-Jene, V. J. Lawson, L. Lo, E. Malinverno, E. Michel, S. Moretti, C. M. Moy, A. C. Ravelo, C. R. Riesselman, M. Saavedra-Pellitero, I. Seo, R. A. Smith, A. L. Souza, J. S. Stoner, I. V. M. P. de Oliveira, S. Wan and X. Zhao (2024). Late Miocene to Early Pliocene paleocean-
ographic evolution of the Central South Pacific: A deep-sea benthic foraminiferal perspective. Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 647: 112252, doi: 10.1016/j.palaeo.2024.112252
Das, S. K., R. K. Singh, M. Saavedra-Pellitero, J. Gottschalk, C. A. Alvarez Zarikian, L. Lembke-Jene, F. Lamy, G. Winckler, J. L. Middleton, H. W. Arz, C. Basak, A. Brombacher, O. M. Esper, J. R. Farmer, L. C. Herbert, S. Iwasaki, V. J. Lawson, L. Lo, E. Malinverno, E. Michel, S. Moretti, C. M. Moy, A. C. Ravelo, C. R. Riesselman, I. Seo, R. A. Smith, A. L. Souza, J. S. Stoner, I. M. Venancio, S. Wan and X. Zhao (2024). Recent deep-sea nematodes and agglutinated foraminifera select specific grains and bioclasts from their environments: Ecological implications. Mar. Micropaleontol. 192: 102409, doi: 10.1016/j.marmicro.2024.102409
Davies, J., K. Fahl, M. Moros, A. Carter-Champion, H. Detlef, R. Stein, C. Pearce and M.-S. Seidenkrantz (2024). Sea-ice conditions from 1880 to 2017 on the Northeast Greenland continental shelf: a biomarker and observational record comparison. The Cryosphere 18: 3415-3431, doi: 10.5194/tc-18-3415-2024
Dieterich, C. and H. Radtke (2024). Higher quantiles of sea levels rise faster in Baltic Sea Climate projections. Clim. Dyn. 62: 3709 – 3719, doi: 10.1007/s00382-023-07094-x
Dippner, J. W., J. P. Montoya, A. Subramaniam, J. Umbricht and M. Voss (2024). The Amazon River plume - a Lagrangian view. Limnol. Oceanogr. Meth. 22: 572 – 589, doi: 10.1002/lom3.10626
Dusch, N., V. Avsarkisov, M. Gerding, C. Stolle and J. Faber (2024). Analysis of coupled energy and helicity spectra in stratified turbulence: Theory and balloon measurements. Phys. Rev. Fluids 9: 033801, doi: 10.1103/PhysRevFluids.9.033801
Dutheil, C., S. Lal, M. Lengaigne, S. Cravatte, C. Menkès, A. Receveur, F. Börgel, M. Gröger, F. Houlbreque, R. Le Gendre, I. Mangolte, A. Peltier and H. E. M. Meier (2024). The massive 2016 marine heatwave in the Southwest Pacific: An “El Niño-Madden-Julian Oscillation” compound event. Sci. Adv. 10: eadp2948, doi: 10.1126/sciadv.adp2948
Ehlert von Ahn, C. M., O. Dellwig, B. Szymczycha, L. Kotwicki, J. Rooze, R. Endler, P. Escher, I. Schmiedinger, J. Sültenfuß, M. Diak, M. Gehre, U. Struck, S. Vogler and M. E. Böttcher (2024). Submarine groundwater discharge into a semienclosed coastal bay of the southern Baltic Sea: A multi-method approach. Oceanologia 66: 111 – 138, doi: 10.1016/j.oceano.2024.01.001
Ehrmann, W., P. A. Wilson, H. W. Arz, H. Schulz and G. Schmiedl (2024). Monsoon-driven changes in aeolian and fluvial sediment input to the central Red Sea recorded throughout the last 200 000 years. Clim. Past 20: 37 – 52, doi: 10.5194/cp-20-37-2024
Estelmann, A., R. Prien, W. Marz, M. Elbing, P. Harz and G. Rehder (2024). An SPR-Based In Situ Methane Sensor for the Aqueous and Gas Phase. Anal. Chem. 96: 16203 – 16214, doi: 10.1021/acs.analchem.4c02875
Fajardo-Urbina, J. M., Y. Liu, S. Georgievska, U. Gräwe, H. J. H. Clercx, T. Gerkema and M. Duran-Matute (2024). Efficient deep learning surrogate method for predicting the transport of particle patches in coastal environments. Mar. Poll. Bull. 209: 117251, doi: https://doi. org/10.1016/j.marpolbul.2024.117251
Falfushynska, H., O. Dellwig, A. Köhler and I. M. Sokolova (2024). Adverse outcome pathways as a tool for optimization of the biomarker-based assessment of pollutant toxicity: A case study of cadmium in the blue mussels Mytilus edulis. Ecol. Indic. 158: 111431, doi: 10.1016/j.ecolind.2023.111431
Feistel, R. (2024). Origin of Life: A Symmetry-Breaking Physical Phase Transition. Symmetry 16: 1611, doi: 10.3390/sym16121611
Feistel, R. (2024). TEOS-10 and the climatic relevance of ocean–atmosphere interaction. Ocean Sci. 20: 1367 – 1402, doi: 10.5194/os-20-1367-2024
Feistel, R. and O. Hellmuth (2024). Irreversible thermodynamics of seawater evaporation. J. Mar. Sci. Eng. 12: 166, doi: 10.3390/jmse12010166
Feistel, R. and O. Hellmuth (2024). TEOS10 Equations for determining the lifted condensation level (LCL) and climatic
feedback of marine clouds. Oceans 5: 312 – 351, doi: 10.3390/oceans5020020
Fer, I., M. Dengler, P. Holtermann, A. Le Boyer and R. Lueck (2024). ATOMIX benchmark datasets for dissipation rate measurements using shear probes. Sci. Data 11: 518, doi: 10.1038/s41597-024-03323-y
Fernández-Juárez, V., D. J. Riedinger, J. B. Gusmao, L. F. Delgado-Zambrano, G. Coll-García, V. Papazachariou, D. P. R. Herlemann, C. Pansch, A. F. Andersson, M. Labrenz and L. Riemann (2024). Temperature, sediment resuspension, and salinity drive the prevalence of Vibrio vulnificus in the coastal Baltic Sea. mBio 15: e01569-24, doi: 10.1128/mbio.01569-24
Filella, A., J. Umbricht, A. Klett, A. Vogts, T. Vannier, O. Grosso, M. Voss, L. Riemann and M. Benavides (2024). Dissolved organic matter offsets the detrimental effects of climate change in the nitrogen-fixing cyanobacterium Crocosphaera. Limnol. Oceanogr. Lett. 9, 296-306, doi: 10.1002/lol2.10380
Gande, D., C. Hassenrück, M. Žure, T. Richter-Heitmann, E. Willerslev and M. W. Friedrich (2024). Recovering short DNA fragments from minerals and marine sediments: A comparative study evaluating lysis and isolation approaches. Environ. DNA 6: e547, doi: 10.1002/edn3.547
Gaye, B., N. Lahajnar, H. C. Frazão, M. Metzke, C. Perkuhn, R. Prien, S. Tian and J. J. Waniek (2024). Amino Acids as Indicators of Organic Matter Sources and Degradation in Suspended Matter off the Pearl River: Indications for Resuspension in the Northern South China Sea. J. Geophys. Res. Oceans 129: e2024JC021519, doi: 10.1029/2024JC021519
Geersen, J., M. Bradtmöller, J. Schneider von Deimling, P. Feldens, J. Auer, P. Held, A. Lohrberg, R. Supka, J. J. L. Hoffmann, B. V. Eriksen, W. Rabbel, H.-J. Karlsen, S. Krastel, D. Brandt, D. Heuskin and H. Lübke (2024). A submerged Stone Age hunting architecture from the Western Baltic Sea. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 121: e2312008121, doi: 10.1073/pnas.2312008121
Glackin, C. C., S. Dupke, T. S. Chandra, D. Riedinger and M. Labrenz (2024). Combined TCBS and CHROMagar analyses allow for basic identification of Vibrio
vulnificus within a 48 h incubation period in the coastal Baltic Sea. Microorganisms 12: 614, doi: 10.3390/microorganisms12030614
Gogina, M., S. J. Hahn, R. Ohde, A. Brandt, S. Forster, I. Kröncke, M. Powilleit, K. Romoth, M. Sonnewald and M. L. Zettler (2024). Baseline inventory of benthic macrofauna in German marine protected areas (2020–2022) before closure for bottom-contact fishing. Biology 13: 389, doi: 10.3390/biology13060389
Greenwood, P. F., H. Grotheer, M. E. Böttcher and K. Grice (2024). The stable sulfur isotope and abundance fluxes of reduced inorganic sulfur and organic sulfur phases recorded in the Permian-Triassic transition of the Meishan type section. Org. Geochem. 196: 104808, doi: 10.1016/j.orggeochem.2024.104808
Gröger, M., C. Dutheil, F. Börgel and M. H. E. Meier (2024). Drivers of marine heatwaves in a stratified marginal sea. Clim. Dyn. 62: 3231 – 3243, doi: 10.1007/s00382-023-07062-5
Gröger, M., F. Börgel, S. Karsten, H. E. M. Meier, K. Safonova, C. Dutheil, A. Receveur and P. Polte (2024). Future climate change and marine heatwaves - Projected impact on key habitats for herring reproduction. Sci. Total Environ. 951: 175756, doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.175756
Gustafsson, M., Å. Strand, A. T. Laugen, J. Albretsen, C. André, G. Broström, P. E. Jorde, H. Knutsen, O. Ortega-Martinez, M. Sodeland, M. Waern, A.-L. Wrange and P. De Wit (2024). Unlocking the secret life of blue mussels: Exploring connectivity in the Skagerrak through biophysical modeling and population genomics. Evol. Appl. 17: e13704, doi: 10.1111/eva.13704
Gyraite, G., M. Katarzyte, M. Bucas, G. Kalvaitiene, S. Kube, D. P. R. Herlemann, C. Pansch, A. F. Andersson, T. Pitkanen, A.-M. Hokajarvi, A. Annus-Urmet, G. Hauk, M. Hippelein, E. Lastauskiene and M. Labrenz (2024). Epidemiological and environmental investigation of the ‘big four’ Vibrio species, 1994 to 2021: a Baltic Sea retrospective study. Euro Surveill. 29: 32, doi: 10.2807/1560-7917.ES.2024.29.32.2400075
Hagemann, J. R., F. Lamy, H. W. Arz, L. Lembke-Jene, A. Auderset, N. Harada, S. L. Ho, S. Iwasaki, J. Kaiser, C. B. Lange, M. Murayama, K. Nagashima, N. Nowaczyk, A.
Martínez-García and R. Tiedemann (2024). A marine record of Patagonian ice sheet changes over the past 140,000 years. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 121: e2302983121, doi: 10.1073/pnas.2302983121
Hariri, S., H. E. M. Meier and G. Väli (2024). Investigating the influence of sub-mesoscale current structures on Baltic Sea connectivity through a Lagrangian analysis. Front. Mar. Sci. 11: 1340291, doi: 10.3389/fmars.2024.1340291
Heise, S. and I. Stresius (2024). Application of qualitative modelling to improve system understanding of the stressed elbe estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 307: 108908, doi: doi.org/10.1016/j.ecss.2024.108908
Heller, T., D. P. R. Herlemann, A. Plieth, J.-C. Kröger, M.-A. Weber, J. Reiner, R. Jaster, B. Kreikemeyer, G. Lamprecht and H. Schäffler (2024). Liver cirrhosis and antibiotic therapy but not TIPS application leads to a shift of the intestinal bacterial communities: A controlled, prospective study. J. Digest. Dis. 25: 200-208, doi: 10.1111/1751-2980.13262
Hepach, H., J. Piontek, H. W. Bange, T. Barthelmeß, A. von Jackowski and A. Engel (2024). Enhanced warming and bacterial biomass production as key factors for coastal hypoxia in the southwestern Baltic Sea. Sci. Rep. 14: 29442, doi: 10.1038/s41598-024-80451-w
Herlemann, D. P. R., H. Tammert, C. Kivistik, K. Käiro and V. Kisand (2024). Distinct biogeographical patterns in snail gastrointestinal tract bacterial communities compared with sediment and water. MicrobiologyOpen 13: e13, doi: 10.1002/mbo3.1413
Hermann, A., F. Furkert, M. Björner, M. Naumann, D. Stepputtis, M. Gag and S. Klein (2024). HyFiVe: hydrography on fishing vessels; A new monitoring system enables cost effective and scalable ocean monitoring. J. Applied Hydrography 129: 12 – 18, doi: 10.23784/HN129-02
Hieronymus, J., M. Hieronymus, M. Gröger, J. Schwinger, R. Bernadello, E. Tourigny, V. Sicardi, I. Ruvalcaba Baroni and K. Wyser (2024). Net primary production annual maxima in the North Atlantic projected to shift in the 21st century. Biogeosciences 21: 2189 – 2206, doi: 10.5194/bg-21-2189-2024
Hoffman, L. and M. L. Zettler (2024). Galeommatoidea (Bivalvia) from Namibia (Part 2). Iberus 42: 155 – 164
Hoffman, L. and M. L. Zettler (2024). Neoleptonidae (Bivalvia) from Namibia. Iberus 42: 165 – 173
Hoffman, L., C. Wienberg, M. Lisher and M. L. Zettler (2024). Occurrence of Adacnarca (Bivalvia: Philobryidae) of Late Pleistocene age from the continental shelf off Namibia and notes on species from South Africa. Basteria 88: 264 – 270
Honorato-Zimmer, D., G. Escobar-Sánchez, K. Deakin, D. De Veer, T. Galloway, V. Guevara-Torrejón, J. Howard, J. Jones, C. Lewis, F. Ribeiro, G. Savage and M. Thiel (2024). Macrolitter and microplastics along the East Pacific coasts - A homemade problem needing local solutions. Mar. Poll. Bull. 203: 116440, doi: 10.1016/j.marpolbul.2024.116440
Hu, Z., W. Li, S. V. Hohl, P. Meister, S. Yang, B. Zhang, Z. Xia and C. Liu (2024). Evaporite sequences as archives for Mg isotope compositions of seawater - Evidence from a Tethys marginal shelf basin in the Anisian. Chem. Geol. 668: 122346, doi: 10.1016/j.chemgeo.2024.122346
Hubert-Huard, R., N. Andersen, H. W. Arz, W. Ehrmann and G. Schmiedl (2024). Changes in the Red Sea overturning circulation during Marine Isotope Stage 3. Clim. Past 20: 267 – 280, doi: 10.5194/cp-20-267-2024
Jiménez, J. A., G. Winter, A. Bonaduce, M. Depuydt, G. Galluccio, B. van den Hurk, H. E. M. Meier, N. Pinardi, L. G. Pomarico and N. Vazquez Riveiros (2024). Sea Level Rise in Europe: Knowledge gaps identified through a participatory approach. Sea Level Rise in Europe: 1st Assessment Report of the Knowledge Hub on Sea Level Rise (SLRE1) 3-slre1: 3, doi: 10.5194/sp-3-slre1-3-2024
Kaiser, J., E. Schefuß, J. Collins, R. Garreaud, J.-B. W. Stuut, N. Ruggieri, R. De Pol-Holz and F. Lamy (2024). Orbital modulation of subtropical versus subantarctic moisture sources in the southeast Pacific mid-latitudes. Nat. Commun. 15: 7512, doi: 10.1038/s41467-024-51985-4
Kaiser, J., M. Tomczak, O. Dellwig and H. W. Arz (2024). Mediterranean-like “fall dump” events in the Baltic Sea. Holocene
34: 415 – 419, doi: 10.1177/09596836231219479
Karsten, S., H. Radtke, M. Gröger, H. T. M. Ho-Hagemann, H. Mashayekh, T. Neumann and H. E. M. Meier (2024). Flux coupling approach on an exchange grid for the IOW Earth System Model (version 1.04.00) of the Baltic Sea region. Geosci. Model Dev. 17: 1689 – 1708, doi: 10.5194/gmd-17-1689-2024
Kasuya, T., Y. Okazaki, S. Iwasaki, K. Nagashima, K. Kimoto, F. Lamy, J. R. Hagemann, L. Lembke-Jene, H. W. Arz, M. Murayama, C. B. Lange and N. Harada (2024). Orbital timescale CaCO3 burial and dissolution changes off the Chilean margin in the subantarctic Pacific over the past 140 kyr. Progress in Earth and Planetary Science 11: 56, doi: 10.1186/s40645-024-00657-4
Kiesel, J., C. Wolff and M. Lorenz (2024). Brief communication: From modelling to reality – flood modelling gaps highlighted by a recent severe storm surge event along the German Baltic Sea coast. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 24, 11: 3841 – 3849, doi: 10.5194/nhess-24-3841-2024
Knoke, M., T. Dittmar, O. Zielinski, M. Kida, N. E. Asp, C. E. de Rezende, B. Schnetger and M. Seidel (2024). Outwelling of reduced porewater drives the biogeochemistry of dissolved organic matter and trace metals in a major mangrove-fringed estuary in Amazonia. Limnol. Oceanogr. 69: 262 – 278, doi: 10.1002/lno.12473
Kuznetsov, I., B. Rabe, A. Androsov, Y. C. Fang, M. Hoppmann, A. Quintanilla-Zurita, S. Harig, S. Tippenhauer, K. Schulz, V. Mohrholz, I. Fer, V. Fofonova and M. Janout (2024). Dynamical reconstruction of the upper-ocean state in the central Arctic during the winter period of the MOSAiC expedition. Ocean Sci. 20: 759 – 777, doi: 10.5194/os-20-759-2024
Lainela, S., E. Jacobs, S.-T. Luik, G. Rehder and U. Lips (2024). Seasonal dynamics and regional distribution patterns of CO2 and CH4 in the north-eastern Baltic Sea. Biogeosciences 21: 4495 – 4519, doi: 10.5194/bg-21-4495-2024
Lamy, F., G. Winckler, H. W. Arz, J. R. Farmer, J. Gottschalk, L. Lembke-Jene, J. L. Middleton, M. van der Does, R. Tiedemann, C. Alvarez Zarikian, C. Basak, A. Brombacher, L. Dumm, O. M. Esper, L. C. Herbert,
S. Iwasaki, G. Kreps, V. J. Lawson, L. Lo, E. Malinverno, A. Martinez-Garcia, E. Michel, S. Moretti, C. M. Moy, A. C. Ravelo, C. R. Riesselman, M. Saavedra-Pellitero, H. Sadatzki, I. Seo, R. K. Singh, R. A. Smith, A. L. Souza, J. S. Stoner, M. Toyos, I. M. V. P. de Oliveira, S. Wan, S. Wu and X. Zhao (2024). Five million years of Antarctic Circumpolar Current strength variability. Nature 627: 789 – 796, doi: 10.1038/s41586-024-07143-3
Lapham, L. L., K. G. Lloyd, H. Fossing, S. Flury, J. B. Jensen, M. J. Alperin, G. Rehder, W. Holzhueter, T. Ferdelman and B. B. Jørgensen (2024). Methane leakage through the sulfate–methane transition zone of the Baltic seabed. Nat. Geosci. 17: 1277 – 1283, doi: 10.1038/s41561-024-01594-z
Lauvset, S. K., N. Lange, T. Tanhua, H. C. Bittig, A. Olsen, A. Kozyr, M. Álvarez, K. Azetsu-Scott, P. J. Brown, B. R. Carter, L. Cotrim da Cunha, M. Hoppema, M. P. Humphreys, M. Ishii, E. Jeansson, A. Murata, J. D. Müller, F. F. Pérez, C. Schirnick, R. Steinfeldt, T. Suzuki, A. Ulfsbo, A. Velo, R. J. Woosley and R. M. Key (2024). The annual update GLODAPv2.2023: the global interior ocean biogeochemical data product. Earth Syst. Sci. Data 16: 2047 – 2072, doi: 10.5194/essd-16-2047-2024
Lenz, R., K. Enders, E. C. Vizsolyi, M. Schumacher, J. Lötsch, M. G. J. Löder, G. Eder, Y. Voronko, J. M. Andrade-Garda, S. Muniategui-Lorenzo, C. Laforsch, D. Fischer and M. Labrenz (2024). What Goes Around Should Not Move Around: Immbilizing Microplastics as a New Approach for Analytical Ring Trials. Environ. Sci. Technol. 58: 22224 –22234, doi: 10.1021/acs.est.4c09427
Li, X., E. Chrysagi, K. Klingbeil and H. Burchard (2024). Impact of Islands on Tidally Dominated River Plumes: A High-Resolution Modeling Study. J. Geophys. Res. Oceans 129: e2023JC020272, doi: 10.1029/2023JC020272
Lueck, R., I. Fer, C. Bluteau, M. Dengler, P. Holtermann, R. Inoue, A. LeBoyer, S.-A. Nicholson, K. Schulz and C. Stevens (2024). Best practices recommendations for estimating dissipation rates from shear probes. Front. Mar. Sci. 11: 1334327, doi: 10.3389/fmars.2024.1334327
Lønborg, C., C. Carreira, G. Abril, S. Agustí, V. Amaral, A. Andersson, J. Arístegui, P. Bhadury, M. B. Bif, A. V. Borges, S. Bouillon, M. L. Calleja, L. C. Cotovicz Jr., S. Cozzi, M. Doval, C. M. Duarte, B. Eyre, C. G. Fichot,
E. E. García-Martín, A. Garzon-Garcia, M. Giani, R. Gonçalves-Araujo, R. Gruber, D. A. Hansell, F. Hashihama, D. He, J. M. Holding, W. R. Hunter, J. S. P. Ibánhez, V. Ibello, S. Jiang, G. Kim, K. Klun, P. Kowalczuk, A. Kubo, C.-W. Lee, C. B. Lopes, F. Maggioni, P. Magni, C. Marrase, P. Martin, S. L. McCallister, R. McCallum, P. M. Medeiros, X. A. G. Morán, F. E. Muller-Karger, A. Myers-Pigg, M. Norli, J. M. Oakes, H. Osterholz, H. Park, M. Lund Paulsen, J. A. Rosentreter, J. D. Ross, D. Rueda-Roa, C. Santinelli, Y. Shen, E. Teira, T. Tinta, G. Uher, M. Wakita, N. Ward, K. Watanabe, Y. Xin, Y. Yamashita, L. Yang, J. Yeo, H. Yuan, Q. Zheng and X. A. Álvarez-Salgado (2024). A global database of dissolved organic matter (DOM) concentration measurements in coastal waters (CoastDOM v1). Earth Syst. Sci. Data 16: 1107 – 1119, doi: 10.5194/essd-16-1107-2024
Marx, D., A. Feldens, S. Papenmeier, P. Feldens, A. Darr, M. L. Zettler and K. Heinicke (2024). Habitats and biotopes in the German Baltic Sea. Biology 13: 6, doi: 10.3390/biology13010006
Medwed, C., U. Karsten, J. Romahn, J. Kaiser, O. Dellwig, H. W. Arz and A. Kremp (2024). Archives of cyanobacterial traits: insights from resurrected Nodularia spumigena from Baltic Sea sediments reveal a shift in temperature optima. ISME Communications 4: ycae140, doi: 10.1093/ismeco/ycae140
Melet, A., R. van de Wal, A. Amores, A. Arns, A. A. Chaigneau, I. Dinu, I. D. Haigh, T. H. J. Hermans, P. Lionello, M. Marcos, H. E. M. Meier, B. Meyssignac, M. D. Palmer, R. Reese, M. J. R. Simpson and A. B. A. Slangen (2024). Sea Level Rise in Europe: Observations and projections. Sea Level Rise in Europe: 1st Assessment Report of the Knowledge Hub on Sea Level Rise (SLRE1) 3-slre1: 4, doi: 10.5194/sp-3-slre1-4-2024
Meng, S., J. Strahl, A. Börner, K. Krienke, M. L. Zettler and C. Wrozyna (2024). The bay barnacle Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) in the Pleistocene of Europe? A review of Pleistocene Balanidae of northern Central Europe. J. Quat. Sci. 39: 547 – 565, doi: 10.1002/jqs.3603
Miedtank, A., J. Schneider, C. Manss and O. Zielinski (2024). Marine digital twins for enhanced ocean understanding. Remote Sens. Appl.-Soc. Environ. 36: 101268, doi: https://doi.org/10.1016/j. rsase.2024.101268
Moll, D., H. Asmus, A. Blöcker, U. Böttcher, J. Conradt, L. Färber, N. Funk, S. Funk, G. Helene, H.-H. Hinrichsen, P. Kotterba, U. Krumme, F. Madiraca, H. E. M. Meier, S. Meyer, T. Moritz, S. A. Otto, M. Parr, G. Pinto, P. Polte, M.-C. Riekhof, V. Sarrazin, M. Scotti, R. Voss, H. Winkler and C. Möllmann (2024). A climate vulnerability assessment of the fish community in the Western Baltic Sea. Sci. Rep. 14: 16184, doi: 10.1038/s41598-024-67029-2
Morard, R., K. F. Darling, A. K. M. Weiner, C. Hassenrück, C. Vanni, T. Cordier, N. Henry, M. Greco, N. M. Vollmar, T. Milivojevic, S. N. Rahman, M. Siccha, J. Meilland, L. Jonkers, F. Quillévéré, G. Escarguel, C. J. Douady, T. de Garidel-Thoron, C. de Vargas and M. Kucera (2024). The global genetic diversity of planktonic foraminifera reveals the structure of cryptic speciation in plankton. Biol. Rev. 99: 1218-1241, doi: 10.1111/brv.13065
Moros, M., A. T. Kotilainen, I. Snowball, T. Neumann, K. Perner, H. E. M. Meier, S. Papenmeier, H. Kolling, T. Leipe, J. S. Sinninghe Damsté and R. Schneider (2024). Giant saltwater inflow in AD 1951 triggered Baltic Sea hypoxia. Boreas 53: 125 – 138, doi: 10.1111/bor.12643
Mredul, M. M. H., E. P. Sokolov, H. Kong and I. M. Sokolova (2024). Spawning acts as a metabolic stressor enhanced by hypoxia and independent of sex in a broadcast marine spawner. Sci. Total Environ. 909: 168419, doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.168419
Oggerin, M., T. Viver, J. Brüwer, D. Voß, M. Garcia-Llorca, O. Zielinski, L. H. Orellana and B. M. Fuchs (2024). Niche differentiation within bacterial key-taxa in stratified surface waters in the Southern Pacific Gyre. ISME J. 18: wrae155, doi: 10.1093/ismejo/wrae155
Ostrander, C. M., Y. Shu, S. G. Nielsen, O. Dellwig, J. Blusztajn, H. N. Schulz-Vogt, V. Hübner and C. M. Hansel (2024). Anthropogenic forcing of the Baltic Sea thallium cycle. Environ. Sci. Technol. 58: 8510 – 8517, doi: 10.1021/acs.est.4c01487
Ownsworth, E., M. Moros, J. Lloyd, O. Bennike, J. B. Jensen, T. Blanz and D. Selby (2024). Multi-proxy palaeoenvironmental reconstruction of the Skagerrak from the Lateglacial to Middle Holocene. Boreas 53: 360 – 375, doi: 10.1111/bor.12652
Pagli, B., M. Duphil, S. Jullien, C. Dutheil, A. Peltier and C. Menkes (2024). Wave climate around New Caledonia. Clim. Dyn. 62: 88658887, doi: 10.1007/s00382-024-07365-1
Pham, A. H., N. Choisnard, A. FernándezCarrera, A. Subramaniam, E. K. Strope, E. J. Carpenter, M. Voss and J. P. Montoya (2024). Planktonic habitats in the Amazon plume region of the Western Tropical North Atlantic. Front. Mar. Sci. 11: 1287497, doi: 10.3389/fmars.2024.1287497
Pham, D. N., A. Ruhl, K. Fisch, S. El Toum, S. Heise and I. M. Sokolova (2024). Effects of contamination and warming on ragworms Hediste diversicolor: A laboratory experiment with Oder estuary sediments. Estuar. Coast. Shelf Sci. 299: 108702, doi: 10.1016/j.ecss.2024.108702
Piontek, J., C. Hassenrück, B. Zäncker and K. Jürgens (2024). Environmental control and metabolic strategies of organic-matter-responsive bacterioplankton in the Weddell Sea (Antarctica). Environ. Microbiol. 26: e16675, doi: 10.1111/1462-2920.16675
Piret, L., S. Bertrand, C. Moffat, P. Feldens, S. Papenmeier and H. W. Arz (2024). Recent ice-contact delta formation in front of Pio XI glacier controls sedimentary processes in Eyre Fjord, Patagonia. Earth Surface Processes and Landforms 49: 5054 – 5068, doi: 10.1002/esp.6012
Premaratne, K. M., R. Chandrajith, N. P. Ratnayake, S.-L. Li, K. Gayantha and J. Routh (2024). North Atlantic forcing of Indian Winter Monsoon intensification: Evidence from Holocene sediments from the tropical Indian Ocean Island of Sri Lanka. Holocene 34: 274 – 282, doi: 10.1177/09596836231211875
Rain-Franco, A., H. Peter, G. Pavan de Moraes and S. Beier (2024). The cost of adaptability: resource availability constrains functional stability under pulsed disturbances. mSphere 9: e00727, doi: 10.1128/msphere.00727-23
Receveur, A., C. Menkes, M. Lengaigne, A. Ariza, A. Bertrand, C. Dutheil, S. Cravatte, V. Allain, L. Barbin, A. Lebourges-Dhaussy, P. Lehodey and S. Nicol (2024). A rare oasis effect for forage fauna in oceanic eddies at the global scale. Nat. Commun. 15: 4834, doi: 10.1038/s41467-024-49113-3
Reckhardt, A., R. Meyer, S. L. Seibert, J. Greskowiak, M. Roberts, S. Brick, G. Abarike,
K. Amoako, H. Waska, K. Schwalfenberg, I. Schmiedinger, O. Wurl, M. E. Böttcher, G. Massmann and K. Pahnke (2024). Spatial and temporal dynamics of groundwater biogeochemistry in the deep subsurface of a high-energy beach. Mar. Chem. 267: 104461, doi: 10.1016/j.marchem.2024.104461
Reese, L., U. Gräwe, K. Klingbeil, X. Li, M. Lorenz and H. Burchard (2024). Local mixing determines spatial structure of diahaline exchange flow in a mesotidal estuary: A study of extreme runoff conditions. J. Phys. Oceanogr. 54: 3 – 27, doi: 10.1175/JPO-D-23-0052.1
Reineccius, J. and J. J. Waniek (2024). Critical reassessment of microplastic abundances in the marine environment. Sci. Total Environ. 954: 176449, doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.176449
Reineccius, J., M. Heck and J. J. Waniek (2024). Microplastic Particles and Fibers in Seasonal Ice of the Northern Baltic Sea. Toxics 12: 542, doi: 10.3390/toxics12080542
Rengefors, K., N. Annenkova, J. Wallenius, M. Svensson, A. Kremp and D. Ahrén (2024). Population genomic analyses reveal that salinity and geographic isolation drive diversification in a free-living protist. Sci. Rep. 14: 4986, doi: 10.1038/s41598-024-55362-5
Riedinger, D. J., V. Fernández-Juárez, L. F. Delgado, T. Sperlea, C. Hassenrück, D. P. R. Herlemann, C. Pansch, M. Kataržytė, F. Bruck, A. Ahrens, M. Rakowski, K. Piwosz, A. Stevenson, T. B. H. Reusch, G. Gyraitė, D. Schulz-Bull, H. Benterbusch-Brockmöller, S. Kube, S. Dupke, A. F. Andersson, L. Riemann and M. Labrenz (2024). Control of Vibrio vulnificus proliferation in the Baltic Sea through eutrophication and algal bloom management. Commun. Earth Environ. 5: 246, doi: 10.1038/s43247-024-01410-x
Rita, D., A. Borrell, D. Wodarg, G. Víkingsson, R. García-Vernet, A. Aguilar and N. Loick-Wilde (2024). Amino acid-specific nitrogen stable isotope analysis reveals the trophic behavior of Icelandic fin whales in winter and suggests variable feeding strategies. Mar. Mamm. Sci. 40: e13097, doi: 10.1111/mms.13097
Robbe, E., L. B. Abdallah, L. El Fels, N. E. H. Chaher, M. Haseler, F. Mhiri and G. Scher-
newski (2024). Towards solving the beach litter problem: Ecosystem service assessments at North African coasts. Sustainability 16: 5911, doi: 10.3390/su16145911
Robbe, E., L. Rogge, J. Lesutienė, M. Bučas and G. Schernewski (2024). Assessment of Ecosystem Services Provided by Macrophytes in Southern Baltic and Southern Mediterranean Coastal Lagoons. Environ. Manage. 74: 206 – 229, doi: 10.1007/s00267-024-01955-9
Rodrigues, J. V., L. C. Cotovicz Jr., N. Beloto, M. R. Gmach and L. E. A. Bezerra (2024). Historical land use changes lead to massive loss of soil carbon stocks in a recovering, semiarid mangrove. Mar. Poll. Bull. 208: 116980, doi: 10.1016/j.marpolbul.2024.116980
Rodríguez-Marconi, S., B. Krock, U. Tillmann, A. Tillmann, D. Voss, O. Zielinski, M. Vásquez and N. Trefault (2024). Diversity of eukaryote plankton and phycotoxins along the West Kalaallit Nunaat (Greenland) coast. Front. Mar. Sci. 11: 1443389, doi: 10.3389/fmars.2024.1443389
Rollwage, L., O. Sánchez-Guillamón, C. Sippl, R. León, J. T. Vázquez, M. Urlaub, F. Gross, C. Böttner, S. Krastel and J. Geersen (2024). Geomorphological evidence for volcano-tectonic deformation along the unstable western flank of Cumbre Vieja Volcano (La Palma). Geomorphology 465: 109401, doi: 10.1016/j.geomorph.2024.109401
Romahn, J., D. Baranski, A. Schmidt, J. Kaiser, H. W. Arz, L. S. Epp, A. Kremp and M. Bálint (2024). Glimpse of past dynamics: A new set of phytoplankton primers for sedaDNA. Environ. DNA 6: e577, doi: 10.1002/edn3.577
Rooze, J., M. A. Zeller, M. Gogina, P. Roeser, J. Kallmeyer, M. Schönke, H. Radtke and M. E. Böttcher (2024). Bottom-trawling signals lost in sediment: A combined biogeochemical and modeling approach to early diagenesis in a perturbed coastal area of the southern Baltic Sea. Sci. Total Environ. 906: 167551, doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.167551
Rostami, M., L. Severino, S. Petri and S. Hariri (2024). Dynamics of localized extreme heatwaves in the mid‐latitude atmosphere: A conceptual examination. Atmos. Sci. Lett. 25: e1188, doi: 10.1002/asl.1188
Ruvalcaba Baroni, I., E. Almroth-Rosell, L. Axell, S. T. Fredriksson, J. Hieronymus, M. Hieronymus, S.-E. Brunnabend, M. Gröger, I. Kuznetsov, F. Fransner, R. Hordoir, S. Falahat and L. Arneborg (2024). Validation of the coupled physical-biogeochemical ocean model NEMO-SCOBI for the North Sea-Baltic Sea system. Biogeosciences 21: 2087 – 2132, doi: 10.5194/bg-21-2087-2024
Sabbaghzadeh, B., G. Uher and R. Upstill-Goddard (2024). “Dynamics of chromophoric dissolved organic matter in the Atlantic Ocean: unravelling province-dependent relationships, optical complexity, and environmental influences”. Front. Mar. Sci. 11: 1432133, doi: 10.3389/fmars.2024.1432133
Saez, P. S., C. Eden and M. Chouksey (2024). Evolution of internal gravity waves in a mesoscale eddy simulated using a novel model. J. Phys. Oceanogr. 54: 985 – 1002, doi: 10.1175/JPO-D-23-0095.1
Safonova, K., H. E. M. Meier and M. Gröger (2024). Summer heatwaves on the Baltic Sea seabed contribute to oxygen deficiency in shallow areas. Commun. Earth Environ. 5: 106, doi: 10.1038/s43247-02401268-z
Saghravani, S. R., M. E. Böttcher, W. L. Hong, K. Kuliński, A. Lepland, A. Sen and B. Szymczycha (2024). Distributions of in situ parameters, dissolved (in)organic carbon, and nutrients in the water column and pore waters of Arctic fjords (western Spitsbergen) during a melting season. Earth Syst. Sci. Data 16: 3419 – 3431, doi: 10.5194/essd-16-3419-2024
Scales, B. S., C. Hassenrück, L. Moldaenke, J. Hassa, C. Rückert-Reed, C. Rummel, C. Völkner, R. Rynek, T. Busche, J. Kalinowski, A. Jahnke, M. Schmitt-Jansen, K. Wendt-Potthoff and S. Oberbeckmann (2024). Hunting for pigments in bacterial settlers of the Great Pacific Garbage Patch. Environ. Microbiol. 26: e16639, doi: 10.1111/1462-2920.16639
Schaub, I., R. Friedland and M. L. Zettler (2024). Good-Moderate boundary setting for the environmental status assessment of the macrozoobenthos communities with the Benthic Quality Index (BQI) in the south-western Baltic Sea. Mar. Poll. Bull. 201: 116150, doi: 10.1016/j.marpolbul.2024.116150
Schernewski, G., G. Escobar Sánchez, S. Felsing, M. Gatel Rebours, M. Haseler, R. Hauk, X. Lange and S. Piehl (2024). Emission, transport and retention of floating marine macro-litter (plastics): The Role of Baltic harbor and sailing festivals. Sustainability 16: 1220, doi: 10.3390/su16031220
Schernewski, G., M. Jekat, F. Kösters, T. Neumann, S. Steffen and M. von Thenen (2024). Ecosystem Services Supporting Environmental Impact Assessments (EIAs): Assessments of Navigation Waterways Deepening Based on Data, Experts, and a 3D Ecosystem Model. Land 13: 1653, doi: 10.3390/land13101653
Schernewski, G., T. Neumann, M. Bučas and M. v. Thenen (2024). Ecosystem Services of the Baltic Sea - State and Changes during the Last 150 Years. Environments 11, doi: 10.3390/environments11090200
Schmidt, A., J. Romahn, E. Andren, A. Kremp, J. Kaiser, H. W. Arz, O. Dellwig, M. Balint and L. S. Epp (2024). Decoding the Baltic Sea’s past and present: A simple molecular index for ecosystem assessment. Ecol. Indic. 166: 112494, doi: 10.1016/j.ecolind.2024.112494
Schmitt, M., H. T. Pham, S. Sarkar, K. Klingbeil and L. Umlauf (2024). Diurnal Warm Layers in the ocean: Energetics, non-dimensional scaling, and parameterization. J. Phys. Oceanogr. 54: 1037 – 1055, doi: 10.1175/JPO-D-23-0129.1
Senckenberg Ocean Species Alliance (SOSA), A. Brandt, C. Chen, L. Engel, P. Esquete, T. Horton, A. M. Jazdzewska, N. Johannsen, S. Kaiser, T. C. Kihara, H. Knauber, K. Kniesz, J. Landschoff, A. N. Lorz, F. M. Machado, C. A. Martinez-Munoz, T. Riehl, A. Serpell-Stevens, J. D. Sigwart, A. H. S. Tandberg, R. Tato, M. Tsuda, K. Voncina, H. K. Watanabe, C. Wenz and J. D. Williams (2024). Ocean Species Discoveries 1-12 - A primer for accelerating marine invertebrate taxonomy. Biodivers Data J 12: e128431, doi: 10.3897/BDJ.12.e128431
Skogen, M. D., J. M. Aarflot, L. M. GarcíaGarcía, R. Ji, M. Ruiz-Villarreal, E. Almroth-Rosell, A. Belgrano, D. Benkort, U. Daewel, M. Edman, R. Friedland, S. Gao, M. Hill-Cruz, S. S. Hjøllo, M. Huret, J. B. Kellner, S. van Leeuwen, A. Lopez de Gamiz-Zearra, M. Maar, E. A. Mousing, M. A. Peck, A. Pastor Rollan, S. F. Sailley, S. Saraiva, C. Speakman, T. Troost and V. Ç. Yumruktepe (2024). Bridging the gap:
integrating models and observations for better ecosystem understanding. Mar. Ecol. Prog. Ser. 739: 257 – 268, doi: 10.3354/meps14616
Smrzka, D., J. Zwicker, H. N. Schulz-Vogt, C. T. S. Little, M. Rieder, P. Meister, S. Gier and J. Peckmann (2024). Fossilized giant sulfide-oxidizing bacteria from the Devonian Hollard Mound seep deposit, Morocco. Geobiology 22: e12581, doi: 10.1111/gbi.12581
Socrate, J., E. Verón and G. García (2024). Contributions to the planning of argentine maritime spaces: The Northern Patagonian socioecological system as a case study. Mar. Policy 168: 106322, doi: 10.1016/j.marpol.2024.106322
Socrate, J., E. Verón and M. Chaparro (2024). Public perception of offshore hydrocarbon activities in the North Argentine Basin: a study in Buenos Aires Province, Argentina. J. Coast. Conserv. 28: 77, doi: 10.1007/s11852-024-01078-7
Speidel, L. G., R. Carvalho da Silva, M. Beck, O. Dellwig, J. Wollschläger, T. Dittmar and M. Seidel (2024). Rivers and tidal flats as sources of dissolved organic matter and trace metals in the German Bight (North Sea). Biogeochemistry 167: 225 – 250, doi: 10.1007/s10533-024-01117-3
Steinkopf, M., U. Krumme, D. Schulz-Bull, D. Wodarg and N. Loick-Wilde (2024). Trophic lengthening triggered by filamentous, N2-fixing cyanobacteria disrupts pelagic but not benthic food webs in a large estuarine ecosystem. Ecol. Evol. 14: e11048, doi: 10.1002/ece3.11048
Svennevig, K., M. J. Owen, M. Citterio, T. Nielsen, S. Rosing, J. Harff, R. Endler, M. Morlighem and E. Rignot (2024). Holocene gigascale rock avalanches in Vaigat strait, West Greenland—Implications for geohazard. Geology 52: 147 – 152, doi: 10.1130/g51234.1
Taenzer, L., W. Pardis, S. D. Wankel, M. Kolbe, M. Voss, H. N. Schulz-Vogt, C. Burmeister, D. S. Hardisty and C. M. Hansel (2024). Subsurface Superoxide Spans the Baltic Sea. J. Geophys. Res. Oceans 129: e2024JC021438, doi: 10.1029/2024JC021438
Tagg, A. S., T. Sperlea, C. Hassenrück, B. Kreikemeyer, D. Fischer and M. Labrenz
(2024). Microplastic-antifouling paint particle contamination alters microbial communities in surrounding marine sediment. Sci. Total Environ. 926: 171863, doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.171863
Umbricht, J., A. Filella, A. Klett, A. Vogts, M. Benavides and M. Voss (2024). Uptake of dissolved inorganic nitrogen and N2 fixation by Crocosphaera watsonii under climate change scenarios. Front. Mar. Sci. 11, doi: 10.3389/fmars.2024.1388214
Umbricht, J., C. Burmeister, J. W. Dippner, I. Liskow, J. P. Montoya, A. Subramaniam and M. Voss (2024). Nitrate uptake and primary production along the Amazon River plume continuum. J. Geophys. Res. Biogeosciences 129: e2023JG007662, doi: 10.1029/2023JG007662
Vajedsamiei, J., N. Warlo, H. E. M. Meier and F. Melzner (2024). Predicting key ectotherm population mortality in response to dynamic marine heatwaves: A Bayesian-enhanced Thermal Tolerance Landscape approach. Functional Ecology 38: 1875 – 1887, doi: 10.1111/1365-2435.14620
Väli, G., H. E. M. Meier, T. Liblik, H. Radtke, K. Klingbeil, U. Gräwe and U. Lips (2024). Submesoscale processes in the surface layer of the central Baltic Sea: A high-resolution modelling study. Oceanologia 66: 78 – 90, doi: 10.1016/j.oceano.2023.11.002
Vanharanta, M., M. Santoro, C. Villena-Alemany, J. Piiparinen, K. Piwosz, H.-P. Grossart, M. Labrenz and K. Spilling (2024). Microbial remineralization processes during post-spring-bloom with excess phosphate available in the northern Baltic Sea. FEMS Microbiol. Ecol.: online, fiae103, doi: 10.1093/femsec/fiae103
Vedenin, A. A., I. Kröncke, A. J. Beck, A. Bodenbinder, E. Chrysagi, U. Gräwe, M. Kampmeier and J. Greinert (2024). Spatial structure and biodiversity of macrofauna around marine munition dumpsites - A case study from the Baltic Sea. Mar. Poll. Bull. 198: 115865, doi: 10.1016/j.marpolbul.2023.115865
Veeningen, R., A. Fall, M. E. Böttcher, P. Eichhubl, K. Decker and B. Grasemann (2024). Deformation and fluid flow history of a fractured basement hydrocarbon reservoir below the Sab’atayn Basin, Habban Field, Yemen. Mar. Pet. Geol. 169, doi: doi. org/10.1016/j.marpetgeo.2024.107082
Wåhlström, I., E. Almroth-Rosell, M. Edman, M. Olofsson, K. Eilola, V. Fleming, M. Gröger, L. Arneborg and H. E. M. Meier (2024). Increased nutrient retention and cyanobacterial blooms in a future coastal zone. Estuar. Coast. Shelf Sci. 301: 108728, doi: 10.1016/j.ecss.2024.108728
Wilson, S. J., A. Moody, T. McKenzie, M. B. Cardenas, E. Luijendijk, A. H. Sawyer, A. Wilson, H. A. Michael, B. Xu, K. L. Knee, H.-M. Cho, Y. Weinstein, A. Paytan, N. Moosdorf, C.-T. A. Chen, M. Beck, C. Lopez, D. Murgulet, G. Kim, M. A. Charette, H. Waska, J. S. P. Ibánhez, G. Chaillou, T. Oehler, S.-i. Onodera, M. Saito, V. Rodellas, N. Dimova, D. Montiel, H. Dulai, C. Richardson, J. Du, E. Petermann, X. Chen, K. L. Davis, S. Lamontagne, R. Sugimoto, G. Wang, H. Li, A. I. Torres, C. Demir, E. Bristol, C. T. Connolly, J. W. McClelland, B. J. Silva, D. Tait, B. Kumar, R. Viswanadham, V. Sarma, E. Silva-Filho, A. Shiller, A. Lecher, J. Tamborski, H. Bokuniewicz, C. Rocha, A. Reckhardt, M. E. Böttcher, S. Jiang, T. Stieglitz, H. G. V. Gbewezoun, C. Charbonnier, P. Anschutz, L. M. Hernández-Terrones, S. Babu, B. Szymczycha, M. Sadat-Noori, F. Niencheski, K. Null, C. Tobias, B. Song, I. C. Anderson and I. R. Santos (2024). Global subterranean estuaries modify groundwater nutrient loading to the ocean. Limnol. Oceanogr. Lett. 9: 411 – 422, doi: 10.1002/lol2.10390
Wimart-Rousseau, C., T. Steinhoff, B. Klein, H. C. Bittig and A. Körtzinger (2024). Technical note: Assessment of float pH data quality control methods - a case study in the subpolar northwest Atlantic Ocean. Biogeosciences 21: 1191 – 1211, doi: 10.5194/bg-21-1191-2024
Xie, R., L. Lin, C. Shi, P. Zhang, P. Rao, J. Li and D. Izabel-Shen (2024). Elucidating the links between N2O dynamics and changes in microbial communities following saltwater intrusions. Environ. Res. 245: 118021, doi: 10.1016/j.envres.2023.118021
Yau, Y. Y. Y., A. Cabral, G. Reithmaier, L. C. Cotovicz Jr., J. Barreira, G. Abril, C. Morana, A. V. Borges, W. Machado, J. M. Godoy, S. Bonaglia and I. R. Santos (2024). Efficient oxidation attenuates porewater-derived methane fluxes in mangrove waters. Limnol. Oceanogr. 69: 1997 – 2014, doi: 10.1002/lno.12639
Zalasiewicz, J., M. J. Head, C. N. Waters, S. D. Turner, P. K. Haff, C. Summerhayes, M. Williams, A. Cearreta, M. Wagreich, I.
Fairchild, N. L. Rose, Y. Saito, R. Leinfelder, B. Fiałkiewicz-Kozieł, Z. An, J. Syvitski, A. Gałuszka, F. M. G. McCarthy, J. I. d. Sul, A. Barnosky, A. B. Cundy, J. R. McNeill and J. Zinke (2024). The Anthropocene within the Geological Time Scale: a response to fundamental questions. International Union of Geological Sciences 47: 65 – 83, doi: 10.18814/epiiugs/2023/023025
Zarghamipour, M., H. Malakooti and M. H. Bordbar (2024). Air-Sea CO2 exchange over the Mediterranean Sea, the Red Sea and the Arabian Sea. Int. J. Environ. Res. 18: 36, doi: 10.1007/s41742-024-00586-6
Zarghamipour, M., H. Malakooti and M. H. Bordbar (2024). Spatio-temporal analysis of the factors affecting NOx concentration during the evaluation cycle of high pollution episodes in Tehran metropolitan. Atmos. Pollut. Res. 15: 102177, doi: 10.1016/j.apr.2024.102177
Zeller, M. A., B. R. Van Dam, C. Lopes, A. M. McKenna, C. L. Osburn, J. W. Fourqurean, J. S. Kominoski and M. E. Böttcher (2024). The unique biogeochemical role of carbonateassociated organic matter in a subtropical seagrass meadow. Commun. Earth Environ. 5: 681, doi: 10.1038/s43247-024-01832-7
Zettler, M. L. (2024). Re-establishment of Malletia sorror (Soot-Ryen, 1957), an endemic bathyal bivalve off Chile (Mollusca: Bivalvia: Nuculanoidea). Gayana 88(2): 320 – 326
Zilius, M., R. Barisevičiūtė, S. Bonaglia, I. Klawonn, E. Lorre, T. Politi, I. VybernaitėLubienė, M. Voss, D. Overlingė and P. A. Bukaveckas (2024). The effects of variable riverine inputs and seasonal shifts in phytoplankton communities on nitrate cycling in a coastal lagoon. Front. Mar. Sci. 11, doi: 10.3389/fmars.2024.1497246
Hinz, M., P. Westfeld, P. Feldens, A. Feldens, S. Themann and S. Papenmeier (2024). AI-based boulder detection in sonar databridging the gap from experimentation to application. Int. Hyd. Rev. 30: 78 – 98, doi: 10.58440/ihr-30-1-a08
Tagg, A. S. and M. Labrenz (2024). Impacts of Climate Change on Microbial Communities in the Baltic Sea. Oxford Research
Encyclopedia of Climate Science, doi: 10.1093/acrefore/9780190228620.013.892
Zettler, M. L. (2024). Bericht über das 42. Kartierungstreffen der Arbeitsgruppe Malakologie Mecklenburg-Vorpommern vom 3. bis 5. Mai 2024 in Kamminke (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Mitt. Dtsch. Malakozool. Ges. 111: 63-71, http://www.dmg. mollusca.de/images/mitteilungen_dmg/ mitteilungen111/mitt_dmg_111_063071_zettler.pdf
Böttcher, M. E., U. Mallast, G. Massmann, N. Moosdorf, M. Müller-Petke and H. Waska (2024). Coastal-Groundwater Interfaces (Submarine Groundwater Discharge). In: Ecohydrological Interfaces. Ed. by S. Krause, D. M. Hannah and N. B. Grimm. 1st ed. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated: 123 – 147, 978-1-119-48966-5
Brandt, P., M. H. Bordbar, P. Coelho, R. A. I. Koungue, M. Körner, T. Lamont, J. F. Lübbecke, V. Mohrholz, A. Prigent, M. Roch, M. Schmidt, A. K. van der Plas and J. Veitch (2024). Physical drivers of southwest African coastal upwelling and its response to climate variability and change. In: Sustainability of Southern African Ecosystems under Global Change: Science for Management and Policy Interventions. Ed. by G. P. von Maltitz, G. F. Midgley, J. Veitch, C. Brümmer, R. P. Rötter, F. A. Viehberg and M. Veste. Cham: Springer International Publishing: 221 – 257, 978-3-031-10948-5, doi: 10.1007/978-3-031-10948-5_9
Gogina, M., I. Kröncke, D. Marx and M. L. Zettler (2024). Status und Trends der biologischen Vielfalt an Küsten und in Küstengewässern. Zoobenthos. In: Faktencheck Artenvielfalt: Bestandsaufnahme und Perspektiven für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschland. Ed. by C. Wirth, H. Bruelheide, N. Farwig, J. M. Marx and J. Settele. München: oekom 681 – 684, 978-3-98726-095-7, doi: 10.14512/9783987263361
ICES, J. Beermann, S. Birchenough, M. Blomqvist, R. Boschen-Rose, L. Buhl Mortensen, J. Craeymeersch, J. Dannheim, S. Degraer, N. Desroy, A. Donnay, E. Farrell, L. Guérin, S. Glorius, L. Healy, H. Hillewaert, M. Gogina, Y. Griffiths, W. Hunter, U. Janas, C. Labrune, P. Magni, H. Nygård, E. Oug, S.
Parra, H. Reiss, H. C. Trannum, J. Vanaverbeke, G. Van Hoey, J. Warzocha, A. Wrede and M. L. Zettler (2024). Benthos Ecology Working Group (BEWG; outputs from 2023 meeting) (BEWG). In: ICES Scientific Reports. Ed. by J. Craeymeersch and P. Magni. International Council for the Exploration of the Sea (ICES) - Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) 06: 26, doi: 10.17895/ices.pub.27257232.v1
Oschlies, A., N. Mengis, G. Rehder, E. Schill, H. Thomas, K. Wallmann and M. Zimmer (2024). Mögliche Beiträge geologischer und mariner Kohlenstoffspeicher zur Dekarbonisierung. In: Klimawandel in Deutschland: Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven. Ed. by G. P. Brasseur, D. Jacob and S. Schuck-Zöller. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg: 449 – 458, doi: 10.1007/978-3-662-66696-8_35
Zielinski, O. (2024). Geleitwort. In: Regenerative Zukünfte und künstliche Intelligenz. Ed. by K. Gondlach, B. Brinkmann, M. Brinkmann and J. Plath. Wiesbaden: Springer 1: XIII-XV, 978-3-658-43585-1, doi: 10.1007/978-3-658-43586-8
Kremp, A., J. Dutz and M. L. Zettler (2024). Biological assessment of the Baltic Sea 2021. Rostock: Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde. 89 S. (Meereswissenschaftliche Berichte = Marine Science Reports; 124), doi: 10.12754/msr-2024-0124
Marx, D., K. Romoth, S. Papenmeier, J. Valerius, S. Eisenbarth and K. Heinicke (2024). Die Biotope des Meeresbodens im Naturschutzgebiet “Kadetrinne”. Bonn: Bundesamt für Naturschutz. (BfN-Schriften; 690), doi: 10.19217/skr690
Matthäus, W. (2024). Die Forschungsschiffe und autonomen Messsysteme des Instituts für Meereskunde Warnemünde – ihre Geschichte und ihr Verbleib. Rostock: Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde. 111 S. (Meereswissenschaftliche Berichte = Marine Science Reports; 126), doi: 10.12754/msr-2024-0126
Naumann, M., U. Gräwe, L. Umlauf, H. Burchard, V. Mohrholz, J. Kuss, M. Kanwischer, H. Osterholz, S. Feistel, I. Hand, J. J. Waniek and D. E. Schulz-Bull (2024). Hydrographic-hydrochemical asse2ssment of the Baltic Sea 2022. Warnemünde: Leibniz
Institute for Baltic Sea Research. (Meereswissenschaftliche Berichte), doi: 10.12754/msr-2024-0127
Naumann, M., U. Gräwe, V. Mohrholz, J. Kuss, M. Kanwischer, H. Osterholz, S. Feistel, I. Hand and J. J. Waniek (2024). Hydrographic-hydrochemical assessment of the Baltic Sea 2023. Warnemünde: Leibniz Institute for Baltic Sea Research. (Meereswissenschaftliche Berichte), doi: 10.12754/msr-2024-128.
Tagg, A. and M. Labrenz (2024). The Microplastic Pollution Problem and the sea. “Mum, can we play in the sand?” A child-centric microbiology education framework. 12 S., http://www.imili-eah. com/api/profile/upload/2024/02/22/ The%20microplastic%20pollution%20problem_20240222101604A314.pdf
Thonicke, K., E. Rahner, A. Arneth, A. Bonn, N. Borchard, A. Chaudhary, M. Darbi, T. Dutta, U. Eberle, N. Eisenhauer, N. Farwig, C. G. Flocco, J. Freitag, P. Grobe, R. Grosch, H. P. Grossart, A. Grosse, K. Grützmacher, N. Hagemann, B. Hansjürgens, A. Hartman Scholz, C. Hassenrück, C. Häuser, T. Hickler, F. Hölker, U. Jacob, S. Jähnig, K. Jürgens, S. Kramer-Schadt, C. Kretsch, C. Krug, J. P. Lindner, L. Loft, C. Mann, B. Matzdorf, M. Mehring, R. Meier, K. Meusemann, D. Müller, M. Nieberg, J. Overmann, R. S. Peters, L. Pörtner, P. Pradhan, A. Prochnow, V. Rduch, C. Reyer, C. Roos, C. Scherber, N. Scheunemann, S. Schroer, A. Schuck, G. B. Sioen, S. Sommer, N. Sommerwerk, F. Tanneberger, K. Tockner, H. van der Voort, T. Veenstra, P. Verburg, M. Voss, B. Warner, W. Wende and K. Wesche (2024). 10 Must-Knows aus der Biodiversitätsforschung 2024. Potsdam: Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität. 72 S. doi: 10.5281/zenodo.10794361
Zettler, M. L., A. Kremp and J. Dutz (2024). Biological assessment of the Baltic Sea 2022. Rostock: Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde. 86 S. (Meereswissenschaftliche Berichte = Marine Science Reports; 125), doi: 10.12754/msr-2024-0125
Ahola, M., L. Bergström, M. Blomqvist, D. Boedeker, F. Börgel, I. Carlén, T. Carlund, J. Carstensen, J. P. A. Christensen, J. De La Cueva, M. Futter, E. Gaget, O. Glibko, M. Gröger, V. Dierschke, C. Dieterich, M. Frederiksen, A. Galatius, B. Gustafsson, C. Frauen, A. Halkka, C. Halling, N. Heibeck, J. Holfort, M. Huss, K. Hyytiäinen, K. Jürgens, M. Jüssi, M. Kallasvuo, M. Kankainen, B. Karlson, A. M. Karlsson, M. Karlsson, A. Kiessling, E. Kjellström, A. Kontautas, D. Krause-Jensen, A. Kremp, K. Kuliński, S. Kuningas, J. Käyhkö, J. Laht, A. Laine, M. Labrenz, G. Lange, A. Lappalainen, T. Laurila, M. Lehtiniemi, K.-O. Lerche, U. Lips, G. Martin, M. McCrackin, H. E. M. Meier, N. Mustamäki, B. Müller-Karulis, R. Naddafi, L. Niskanen, A. Nyström Sandman, J. Olsson, O. Outinen, D. Pavón-Jordán, J. Pålsson, M. Rantanen, A. Razinkovas-Baziukas, G. Rehder, J. H. Reißmann, M. Reutgård, S. Ross, A. Rutgersson, J. Saarinen, L. Saks, O. Savchuk, G. Schernewski, J. Schumacher, M. Sofiev, K. Spich, G. Srėbalienė, S. Suikkanen, J. Särkkä, M. Viitasalo, J. Vielma, J. Virtasalo, I. Wallin, R. Weisse, J. Wikner, W. Zhang, E. Zorita and Ö. Östman (2024). Climate Change in the Baltic Sea 2024 Fact Sheet. HELCOM Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission. https://helcom. fi/wp-content/uploads/2024/10/BalticSea-Climate-Change-Fact-Sheet_2024.pdf
Auge, T., S. Feistel, F. J. Ekaputra, M. Klettke, S. Jürgensmann, E. Michels and L. Waltersdorfer (2024). Towards an Integrated Provenance Framework: A Scenario for Marine Data. 2024 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops, Vienna, Institute of Electrical and Electronics Engineers: 597-601
Bathmann, U., P. Braun and I. Meinke (2024). Abschlussbericht des KüNO III Dachprojektes – Koordination und Transfer (CoTrans).
Björner, M., F. Furkert, A. Hermann, R. Wagner, S. Neubert and M. Naumann (2024). Evaluation of Low-Cost Hydrographic Sensors for Increased Monitoring Density in Coastal Oceans. 2024 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS), Naples, Italy: 1 – 5 doi: 10.1109/SAS60918.2024.10636439
Estelmann, A. and R. D. Prien (2024). Cryptophane A-Based Methane Sensing in the Aqueous and Gas Phase. OCEANS 2024
- Halifax, Halifax, Institute of Electrical and Electronics Engineers: 01-08 doi: 10.1109/OCEANS55160.2024.10754500
Feistel, R. (2024). Thermodynamics of Water in the “Steam Engine” Climate. Gibbs Award Lecture, 18th International Conference on the Properties of Water and Steam, 24 June 2024, Boulder, USA doi: 10.13140/RG.2.2.22056.75522
Gebbe, R., K. Kesy, D. Hallier, A. Brauer, S. Bertilsson, M. Labrenz and M. M. Bengtsson (2024). The ecology of potentially pathogenic Vibrio spp. in a seagrass meadow ecosystem. bioRxiv: 2024.06.15.599152, doi: 10.1101/2024.06.15.599152
Kreuzburg, M., C. Baatz, L. Bednarz, M. Böttcher, C. Merk, T. Morganti, L. Tank, W. B. Yao, H. Wehnert and G. Rehder (2024). Unified ASsessment framework for proposed methods of MArine CDR and interim knowledge SYnthesiS (ASMASYS). Rostock: 1 – 38 S. doi: 10.3289/CDRmare.37
Krüger, F., D. Waltemath, R. Ludwig, M. Schröder, U. Henny-Krahmer, S. Spors, S. Scheel, R. Schneider, J. Novak, S. Schmidt, S. Schick, K. Yordanova, S. Al-Suadi, M. Becker, H. Beelich, D. Bläsing, C. Brock, I. Bruder, K. Budde-Sagert, C. Cap, H. Dieckmann, A. Dorhoi, M. Dörr, A. Eggert, T. Fennel, H. Fischer, W. Flügge, L.-A. Garbe, P. Gröber, K.M. Henkel, R. Henkel, K. Hoff, F. Jansen, S. Jürgensmann, H. Jürß, R. Kammerer, D. Kaunaite, L. Kennes, M. Kerntopf, J. Kiesendahl, S. Klinger, U. Kragl, S. Kroll, K. Kubisch, R. Köhling, K. Labahn, H. Lebert, M. Manzke, J. Matela, P. Mattern, F. Meinel, J. Michael, H. Murua Escobar, M. Premke-Kraus, I. Rusch, C. Schmidt, C. Schmidt, F. Schmitt, S. Schnell, D. Schwerdt, J. Sender, A. Stahl, M. Stanke, G. Szepannek, A. Theise, M.-A. Weber, F. Winkelmann, C. Winterhalter, J. Wodke, F. Woitzel, N. Wrage-Mönnig and O. Zielinski (2024). Bedarfsermittlung für die FDM-Landesinitiative in Mecklenburg-Vorpommern: Ergebnisse des Vernetzungstreffens Forschungsdatenmanagement vom 04.12.2023. Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.10798387
Lindmark, M., F. Maioli, S. C. Anderson, M. Gogina, V. Bartolino, M. Sköld, M. Ohlsson, A. Eklöf and M. Casini (2024). Quantifying competition between two demersal fish species from spatiotemporal stomach content data. bioRxiv, doi: 10.1101/2024.04.22.590538
Löschke, S., M. Kreuzburg, G. Rehder, M. Böttcher, L. Tank, C. Baatz and ASMASYSKonsortium (2024). CDRmare Insights: Neuer Leitfaden: Marine CO2-Entnahmemethoden und -projekte einheitlich und wissensbasiert bewerten. 1 – 8 S. doi: 10.3289/CDRmare.40
Markfort, G., H. Schröder and O. Zielinski (2024). Digitalization and Augmentation of ROV Operations. OCEANS 2024 - Halifax, Halifax, IEEE: 1-5 doi: 10.1109/ OCEANS55160.2024.10754227
Meier, M. and K. Kulinski (2024). Scientific cooperation under changing geopolitics. Baltic Rim Economies 4/2024 - Germany. https://www.centrumbalticum.org/en/ publications/baltic_rim_economies/baltic_rim_economies_4_2024_-_germany/ markus_meier_karol_kulinski_scientific_ cooperation_under_changing_geopolitics
Prien, R. D. and M. Floth-Peterson (2024). Oxygen Optode Profiles - A Closer Look on Facts and Artefacts. OCEANS 2024 - Halifax, Halifax, NS, Canada, IEEE: 1-6
Rodiouchkina, K., S. Goderis, O. Karatekin, P. Claeys, M. E. Böttcher, F. Vanhaecke, C. Senel, I. Rodushkin, O. Temel, J. Vellekoop and P. Kaskes (2024). Reduced contribution of sulfur to the mass extinction associated with the Chicxulub impact event. EarthArXiv Preprints, doi: 10.31223/X5M99H
Saghravani, S. R., M. E. Böttcher, W. L. Hong, K. Kuliński, A. Lepland, A. Sen and B. Szymczycha (2024). Distributions of in situ parameters, dissolved (in)organic carbon, and nutrients in the water column and pore waters of Arctic fjords (western Spitsbergen) during a melting season. Earth Syst. Sci. Data Discuss. 2024: 3419-3431, doi: 10.5194/essd-16-3419-2024
Spilling, K., M. Vanharanta, M. Santoro, C. Villena-Alemany, M. Labrenz, H.-P. Grossart and K. Piwosz (2024). Effects of excess phosphate on a coastal plankton community. bioRxiv: 2024.02.05.576994, doi: 10.1101/2024.02.05.576994
Vanharanta, M., M. Santoro, C. Villena-Alemany, J. Piiparinen, K. Piwosz, H.-P. Grossart, M. Labrenz and K. Spilling (2024). Microbial remineralization processes during post-spring-bloom excess phosphate in the northern Baltic Sea. bioRxiv: 2024.02.02.577174, doi: 10.1101/2024.02.02.577174
STAND 31.12.2024
Woldemar Venohr (Vorsitzender)
Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern, Leiter der Abteilung 3
Dr. Zage Kaculewski (Stellvertretende Vorsitzende)
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), Leiterin Ref. 724
Peter Grönwoldt
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), Ref. 724
Holger Wandsleb
Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern, Leiter des Referats 340
Prof. Helge Heegewaldt
Präsident des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie
Prof. Dr. Elizabeth Prommer
Rektorin der Universität Rostock
Prof. Dr. Katja Fennel
(Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates) Dalhousie University, Kanada
Sabine Müller Geschäftsführerin Innomar Technologie Rostock
Prof. Dr. Katja Fennel (Vorsitzende) Dalhousie University, Kanada
Prof. Dr. Heinz Wilkes (Stellvertretender Vorsitzender) Universität Oldenburg, Institut für Chemie und Biologie des Meeres
Prof. Dr. Katarina Abrahamsson University of Gothenborg, Schweden
Prof. Dr. Gerhard Herndl Universität Wien, Österreich
Prof. Dr. Christian Hübscher Universität Hamburg, Marine Seismik und Hydroakustik
Prof. Dr. Jack Middelburg University of Utrecht, Niederlande
Dr. Uta Passow Memorial University of Newfoundland, Kanada
Prof. Dr. Niels Peter Revsbech Aarhus University, Dänemark
Prof. Dr. Anna Rutgersson Uppsala University, Schweden
STÄNDIGE MITGLIEDER
Prof. Dr. Helge W. Arz
Leiter der Sektion Marine Geologie
Prof. Dr. Michael E. Böttcher
Stellv. Leiter der Sektion Marine Geologie
Prof. Dr. Klaus Jürgens
Stellv. Leiter der Sektion Biologische Meereskunde
Prof. Dr. Markus Meier
Leiter der Sektion Physikalische Ozeanographie und Messtechnik
Dr. Volker Mohrholz
Stellv. Leiter der Sektion Physikalische Ozeanographie und Messtechnik
Prof. Dr. Gregor Rehder Leiter der Sektion Meereschemie
Prof. Dr. Heide Schulz-Vogt Leiterin der Sektion Biologische Meereskunde
Prof. Dr. Joanna Waniek
Stellv. Leiterin der Sektion Meereschemie
GEWÄHLTE MITGLIEDER DER SEKTIONEN
Dr. Henry Bittig (Sprecher) Sektion Meereschemie
Dr. Florian Börgel Sektion Physikalische Ozeanographie und Messtechnik
Dr. Jacob Geersen Sektion Marine Geologie
Dr. Isabell Klawonn Sektion Biologische Meereskunde
Abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten sind hier nicht gelistet
Noémie Joseph dit Choisnard
Aspects of the N-cycle of the Amazon River plume.
Universität Rostock
Betreuerin: Prof. Dr. Maren Voß
Gabriela Dangl
Microbial community dynamics and nitrous oxide production in the Benguela Upwelling System.
Universität Rostock
Betreuer: Prof. Dr. Klaus Jürgens
Sophie Kache
Bentho-pelagic transport of methanotrophs at methane gas seep sites.
Universität Rostock
Betreuerin: Prof. Dr. Maren Voß
Lev Naumov
Hypoxia in various coastal seas: Modelling and comparison.
Universität Rostock
Betreuer: Prof. Dr. Markus Meier
David Riedinger
Predictors of Vibrio vulnificus occurence: A machine learning approach.
Universität Rostock
Betreuer: Prof. Dr. Matthias Labrenz
Esther Robbe
Ecosystem service assessments of the coastal zone: Case studies and management implications.
Universität Klaipeda
Betreuer: Prof. Dr. Gerald Schernewski
Jacqueline Umbricht
Nitrogen assimilation and phytoplankton communities in changing environments.
Universität Rostock
Betreuerin: Prof. Dr. Maren Voß
Anna Katharina Wittenborn
A comprehensive study for the application of proxies based on glycerol dialkyl glycerol tetraethers in the Baltic Sea.
Universität Greifswald
Betreuer: Prof. Dr. Helge Arz
Mo Zhou
Analysis and tracking chlorinated hydrocarbons: PCB, DDT and HCB in Baltic Sea sediments.
Universität Rostock
Betreuerin: Prof. Dr. Joanna Waniek
PERSONAL*

FRAUEN MÄNNER
PUBLIKATIONEN
**** ohne student. und wiss. Hilfskräfte 87 106 30 2 225
PROMOTIONEN
9 abgeschlossene Promotionen, davon 7 Frauen
225 Mitarbeitende 44 betreute Promotionen, davon 27 Frauen
Auszubildende ** Wissenschaftstützendes Personal Promovierende Wissenschaftliches Personal *** Personal (Gesamt) ****
* nach Köpfen
** Stichtag: 15.10. des Jahres
*** ohne Promovierende
FINANZEN*
19,9
Mio. EUR INSTITUTIONELLE FÖRDERUNG
8,2 Mio EUR DRITTMITTEL
STAND 31.12.2024 1,0
201

Open Access
Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften 166 141

5,8 Mio. EUR Bund, davon
Mio. EUR Gesamt

29,1
Mio. EUR UMSATZERLÖSE UND SONST. BETR. ERTRÄGE
2,7 Mio. EUR BSH-Monitoring** 0,2 Mio. EUR SAW***
1,7 Mio. EUR DFG
0,4 Mio. EUR EU 0,2 Mio. EUR Sonstige
*Finanzdaten basierend auf der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) des IOW **Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie *** Leibniz-Wettbewerbsverfahren

KURATORIUM
Woldemar Venohr (Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern)
Dr. Zage Kaculevski (Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt) (Stellv. Vorsitz)
WISSENSCHAFTLICHER RAT
Dr. Henry Bittig (Sprecher)
VERWALTUNG
Beatrix Blabusch
Bereiche Finanzen/Personal/ Betriebstechnik
DIREKTOR
Prof. Dr. Oliver Zielinski
STELLV. DIREKTORIN
Prof. Dr. Heide Schulz Vogt
WISSENSCHAFTSMANAGEMENT
Dr. Matthias Premke-Kraus Bereiche Kommunikation/ Bibliothek
SEKTIONEN (ABTEILUNGEN)
BIOLOGISCHE MEERESKUNDE
Prof. Dr. Heide Schulz-Vogt
Prof. Dr. Klaus Jürgens (Stellv.)
FORSCHUNGSBEREICHE
MARINE GEOLOGIE
Prof. Dr. Helge Arz
Prof. Dr. Michael Böttcher (Stellv.)
WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
Prof. Dr. Katja Fennel (Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada)
KÜSTENMEERE & GESELLSCHAFT
Prof. Dr. Gerald Schernewski Miriam von Thenen (Stellv.)
VERTRETUNGEN
UND BEAUFTRAGTE
GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE
Dr. Marion Kanwischer
Dr. Svenja Papenmeier (Stellv.)
PERSONALRAT
Christian Burmeister
OMBUDSPERSONEN
Dr. Peter Holtermann
Prof. Dr. Maren Voß
DIVERSITÄTSBEAUFTRAGTE
Hendrikje Wehnert ARBEITSSICHERHEIT
Una Reck
PHYSIKALISCHE OZEANOGRAPHIE & MESSTECHNIK
Prof. Dr. Markus Meier Dr. Volker Mohrholz (Stellv.)
FB: 1 SKALEN- UND SYSTEMÜBERGREIFENDE SCHLÜSSELPROZESSE
FB 2: KÜSTENMEERE IM WANDEL
FB 3: NEUE TECHNOLOGIEN IN DER KÜSTENFORSCHUNG
ZENTRALE DIENSTE
ANALYTIK-GRUPPE
Dr. Marion Kanwischer
Una Reck
NANOSIMS
Dr. Angela Vogts
EDV
Dr. Steffen Bock
MEERESCHEMIE
Prof. Dr. Gregor Rehder
Prof. Dr. Joanna Waniek (Stellv.)

HERAUSGEBER
Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW)
Seestraße 15
18119 Rostock info@leibniz-iow.de www.leibniz-iow.de
REDAKTION
Dr. Matthias Premke-Kraus, Hendrikje Wehnert
Diese Publikation wurde unter teilweiser Nutzung von KI-basierten Werkzeugen erstellt. Dazu gehören Werkzeuge zur Textgenerierung und Recherche. Die redaktionelle Verantwortung und die endgültige Qualitätskontrolle lagen stets beim Redaktionsteam.
Die Publikation steht auf der Internetseite des IOW zum Herunterladen bereit: https://www.io-warnemuende.de/ jahresberichte.html
GESTALTUNG
JAKOTA Design Group GmbH
BILDNACHWEIS (SOFERN NICHT ANGEGEBEN)
Prien, IOW: S. 2/3, 58
Schmale, IOW: S. 4
Holtermann, IOW: S. 6
saitec: S.6
Nietz, IOW: S.7
Raeke, DWD: S.7
Meeske: S. 8
Premke-Kraus, IOW: S. 38, 46
WERK3: S. 41
Cwierz, IOW: S. 48
Giovanazzi, Leibniz-Gemeinschaft: S. 55
Wehnert, IOW: S. 64/65
IOW: S. 87, 89
Gohlke: Cover
Stand: November 2025
LEIBNIZ-INSTITUT FÜR OSTSEEFORSCHUNG WARNEMÜNDE (IOW)
Seestraße 15 18119 Rostock
info@leibniz-iow.de www.leibniz-iow.de
