
Themenhef von Hochparterre, Juni 2016
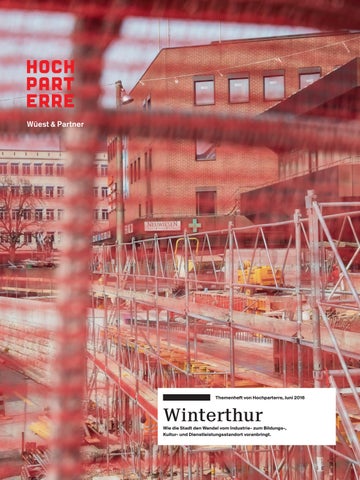

Themenhef von Hochparterre, Juni 2016
Wie die Stadt den Wandel vom Indusrie- zum Bildungs-, Kultur- und Diensleisungssandort voranbringt.

Inhalt
4 Die grosse Unbekannte
Einblicke in den Charakter der sechsgrössen Stadt der Schweiz.
8 Hirnschmalz sat Muskelkraf
Die Entwicklung zur Bildungssadt bedingt grosse Invesitionen.
12 Arbeitslätze braucht die Stadt
Die Zahl der Jobs hinkt dem Bevölkerungswachsum hinterher.
14 Taktgeber für preiswertes Wohnen
Die Genossenschafen realisieren neuartige Projekte.
15 Bauten und Projekte seit 2010
Die bauliche Entwicklung im Überblick.
20 Übersichtslan Winterthur auf einen Blick.
26 Ringen um den Raum
Der Verkehr und die Bedürfnisse der Menschen brauchen Platz.
30 Winterthur, ein Stimmungsbild
Die Eulachsadt bleibt sich trotz indusriellem Wandel treu.
32 Immobilienlandschaf in Bewegung Strategien, Akteure, Trends.
36 «Eine Stadt mit allem Drum und Dran»
Wie die Stadt die Entwicklung seuert – ein Gesräch.
Impressum
Editorial
Vor zehn Jahren widmete Hochparterre Winterthur erstmals ein Themenhef: ‹ Winterthur: Eine Stadt im Wandel ›. Die ehemaligen Industrieareale von Sulzer in der Stadtmite und in Oberwinterthur sowie das Bahnhofgebiet waren die grossen Themen. Vor Ort sah man davon allerdings noch wenig – viel war geplant, ers Einzelnes gebaut. Wer heute die Stadt besucht, reibt sich die Augen: Vieles von dem, was damals Papier war, is heute Realität. Insbesondere das Sulzerareal Stadtmitte ist ein Vorzeigebeispiel für eine gelungene Transformation von einem Industriezu einem Bildungs-, Dienstleistungs- und Kulturstandort. Und in Oberwinterthur zeichnen sich die Konturen des neuen Stadteils Neuhegi deutlich ab.
Wer Winterthur nicht kennt, lies am Anfang des Hefs den Grundkurs: ‹ Die grosse Unbekannte ›. Den Kern dieser Publikation bilden die Kurzportraits von 66 Bauten und Projekten, alle auf der Karte in der Heftmitte verzeichnet. Ihr architektonisches Spektrum is ebenso breit wie die Nutzungen, die sie aufnehmen. Nach wie vor sielt der Wohnungsbau eine wichtige Rolle. Denn der Wachsumsschub, den Winterthur in den letzten Jahren erlebte und die Stadt 2008 mit 100 000 Einwohnern zur Grossstadt machte, is noch nicht abgeschlossen.
Auf der politischen Agenda sehen jedoch nicht die Wohnungen, sondern die Arbeitsplätze ganz oben. Hier hat Winterthur noch viel Potenzial und atraktive Standorte zu bieten. « Arbeitslätze braucht die Stadt », bringt es Julia Selberherr in ihrem Beitrag auf den Punkt. Weitere Artikel thematisieren die Entwicklung Winterthurs zur Bildungssadt und die Rolle der Genossenschafen beim Wohnungsbau. Die Immobilienimperien von Robert Heuberger und Bruno Stefanini sowie die anderen Spieler auf dem lokalen Markt sind ebenso Thema wie das Ringen um den Raum. Den Schlusspunkt setzen ein Stimmungsbild, ein Gesräch mit den Akteuren der Stadt und schliesslich ein Statement des Stadtpräsidenten.
Parallel zu diesen Beiträgen spannt die Fotografin Andrea Diglas einen Bilderbogen auf, der die vielfältigen Asekte Winterthurs zeigt. Macht dieses Hef Lus auf einen Besuch vor Ort ? Umso besser ! Werner Huber
Verlag Hochparterre AG Adressen Aussellungssrasse 25, CH-8005 Zürich, Telefon 044 444 28 88, www.hochparterre.ch, verlag@hochparterre.ch, redaktion@hochparterre.ch Verleger und Chefredaktor Köbi Gantenbein Verlagsleiterin Susanne von Arx Konzept und Redaktion Werner Huber Fotografie Andrea Diglas, www.diglas.com Art Direcion Antje Reineck Layout Michael Adams Produktion Thomas Müller Korrektorat Elisabeth Sele, Dominik Süess Bildnachweis Objektportraits Seiten 15–25 Georg Aerni: 60; Adolf Bereuter: 41; Roland Bernath: 20, 25, 55; Bildraum: 39; Oliver Erb: 37; Caroline Gamper: 53; Michael Haug: 9, 13, 21, 56; Hannes Henz: 26; Kuser Frei: 15; Claudia Luperto: 27, 58, 65; Giuseppe Micciché: 57; Anne Moldenhauer: 52; Nightnurse Images: 7, 61; Raumgleiter: 62; Lukas Roth: 38; Chrisian Schwager: 54, 66; Seraina Wirz: 23; Jürg Zimmermann: 19; Reinhard Zimmermann: 47 Lithografie Team media, Gurtnellen Druck Somedia Producion, Chur Herausgeber Hochparterre und Martin Hofer, Wües & Partner, in Zusammenarbeit mit der Stadt Winterthur Besellen shop.hochparterre.ch, Fr. 15.—
Winterthur is die sechsgrösse Stadt der Schweiz –vor Luzern und St. Gallen. Doch ausserhalb weiss man wenig über die Stadt. Warum? Ein Blick auf ihre Eigenschafen.
Text: Werner Huber
Hundertausend. Diese Einwohnerzahl muss eine Stadt erreichen, damit sie eine Grosssadt is. 2008 hat Winterthur diese Marke geknackt und fungiert seither als sechste Grossstadt der Schweiz. Den sechsten Rang hat die Eulachsadt schon seit Längerem inne, denn die Hunderttausender-Marke hat sie aus eigener Kraf erreicht, nicht wie Luzern, das nach der Fusion mit der Nachbargemeinde Littau auf den siebten Platz vorgerückt ist, um St. Gallen hinter sich zu lassen. Die Winterthurerin mag es mit Stolz erfüllen, in der sechsgrössen Ortschaf der Schweiz zu leben, umso mehr, als die eigene Stadt nun direkt auf Bern folgt, das von Lausanne überholt und auf Platz fünf abgerutscht is. Die Nicht-Winterthurerin indes wundert sich: Zürich, Genf und Basel, die drei grössten der Grossen, kennt sie ebenso wie Bern und Lausanne. Und vom Tourismusmagneten Luzern hat sie ebenso eine Vorsellung wie von St. Gallen, der Textilmetropole der Osschweiz. Aber Winterthur ? Stellt es der Laie nicht eher in eine Reihe mit La Chaux- de -Fonds ( Winterthurs Partnersadt ) oder Biel ? Dort hate die Indusrie ja auch mit Problemen zu kämpfen. Denn wenn Nicht-Winterthurer eines wissen, dann das: Das war eins eine Indusriesadt, die von der Krise heftig durchgeschüttelt worden ist. Gräbt man etwas weiter in den Klischees, kommt die Gartensadt zum Vorschein und vielleicht die Bedeutung Winterthurs als Kunssadt. « Pro Einwohner ein Renoir », pflegte man vor Jahrzehnten so scherzhaf wie neidisch über die hiesigen Kunstschätze zu sagen. Warum bloss weiss man in der Schweiz so wenig über die Stadt an der Eulach und der Töss ? Eine Annäherung in sechs Schriten
Grosssadt im Kleinsadtgewand
Hören wir ‹ Grosssadt ›, dann denken wir an dichte, mit mehrgeschossigen Häusern bebaute Strassenräume und Plätze, an S - Bahnen, Trams oder U - Bahnen, an geschäftiges Treiben und Anonymität. Meist stammen die grosssädtischen Quartiere aus dem säten 19. Jahrhundert, als
die Menschen zu Tausenden in die Städte strömten. In Winterthur fehlen diese Stadtsrukturen weitgehend. Einige meis unvollsändige Blockränder sehen im Neuwiesenquartier hinter dem Bahnhof und im Dreieck zwischen dem Bahnhofgebäude und der Altsadt. Aber Mietskasernen wie in Zürich-Wiedikon, -Aussersihl und -Indusrie, wo Fabrikarbeiter und Angesellte wohnten, gibt es in Winterthur nicht. Hier bauten die Fabrikherren Reihenhäuser mit Vorgärten und Gemüsebeeten. Sie sorgten gut für ihre Arbeitskräfte, wenn auch weniger aus Fürsorge als aus Kalkül. So konnten die Arbeiterfamilien ihr karges Budget mit eigenen Gemüsepflanzungen entlasen. Und vor allem hatten sie in der spärlichen Freizeit eine Aufgabe, die sie vom Besuch der Wirtschafen abhielten.
Aus der Sicht der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts war diese Besiedlung fortschrittlich. In Winterthur waren selbst die Arbeiterquartiere stark durchgrünt, gut besonnt und belüftet. Grossstädtisches Leben pulsierte da aber nicht. Die verschiedenen Merkmale der Stadt –grosse zusammenhängende Verkaufsflächen, Büros und Praxen – breiteten sich hinter den alten Fassaden oder in den Neubauten in der Altstadt aus. Wer in Winter thur ‹ Stadt › sagt, meint die Altstadt und vielleicht noch das Einkaufszentrum Neuwiesen. Allein schon der Sprung über die Technikumsrasse in das Einkaufszentrum Arch höfe is nicht selbsversändlich.
Nur ein Agglomeratiönchen
Wie jede Grossstadt hat auch Winterthur eine Agglomeration ; gemäss dem Bundesamt für Statisik gehören dazu elf Gemeinden. Doch Hand aufs Herz: Mehr als ein Agglomeratiönchen ist das nicht. Bei anderen gros sen Städten wohnen in der Agglomeration teilweise deutlich mehr Menschen als in der Kernsadt. Spitzenreiterin is diesbezüglich die Agglomeration Zürich, wo mehr als doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner ausserhalb der Stadtgrenzen wohnen wie innerhalb. Die elf Agglomerationsgemeinden um Winterthur hingegen zählen gerade mal etwas über 41 000 Seelen, womit der Ballungsraum insgesamt – also die Stadt inklusive Agglomeration – hinter Luzern und St. Gallen nur Platz acht erreicht.


Der Blick auf eine Karte zeigt den Grund: Die Stadt ist zwischen sieben Hügelzügen eingebettet, die als natürliche Grenzen wirken. Diese Topografie verhinderte die Wucherung der Siedlungsflächen und sorgt für einen kompakten Stadtkörper. Die Karte zeigt auch, dass Winterthur mit grosszügigen Grenzen ausgestattet ist. Das Stadtgebiet Winterthurs miss immerhin 70 Prozent der Fläche der Stadt Zürich, die Bevölkerungszahl hingegen beträgt nur gut ein Viertel.
Mit der Eingemeindung von 1922 kamen mit Ausnahme des Arbeiterortes Töss nicht etwa dicht besiedelte städtische Gebiete zur Stadt, sondern Dörfer wie Seen und Wülflingen, die ers in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg einen Wachsumsschub erlebten. Winterthurs Agglomeration wuchs also im Grunde innerhalb der Stadtgrenzen. Das hat den Vorteil, dass das Siedlungsgebiet klar begrenzt is und nicht planlos über die Grenzen wucherte. Das führte aber auch dazu, dass Winterthur von seiner Umgebung isoliert ist . Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit is weniger zwingend und nicht so selbsversändlich wie an Orten, die mit den Nachbargemeinden zusammengewachsen sind.
Die grösse Nicht-Hauptsadt der Schweiz « Nein, nein, das is gar kein Problem », heiss es häufig und manchmal entrüset, wenn man Winterthurer auf ihr eher gesanntes Verhältnis zu Zürich ansricht. « Kein Problem », das mag sein, aber eine gewisse Spannung is doch da. Sie reicht weit zurück und manifestierte sich beisielsweise in den 1830er-Jahren, als sich Winterthur
an vorderster Front gegen die Vormachtstellung Zürichs im Kanton engagierte. Oder als sich die Stadt unter ihrem Präsidenten Johann Jakob Sulzer in den 1870er -Jahren bei der Nationalbahn engagierte, die als ‹ Volksbahn › eine Konkurrenz zur ‹ Herrenbahn › werden sollte, wie Alfred Eschers Nordbahn genannt wurde. Das Unternehmen scheiterte schnell und bescherte Winter thur Schulden, die ers in den 1950er-Jahren abbezahlt waren. Diese Geschichten sind längs überwunden, doch der Unterschied in Grösse und Bedeutung is geblieben. Winterthur is die grösse Stadt, die nicht Kantonshauptsadt is ; in jedem anderen Kanton wäre eine Stadt von dieser Grösse auch Hauptstadt. Das bringt nicht nur Prestige, sondern auch politische Bedeutung als Regierungs - und Parlamentssitz und Arbeitslätze als Verwaltungssitz. Immerhin konnte Winterthur den Kanton 1874 davon überzeugen, das Technikum hier anzusiedeln, zudem wurde die Stadt mit einer sarken Kantonsschule ausgesatet. Aus dem Technikum is in den letzten Jahren die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschafen (ZHAW) hervorgegangen, die grösste Fachhochschule der Schweiz: Über 8000 Studierende bringen junges Leben in die Stadt. Im Rahmen der ZHAW wird auch die hundertvierzigjährige Tradition der Architekturschule des ‹ Tech › fortgeführt.
Eine Viertelsunde dauert die Fahrt mit der S 12 von Winterthur in die Hauptsadt nach Stadelhofen. Manche behaupten, diese schnelle Bahnverbindung nach Zürich sei das Beste an Winterthur. Bedeutend ist diese Linie tatsächlich, aber nicht, um aus Winterthur zu flüchten, sondern um die Stadt in den Metropolitanraum Zürich →
Die einstige Industriestadt hat sich als Dienstleistungs- und Bildungsstandort neu erfunden.
einzubinden. Problemlos kann man am einen Ort arbeiten oder sudieren und am anderen Ort wohnen – so haben sich denn auch Tausende eingerichtet. Zum Kummer der Stadtentwicklung wird die Option Winterthur vor allem fürs Wohnen gewählt, während fürs Arbeiten, das heisst für die Einrichtung von Arbeitslätzen, diese Option noch zu wenig genutzt wird.
Jahrzehnte der Metamorphose
Noch schneller als im Zürcher Opernhaus is man von Winterthur am Flughafen. Stat ‹ Zürich Kloten › könnte der Airport genauso gut ‹ Winterthur Kloten › heissen und damit Winterthurs Standortguns auch den Managern aus Übersee vor Augen führen. Doch die Vorzeichen haben sich in den letzten 25 Jahren gewendet. Eins liefen in den grossen Indusriekonzernen Sulzer und Rieter oder beim Handelshaus der Gebrüder Volkart ( einer der weltgrössten Baumwoll- und Kafeehändler mit Sitz in Winterthur und Bombay) die Fäden aus aller Welt zusammen. Heute sind die Indusriekonzerne nur noch Schaten ihrer selbs, und Volkart hat seine Geschäfsätigkeit eingesellt.
Sulzers Ankündigung, bis 2017 das Werk in Oberwinterthur zu schliessen und damit die Produktion in Winterthur einzusellen, machte im März 2016 zwar Schlagzeilen, doch weniger in Winterthur als in der übrigen Schweiz. Die Medien rückten das Bild der leidenden Industriemetropole noch einmal in den Vordergrund, und Stadtpräsident Michael Künzle zeigte sich « betroffen ». Für die betroffenen Angestellten ist das ein Drama und für den Indusriesandort biter, doch wer in Winterthur lebt und die Stadt kennt, weiss: Die indusrielle Tradition is schon seit einigen Jahren weitgehend Geschichte.
Vor 25 Jahren war das noch anders, da sand die Stadt an der Wende einer Epoche. Für das nicht mehr benötigte Sulzerareal wälzte man grosse Pläne, Jean Nouvel projektierte ‹ Megalou › und signalisierte Aufruchsimmung. Aber vielen war es beim Blick in die Zukunf Angs und Bange: Kann Winterthur ohne seine Indusrie überleben ? Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Stadt nicht nur überlebte, sondern sich als Diensleisungs- und Bildungssandort neu erfunden hat.
Indusrieller Charme bleibt sürbar
Die Altsadt, die Villenquartiere und Arbeitersiedlungen geben Winterthur ein kleinsädtisches Gepräge. Mittendrin gibt es aber seit über hundert Jahren ein Gebiet so gross wie die Altsadt, das zwar nicht in seiner Nutzung, aber in seiner Masssäblichkeit absolut grosssädtischen Charakter hate: das Fabrikareal der Gebrüder Sulzer und der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik. Für Normalbürger war das eingezäunte Gebiet eine verbotene Stadt, für Tausende von Arbeitern war es Alltag. Mit dem Rückzug von Sulzer wurde dieses 20 Hektaren grosse Areal geöffnet und an die Stadt angebunden. Ähnliche Transformationen gab es in Zürich West, in Zürich Nord und in Baden. Vor allem in Zürich kam die Planung flott voran. Innerhalb kurzer Zeit war die indusrielle Nutzung
weg, und bald darauf war dort auch der in postindustrieller Zeit beliebte indusrielle Charme verschwunden. Im Windschatten der grossen Vorhaben in Zürich erfolgte der Umbau des Sulzer- Areals ‹ Stadtmitte › in Winterthur. Die ersen Anläufe scheiterten, kleine Schrite ersetzten den grossen Wurf – zum Glück ! Obwohl der Umbau zu einem grossen Teil abgeschlossen ist, hat das Areal den Charakter der indusriellen Vergangenheit bewahrt. Zahlreiche Altbauten, fas alle schon neu genutzt, zeugen von der vergangenen Indusrieproduktion, dazwischen setzen Neubauten Zeichen der Gegenwart. Obschon das Gebiet kleiner is als Zürich Wes, is die Architektur vielfältiger, die Stadträume sind sannungsvoller und dichter. In den Köpfen der Winterthurerinnen und Winterthurer mag sich das Sulzer-Areal noch nicht wirklich als Teil ihrer Stadt festgesetzt haben ; für Tausende von Studierenden der ZHAW gehört es jedoch bereits zum Alltag. Der Umzug der Stadtverwaltung in den dortigen ‹ Superblock › wird den Integrationsrozess beschleunigen. Ebenso wichtig sind jedoch die Einrichtungen, die sich jüngs auf dem Lagerplatz-Areal eingeniset haben, etwa das Kino Cameo und das Bisro Les Wagons.
Grosssadt mit Zukunf Gemäss dem kantonalen Richtplan soll Winterthur bis 2040 rund 20 000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner aufnehmen. Angesichts der geringen Dichte und der vielerorts schlummernden Ausnützungsreserven scheint dies gut möglich zu sein. Die innere Verdichtung is ja ohnehin das Gebot der Stunde – wäre das nicht die ideale Gelegenheit, Winterthur das Antlitz einer Grosssadt zu geben ?
So einfach is das nicht, im Gegenteil: Die Stadt muss darauf achten, ihre Qualitäten nicht leichtertig aufs Spiel zu setzen. Quartiere wie der Deutweg, das ‹ Birchermüesliquartier › mit seinen Reihenhäuschen oder das Innere Lind mit den herrschaftlichen Wohnhäusern und Villen sind für Winterthurs Charakter als Gartensadt entscheidend. Auch wenn es paradox klingt: Gerade solche sehr locker bebauten Gebiete benötigen am meisten Schutz. Denn für die innere Verdichtung is die Giesskanne das falsche Instrument. Würde man die zusätzliche Baumasse gleichmässig über die Stadt verteilen, verlören die unterschiedlichen Quartiere der gewachsenen Stadt – die ja keineswegs planlos gewachsen ist – ihren Charakter. Die Verdichtung mit Neubauten, Aufsockungen oder Ersatzbauten muss sorgfältig geplant werden.
Grosses Potenzial zur Verdichtung hat die Stadt im Gebiet Neuhegi- Grüze, wo die frühere indusrielle Nutzung grossmasssäbliche Strukturen hinterliess, aber auch an den Rändern, etwa im Sennhof oder in Zinzikon. Hier zeigt Winterthur ein neues Gesicht, und das kann manchmal durchaus grossstädtisch sein. Grossstadtallüren muss sich Winterthur deswegen nicht zulegen. Die Stadt muss die Vielfalt, die sie heute auszeichnet, bewahren und weiterentwickeln – denn genau das macht den Charakter einer Grosssadt aus. So klein sie auch is ●
Winterthur im Vergleich mit den zwei grösseren und zwei kleineren Städten
Lausanne
Einwohner: 141 200
Beschäfigte: 91 700
Fläche: 41,4 km2
Siedlungsgebiet: 42,9 %
Winterthur
Einwohner: 111 000
Beschäfigte: 65 500
Fläche: 68,05 km2
Siedlungsgebiet: 32 %
Luzern
Einwohner: 81 100
Beschäfigte: 77 600
Fläche: 37,4 km2
Siedlungsgebiet: 47,6 %
Bern
Einwohner: 141 100
Beschäfigte: 184 600
Fläche: 51,6 km2
Siedlungsgebiet: 44,2 %
St. Gallen
Einwohner: 79 100
Beschäfigte: 78 600
Fläche: 39,4 km2
Siedlungsgebiet: 41 %
Die Entwicklung von der Arbeiter- zur Bildungssadt macht grosse Invesitionen in die Infrasruktur von Volks-, Kantons-, Berufs- und Hochschulen nötig.
Text: Reto Wesermann
Die Fabrikhallen von Sulzer und Lokomotivfabrik drückten Winterthur jahrzehntelang den Stempel einer Arbeitersadt auf. Die Indusrie garantierte einem grossen Teil der Bevölkerung Lohn und Brot. Entsprechend behäbig war die Entwicklung der Stadt: So pendelte beisielsweise die Einwohnerzahl zwischen 1978 und 1998 immer um die 85 000, und auch die Infrasruktur wuchs nur marginal. Diese Zeiten sind vorbei: Statt 85 000 leben heute mehr als 110 000 Menschen in Winterthur, Sulzer und die Lokomotivfabrik sind weitgehend Geschichte, Hirnschmalz hat die Muskelkraf der Arbeiter abgelös – aus der Indusrieis eine Bildungssadt geworden.
Mit diesem Wandel waren und sind grosse Invesitionen in die Bildungsinfrastruktur verbunden, die vor allem von Stadt und Kanton getragen werden. So finanziert der Kanton die drei Winterthurer Gymnasien, die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschafen (ZHAW) sowie verschiedene Berufsschulen für Lernende, darunter beispielsweise das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen (ZAG). Die Stadt wiederum sellt die gesamte Infrasruktur für die Volksschule bereit. Weitere wichtige Invesoren sind die Höhere Technische Fachschule sowie die Anbieter von Wohnräumen für Studierende. Sie alle zusammen invesieren im Zeitraum zwischen 2011 und 2021 rund 800 Millionen Franken.
500 Millionen für die Fachhochschule
Notwendig wurden Invesitionen bei den drei Kantonsschulen Rychenberg, Im Lee und Büelrain, die in den letzten Jahren steigende Schülerzahlen verzeichneten. Im Jahr 2007 erhielten die Schulhäuser Lee und Rychenberg einen Erweiterungsbau. Aktuell liegt der Fokus auf dem Büelrain. Hier hat der Kantonsrat im März 2016 einen Kredit von 60 Millionen Franken für den Bau eines zweiten Schulgebäudes bewilligt. Damit sollen bis 2019 die seit Jahrzehnten genutzten Provisorien abgelös werden.
Wichtigses Standbein und Aushängeschild der Bildungssadt Winterthur is die ZHAW. Die 1874 als Technikum gegründete Hochschule wuchs in den letzten zehn Jahren massiv und belegt mehrere Dutzend Gebäude in der Stadt. Die Schafung des Departements Gesundheit 2006, die Aufwertung zur Fachhochschule und die Fusion mit weiteren kantonalen Hochschulen zur ZHAW im Jahr 2007 sowie die massive Nachfrage im Bereich der Wirtschafsstudiengänge haben das Wachstum befeuert. Vor zehn Jahren waren an der Hochschule noch 2900 Studierende eingeschrieben, heute sind es 8800. Im selben Zeitraum sieg der Flächenbedarf von 50 000 auf fas 80 000 Quadratmeter. 2012 beziferte der Kanton den Finanzaufwand für den Ausbau des Hochschulsandortes Winterthur bis 2020 mit 500 Millionen Franken.
Bibliothek in ehemaliger Sulzer-Halle
Um die Nachfrage befriedigen zu können, mietete die ZHAW vor allem Gebäude privater Investoren an. Dazu zählen die Eulachpassage an der Technikumstrasse, der Mäanderbau neben dem einstigen Swisscom-Hochhaus sowie diverse Bauten auf dem Sulzer-Areal ‹ Stadtmite ›. «Durch die teilweise Anmietung von Räumen können wir rascher auf den wechselnden Bedarf reagieren als durch den Bau durchwegs eigener Gebäude», sagt ZHAW-Verwaltungsdirektor Reto Schnellmann. Jüngser Zugang bei den Mietliegenschafen is die zentrale Hochschulbibliothek in einer ehemaligen Sulzerhalle, die einem Fonds der Credit Suisse gehört. Das künfige Wachsum soll auch durch privat finanzierte Liegenschaften abgedeckt werden. Bereits aufgegleis is der Bau des Adeline-Favre-Gebäudes am Katharina-Sulzer-Platz mit einem Winterthurer Immobilienunternehmen, der Siska Heuberger Holding, als Invesorin. In vier Jahren wird hier das Departement Gesundheit einziehen. Selbs invesieren möchte die ZHAW auf dem Campusgelände an der Technikumstrasse. Wie die Entwicklung hier aussehen könnte, wurde im Rahmen eines Testplanungsverfahrens in den wesentlichen Grundsätzen bereits fesgelegt. In einem ersen Schrit soll das →

der ehemaligen
Raumangebot durch einen Neubau erweitert werden. «Die Planungen dafür könnten voran getrieben werden, sobald die entsprechenden Mittel vorhanden sind», sagt Schnellmann. Baubeginn wäre frühesens ab 2020.
Florierende Gesundheitsschule
Mit dem Wachsum der ZHAW sieg auch die Nachfrage nach sudentischem Wohnraum. «Wir gehen davon aus, dass rund zehn Prozent der Studierenden ein sezielles Wohnangebot brauchen», sagt Reto Schnellmann. Grösster Anbieter vor Ort ist die Stiftung für studentischen Wohnraum in Winterthur (Swowi). Sie vermietet an neun Standorten insgesamt 276 Zimmer, weitere 27 werden ab Herbs 2016 in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Stadt hinzukommen. Auch andere Anbieter haben in den letzten Jahren Winterthur entdeckt: So der Versicherer Swiss Life, der 2010 in Töss ein Wohnhaus für Studierende baute oder die studentische Wohngenossenschaft Woko, die bisher vor allem in Zürich tätig war. Die Woko übernahm 2013 auf Initiative der ZHAW die Verwaltung des von der Siska Heuberger Holding gebauten Studentenhauses an der Bürglisrasse.
Das dritte Standbein des Kantons in der Bildungssadt Winterthur sind die Berufsschulen, allen voran die ZAG. Die Schule wurde 2005 gegründet und hat ein massives Wachstum hinter sich: Beim Start genügten rund

Sulzer-Areal Stadtmite, Halle 53: zurzeit als ‹ schönstes Parkhaus › genutzt. Die einsige Giesserei soll ein Veransaltungsort werden.
Ebenfalls stark gewachsen ist die Schweizerische Technische Fachschule Winterthur (STFW). Die Zahl der Schülerinnen und Schüler hat dort zwischen 2005 und 2015 um 30 Prozent zugenommen. Um die Nachfrage bewältigen zu können, realisierte die Schule 2011 und 2015 in Wülflingen für rund 40 Millionen Franken zwei Erweiterungsbauten und ein Gebäude-Energielabor, das Einblick in Gebäudetechnikanlagen bis hin zum in Oberwinterthur entwickelten Hexis-Brennsofzellensysem erlaubt.
Gross in die Bildungsinfrastruktur investiert hat in den letzten zehn Jahren auch die Stadt Winterthur selbs In dieser Zeit stieg der Flächenbedarf der Volksschulen um 21 Prozent von 525 auf 635 Einheiten an – 585 Klasseneinheiten und 50 Betreuungseinheiten. Dazu beigetragen haben aber nicht nur die Bevölkerungszunahme sowie die seigende Geburtenrate: «Das 2005 verabschiedete neue Volksschulgesetz des Kantons liess den Raumbedarf sark anseigen», sagt Urs Borer vom Departement Schule und Sport. Die neuen Unterrichtsformen bräuchten mehr Platz, ebenso das Betreuungsangebot.
Pavillons oder Neubauten?
Rund 138 Millionen Franken wird die Stadt im Zeitraum 2011 bis 2021 in die Schulraumerweiterung invesieren. Das geschieht zweigleisig: In Wülflingen und Zinzikon wurde in den Jahren 2011 und 2015 je ein neues Schulhaus in Betrieb genommen, dasjenige in Neuhegi befindet sich derzeit in Bau. An sieben weiteren Standorten entsanden Pavillons. Die aus vorgefertigten Holzelementen gefertigten Bauten erfüllen den Minergiesandard und sind für eine Nutzungsdauer von 50 bis 60 Jahren ausgelegt. «Damit können wir die benötigten Räume rasch bereitsellen», sagt Borer. Während ein neues Schulhaus von der Idee bis zur Realisierung rund zehn Jahre benötige, reichten bei den vorgefertigten Bauten zwei Jahre. Die Pavillons prägen unterdessen das Bild zahlreicher Schulhäuser, ordnen sich aber nicht überall gleich gut ein und verkleinern die Freiräume auf den Arealen empfindlich. Für Stadtbaumeister Michael Hauser ist deshalb klar: «Pavillonbauten sind schnell ersellt, nicht zuletzt, weil sie unter dem politischen Radar fliegen. Dort wo längerfristig Bedarf nach Schulraum beseht, sollten jedoch ortssezifische, quartierdienliche Lösungen zum Einsatz kommen – zumal diese nicht teurer sind.» Diesen Weg geht die Stadt beim Ersatzneubau und der Erweiterung des Schulhauses Wallrüti, wo derzeit der Architekturwetbewerb läuf. Wallrüti wird wohl nicht der letzte Neubau sein: Die seigenden Geburtenraten – 1980 wurden in der Stadt noch 900 Kinder geboren, 2012 bereits 1250 – machen schon bald weitere Invesitionen in die Schulinfrasruktur nötig.
Eine Stadt mit jugendlichem Gesicht
2000 Quadratmeter für die 250 Lernenden. Im Jahr 2008 zog die Schule um. Sie mietete neue Räume an der Turbinensrasse auf dem Sulzer-Areal ‹ Stadtmite › mit Platz für 2000 Lernende. Ersellt wurde das Gebäude von der Sulzer-Vorsorgestiftung. Aktuell zählt die ZAG bereits 2400 Schülerinnen und Schüler, sie belegt mi tlerweile eine Fläche von rund 14 000 Quadratmetern. Um den setig wachsenden Raumbedarf decken zu können, musse die Schule im Herbs 2015 Räume in einem Verwaltungsgebäude der Sulzer hinzumieten.
Die Bildungssadt is also noch nicht vollendet. Doch schon heute prägen ihre Bauten das Gesicht von Winterthur wie eins die Indusrie: An den Hallen und Gebäuden, in denen früher Arbeiter unter Einsatz von Muskelkraft Lokomotiven bauten und Turbinen herstellten, prangen jetzt die Logos von ZHAW sowie ZAG. Hinter den Mauern und Fenstern sind Studierende und Dozierende beschäftigt: Sie recherchieren in der neuen Bibliothek, vermiteln Wissen in Vorlesungen oder lernen in Seminaren. Auch ausserhalb der Schulbauten prägen die Schülerinnen und die Studenten die Stadt – vor allem natürlich in den Zügen und Bussen, aber auch auf den Strassen und Plätzen. Über Mittag essen sie ihren Kebap unter den Bäumen am Graben, und abends beleben sie die noch immer provisorisch genutzten einsigen Indusriehallen. Winterthur is damit zu einer jugendlichen Stadt geworden. ●

Winterthur is von Wäldern eingefass Die drei Walcheweiher im Lindbergwald sind ein beliebtes Ausflugsziel.
Raum für Arbeitslätze
Die Karte zeigt Entwicklungsgebiete, in denen neue Arbeitslätze entsehen oder wo kurz- und mitelfrisig Potenzial dafür vorhanden is
Gewerbe- und Indus riegebiete
1 Euelwies / Niederfeld
2 Wässerwiesen
3 Steig
4 In der Au
5 Taggenberg
6 Frauenfelder s rasse
7 Toggenburger
8 Holzwingert s rasse
9 Stegacker s rasse
10 Ohrbühl
11 Grüze
12 Neuhegi 13 Feldwisen
Mischgebiete
14 Lantig
15 Wülflingen
16 Schlos s al
17 Ziegelei Dä t nau
18 Steig
19 Neumüli
20 Sulzerareal Stadtmi te ( Werk 1 )
21 Umfeld Grüze
22 Umfeld Hegi
23 Hegifeld s rasse
Winterthur ist ein beliebter Wohnort und in den letzten Jahren stark gewachsen. Damit hält die Arbeitslatzentwicklung nicht Schrit .
Text:
Winterthur ist mit einer Bevölkerungszunahme von fast 14 Prozent in den letzten zehn Jahren so sark gewachsen wie keine andere Schweizer Grosssadt. Die Stadt is ein atraktiver urbaner Wohnort im Grünen mit einer ausgezeichneten Verkehrserschliessung. Mit der rasanten Bevölkerungsentwicklung kann die Entwicklung der Arbeitsplätze allerdings nicht Schritt halten. Während Zürich pro 100 Einwohner 118 Beschäfigte zählt, sind es in Winterthur nur knapp 63.
Aufgrund der grossen Bedeutung des Indusriesektors in der Vergangenheit betrif der Strukturwandel der letzten Jahre hin zum Dienstleistungssektor Winterthur besonders sark. Die Dynamik des Wandels is bislang allerdings verhalten geblieben. Das Beschäfigungswachsum im Dienstleistungssektor fällt sowohl gegenüber Zürich als auch im gesamtschweizerischen Vergleich unterdurch-
schnitlich aus. Auch bei der Entwicklung der Arbeitslätze insgesamt, liegt Winterthur unter dem Durchschnitt siehe Grafik ‹ Beschäfigte › Winterthurs Vergangenheit als Indusriesadt hat einen besonders hohen Anteil an Indusrieflächen hinterlassen. Er ist mit rund 20 Quadratmetern pro Kopf etwa doppelt so hoch wie in Zürich. Bei den Büroflächen is das Verhältnis hingegen genau umgekehrt: Gibt es in Winterthur pro Kopf der Bevölkerung 10 Quadratmeter Büroflächen, kommt Zürich auf mehr als das Doppelte. Einzig die Versorgung mit Verkaufsflächen is mit rund vier Quadratmetern pro Einwohner in beiden Städten vergleichbar. Nach wie vor verfügt Winterthur über grosse Entwicklungsreserven an gut erschlossenen Standorten.
Büro und Gewerbe im Aufwind, Verkauf unter Druck Zwischen 2004 und 2013 betrugen die durchschnitlichen Bauinvestitionen in Büro - und Verkaufsflächen rund 60 Millionen Franken pro Jahr ; im Jahr 2015 lagen die Baugesuche und -bewilligungen ebenfalls in dieser Grös-
senordung. Pro Kopf sind die Investitionen in Büroraum nur etwa halb so gross wie in Zürich, bei den Verkaufsflächen sind es 70 Prozent.
Interessant is ein Vergleich der Entwicklung der Angebotspreise von Büroflächen: Während schweizweit ein Rückgang zu verzeichnen war, sind die Preise in Winterthur in den letzten zehn Jahren um 16 Prozent angesiegen – deutlich särker als in Zürich, wo sie um 11 Prozent zulegten. Noch markanter is der Unterschied bei den Gewerbeflächen: In der gesamten Schweiz, auch in Zürich, gingen die Preise zurück oder stagnierten, in Winterthur hingegen sind sie um mehr als einen Viertel gesiegen.
Hingegen trifft der Wandel im Detailhandel Winterthur besonders sark. Die Konkurrenz durch den Onlinehandel und die Aufebung des Euro-Mindeskurses durch die Schweizerische Nationalbank Anfang 2015 verschärften die Situation zusätzlich. Das zeigt sich in Winterthur durch hohe Angebotszifern und Preisrückgänge von mehr als 20 Prozent siehe Grafik ‹ Angebotsreise von Geschäfsflächen ›
Hohe Lebensqualität und Marktansannung
Treiber des Wachstums der vergangenen Jahre war insbesondere der rege Wohnungsbau. In Winterthur gibt es rund 53 000 Wohneinheiten. Davon sind fas 70 Prozent Mietwohnungen, den Res teilen sich Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser gleichmässig. Der Anteil genossenschaflicher Wohnungen liegt bei rund 11 Prozent. Während der letzten zehn Jahre wurden durchschnitlich rund 630 Wohneinheiten pro Jahr ersellt, mit einem Spitzenwert von 760 Wohnungen im Jahr 2009.
Die Bautätigkeit kann aber kaum mit der Nachfrage Schritt halten ; in den letzten zehn Jahren lag die Leersandsquote bei insgesamt 0,3 Prozent. Bei den Mietwohnungen betrug die durchschnittliche Leerstandsquote zwischen 2006 und 2015 0,4 Prozent. Das is doppelt so hoch wie in Zürich, aber fast fünfmal weniger als in der gesamten Schweiz. Beim Wohneigentum betrug die Leersandsquote lediglich 0,1 Prozent – ein Schweizer Rekord. Heute liegt er bei Null. Bei den Mietwohnungen verzeichnen die Statistiker inzwischen einen Anstieg des Leersands auf immerhin 0,9 Prozent, was ein Hinweis auf eine Entsannung des Markts sein könnte.
Kein Wunder, ist Winterthur als Wohnort attraktiv: Die Lebensqualität is hoch. Im Städte -Ranking 2016 von Wües & Partner belegt Winterthur den driten Rang, hinter Zürich und Zug. Das Ranking bewertet die Lebensqualität in 162 Schweizer Städten anhand von elf Themenbereichen mit unterschiedlichen Variablen. In der Kategorie ‹ Bildung › ist Winterthur schweizweit Spitzenreiter, in der Kategorie ‹ Mobilität und Verkehr › liegt die Stadt auf Rang 8, bei ‹ Kultur und Freizeit › auf Rang 15.
Wohnungsreise ziehen an Zürich machte in den letzten Jahren mit einem sarken Preisansieg bei Mietwohnungen von sich reden. Tatsächlich sind in der grössten Schweizer Stadt die Angebotsreise seit 2005 um 20 Prozent gesiegen. Aber auch in Winterthur beträgt der Preisansieg mit 14 Prozent immer noch fas das Dreifache des schweizerischen Durchschnitts siehe Grafik Angebotspreise für Mietwohnungen . Mittlerweile wird eine durchschnittliche Vierzimmerwohnung in Winterthur für 1 690 Franken pro Monat angeboten. In Zürich verlangt der Markt für eine vergleichbare Wohnung nahezu 40 Prozent mehr.
Bei Eigentumswohnungen ist der Preisunterschied noch markanter: Koset eine Vierzimmerwohnung im mitleren Segment in Winterthur rund 750 000 Franken, muss man in Zürich dafür fas 60 Prozent mehr hinblätern. ●
Kreis Stadt
Kreis Oberwinterthur
Kreis Seen
Kreis Töss
Kreis Veltheim
Kreis Wülflingen
Kreis Matenbach
Stadt Winterthur
Stadt Zürich
Entwicklung der Beschäfigung in Prozent
Winterthur Total
Winterthur
Diensleisungssektor
Zürich Total
Zürich
Diensleisungssektor
Schweiz Total
Schweiz
Diensleisungssektor
Angebotsreise von Geschäfsflächen in Fr. / m2 und Jahr (Median )
Winterthur Verkauf
Zürich Verkauf
Winterthur Büro
Zürich Büro
Winterthur Gewerbe
Zürich Gewerbe
Angebotsreise von Mietwohnungen in Fr. / m2 und Jahr (Median )
Winterthur
Zürich
Schweiz
Fr. pro Wohnung
Angebotsreise von Mietwohnungen nach Stadtkreisen ( pro Monat ) günsig unt. Mitelfeld ob. Mitelfeld teuer
Der Anteil an gemeinnützigem Wohnungsbau ist in Winterthur mit elf Prozent nicht hoch. Aber die Genossenschaften realisieren neuartige Projekte.
Text:
Wo, wie und zu welchem Preis sollen all die Menschen wohnen, die gemäss den Prognosen in die Stadt ziehen werden ? Den grössten Teil der Nachfrage werden Private, Immobilienunternehmen und Baugesellschaften abdecken. Baugenossenschafen sielen mit einem Anteil von elf Prozent in Winterthur eher eine Nebenrolle. Aber sie sind Taktgeber, wenn es um günsige Wohnungen geht. Mit der grossen Nachfrage, aber auch dank spannender Projekte is das Presige von Wohnbaugenossenschafen im öfentlichen Bewusssein gesiegen.
« Derzeit sind rund tausend gemeinnützige Wohnungen in und um Winterthur in Planung. Unser Produkt überzeugt: preiswerter Wohnraum ohne Gewinnabschöpfung», sagt Doris Sutter Gresia vom Regionalverband Winterthur der Schweizer Wohnbaugenossenschafen. Sie denkt auch langfrisig: « Nach diesen tausend Wohnungen muss es weitergehen. Nur so können wir die Aufgabe, die wir uns selbs gesellt haben, auch in den nächsen Jahrzehnten erfüllen ». Für die Expansion braucht es Land zu guten Konditionen – und das is schwer zu haben. Of haben Genossenschafen nur dann eine Chance, wenn das Bauland nicht an den Meistbietenden geht. Um die finanziellen Möglichkeiten etwas zu vergrössern, haben die Winterthurer Stimmberechtigten 2014 einen Rahmenkredit von zehn Millionen Franken gesrochen. Dieses zinslose Darlehen is primär für den Erwerb von Bauland besimmt. Das ist ein wichtiges politisches Zeichen, reicht allein aber wohl nicht. Der Verband biete den Genossenschaften deshalb gezielt Untersützung bei der Akquisition von neuen Projekten, so Suter Gresia.
Anteil für gemeinnützige Wohnungen ausgehandelt
Die Stadt selbs baut keine Wohnungen und is kaum mit Kapital an Genossenschaften beteiligt. Ein Hebel is die Vergabe von sädtischem Land im Baurecht. Vier grosse Grundstücke wurden in den vergangenen Jahren an Wohnbaugenossenschaften vergeben. Gross sind die Landreserven aber nicht: rund hundert Hektar in Wohnund Misch zonen. Ob diese Flächen für gemeinnütziges Wohnen oder als Reserve für Infrasruktur dienen sollen –darüber herrscht in Winterthur keine Einigkeit.
Auf sädtischem Land an der Vogelsangsrasse plant die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaf ( GWG ) 150 Wohnungen für Haushalte mit Kindern, für Studierende sowie für Ein - und Zweipersonenhaushalte. Die Stadt hat der GWG dafür einen Teil des angrenzenden Familiengartenareals verkauf. Das Areal wird durch Ersatzneubauten von Knapkiewicz & Fickert Architekten verdichtet. « In einigen Jahren werden rund doppelt so viele Menschen hier
günstig wohnen wie heute », freut sich GWG- Geschäftsführer Andreas Siegenthaler. Die GWG is mit den Genossenschafen HGW und Gaiwo auch an der Überbauung des denkmalgeschützten Busdepots Deutweg beteiligt. Die meisten gemeinnützigen Wohnungen entstehen auf privaten Grundstücken, etwa auf dem Sulzer-Areal Stadtmite. Beim Werk 1 hat die Stadt ihren Willen zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus bewiesen: Mit der Eigentümerin und Entwicklerin Implenia konnte sie einen Anteil an gemeinnützigen Wohnungen von 30 Prozent und öfentliche Freiräume aushandeln. Die Nachfrage bei den Genossenschaften war gross: « Wir haben uns explizit um ein Baufeld beworben », sagt Samuel Schwiter von der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (Gaiwo). Die Gaiwo plant auf dem Areal rund 50 Wohnungen. Auch beteiligt is die Gesewo, die 90 selbsverwaltete Wohnungen auf dem Sulzer-Areal plant. « Dass wir auf dem Werk 1 kurz nach der Fertigsellung der Giesserei wieder so viele Wohnungen bauen, war intern umstritten », sagt Gesewo - Geschäfsführer Martin Geilinger, « denn mit der Giesserei haben wir unseren Wohnungsbesand fas verdoppelt. » Schliesslich simmte die Generalversammlung dem Projekt aber mit überwältigendem Mehr zu.
Zukunfsweisende Wohnprojekte
Nebenan auf dem Lagerplatzareal finanziert die Pensionskasse Abendrot ein prototypisches Wohnprojekt der Genossenschaft ‹ Zusammenhalt ›. Eine Gruppe von Senioren gründete die Genossenschaf, um ihre Vision einer Wohn-, Arbeits- und Lebenskultur im Alter zu verwirklichen. Die 80 Wohnungen für Paare und Alleinsehende sind nur 40 bis 80 Quadratmeter gross. Zum Projekt gehören auch Räume für gemeinsame Tätigkeiten und für die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschafen.
Auch beim zentral gelegenen Areal der Volg-Weinkellereien in Veltheim kommt gemeinnütziges Wohnen in Betracht. Anfang 2016 reichten einige Wohnbaupolitiker im Gemeinderat eine Motion ein, in der sie die Stadt aufordern, das 8000 Quadratmeter grosse Areal zu kaufen oder zumindes zu einer Zone für gemeinnützigen Wohnungsund Gewerberaum zu erklären. Der Gemeinderat wies das Anliegen ab, ein privater Invesor kaufe die Liegenschaf Die Lobby des gemeinnützigen Wohnens versucht nun, einen Mindestanteil für den Bau von preisgünstigen Wohnungen durchzusetzen.
Insgesamt ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Winterthur recht entsannt. Mietpreisunterschiede zwischen privaten und genossenschaftlichen Wohnungen sind nicht ganz so gross wie in Zürich, und es gibt mehr Angebote im mitleren Segment. Deshalb legt Winterthur angesichts der knappen Finanzen den Fokus eher auf die Förderung von Arbeitslätzen als auf die des gemeinnützigen Wohnungsbaus. ●




Wohnen
1 Siedlung Vogelsang, 2021
Die Neubauten ersetzen eine alte Siedlung, die Anfang des Zweiten Weltkriegs ersellt wurde. Es entsanden 150 diferenzierte Wohnungen für unterschiedliche Benutzer. Charakterisisch is die Enfilade von Wohnhöfen. Bebauung und Freiraum sind eng ineinander verflochten.
Adresse: Unt. Vogelsangsrasse 185 – 207 Bauherrschaf: Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaf Winterthur (GWG)
Architektur: Fickert & Knapkiewicz, Zürich Landschaf: Tremp, Zürich
2 Wohnüberbauung Oberzelg, 2018
Die öfentlichen Räume sind Ausgangspunkt des Projekts. Sie sind deutlich gefasst, da die Siedlung eine Pionierin im landwirtschaflich geprägten Sennhof is . Fünf Häuser nehmen 145 Wohnungen auf. Ein Quartierladen, ein Kindergarten und ein Quartiertref sollen die Siedlung ins Quartier einbinden.
Adresse: Oberzelgweg, Sennhof Bauherrschaf: HeimsätenGenossenschaf Winterthur (HGW)
Architektur: Esch Sintzel, Zürich
Landschaf: Kuhn, Zürich



3 Mehrfamilienhaus Pappelweg, 2018
Der Neubau mit 35 Wohnungen ersetzt baufällige Mehrfamilienhäuser. Dank dem Laubengang können die Wohnungen so angeordnet werden, dass die Schlaf- und Wohnräume zur Gartenseite liegen.
Adresse: Pappelweg, Oberwinterthur
Bauherrschaf: HGW HeimsätenGenossenschaf Winterthur
Architektur: Bellwald, Winterthur
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
Kosen: Fr. 13,5 Mio.
4 Wohnüberbauung Sue & Til, 2018
Die Überbauung auf zwei Parzellen zählt rund 300 Wohnungen. Als Blockrand gesaltet, definiert sie einen Innenhof, der in drei Bereiche gegliedert is . Loggien erweitern die Fläche des Wohnbereichs.
Adresse: Sulzerallee, Ida-Sträuli-Strasse, Else -Züblin-Strasse
Bauherrschaf: Allianz Schweiz Immobilien
Totalunternehmer: Implenia, Zürich
Architektur: Weberbrunner, Zürich ; Soppelsa, Zürich
Landschaf: Lorenz Eugser, Zürich
Kosen: Fr. 170 Mio.

5 Siedlung Büelrain, 2017
Die beiden Häuser ‹ Max › und ‹ Moritz › sehen in seilem Gelände. Sie sind so situiert, dass sannende Zwischenräume zur Nachbarschaf entsehen. Die 22 Wohnungen – vier pro Geschoss bei ‹ Max ›, zwei bei ‹ Moritz › – sind als Splitlevel organisiert.
Adresse: Büelrainsrasse 53, Gutsrasse 55
Bauherrschaf: Habitat 8000, Zürich
Architektur: Beat Rothen, Winterthur
Landschaf: Vetschpartner, Zürich
6 Hagmann-Areal, 2017
Der Neubau fügt sich mit dem Besand zu einem Ensemble zusammen, das einen Hof umschliess . Eine durchlaufende
Veranda vermitelt zwischen dem Hof und den Wohnräumen. Aufgrund der Topografie variiert die Gebäudehöhe zwischen drei und fünf Geschossen.
Adresse: Arbergsrasse 7 + 9, Seen
Bauherrschaf: Privat
Architektur: Weberbrunner, Zürich ; Soppelsa, Zürich
Landschaf: Kuhn, Zürich
Kosen: Fr. 23,7 Mio.
7 Wohnüberbauung im Grüntal, 2017
Die Überbauung is in der Höhe gesafelt und gut im Terrain eingebetet. Die fünf Häuser in unterschiedlicher Grösse sind als Zwei- und Dreisänner organisiert. Die Höhenstaffelung und die Attikageschosse vermiteln zur angrenzenden zwei- bis fünfsöckigen Bebauung.
Adresse: Oberseenersrasse, Seen
Bauherrschaf: Privat; HeimsätenGenossenschaf Winterthur (HGW)
Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur
Landschaf: Ryfel & Ryfel, User
8 Überbauung Roy, 2016
Auf drei benachbarten Parzellen entseht ein Wohnhaus mit Läden im Erdgeschoss. Die Blockrandüberbauung enthält Wohnungen mit 1 ½ bis 5 ½ Zimmern sowie Loftwohnungen. Das Projekt verfolgt die Ziele der 2000 -Watt- Gesellschaft.
Adresse: Else -Züblin-Strasse, Neuhegi
Bauherrschaf: Credit Suisse Real Esate Fund Siat, Credit Suisse Real Esate Fund
Green Property
Totalunternehmer: Implenia, Zürich
Architektur: Dachtler Partner, Zürich
Landschafsarchitektur: ASP, Zürich
Kosen: Fr. 105 Mio.



9 Villa Büel, 2016
Im Erdgeschoss der 1850 gebauten Villa hat eine private Schule ihre Räume, in den Obergeschossen gibt es jeweils zwei Wohnungen und eine Atelierwohnung als Maisonete. Die charakterisische Halle is als Erschliessungsraum für das ganze Haus reaktiviert und funktioniert wieder als Rückgrat des Hauses.
Adresse: Büelrainsrasse 16
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Architektur: Kilga Popp, Winterthur Kosen: 3,75 Mio.
10 Wohnüberbauung Werk 3, 2016
In den sechsgeschossigen Bauten sind 211 Wohnungen für unterschiedliche Wohnformen untergebracht. Die Gebäudevolumen und die Fassade aus Zementseinen sind eine Reverenz an die indusrielle Vergangenheit des Areals. Die Überbauung seht an der Zürchersrasse, einer sark befahrenen Ausfallachse.
Adresse: Zürchersrasse, Obere Schöntalsrasse, Schlosshofsrasse
Bauherrschaf: Swica Versicherungen, Winterthur ; Swisscanto Asset Management, Zürich
Architektur: Beat Rothen, Winterthur Landschaf: Müller Illien, Zürich




11 Haus Rudolfsrasse, 2016
Der Neubau mit Büros in den unteren und Wohnungen in den oberen Geschossen ist ein Beitrag an die innere Verdichtung des Quartiers an der Rudolfsrasse. Die vertikal srukturierte Fassade versärkt die Eleganz des schlanken Baukörpers. Die Fenser bieten atraktive Blicke in die Stadt.
Adresse: Rudolfsrasse 17a Bauherrschaf: Privat
Projektentwicklung und Architektur: Graf Biscioni, Winterthur
12 Mehrfamilienhäuser, 2015
Der lange Baukörper, ‹ die grüne Schlange ›, is in drei Segmente gegliedert und vermitelt zum Quartier. Drei Treppenhäuser erschliessen 23 Wohnungen. Ihr Wohnraum sannt sich über die ganze Gebäudetiefe auf. Die Erdgeschosswohnungen sind vom Terrain leicht abgehoben, haben aber Zugang zum Garten.
Adresse: Oberseenersrasse 43 Bauherrschaf: AG für Ersellung billiger Wohnhäuser c / o Auwiesen Immobilien
Architektur: BDE, Winterthur Kosen: Fr. 9,9 Mio.
13 Umbau Villa und Neubau, 2015
Der alte Baumbesand zeichnet das Grundsück im Villenviertel Inneres Lind aus. Mit seiner Klinkerfassade nimmt der Neubau Bezug zur Villa, grenzt sich aber in seiner Schlichtheit von ihr ab. Die Villa mit eins neun Zimmern wurde in drei Wohnungen unterteilt.
Adresse: Römersrasse, Palmsrasse
Bauherrschaf: Coordinator
Verwaltungs-AG, Winterthur
Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
14 Umbau und zwei Neubauten, 2015
Die Villa von Ritmeyer & Furrer ( 1928 ) is sorgfältig saniert und in zwei Wohnungen unterteilt worden. Im grosszügigen Garten entstanden zwei Neubauten, die sich in ihren Dimensionen am Altbau orientieren, gesalterisch aber davon absetzen.
Adresse: Leimeneggsrasse 24 – 30 Bauherrschaf: Privat
Architektur: Dahinden Heim, Winterthur
Landschaf: Brogle, Winterthur

15 Wohnüberbauung Wülflingen, 2015
Das Grundsück is auf zwei Ebenen aufgeteilt. Auf jeder Ebene sehen zwei abgewinkelte Baukörper, die je über einen gemeinsamen Hof erschlossen sind. Die intimen Wohnhöfe verleihen der Anlage ihre Identität. Gegeneinander versetzte Balkone lockern die einfachen Volumen auf und verzahnen sie mit der Umgebung. Beton und Klinker prägen die Fassaden.
Adresse: Wydensrasse, Habichtsrasse, Esensrasse
Bauherrschaf: Noldin Immobilien, Zürich
Architektur: Boltshauser, Zürich
Landschaf: Metler, Berlin
16 Überbauung Etzbergpark, 2015
Die fünf schlanken Gebäude sehen auf dem Areal eines früheren Tanklagers. Die Anordnung der Baukörper erlaubt vielfältige Durchblicke, und sie bietet den Wohnungen Weitsicht. Die Häuser mit den grösseren Wohnungen sind als Zweioder Dreisänner organisiert, das Haus mit den Alterswohnungen als Viersänner.
Adresse: Etzbergweg 2 – 23
Bauherrschaf: Ed. Kübler & Co, Winterthur
Architektur: Beat Rothen, Winterthur
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur





17 Ersatzneubau, 2015
Die drei Mehrfamilienhäuser ersetzen mit ihren 24 Wohnungen drei Altbauten mit je vier Wohnungen. Die Reihung gleicher Baukörper is typisch für das Quartier. In den 3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen erweitern zweiseitig belichtete Loggien im Sommer den Wohnraum nach aussen.
Adresse: Rundsrasse 52 – 56
Bauherrschaft: Johann Jakob SulzerStifung, c / o Auwiesen Immobilien
Architektur: P & B Partner, Winterthur
18 Siedlung Oberwis, 2015
Die Zeilenbauten am Siedlungsrand von Dätnau reihen sich auf beiden Seiten der Erschliessungsachse auf. Vier Baukörper mit 16 Häusern nehmen total 85 Wohnungen und neun Zimmer auf. Ziel der Bauherrschaf war es, günstigen Wohnraum zu schaffen, dem der Architekt räumlichen Mehrwert gab.
Adresse: Dätnauersrasse 131 – 163
Bauherrschaf: Anlagesifung Adimora, vertreten durch Pensimo Management
Architektur: Jakob Steib, Zürich Landschaf: Bandorf Neuenschwander Partner, Zürich
19 Umbau Wohnhaus, 2014
Das Bauernhaus mit Scheunenteil ist auf einem Plan von 1739 schon als Hofsäte verzeichnet. Der jüngse Umbau fügte der Baugeschichte eine weitere Schicht an. Die gedämmten Wohnbereiche halten Distanz zur Konsruktion, damit entsehen witerungsgeschützte, aber ungedämmte Zwischenräume, die vielfältig genutzt werden können.
Adresse: Ibergsrasse 54 Bauherrschaf: Privat
Architektur: Jonathan Roider, Zürich Kosen: Fr. 830 000.–
20 Wohnhaus mit Resaurant, 2014
Im Frühjahr 2012 brannte das Haus in der Altsadt bis auf die Grundmauern nieder. Der an seiner Stelle entstandene Neubau hat ein zusätzliches Geschoss, er tariert die Bebauung des Neumarkts aus. Herzstück des schmalen Hauses ist die zentrale Halle im zweiten Stock: Hier führen sieben Türen in die Wohnungen, die einen auf dem gleichen Niveau, andere über Treppen nach unten oder nach oben.
Adresse: Neumarkt 5
Bauherrschaf: Guido Binkert, Seuzach
Architektur: Kilga Popp, Winterthur
Kosen: Fr. 3,85 Mio.



21 Sanierung Wohnhäuser, 2014
Die Raumsrukturen der 1953 erbauten Häuser blieben unverändert. Doch Innenausbau, Nasszellen und Hausechnik sowie die Boden- und Wandbeläge wurden erneuert. Die bunten Farben der Fassaden binden die Bauten besser ins Quartier ein.
Adresse: Talwiesensrasse 14–18
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur
Landschaf: Thomas Steinmann, Winterthur
22 Wohnüberbauung Tägelmoos, 2014
In der Überbauung sind 99 Wohnungen der Asig und 42 Wohnungen der Gaiwo untergebracht. Die zehn Häuser sind zu fünf Baukörpern zusammengefass , die ein abwechslungsreiches Geflecht von Aussenräumen definieren.
Adresse: Wurmbühlsrasse, Tägelmoosweg, Grundsrasse Bauherrschaf: Konsortium Tägelmoos ( Wohngenossenschaf Asig, Zürich ; Genossenschaf für Invaliden- und Alterswohnungen Gaiwo, Winterthur )
Architektur: Nef Neumann, Zürich
Landschaf: Studio Vulkan, Zürich Kosen: Fr. 54 Mio.
23 Neubau Hohfurri Eigenweg, 2014
Die sechs Häuser schmiegen sich an die Wohnbebauung der Umgebung. Auf dem Grundsück seht die Sonne auf der ‹ falschen › Seite, doch das Grundrisskonzept schaf Aussicht und Besonnung. Adresse: Hohfurrisrasse, Eichenweg
Bauherrschaf: Swica Krankenversicherung und Swica Personalvorsorgesifung, Winterthur
Architektur: Beat Rothen, Winterthur
Landschaf: Schweingruber Zulauf, Zürich ; Müller Illien , Zürich
24 Terrassenhäuser am Lindberg, 2014
Die Terrassenhäuser mit je zwei Wohnungen sehen auf dem Grundsück eines herrschaflichen Hauses aus der Nachkriegszeit. Die ebenerdigen Wohnungen sind eingeschossig, darauf liegen Maisoneten mit grosszügigen Terrassen mit Fernsicht. Dunkel eingefärbter, sandgesrahlter Beton prägt das Äussere.
Adresse: Tachlisbrunnensrasse 33–37 Bauherrschaf: Erbengemeinschaf
Architektur: Dahinden Heim, Winterthur
Landschaf: Ryfel + Ryfel, User Kosen: Fr. 10,3 Mio.





25 Sanierung Leimenegg-Haus, 2013
Hermann Siegris baute 1932 eine radikal moderne Reihenhaussiedlung. Mit der Sanierung haben die Architekten nun Vorhandenes resauriert, Zersörtes rekonstruiert und Fehlendes im Geiste der Bauzeit neu geschaffen. Damit sind die Grenzen zwischen Alt und Neu fliessend geworden.
Adresse: Leimeneggsrasse 43
Bauherrschaf: Marisa Eggli, Benjamin Widmer, Winterthur
Architektur: Bernath + Widmer, Zürich
26 Mehrgenerationenhaus, 2013
Die ‹ Giesserei › steht auf dem Areal der einstigen Sulzer-Giesserei. Die zwei Längsbauten fassen mit zwei niedrigen Querbauten einen Hof. Öfentliche Erdgeschossnutzungen beleben die Siedlung. Acht Treppenhäuser erschliessen 155 Wohnungen, die den Rahmen für die selbsverwaltete Genossenschaf bilden.
Adresse: Ida-Sträuli-Strasse 69 – 79 Bauherrschaf: Genossenschaf für selbsverwaltetes Wohnen ( Gesewo ), Winterthur
Architektur: Galli & Rudolf, Zürich
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
27 Terrassengarten Landenberg, 2013
Die sechs identischen Terrassenhäuser sehen auf Betonbändern, die das Terrain terrassieren. Zwischen den Häusern verbinden sich grosszügige Grünräume mit dem nahen Waldrand, wobei die sonnenseitigen Bereiche als Gärten genutzt sind.
Adresse: Landenbergsrasse 50 – 84
Bauherrschaf: Baugesellschaf Landenberg
Architektur: Peter Kunz mit Atelier Strut, Winterthur Landschaf: Schweingruber Zulauf, Zürich
28 Mehrfamilienhaus, 2013
Der Neubau seht in einem Quartier mit hisorischen Gebäuden und Gärten. Ein rindenartiger, zweifarbiger Putz bindet ihn in seine Umgebung ein. Jede der vier Wohnungen is um den zentralen
Eingangsraum organisiert, wobei die verschiedenen Niveaus spannende
Raum bezüge hersellen.
Adresse: Seidensrasse 23
Bauherrschaf: Privat
Architektur: Stutz Bolt Partner, Winterthur
Landschaf: Brogle Rüeger, Winterthur



29 Mehrfamilienhaussanierung, 2013
Die drei Mehrfamilienhäuser mit 30 Wohnungen aus dem Jahr 1963 wurden umfassend saniert. In einem Anbau erhielten sie eine Wohnküche, die Balkone wurden durch neue, grössere Aussenbereiche ersetzt. Mit der Zusammenlegung von Zimmern passe man die Raumsruktur an.
Adresse: Seuzachersrasse 18 – 28
Bauherrschaf: Heimsäten- Genossenschaf Winterthur ( HGW )
Architektur: Hollensein, Winterthur
Landschaf: Ryfel + Ryfel, User
30 Sanierung Corti-Haus, 2011
Bauunternehmer Jean Corti ersellte das Haus 1877. Nun wurde es stilgerecht erneuert. In die ehemaligen Küchen baute man neue Bäder ein und machte einen Raum zur Wohnküche. Im Haupthaus gibt es drei Wohnungen, eine weitere entsand im Waschhäuschen.
Adresse: Turmhaldensrasse 10
Bauherrschaf: Stifung Winterthurer
Sozialarchiv und Bibliothek
Architektur: Walser Zumbrunn Wäckerli, Winterthur
Landschaf: Toni Raymann, Dübendorf
31 Ersatzneubauten, 2011
Die Neubauten mit je neun Wohnungen ersetzen vier Zeilen mit kleinen Einfamilienhäusern. Mit den srassenseitigen Giebeln ergänzen die drei Häuser das quartierübliche Muser, und auch die Grünräume orientieren sich an der Bebauung in der Umgebung.
Adresse: Wolfühlsrasse 40, 44, 48 Bauherrschaf: HGW HeimsätenGenossenschaf Winterthur
Architektur: P & B Partner, Winterthur
Landschaf: Team Walter + Partner, Winterthur
Kosen: 15 Mio.
32 Wohnüberbauung Max, 2011
‹ Max › beseht aus zwei Teilen: dem ehemaligen Laborgebäude an der Strasse mit Läden, Lofs und einem auskragenden Aufau sowie einer hufeisenförmigen Wohnanlage. Das Spektrum reicht von der Studiowohnung bis zur 6 ½ -ZimmerWohnung. Im Hof erzeugt eine üppige Bepflanzung räumliche Dichte.
Adresse: Else -Züblin-Strasse 90 – 112 Bauherrschaf: Helvetia Versicherungen, Zürich
Architektur: Dahinden Heim, Winterhtur Landschaf: Schweingruber Zulauf, Zürich




33 Wohn- und Geschäfshaus, 2011
Die Überbauung an markanter Stelle verwirklicht die Vision der 1860er-Jahre eines Blockrandquartiers hinter dem Bahnhof. 83 Stadtwohnungen, orientiert auf den Hof, finden hier Platz ; dänischer Backsein kleidet die Fassaden ein.
Adresse: Rudolfsrasse, Wülflingersrasse Bauherrschaf: Friedberg-Immobilien, Winterthur
Architektur: Dahinden Heim, Winterthur
Landschaf: Ryfel + Ryfel, User Kosen: Fr. 35,1 Mio.
34 Wohnhäuser Schöntalsrasse, 2010
Die beiden Neubauten mit 36 preisgünstigen Wohnungen ersetzen drei alte Wohnhäuser. Die auskragenden Balkone an den Gebäudeecken zeichnen die einfachen, viergeschossigen Kuben aus. Diese sind sorgfältig in die Umgebung eingefügt – auch in Material und Farbe.
Adresse: Obere Schöntalsrasse 20 – 22 Bauherrschaf: AG für Ersellung billiger Wohnhäuser, Winterthur
Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
35 Studentenwohnen, 2010

Gleich bei der ZHAW entsand Wohnraum für über 105 Studierende. An zwei Mitelgänge reihen sich die Zimmer. Angelpunkt is der Küchentrakt mit Koch- und Essgelegenheit. Am vertieften Innenhof liegt ein auch Aussensehenden ofener Saal.
Adresse: Untere Briggersrasse 31
Bauherrschaf: Swiss Life, Zürich
Architektur: Denkwerk, Winterthur Kosen: Fr. 11,1 Mio.
36 Haldengut, 2010
Wo bis 2002 Bier gebraut wurde, is eine Überbauung mit 200 Wohnungen und Gewerberäumen entstanden. Die alten Brauereigebäude wurden durch Neubauten ergänzt. Das weitherum sichtbare Zeichen ist der Hochkamin. Im Zentrum liegt ein öfentlicher Platz.
Adresse: Rychenbergsrasse, Tachlisbrunnensrasse, Haldensrasse
Bauherrschaf: Anlagesifung Turidomus ; Hans-Imholz-Stifung ; Stockwerkeigentum
Architektur: Atelier WW, Zürich ( Brauerei, Silo, Os ) ; Marcel Ferrier, St. Gallen ( We s )
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur



Verwaltung / Gewerbe / Diensleisung
37 Busdepot Grüzefeld, 2015
Um die Betriebsräume von ‹ Stadtbus › an einem Ort zu konzentrieren, ergänzte die Stadt das Depot um einen Neubau mit Platz für 144 Gelenk- und Standardbusse und einen Verwaltungsrakt. Das in eine gefaltete, chromsahlglänzende Hülle verpackte Gebäude dockt an den sanierten Altbau aus dem Jahr 1969 an.
Adresse: Grüzefeldsrasse 35 Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Architektur: BDE, Winterthur
Kosen: Fr. 40,5 Mio.
38 Superblock, 2015
Der Neubau nimmt den grossen Masssab der einsigen ‹ Hektarenhalle › auf und umschliesst einen grossen Innenhof. Im rot verschindelten Kopf gegen den ‹ Rundbau › ( Objekt 57 ) hat die Axa Winterthur 1200 Arbeitslätze eingerichtet, im grau verputzten Gebäude konzentriert die Stadt als Mieterin ihre Verwaltung.
Adresse: Pioniersrasse, Turbinensrasse Bauherrschaf: Axa Leben, Winterthur
Architektur: Architekt Krischanitz, Zürich
Kosen: Fr. 230 Mio.
39 Unterwerk Neuwiesen, 2015
Das unter der Erde dreigeschossige Bauwerk zeigt sich im Hof einer Wohnsiedlung als kompakter Klinkerkubus. Dessen Wände sind vier Grad geneigt, was die skulpturale Wirkung versärkt. Der Kommandoraum im Erdgeschoss hat Tageslicht, im 1. Untergeschoss liegt eine grosse Halle mit Fensern zu den technischen Anlagen.
Adresse: Alfred-Büchi-Weg 1 Bauherrschaf: Stadtwerk Winterthur
Architektur: Graf Biscioni, Winterthur
Landschaf: Hofmann & Müller, Zürich
Kosen: Fr. 14,5 Mio.
40 Umbau Hauptpos , 2014
Die Hauptpos entsand 1899 als Gegenüber des Bahnhofs und wurde im Takt der tech nischen Entwicklung umgebaut und an der Rückseite mit einem Industriebau erweitert. Ein geschwungener Neubau ersetzt den Anbau im Hof und erzeugt so die neue Schalterhalle. Zudem wurde eine Zwischendecke entfernt und der Altbau entrümpelt.
Adresse: Bahnhofsrasse 8
Bauherrschaf: Posfinance, Bern
Architektur: Stutz Bolt Partner, Winterthur Kosen: Fr. 40 Mio.
Wohnen
1 Siedlung Vogelsang, 2021 | E5
2 Wohnüberbauung Oberzelg, 2018 | G9
3 Mehrfamilienhaus Pappelweg, 2018 | C8
4 Wohnüberbauung Sue & Til, 2018 | D8
5 Siedlung Büelrain, 2017 | E6
6 Hagmann - Areal, 2017 | F8
7 Wohnüberbauung im Grüntal, 2017 | G9
8 Überbauung Roy, 2016 | D8
9 Villa Büel, 2016 | E6
10 Wohnüberbauung Werk 3, 2016 | E4
11 Haus Rudolf s rasse, 2016 | E5
12 Mehrfamilienhäuser, 2015 | G9
13 Umbau Villa und Neubau, 2015 | E6
14 Umbau und zwei Neubauten, 2015 | D7
15 Wohnüberbauung Wülflingen, 2015 | D2
16 Überbauung Etzbergpark, 2015 | E8
17 Ersatzneubau, 2015 | D5
18 Siedlung Oberwis, 2015 | F3
19 Umbau Wohnhaus, 2014 | H10
20 Wohnhaus mit Re s aurant, 2014 | E6
21 Sanierung Wohnhäuser, 2014 | D8
22 Neubau Hohfurri Eigenweg, 2014 | D3
23 Wohnüberbauung Tägelmoos, 2014 | F8
24 Terrassenhäuser am Lindberg, 2014 | D6
25 Sanierung Leimenegg - Haus, 2013 | D7
26 Mehrgenerationenhaus, 2013 | D8
27 Terrassengarten Landenberg, 2013 | D7
28 Mehrfamilienhaus, 2013 | E7
29 Mehrfamilienhaussanierung, 2013 | C5
30 Sanierung Corti - Haus, 2011 | E6
31 Ersatzneubauten, 2011 | D3
32 Wohnüberbauung Max, 2011 | D8
33 Wohn - und Geschä f shaus, 2011 | D5
34 Wohnhäuser Schöntal s rasse, 2010 | E4
35 Studentenwohnen, 2010 | F5
36 Haldengut, 2010 | D6
Verwaltung / Gewerbe / Diensleisung
37 Busdepot Grüzefeld, 2015 | E8
38 Superblock, 2015 | E5
39 Unterwerk Neuwiesen, 2015 | D5
40 Umbau Hauptpo s , 2014 | E5
41 Hauptsitz DMG Mori, 2014 | D8
42 Umbau Halle 181, 2014 | E5
43 Werkhof Rosenberg, 2013 | C5
44 Umbau Credit Suisse, 2013 | E6
45 Archhöfe, 2013 | E5
46 Geschä f shaus Drehscheibe, 2012 | E5
47 Geschä f shaus Stellwerk, 2010 | E5
Kultur / Bildung / Sport
48 Sulzer Werk 1, 2024 | E5
49 Halle 52, Haus Adeline - Favre, 2020 | E5
50 Neubau Gebäude 141, 2019 | F5
51 Sportkomplex Wincity, 2018 | E7
52 Umbau Halle 194, 2015 | E5
53 Bi s ro Les Wagons, 2015 | E5
54 Kino Cameo, 2015 | E5
55 Schulhaus Zinzikon, 2015 | C8
56 Stehplatztribüne, 2015 | E5
57 Bibliothek ZHAW, 2015 | E5
58 Eventkomplex Gate 24, 2014 | D6
59 Anton - Gra f- Haus, 2012 | E5
60 Schulhaus Wyden, 2011 | D2
Öfentlicher Raum
61 Science - Jungle, 2017 | C8
62 Gleisquerung, 2016 | E5
63 Bahnhofplatz Süd, 2013 | E5
64 Eulachpark, 2013 | D8
65 Sanierung Freibad, 2012 | C8
66 Brühlgutpark, 2010 | E5
SBB - Fernverkehr S - Bahnlinien
Stadtbuslinien
Plan: Reproduziert mit Bewilligung von Swis sopo ( BA 160111 ),
Bearbeitung: Werner Huber



41 Hauptsitz DMG Mori, 2014
Der Neubau nimmt den weltweiten Hauptsitz des Maschinenbaukonzerns auf. Das Herzsück is ein 14 Meter hoher Aussellungsraum. Um ihn herum sind ringförmig Schulungsräume, Konferenzräume und ein Resaurant angeordnet. Die Büros darüber orientieren sich auf einen zweigeschossigen begrünten Innenhof.
Adresse: Sulzerallee 70
Bauherrschaf: DMG Holding, Dübendorf
Architektur: Cukrowicz Nachbaur, Bregenz
42 Umbau Halle 181, 2014
Die zweigeschossige Halle aus Beton und Stahl erhielt eine dreigeschossige, in Holz konsruierte Aufsockung. Eine feingliedrige Doppelfassade is zugleich Klimapufer und ‹ botanisches Labor › für die hier tätigen Landschaftsarchitekten. Daneben gibt es weitere Büros, Ateliers, ZHAW-Hörsäle und Werksäten.
Adresse: Lagerplatz 21
Bauherrschaf: Stifung Abendrot, Basel
Architektur: Kilga Popp, Winterthur
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
Kosen: Fr. 15 Mio.




43 Werkhof Rosenberg, 2013
Der neue Werkhof des Friedhofs Rosenberg verbessert die betrieblichen Abläufe und Arbeitsbedingungen. In der denkmalgeschützten Friedhofanlage nimmt der Neubau Bezug auf die ursprüngliche Konzeption der Architektengemeinschaft von Robert Ritmeyer und Walter Furrer. Die Gestaltung nimmt die Formsprache der Friedhofmauern auf.
Adresse: Am Rosenberg 13
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur
44 Umbau Credit Suisse, 2013
Mit dem Umbau wurde das ehemalige Volksbank-Gebäude von Franz Scheibler aus den 1960er-Jahren den heutigen Bedürfnissen angepass . Die kaum wahrnehmbare Aufsockung übernimmt die Trauf- und Gesimshöhen der Nachbarn. Eine grosszügigere Fassade ersetzt die bisherige Naturseinfassade. Die alten Erschliessungskerne brach man ab und baute sie an neuer Stelle wieder ein.
Adresse: Stadthaussrasse 16
Bauherrschaf: Credit Suisse, Zürich
Architektur: Dahinden Heim, Winterthur
Kosen: Fr. 20 Mio.
45 Archhöfe, 2013
Der markante Block anselle des früheren Volkshauses und Parkhausrovisoriums nimmt fas 30 Läden, Re saurants, Büros und Praxen sowie 68 Wohnungen auf. Das Volumen orientiert sich am Parzellenrand, was zu geknickten Fassaden und einer bewegten Dachform führte.
Adresse: Archplatz
Bauherrschaft: Personalvorsorge des Kantons Zürich (BVK)
Architektur: BDE, Winterthur
Landschaf: Ganz, Zürich
46 Geschäfshaus Drehscheibe, 2012
Der Neubau entstand an zentraler Stelle des Sulzer-Areals. Er nimmt Räume für die Lehre, Forschung und Entwicklung sowie Geschäftsräume auf. Auf dem Dach des fünfgeschossigen, 156 Meter langen Gebäudes gibt es einen Aussenraum für Sport und Spiel.
Adresse: Technoparksrasse 1 – 7
Bauherrschaf: Personalvorsorgesifung der Ärzte und Tierärzte (PAT-BVG), Bern
Architektur: LOZ-Z, Zürich
Landschafsarchitektur: Rotzler Krebs
Partner, Winterthur
Kosen: Fr. 44 Mio.
47 Geschäfshaus Stellwerk, 2010
Der Neubau am Nordende des Bahnhofs ist die Hälfte eines 160 Meter lang geplanten Hauses. Die Architekten sapelten drei Teile übereinander: das Erdgeschoss, drei Bürogeschosse und einen ebenfalls mit Büros genutzten zweigeschossigen Aufbau. Blechpaneele in unterschiedlichen Grautönen kleiden das Gebäude ein und untersreichen die Stapelung.
Adresse: Bahnhofplatz 15
Bauherrschaf: Schweizerische Bundesbahnen ( SBB )
Architektur: AGPS, Zürich
Kosen: Fr. 22,4 Mio.



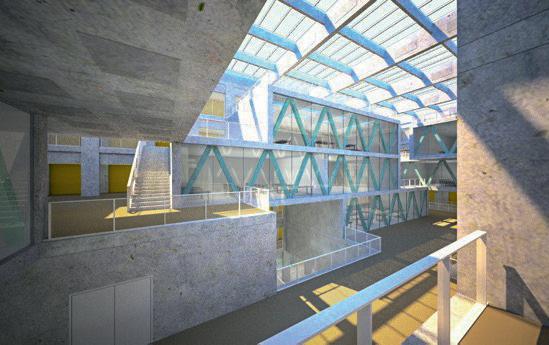



Kultur / Bildung / Sport
48 Sulzer Werk 1, 2024
Auf dem Stammareal der Lokomotivfabrik entseht ein Stadtquartier mit Arbeitsplätzen, Wohnungen, Bildungs - und Freizeiteinrichtungen. Altbauten, Neubauten und öffentliche Freiräume bilden ein Geflecht, der vom Volk genehmigte Gesaltungslan läss drei Hochhäuser zu.
Adresse: Sulzer-Areal Stadtmite
Projektentwicklung: Implenia, Winterthur
Bauherrschaf: Implenia Immobilien
Tesplanung: Gigon / Guyer, Zürich ( Architektur ), Vogt, Zürich ( Landschaf )
49 Halle 52, Haus Adeline-Favre, 2020 Gegen den Platz zeigt das Gebäude seine alte Indusriefassade aus Backsein. Dahinter entseht ein Neubau für das Departement Gesundheit der ZHAW. Ein Gebäudering umschliess einen grossen Innenhof, in dem die Hörsäle versetzt übereinander gesapelt sind. So entsehen Terrassen, die als Hörsaal-Foyer, Aufenthalts- oder Arbeitsort dienen.
Adresse: Katharina-Sulzer-Platz
Projektentwicklung: Implenia, Winterthur
Invesor: Siska Heuberger, Winterthur
Architektur: pool, Zürich
50 Neubau Gebäude 141, 2019
Der markante Neubau schliess das einsige Indusrieareal gegen Süden ab und bildet an der Tössfeldsrasse gleichzeitig einen Aufakt zum vielfältig genutzten Areal. Im Erdgeschoss sind Restaurants und Läden vorgesehen, darüber gibt es Hörsäle, Labors und weitere Räume für die ZHAW sowie 86 Lofwohnungen.
Adresse: Lagerplatz
Bauherrschaf: Stifung Abendrot, Basel
Architektur: Beat Rothen, Winterthur
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
51 Sportkomplex Wincity, 2018
Das Projekt auf dem Sportgelände Deutweg is auf den Breiten- und Spitzens ort ausgerichtet. Es umfass drei Volumen, die einen Aussenraum formen. Die erste Etappe umfass eine Balls ortarena –die Heimat für die Handballer von Pfadi Winterthur und anderen Vereinen –und den Sportrakt 1. In der Arena gibt es eine Tribüne mit 2400 Sitzplätzen.
Adresse: Grüzesrasse 32 – 36
Bauherrschaf: Wincity, Winterthur
Architektur: EM2N, Zürich
Landschaf: Balliana Schubert, Zürich
Kosen: Fr. 30 – 45 Mio.
52 Umbau Halle 194, 2015
Seit den 1990er-Jahren gab es in der Halle 194 Zwischennutzungen. Beim Umbau zog man einen Zwischenboden ein und stockte das Seitenschiff auf, sodass der Akademische Sportverein einziehen konnte. Bisherige Mieter konnten bleiben, die Badmintonhalle erhielt von Nicola Gabriele gesaltete Fenser.
Adresse: Zur Kesselschmiede, Lagerplatz Bauherrschaf: Stifung Abendrot, Basel Architektur: Hannes Moos, Winterthur Kosen: Fr. 13,5 Mio.
53 Bisro Les Wagons, 2015 Mit viel Enthusiasmus, Fronarbeit und vielfältiger Untersützung konnten Florian Moser und Anja Holensein in alten Bahnwagen ein Resaurant einrichten. Die Sihltal–Zürich–Üetliberg -Bahn stellte die Wagen zu einem symbolischen Preis zur Verfügung und Nachbarn auf dem Areal zeichneten die nötigen Pläne. Morgens sind die 33 Plätze ( plus 50 auf dem Perron ) ein Café, mitags werden zwei Menus aufgetischt und abends ist Barbetrieb.
Adresse: Lagerplatz 17a Bauherrschaf: Stifung Abendrot ( Areal ), Florian Moser, Anja Holensein Kosen: Fr. 400 000.–
54 Kino Cameo, 2015
Das neue Kino mit 84 Plätzen seht unter einem alten Schutzdach von Sulzer auf dem Lagerplatz-Areal der Stifung Abendrot. Von aussen wirkt der dunkle Baukörper wie eine geheimnisvolle Schatulle. Darin verbergen sich ein Foyer samt Bar sowie der Kinosaal mit grosszügig angeordneten Sitzreihen.
Adresse: Lagerplatz 19
Bauherrschaft: Filmfoyer Winterthur
Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur Kosen: 1,7 Mio.



55 Schulhaus Zinzikon, 2015
Der Neubau entlaset besehende Schulhäuser und schafft neuen Raum im wachsenden Quartier. Aus allen Himmelsrichtungen führen Eingänge ins Haus, in dessen Mite die Doppelturnhalle liegt. Darum herum sind in vier Baukörpern die Klassenzimmer und alle anderen Räume untergebracht. Die Erschliessungszone is ein sich verengendes und erweiterndes Raumkontinuum.
Adresse: Ruchwiesensrasse 1
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Architektur: Adrian Streich, Zürich
Landschaf: Schmid, Zürich
Kosen: Fr. 31,45 Mio.
56 Stehplatztribüne, 2015
Die neue Tribüne is der erse Bausein aus dem Modulbaukasen, den die Architekten im Wettbewerb entwickelten.
Sie bietet Platz für 3600 Stehplätze und ergänzt so die bestehende Anlage ideal. Bei Bedarf und finanzieller Kraft können weitere Teile realisiert werden.
Adresse: Rennweg 5
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Architektur: Sollberger Bögli, Biel
Landschaf: Müller Illien, Zürich
Kosen: Fr. 9 Mio.
57 Bibliothek ZHAW, 2015
Der ‹ Rundbau ›, die Rohrschlosserei von 1931, is eine der markantesen Bauten des Sulzer-Areals. Dank der Nutzung als Bibliothek konnten die Qualitäten der lichtdurchfluteten Indusriehalle erhalten bleiben, und dank der ebenso sorgfältigen wie aufwendigen Sanierung zeigt das Äussere heute das ursrüngliche Gesicht.
Adresse: Turbinensrasse 2
Projektentwicklung: Implenia, Winterthur
Eigentümer: Credit Suisse Real Esate Fund Hositality, Zürich
Architektur: P & B Partner, Winterthur
Kosen: Fr. 50 Mio. ( inkl. Grundsück )
58 Eventkomplex Gate 24, 2014
Der Neubau der Freien Evangelischen Gemeinde umfasst einen 750 -plätzigen Saal, ein Bisro, eine Kapelle, Freizeiträume und 21 Wohnungen. Das Gebäude aus lasiertem Sichtbeton hat die nötige Kraft, um sich neben dem benachbarten Hochhaus zu behaupten. Das Auditorium läss unterschiedliche Veransaltungen zu.
Adresse: Theatersrasse 27
Bauherrschaf: FEG Winterthur
Architektur: Graf Biscioni, Winterthur
Landschaf: Hofmann & Müller, Zürich



59 Anton-Graf-Haus, 2012 1970 war das Gebäude eine Berufs- und Fachschule und die Kantine für die ganze Belegschaf von Sulzer. Seit 1988 is es ein Schulhaus der Berufsbildungsschule BBW. Mit der Sanierung wurde aus der alten Kantine eine Raumfolge mit Mediathek, Aula und Mensa ; auf der Rückseite entstanden zwei neue Turnhallen. Die Struktur der Obergeschosse ist erhalten geblieben.
Adresse: Zürchersrasse 28
Bauherrschaf: Kanton Zürich
Architektur: Bosshard & Luchsinger, Luzern
Landschaf: Appert + Zwahlen, Cham
60 Schulhaus Wyden, 2011
Entsrechend dem Terrainverlauf entwickelt sich das Schulhaus auf mehreren Ebenen. Die verschiedenen Gebäudeteile für die einzelnen Nutzungen sind zu einem diferenzierten Gesamtvolumen zusammen gefügt. Eine dreigeschossige Erschliessung verbindet die Hauptebenen.
Adresse: Esensrasse 16
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Architektur: Von Ballmoos Krucker, Zürich
Landschaf: Schweingruber Zulauf, Zürich
Kosen: Fr. 23 Mio.





Öfentlicher Raum
61 Science-Jungle, 2017
Mit dem geplanten Ausbau des OutdoorAussellungsbereichs soll der Park des Technoramas zu einer Experimentierlandschaft werden. In dem als ‹Science Jungle› inszenierten Park steht die Natur in einem Kontras zur Architektur und zu den Exponaten. Die Wunderbrücke erschliess die drite Dimension.
Adresse: Technoramasrasse 1
Bauherrschaf: Stifung Swiss Science Center Technorama, Winterthur
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
Ingenieure: Conzet Bronzini Partner, Chur
62 Gleisquerung, 2016
Um die Quartiere beidseits der Gleise und der Zürchersrasse -Unterführung besser zu verbinden, entsehen auf beiden Seiten der Bahn zwei Plätze. Mit einer Unterführung verbunden, sind sie punktuell mit Pflanzen und Sitzelementen ausgesaltet.
Adresse: Zürchersrasse
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Architektur: Müller & Truniger, Zürich
Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur
63 Bahnhofplatz Süd, 2013
Der südliche Bereich des Bahnhofplatzes is Drehscheibe für über 90 000 Fussgänger und Hauptknoten der sädtischen Busse. Ein riesiges Pilzdach auf einer einzigen Stütze markiert die Bedeutung des Orts im Stadtbild. Von der Altsadt is es weit abgerückt, auf der anderen Seite kragt es jedoch 34 Meter aus.
Adresse: Bahnhofplatz
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Architektur: Stutz Bolt Partner, Winterthur
Kosen: Fr. 13 Mio.
64 Eulachpark, 2013
In drei Etappen wuchs der Eulachpark als zentraler Grünraum des wachsenden Stadteils Neuhegi. Eichenbäume in freier Anordnung prägen den Parkteil Os In der Mite des Parkteils We s liegt eine grosse Spielwiese. Der Parkteil Nord liegt anstelle des Gartens vor dem verschwundenen Wohlfahrtsgebäude.
Adresse: Barbara-Reinhart-Strasse, Else -Züblin-Strasse
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Landschaf: Koepfli Partner, Luzern
Kosen: Fr. 8,8 Mio.
65 Sanierung Freibad, 2012

Mit der Sanierung erhielt das im Jahr 1958 ersellte Bad ein langes, schmales Dach auf angeschrägten Betonstützen. Darunter nehmen drei Gebäude alle nötigen Funktionen auf – von der Kasse über die Küche bis zu den Garderoben.
Die Schwimmbecken erhielten einen Einbau aus Chromsahl.
Adresse: Mooswiesenweg 44 Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Landschaf: Manoa, Meilen
Architektur: Walser Zumbrunn Wäckerli, Winterthur
Kosen: Fr. 11,5 Mio.
66 Brühlgutpark, 2010
Die Umgesaltung führt den 1870 angelegten Park in die Zukunf . In der Mite liegt eine annähernd kreisrunde Rasenfläche, die von einem weich geformten Betonband eingefass is . Als Kontras dazu sind die umgebenden Partien dicht bepflanzt. Ein Blickfang an der Zürchersrasse is der hohe Zaun aus verdrehten Staketen.
Adresse: Zürchersrasse
Bauherrschaf: Stadt Winterthur
Landschafsarchitektur: Rotzler Krebs
Partner, Winterthur
Kosen: Fr. 1,84 Mio.

Die Wülflingerunterführung is eines der Nadelöhre im sädtischen Verkehrsnetz.


Drei Brunnen von Donald Judd sind die Atraktion in der breiten und ruhigen Steinberggasse in der Altsadt.
In der wachsenden Stadt i s der ö fentliche Raum begrenzt. Nun gilt es ihn so zu gesalten, dass er den Bedürfnissen der Menschen und des Verkehrs gerecht wird.
Der Bahnhof Winterthur is wieder einmal eine Bauselle. Für 110 Millionen Franken organisieren die SBB die Zufahrten neu und erweitern die Perrons. Der Ausbau der Zürcher S-Bahn wird dem Winterthurer Hauptbahnhof ab 2018 neue Linien, mehr und längere Züge bescheren. Aber auch die Stadt is am Werk: Mit der Gleisquerung als neue Fussgänger- und Veloverbindung sowie mit zwei neuen Plätzen geht das Herzsück des Maserplans Bahnhof seiner Vollendung entgegen. Diese Arbeiten setzen den Schlussunkt unter den Wandel, der den Bahnhof und seine Umgebung in den letzten Jahren sark verändert hat.
Als markante Hochbauten flankieren seit 2001 das Einkaufszentrum ‹ Stadtor› und seit 2010 das Geschäfshaus ‹ Stellwerk › das historische Bahnhofgebäude. Der Platz davor wurde schon 2003 neu gesaltet, zehn Jahre säter folgte der neue Busbahnhof mit seinem grossen Pilzdach. Die neu gestalteten Strassen und Plätze beidseits des Bahnhofs gesellen sich zu einer Reihe von öfent-
lichen Räumen mit hoher Aufenthaltsqualität und breitem kulturellen Angebot. Dazu gehören der Stadtgarten und die damit verbundene ‹Kulturmeile › mit Theater, Museum Oskar Reinhart und Kunstmuseum, aber auch die Altsadt als eine der ersen und grössen Fussgängerzonen der Schweiz. In jüngser Zeit hat sich im Stadtzentrum der Katharina-Sulzer-Platz zum Brühlgutpark gesellt, in Neuhegi-Grüze entsand der Eulachpark. Als Velosadt findet Winterthur sogar internationale Beachtung ; die Gleisquerung und die neue Unterführung Nord am Bahnhof untersreichen die Bedeutung dieses Verkehrsmitels.
Grosse Projekte beflügeln die Gedanken
Mit dem Maserplan Bahnhof Winterthur hat die heutige Generation ihre Hausaufgaben gemacht. Doch ausgerechnet das wichtigste Element eines Bahnhofs, die Perronanlage, verharrt in Winterthur seit dreissig Jahren in einer Art Schocksarre. In den 1980er-Jahren verschwanden Gleise und Perrons unter einem zweigeschossigen Parkhaus, einer Konsruktion von einer kaum zu überbietenden Grobheit. Selbs die nachträglich aufgebrachte Farbe und mehr Licht konnten die Situation nicht retten.

Bahnhof Winterthur: bezüglich Passagierzahlen der viertwichtigse der Schweiz, aber nicht der atraktivse.

Der St.-Georgen-Platz is als Platz gar nicht erkennbar; er is eine Verkehrsanlage aus den 1970er-Jahren.

In Lausanne lös das Projekt Léman 2030 einen kompletten Umbau des Bahnhofs aus, bei dem kein einziger Meter Schiene an seinem Ort bleibt. Die Perronhalle wird verschoben, der Bahnhofplatz komplett unterhöhlt. Genf wird zwei unterirdische Gleise erhalten, und auch in Luzern entseht bis 2030 für insgesamt 2,4 Milliarden Franken ein Durchgangsbahnhof.
Der Weg zur bipolaren Stadt
Der Winterthurer Hauptbahnhof bündelt sieben Bahnlinien. Daneben gibt es auf Stadtgebiet noch neun weitere Stationen, die von verschiedenen S-Bahnlinien bedient werden. Anders als in Zürich hat sich die S-Bahn in Winterthur nicht als innerstädtisches Verkehrsmittel etabliert. Hohe Passagierfrequenzen zählen nur die
Auch für den Bahnhof Winterthur gilt: Nach der Bauselle is vor der Bauselle – oder zumindes vor der nächsen Planung. Am Horizont zeichnet sich der Brütenertunnel ab, der ab 2030 eine zusätzliche direkte Verbindung zum Flughafen und Richtung Dietlikon herstellen wird. Das Milliardenprojekt wird im Stadtbild sichtbar sein, nicht nur am Rand der Töss, wo die neue Linie in die Stammsrecke münden soll. Die Planer erwarten, dass die Passagierzahlen im Bahnhof Winterthur sark anseigen. Reichen die bestehenden Perrons aus ? Genügen die ( bis dahin ausgebaute ) Personenunterführung Nord und die ( heute äusserst unattraktive ) Hauptunterführung Süd, um die Passagierströme zu bewältigen ? Natürlich nicht ! Man könnte nun in gewohnter Manier Passagierströme interpolieren, daraus die nötigen Treppen- und Unterführungsbreiten ableiten und ein Projekt machen. Das reicht aber nicht. Die Dimensionen des geplanten Ausbaus sollten vielmehr der Anlass sein, den Bahnhof Winterthur gründlich zu durchleuchten, planerisch auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Die Anlage is das Ergebnis einer über 150-jährigen Entwicklung. Am Anfang baute man den Eisenbahnhof am heutigen Standort, dann folgten unzählige Ausbauschritte, die ihn zu dem machten, was er heute ist: ein Konglomerat aus allen Epochen der Eisenbahngeschichte, das die Stadt in ihrer Mite in zwei Hälften teilt. Gibt es keine Alternative, als dieser Zusammenballung eine weitere Schicht anzufügen ? Bietet der Ausbau nicht die Chance, den Bahnhof neu zu denken ? Immerhin is er laut SBB der viertwichtigse der Schweiz.
Die Gleisquerung wertet die Verbindung zwischen Altsadt / Bahnhof und Neuwiesenquartier / Sulzer-Areal auf. →
Stationen an der S 12, der schnellen Verbindung nach Zürich. Die anderen Stationen auf Stadtgebiet liegen an weniger frequentierten Linien, etliche peripher zum Siedlungsgebiet. Rafael Noesberger, Gesamtleiter Verkehr im Amt für Städtebau, is deshalb skeptisch, wie weit sich die S-Bahn als innersädtisches Verkehrssysem eignet. Auf einer Achse hingegen, zwischen dem Hauptbahnhof und Neuhegi-Grüze, soll die S-Bahn nicht nur ein wichtiger Verkehrsräger, sondern eine Entlasung für das Strassennetz sein. Im Gebiet des ehemaligen Indusrieareals von Sulzer in Oberwinterthur soll hier ein zweites Zentrum entstehen, das Winterthur zu einer bipolaren Stadt macht. Bereits heute erschliessen drei Bahnsationen das Gebiet: Grüze ( St. Galler- und Tösstallinie ), Hegi ( St. Gallerlinie ) und Oberwinterthur ( Frauenfelderlinie ). Zudem soll die Frauenfelderlinie mit einem Halt in der Grüze ausgestattet werden. Damit wird Neuhegi-Grüze mit der S-Bahn eng an den Hauptbahnhof, aber auch an Zürich angebunden. Eine neue Brücke für den Bus beim Bahnhof Grüze schaf eine atraktive Umseigebeziehung zwischen Bus und Bahn und erschliesst das Gebiet Neuhegi mit dem ÖV direkt. Gleichzeitig werden parallel zu den Bahngleisen Veloschnellrouten geschafen, die den Radverkehr mit breiten Fahrsreifen, wenigen Kreuzungspunkten und möglichs hindernisfrei noch atraktiver machen sollen. Stadtauswärts soll eine neue Erschliessungsstrasse dafür sorgen, dass der motorisierte Verkehr auf direktem Weg zur Autobahn gelenkt wird. Dies sind die Schlüsselprojekte in einer Gesamtverkehrslösung für dieses Entwicklungsgebiet.
Diese Massnahmen sind ein wichtiger Teil des sädtischen Gesamtverkehrskonzepts, das der Grosse Gemeinderat, das Stadtparlament, 2011 ohne Gegensimme verabschiedet hate. Damit gab die Stadt Winterthur ein sarkes Signal in Richtung Bern, denn das Gesamtverkehrskonzept floss in das Agglomerationsrogramm ein, das die Stadt zusammen mit dem Kanton ausarbeitete – und das zu einem grossen Erfolg wurde: Mit 40 Prozent wurden dem Winterthurer Agglomerationsrogramm schweizweit die höchsen Bundesbeiträge in Aussicht gesellt.
Personen transortieren, nicht Fahrzeuge
Auf die einsimmige Verabschiedung des Gesamtverkehrskonzepts im Stadtparlament folgt nun die keineswegs mehr einstimmige Umsetzung. Denn das Konzept legte die Stossrichtung fest, aber keine Details. Jetzt, da es um die konkreten Massnahmen geht, kann man die Unschärfen des Konzepts je nach politischem Blickwinkel ganz unterschiedlich interpretieren. Die Diskussionen werden emotional geführt, und mit der Parkplatzverordnung hat ein Kernsück im Herbs 2015 an der Urne bereits Schifruch erliten. So verhärtet wie in Zürich sind die Fronten allerdings nicht. « In Winterthur arbeiten wir sehr konsensorientiert », meint Rafael Noesberger. Das ist einerseits zwar positiv, andererseits hemmt es aber grundlegende Neuerungen.
Das Hauptproblem des Verkehrs is in Winterthur das gleiche wie fast überall: Die Strassen sind in den Hauptverkehrszeiten ausgelastet, stellenweise überlastet. In der Innensadt die Strassen auszubauen, is nicht möglich, und so herrscht ein Verteilkampf um den begrenzten Raum. Weil die Strassen nicht mehr Verkehr schlucken können, muss man versuchen, die Menschen platzsparend zu befördern – im öfentlichen Verkehr, per Velo, zu Fuss oder indem man sie dazu bringt, die fünf Sitzplätze pro Auto besser zu nutzen. « Es geht darum, Personen zu transortieren, nicht Fahrzeuge », bringt es Verkehrslaner Noesberger auf den Punkt.
Winterthur war schon vor Jahrzehnten, als die Zukunft noch dem Auto gehörte, eine Velostadt. Damals war das Fahrrad nicht als schnelles und umweltfreundliches Verkehrsmittel populär, sondern – typisch für eine Industriesadt – als billiges. Seit den 1980er-Jahren hat sich daraus eine Kultur entwickelt, die Winterthur zur Schweizer Velostadt schlechthin machte. « Der Veloverkehr hat in Winterthur den Stellenwert, den in Zürich der öfentliche Verkehr hat », meint Rafael Noesberger. Dafür is der öffentliche Verkehr weniger privilegiert als in der Kantonshauptsadt. Die Ampelseuerung erlaubt dem Autoverkehr mit grünen Wellen ein flotes Vorwärtskommen auf langen Abschniten. Darunter leidet die Flexibilität der Busriorisierung. Stocken in Stosszeiten die Autos, bleiben auch die Busse in den Kolonnen secken, was dem Stadtbus regelmässig schlechte Pünktlichkeitswerte beschert.
Der öfentliche Raum als Trumpf Das Gesamtverkehrskonzept sieht für die Hauptachsen ÖV-Hochleisungs-Korridore vor, die als « Urban Boulevards » gesaltet sind. Damit sollen die Fahrzeiten der Busse in den Hauptverkehrszeiten stabiler und die vom Verkehr geprägten Strassenräume aufgewertet werden. Achsen wie die Zürchersrasse in Töss oder die Technikumsrasse am Rand der Altsadt zeigen zum Teil noch immer das Bild der 1960er-Jahre, als man die Verkehrsräger säuberlich voneinander trennte, die Fussgänger in Unterführungen verbannte und die Strasse nicht als Stadtraum, sondern als Verkehrsachse versand. Heute setzt man auf Koexistenz. Autos, Velos, Busse und Fussgänger teilen sich den Raum, der nicht nur ein Verkehrskorridor, sondern ein gut gestalteter Stadtraum sein soll. Dieses Ziel verfolgte die Stadt mit dem Leitbild Zürchersrasse, das als Hauptelement eine zweiseitige Baumallee vorsah. Wie so of in Zeiten knapper Mitel fällt die ‹ zwecklose › Gesaltung als Erses dem Rotsif zum Opfer. Nun beschränkt sich Winterthur auf punktuelle Aufwertungen. Trotz beschränkter Mitel muss sich die schnell gewachsene Stadt mit Funktion und Gestalt ihrer öffentlichen Räume auseinandersetzen. Schnelle, verlässliche Verbindungen zu bieten, das ist die Aufgabe jedes Verkehrsnetzes. In der Stadt gesellen sich dazu eine gute Fussläufigkeit, die Ermöglichung vielfältiger Begegnungen und die Schafung ‹ lauter und leiser › öfentlicher Orte unterschiedlicher Qualität. Das macht eine Stadt zu einem lebendigen, lebenswerten Ort, das unterscheidet sie von der Agglomeration. Wenn Winterthur seine Qualitäten särkt und Defizite ausmerzt, seigt die Standortguns der Stadt – sie wird atraktiv für Firmen mit hoher Wertschöpfung und auch für zahlungskräftige Bevölkerungskreise. Viele französische Städte haben das Tram als Katalysator für die Stadtentwicklung genutzt. Sei es in Strassburg, in Lyon, in Nizza, in Bordeaux oder am Stadtrand von Paris: Überall entstanden in den letzten Jahren neue Tramnetze, bei deren Bau man unwirtliche Verkehrsachsen zu atraktiven sädtischen Räumen umgesaltete. Der Aufwand dafür ist zwar gross, die Wirkung aber ebenso. Wäre das für die Grossstadt Winterthur nicht auch eine Lösung ? Rafael Noesberger meint, die Buslinien 1 und 2 ( beide haben eine Tram-Vergangenheit ) häten grundsätzlich vom Passagieraufkommen und dem zukünftigen Einzugsgebiet durchaus das Potenzial für eine Tramlinie. Angesichts der hohen Kosten, der engen Strassenräume und der nach Optimierungen ausreichenden Kapazität des Busnetzes hat man sich im städtischen Gesamtverkehrskonzept anders entschieden. Ins Reich der Hirngesinse sollte man den Traum vom Tram deswegen nicht verbannen. Grosse Würfe brauchen ihre Zeit. ●

Der indusrielle Wandel und das Bevölkerungswachsum prägten Winterthur in den letzten Jahren. Dennoch hat die Eulachsadt ihren persönlichen Charakter bewahrt.
Text:
Thomas Bürgisser und Werner Huber
Während Jahrzehnten war Winterthur eine Arbeitersadt. Von hier aus verschife Sulzer zunächs Dampfmaschinen und Dieselmotoren in alle Welt, die ‹Loki› sellte Gothard- und andere Lokomotiven her, und Rieter belieferte die Welt mit Spinnereimaschinen. Allein auf das Konto von Sulzer ging 1970 ein Viertel aller Arbeitslätze in der Stadt. Das hat sich radikal geändert. Die grössen vier Arbeitgeber sind heute die Stadt selbs, der Versicherungskonzern Axa, das Kantonsspital und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschafen.
Dieser Wandel und der damit verbundene Verlus von indusriellen Arbeitslätzen war dramatisch und für die Stadtregierung eine grosse Herausforderung. Diese wollte die Stadt ab 2002 unter der Führung des damaligen Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend mit Wachstum meistern. Das Standortmarketing rückte die Nähe Winterthurs zum Flughafen und zu Zürich sowie die umliegende Natur als Standortqualitäten in den Vordergrund. Dazu kamen die riesigen Indusriebrachen miten in der Stadt: Sie boten Platz für neue Quartiere an beser Lage. So erinnern heute nicht nur die vielen kleinen Arbeiterhäuser an die industrielle Vergangenheit, sondern auch eindrückliche Industriehallen, in denen sich nun Wohnungen, Kinos, Läden, Büros oder Ateliers finden.
Massnahmen wirken
Die Argumente überzeugten. Die Menschen srömten nach Winterthur. Aber das Wachsum verlangt Invesitionen, die die Steuerkraft der Zugezogenen nicht decken kann. Die seit 2012 bürgerlich geprägte Regierung unter Stadtpräsident Michael Künzle thematisierte die Schulden. Sie beschloss Einsarungen wo immer möglich und erhöhte 2016 den Steuerfuss um 2 auf 124 Prozentpunkte. Heute schaut Winterthur zuversichtlich in die Zukunf Mitelfrisig prognosiziert die Credit Suisse laut Thomas Rühl, Leiter Regionenanalyse, ein jährliches Bevölkerungswachsum von 1,1 Prozent. Das is weniger als vor einigen Jahren und ganz im Sinn der Stadtregierung. «Wir möchten als Wohnort atraktiv bleiben. Dabei seht aber nicht primär das quantitative Wachstum im Vordergrund», besätigt Stadtentwickler Mark Würth. Vielmehr sollen das Wachsum zuers verdaut, die Infrasruktur angepass und neue Arbeitslätze geschafen werden. Nachdem die Wirtschaf nicht ganz mitzuhalten vermochte, entwickelt sich die Zahl der Arbeitslätze jetzt wieder gleichläufiger zum Bevölkerungswachstum. Dank der industriellen Vergan -
genheit sei man heute bei den Ingenieurwissenschafen sark, sagt Würth. In diesem Bereich und in der Versicherungsbranche sieht Thomas Rühl denn auch das grösste Potenzial. Die Aussichten auf neue Unternehmen für Winterthur seien nicht schlecht: Bezüglich Standortqualitäten liegt die Stadt in einem Vergleich der CS auf Rang 8 von 110 Schweizer Wirtschafsregionen.
Dank dieser Entspannung rücken andere Themen in den Vordergrund. Winterthur is auch eine Bildungssadt, die junge Menschen anzieht. Winterthur is eine Velosadt, eine Gartenstadt und eine Familienstadt mit kurzen Wegen, viel Grün, familiärer Stimmung und erschwinglichen Mieten. Die renommierten Kunssammlungen haben Winterthurs Ruf als Kultursadt begründet. Dazu gesellt sich das Fotomuseum, das international Anerkennung findet. Die Musikfeswochen sind seit 1976 das ältese regelmässige Openair-Fesival der Schweiz, und auch die Internationalen Kurzfilmtage haben sich etabliert.
«Züri brännt – Winti pennt», so hiess es Anfang der 1980er-Jahre, als in Zürich die Jugend rebellierte, an einer Backsteinwand. Heute hat Winterthur gerade für alternative Angebote einen Standortvorteil, der in Zürich verschwindet: die einsigen Indusriehallen. Ein neuer Brennpunkt is diesbezüglich das Lagerplatzareal mit dem Kino Cameo, dem Bistro Les Wagons und der Badmintonhalle.
Gesellschafliche Entwicklungen
Zu diesem idyllischen Bild kontrasieren die Meldungen über Winterthurer IS-Sympathisanten scharf. Auch wenn dieses Phänomen nicht Winterthur-sezifisch sein mag, schrecken solche Berichte auf. Die Stadt hat das Problem erkannt und organisiert regelmässige Gesrächsrunden mit allen Imamen. Winterthur is aber auch eine ‹Stadt der Freikirchen›, wie das Winterthurer Kulturmagazin ‹Coucou› schrieb. Tatsächlich sind in der Evangelischen Allianz Winterthur nicht weniger als 14 Gemeinden und vier Werke zusammengeschlossen; die Freie Evangelische Gemeinde hat an der Theaterstrasse gar einen imposanten Eventkomplex mit Wohnungen errichtet.
Noch Anfang der 1980er-Jahre war in Winterthur um 23 Uhr Polizeisunde. Die Trotoirs wurden hochgeklappt, und die Stadt legte sich schlafen; die Indusriekapitäne wollten ausgeruhte Arbeiter. Jenseits der Gleise lag die verbotene Stadt von Sulzer, Lokomotivfabrik und Rieter. Es rauchte und dampfte. Das städtische Leben konzentrierte sich auf die schmucke Altsadt mit dem säuberlich gepflaserten ‹Schluuch›, wie die Achse Untertor–Marktgasse–Obertor im Volksmund heiss. Nur wer dieses alte Winterthur kennt, verseht, welchen Wandel die Stadt seither durchgemacht hat. ●

Welche Strategien verfolgen Siska und Terresta ? Und welche Rolle sielen andere Akteure in der Winterthurer Immobilienszene ? Eine Auslegeordnung.
Wer in Winterthur günsigen Wohnraum sucht, is bei der Teryresa Immobilien- und Verwaltungs AG an der richtigen Adresse. « Unsere Immobiliensrategie is es, Immobilien zu Anlagezwecken zu halten », sagt Markus Brunner, der Geschäfsführer der von Bruno Stefanini gegründeten Terresa. In jüngser Zeit hat sie mit Renovationen von sich reden gemacht. Doch im Gegensatz zu Luxussanierungen bieten ihre rund 1500 Winterthurer Mietwohnungen günsigen Wohnraum an, der äussers gefragt is. Zwar geniessen ‹ Stefanini-Häuser › einen eher zweifelhaften Ruf. Die Verwaltung erledige nur das Allernötigse, heiss es. Trotzdem gilt der wohl grösse private Immobilienbesitzer der Stadt nicht als Mieterschreck. Terresa mache zwar an den Häusern wenig, sei dafür aber aufgeschlossen, wenn die Mieter selbs Hand anlegten. Ein beachtlicher Teil der von der Terresa verwalteten Liegenschafen befindet sich gemäss Brunner noch in Stefaninis Privatbesitz. Nach dessen Tod würden sie nicht der Stadt vermacht, sondern der Stifung für Kuns, Kultur und Geschichte.
Nach dem Energieefzienzpfad 2040
Implenia wiederum erwirbt schweizweit Grundsücke, die an zentralen Lagen mit Potenzial eine nachhaltige Entwicklung zulassen. Die baureifen Projekte veräussert Implenia als Anlageobjekte für insitutionelle Invesoren oder vermarktet einzelne Stockwerkeigentumseinheiten. Mit dem Erwerb der Sulzer Immobilien vor sechs Jahren konnte Implenia ihr Immobilienportolio um das bis dato grösse Projektentwicklungs-Areal erweitern. Früher eilte Projektentwicklern und Generalunternehmern der Ruf von ‹ Heuschrecken › voraus, die in kurzer Zeit den grössmöglichen Gewinn suchen, um dann sogleich an den nächsen Ort abzuschwirren. In Winterthur geht Implenia nicht so ungesüm vor. Vertrauen, Innovation und Qualität sind die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Gewinn, was etwas mehr Zeit benötigt.
Implenias Wirken in Winterthur läss sich sehen: « Die wichtigsten aus dieser Investition stammenden Projekte sind mehrere Wohnüberbauungen in Oberwinterthur, die neue ZHAW-Bibliothek in der ehemaligen City-Halle und die im Februar dieses Jahres verkaufe Halle 52, in der das neue Departement Gesundheit der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften ( ZHAW ) entsteht », listet Urs Baumann, Leiter Development Deutschschweiz bei Implenia, auf. Hinzu kommen mehrere Baufelder, die vor dem Hintergrund des im März 2015 vom Winterthurer Stimmvolk gutgeheissenen Gesaltungslans auf dem zum Teil denkmalgeschützten Areal im Gestaltungsplanperimeter Werk 1 realisiert werden. « Ein Grosseil unserer Bauvorhaben in Winterthur richtet sich nach dem Energieeffizienzpfad 2040, und mit ‹ Sue & Til › wird in Winterthur-Neuhegi das dereins grösse Holzbauprojekt der Schweiz realisiert », betont Baumann.
Knapp 100 Millionen Franken invesiert
Ein weiterer grosser Player auf dem lokalen Immobilienmarkt is die von Robert Heuberger gegründete Siska Heuberger Holding. Siska invesiert auf dem Sulzerareal knapp 100 Millionen Franken in das neue ZHAW-Gesundheitszentrum. Implenia erhält den Auftrag als Totalunternehmerin zum Bau dieses grössten Schweizer Ausbildungszentrums für Ergotherapie, Hebammen, Pflege und Physiotherapie. Implenia trit dazu die Halle 52 auf dem Sulzerareal an die neue Eigentümerin Siska ab.
Zudem hat die Siska ein Baugesuch für Stadtwohnungen im Zentrum Neuwiesen eingereicht. Das im Frühjahr 1982 nach langer Planungsgeschichte eröfnete Einkaufszentrum mit Wohnungen und Büros in den Obergeschossen hate seinerzeit hinter dem Bahnhof einen zweiten Einkaufsschwerpunkt gesetzt. Mit dem geplanten Umbau sollen Büros umgenutzt und die Durchmischung des Einkaufszentrums und des ganzen Neuwiesenquartiers mit Einkaufen, Gewerbe und Wohnungen verbessert werden. Geplant sind 33 Wohnungen, davon 8 Maisonetten plus ein grosszügiges Veloparking im Untergeschoss mit direkter Anbindung an die neue Gleisquerung beim Bahnhof. Der Bezug der Wohnungen is auf Ende 2017 geplant.
Sanierungen mit erträglichen Mietzinsseigerungen Eine immer aktivere Rolle in der örtlichen Immobilienszene spielen die Genossenschaften. Die Heimstätten-Genossenschaf Winterthur ( HGW ) habe sich als gemeinnütziger Träger dem günstigen Wohnungsbau für Kleinhaushalte und insbesondere Familien verschrieben, betont Geschäfsführer Martin Schmidli. « Dabei legen wir insbesondere Wert auf gut gesaltete, gemeinsam genutzte Aussenräume. » Und: Günsig bedeute nicht qualitativ billig, schiebt Schmidli nach. In den nächsen Jahren will

die HGW Neubauten mit rund 250 Wohnungen realisieren –mit modernen Grundrissen, ohne Luxus und leicht unterdurchschnitlichen Wohnungsgrössen. « Bei Sanierungen unseres Besandes legen wir Wert darauf, dass die Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin dort wohnen können. Wir streben dabei eine hohe Qualität ohne unerträgliche Mietzinsseigerungen an », sagt Schmidli. In Einzelfällen bedeute dies für die Sanierung: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Geografisch is die HGW im Grossraum Winterthur tätig. « Wir bevorzugen dabei Siedlungen mit mehreren Bauten und über 50 Wohnungen », so Schmidli.
Eine weitere Genossenschaf is die Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur ( GWG ). Gegründet im Jahr 1939, habe sie die Erträge reinvesiert und durch Neubauten und Akquisitionen den Wohnungsbesand auf mittlerweile rund 1 250 Wohnungen erweitert, erläutert ihr Geschäfsführer Andreas Siegenthaler. « Der Unterhalt und die kontinuierliche Erneuerung der Liegenschaften, die den Bewohnerinnen und Bewohnern gehören, haben einen hohen Stellenwert. Nachverdichtungen und das Wachsum in der Stadt Winterthur und in den umliegenden Gemeinden durch Zukäufe und Neubauten stehen in diesem Jahrzehnt für die GWG srategisch im Vordergrund. » Seit der Jahrtausendwende hätten die gemeinnützigen Bauträger mit ihrer unterproportionalen Bautätigkeit Marktanteile verloren, gibt Siegenthaler zwar zu bedenken. Auf der andern Seite seien die Genossenschaften in den vergangenen Jahren vermehrt in den Fokus der Wahrnehmung gerückt und häten viel Zulauf und Untersützung erhalten. « Der wichtigse Faktor dafür is wohl die grosse Nachfrage nach preiswertem oder gün sigem

Wohnraum in den Zentren und in den Agglomerationen, die das Angebot bei Weitem überseigt », vermutet der Geschäfsführer der Genossenschaf
Dauerhaf der Spekulation entziehen
Die Genossenschaf für Alters- und Invalidenwohnungen ( Gaiwo ) plant, baut und betreibt seit sechzig Jahren zeitgemässe Alterssiedlungen mit kosengünsigen und attraktiven Wohnungen. Sie stellt ihre Liegenschaften älteren Menschen und Behinderten zur Verfügung, die mehrheitlich über ein bescheidenes Einkommen verfügen. Bereits in der Gründungszeit der Gaiwo herrschte in Winterthur Wohnungsnot. Insbesondere für Familien war es schwierig, eine geeignete Wohnung zu finden. Viele ältere Alleinsehende und Ehepaare blieben in den grossen Wohnungen, die eigentlich für Familien gebaut worden waren. « Aus dieser Problematik heraus wurde die Gaiwo gegründet, mit dem Ziel, der älteren Generation ein kleineres Zuhause zu bieten, um für Familien, die auf grösseren Wohnraum angewiesen sind, Platz zu schafen », blickt Geschäfsführer Samuel Schwiter zurück. Bei Umbauten wird das innere Verdichtungsotenzial geprüf und wenn möglich realisiert. Der bestehende Wohnraum wird laufend unterhalten. « Wohnbaugenossenschafen realisieren langfrisig preiswerten Wohnraum, und dieser is auf dem Markt gesucht. Die Gesellschaf wie auch die Politik haben erkannt, dass Wohnbaugenossenschafen dafür einsehen », betont Schwiter. Nicht weil sie billig bauen, sondern weil sie diese Immobilien dauerhaf der Spekulation entziehen. Der erwirtschafete Erfolg bleibt in der Genossenschaf und wird reinvesiert. « Die Mieten basieren
auf dem Prinzip der Kosenmiete nach dem Kalkulationsmodell der Stadt Zürich, was gegenüber dem Markt, der zur Optimierung der Rendite tendiert, zu preiswerten Mieten führt », so Schwiter.
Versändnis der Nachhaltigkeit
Ein neuerer Player auf dem Winterthurer Immobilienmarkt is die Pensionskasse Stifung Abendrot aus Basel, die 1984 von einer Gruppe Alternativer und AKW-Gegnern gegründet wurde. Wenn sie schon gezwungen waren, fürs Alter zu sparen, wollten sie wenigstens selbst bestimmen, wie das Geld angelegt wird, fanden die damals rund Dreissigjährigen. Per Ende 2014 betrug die Bilanzsumme der Stifung Abendrot 1,3 Milliarden Franken.
Anfang 2009 erwarb die Stifung das fas 50 000 Quadratmeter umfassende Lagerplatzareal von Sulzer Immobilien und der Schweizerischen Pos. Der Kauf erfolgte auf Initiative des Arealvereins hin, dem ein Grosseil der aktuellen Mieter angehört. 100 kleinere und mitlere Betriebe mit gegen 400 Angestellten haben durch die Zwischennutzung zur Entwicklung vom unbelebten Indusrieareal in ein urbanes Arbeits- und Freizeitquartier beigetragen. Zunächst drohte das übliche Szenario: Verkauf des Areals, Ende der Zwischennutzung, Sanierung und Neubau für eine neue Mieterschaf. Mit dem Verkauf des Lagerplatzareals ging zwar auch hier die Zeit der Zwischennutzung zu Ende. Doch statt Abbruch und Neuüberbauung wird das Areal sanft und nachhaltig weiterentwickelt. « Ausgehend von ihrem Verständnis der Nachhaltigkeit ist es für unsere Stiftung wichtig, nicht über die Köpfe der Betrofenen hinweg Entscheide zu fällen », betont die Architektin Klara Kläusler, Leiterin Immobilien bei der Stifung Abendrot. Deshalb wurden die verschiedenen Inte ressentengruppen zu einer Zukunftskonferenz eingeladen. 120 Mieter, Anwohnerinnen, Mitglieder des Quartiervereins und eine Vertretung der Stadt nutzten die Gelegenheit, im September 2009 ihre Visionen für die künfige Entwicklung des Lagerplatzareals zu entwerfen. Dabei kam sark zum Ausdruck, dass das Areal von vielen Nutzerinnen und Nutzern als Heimat, als Perle und als Biotop empfunden wird, das in seiner Durchmischung erhalten und weiterentwickelt werden soll.
Text: Werner Huber
Die Parallelen zwischen den beiden sind frappant, die Unterschiede ebenfalls: Sowohl Robert Heuberger, geboren 1922 in Olten, als auch Bruno Stefanini, Jahrgang 1924, stammen aus armen Verhältnissen und wurden mit Immobilien zu Milliardären.
Stefanini, ein Sohn italienischer Einwanderer, erhielt noch während des Zweiten Weltkriegs von seinem tüchtigen Vater, dem Präsidenten der Konsumgenossenschaft Società Cooperativa, ein erstes Haus geschenkt. Mit 22 verdiente Bruno Stefanini damit sein erstes Geld und investierte es so geschickt, dass er fünfzehn Jahre später bereits Millionär war. Bis in die 1970er-Jahre sellte er einen umfangreichen Immobilienbesand zusammen und wurde bald bekannt als sarsamer, ja geiziger Eigentümer. ‹ Stefanini-Haus › wurde in Winterthur zum Synonym für schlecht unterhaltene, gar zerfallende Häuser – etliche davon in der Altsadt. Seine Gewinne invesierte Stefanini
in seinen Sammeltrieb. Dabei trug er hochkarätige Kuns von Giacometi, Anker und Hodler ebenso zusammen wie historisch wertvolle oder wertlose Gegenstände – über 100 000 insgesamt. Dafür gründete er die Stiftung für Kunst, Kultur und Gesellschaft, über die er unter anderem auch das Sulzer-Hochhaus in Winterthur erwarb. So sarsam Stefanini beim Unterhalt seiner Liegenschafen war, so genügsam war er auch sich selbs gegenüber. Cervelat, Brot und Bier waren seine Leibseisen, und of hat er in seinen leersehenden Häusern übernachtet. Aus der Öfentlichkeit hat er sich immer mehr zurückgezogen ; Interviews gab er praktisch nie. Um das Millionen-, ja milliardenschwere Erbe is schon seit einiger Zeit ein Streit unter seinen Wegbegleitern und der Familie entbrannt. Robert Heuberger wuchs als Halbwaise in Olten auf, konnte aber dank guter Noten eine Banklehre absolvieren. Nach dem Krieg zog er als Versicherungsvertreter nach Winterthur. Als Bankfachmann beriet er Kunden bei der Finanzierung von Bauvorhaben, sodass er innert weniger Jahre 200 000 Franken besass. Damit gründete er 1954 mit seiner Frau das Immobilienunternehmen Siska – Sichere Schweizer Kapitalanlagen. Diesem Credo is er immer treu geblieben und hat nie einen Franken im Ausland invesiert. Heute gehören zum Portolio der Siska Heuberger Holding Wohn- und Gewerbeobjekte in den Kantonen Zürich, Thurgau, St. Gallen und Aargau sowie Einkaufszentren in Winterthur, Efretikon und User. Wie zu Stefanini hielt das Winterthurer Bürgertum der Sulzers und Reinharts auch zu Heuberger Disanz. Dafür verkehrte er mit Filmsars wie Lili Palmer, die 1978 an der Effi-Märt-Eröfnung teilnahm, mit Hildegard Knef oder Curd Jürgens. Auch Heuberger drehte jeden Fünfliber zweimal um, bevor er ihn ausgab. Seine Wohnungen boten einen bescheidenen Standard, und die Linken sahen in ihm einen skrupellosen Kapitalisen. Dem Vorwurf, Geld am Fiskus vorbeizuschleusen, begegnete er deshalb früh mit der Offenlegung des Geschäfsberichtes seiner Familienholding. Ausserdem hat Robert Heuberger schon Millionen für soziale und kulturelle Projekte gesifet, sein Jungunternehmerpreis is hoch dotiert.
Neben diesen beiden Immobilienkönigen, die sich einen grossen Teil des Wohnungsbesandes in Winterthur teilen, gibt es noch eine alte Prinzessin: Die ‹ billige Gesellschaf ›, wie sie im Volksmund heiss. Gegründet wurde die ‹ Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur › schon 1871 auf Initiative von Pfarrer und Hülfsgesellschafs-Präsident Johann Jakob Zollinger. Sie sollte den Arbeitern als Ergänzung zu den bescheidenen Wohnungsbauten der grossen Industriebetriebe günstigen Wohnraum bieten. Dabei war ‹ die Billige › nicht etwa eine Genossenschaft, sondern eine Aktiengesellschaft –heute mit einem der teuersen Papiere der Schweiz. Gegen 850 Wohnungen gehören ihr zurzeit, verwaltet von der Auwiesen Immobilien AG. ●
Literatur:
– Miguel Garcia: Bruno Stefanini. Ein Jäger und Sammler mit hohen Idealen. Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2016, Fr. 32.—
– Robert K. Heuberger: Nicht wie der Wind weht … Lebensbericht eines Unternehmers. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2013 (vergrifen)

terthur. Winterthur hat sich von der etwas einseitigen Industriestadt zur vielfältigen und innovativen Technologiestadt gewandelt. Und Sulzer hat uns ja ein schönes Erbe hinterlassen: dieses Areal, auf dem wir sitzen.
Interview: René Hornung, Werner Huber
Wir sitzen im Sitzungszimmer des Stadtrats im 6. Stock des neuen ‹ Superblocks › im Sulzer-Areal. Vor einem Jahr zog fast die gesamte Stadtverwaltung hier ein. Wie hat der Umzug das Arbeiten verändert ?
Josef Lisibach Insgesamt ist es viel besser herausgekommen als je gedacht. Im Vorfeld gab es drei Gruppen: Die einen freuten sich von Anfang an, hierherzuziehen, andere liessen es auf sich zukommen, und dann gab es jene, die sich gar nicht damit abfinden konnten. Diese dritte Gruppe war vor dem Umzug relativ gross, jetzt is sie klein. Der Umzug selbs war übrigens eine fantasische Leisung, generalsabsmässig organisiert.
Michael Hauser Für die Stadt is es auch interessant, dass sich das Gewicht etwas auf die wesliche Seite der Gleise ins Sulzer-Areal Stadtmite verschoben hat. Für die Durchmischung des Areals is das gut. Früher war hier das Indusrieareal von Sulzer. Welche Rolle spielen Konzerne wie Sulzer oder Rieter heute ?
Josef Lisibach Den traditionellen Indusriesandort gibt es nicht mehr. Das ist ja in der ganzen Schweiz so. Doch auch heute noch sind Sulzer und Rieter wichtige Arbeitgeber in Winterthur. Aber ich möchte den Fokus auf jene Firmen lenken, die diese Lücke geschlossen haben, etwa die wachsende Burckhardt Compression, das Medtechunternehmen Zimmer Biomet, den Automobilzulieferer Autoneum, den Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori oder die Messechnikfirmen Kisler und Keller. Wir haben heute nicht mehr zwei Konzerne in Winterthur, sondern eine Vielzahl hochsezialisierter erfolgreicher KMU.
Mark Würth Als ich vor zehn Jahren hierherkam, wehrten sich die Entscheidungsträger der Stadt kaum, wenn ein Unternehmen wie Sulzer etwas forderte. Heute haben wir ein partnerschafliches Verhältnis.
Is die Indusriesadt Winterthur Vergangenheit ?
Josef Lisibach Den Namen einer Industriestadt wird Winterthur immer behalten. Bis heute hat zum Beispiel jeder Stadler-Rail-Zug auf der Welt ein Fahrwerk aus Win-
Michael Hauser Ja, das Sulzer-Areal Stadtmite is ein Alleinsellungsmerkmal für Winterthur. Jetzt kommt dann noch die Halle 53 dazu, die die Stadt gekauf hat. Diese ehemalige Grossgiesserei is eine Indusriekathedrale, wie es sie vielleicht nur noch im Ruhrgebiet gibt.
Josef Lisibach Diese Arealentwicklung is ein Vorzeigeobjekt. Das zeigt sich an den Delegationen, die aus halb Europa nach Winterthur kommen.
Nun soll Neuhegi-Grüze in Oberwinterthur zu einem zweiten Pol der Stadt werden. Wie kann das gelingen ?
Michael Hauser Das braucht natürlich Zeit, denn dort entseht ja eine Art Retortensadt. Wir brauchen fürs Gelingen rationale Sachen wie eine gute Verkehrserschliessung.
Die wird wirklich atraktiv. Der Bahnhof in Grüze soll dem Hauptbahnhof dereins mindesens zehn Prozent des Verkehrs abnehmen, sodass der Nebenbahnhof zu einem wichtigen Hub wird. Hier wird man auch schön zum Zug kommen: Man seigt aus dem Bus aus und geht eine Kaskadentreppe herunter zur S-Bahn. Nicht ganz einfach wird es sein, in Neuhegi-Grüze auch eine gute Infrasruktur mit Läden und Restaurants zu schaffen. Diese brauchen ein grosses Einzugsgebiet.
Mark Würth Ein Bereich, in dem Winterthur führend is, sind die Zwischennutzungen. Doch in Neuhegi-Grüze fehlen Zwischennutzungen weitgehend. Das versuchen wir mit Freiräumen oder der Halle 710 mit einem Mitwochmarkt und einem Resaurant zu kompensieren.
Winterthur hat ja eine grosse Wachsumshase erlebt. Wächs die Stadt immer noch ?
Josef Lisibach Ja, nach wie vor haben wir ein Bevölkerungswachsum von jährlich 1,4 Prozent, mehr als Zürich.
Mark Würth Ein Dritel des Wachsums sammt vom Geburtenüberschuss, das andere is der Wohnungsbau: Wir haben praktisch keine leeren Wohnungen. Winterthur ist eine Familiensadt. Unter den grossen Städten is hier der Familienanteil am höchsten. Das ist ein gutes Zeichen, doch es bedeutet, dass man Schulhäuser bauen muss.

Is dieser Infrasrukturausbau der Grund für die Finanzprobleme, mit denen Winterthur in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht hat ?
Josef Lisibach Die Finanzen sind tatsächlich unser grosses Problem. Es sind aber hauptsächlich die Soziallasen von hundert Millionen Franken pro Jahr, die uns zu schafen machen. Jedes Jahr kommt mehr dazu. Der Finanzausgleich, den wir seit 2006 haben, ist fix im Gesetz berechnet. Er basiert auf der Bevölkerungszusammensetzung und der Bevölkerungszahl von 2006. Damals haten wir 97 000 Einwohnerinnen und Einwohner, heute sind es aber 110 000. Darum simmen die harten Fakten einfach nicht mehr. Häten wir in diesem Bereich eine kantonale Lösung, dann häten wir eigentlich kein Problem. Wie sind denn die Wachsumsrognosen für Winterthur ?
Michael Hauser Bund und Kanton sagen uns, dass 2040 in Winterthur 130 000 Menschen leben werden. Das sind nochmals zwanzig Prozent mehr als heute. Ich glaube diese Zahl nicht, sondern sage, dass wir 2040 bevölkerungsmässig irgendwo zwischen 100 000 und 150 000 Personen sein werden. Die Zuwanderung is ja schweizweit eine offene Frage. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass die Zuwanderer aus dem oberen Kader oder CEOs sind. Vielleicht haben sie eine geringere Kaufraf. Je nach wirtschaflicher und gesellschaflicher Entwicklung kann die Bevölkerungszahl ja auch wieder schrumpfen. Das heiss, wir müssen reagieren können und bei jedem Areal, bei jeder Umnutzung die Stellschrauben neu jusieren.
Mark Würth Mir is es wichtig, dass man beim Thema Wachstum nicht nur über Quantitäten, sondern auch über Qualitäten spricht. Was sind die Rahmenbedingungen, die wir uns selbs setzen ? Unter welchen Bedingungen is Wachstum möglich, sogar sinnvoll ?
Häte es überhaupt genügend Platz für noch mehr Menschen ?
Michael Hauser Im Rahmen der Bau- und Zonenordnung gibt es noch grosse Reserven, die aber nicht alle verfügbar sind. Nicht jede ältere Dame, die in einem Einfamilienhaus wohnt, will ausziehen und sieben Wohnungen hinbauen. Aber je nachdem können es 150 000 Einwohner sein, ohne dass dafür mehr gebaut wird, weil man beisielsweise Fragen der Sufzienz ernser nimmt, sodass in den besehenden Wohnungen mehr Personen wohnen.
Josef Lisibach Wir dürfen bei diesem Thema die Ängse der heutigen Bevölkerung nicht vergessen. Sagt man den Leuten, ihr müss euch auf eine Zahl von 130 000 einrichten, erschrecken sie zuers. Denn sie kennen noch die Stadt vor dreissig Jahren mit 85 000 Einwohnern.
Wenn neu gebaut wird:
Welche Art von Wohnungen braucht es ?
Michael Hauser Wichtig is, dass nicht nur jene hierherziehen, die anderswo nichts finden, sondern Leute, die unbedingt in Winterthur leben wollen. Wir möchten, dass auch gehobener Wohnungsbau entseht, Winterthur hat ja gute Wohnlagen. Aber man sollte auch im Auge behalten, was passiert, wenn die Stefanini-Liegenschafen, die das günstigere Segment abdecken, einmal saniert werden. Auch für die Leute, die schon in Winterthur leben, brauchen wir Wohnungen im günsigeren Segment. Aber eigentlich wollen wir beim Wohnen eher bremsen und Winterthurs Bekanntheit als Wirtschafssandort vergrössern. Die Stadt muss wieder auf die Wunschliste von Firmen kommen. Weshalb gelingt das nicht im gewünschten Ausmass ?
Josef Lisibach Es gibt keine Stadt dieser Grösse, die nicht Kantonshauptsadt is. Wenn man Winterthur mit Bern, Lausanne und Luzern vergleicht, die grössenmässig in der gleichen Liga sielen, dann is Winterthur doch nicht
Gesrächseilnehmer
– Josef Lisibach, seit 2014 Stadtrat in Winterthur (SVP). Er leitet das Departement Bau.
– Mark Würth, seit 2003 Bereichsleiter Stadtentwicklung.
– Michael Hauser, seit 2007 Stadtbaumeiser von Winterthur.
so bekannt wie diese Städte. Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass Winterthur den Bekanntheitsgrad erhält, den es früher einmal hate.
Michael Hauser Die Industrie ist weg, die Winterthur früher bekannt gemacht hat, die Versicherung ebenfalls, die den Namen in die Welt hinausgetragen hat. Aber wir sind eine Stadt mit allem Drum und Dran, das ist bei uns anders als in der Agglomeration. Und wir sind nahe beim Flughafen. Daraus muss man mehr Kapital schlagen. Wie wollen Sie die Vorteile Winterthurs in die Welt hinausragen ?
Mark Würth Wir machen im Herbs eine Veransaltung im Sulzer-Areal Stadtmite, wo wir genau diese Personen einladen, die Arbeitslätze vermiteln. Wir führen sie in das Areal hinein, hier können wir etwas zeigen. Josef Lisibach Wichtig sind auch die künftigen Entscheidungsräger, die Leute, die aus den Hochschulen kommen. Heute haben wir 10 000 Studierende in der Stadt. Ein Teil davon wird säter über Standortevaluationen diskutieren. Auch darum is der Bildungssektor sehr wichtig. Auch wenn der Bildungssektor keine direkte Wertschöpfung generiert ?
Mark Würth Das stimmt nicht. Allein die ZHAW hat rund 1500 Angesellte, und es gibt noch andere Schulen. Wenn man die Restaurants fragt, dann bringen die Studierenden dort auch nochmals eine Wertschöpfung. Aber man muss dieses Thema mittel- und langfristig sehen. Diese Leute haben einen Teil ihres Lebens hier verbracht, nehmen hoffentlich positive Erinnerungen mit. Irgendwann kommen sie zurück oder bringen Firmen mit.
Michael Hauser Es gibt Start-ups, Studentinnen und Studenten, die während des Studiums arbeiten. Das is positiv und kann die frühere Kraf der Indusrie kompensieren. In Zürich sricht man von der Kreativwirtschaf, wir müssten hier von einer Innovationswirtschaf reden. In diesem Bereich is die Stadt auf gutem Weg.
Mark Würth Früher trugen Sulzer und Rieter den Namen der Stadt in die Welt hinaus. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ein neues Label finden, beisielsweise als Bildungssadt. Dort sielt die Fachhochschule eine zentrale Rolle. Winterthur is eine Kultursadt mit hochkarätigen Sammlungen. Aber man hat das Gefühl, die Museen seien leer. Gibt es da Ideen, das zu entwickeln ?
Mark Würth Wir haben ein Museumskonzept, mit dem wir die Häuser zusammenführen möchten, damit man nicht von den einzelnen Häusern sricht, sondern von den Aussellungen. Auch beim ‹ House of Winterthur › – das is die Zusammenlegung der Standortförderung mit dem Tourismusbüro – is die Kultur eines der drei Standbeine, das man vermarkten möchte.
Michael Hauser Winterthur hat ja einen tollen Bestand an Kunswerken. Aber in diesen Museen wollte sich of der jeweilige Sammler verewigen ; das is jetzt etwas vereinfacht gesagt. Aber aus diesem Grund stehen starre Vorschriften in den Stifungsurkunden. Man muss mit dem Besand die Bevölkerung auf überraschende Weise ansprechen. « In Winterthur muss du ‹ Operete › machen », sagte eins der Direktor des Zürcher Kunshauses.
Mark Würth Winterthur hat bei der alternativen Kultur ein Potenzial. Es gibt erse zarte Pflänzchen, etwa das Designgut in Zusammenarbeit mit dem Gewerbemuseum. Auch die Musikfeswochen und die Kurzfilmtage sind ein Erfolg. Josef Lisibach Vielleicht gibt es auch ein grundsätzliches Problem: Winterthur is zu bescheiden. Wir sollten etwas selbsbewusser aufreten, nicht jammern. Daran arbeiten wir. Schliesslich sitzen wir hier ja in der schönsen und wichtigsen Stadt der Schweiz, wie ich unseren Besucherinnen und Besuchern jeweils sage. ●

Michael Künzle, 51, hier an seinem Lieblingsort, dem Aussichtspunkt Bäumli, is seit 2012 Stadtpräsident von Winterthur (CVP).
Schlusswort des Stadtpräsidenten
« Als wir 2008 die hunderttausendste Einwohnerin begrüssten, freute sich die ganze Stadt. Aber das Wachstum is nur ein Asekt, der Winterthur in den letzten Jahren geprägt hat. Ebenso bedeutend ist der Wandel von der Arbeiter- und Indusriesadt zu einer Diensleisungsund Denkstadt. Diese Veränderung zeichnet sich auch im Stadtbild ab. So sind in den letzten Jahren zahlreiche Neubauten entsanden. Noch eindrücklicher sind die Umnutzungen der alten Industriegebäude, insbesondere im Sulzer-Areal Stadtmite. Pionierin war da schon vor 25 Jahren die Architekturschule des früheren Technikums, um die herum sich ein ganzes Hochschulviertel entwickelt hat und weiter entwickeln wird. Ich denke, da ist es Winterthur in den letzten Jahren vorbildlich gelungen, das Neue mit der Tradition zu verbinden. Obschon bereits viel Definitives entstanden ist, spielen die Zwischennutzungen nach wie vor eine wichtige Rolle ; of sind sie der Kern eines dauerhafen kulturellen Engagements.
Das Bevölkerungswachstum widerspiegelt sich im nach wie vor starken Wohnungsbau. In unseren strategischen Zielen seht dieser jedoch nicht an erser Stelle, dringender sind Arbeitslätze. Wir haben fas doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie Beschäfigte. Andere Städte unserer Grösse haben ein ausgeglicheneres Verhältnis. Das hat auch damit zu tun, dass die Kantonshauptstädte Lausanne, Luzern oder St. Gallen allein schon durch die Verwaltung mehr Arbeitsplätze haben. Deshalb betreuen wir ansässige Unternehmen und begleiten Firmen eng, die bei uns einen Standort suchen.
Wer seit zehn Jahren nicht mehr in Winterthur war und die Stadt jetzt besucht, wird sie kaum mehr wiedererkennen. Wenn man aus dem Zug seigt, scheint sich zwar noch wenig verändert zu haben, doch rund um den Bahnhof hat sich das Gesicht Winterthurs sark gewandelt. Hier hat die Stadt schon etliche Bauseine des Maserplans Stadtraum Bahnhof vollendet, und die Gleisquerung als Herzsück geht der Vollendung entgegen siehe Titelbild . Auch die SBB haben das Potenzial von Winterthur erkannt, sie bauen nun ihre Anlagen aus.
Winterthur in zehn Jahren ? Wir werden immer noch eine Kultur-, Bildungs- und Gartenstadt sein. Bis dahin haben wir im Kanton einen Ausgleich der Soziallasten geschafen, der uns finanziell entlaset. Damit wäre unser Ziel der nachhaltigen städtischen Finanzen eigentlich erreicht. Wir werden eine ‹ smart city › sein und werden viel mehr Unternehmen und Arbeitslätze haben. In zehn Jahren ist die Planungszone Neuhegi überbaut, und das Gesicht des Sulzer-Areals is um das Werk 1 ergänzt. Winterthur wird sich auch in Zukunf durch eine sehr hohe Lebensqualität auszeichnen. » Aufgezeichnet von Werner Huber
Der Hochkamin im Hof des Wohnhauses auf dem Haldengut-Areal zeugt von der Brauereivergangenheit.

Vor zehn Jahren widmete Hochparterre Winterthur erstmals ein Themenheft: ‹ Winterthur –eine Stadt im Wandel ›. Die ehemaligen Indusrieareale von Sulzer in der Stadtmitte und in Oberwinterthur sowie das Bahnhofgebiet waren die grossen Themen. Vor Ort sah man davon allerdings noch wenig – vieles war geplant, erst Einzelnes gebaut. Wer heute die Stadt besucht, reibt sich die Augen: Was damals ers Papier war, is heute in grossen Teilen Realität. Vor allem das Sulzer-Areal Stadtmitte ist ein Vorzeigebei siel für eine gelungene Transformation von einem Industrie - zu einem Bildungs - , Dienstleisungs- und Kultursandort.



