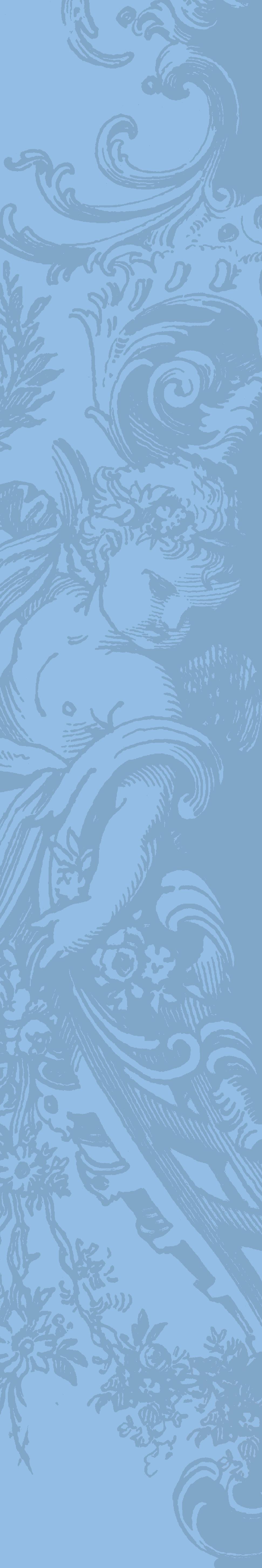
Breitkopf & Härtel Partitur-Bibliothek
Nr. 15148 Mozart
Konzert
für Klavier und Orchester
c-moll
KV 491
Partitur
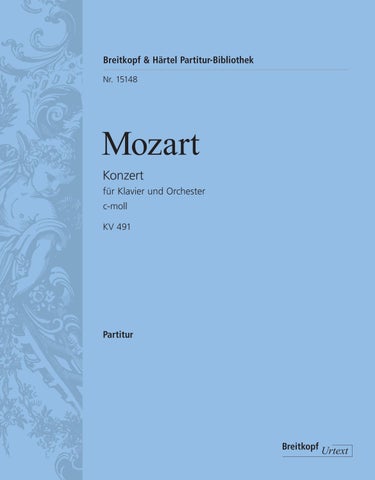
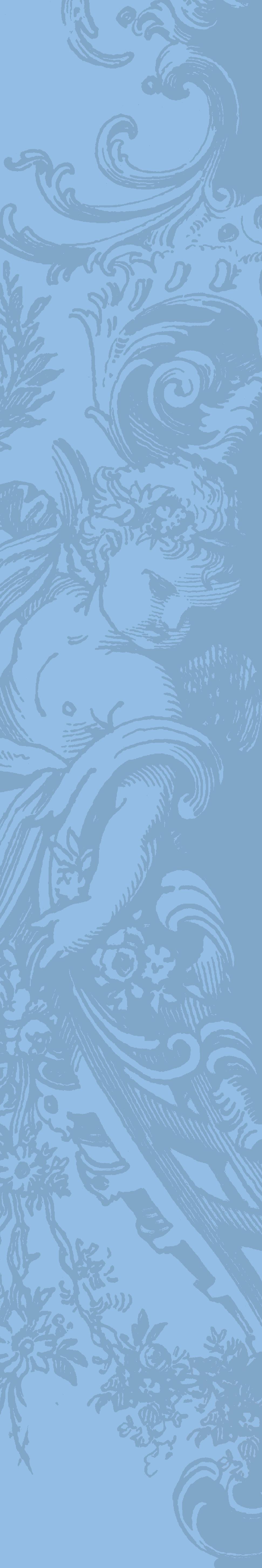
Breitkopf & Härtel Partitur-Bibliothek
Nr. 15148 Mozart
Konzert
für Klavier und Orchester
c-moll
KV 491
Partitur
(1756–1791)
für Klavier und Orchester c-moll
Concerto for Piano and Orchestra in C minor
KV 491
herausgegeben von/edited by Ernst Herttrich
BREITKOPF & HÄRTEL
G. Henle Verlag
Partitur-Bibliothek 15148
FlöteFlute
2 Oboen2 Oboes
2 Klarinetten2 Clarinets
2 Fagotte2 Bassoons
2 Hörner2 Horns
2 Trompeten2 Trumpets
PaukenTimpani
StreicherStrings
AufführungsdauerPerforming Time
etwa 28 Minutenapprox. 28 minutes
Orchesterstimmen/Orchestral parts: Breitkopf & HärtelOB15148
Ausgabe für zwei Klaviere mit Fingersatz, Kadenzen und Eingängen von András Schiff Edition for two pianos with fingering, cadenzas and lead-ins by András Schiff
Breitkopf & HärtelEB10787 oder/or G. Henle Verlag HN 787
Studienpartitur/Study score: Breitkopf & Härtel PB 15149
Eine Gemeinschaftsproduktion von Breitkopf & Härtel, Wiesbaden und G. Henle Verlag, München
A Coproduction of Breitkopf & Härtel, Wiesbaden and G. Henle Verlag, Munich
Printed in Germany
Wolfgang Amadeus Mozarts (1756–1791) Klavierkonzert KV 491 in c-moll ist neben dem d-moll-Konzert KV 466 sein einziges in Moll. Der eher düstere Charakter dieser zwei Konzerte war wohl der Grund dafür, dass im 19. Jahrhundert, das ganz vom Vorbild Beethovens dominiert war, von allen 25 Klavierkonzerten Mozarts hauptsächlich diese beiden auf den Konzertprogrammen der großen Pianisten auftauchten. Man fasste sie als Musterbeispiele für Mozarts hoch emotionale Ausdruckshaftigkeit auf, und als solche gelten sie durchaus auch heute noch. Dabei wurde das c-moll-Konzert jedoch ganz offensichtlich in allergrößter Eile zu Papier gebracht. In seinem eigenhändigen Werkverzeichnis notierte Mozart als Abschluss der Komposition das Datum 24. März 1786. Wahrscheinlich bereits zwei Wochen später, am 7. April, fand im Rahmen einer Akademie im Burgtheater die Uraufführung statt, wobei Mozart den Solopart selbst spielte1. Es ist jedoch nicht ganz auszuschließen, dass bei dieser Akademie ein anderes Konzert, etwa das drei Wochen vor KV 491 vollendete Konzert KV 488 in A-dur, auf dem Programm stand.
Der geringe Zeitabstand zwischen Vollendung der Komposition und erster Aufführung ist nicht unbedingt etwas Besonderes für Mozart. Beim Klavierkonzert KV 482 in Es-dur beispielsweise lag zwischen Fertigstellung des Werks (16. Dezember 1785) und Uraufführung (23. Dezember 1785) sogar nur eine Woche. Vielleicht hängt es also doch mit dem besonderen Charakter des Konzerts KV 491 zusammen, dass das Autograph sowohl in den Orchesterstimmen als auch in der Partie des Soloklaviers für Mozart ganz ungewöhnlich viele Korrekturen sowie einige einschneidende Änderungen aufweist und teilweise fast wie ein Entwurf wirkt.
Solche Mutmaßungen sind allerdings recht gefährlich, denn Mozart stand zur Zeit der Komposition unter gewaltigem Zeitdruck. Es gibt keinen Abschnitt in seinem Leben, in dem er so viel komponierte wie im Winterhalbjahr 1785/86: außer den genannten drei Klavierkonzerten noch die Maurerische Trauermusik KV 477 und mindestens zwei weitere Freimaurermusiken, die Violinsonate KV 481, zwei Ensemblestücke für Francesco Bianchis Oper La villanella rapita (KV 479 und 480), zwei nachkomponierte Stücke zum Idomeneo (Duett KV 489 und Arie KV 490), die Musik zur Komödie Der Schauspieldirektor KV486 und vor allem den Figaro KV 492, der am 1. Mai 1786 uraufgeführt wurde. Hinzu kamen die Vorbereitung mehrerer Akademien und der Privataufführung des Idomeneo im Palais Auersperg, die Unterrichtsverpflichtungen gegenüber mehreren Schülern sowie mindestens sieben öffentliche Konzertauftritte. Allein diese Arbeitsbelastung würde ausreichen, die ungewöhnlich zahlreichen Korrekturen im Autograph des c-moll-Konzerts zu erklären; doch die Frage bleibt offen, warum sie ausgerechnet bei diesem Stück auftauchen und nicht bei anderen. Dass zu Satz II ein anderer Anfang (KV 491a) existiert – ein Fragment von 3 Takten – mag nochmals unterstreichen, wie unsicher Mozart bei der Konzeption dieses Werks gewesen sein mag (obwohl uns verworfene Satzanfänge auch bei anderen Werken begegnen).
Das Autograph zum Klavierkonzert KV 491 befindet sich heute im Royal College of Music in London. Wie bereits angedeutet, weist es alle Anzeichen einer äußerst flüchtigen Niederschrift auf. Die Klavierstimme wurde an manchen Stellen offenbar nur skizziert – in der Uraufführung dürfte Mozart sie vermutlich aus dem Kopf gespielt haben. In mindestens zwei nachträglichen Arbeitsgängen nahm er Verdeutlichungen, aber auch Änderungen und Korrekturen vor. Für die letzte Überarbeitung verwendete er dabei eine spitzere, dünnere Feder. Dieses Stadium ist daher von den vorherigen sehr gut zu unter-
scheiden. Es stellt die Fassung letzter Hand dar, ist aber bisweilen nur lückenhaft notiert; in unserer Edition erscheint diese Version im Haupttext, die in anderen Ausgaben weit verbreitete frühere Version als Ossia darüber. Gelegentlich sind auch zwei unterschiedliche Fassungen vorhanden, ohne dass eine der ursprünglichen ausgestrichen oder auf eine andere Art ungültig gemacht worden wäre. In unserer Edition geben wir solche Stellen in beiden Fassungen wieder. Trotz der mehrmaligen Überarbeitung ist für einige Passagen davon auszugehen, dass Mozart sie nur in abgekürzter Form notierte und dass sie mit Skalen oder Dreiklangsarpeggien auszuzieren sind; Fußnoten weisen an den entsprechenden Stellen im Notentext auf die Möglichkeit zu solchen Auszierungen hin.
Das Autograph enthält vielerorts Eintragungen, die eindeutig darauf hinweisen, dass es als Vorlage für eine oder mehrere Abschriften diente.Eine Stimmenabschrift befindet sich heute im Musikarchiv des Kunsthistorischen Museums in Kroměříž (Kremsier). Im Jahr 1799 verkaufte Constanze Mozart den Rest des noch bei ihr verbliebenen Autographenbestands mit etwa 300 Manuskripten an den Offenbacher Verleger Johann Anton André, darunter auch das Manuskript zum Klavierkonzert KV 491. André gab auf der Grundlage der von ihm erworbenen Autographe rasch zahlreiche Ausgaben heraus, die er jeweils als „Edition faite d’après la partition en manuscrit“ oder ähnlich bezeichnete. Das Klavierkonzert KV 491 erschien bereits 1800 als Nr. 3 der six grands concertos pour le Piano-Forté […] Oeuvre 82, die außer KV 491 die Konzerte KV 482, 467, 488, 503 und 595 umfassten und die André dem Prinzen Louis Ferdinand von Preußen widmete. Andrés Erstausgabe diente wahrscheinlich auch als Vorlage für die vermutlich 1802 erschienene Ausgabe bei Breitkopf & Härtel. Da beide Drucke erst nach Mozarts Tod veröffentlicht wurden, kommt ihnen kein eigentlicher Quellenwert zu. Manche ihrer abweichenden Lesarten sind jedoch in die Rezeptionsgeschichte des Werks eingegangen und werden zum Teil bis heute gespielt. Die wichtigsten sind daher in den Einzelanmerkungenam Ende der vorliegenden Edition mitgeteilt.
Ein besonderes aufführungspraktisches Problem ergibt sich bei Klavierkonzerten der Mozart-Zeit aus der Tatsache, dass in den Autographen an Stellen, wo das Soloinstrument pausiert, für die linke Hand jeweils ein durchgehendes Col basso notiert ist. Manche Ausgaben enthalten an diesen Stellen Generalbassziffern, die nahelegen, dass der Solist dort einen ausgesetzten Generalbass spielte. An den Nahtstellen zwischen Passagen mit und ohne Klavier treten gelegentlich Probleme auf, da für die linke Hand im Klavier unterschiedliche Spielweisen gelten, je nachdem ob das Klavier als Generalbassinstrument weiter gespielt wird oder nicht (siehe Kritischer Bericht). Diese Notierungsgewohnheit blieb bis in die Zeit Beethovens und darüber hinaus lebendig. Die Praxis des durchgehend spielenden Soloinstruments ging dann jedoch verloren; sie wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wiederbelebt, konnte sich bisher aber nicht durchsetzen.
Den im Kritischen Berichtgenannten Bibliotheken sei herzlich für die zur Verfügung gestellten Quellenkopien gedankt.
Berlin, Herbst 2015Ernst Herttrich
1 Vgl. die Notiz in der Wiener Zeitung vom 8. April 1786 unter „Theaternachrichten“.
Except for the Concerto in D minor, K. 466, Wolfgang Amadeus Mozart’s (1756–1791) Piano Concerto K. 491 in C minor is his only one in a minor key. Out of all of Mozart’s 25 piano concertos it was these two, probably due to their more sombre character, that principally appeared on the concert programmes of the great pianists in the 19th century, a time entirely dominated by the model of Beethoven. They were – and actually still are – regarded as perfect examples of Mozart’s highly emotional expressiveness, regardless of the fact that the Concerto in C minor was obviously composed in great haste. In his own autograph catalogue of works, Mozart noted the composition’s completion date as 24 March 1786. The première probably occurred just two weeks later on 7 April, as part of an Akademie at the Burgtheater. Mozart played the solo part himself1. It cannot, however, be completely ruled out that a different concerto was performed at this Akademie, perhaps the Concerto K. 488 in A major that he had completed three weeks prior to K. 491.
The very short interval between the composition’s completion and its first performance is not at all unusual for Mozart. In the case of the Piano Concerto K. 482 in E flat major, for instance, only one week elapsed between its completion (16 December 1785) and première (23 December 1785). So perhaps it was rather due to the particular character of the Concerto K. 491 that the autograph contains a large number of corrections, both in the orchestral parts and the solo piano part, which is quite uncharacteristic of Mozart. In addition, it displays several far-reaching changes, and in places seems almost like a sketch.
Such conjectures are, however, rather dangerous because Mozart was extremely pressed for time when he wrote this work. At no other time in his life did he compose as much as in the winter season 1785/86: aside from the aforementioned three piano concertos he also composed the Maurerische Trauermusik K. 477 (and at least two other masonic pieces of music), the Violin Sonata K. 481, two ensemble pieces for Francesco Bianchi’s opera La villanella rapita (K. 479 and 480), two subsequently composed pieces for Idomeneo (the Duet K.489 and Aria K. 490), the music for the comedy Der Schauspieldirektor K. 486, and, above all, Figaro K. 492, which was first performed on 1 May 1786. In addition he was involved in preparations for several concerts and a private performance of Idomeneo in the Palais Auersperg, as well as having tuition commitments towards several pupils and at least seven public concert appearances. This workload alone would suffice to explain the unusually high number of corrections to the autograph of the Concerto in C minor; yet the question remains as to why they occur with this piece in particular and not others. The fact that another opening (K. 491a – a threemeasure fragment) exists for movement II serves to further underline how unsure Mozart must have been over the work’s conception (even though there are discarded openings of movements for other works too).
The autograph of the Piano Concerto K. 491 is today held at the Royal College of Music in London. As already indicated it shows all signs of having been written down in great haste. In several places the piano part was apparently only sketched out – Mozart would have presumably played it from memory at the première. In at least two subsequent phases of work he made clarifications, but also changes and
corrections. During the last revision phase he used a more pointed, thinner quill, so this phase can be easily distinguished from the others. It represents the definitive version but is at times only sketchily notated; this version appears in our edition as the main musical text, with the earlier version that is widely present in other editions notated above it as an ossia version. Occasionally two different versions are present without one of them having been crossed out or rendered invalid using other means. In our edition we reproduce both versions of such passages. Despite having been revised several times, it must be assumed that Mozart notated several passages only in abbreviated form, and that these are to be embellished with scales or arpeggiated chords; footnotes at the relevant passages in the musical text indicate where such embellishments are possible.
In many places the autograph contains entries that clearly indicate its use as the model for one or several copies. A copy of the parts is today in the music archive of the Museum of Art History in Kroměříž. In 1799 Constanze Mozart sold the rest of the autographs still in her possession – around 300 manuscripts – to the Offenbach publisher Johann Anton André, the Piano Concerto K. 491 among them. André quickly published numerous editions based on the autographs he had obtained, which he described as “Edition faite d’après la partition en manuscrit” or such like. The Piano Concerto K. 491 was already published in 1800 as no. 3 of the six grands concertos pour le Piano-Forté […] Oeuvre 82, which also comprised the Concertos K. 482, 467, 488, 503 and 595 and which the publisher dedicated to Prince Louis Ferdinand of Prussia. André’s first edition probably also served as the model for the edition published by Breitkopf & Härtel presumably in 1802. As both editions were not published until after Mozart’s death, they do not possess any real source-value. However, some of their divergent readings have entered the reception history of the work and are still partly played today. The most important of them are thus listed in the “Einzelanmerkungen” (Individual Notes) at the end of this edition.
A particular performance practice issue that arises in connection with piano concertos from Mozart’s time is that at places in the autographs where the solo instrument is silent, col basso is written in the left hand. Some editions contain figured bass numbers at these points, implying that the soloist should play a basso continuo. Problems occasionally arise at the crossover points between passages with and without piano, since different manners of performance apply to the left hand in the piano depending on whether the instrument is to continue to play a continuo role or not (see the “Kritischer Bericht” [Critical Report]). This notational custom continued up to Beethoven’s time and even later. The practice of the solo instrument playing throughout then discontinued, however; it was revived in the second half of the 20th century but has not, up to now, re-established itself. We would like to thank the libraries mentioned in the “Kritischer Bericht” for kindly making copies of the sources available.
Berlin, fall 2015Ernst Herttrich
1Cf. note in the Wiener Zeitung of 8 April 1786 under “Theaternachrichten.”
Allegro *
Flauto
Oboe II I
Clarinetto (B) II I
Fagotto II I
Corno
II I
I
Wolfgang Amadeus Mozart KV 491 herausgegeben von Ernst Herttrich
Pianoforte
Allegro *
I
Violoncello e Viola
Contrabbasso
* Tempobezeichnung in A von fremder Hand, hier ergänzt nach Mozarts eigenhändigem Werkverzeichnis. Tempo mark in A by another hand, added here according to Mozart’s autograph thematic catalogue.
Partitur-Bibliothek 1
© 2015 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden and G. Henle Verlag, München 4 518
This is an excerpt. Not all pages are displayed. Have we sparked your interest? We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com. Dies ist eine Leseprobe.
Nicht alle Seiten werden angezeigt. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalien- und Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.