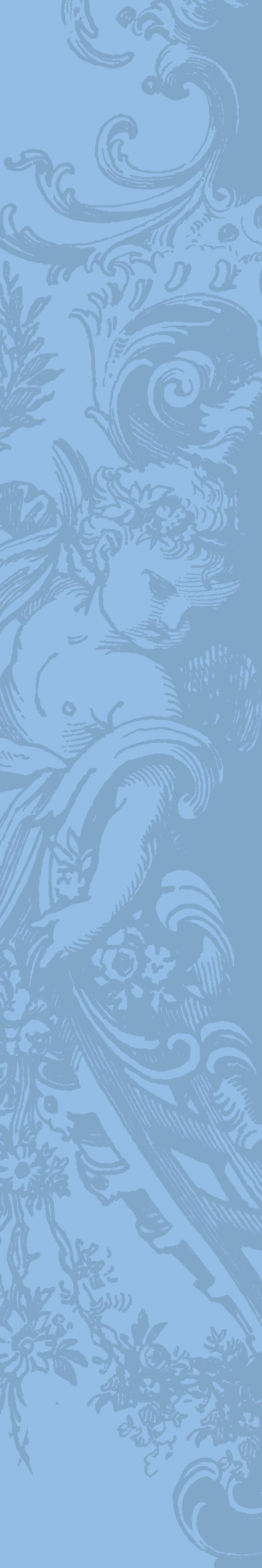
Breitkopf & Härtel Partitur-Bibliothek
Nr. 15143
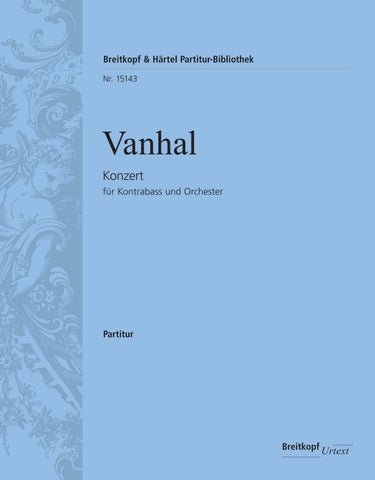
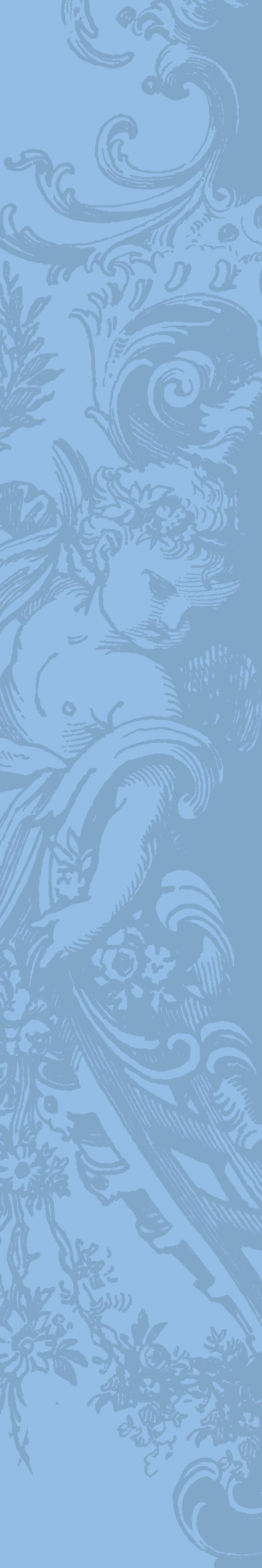
Breitkopf & Härtel Partitur-Bibliothek
Nr. 15143
Konzert für Kontrabass und Orchester
Partitur
Breitkopf Urtext
(1739–1813)
Concerto
for Double Bass and Orchestra
herausgegeben von/edited by Tobias Glöckler
BREITKOPF & HÄRTEL
Partitur-Bibliothek 15143
G. Henle Verlag
Von Johann Baptist Vanhal (1739–1813) ist nur ein einziges Kontrabasskonzert überliefert. Es gilt heute als eines der bekanntesten und meistgespielten klassischen Werke für Kontrabass und ist auch bei Probespielen und Wettbewerben längst zum unverzichtbaren Standard geworden. Das im Vanhal-Verzeichnis von Alexander Weinmann mit der Werknummer II h bezeichnete Konzert wurde vermutlich zwischen 1786 und 1789 geschrieben. In diesen Jahren wirkten Vanhal und der Kontrabassist und Komponist Johannes Sperger (1750–1812), in dessen Nachlass die einzige Stimmenabschrift des Werks überliefert ist, gemeinsam in Wien. Die näheren Umstände der Entstehung und Uraufführung des Konzerts sind nicht bekannt. Vermutlich entstand es für Sperger, dessen Beschäftigung mit dem Werk durch Eintragungen in der Quelle sowie eigene Kadenzen belegt ist. Als Adressat kommt aber auch der Wiener Kontrabass-Virtuose Josef Kämpfer (1735–nach 1797) in Frage. In jedem Fall lässt die vergleichsweise hohe Lage des Soloparts auf einen versierten Solisten schließen. Ausgehend von den frühen Konzerten Joseph Haydns (1763, verschollen) und Carl Ditters von Dittersdorfs (um 1767) hatte sich damals das solistische Kontrabass-Spiel in und um Wien zu einer außergewöhnlichen Blüte entwickelt und erfreute sich großen Zuspruchs. Diese Konstellation mag auch Vanhal zur Komposition seines Kontrabasskonzerts bewogen haben.
Zur Aufführungspraxis
Die einzige bekannte Quelle des Werks ist die erwähnte Stimmenabschrift aus Spergers Nachlass. Die Kontrabass-Solostimme ist darin in D-dur notiert, die Orchesterstimmen stehen dagegen in Es-dur. Dies ist auf eine damals häufig geübte Praxis zurückzuführen, wonach der Solist seinen Part in der grifftechnisch und klanglich günstigen Tonart D-dur spielte, gleichzeitig aber den Kontrabass um einen Halbton nach oben stimmte, um den Klang des Instruments durch die höhere Saitenspannung heller und tragfähiger zu machen. Da diese Halbton-Skordatur heute nicht mehr üblich ist, war es für unsere praktische Ausgabe notwendig, die Begleitung ebenfalls nach D-dur zu übertragen.
Die damals geläufige Notation einiger Solo-Passagen des Kontrabasses im hohen (transponierenden) Violinschlüssel wurde dagegen unverändert übernommen; der reale Klang ist somit zwei Oktaven tiefer.
Eine differenzierte Behandlung erfordern einige nachträgliche Eintragungen in der Kontrabass-Solostimme, die nicht vom Kopisten stammen. Ein Handschriftenvergleich ergab, dass diese auf Sperger sowie auf mindestens einen weiteren, unbekannten Schreiber zurückgehen. Als besonders problematisch erweisen sich dabei die 8 va-Ergänzungen im 3. Satz, die im musikalischen Kontext nicht immer sinnvoll erscheinen (so die der Melodieführung in T. 43f. entgegenstehende Anweisung für T. 39–43). Um größtmögliche Transparenz zu wahren und dem Musiker eine individuelle Entscheidung zu ermöglichen, wurden alle nachträglichen Oktavierungen durch Fußnoten kommentiert. In den ersten beiden Sätzen sind dagegen sämtliche Oktavierungen zweifelsfrei vom oben erwähnten Kopisten notiert. Unklar bleibt allerdings, warum und von wem die figurative Veränderung im 1. Satz, Takte 53f. (bzw. diekorrespondierende Ergänzung in T. 124f.), vorgenommen wurde.
Die überlieferte Basso-Stimme ist nicht beziffert. Neben der Besetzung mit Violoncello/Kontrabass erscheint die Mitwirkung eines Cembalos naheliegend, zumal auf dem Deckblatt explizit „Basso Continuo“ notiert ist. Zusätzlich könnte in den Ecksätzen auch ein Fagott mitgespielt haben, wofür die Bläserbesetzung mit Oboen spricht. Die ohne Bläser instrumentierten Solo-Abschnitte sind in kleinerer Streicherbesetzung zu spielen, wie aus den überlieferten Ripieno-Stimmen für Violine I und II hervorgeht, die nur die Tutti enthalten. Reizvoll erscheint sogar eine Reduktion bis auf einen Spieler je Stimme bzw. Instrument (Continuo).
Um die zeittypische Artikulationsvielfalt zu wahren, wurden Parallelstellen in der Regel ebenso wenig angeglichen wie unterschiedliche Artikulation in parallel geführten Stimmen. Sämtliche Ergänzungen des Herausgebers wurden in eckige Klammern gesetzt; hinzugefügte Bögen sind gestrichelt gedruckt. Lediglich bei Vorschlagsnoten wurden gelegentlich fehlende Bögen stillschweigend ergänzt und bis zur Hauptnote geführt. Die geteilte Halsung bei Doppelgriffen wurde unverändert übernommen.
In der Quelle ist keine systematische Unterscheidung zwischen Staccatopunkt und -strich erkennbar, vielmehr scheinen beide Zeichen für „gekürztes“ Spiel willkürlich gesetzt. In der Edition wurde deshalb zu Staccatopunkt vereinheitlicht. Gelegentlich sind auch Legatobögen nicht eindeutig positioniert oder tendenziell zu kurz notiert, sodass anhand des jeweiligen Kontexts eine musikalisch sinnvolle Lösung gefunden werden musste. Problematische Stellen und Lesarten werden im Revisionsbericht kommentiert.
Anmerkungen zur „Wiener Stimmung“
Ziel unserer Ausgabe ist es auch, zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit der historischen „Wiener Kontrabass-Stimmung“ (A-d-fis-a) anzuregen. Ohne diese Stimmung, für die auch Vanhal sein Konzert schrieb, wäre ein derartiger Höhepunkt des solistischen Kontrabass-Spiels während der Wiener Klassik kaum möglich gewesen. So erlaubt die „Wiener Stimmung“ eine grifftechnisch außerordentlich effiziente Umsetzung des Notentextes. Darüber hinaus lassen die im D-dur-Dreiklang gestimmten leeren Saiten zusammen mit häufigem Akkordspiel „über die Saiten“ einen ganz eigenen, überaus tragfähigen Klang entstehen. Gleichwohl gerieten diese Stimmung und die damit verbundene typische Spielweise bald nach 1800 in Vergessenheit.
Aufgrund der „Wiener Faktur“ des Werkes sind einige wenige Passagen mit einem modernen Kontrabass in Solo- bzw. OrchesterStimmung nicht ohne Umlegung oder Erleichterung spielbar. Mit größtmöglicher Zurückhaltung sind diese Stellen sinngemäß an die Applikatur des quartgestimmten Kontrabasses anzupassen. Der im G. Henle Verlag München erschienene Klavierauszug (HN979 / EB 10979) enthält Solostimmen mit Realisierungsvorschlägen (inklusive Fingersätze und Strichbezeichnungen) für Solo-, Orchesterund „Wiener Stimmung“ sowie Kadenzen vom Herausgeber.
Herausgeber und Verlag danken der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern herzlich für die Bereitstellung der Quellenkopie.
Dresden, Herbst 2015Tobias Glöckler
Only a single double bass concerto has come down to us from Johann Baptist Vanhal (1739–1813). Today it is one of the bestknown and most frequently played works for double bass, and has long been an indispensable “standard” at auditions and competitions. The Concerto, assigned work number II h in Alexander Weinmann’s Catalogue of Vanhal’s works, was presumably written between 1786 and 1789. During these years, Vanhal and double bass player and composer Johannes Sperger (1750–1812), whose estate preserves the only set of parts for the work, were both active in Vienna. More precise details concerning the Concerto’s genesis and première are not known. It was presumably composed for Sperger, whose involvement with it is documented by annotations in the source as well as by his own cadenzas. Nevertheless, the Viennese double bass virtuoso Josef Kämpfer (1735–after 1797) also comes into question as the work’s addressee. In any case, the relatively high tessitura of the solo part suggests an experienced soloist. Starting with the earlier concertos by Joseph Haydn (1763, lost) and Carl Ditters von Dittersdorf (ca. 1767), soloistic double bass playing in and around Vienna experienced an exceptional blossoming and enjoyed great popularity at that time. This constellation may also have inspired Vanhal to compose his Double Bass Concerto.
The only known source of the work is the abovementioned manuscript set of parts from Sperger’s estate. The solo double bass part is notated in D major there, while the orchestral parts, on the other hand, are in Ej major. This is due to a then frequent practice in which the soloist played his part in the key of D major, which was advantageous in terms of fingering and sound, while simultaneously tuning the double bass a semitone higher in order to lend the instrument a brighter timbre and more carrying power due to the increased tension of the strings. Since this semitone scordatura is no longer usual today, it has been necessary to transpose the accompaniment into D major for our practical edition.
On the other hand, the then usual notation of several solo passages in high (transposed) treble clef has been adopted unaltered; the sounding pitch is thus two octaves lower. Several later entries in the solo double bass part not stemming from the copyist require differentiated treatment. A comparison of the handwriting has revealed that these annotations are by Sperger and at least one further, unknown scribe. The 8 va additions in movementIII,which do not always seem sensible in the musical context (e. g., the instruction for mm. 39–43 that goes against the melodic writing in mm. 43f.), prove to be particularly problematic in this regard. To maintain the greatest possible transparency, and to allow the musician to decide for himself, all subsequently added octave transpositions are indicated by footnotes. On the other hand, there is no doubt that the octave transpositions in the first two movements were all notated by the copyist. It does, however, remain unclear why and by whom the figurative modification in movement I, mm. 53f. (and the corresponding amendment in mm. 124f.), was made.
The preserved bass part does not have continuo figures. Besides the instrumentation with violoncello/double bass, the participation of a harpsichord seems obvious, especially since “Basso Continuo” is explicitly notated on the cover sheet. In addition, a bassoon could also have played along in the outer movements, which is suggested by the woodwind orchestration with oboes. The solo sections without woodwinds are to be played with a smaller string group, as is shown by the preserved ripieno parts for violin I and II, which only contain the tutti sections. A reduction to one player on a part or instrument (continuo) might also be attractive.
In order to retain the diversity of articulation typical at that time, as a rule neither parallel passages nor differing articulations in parallel parts have been changed to match each other. All editorial additions appear in square brackets; added slurs are printed as lines of dashes. Only in the case of grace notes have missing slurs occasionally been tacitly added and connected to the main note. The divided stemming in double stops has been adopted unaltered.
No systematic differentiation between staccato dots and staccato dashes is discernible in the source; on the contrary, both signs seem to be arbitrarily used to indicate “shortened” playing. They are uniformly notated as staccato dots in our edition. Occasionally, legato slurs are also not clearly positioned, or tend to be drawn too short, so that a sensible musical solution has to be found based on context. Problematic passages and readings are elucidated in the “Revisionsbericht.”
Notes on “Viennese tuning”
It is also a goal of our edition to stimulate increased engagement with the historical “Viennese double bass tuning” (A-d-fK-a). Without this tuning, which Vanhal had in mind when writing his Concerto, such a heyday of soloistic double bass playing during the Viennese Classic period would hardly have been possible. Thus in terms of fingering the “Viennese tuning” allowed an extraordinarily efficient realisation of the musical text. Moreover, the open strings tuned to a D-major triad, along with the frequent playing of chords “across the strings,” allow the development of a very unique and eminently sustainable sound. Nevertheless, this tuning system and the associated playing style fell into oblivion soon after 1800. Because of the “Viennese texture” of the work, a few passages are not playable on a modern double bass in solo or orchestral tuning without modifications or simplifications. These passages have been correspondingly adapted with the greatest possible restraint to the technique of the double bass tuned in fourths. The piano reduction (HN 979 / EB 10979) issued by G. Henle Publishers, Munich, contains solo parts with performance suggestions (including fingerings and bowings) for solo, orchestral and “Viennese tuning,” along with cadenzas by the editor.
Editor and publisher thank the Landesbibliothek MecklenburgVorpommern in Schwerin for providing copies of the source.
Dresden, Fall 2015Tobias Glöckler
2 Oboen2 Oboes
Fagott ad lib. * Bassoon ad lib. *
2 Hörner2 Horns
StreicherStrings
Cembalo *
* zur Mitwirkung siehe Vorwort
Harpsichord *
* Regarding the scoring see Preface
AufführungsdauerPerforming Time
etwa 20 Minutenapprox. 20 minutes
Orchesterstimmen/Orchestral parts: Breitkopf & HärtelOB15143
Ausgabe für Kontrabass und Klavier (Tobias Glöckler/Christoph Sobanski)
Edition for double bass and piano (Tobias Glöckler/Christoph Sobanski)
Breitkopf & HärtelEB10979
oder/or G. Henle Verlag HN 979
Studienpartitur/Study score: Breitkopf & HärtelPB15144
Eine Gemeinschaftsproduktion von Breitkopf & Härtel, Wiesbaden und G. Henle Verlag, München
A Coproduction of Breitkopf & Härtel, Wiesbaden and G. Henle Verlag, Munich
Printed in Germany
e Contrabbasso,
Cembalo*)
Johann Baptist Vanhal herausgegeben von Tobias Glöckler
Partitur-Bibliothek
* Zur Mitwirkung von Fagott und Cembalo siehe Vorwort. / Regarding the scoring of bassoon and harpsichord see Preface. ©5 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden and G. Henle Verlag, München
Zur Besetzung der Streicher in den Solo-Abschnitten siehe Vorwort.
Regarding the number of string players in the Solo sections see Preface.
mit 8 -Hinweis eine Oktave tiefer. * Die im Violinschlüssel notierten Soli klingen in loco-Notation zwei Oktaven tiefer, Breitkopf PB 15143
The Solos written in treble clef sound two octaves lower if notated loco; with 8 sign they sound one octave lower.
dolce sowie T. 51 wohl von Sperger ergänzt. / dolce and m. 51 probably added by Sperger.
* Edition folgt Korrektur des Kopisten in Quelle T. 53f., siehe auch Revisionsbericht; ursprüngliche Lesart wohl: Edition follows copyist’s correction at mm. 53f. of source, see also “Revisionsbericht”; original version probably:
** Kadenzvorschlag des Herausgebers siehe Klavierauszug EB 1
* In Quelle T. 124f. punktierte Lesart (vgl. T. 53f.) von fremder Hand (Sperger?) angedeutet, siehe auch Revisionsbericht. In source mm. 124f. dotted version (cf. mm. 53f.) indicated by unknown hand (Sperger’s?), see also “Revisionsbericht.” Editor’s suggestion for a cadenza see the piano reduction
This is an excerpt. Not all pages are displayed. Have we sparked your interest? We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com. Dies ist eine Leseprobe.
Nicht alle Seiten werden angezeigt. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalien- und Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.
Die ungebrochene Beliebtheit von Vanhals einzigem Kontrabasskonzert in Wettbewerb, Probespiel und Konzert bot Anlass, das Werk im „Breitkopf Urtext“ herauszubringen. Die Ausgabe profitiert dabei von der langjährigen Erfahrung Tobias Glöcklers. Wie bei den anderen großen Kontrabasskonzerten des klassischen Wiener Repertoires kommt Glöckler zu überzeugenden Lösungen. Zunächst galt es, aus der nicht immer widerspruchsfreien und mit zahlreichen Nachträgen versehenen Quelle einen stimmigen Notentext herauszufiltern. Zusätzlich erforderte die Präsentation des Soloparts detaillierte aufführungspraktische Kenntnis, da das Werk in der historischen „Wiener Kontrabass-Stimmung“ geschrieben ist und einige Passagen auf einem modernen Instrument nicht ohne weiteres spielbar sind. Der Klavierauszug ermöglicht wie bei Dittersdorf und Hoffmeister drei verschiedene Kontrabass-Stimmungen (Solo-, Orchester- und Wiener Stimmung) und enthält zudem virtuose Kadenzen des Herausgebers.
Weitere Kontrabasskonzerte (Urtext-Ausgaben von Tobias Glöckler in Koproduktion von Breitkopf & Härtel und dem G. Henle Verlag):
Carl Ditters von Dittersdorf Konzert „E-dur“ Krebs 171 Franz Anton Hoffmeister Konzert „Nr. 1“
The unbroken popularity of Vanhal’s sole Double Bass Concerto in competitions and for practice and concert purposes is reason enough for us to publish the work in “Breitkopf Urtext.” The edition profits from Tobias Glöckler’s experience of many years. As with the other great double bass concertos of the classical Viennese repertoire, Glöckler arrives at convincing solutions. He began by filtering out a solid musical text from the source (which was not always free of contradictions) that was supplied with many additions. The disposition of the solo part required detailed knowledge of performance practice, since the work was written in the historical Viennese double bass tuning, and a few passages cannot be played without difficulty on a modern instrument. As with Dittersdorf and Hoffmeister, the piano reduction makes it possible to use three different double-bass tunings (solo, orchestral and Viennese). Moreover, it contains the editor’s virtuoso cadenzas as well.
Further Double Bass Concertos (Urtext Editions by Tobias Glöckler in coproduction of Breitkopf & Härtel and G. Henle Verlag):
Carl Ditters von Dittersdorf
Concerto in “E major” Krebs 171
Franz Anton Hoffmeister
Concerto “No. 1”