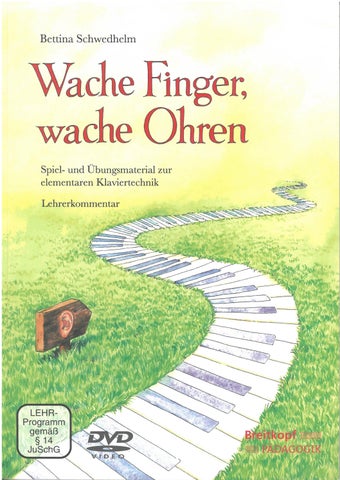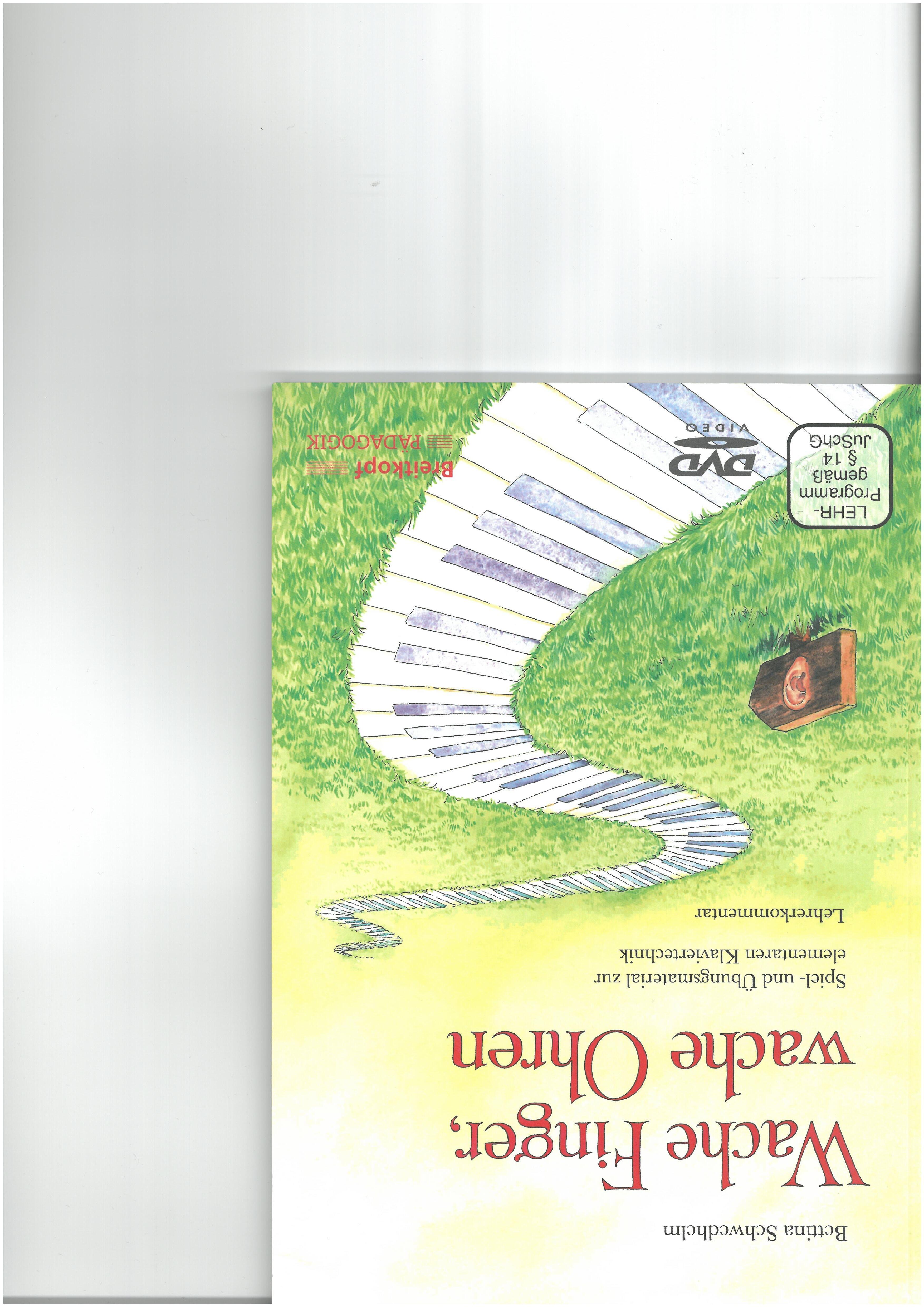
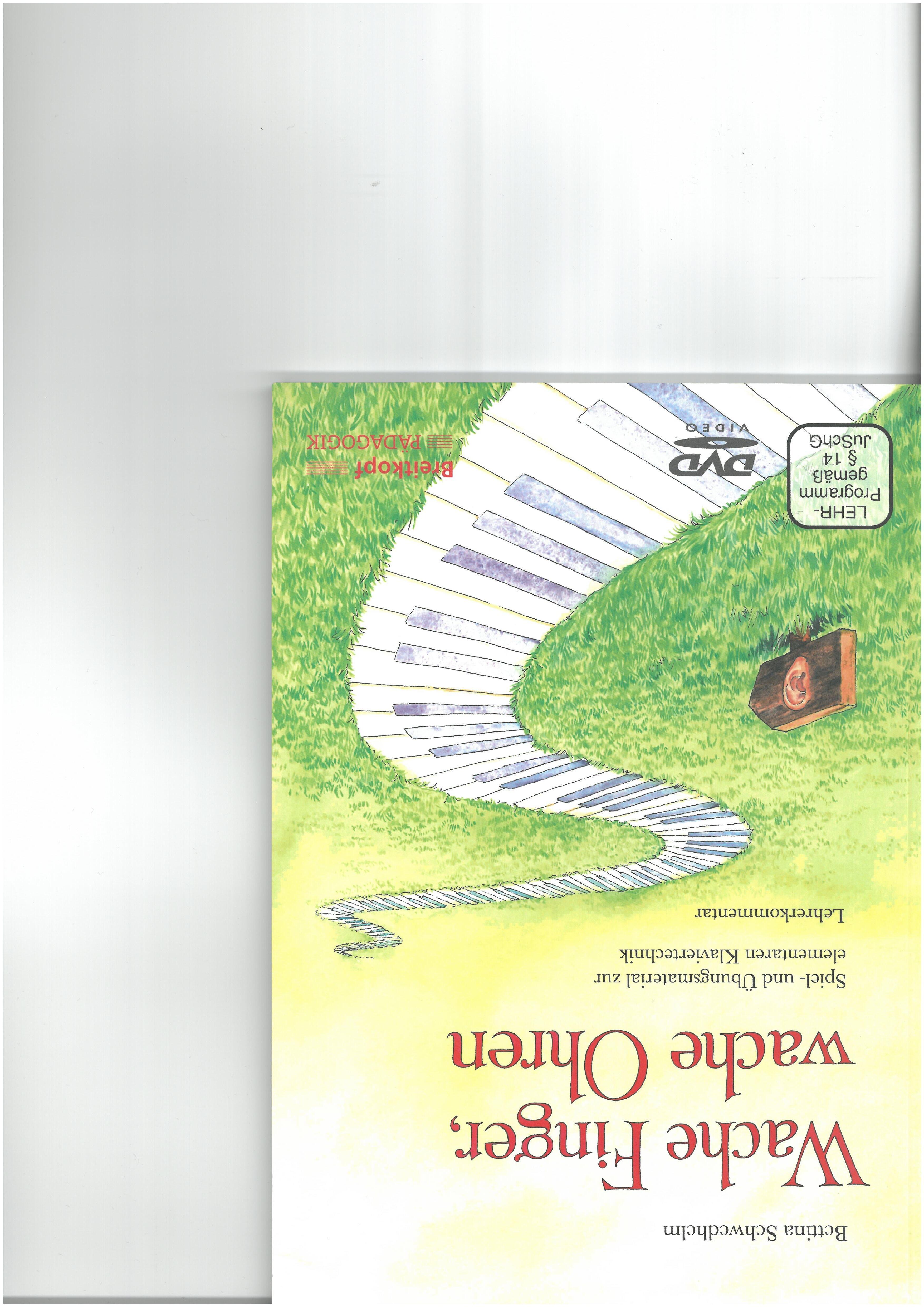
BETTINASCHWEDHELM

Spiel- und Übungsmaterial zur elementaren Klaviertechnik
Lehrerkommentar
BREITKOPF & HÄRTEL
WIESBADEN · LEIPZIG · PARIS
Printed in Germany
BV 476 Lehrerkommentar mit DVD
Schülerheft 1 EB 8821 ISMN 979-0-004-18386-1
Schülerheft 2 EB 8822 ISMN 979-0-004-18387-8
BV 476
ISBN 978-3-7651-0476-3
© 2013 by Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
Alle Rechte vorbehalten
DVD
DVD Video ca. 31:12 Minuten Film
Ländercode: O/PAL – Sprache: Deutsch – Bildformat: 16:9
Konzeption: Bettina Schwedhelm
Klavier: Christine Schütze
Aufnahmen: 3. Januar 2011, Konzertsaal des Hamburger Konservatoriums Kamera, Schnitt und Mediendesign: Frank Jasper und Ralf Lange, RL-Media Production, Hamburg www.rl-media.com
Herstellung: B & B Media Service GmbH & Co KG, Olpe
Illustrationen und Piktogramme: Imke Kretzmann, Hamburg
Umschlag: Imke Kretzmann, Hamburg
Notensatz, Satz und Layout: Ansgar Krause, Krefeld
Druck: druckhaus köthen GmbH, Köthen
Printed in Germany
Wir danken dem Hamburger Konservatorium für die freundliche und großzügige Unterstützung bei der Produktion der DVD. LEHRProgramm gemäß § 14 JuSchG
1 Wozu technische Übungen?
2 Zur Klaviertechnik
2.1 Zu den Begriffen in der Technik des Klavierspiels
2.2 „Ganzheitliches“ Klavierspiel
2.2.1 Die Bedeutung der Körperwahrnehmung
2.3 Elementare Klaviertechnik
2.3.1 Lernziele und -inhalte elementarer Spieltechnik
2.3.2 Die Entwicklung der Spieltechnik
Armspiel – Fingerspiel – Zusammenfassende Spielbewegung und Schwungbewegungen
3 Vorinstrumentale Übungen
3.1 Welche Ziele verfolgen vorinstrumentale Übungen?
3.2 Zur Arbeit mit den Übungen
3.3 Rücken/Schulter – Arm
Spannung und Entspannung – Elementare Bewegungsstudien des Arms
3.4 Schulter/Arm – Hand
Koordination – Unabhängigkeit
3.5 Hand und Finger
Zur Vorbereitung der Gewölbefunktion der Hand – Fingerbewusstsein und Muskeltraining für die Hand – Zur Stützfähigkeit von Fingern und Hand
3.6 Schwungbewegungen
Vertikal- und Seitenschwünge – Kreis- und Drehschwünge
3.7 Der pianistische Sitz
4 Zu den Schülerheften
4.1 Übungen und Etüden
4.2 Die Anschlagsarten
4.2.1 Armspiel
Arm-/Unterarm-Portato – Arm-/Unterarm-Staccato – (Hand-Staccato) – Arm-Legato
4.2.2 Fingerspiel
Neutrales Finger-Legato – Gewichts-Legato – Fingeraktives Legato –Finger-Staccato
4.2.3 Schwungbewegungen
Zusammenfassende Spielbewegung und Kreisschwung –Vertikalschwünge (Hoch- und Tiefschwung) – Seitenschwung – Drehschwung
4.3 Allgemeine Übemethoden
4.3.1 Das Üben mit Varianten
5 Zu den Kapiteln von Schülerheft 1
5.1 Kapitel 1 – Töne bilden (Elementare Anschlagsübungen)
5.2 Kapitel 2 – Zwei- bis Fünffingerübungen
5.3 Kapitel 3 – Doppelgriffe (Sekunden bis Sexten)
5.4 Kapitel 4 – Unabhängige Hände
5.5 Kapitel 5 – Fortrückende Tonfolgen
5.6 Kapitel 6 – Dreistimmige Akkorde
6 Zu den Kapiteln von Schülerheft 2
6.1 Kapitel 1 – Fünffingerübungen (Elementare Geläufigkeit)
6.2 Kapitel 2 – Unter- und Übersetzen
6.3 Kapitel 3 – Tonleitern (Elementares Skalenspiel)
6.4 Kapitel 4 – Doppelgriffe (Sekunden bis Septimen)
6.5 Kapitel 5 – Drei- und vierstimmige Akkorde
6.6 Kapitel 6 – Unabhängige Hände und Finger
DVD-Index
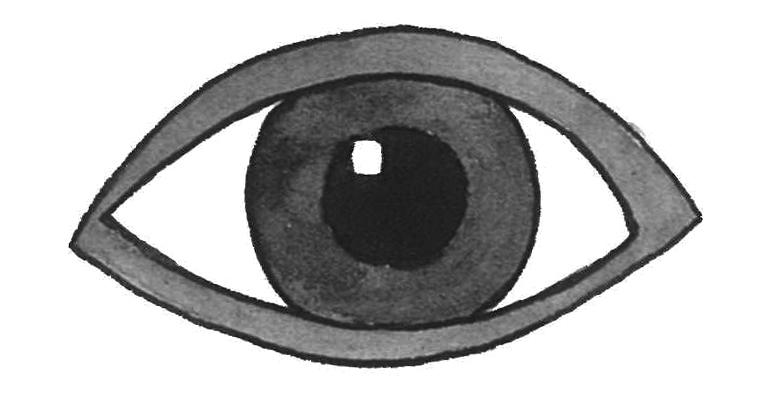
verweist auf entsprechenden DVD-Track.
Entsprechend gekennzeichnete Textpassagen enthalten vertiefende Ausführungen zu den zentralen Anschlagsarten bzw. Spieltechniken.
In den beiden Schülerheften werden folgende Symbole verwandt:
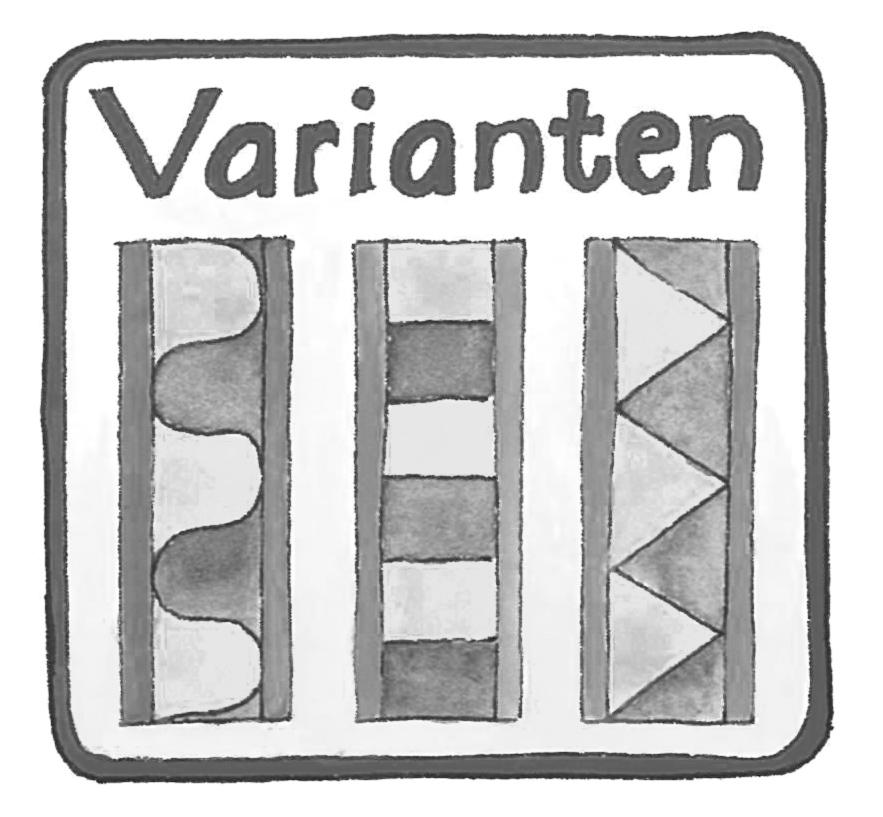
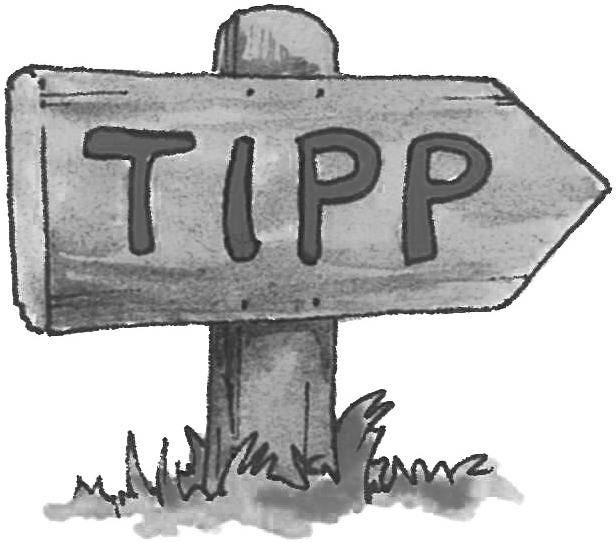

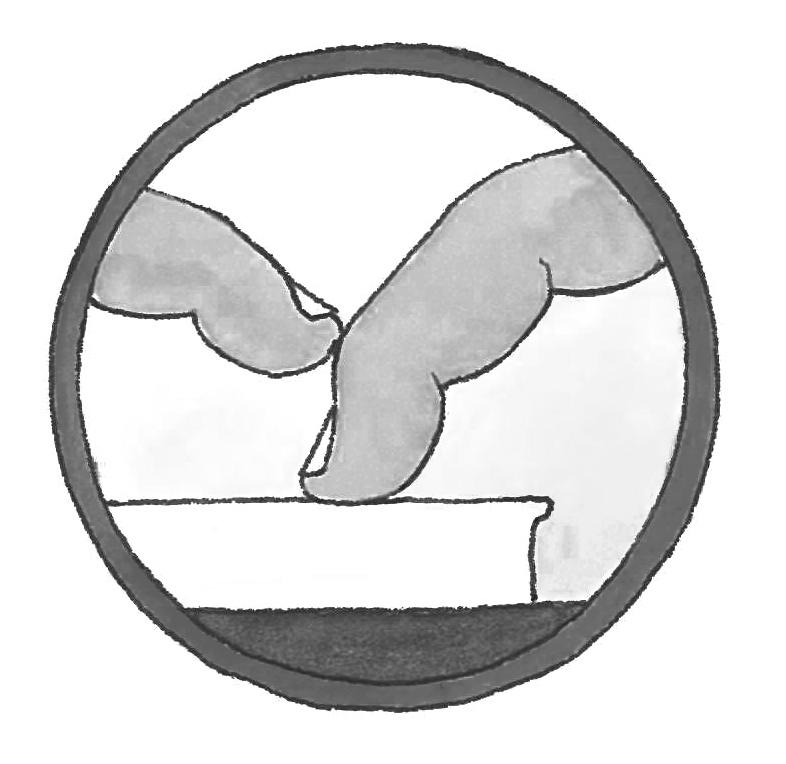
= Dieses Zeichen fordert dazu auf, die jeweilige Übung oder Etüde in verschiedenen Varianten zu üben (siehe Einleger).
= Spezielle Übetipps für den Schüler
= Der Schüler soll selbst etwas erfinden.
= Der Schüler soll prüfen, ob seine Finger 2–5 widerstehen, also ihr Endgelenk stabil ist.
Fingersatzvarianten sind türkis gesetzt. Der Schüler soll die entsprechende Übung oder Etüde auch mit diesen anderen Fingersätzen erarbeiten.
Vorwort
Wache Finger, wache Ohren ist ein Kompendium von Übungen und kurzen Etüden oder Spielstücken zum Erwerb elementarer spieltechnischer Fähigkeiten und wurde für die Unterrichtspraxis konzipiert. Es umfasst zwei Hefte und einen Lehrerkommentar einschließlich einer DVD und richtet sich an Anfänger aller Altersstufen bzw. alle Klavierschüler der Unterstufe. Dieses Werk soll auf die leichte Literatur aller Epochen vorbereiten, z. B. auf das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach und die Präludien und Fughetten von J. S. Bach, die leichtesten Klavierstücke von W. A. Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Grieg u. v. m., aber auch die leichte Literatur anderer Stilrichtungen wie die Klassische Moderne, Neue Musik, Jazz, Rock- , Pop- und Filmmusik.
Die beiden Schülerhefte vermitteln die Basistechnik in Form von progressiv geordneten Übungen und Etüden, mit denen nach und nach die zentralen pianistischen Grundspielformen als universal anwendbares „Vokabular“ erarbeitet werden können.
Kurze, musikalisch abwechslungsreiche und strukturell fassliche Etüden und Spielstücke vertiefen in jedem Kapitel das vorangegangene Übungsmaterial und bereichern es um diverse anschlagstechnische, dynamische und artikulatorische Nuancen. Besonderer Wert wurde auf die im Unterricht häufig vernachlässigte Ausbildung der Hände und Finger einer Hand zur Unabhängigkeit gelegt.
Wertvolle Tipps zum Üben fordern den Schüler1 zum wahrnehmungsintensiven, klang- und anschlagsbewussten Lernen bzw. Spielen auf. Darüber hinaus kann das Übungsmaterial mit verschiedenen (z. B. rhythmischen, dynamischen, artikulatorischen) Varianten erarbeitet werden, die sich jeweils im Einleger der Hefte finden.
Für den Lehrer eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten der Anwendung: Die spieltechnische Arbeit im Unterricht kann erfolgen, indem die Schülerhefte z. B. parallel zur Klavierschule oder zu anderer Spielliteratur eingesetzt und sukzessive erarbeitet oder zur Aufrechterhaltung technischer Fähigkeiten regelmäßig herangezogen werden. Aus gegebenem Anlass kann der Lehrer aber auch das entsprechende Übungsmaterial eines Kapitels zur Erarbeitung herausgreifen, z. B. bei auftretenden spieltechnischen Problemen des Schülers innerhalb einer der pianistischen Grundspielformen wie etwa dem Tonleiter- oder Akkordspiel. Häufig stellt sich dabei auch heraus, dass motorische Schwierigkeiten eines Schülers auf einer höheren Lernstufe erst dann gelöst werden können, wenn die ihnen zugrundeliegenden Defizite erkannt und auf einer grundsätzlicheren Ebene anhand geeigneten elementaren Übungsmaterials beseitigt wurden.
Der Lehrerkommentar richtet sich an den Pädagogen, der zusätzlich zum Übungsmaterial der beiden Schülerhefte methodisch-didaktische Anregungen für die spieltechnische Arbeit in seinem Unterricht sucht. Hier findet er Erläuterungen zu grundlegenden Ansätzen eines „ganzheitlichen“ Klavierspiels und seiner Vermittlung sowie zum systematischen Aufbau der elementaren Spieltechnik einschließlich vorbereitender nichtinstrumentaler Übungen. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Darstellung zentraler pianistischer Spielbewegungen und Anschlagsarten sowie ihrer Beziehung untereinander.
Einige Gedanken zum Thema Üben sowie eine Auswahl der wichtigsten Übemethoden erfassen darüber hinaus zentrale Aspekte des motorischen Lernens wie etwa Zielvorstellungen, Selbstwahrnehmung, Körperbewusstsein und die Verbindung von Klangvorstellung und Bewegungsausführung, die alle eine fundamentale Rolle in der Ausübung und Optimierung von instrumentalen Musizierbewegungen spielen.
1 Im weiteren Text wird wegen der besseren Lesbarkeit von dem Lehrer und dem Schüler gesprochen. Selbstverständlich sind damit auch alle Lehrerinnen und Schülerinnen gemeint.
Inhaltliche Wiederholungen haben mit der Wichtigkeit bestimmter spieltechnischer Aspekte zu tun, die bei der Erarbeitung der Übungen und Etüden immer wieder berücksichtigt werden sollten.
Mit diesem Werk möchte ich den unzähligen Klavierspiellehren keine neue hinzufügen, sondern Ordnung schaffen innerhalb der zum Teil verwirrenden Vielfalt spieltechnischer Methoden und häufig widersprüchlicher instrumentalpädagogischer Empfehlungen und so einen für die Unterrichtspraxis gangbaren Weg aufzeigen. Der idealistische Ansatz, Spielbewegungen seien erstens individuell und zweitens eine natürliche, sich von selbst ergebende Übertragungsform intensiver Klangvorstellung, führt dabei nach meiner Ansicht ebenso wenig weiter wie der mechanistische Ansatz, „isoliertes“ und gleichförmiges Trainieren (der verschiedenen Teile) des Spielapparates vor allem im Hinblick auf Kraft und Schnelligkeit könne unabhängig von klanglich-musikalischen Gesichtspunkten umfassende technische Fähigkeiten herausbilden.
Ein für die Unterrichtspraxis gangbarer Weg bedeutet dagegen, gerade angesichts der Komplexität möglicher Spielbewegungen und Anschlagsarten eine (vorübergehende) Vereinfachung durch das Systematisieren und Benennen von Spielvorgängen herbeizuführen, die das Fundament für die im Laufe der musikalischen Entwicklung weiter auszudifferenzierende Spieltechnik bilden.
Ziel ist es, parallel zur Entwicklung des musikalischen Hörvermögens allmählich einen Fundus grundlegender, gut automatisierter Spieltechniken anzulegen, die auf jeder Lernstufe in den Dienst eines die künstlerischen, körperlichen, gestischen, geistigen und emotionalen Ebenen umfassenden Musizierens gestellt werden können.
Das hier vorgestellte Übungsmaterial, einschließlich der spieltechnischen Ausbildungsschritte, ist als eine Art Rohmaterial aufzufassen, welches im Hinblick auf die individuelle Persönlichkeit eines Schülers und seine musikalischen und motorischen Lernmöglichkeiten stets modifiziert werden sollte: Lernumfang, Sorgfalt bei der Ausführung und vor allem die wahrnehmungsorientierten und bewussten Anteile im Bewegungslernen können naturgemäß nicht auf jeder Lernstufe und bei jedem Schüler optimal umgesetzt werden. Entscheidend ist, dass der Lehrer zu jeder Zeit weiß, worauf es langfristig ankommt, und sich der hochgradig verantwortungs- und anspruchsvollen Aufgabe bewusst ist, von Anfang an bei seinem Schüler die richtigen instrumentaltechnischen Weichen zu stellen. So kann vermieden werden, dass es irgendwann zu beispielsweise körperlichen Blockaden oder fehlerhaften Bewegungsprogrammen kommt, die eine weitere spieltechnische und damit musikalisch-künstlerische Entwicklung unmöglich machen oder zumindest erschweren.
Die in diesem Werk vorgestellten elementaren Spielbewegungen und Anschlagsarten werden – einschließlich zwei wichtiger vorinstrumentaler Übungen – auf der beigefügten DVD demonstriert, zuerst in Form kurzer Übungen, anschließend im musikalisch-klanglichen Zusammenhang entsprechender Etüden. Wenngleich sich die einer Spielbewegung zugrundeliegende und für das motorische Lernen entscheidende Bewegungsempfindung nicht auf diesem Weg mitteilen lässt, so bietet sich doch zumindest die Möglichkeit, einen Gesamteindruck von Spielbewegung und Klangergebnis zu bekommen und auch einzelne Phasen komplexerer Bewegungsabläufe nachzuvollziehen. Angesichts der Fülle möglicher Spieltechniken ist in manchen Fällen durchaus eine andere spieltechnische Ausführung einer Übung oder Etüde denkbar, daher möchten die – hinsichtlich der Spielbewegungen gelegentlich bewusst leicht übertreibenden – Einspielungen auf der DVD vor allem als eine Anregung für den praktischen Gebrauch der grundlegenden Anschlagsarten verstanden sein.
Grundsätzlich sollen und wollen die in diesem Werk verwendeten Fachbegriffe und Bezeichnungen der diversen Anschlagsarten – die keine eigenen Wortschöpfungen, sondern überwiegend der klaviermethodischen Literatur entnommen und daher weitgehend verbreitet sind – im Sinne eines Angebots, weniger als „Indoktrinierung“ des Lehrenden verstanden sein. Denn wer denselben Inhalt in seinem Unterricht mit anderen Begriffen umschreibt, will dies vielleicht auch weiter so halten.
In meiner langjährigen Arbeit als Dozentin für Klaviermethodik wurde und wird regelmäßig deutlich, welche Ratlosigkeit sich bei vielen auch exzellent spielenden Studenten offenbart, wenn es darum geht, zentrale pianistische Bewegungsformen und Anschlagsarten aufzuzeigen und diese zu beschreiben. Dabei sind das Bewusstmachen und Verbalisieren-Können der eigenen instrumentalen Spielbewegungen und Musiziervorgänge wie auch das Reflektieren der eigenen Lernbiographie eine wesentliche Voraussetzung für die spieltechnische Unterweisung eines Schülers, die diesem eine Erweiterung seiner musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet und die Voraussetzungen zur Ausbildung einer fundierten Technik schafft.
Mein herzlicher Dank gilt dem Aufnahmeteam, Herrn Ralf Lange und Herrn Frank Jasper, sowie meiner ehemaligen Schülerin, der sensiblen Pianistin Christine Schütze, für die hervorragende Zusammenarbeit bei den Aufnahmen zur DVD.
Ganz besonders danken möchte ich meinem Lektor, Herrn Friedhelm Pramschüfer, der dieses Werk mit unermüdlichem Engagement, bewundernswerter Geduld und Akribie, enormer Sachkenntnis und vielen äußerst wertvollen Hinweisen und Ratschlägen betreut und vorangetrieben hat!
Hamburg, Frühjahr 2013 Bettina Schwedhelm
1 Wozu technische Übungen?
Wie jeder andere Instrumentalunterricht sollte Klavierunterricht ein Musikunterricht am Instrument sein, in dem der Schüler zusammen mit dem Erwerb instrumentaltechnischer Fähigkeiten ein zunehmendes Musikverständnis entwickelt, in dem also die technische Arbeit Hand in Hand geht mit der Ausbildung beispielsweise des Gehörs, des Rhythmusgefühls, der Ausdruckskraft und der musikalischklanglichen Gestaltungsfähigkeit. Ziel ist es, dass der Schüler auf jeder Lernstufe seine musikalischen und technischen Fähigkeiten einem lebendigen und ausdrucksvollen Spiel – improvisierend oder reproduzierend – nutzbar macht.
Allerdings bringen nur wenige Schüler die Fähigkeit mit, ihre Klangvorstellungen mühelos in Form „richtiger“, also funktioneller Musizierbewegungen auf das Instrument zu übertragen. In den allermeisten Fällen muss ein Weg gefunden werden, auf dem der Schüler die notwendigen spieltechnischen Fertigkeiten erwirbt, um sich auf dem Instrument seinen Wünschen und Möglichkeiten gemäß ausdrücken zu können. Für eine zumindest befriedigende spieltechnische Grundausbildung kann hier ein überschaubares Repertoire von exemplarischen Übungen und Etüden sorgen, welches zusammen mit effektiven Übemethoden zum Beherrschen der pianistischen Grundspielformen und Anschlagsarten, zur Unabhängigkeit der Hände sowie zu einer gleichberechtigt ausgebildeten linken Hand beiträgt.
Dennoch stehen technische Übungen heutzutage (noch immer) in schlechtem Ruf: Häufig wird befürchtet, die Schüler mit Fingerübungen zu vergraulen, werden solche Übungen grundsätzlich für überflüssig gehalten, oder es ist aufgrund eigener Defizite in der Ausbildung nicht klar, worauf es bei einer soliden spieltechnischen Ausbildung wirklich ankommt.
Vielleicht ist der schlechte Ruf der Fingerübung auch in dem geradezu unmenschlichen Drill der „schwarzen“ Instrumentalpädagogik zu suchen, die durch das im 19. und bis ins letzte Jahrhundert übliche Exerzieren aberhunderter Fingerübungen und Etüden ihren Schrecken verbreitete. Das umfassende Training pianistischer Grundspielformen wie Tonleitern, Arpeggien, Doppelgriffe etc. sowie der verschiedenen Anschlagstechniken hatte jedoch immerhin zur Folge, dass sämtliche gebräuchlichen Spielfiguren jederzeit – ob improvisierend oder beim Vortrag der Spielliteratur – auch auf hohem pianistischem Niveau abrufbar waren und schwierige Vortragsstücke in kürzester Zeit einstudiert werden konnten. So sollen alle namhaften Pianisten des 19. Jahrhunderts (u. a. Carl Czerny, Clara Schumann, Franz Liszt) regelmäßig das pianistische Vokabular in Form stetig variierender Passagenübungen trainiert haben.
Etwa in den 1970er-Jahren lenkten innovative pädagogische Konzepte, die sich auch die Erkenntnisse der kindbezogenen Lern- und Entwicklungspsychologie zunutze machten, den traditionellen Unterricht in eine andere Richtung: Experimentelle und improvisatorische Zugangsweisen zum Instrument, das Spiel mit freitonalen Klängen und Geräuschen, spielbezogene Lernmethoden und ein grundsätzlich autonomeres Verhalten des Kindes gegenüber den weniger ziel- als prozessorientierten Lerninhalten wurden nun in den Mittelpunkt gerückt (siehe z. B. die Klavierschulen von Klaus Runze2 bzw. Lili Kroeber-Asche und Guido Waldmann3).
Mit dem Einzug der „Spaßpädagogik“ in den Unterricht, also einer vorwiegend auf leichtes, schnelles und anstrengungsloses Lernen ausgerichteten Pädagogik, gerieten schließlich Fingerübungen und Etüden mehr denn je in Verruf – mit dem Effekt, dass vor allem klassischen spieltechnischen Fähigkeiten wie der Geläufigkeit oder der Anschlagsdifferenzierung immer weniger Beachtung geschenkt wurde.
Dass sich eine breit angelegte Technik allein mittels der Erarbeitung von Spielliteratur erwerben lässt, mag für (angehende) Profis gelten, wenngleich auch viele der heutigen Pianisten während ihrer Arbeit
2 Runze 1971
3 Kroeber-Asche/Waldmann 1979
2.3 Elementare Klaviertechnik
Der Elementarbereich spieltechnischen Lernens umfasst allgemein die Entwicklung einer Vielzahl zentraler körperlicher, geistiger, musikalischer, emotionaler und wahrnehmungsbezogener Fähigkeiten, die ein lebendiges Musizieren auch bereits im Anfangsunterricht ermöglichen.
Ausgehend vom Gesamtbereich der Klaviertechnik und dem Wissen um methodische Ansätze für das Bewegungslernen sowie die Bedeutung harmonisch koordinierter Bewegungsabläufe (s. Kap. 2.2, „Ganzheitliches“ Klavierspiel, S. 13) geht es bei der Ausbildung einer elementaren Spieltechnik um die Entwicklung allgemeiner körperlicher und bewegungstechnischer Voraussetzungen sowie den Aufbau spezifischer elementarer Bewegungsprogramme im Zusammenhang mit den grundlegenden pianistischen Spielformen. Dies wird im Folgenden aufgeführt. Die anschließende Übersicht über zentrale pianistische Spielweisen und Anschlagstechniken macht zusammen mit den detaillierteren Erläuterungen der Anschlagsarten in Kapitel 4.2 (Die Anschlagsarten, S. 32) sowohl die Bedeutung der Basisanschlagsarten für den weiteren spieltechnischen Aufbau als auch die Beziehung der Anschlagsbewegungen untereinander deutlich.
Wie bereits erwähnt, ist der Autorin das Problem der klaviertechnischen Fachbegriffe bewusst, sodass die – größtenteils verschiedenen Klaviermethoden entnommenen – Begriffe für die diversen Anschlagsarten als Angebot und weniger als eine „Indoktrinierung“ des Lehrers aufzufassen sind.
2.3.1 Lernziele und -inhalte elementarer Spieltechnik
Lernziele der elementartechnischen Ausbildung sind:
• das Hinlenken zu einer wohlgespannten körperlichen Grunddisposition
• das Einrichten und Regulieren der Sitzhaltung
• das Kennenlernen von Funktion und Bewegungseigenart der verschiedenen Spielhebel
• das Stabilisieren von Fingern und Hand
• das Verständnis für sinnvolle Fingersätze
• das Erlernen typischer Spielbewegungen: vertikale und horizontale, vor- und rückwärts gerichtete, später kreisende oder elliptische Bewegungsformen des Arms, vertikale, seitliche und kreisende Bewegungen des Handgelenks, Vertikal- und Seitenbewegungen der Finger, zusammenfassende Spielbewegungen, später Schwungbewegungen des Arms sowie die daraus entstehenden Anschlagsarten, Artikulationen und Dynamiken
• das Bilden elementarer Koordinationen wie die innerlich gefühlte Verbindung „Finger – Schulter“ und die Fixierung der Fingergelenke bei gleichzeitig „durchlässigen“ Armgelenken einschließlich des Handgelenks
• das Konditionieren der Finger: Stützfähigkeit, Druckkraft, Beweglichkeit in den Grundgelenken und Unabhängigkeit einzelner Finger
Leseprobe Sample page
• die Arbeit an der Koordination der Hände und ihrer Unabhängigkeit voneinander (in Bezug auf Rhythmus, Dynamik, Artikulation und Anschlagsbewegung)
• das Automatisieren von Bewegungsabläufen
• das Entwickeln einer elementaren Geläufigkeit, verstanden als gleichmäßiges, mäßig schnelles, einfaches Passagenspiel
• das Hinlenken zu organischen, „ganzheitlich“ koordinierten Spielbewegungen
• das Sensibilisieren für klangliche und anschlagstechnische Unterschiede
• das Erlernen der pianistischen Grundspielformen (s. im Folgenden)
• die Anleitung zur Selbstwahrnehmung, besonders in Bezug auf Körpergefühl, Bewegungsempfindung und inneres sowie äußeres Hören
• das Bewusstmachen des Zusammenhangs von Spielbewegung und Klangergebnis
• das Sensibilisieren für die Einheit von Denken, Fühlen und körperlichem Handeln
Fingerbewusstsein und Muskeltraining für die Hand (im Sitzen/am Tisch)
• Fingerraten: S streckt auf Zuruf von L jeweils den genannten Finger mit geschlossenen Augen hervor. Die Fingerhaltung spielt dabei keine Rolle.
• Explosion: S macht eine Faust und streckt „explosionsartig“ seine Finger auseinander (mehrmals hintereinander).
• Fingerkette: S spreizt aus der gestreckten Handhaltung heraus z. B. den 2. Finger einer Hand ab und hält ihn unbeweglich gestreckt. Nacheinander schließen die anderen Finger auf.
• Fächer: S spreizt seine Hand so weit wie möglich, hält diese Position etwa sieben Sekunden und entspannt die Hand wieder; mehrmals wiederholen.
• Ausgangshaltung wie in Fächer: Jeder Finger macht kreisende Bewegungen, seitliche Bewegungen (weg vom Nebenfinger und wieder heran) sowie vertikale Bewegungen.
• Vogelschnabel: S bildet mit seinem Daumen und jeweils einem anderen (runden) Finger der Hand einen „Vogelschnabel“, indem dieser mit seinem Fingerpolster auf den Daumen drückt (Arm gleichzeitig leicht hin und her schlenkern, um einer eventuellen Verspannung vorzubeugen).
• Kraftsport: S drückt mit seinem Daumen und jeweils einem anderen (runden) Finger einen kleinen Ball zusammen.
• Klavierhand II: S streckt seine Hand nach oben. Der gestreckte 5. Finger wird waagerecht zum Handteller geführt, sodass beide zusammen einen spitzen Winkel bilden und der Kleinfingerballen sichtbar kontrahiert ist. Die Finger 2–4 werden anschließend gebeugt, der Arm hängt passiv herab und führt einige schlenkernde Bewegungen aus.
• Fühlende Finger: S führt mit „fühlenden“ Fingern verschiedene Bewegungen auf der Tischplatte aus: tupfen, gleiten, zupfen, streiche(l)n, klopfen etc. Bewusst fühlt S sich dabei in seine Fingerpolster hinein.
• Krake: S legt seine Hand flach auf: Die Fingerballen der Finger 2–5 „saugen“ sich mit einem leichten Heranziehen an der Tischplatte fest – wieder lösen.
• Raupe: wie bei Krake, nach dem „Ansaugen“ der Fingerballen aber schiebt sich die Handwurzel an diese heran. Danach streckt sich die Hand erneut aus, die Finger „saugen“ sich fest usw.
• Känguru: S stößt die Hand mit zwei Fingern ab und landet elastisch auf diesen beiden, stößt sie wieder ab usw.
• Frosch: Die Hand liegt entspannt auf dem Tisch, stößt sich in einer abrollenden Schwungbewegung ab und landet flach ein Stück weiter vorne.
• Storch: Zwei Finger „stolzieren“ steil aufgestellt mit möglichst wenig durchgedrückten Fingerendgelenken.
• Buntspecht: Daumen und ein anderer Finger der Hand bilden einen „Vogelschnabel“ (s. Vogelschnabel ). Die Hand führt schnelle Klopfbewegungen aus dem Handgelenk heraus, ohne dass der Arm mitgeht.
Leseprobe Sample page
• Krabbe: Zwei Finger (der Daumen und jeweils einer der anderen Finger) laufen mit Unter- und Übersatzbewegungen wie beim Tonleiterspiel seitwärts hin und her.
Die Hand liegt in Spielhaltung auf dem Tisch, der Unterarm liegt auf:
• Der Finger „fällt“: S hebt nacheinander jeden Finger (in gebeugter Haltung) und lässt ihn entspannt fallen.
• Spiralfeder: S drückt bei der Abwärtsbewegung des Fingers langsam und kraftvoll eine vorgestellte Spiralfeder oder ein kleines Schaumstoffkissen hinunter (Schulter und Arm bleiben gelöst). Die nicht beteiligten Finger dürfen sich frei mitbewegen.
• Nasser Sand: Jeweils ein Finger drückt sanft auf die Tischplatte, so, als würde er sich in nassen Sand bohren. Die anderen Finger bleiben entspannt.
4 Zu den Schülerheften
4.1 Übungen und Etüden
Die Übungen und Etüden von Wache Finger, wache Ohren verfolgen das Ziel, universal anwendbare Grundspielformen, etwa Fünftonfolgen, Sequenzen, Akkorde etc. sowie die dafür geeigneten Spielbewegungen und Anschlagsarten als eine Art „Vokabular“ der elementaren Spieltechnik zu vermitteln. Sie sollen helfen, die Voraussetzungen für die Bewältigung leichter Klavierliteratur aller Epochen zu schaffen. Besonderer Wert wurde auf die Entwicklung der Unabhängigkeit der Hände voneinander in Bezug auf verschiedene spieltechnische Aufgaben, beispielsweise für die Bewältigung des polyphonen Spiels, gelegt.
Die den Etüden vorangestellten Übungen repräsentieren in exemplarischer Weise das jeweils im Mittelpunkt stehende spieltechnische Thema und beleuchten durch spezifische Varianten des Übungsmaterials, aber auch seiner Ausführung die wesentlichen Aspekte einer Aufgabe. Häufig werden im Anschluss an die anfänglichen Hauptübungen weitere, aus diesen abgeleitete Übungsformeln angeboten, die in gleicher Weise erarbeitet werden sollen.
Aus Platzgründen wurden die aus den Hauptübungen abgeleiteten Übungsformeln nicht immer ausnotiert, ebenso wurde darauf verzichtet, alle Übungen auch für die jeweils andere Hand auszunotieren. Es werden jedoch Hinweise gegeben, in welcher Weise eine Übung auf die andere Hand zu übertragen ist, z. B. spiegelbildlich und/oder oktaviert. Gelegentlich wird der Schüler hierbei die Hilfe seines Lehrers benötigen.
Das Mitdenken wird auch bei allen Sequenzübungen gefordert: Hier wird nur anfangs angegeben, welches Motiv in welcher Weise fortgeführt werden soll.
Manche am Ende offene Übung oder Etüde ermuntert den Schüler dazu, eigene Ideen für deren Fortsetzung einzubringen bzw. neue Kombinationen einer Spielfigur herauszufinden. Um den Lerneffekt zu steigern, sollten unbedingt bei der Erarbeitung auch die türkis gesetzten alternativen Fingersätze berücksichtigt werden. Musiktheoretische Begriffe – z. B. die Bezeichnungen von Intervallen, Akkorden und Akkordfolgen – können ggf. vom Lehrer genauer erläutert werden.
Die kurzen, musikalisch abwechslungsreichen Etüden vertiefen das vorangestellte Übungsmaterial und bereichern es um diverse Nuancen hinsichtlich der musikalisch-klanglichen Gestaltungsmittel Dynamik, Artikulation, Phrasierung, Tempo und ggf. Pedal. Damit kann der aus der Arbeit an den Übungen erzielte funktionell-technische Fortschritt unmittelbar einer differenzierten musikalischen Gestaltung nutzbar gemacht werden. Bewusst sind die Etüden kurz gehalten und für den Schüler strukturell fasslich konzipiert, soll der Lernaufwand doch möglichst klein und die Spielfreude dafür umso größer sein!
Leseprobe Sample page
Soweit es spieltechnisch vertretbar war, wurden in vielen Etüden neben einfachen diatonischen Durund Mollskalen auch andere Klangräume einbezogen wie die Ganztonskala, Pentatonik, Chromatik und bitonale Strukturen. Ein großes Kreuz oder B als Vorzeichnung zeigt an, dass eine Stimme oder das ganze Stück (z. T. optional) ausschließlich auf schwarzen Tasten ausgeführt werden soll. So wird das Spiel auf diesen von Anfang an in die elementartechnische Ausbildung einbezogen.
Die Etüden wurden so angelegt, dass regelmäßig verschiedene Spielformen zusätzlich zum jeweils aktuellen Übestoff eines Kapitels wieder aufgegriffen bzw. vertieft werden. Diese sind:
• ablösendes/übergreifendes/spiegelbildliches/paralleles Spiel der Hände
• Lagenwechsel aller Art
• Repetition
• Seitwärtsbewegungen einzelner Finger
• (stummer) Fingerwechsel
• Spiel auf den schwarzen Tasten
• unabhängiges Spiel beider Hände
• polyphones Spiel
• Pedalisierung
Obwohl das Übungsmaterial überwiegend progressiv angeordnet ist, gibt es vielfältige Möglichkeiten der Anwendung:
Abgesehen von Kapitel 1 in Heft 1 (Töne bilden) kann es zum Beispiel sinnvoll sein, die Reihenfolge der Kapitel aus individuellen Gründen zu ändern, gleichzeitig an zwei Kapiteln zu arbeiten oder nur einige Übungen und/oder Etüden eines Kapitels in das individuelle Unterrichtsprogramm aufzunehmen, um z. B. ein aktuelles spieltechnisches Problem anzugehen. Auch kann gelegentlich auf bereits erarbeitete Übungen unter neuen Gesichtspunkten zurückgegriffen werden. Konditionsverbessernde Übungen zum Beispiel können nach deren Erarbeiten weiterhin mitlaufen, bis die nächste Schwierigkeitsstufe mit anderen Varianten oder neuem Übestoff erklommen werden kann.
Leseprobe Sample page
Die Auseinandersetzung mit einem spieltechnischen Thema kann durch vielfältiges Variieren vertieft werden. Diese bekannte Übemethode (s. auch Kap. 4.3.1, Das Üben mit Varianten, S. 40) wird in Form diverser allgemeiner Varianten, beispielsweise in Bezug auf Dynamik, Rhythmus, Artikulation, Betonung und Tonart, nahegelegt, die sich jeweils im Einleger der Hefte finden. Dazu regen die neben dem entsprechenden Logo (s. Legende S. 4) notierten Hinweise an, die über vielen Übungen und Etüden stehen. So kann der Schüler auch selbstständig den Übestoff zu Hause variieren. Allerdings muss nicht jede Übung mit jeder möglichen Variante erarbeitet werden, das wäre viel zu zeitraubend und ermüdend! Eher sind die Varianten als Anregung gedacht, aus denen für jede Übung eine individuelle Auswahl getroffen werden kann. Die Erläuterungen der im Einleger aufgeführten Anschlagsarten wurden zum besseren Verständnis des Schülers sprachlich bewusst vereinfacht. Eine sinnvolle Auswahl der für das spieltechnische Training geeigneten Anschlagsarten kann im Allgemeinen jedoch nur der Lehrer treffen; deswegen gibt es für den Schüler hierfür keinen Hinweis neben dem Logo. Die gelegentlich an den Schüler gerichteten Fragen oder Hinweise (Übetipps) im Übungsteil sollen diesen vor allem zur Selbstwahrnehmung in Bezug auf Bewegungsgefühl und Klanggestaltung anregen, während die den Heften vorangestellten 16 Tipps zum erfolgreichen Üben dem – schon selbstständig arbeitenden – Schüler Allgemeines zum Lernen und strukturierten Vorgehen an die Hand geben. Da vor allem die Übungen lediglich eine Art Rohmaterial sind, kann der Lehrer sie innerhalb des Unterrichts mit unterschiedlichem Anspruch in Bezug auf Präzision, Tempo, differenzierte Dynamik und Artikulation usf. einsetzen. Insofern spielt auch weniger das Alter des Schülers eine Rolle, vielmehr sind seine spieltechnischen Möglichkeiten entscheidend. Grundsätzlich sollte der Lehrer auch berücksichtigen, dass Kinder intuitiver und „ganzheitlicher“ denken, fühlen und handeln als Jugendliche oder Erwachsene: Für sie sollte mit einfachen Worten, anschaulichen Vorstellungshilfen sowie einer genauen, modellhaften Ausführung auf die wesentlichen Aspekte beispielsweise einer Spielbewegung aufmerksam gemacht werden statt mit anschlagstheoretischen Überlegungen! Bewegungsanweisungen werden umso lernfördernder sein, je mehr sie Phantasie und Spielfreude des Kindes anregen, beispielsweise durch das Formulieren einer Aufgabe als Geschicklichkeitsspiel, „Wettkampf“ zwischen den Fingern einer Hand oder Spiel mit Tieren, die sich auf verschiedene Weise fortbewegen (siehe z. B. den Schmetterling in Kap. 1 des ersten Heftes).
Der Lerneffekt der Übungen und des spieltechnischen Trainings ergibt sich vor allem aus dem Transfer auf die Musikstücke und der bewussten Arbeit an deren klanglich-technischen Bewältigung. Deswegen sollte der Lehrer stets dafür sorgen, dass jede erarbeitete funktionale Spielbewegung sogleich in einen entsprechenden musikalischen Zusammenhang gestellt und letztlich zu einer dem Ausdruck dienenden Musizierbewegung wird.
4.2 Die Anschlagsarten
Im Folgenden werden die Anschlagsarten erläutert, die die Entwicklung der Spieltechnik bestimmen. Zunächst geht es um die elementaren Anschlagsarten innerhalb der Arm- und Fingertechnik, anschließend werden die aus diesen Techniken koordinierten Spiel- bzw. Schwungbewegungen dargestellt.
4.2.1 Armspiel
Das Arm-/Unterarm-Portato (Heft 1, Kap. 1–4, 6 / Heft 2, Kap. 4–6) 2–5
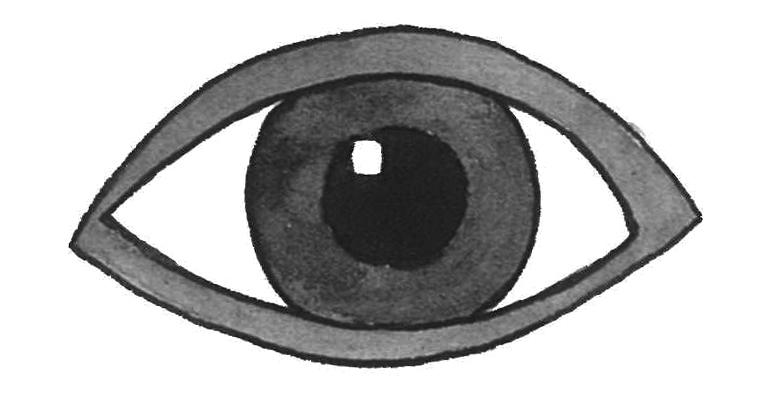
Die aktiv geführte, ruhige Anschlagsbewegung des Arms im Arm-Portato lässt sich durch die gegenläufige Zugkraft der Muskeln des Rückens, der Schultern und der Brust hervorragend kontrollieren. Diese mächtigen Muskeln ermöglichen äußerst feine, präzise Bewegungen des Armes aus dem Schultergelenk. So führt der Arm sicher und ruhig die Hand, je nach Spieltempo mit mehr oder weniger ausladender Bewegung. Gleichzeitig kann er seine Anschlagskraft von der Minimalbelastung („leichter“ Arm) über alle Zwischenstufen bis hin zur Maximalbelastung der Finger („schwerer“ Arm durch Einsatz von Gewicht und Druckenergie) präzise dosieren. Es gelten folgende Voraussetzungen, die auch durch die vorinstrumentalen Übungen des Kapitels 3 erworben werden können:
• koordinierte Gesamtbewegung von Arm, Hand und Spielfinger aus der Schulter
• Standfestigkeit des Spielfingers (durch Fixieren der Fingergelenke) bei größtmöglicher Entspannung der Arm- und Schultermuskulatur
• richtige Handposition (leicht nach innen geneigt mit etwa gleicher Höhe der Fingergrundgelenke)
• Elastische Fixierung, später Flexibilität bzw. Nachgiebigkeit des Handgelenks
Anschlag mit elastisch fixiertem Handgelenk
Um die Anschlagsbewegung der „großen Gelenkbrücke“ (Wieland/Uhde) Arm – Hand – Finger und die damit verbundene elastische Fixierung aller beteiligten Gelenke spürbar zu machen, ist es anfangs sinnvoll, das Arm-Portato mit unbewegtem Handgelenk und großer Bewegung in Zeitlupe ausführen zu lassen. Voraussetzung hierfür ist die Fixierung aller Gelenke zwischen Kraftquelle (Rücken- und Schultermuskulatur) und Anschlagspunkt (Fingerendgelenk). In dieser Spielart wird das Arm-Portato den sogenannten „isolierten“, mit „einarmigem“ Hebel ausgeführten Anschlagsbewegungen zugerechnet. Diese sind im Allgemeinen leichter auszuführen als koordinierte Anschlagsbewegungen, bei denen mehrere Hebel am Anschlag beteiligt sind.
Anschlag mit flexiblem Handgelenk
Leseprobe Sample page
Vielen Schülern gelingt es häufig erst sehr viel später, die anschlagsverlängernde Funktion des Handgelenks im Moment des Anschlags zugunsten einer weicheren Tonqualität zu nutzen, ohne dabei die Stabilität des spielenden Fingers zu vernachlässigen.
Die – von dem berühmten russischen Pädagogen Heinrich Neuhaus und auch von Renate Wieland als Urbewegung bezeichnete – Spielbewegung des Arm-Portatos mit flexiblem bzw. nachgiebigem Handgelenk entspricht im übertragenen Sinn dem organischen Verlauf eines gesungenen Tons:
• Arm mit gelöster Hand hebt sich, holt aus (= Einatmen)
• Der Ton wird geformt: Arm sinkt mit nachgiebigem Handgelenk in die Taste und hebt sich anschließend mit gelöster Hand aus der Taste (= Ausatmen)
Diese Urbewegung vollzieht sich in einer Bewegungsgestalt und entspricht dabei dem Prinzip der Balance von Impuls und Auslösung (Wieland/Uhde), von Spannung und Entspannung. Gleichzeitig bezieht der Bewegungsfluss das Tongeschehen organisch ein: In der geschmeidigen, je nach gewünsch-
ter Tonintensität mehr oder weniger energischen Abwärtsbewegung von Arm und nachgiebigem Handgelenk zum Tastenboden und etwas über diesen hinaus entsteht der Ton (Spiel in der Taste genannt wegen des intensiven Kontakts des Fingerpolsters zum Tastenboden). So organisch, wie dieser nach seinem gehörten oder vorgestellten Kulminationspunkt wieder abschwillt, so organisch ist auch das Nachlassen der Muskelarbeit, sichtbar am zunehmend entspannten und dabei zeitlich der gewünschten Tondauer angepassten Sich-aus-der-Taste-Heben des Arms mit gelöster Hand. Am unteren Umkehrpunkt der Anschlagsbewegung vollzieht sich nicht allein eine rein vertikale Aufwärtsbewegung von Arm und Handgelenk, sondern eine sanfte Handgelenksdrehung nach außen zusammen mit einer halbkreisförmigen Bewegung des Arms bzw. des Ellenbogens. So ist die Anschlagsparabel an keiner Stelle unterbrochen oder eckig, sondern im Gegenteil rund und in ihrer fließend-organischen Qualität nur der äußere Ausdruck lebendiger Tonvorstellung und eng damit verwobener Muskelarbeit.
Wurde dieser Bewegungsablauf gelernt, kann die Senkbewegung des Arms unmittelbar von der Taste erfolgen und für etwas schneller zu spielende Tonfolgen der Anschlagshebel verkürzt werden – der Niederdruck der Tasten erfolgt durch den Unterarm, nun Unterarm-Portato genannt.
Das Arm-/Unterarm-Staccato (Heft 1, Kap. 1–4, 6 / Heft 2, Kap. 4–6)

6–8
Das Arm-Staccato unterscheidet sich vom Arm-Portato nur durch eine schnellere Anschlagsbewegung und einen kürzeren Tastenkontakt (Spiel über der Taste).
In einem langsamen Tempo kann das Staccato mit dem ganzen Arm, in schnellerem Tempo mit dem Unterarm als Anschlagshebel ausgeführt werden (in beiden Fällen mit elastisch fixiertem oder flexiblem Handgelenk).
Während es im langsamen Spiel von Staccato-Tönen weniger auf die Bewegungsökonomie ankommt (hier sind von der Taste hochschnellende, repulsive Anschlagsbewegungen des Arms bzw. Unterarms zur besseren Klangkontrolle sinnvoll), sollte im Hinblick auf ein funktionierendes Staccato-Spiel in einem zügigeren Tempo von vornherein auch auf die von oben erfolgenden, direkt auf den Tastenboden gerichteten Anschlagsbewegungen des Unterarms Wert gelegt werden. Diese können im perkussiven Spiel zu hammerschlagähnlichen Bewegungen werden. Eventuelle - im Zusammenhang mit den vertikalen Impulsen des Unterarms auftretende - Anschlagshärten kann das elastisch federnde Handgelenk abmildern.
Grundsätzlich kann mit der kontinuierlich geführten Armbewegung von Taste zu Taste im Spiel von Portato- oder Staccato-Tonfolgen vermittelt werden, dass der organische Bewegungsfluss auch bei Lagenwechseln möglichst nicht unterbrochen werden sollte Ein angstfreies Umgehen mit Distanzen auf der Tastatur und im Luftraum über ihr legt zugleich die Grundlagen für eine Weiterentwicklung dieses natürlichen Bewegungsmusters hin zu einer guten Sprungtechnik.
Leseprobe Sample page
(Die schnelle Repetition mit Unterarm/Hand (Heft 2, Kap. 5))
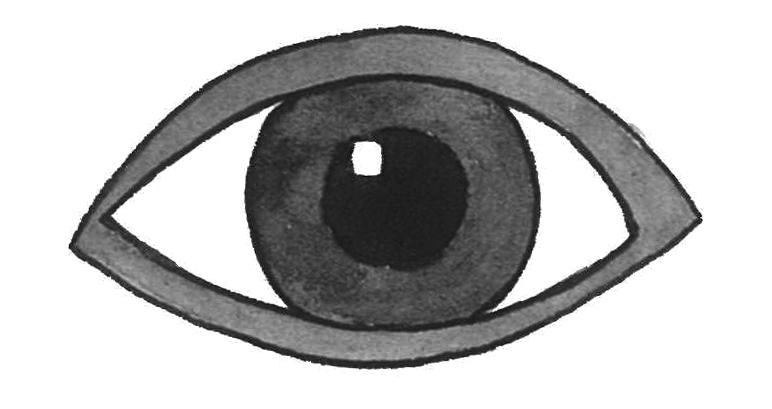
9
Für das schnelle Repetieren kann der Unterarm seine Energie zusammen mit der Hand in Form einer aus diesen beiden Hebeln zusammengesetzten Anschlagsbewegung in die Tasten übertragen. Dabei wird auf einen vertikalen Impuls des Unterarms hin ein Anschlag oder werden mehrere Anschläge der Hand ausgelöst. Ähnlich wie bei einer Fliegenklatsche wirkt sich dabei der Hauptimpuls des Unterarms als des größeren Hebels beschleunigend auf die Hand als den kleineren, vorderen Hebel aus. Diese Anschlagsbewegung eignet sich zugleich für schnelle Lagenwechsel. Da sie einer höheren Lernstufe vorbehalten ist, wird sie in Kap. 6.5 nur in elementarer Form (optional) eingeführt (s. zu Etüde 2 Kastagnetten S. 85).
5 Zu den Kapiteln von Schülerheft 1
Im Folgenden werden zunächst die Lernziele und -inhalte der einzelnen Kapitel aufgeführt und im Anschluss daran die entsprechenden Arbeitsschritte methodisch und didaktisch erläutert. Gleichzeitig mit der Erläuterung der Übungen und Etüden werden Hinweise auf die zu erarbeitenden Spieltechniken gegeben, die jedoch stets in Zusammenhang mit Klangvorstellung und -bildung gesehen werden.
Die Erläuterungen zum Kapitel 1 nehmen vergleichsweise viel Platz ein, da es hier um die Vorstellung bzw. Erarbeitung der Basisanschlagsarten und damit um die Grundlagen für den gesamten spieltechnischen Aufbau geht.
Einige inhaltliche Wiederholungen in den Kommentaren haben mit der Wichtigkeit bestimmter spieltechnischer Aspekte zu tun, die bei der Erarbeitung jeweils erneut berücksichtigt werden sollten. Gleichzeitig soll damit dem Lehrer ein Zurückblättern erspart werden.
5.1 Kapitel 1 – Töne bilden (Elementare Anschlagsübungen)
Lernziele und -inhalte
• elementare Tonbildung durch ununterbrochene, einfache und runde Anschlagsbewegungen
• Anschlagsarten: Arm-Portato, Arm-Staccato, neutrales Finger-Legato, je nach Stand des Schülers die zusammenfassende Spielbewegung
• „ganzheitliche“ Koordination durch Gesamthebel Finger bis Schulter
• Funktionen des Handgelenks: elastisch fixiert – flexibel
• Stabilität der Fingergelenke (bei gleichzeitig „freiem“ Arm)
• Eigenbewegung des Spielfingers
• Gesetzmäßigkeiten des Anschlags
• „Modulierbarkeit“ des Tons durch anschauliche Vorstellungshilfen
• bewusste Kontrolle von Tonlänge und Tonstärke
• Selbstwahrnehmung in Bezug auf Bewegungsgefühl und Tonqualität (Klangfarbe)
Armspiel mit einem Finger (Portato – Staccato) _ Heft 1, S. 5
Leseprobe Sample page
Folgende Voraussetzungen sollten durch vorbereitende Übungen mit dem Schüler gegeben sein bzw. bei auftretenden Schwierigkeiten immer wieder geschaffen werden (s. Kap. 3, Vorinstrumentale Übungen, S. 22):
• Vertrautsein mit den Gegebenheiten des Instruments und Orientierung auf der Tastatur
• bewusstes Wahrnehmen von Spannung und Entspannung der Rücken-, Schulter-, Armmuskulatur
• unverkrampft aufgerichtete Sitzposition
• die ruhig geführte vertikale Bewegung des Arms
• „richtige“ Handposition (leicht nach innen gedreht mit etwa gleicher Höhe aller Knöchel der Mittelhand)
• Standfestigkeit von Fingern (besonders Endgelenk) und Hand
Zu den Übungen
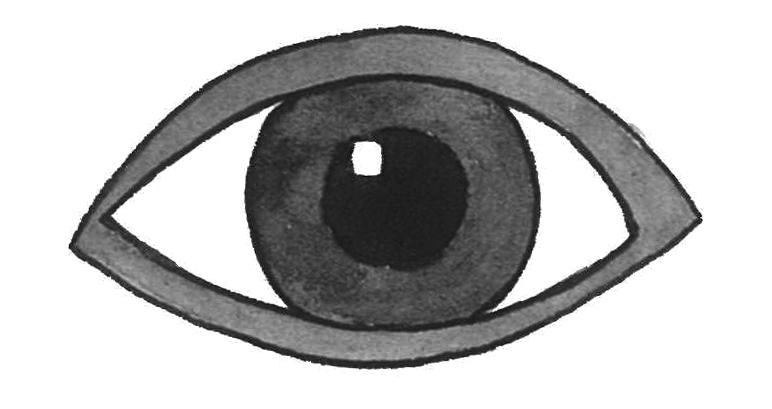
Das Arm-Portato mit elastisch fixiertem Handgelenk 2 Es empfiehlt sich, die ersten Anschlagsübungen mit dem ganzen Arm und zunächst elastisch fixiertem (aber nicht starrem, verkrampftem!) Handgelenk auszuführen, um die Anbindung des Spielfingers an den Arm deutlich spürbar zu machen. Sich ergebende Anschlagshärten können (eventuell später) durch das flexible, durchlässigere Handgelenk ausgeglichen werden (s. S. 44). Das Erreichen des Tastenbodens sollte bewusst gespürt werden, der Hinweis auf ein wenig „Haftung“ (aber ohne Nachdruck!) lenkt die Aufmerksamkeit auf die Empfindung im Fingerpolster.
Um sicherzustellen, dass der Anschlag nur durch die aus der Schulter geführte, langsame Senkbewegung des Arms in die Taste erfolgt, hilft es, diese probeweise mit gestrecktem Arm auszuführen.
Übung 1 2
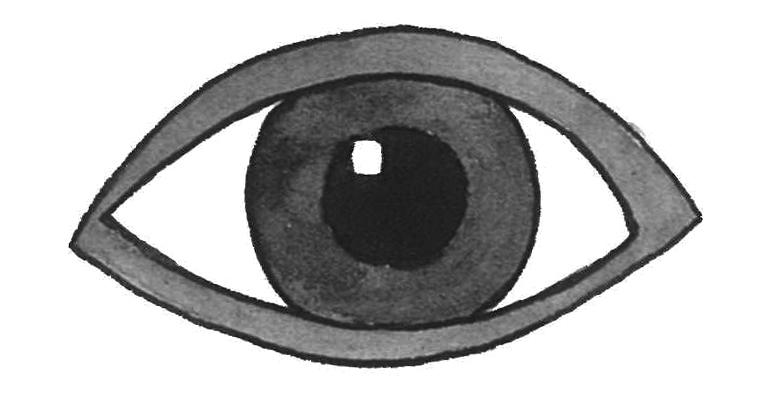
Assoziation: Ein Schmetterling lässt sich mehrmals auf einem Blatt nieder Der Schüler spielt einen Ton (mehrmals) mit einer ruhigen, geführten Armbewegung aus ca. 10–15 cm Höhe. Die ununterbrochene Anschlagsbewegung strebt direkt, langsam, aber mit unveränderter Geschwindigkeit dem Tastenboden zu, mit dem Berühren der Tastenoberfläche sollte die Bewegung also nicht abgebremst werden. So soll der Schüler von Anfang ein Gefühl für eine ökonomische (physiologisch richtige, organische) Spielbewegung bekommen, die ebenso ununterbrochen fließt wie der in der Vorstellung und sogleich auf dem Instrument entstehende Ton. Zur Verstärkung kann dieser auch mitgesungen werden. Das Zeichen soll hier und in allen folgenden Kapiteln die Anschlagsbewegung des Arms verdeutlichen.
Gerade am Anfang sollten die Töne in ruhigem Tempo als ganze Noten und p gespielt werden, sodass genug Zeit für die Hörkontrolle und Bewegungsempfindung bleibt. Damit jeder Finger an den Arm „angeschlossen“ wird, sollte diese Einzeltonübung nicht nur mit den starken Fingern 2 und 3, sondern auch mit allen übrigen ausgeführt werden. Wenn sich der Arm wieder aus den Tasten hebt, die Handstellung unverändert lassen, damit die Koordination zwischen Fingern, Hand und Arm nicht verloren geht, der Finger also permanent als Verlängerung des Arms empfunden wird.
Übungen 2 und 3 2
Leseprobe Sample page
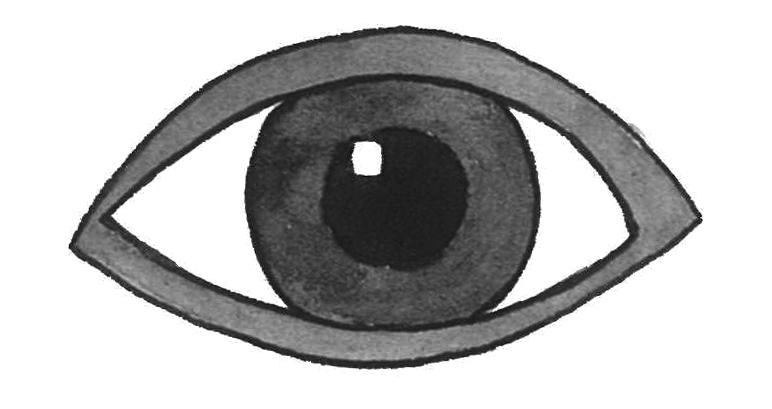
Assoziation: Der Schmetterling fliegt von einem Blatt zum anderen, anschließend von einem Strauch zum nächsten
Nachdem anhand der Tonwiederholungen in Übung 1 die rein vertikalen Anschlagsbewegungen des Arms erprobt wurden, werden diese mit kleineren, anschließend größeren Lagenwechseln, also (horizontalen) Seitenbewegungen verbunden, sodass ausgedehntere bogenförmige Spielbewegungen entstehen (im Heft mit gekennzeichnet). Dabei wird vermittelt, dass auch Lagenwechsel möglichst nicht den organischen Bewegungsfluss unterbrechen sollten.
Im Verlauf dieser Übungen probiert der Schüler Varianten aus: So soll zunächst das Spielen dynamisch unterschiedlicher Töne bewusst machen, wie Tonstärke, Anschlagsgeschwindigkeit und das entsprechende Muskelgefühl zusammenhängen. Gleichzeitig kann hier schon die Wahrnehmung für einen „schönen“ Ton wachgerufen werden, der ja nicht nur eine mittlere, tragfähige Lautstärke, sondern auch einen geräuscharmen Anschlag erfordert. Anschließend kann der Schüler andere Tonfolgen (auch mit schwarzen Tasten) finden und zudem vorsichtig das Tempo steigern (s. Varianten).
Mehr Aufmerksamkeit wird er diesen Bewegungsvorgängen schenken, wenn die Übungen in kurze Improvisationen eingebunden werden. Neben dem Schmetterling können weitere fliegende, hüpfende oder springende Tiere wie Vogel, Floh und Känguru herangezogen werden, deren Bewegungen
6.6 Kapitel 6 – Unabhängige Hände und Finger
Lernziele und -inhalte
• Unabhängigkeit der Hände in Bezug auf Rhythmus, Artikulation, Dynamik
• Unabhängigkeit der Hände im polyphonen Spiel
• Unabhängigkeit der Finger einer Hand in Bezug auf Rhythmus, Artikulation, Dynamik
• Zweistimmigkeit in einer Hand
• Anschlagsarten: Arm- und Unterarm-Portato (-Staccato), zusammenfassende Spielbewegung, neutrales/fingeraktives Legato, Finger-Staccato, Gewichts-Legato, Arm-Legato
Unabhängige Hände _ Heft 2, S. 54
Zu den Übungen
Artikulation _ Heft 2, S. 54
Die Voraussetzung für die Übungen 1 und 2 ist die Fähigkeit, in der einen Hand legato, in der anderen gleichzeitig staccato zu spielen. In Übung 1 muss nun jeweils eine Zweierbindung mit nachfolgendem Staccato-Ton gegen eine Dreierbindung gespielt werden. Dabei sollte im beidhändigen Spiel jede Hand zumindest ihre Zweierbindung jeweils mit zusammenfassender Spielbewegung ausführen können, bis im zweiten Schritt auch die Dreierbindung in derselben Weise von der jeweils anderen Hand gespielt werden kann. Um zu vermitteln, dass es hier allein auf die anschlags- und bewegungstechnischen Unterschiede im Zusammenspiel der Hände und nicht auf zügiges Spiel ankommt, wurden diese Übungen in ruhigen Notenwerten (Vierteln und Halben) notiert.
In der Übung 2 wird die Zweierbindung einem Staccato (mit Unterarm-Staccato zu spielen) gegenübergestellt, anschließend der schnelle Wechsel dieser Spielarten im Gegeneinander der Hände gefordert.
Dabei empfiehlt sich ein Vorgehen in folgenden Schritten:
1. einzelnes Üben jeder Hand
2. stummes gleichzeitiges und sehr langsames Spiel beider Hände auf dem Tastendeckel mit übertriebenen Spielbewegungen, um sicht- und fühlbar zu machen, wo welche Hand im Gegensatz zur anderen gehoben wird
Leseprobe Sample page
3. die zusammenfassenden Bewegungen im Hinblick auf die später geforderte Dynamik der Artikulationsbögen mit den entsprechenden Handgelenksbewegungen im stummen Spiel herausarbeiten; die Staccato-Töne der deutlicheren Unterscheidbarkeit wegen aus dem Unterarm, also nicht aus den Fingern spielen
4. die zuvor stumm geübten Bewegungsabläufe auf die Tasten übertragen, zuerst wieder einzeln, dann mit jeweils einer stumm spielenden Hand zum klingenden Spiel der anderen; alles in sehr langsamem Tempo und zur besseren Selbstwahrnehmung mit weiterhin übertriebenen Spielbewegungen und deutlichem Anschlag
Dynamik
_ Heft 2, S. 54
Die Übung 1 verlangt das gleichzeitige Spiel unterschiedlicher Dynamiken: Während eine Hand Tonwiederholungen im Pianissimo spielt, muss die andere dynamische Verläufe im CrescendoDecrescendo spielen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten der Ausführung: Für ein langsames Tempo eignet sich für beide Hände das Spiel aus dem Arm, d. h. für die Tonwiederholungen ein dicht an den Tasten gespieltes Arm-Portato oder -Staccato, für die Legato-Stimmen das Arm-Legato zur
besseren Kontrolle des Tastenniederdrucks für jeden einzelnen Ton. Erst im zweiten Schritt und in mäßig schnellem Tempo können die Legato-Bögen im Finger-Legato mit zu- bzw. abnehmendem Gewicht gegen das Non-Legato der anderen Hand gespielt werden. Die anschlagstechnischen Hürden der Übung 2 dürften nicht gleich im ersten Anlauf genommen werden können, sind aber langfristig zu wichtig für das polyphone Spiel, als dass sie unter den Tisch fallen sollten. Hier wird das imitierende Phrasieren der Hände geübt, wobei das Ende der einen Phrase dynamisch jeweils gegensätzlich zum Anfang der von der anderen Hand gespielten Phrase gestaltet werden muss. Da die Hauptschwierigkeit im Bewältigen dieses Moments liegt, kann sie nach anfänglichem Üben der einzelnen Hände folgendermaßen überwunden werden: Der Schüler entscheidet sich für eine der beiden Dynamiken (rot oder blau) und spielt zunächst nur bis zum ersten Viertel des zweiten Taktes mit der klaren Absicht, diese beiden Zieltöne dynamisch deutlich (übertrieben) voneinander zu unterscheiden. Um genauer nachzuhören und nachzufühlen, hält der Schüler hier auch inne, bevor wiederholt wird. Gelingt die deutliche Unterscheidung der Zieltöne allmählich, wird genauso von Takt 2 bis in den Anfang von Takt 3 gespielt. Nun wird die Etappe vergrößert: Der Schüler spielt von Takt 1 bis zum Anfang von Takt 3 etc. Anschlagstechnisch gilt dasselbe wie für die Legato-Stimmen in Übung 1.
Spielt der Schüler auf einer höheren Lernstufe mit der zusammenfassenden Spielbewegung der Arme, wird beim Ausführen der blau markierten Dynamik (decrescendo zum Bogenende) im Zusammenspiel der Bewegungsunterschied der Handgelenke deutlich sichtbar (und hörbar): Hebt sich das Handgelenk der einen Hand aus den Tasten, senkt sich das andere hinein. Bei der rot markierten Dynamik geht es um eine Variante der zusammenfassenden Spielbewegung (crescendo zum Bogenende hin bzw. betontes Ende), die nun durch zunehmende Druckenergie und ein Abstemmen von der Taste bestimmt ist.
Rhythmus _ Heft 2, S. 55
In den beiden Übungen dieses Abschnitts wird die rhythmische Unabhängigkeit der Hände trainiert: Während die eine Hand ein rhythmisch unkompliziertes Ostinato spielt, muss die andere dazu einige durchaus vertrackte Rhythmen ausführen (die Vorgehensweise ist im Heft erläutert). Zumindest auf der unteren Lernstufe ist es nicht erforderlich, dass der Schüler alle Rhythmen hintereinander bewältigt. Wenn zunächst der eine oder andere Takt erarbeitet wird, reicht dies vollkommen. Auf einer höheren Lernstufe sollten zunächst z. B. zwei, dann vier Takte, danach beide Übungen hintereinander gespielt werden können, was nun ein schnelles Umdenken bzw. Vorausdenken erfordert.
Zu den Spielstücken
Leseprobe Sample page
Die fünf Stücke dieses Übungsteils behandeln das unabhängige Spiel beider Hände im strengen oder freien zweistimmigen Satz. Hier werden dem Schüler nun alle Fähigkeiten in Bezug auf unterschiedliche Spielweisen der Hände abverlangt: die gleichzeitige Ausführung unterschiedlicher Dynamik, Artikulation und Rhythmen, in ungleicher Phrasierung und demzufolge in unterschiedlichen Spielund Anschlagsbewegungen. Um dem Schüler die gestalterischen Aufgaben vor Augen zu führen, wurden Phrasierungs- bzw. Legato-Bögen und dynamische Angaben von der Autorin im Notentext eingezeichnet, sie sind also nicht original!
Mit dem Bewältigen dieser anspruchsvollen koordinativen Aufgaben hat der Schüler dann auch die Elementarstufe der spieltechnischen Ausbildung abgeschlossen und damit die Voraussetzungen für das Bewältigen leichter polyphoner Stücke wie etwa aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach erworben.
Den Spielstücken liegt die strenge bzw. kanonische (Nr. 1) oder freie Imitation (Nr. 2, 4 und 5) zugrunde. Einzig der Choral von Bach (Nr. 3) stellt mit melodischer Hauptstimme und frei beglei-
Dies ist eine Leseprobe.
Nicht alle Seiten werden angezeigt.
This is an excerpt.
Not all pages are displayed.
Literaturverzeichnis
Albrecht, Stefan: Von Sportlern lernen. Differenzielles Lernen – Impulse für die Musikpädagogik. In: Üben & Musizieren, 26 (2009), Heft 5, S. 51–53
Bardas, Willy: Zur Psychologie des Klavierspiels. Berlin: Werk-Verlag 1927, Reprint: Düsseldorf: STACCATO-Verlag 2002
Biesenbender, Volker: Von der unerträglichen Leichtigkeit des Instrumentalspiels. Aarau: Nepomuk 1992
Böttner, Bernhard: Grundlagen gegenwärtiger Klavierpädagogik im technischen Bereich. In: Üben & Muszieren, 7 (1990), Heft 2, S. 80–87
Ders.: Habituation von Kunstbewegungen. In: Üben & Musizieren, 2 (1985), Heft 5, S. 354–360
Breithaupt, Rudolf Maria: Die natürliche Klaviertechnik. 2 Bde. Leipzig: Kahnt Nachfolger 1905
Caland, Elisabeth: Die Deppe’sche Lehre des Klavierspiels. Stuttgart: Ebner (Verlag der Ebner’schen Musikalienhandlung) 1897, Reprint: Wilhelmshaven: Noetzel 2004
Dies.: Die Ausnützung der Kraftquellen beim Klavierspiel. Physiologisch-anatomische Betrachtungen. Magdeburg: Heinrichshofen 1922, Reprint: Wilhelmshaven: Noetzel 2006
Cortot, Alfred: Grundbegriffe der Klaviertechnik. Paris: Salabert 1928
Doerne, Andreas: Umfassend musizieren. Grundlagen einer Integralen Instrumentalpädagogik. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 2010
Engel, Karl Wilhelm: Liszts Offenbarung. Eigenverlag ca. 1967
Gát, József: Die Technik des Klavierspiels. Budapest: Corvina 1964
Geiger, Joachim: Körperbewusstsein beim Instrumentalspiel. In: Gerhard Mantel (Hrsg.): Ungenutzte Potentiale. Wege zu konstruktivem Üben. Kongressbericht 1997 des Forschungsinstituts für Instrumental- und Gesangspädagogik e. V. in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Mainz: Schott 1998
Guttenberg, Kristin: Die Kraft der inneren Bilder. Imagination als Weg zu motorischer Regulation von Haltung und Bewegung. In: Üben & Musizieren, 21 (2004), Heft 3, S. 26–31
Heilbut, Peter: Klavier spielen. Früh-Instrumentalunterricht. Ein pädagogisches Handbuch für die Praxis Mainz: Schott 1993
Herrgott, Gerhard: Die Topologie der Spannung (I und II). In: Üben & Musizieren, 9 (1992), Heft 6, S. 3–8; und 10 (1993), Heft 1, S. 19–24
Leseprobe Sample page
Gellrich, Martin: Üben mit Lis(z)t. Wiederentdeckte Geheimnisse aus der Werkstatt der Klaviervirtuosen. Frauenfeld: Waldgut 1992
Ders.: Über den Aufbau motorischer Schemata beim Instrumentalspiel. In: Gerhard Mantel (Hrsg.): Ungenutzte Potentiale. Wege zu konstruktivem Üben. Kongressbericht 1997 des Forschungsinstituts für Instrumentalund Gesangspädagogik e. V. in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Mainz: Schott 1998
Gerig, Reginald R.: Famous pianists & their technique. Newton Abbot: David & Charles 1976
Goebels, Franzpeter: Zur Grundlegung der Klaviertechnik. Mäßig, aber regelmäßig. In: Üben & Musizieren, 3 (1986), Heft 4, S. 368–372
Hirzel-Langenhan, Anna: Greifen und Begreifen. Kassel: Bärenreiter 1963
Keller, Roland: Über das Üben. In: Üben & Musizieren, 18 (2001), Heft 6, S. 56–63
Klöppel, Renate: Die Kunst des Musizierens. Von den physiologischen und psychologischen Grundlagen zur Praxis. Mainz: Schott 1993
Dies.: Mentales Training für Musiker: Leichter lernen –sicherer auftreten. Kassel: Bosse 1996
Kratzert, Rudolf: Technik des Klavierspiels Ein Handbuch für Pianisten. Kassel: Bärenreiter 2002
Ders.: Alexander-Technik für Pianisten. In: Üben & Musizieren, 4 (1987), Heft 2, S. 115–120
Kroeber-Asche, Lili/Waldmann, Guido: Neue Wege am Klavier. Schulwerk für Einzel- und Gruppenunterricht. Wolfenbüttel: Möseler 1979
Kullak, Adolph: Ästhetik des Klavierspiels. Berlin 1860, Reprint: Regensburg: Conbrio 1994
Langeheine, Linda: Üben mit Köpfchen. Mentales Training für Musiker. Frankfurt am Main: Zimmermann 1996
Dies.: Üben? – Und wie? … Die Übefibel mit Tipps und Tricks für ein besseres Üben für Kinder ab 10 Jahren und für alle, die üben wollen. Frankfurt am Main: Zimmermann 1999
Lehmstedt, Sigrid: Vor-ABC der Pianistik – Der Anfang am Klavier. Beitrag zum EPTA-Kongress 1991. In: Dokumentation 1991. Beiträge des 12. EPTA-Kongresses Würzburg. Selbstverlag der EPTA
Leimer, Karl: Rhythmik, Dynamik, Pedal und andere Probleme des Klavierspiels nach Leimer-Gieseking.
Mainz: Schott 1938
Ders.: Modernes Klavierspiel nach Leimer-Gieseking.
Mainz: Schott 1931
Loebenstein, Frieda: Klavierpädagogik. Heidelberg: Quelle & Meyer 1963
Marek, Czeslaw: Lehre des Klavierspiels. Zürich: Atlantis 1972
Mahlert, Ulrich (Hrsg.): Handbuch Üben. Grundlagen – Konzepte – Methoden. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 2006
Ders.: Pädagogik des Instrumentalspiels und des Instrumentalunterrichts. Teil C des Artikels Musikpädagogik. In: Ludwig Finscher (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil Band 6. Kassel: Bärenreiter 1997, Sp. 1499–1520
Mantel, Gerhard (Hrsg.): Ungenutzte Potentiale. Wege zu konstruktivem Üben. Kongressbericht 1997 des Forschungsinstituts für Instrumental- und Gesangspädagogik e. V. in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Mainz: Schott 1998
Ders.: Spiel doch locker! In: Üben & Musizieren, 21 (2004), Heft 3, S. 19–25
Ders.: Bewusst – unbewusst. Strategien des Übens. In: Üben & Musizieren, 8 (1991), Heft 1, S. 13
Ders.: Einfach üben. 185 unübliche Überezepte für Instrumentalisten. Mainz: Schott 2001
Martienssen, C. A.: Zur Methodik des Klavierunterrichts.
Leipzig: Breitkopf & Härtel 1951
Ders.: Schöpferischer Klavierunterricht. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1954
Matthay, Tobias: Die ersten Grundsätze des Klavierspiels.
Leipzig: C. F. Kahnt 1905
Matuschka, Mathias: Die Erneuerung der Klaviertechnik nach Liszt. München, Salzburg: Katzbichler 1987
Meister, Konrad/Wagner, Christoph: Fingertraining durch Seitentraining. In: Üben & Musizieren, 6 (1989), Heft 5, S. 328–333
Meister, Konrad: Gibt es eine „ideale“ Klaviertechnik, oder sind pianistische Bewegungsformen individuell? Beitrag zum EPTA-Kongress 1986. In: Dokumentation 1986. Beiträge des 6. EPTA-Kongresses Würzburg. Selbstverlag der EPTA
Molsen, Uli: Die Geschichte des Klavierspiels in historischen Zitaten. Balingen, Endingen: Musik-Verlag Molsen 1982
Neuhaus, Heinrich: Die Kunst des Klavierspiels. Köln: Gerig 1967
Philipp, Günter: Klavier – Klavierspiel – Improvisation. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik 1984
Pichier, Paul/Krause, Walter: Der pianistische Anschlag. Graz: Leykam 1962
Röbke, Peter: Vom Handwerk zur Kunst Didaktische Grundlagen des Instrumentalunterrichts. Mainz: Schott 2000
Roth, Elgin: Klavierspiel und Körperbewusstsein in einer Auswahl historischer klaviermethodischer Zitate. Hallesche Schriften zur Musikpädagogik, Forum Musikpädagogik, Band 47, Augsburg: Wißner 2001
Saxer, Marion: „Mit schwimmenden Schultern“. In: Üben & Musizieren, 21 (2004), Heft 3, S. 6–11
Scaramuzza, Vincenzo: Enseñanzas de un gran maestro. Hrsg. von Maria Rosa Oubiña de Castro. Buenos Aires (?) 1927
Schöllhorn, Wolfgang: Differenzielles Lehren und Lernen von Bewegung. In: U. Göhner/F. Schiebl (Hrsg.): Zur Vernetzung und Forschung von Lehre in Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft. Hamburg: Czwalina 2005
Schneider, Francis: Üben – was ist das eigentlich? Aarau: Nepomuk 1992
Leseprobe Sample page
Dies.: Bewegungsschulung am Klavier. Beitrag zum EPTA-Kongress 1981. In: Dokumentation 1981. Beiträge des 2. EPTA-Kongresses Würzburg. Selbstverlag der EPTA
Roth, Georg: Methodik des virtuosen Klavierspiels. Alfred Hoehns Methode. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1949, Wilhelmshaven: Noetzel 1995
Rüdiger, Wolfgang: Der musikalische Körper. Mainz: Schott 2007
Runze, Klaus: Zwei Hände – zwölf Tasten Ein Buch mit Bildern für kleine Klavierspieler. Mainz: Schott 1971
Schulz, Arnold: The riddle of the pianists finger.
New York: Carl Fischer 1936
Schwarzenbach, Peter/Bryner-Kronjäger, Brigitte: Üben ist doof. Gedanken und Anregungen für den Instrumentalunterricht. Frauenfeld: Waldgut 2005
Simkova, Ludmillá: Natürliche physische Bewegung als Grundlage der Entwicklung des pianistischen inneren Hörens. In: Üben & Musizieren, 2 (1985), Heft 5, S. 348–353
Steinhausen, Friedrich A: Die physiologischen Fehler und die Umgestaltung der Klaviertechnik. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1905
Taylor, Harold: Das pianistische Talent Ein neuer Weg zum künstlerischen Klavierspiel auf Basis der Lehren von F. Matthias Alexander und Raymond Thiberge. Wien: Facultas 1996
Taylor, Kendall: Klaviertechnik und Interpretation. Frankfurt am Main: Zimmermann 1981
Trendelenburg, Wilhelm: Die natürlichen Grundlagen der Kunst des Streichinstrumentenspiels. Berlin: Julius Springer 1925, Reprint Kassel: Bärenreiter 1974.
Varró, Margit: Der lebendige Klavierunterricht. Seine Methodik und Psychologie. Berlin: Simrock 1929
Wagner, Christoph: Hand und Instrument. Musikphysiologische Grundlagen, Praktische Konsequenzen. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 2005
Wessel, Michael: Die Kunst des Übens. Wilhelmshaven: Heinrichshofen’s Verlag 2007
Wieland, Renate/Uhde, Jürgen: Der Körper als Instrument der Musik. In: Üben & Musizieren, 2 (1985), Heft 3, S. 155–160
Dies.: Forschendes Üben. Wege instrumentalen Lernens Kassel: Bärenreiter 2002
Wolf, Erich: Der Klavierunterricht. Ein Leitfaden durch die Unterrichtspraxis. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 1985
Wolters, Klaus (Hrsg.): Orientierungsmodelle für den Instrumentalunterricht. Regensburg: Bosse 1975
Internetseiten: http://de.wikipedia.org/wiki/Differenzielles_Lernen (Zugriff: 8.2.2013)
DVD-Index
TrackThema
1 Stützfähigkeit von Fingern und Hand
2
Das Arm-Portato mit elastisch fixiertem Handgelenk
3 Das Arm-Portato mit flexiblem Handgelenk
4 Das Unterarm-Portato mit elastisch fixiertem Handgelenk
5 Das UnterarmPortato mit flexiblem Handgelenk
Kurzbeschreibung
Übung: vorinstrumental, in sieben Schritten
Übung 1: Tonwiederholungen und verschiedene Lagenwechsel mit einzelnen Tönen
Übung 2: in vier Phasen ausgezählte Anschlagsbewegung
Bezug ca. bei Spielzeit
Lehrerkommentar (LK), im Kap. 3.5, S. 27 0:00
Heft 1, Kap. 1, Ü. 1–3, S. 5 0:00
6
Das Arm-Staccato mit elastisch fixiertem und mit flexiblem Handgelenk
7 Das Unterarm-Staccato –auf die Taste gerichtet und von der Taste hochschnellend (repulsiv)
8 Das perkussive Unterarm-Staccato
9 Die schnelle Repetition mit Unterarm/Hand
10Das Hand-Staccato
Übung: in vier Phasen ausgezählte Anschlagsbewegung
H. 1, Kap. 1, Ü. 4, S. 51:29
Etüde: „Glocken“ H. 1, Kap. 3, S. 26 2:05
H. 1, Kap. 1, Ü. 4, S. 50:00
Etüde: „Lento“ H. 2, Kap. 4, S. 34 0:33
Übung: Lagenwechsel mit Doppelgriffen H. 1, Kap. 3, Ü. 1, S. 210:00
Etüde: „Einfach ein Boogie“H. 1, Kap. 3, S. 27 0:52
Übung: wechselnde Doppelgriffe
Übung: Doppelgriffe a) mit elastisch fixiertem Handgelenk b) mit flexiblem Handgelenk
Etüde: „Kleines Känguru“ a) mit elastisch fixiertem Handgelenk b) mit flexiblem Handgelenk
Übung:
a) Quarten – auf die Taste gerichtet b) Quinten – von der Taste hochschnellend (repulsiv)
H. 1, Kap. 3, Ü. 5, S. 220:00
Etüde: „Walzer mit Sexten“H. 1, Kap. 3, S. 27 0:45
H. 1, Kap. 3, Ü. 2, S. 210:00 0:28
H. 1, Kap. 3, S. 23 0:59 1:25
H. 1, Kap. 3, Ü. 2, S. 21 0:00 0:30
Leseprobe Sample page
Etüde: „Flohhüpfen“ a) auf die Taste gerichtet b) von der Taste hochschnellend (repulsiv)
Übung: Terzen
H. 2, Kap. 5, S. 44 0:56 1:34
H. 2, Kap. 4, Ü. 1, S. 320:00
Etüde: „Verfolgungsjagd“H. 1, Kap. 6, S. 59 0:20
Übung: Terzen freie Übung 0:00
Etüde: „Kastagnetten“H. 2, Kap. 5, S. 43 0:27
Übung: Terzen
H. 2, Kap. 4, Ü. 1, S. 320:00
Etüde: „Hexentanz“ H. 2, Kap. 4, S. 39 0:21
TrackThema
11Das Arm-Legato
12 Das neutrale FingerLegato
13 Das GewichtsLegato
14 Das fingeraktive Legato
Kurzbeschreibung
Bezug ca. bei Spielzeit
Übung: Fünftonfolgefreie Übung 0:00
Etüde: „Aus dem Nest gefallen“
H. 2, Kap. 5, S. 52 0:45
Übung: FünftonfolgeH. 1, Kap. 2, Ü. 2, S. 160:00
Etüde: „Ohne Ende“H. 1, Kap. 2, S. 18 0:33
Übung: zweistimmiges Fünftonmotiv
Etüde: „Frühling“
H. 1, Kap. 4 (Rhythmus), Ü. 1, S. 38 0:00
H. 1, Kap. 4, S. 45 0:45
15Das Finger-Staccato
16 Die zusammenfassende Spielbewegung und der Kreisschwung
17 Vertikalschwünge (Hoch- und Tiefschwung) und Seitenschwünge
18Der Hochschwung
19Der Tiefschwung
20Der Seitenschwung
21Der Drehschwung
Übung 1: Fingerschwünge der Finger 2–5 bei aufgestütztem Daumen H 1, Kap. 2, Ü. 11, S. 170:00
Übung 2: fingeraktives Legato in ansteigendem Tempo
Etüde: „Rolltreppe“ a) im mp b) mit Crescendo/ Decrescendo
Übung: „Fesselübungen“
Übung 1: In vier Phasen ausgezählte Ausführung einer Zweierbindung
Übung 2: Zweier-, Dreier-, Vierer- und Fünferbindung
H. 1, Kap. 5, Ü. 6, S. 520:28
H. 2, Kap. 3, S. 29 1:14
H. 2, Kap. 6, Ü. 1–2, S. 59 0:00
Etüde: „Zu dritt unterwegs“ H. 2, Kap. 6, S. 61 1:00
H. 1, Kap. 1, Ü. 2, S. 80:00
H. 1, Kap. 1, Ü. 3, S. 80:24
Etüde 1: „Immer mehr“H. 1, Kap. 2, S. 17 0:53
Etüde 2: „Im Kreis“ H. 2, Kap. 1, S. 16 1:53
Übung: „Froschsprung“LK Kap. 3.6, S. 28 0:00
Übung: Zwei- bis Fünftonfolgen mit abschließendem Hochschwung
Etüde: „ Iwan tanzt“
Übung: Terzen
Etüde: „Samba“
Übung: Sprünge
H. 2, Kap. 1, Ü. 18, S. 70:00
H. 2, Kap. 4, S. 36 0:42
Leseprobe Sample page
H. 2, Kap. 4, Ü. 1, S. 320:00
H. 2, Kap. 5, S. 47 0:35
H. 2, Kap. 4, Ü. 2, S. 320:00
Etüde: „Nächtlicher Spuk“H. 2, Kap. 4, S. 37 0:24
Übung: Gebrochene QuintenH. 2, Kap. 1, Ü. 3, S. 50:00
Etüde: „Schüttelfrost“H. 2, Kap. 1, S. 10 0:42
Dies ist eine Leseprobe.
Nicht alle Seiten werden angezeigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bestellungen nehmen wir gern über den Musikalien- und Buchhandel oder unseren Webshop unter www.breitkopf.com entgegen.
This is an excerpt. Not all pages are displayed.
Have we sparked your interest? We gladly accept orders via music and book stores or through our webshop at www.breitkopf.com.