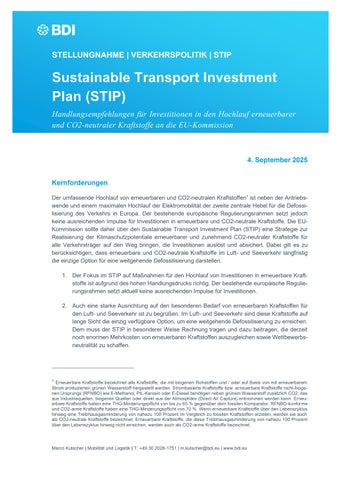Sustainable Transport Investment Plan (STIP)
Handlungsempfehlungen für Investitionen in den Hochlauf erneuerbarer und CO2-neutraler Kraftstoffe an die EU-Kommission
4. September 2025
Kernforderungen
Der umfassende Hochlauf von erneuerbaren und CO2-neutralen Kraftstoffen1 ist neben der Antriebswende und einem maximalen Hochlauf der Elektromobilität der zweite zentrale Hebel für die Defossilisierung des Verkehrs in Europa. Der bestehende europäische Regulierungsrahmen setzt jedoch keine ausreichenden Impulse für Investitionen in erneuerbare und CO2-neutrale Kraftstoffe. Die EUKommission sollte daher über den Sustainable Transport Investment Plan (STIP) eine Strategie zur Realisierung der Klimaschutzpotentiale erneuerbarer und zunehmend CO2-neutraler Kraftstoffe für alle Verkehrsträger auf den Weg bringen, die Investitionen auslöst und absichert. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass erneuerbare und CO2-neutrale Kraftstoffe im Luft- und Seeverkehr langfristig die einzige Option für eine weitgehende Defossilisierung darstellen
1. Der Fokus im STIP auf Maßnahmen für den Hochlauf von Investitionen in erneuerbare Kraftstoffe ist aufgrund des hohen Handlungsdrucks richtig. Der bestehende europäische Regulierungsrahmen setzt aktuell keine ausreichenden Impulse für Investitionen
2. Auch eine starke Ausrichtung auf den besonderen Bedarf von erneuerbaren Kraftstoffen für den Luft- und Seeverkehr ist zu begrüßen. Im Luft- und Seeverkehr sind diese Kraftstoffe auf lange Sicht die einzig verfügbare Option, um eine weitgehende Defossilisierung zu erreichen. Dem muss der STIP in besonderer Weise Rechnung tragen und dazu beitragen, die derzeit noch enormen Mehrkosten von erneuerbaren Kraftstoffen auszugleichen sowie Wettbewerbsneutralität zu schaffen
1 Erneuerbare Kraftstoffe bezeichnet alle Kraftstoffe, die mit biogenen Rohstoffen und / oder auf Basis von mit erneuerbarem Strom produzierten grünen Wasserstoff hergestellt werden. Strombasierte Kraftstoffe bzw. erneuerbare Kraftstoffe nicht-biogenen Ursprungs (RFNBO) wie E-Methanol, PtL-Kerosin oder E-Diesel benötigen neben grünem Wasserstoff zusätzlich CO2, das aus Industriequellen, biogenen Quellen oder direkt aus der Atmosphäre (Direct Air Capture) entnommen werden kann. Erneuerbare Kraftstoffe haben eine THG-Minderungspflicht von bis zu 65 % gegenüber dem fossilen Komparator, RFNBO-konforme und CO2-arme Kraftstoffe haben eine THG-Minderungspflicht von 70 %. Wenn erneuerbare Kraftstoffe über den Lebenszyklus hinweg eine Treibhausgasminderung von nahezu 100 Prozent im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen erzielen, werden sie auch als CO2-neutrale Kraftstoffe bezeichnet. Erneuerbare Kraftstoffe, die diese Treibhausgasminderung von nahezu 100 Prozent über den Lebenszyklus hinweg nicht erreichen, werden auch als CO2-arme Kraftstoffe bezeichnet.
3. Für einen umfassenden Ansatz zum Hochlauf erneuerbarer Kraftstoffe muss der STIP zwingend alle Verkehrsträger in den Blick nehmen. Ein beschleunigter und umfassender Hochlauf kann nur durch ein Bündel geeigneter Maßnahmen erreicht werden. Erneuerbare Kraftstoffe leisten einen unverzichtbaren Klimaschutzbeitrag in der Pkw- und Lkw-Bestandsflotte, beim Betrieb von Wasserstofffahrzeugen sowie für den nicht elektrifizierten Schienenverkehr und die Binnenschifffahrt.
4. Insgesamt wird die EU-Kommission mit dem bisherigen Ansatz für einen STIP ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht, einen strategischen Rahmenplan für Investitionen in den Klimaschutz für alle Verkehrsträger vorzulegen. Dafür braucht es eine Ausweiterung des STIP oder ein analoges Instrumentenpaket auf zusätzliche Investitionsfelder für alle Verkehrsträger. Dazu zählen Effizienzsteigerungen bei bestehenden Transporttechnologien und -lösungen, die Nutzung von Digitalisierungspotenzialen, der Aufbau von Lade- und Tankinfrastrukturen sowie Investitionen in innovative Technologien.
5. Der STIP sollte einen kohärenten und holistischen Rahmen für Investitionen in die Defossilisierung des Verkehrs schaffen. Vorgeschlagene Maßnahmen sollten Kohärenz mit und zwischen bestehenden EU-Regulierungen, Fonds und dem Mehrjährigen Finanzrahmen der EU, aber auch internationalen Organisationen schaffen und stärken. Dazu muss auch eine Rückführung von ETS-Einnahmen in beitragende Sektoren sichergestellt werden, insbesondere für den Luft- und Seeverkehr.
6. Die Maßnahmen des STIP für den Hochlauf erneuerbarer Kraftstoffe müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
▪ Investitionen durch belastbaren Fahrplan für Hochlauf sowie Bestandsschutzgarantien und Förderansätze für First Mover absichern
▪ Internationalen Markt für RFNBO durch praxisnahe regulatorische Anforderungen und funktionale Zertifizierungssysteme entwickeln
▪ Klimaschutz im Luft- und Seeverkehr durch mehr Flexibilität (Book & Claim), SAF-Finanzierungsinstrumente und Einsatz für globales Level Playing Field wettbewerbsneutral ermöglichen
▪ Klare CO2-Preissignale im Straßenverkehr setzen
▪ Investitionen in die Transformation der Mineralölbranche zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und der Versorgungssicherheit anreizen
Key recommendations
The large-scale ramp-up of renewable and CO2-neutral fuels (CO2-neutral fuels meaning renewable fuels that achieve an almost 100 percent reduction in greenhouse gas emissions over their lifecycle compared to fossil fuels) is, alongside the switch to alternative drive systems and the maximum ramp-up of electromobility, the second key lever for the defossilisation of transport in Europe. However, the existing European regulatory framework does not set sufficient incentives for investments in renewable and CO2-neutral fuels. The European Commission should therefore use the Sustainable Transport Investment Plan (STIP) to put forward a strategy for unlocking the climate protection potential of renewable and increasingly renewable and CO2-neutral fuels across all transport modes –one that triggers and secures investments. It must be taken into account that in aviation and maritime transport, renewable and CO2-neutral fuels will represent the only long-term option for far-reaching defossilisation.
1. The STIP’s focus on measures to accelerate investments in renewable fuels is appropriate, given the urgent need for action. The current European regulatory framework does not provide sufficient investment incentives.
2. A strong emphasis on the specific needs for renewable fuels in aviation and maritime transport is also welcome. In these sectors, such fuels are the only viable option for achieving far-reaching defossilisation in the long term. The STIP must particularly take this into account and help offset the still enormous additional costs of renewable fuels while ensuring a level playing field.
3. For a comprehensive approach to scaling up renewable fuels, the STIP must address all modes of transport. An accelerated and large-scale ramp-up can only be achieved through a package of appropriate measures. Renewable fuels make an indispensable contribution to climate protection in the existing fleet of passenger cars and trucks, in the operation of hydrogen vehicles, as well as in non-electrified rail transport and inland waterway transport.
4. Overall, with its current approach to the STIP, the European Commission falls short of its own ambition to present a strategic investment framework for climate protection across all modes of transport. This requires either an expansion of the STIP or an analogous package of instruments covering additional investment fields for all modes of transport. These include efficiency improvements in existing transport technologies and solutions, the use of digitalisation potential, the development of charging and refuelling infrastructures, as well as investments in innovative technologies.
5. The STIP should provide a coherent and holistic framework for investments in the defossilisation of transport. Proposed measures should create and strengthen coherence with and between existing EU regulations, funds, and the EU’s Multiannual Financial Framework, but also with international organisations. This also requires thatETS revenues are channelled back into contributing sectors, in particular aviation and maritime transport.
6. The STIP measures to ramp up renewable fuels must meet the following requirements:
▪ Secure investments through a reliable roadmap for scale-up, guarantees for existing assets, and support schemes for first movers
▪ Develop the international market for RFNBOs through pragmatic regulatory requirements, and functional certification systems
▪ Enable climate protection in aviation and maritime transport by means of greater flexibility (Book & Claim), SAF financing instruments and efforts to ensure a global level playing field
▪ Set clear CO2 price signals in road transport
▪ Incentivise investments in the transformation of the mineral oil industry to strengthen Europe’s industrial base and supply security
1. Sachstand: Bestehender Regulierungsrahmen setzt keine ausreichenden Impulse für Investitionen in CO2-neutrale Kraftstoffe
Der Mission Letter der Präsidentin der Europäischen Kommission an ihren Kommissar für nachhaltigen Verkehr und Tourismus beinhaltet einen klaren Auftrag: die Entwicklung eines Sustainable Tranport Investment Plan (STIP), der Investitionen in den Klimaschutz im Verkehr auslöst Der STIP soll alle Verkehrsträger adressieren. Einen besonderen Handlungsbedarf macht die Kommission in ihrem Call for Evidence richtigerweise beim schleppenden Hochlauf erneuerbarer Kraftstoffe aus, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Luftfahrt und Schiffsverkehr. Der STIP soll daher den Aufbau von Produktionskapazitäten durch Maßnahmen unterstützen, die das Risiko privater Investitionen in erneuerbare und kohlenstoffarme Kraftstoffe mindern.
Die EU versucht den Hochlauf erneuerbarer Kraftstoffe bislang primär über Verpflichtungen zum Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe für Mitgliedsstaaten und Unternehmen anzukurbeln Im Rahmen des Green Deal hat die EU mit der Revision der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (nachfolgend RED III) Ziele für die Nutzung erneuerbarer Energien im Verkehr definiert: Bis 2030 sollen mindestens 29 % des Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor durch erneuerbare Energien gedeckt oder eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 14,5 % im Vergleich zum Einsatz fossiler Kraftstoffe erreicht werden. Zudem enthält die RED III eine gemeinsame Unterquote zu fortschrittlichen Biokraftstoffen und erneuerbare Kraftstoffe nicht-biogenen Ursprungs (Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO)) von 5,5 % bis 2030 (Zwischenziel 2025: 1 %). Innerhalb dieser gemeinsamen Unterquote ist eine Unterquote zu RFNBO von mindestens 1 % bis 2030 zu erfüllen. Darüber hinaus gelten seit 2025 mit den Verordnungen ReFuelEU Aviation und FuelEU Maritime spezifische und europaweit einheitliche Ziele für den Hochlauf nachhaltiger Kraftstoffe im Luft- und Seeverkehr. Die ReFuelEU Aviation verpflichtet Flugkraftstoffanbieter ab 2025 nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels (SAF)) einzusetzen, die ab 2030 einen Mindestanteil an RFNBO beinhalten müssen. Die FuelEU Maritime verpflichtet Schifffahrtsunternehmen zur Reduktion der Treibhausgasintensität der an Bord eines Schiffs verbrauchten Energie und setzt RFNBO-Ziele fest.
Die regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa setzen trotz dieser Ziele und Quotenverpflichtungen bislang keine ausreichenden Anreize für Investitionen in RFNBO und fortschrittliche Biokraftstoffe aus innovativen Verarbeitungsverfahren und bislang ungenutzten Biomassepotentialen. Der kurze Regulierungshorizont, fehlende oder unklare rechtliche Rahmenbedingungen, die hohe Komplexität, ungenügende Anreize und das Fehlen gleichgerichteter Regulierungsinstrumente in anderen Weltregionen bergen hohe Risiken für Investitionsprojekte mit typischen Investitionszeiträumen von 15-20 Jahren Das gegenwärtige Design des Europäischen Emissionshandels und der EU-Quotenverpflichtungen für den Luft- und Seeverkehr behindert die Produktion der dringend benötigten CO2neutralen Kraftstoffe. Um die die Quotenverpflichtungen der EU zu erfüllen, müssen europäische Unternehmen daher enorme Mehrkosten schultern. Zudem verteuert die Regulierung einseitig Verkehre über europäische Flug- und Seehäfen und setzt somit Anreize zur Umgehung kostenintensiver europäischer Klimaschutzinstrumente. Im Ergebnis droht eine Verlagerung von Verkehren auf außereuropäische Drehkreuze, in denen weniger ambitionierte Sozialstandards und Klimaschutzvorgaben gelten (Carbon Leakage).
2. Hochlauf CO2-neutraler Kraftstoffe erfordert Maßnahmenbündel
Ein beschleunigter und umfassender Hochlauf von CO2-neutralen Kraftstoffen kann nur durch ein Bündel geeigneter Maßnahmen erreicht werden. Der STIP sollte daher eine Strategie zur Realisierung der Klimaschutzpotentiale CO2-neutraler Kraftstoffe für alle Verkehrsträger entwickeln. Der umfassende Hochlauf von CO2-neutralen Kraftstoffen ist neben der Antriebswende und einem maximalen Hochlauf der Elektromobilität der zweite zentrale Hebel für die Defossilisierung des Verkehrs. CO2neutrale Kraftstoffe leisten einen unverzichtbaren Klimaschutzbeitrag in der Pkw- und Lkw-Bestandsflotte, im Luft- und Seeverkehr, im nicht elektrifizierten Schienenverkehr und der Binnenschifffahrt. Im Luft- und Seeverkehr sind CO2-neutrale Kraftstoffe auf lange Sicht die einzig verfügbare Option, um eine weitgehende Defossilisierung zu erreichen – auch wenn batterieelektrische oder wasserstoffbetriebene Antriebe in der Zukunft verfügbar sein werden. Dem muss der STIP in besonderer Weise Rechnung tragen. Die Maßnahmen des STIP für den Hochlauf erneuerbarer Kraftstoffe müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
Investitionen in RFNBO und fortschrittliche Biokraftstoffe aus innovativen Verarbeitungsverfahren und bislang ungenutzten Biomassepotentialen müssen durch einen langfristigen Pfad für den Hochlauf CO2-neutraler Kraftstoffe und Bestandsschutzregelungen abgesichert werden. Instrumente mit CO2Lenkungswirkung, unter anderem eine Reform der Energiesteuern auf Kraftstoffe im Straßen-, Bahnund Binnenschiffsverkehr sowie ein effektiver Emissionshandel im Straßenverkehr, setzen Anreize für den Einsatz CO2-neutraler Kraftstoffe und führen zu einem größeren und resilienteren Absatzmarkt. Es gilt, Investmentbarrieren abzuschaffen, wirksame und verlässliche Finanzierungsansätze einzuführen und einen internationalen Markt für CO2-neutrale Kraftstoffe zu entwickeln. Entscheidend dafür sind praxisnahe regulatorische Anforderungen an Produkte sowie eine flexiblere Inverkehrbringung und Anrechnung von Kraftstoffen. Für internationale Verkehrsträger bedarf es zusätzlich Maßnahmen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen sowie Carbon Leakage und es müssen Anreize für die Nutzer geschaffen bzw. gestärkt werden, um die Mehrkosten erneuerbarer Kraftstoffe gegenüber fossilen Kraftstoffen zu mindern. Investitionen durch belastbaren Fahrplan für Hochlauf sowie Bestandsschutzgarantien und Förderansätze für First Mover absichern
Die Molekülwende im Verkehr erfordert eine langfristige Strategie, um Investitionsprojekte zukunftssicher zu gestalten. Mit Blick auf die Dauer von Planung, Genehmigung, Bau sowie typischen Investitionszeiträumen von 15-20 Jahren für Produktionsanlagen für nachhaltige Kraft- und Brennstoffe ist ein langfristig belastbarer Regulierungsrahmen erforderlich, um Investitionen in und für Europa auszulösen.
RED III langfristig, konsistent und harmonisiert fortschreiben
Die Ziele der RED III gelten gegenwärtig bis 2030. Neue Anlagen zur Produktion CO2-neutraler Kraftstoffe sind auf einen deutlich über das Jahr 2030 hinaus belastbaren Regulierungsrahmen angewiesen. Das Review der RED III im Jahr 2027 sollte daher für eine langfristige, konsistente und harmonisierte Fortschreibung genutzt werden. Dabei muss die Kohärenz mit den Verordnungen ReFuelEU Aviation und FuelEU Maritime, die bereits einen Pfad für den CO2-neutraler Kraftstoffe im Luft- und Seeverkehr bis 2050 definieren, sichergestellt werden. Dazu zählt auch, dass die EU-Kommission darauf hinwirkt, nationale Alleingänge von Mitgliedstaaten zu vermeiden Das betrifft beispielsweise in Deutschland die ersatzlose Streichung der nationalen PtL-Quote im Luftverkehr ebenso wie eine Doppelregulierung von Luft- und Seeverkehr über die THG-Minderungsquote.
Investitionssicherheit für First Mover durch Bestandsschutzregelung schaffen
Ein regelmäßiges Monitoring und die Nachjustierung von Regulierung durch nationale und europäische Politik ist ein Grundanliegen der Wirtschaft. Zugleich bergen mögliche kurzfristige Änderungen der regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen ein hohes Risiko für Fehlinvestitionen bei Projekten mit typischen Investitionszeiträumen von 15-20 Jahren. In einem sich noch entwickelnden Markt für Wasserstofftechnologien und CO2-neutrale Kraftstoffe sollten Investoren für Pilotanlagen Bestandsschutzgarantien („Grandfathering“) über den erforderlichen Betriebszeitraum von 15-20 Jahren erhalten.
Förderinstrumente für First Mover einführen und Einnahmen aus dem Emissionshandel im Luft- und Seeverkehr für deren Defossilisierung nutzen
Förderprogramme für Produktionsanlagen für CO2-neutrale Kraftstoffe im industriellen Maßstab können die Nachteile für First Mover kompensieren. Ein geeignetes Instrument sind PtX-Doppelauktionen nach dem Vorbild von H2Global. Diese müssen realisiert, ausgeweitet und langfristig sicher finanziert werden. Dazu sollten die Einnahmen aus dem Luft- und Seeverkehr im Europäischen Emissionshandel (EU ETS 1) genutzt werden
2.1Internationalen Markt für RFNBO durch praxisnahe regulatorische Anforderungen und funktionale Zertifizierungssysteme entwickeln
Die kosteneffiziente Bereitstellung von CO2-neutralen Kraftstoffen und insbesondere RFNBO in Deutschland und Europa erfordert umfassende Importe von Standorten mit günstigen Bedingungen zur Herstellung erneuerbarer Energien. Die EU sollte daher Importkapazitäten aufbauen, Energiepartnerschaften stärken und die Entwicklung eines internationalen Marktes für RFNBO aktiv vorantreiben.
Review der delegierten Rechtsakte zu RFNBO vorziehen und Kriterien praxisnah ausgestalten
Für die Entwicklung eines internationalen Markts für RFNBO müssen Handelshemmnisse abgebaut werden, unter anderem durch praxistauglichere Definitionen für kohlenstoffarmen und erneuerbaren Wasserstoff sowie CO2-Bezugsquellen für RFNBO. Der für 2028 angesetzte Review der Kriterien ist daher vorzuziehen Davon profitieren auch Produzenten innerhalb der EU.
Verbindliche Sicherheitsstandards für Einsatz, Betankung, Ladung und Notfallmanagement etablieren
Für den sicheren Betrieb von Chemieanlagen braucht es verbindliche Sicherheitsstandards für den Einsatz, Betankung, Ladung und ein Notfallmanagement entlang der Chemielogistikketten von erneuerbaren Kraftstoffen hinsichtlich Ex-Zonen (explosionsgefährdete Bereiche), thermischen Durchgehens, Hochvolt-Sicherheit und ADR-Kompatibilität. Außerdem sollten EU-weit harmonisierte Leitfäden für Be- und Entladevorgänge an Chemie-Standorten entwickelt werden, um Betriebssicherheit und Akzeptanz in der Praxis zu gewährleisten
2.2Klimaschutz im Luft- und Seeverkehr durch mehr Flexibilität (Book &Claim), SAF-Finanzierungsinstrumente und Einsatz für globales Level Playing Field wettbewerbsneutral ermöglichen
Die EU setzt mit dem Green Deal Impulse für Investitionen in eine klimaneutrale Luftfahrt und einen defossilisierten Seeverkehr, hat es jedoch versäumt, den ordnungspolitischen Rahmen wettbewerbsneutral auszugestalten. Im Ergebnis verteuert die EU-Klimaschutzgesetzgebung einseitig Verkehre über europäische Flug- und Seehäfen und setzt somit Anreize zur Verlagerung von Verkehren und Emissionen ins Ausland (Carbon Leakage). Im Luftverkehr müssen ein Wettbewerbsfähigkeitscheck und notwendige Nachbesserungen rasch erfolgen, um international faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen und die Realisierung der EU-Quotenverpflichtungen für nachhaltige Flugkraftstoffe möglich zu machen, zu denen die Luftfahrtbranche steht.
Wettbewerbsneutrale Realisierung der EU-Quotenverpflichtungen für nachhaltige Flugkraftstoffe über SAF Levy oder SAF Rebalancing Charge ermöglichen
Das gegenwärtige Design der ReFuelEU Aviation und ihrer Quotenverpflichtungen für SAF verteuert einseitig Flugverbindungen über europäische Drehkreuze und setzt somit Anreize zur Umgehung kostenintensiver europäischer Klimaschutzinstrumente. Die EU muss dringend Instrumente zur Korrektur der Wettbewerbsverzerrungen einführen und dafür spätestens den in der Verordnung angelegten Review-Prozess nutzen. Die Einführung einer europäischen, reisezielbezogenen und zweckgebundenen Klimaabgabe (SAF Levy) stellt eine Möglichkeit dar, Wettbewerbsverzerrungen zulasten europäischer Fluggesellschaften auszugleichen, Carbon Leakage zu reduzieren und den Hochlauf nachhaltiger Flugkraftstoffe abzusichern. Alternative Instrumente zur Herstellung international fairer Wettbewerbsbedingungen, wie eine Klimaausgleichsgebühr (SAF Rebalancing Charge), sollten geprüft werden. Diese würde bei Flugverbindungen über außereuropäische Drehkreuze für Flugabschnitte, die nicht der SAF-Quote unterliegen, von Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen erhoben. Die Funktionalität und Praktikabilität der Instrumente müssen gewährleistet werden.
Einsatz für globales Level Playing Field bei ICAO und IMO ausweiten
Das Engagement für international harmonisierte und wirksame Klimaschutzmaßnahmen auf Ebene der Internationalen Luftfahrtorganisation ICAO und der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO muss ausgeweitet werden. Die EU sollte sich für eine Stärkung des Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) der ICAO einsetzen. CORSIA hat als bereits existierendes und global angelegtes System das Potential, zu einem Level-Playing-Field auch jenseits Europas beizutragen. Die derzeit laufenden Verhandlungen über die Einführung eines international geltenden Treibhausgasintensitätsstandards (GHG Fuel Intensity Standard, GSI) und Emissionsbepreisungsmechanismus unter dem Dach der IMO sollten durch die EU weiter positiv begleitet und bis Jahresende zu einem ambitionierten Abschluss geführt werden. Nach der Einführung der IMO-Vorgaben ist eine Harmonisierung der FuelEU Maritime und des EU ETS für den Seeverkehr mit den internationalen Vorgaben vorzunehmen, um eine Doppelregulierung mit entsprechenden Kostennachteilen für europäische Verkehrsdienstleister und Verlader zu verhindern.
Mehr SAF Allowances zur Verfügung stellen
Die bislang vorgesehenen Zertifikate im ETS zur Kompensation der Mehrkosten des Einsatzes von nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF Allowances bzw. FEETS) werden nicht annähernd für eine Kompensation der Mehrkosten ausreichen und voraussichtlich spätestens 2028 aufgebraucht sein. Die
bereits in der EU ETS-Richtlinie angelegte Möglichkeit zu einer Verlängerung des Programms sollte daher genutzt und eine Aufhebung der mengenmäßigen Deckelung und der zeitlichen Begrenzung der SAF Allowances umgesetzt werden.
Funktionale Nachweis- und Zertifizierungssysteme einführen und durchsetzen
Internationale Standards für Nachhaltigkeits- und Qualitätskriterien, ein internationaler Zertifikatehandel sowie internationale Vorgaben für die Anrechnung nachhaltiger Kraftstoffe in den Klimabilanzen von Nutzern und ihren Kunden müssen implementiert werden. Der in der ReFuelEU Aviation angelegte Flexibilitätsmechanismus sollte zu einem Book & Claim-System weiterentwickelt werden Gleichzeitig gilt es bestehende Standards durch Audits international durchzusetzen und Verstöße zu sanktionieren.
2.3Klare CO2-Preissignale im Straßenverkehr setzen durch rasche Einführung des ETS2 und eine Novelle der ETD
Für den Straßenverkehr sind CO2-Preissignale über den europäischer Emissionshandel ETS 2 und eine Novelle der ETD zentrale Anreizelemente. Die neue europäische Energiesteuerrichtlinie (ETD) muss schnellstmöglich mit Anreizen für den Einsatz CO2-neutraler Kraftstoffe im Straßen-, Bahn- und Binnenschiffsverkehr verabschiedet werden. Die neue ETD muss für eine Transformationsphase europaweit verpflichtend CO2-neutrale Kraftstoffe von der Mindestbesteuerung ausnehmen, um mit einem angemessenen Preissignal Investitionen in RFNBO und fortschrittliche Biokraftstoffe zu fördern. Nach dieser Transformationsphase sollte für CO2-neutrale Kraftstoffe nur ein Steuertarif analog zur Elektrizität eingeführt werden. Außerdem gilt es,den Ansatz einer komponentenbasierten Besteuerung einzuführen. Der BDI lehnt eine nationale oder europäische Besteuerung von Kraftstoffen für den Luftund Seeverkehr ab, da diese systemimmanent zu Nachteilen für europäische Unternehmen im internationalen Wettbewerb und Carbon Leakage führt.
Zusätzlich kommt es für den Straßenverkehr auf weitere Anreize für den Markthochlauf erneuerbarer Kraftstoffe an, v. a. durch eine rasche Anpassung der Eurovignetten-Richtlinie, der Umsetzung des Erwägungsgrunds 11 der CO2-Flottenregulierung für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie eine Unterstützung des Markthochlaufs von Wasserstofffahrzeugen.
3. Investitionen in die Transformation der Mineralölbranche zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und der Versorgungssicherheit anreizen
Raffinerien sind ein zentraler Bestandteil der industriellen Wertschöpfungsketten in Deutschland und Europa, indem sie die – zukünftig defossilisierte – Versorgung des Standorts mit Kraft- und Brennstoffen sowie Mineralölprodukten für die stoffliche Verwendung sicherstellen. Darüber hinaus bestehen enge Verflechtungen der Mineralölwirtschaft mit weiteren Branchen wie der Chemieindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Baustoffindustrie, der Stahl- und Aluminiumproduktion sowie der Automobilindustrie – sei es durch den Austausch von Vor- und Zwischenprodukten oder durch die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen und Standortdienstleistungen. Raffinerien ermöglichen in Krisenzeiten eine unabhängige Erzeugung von Energie sowie Kraft- und Brennstoffen. Damit leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Mobilität und Versorgung von Bevölkerung, Wirtschaft und Streitkräften sowie der Funktionsfähigkeit kritischer Infrastrukturen. Die Sicherung der heimischen Energie- und Kraftstofferzeugung ist somit nicht nur industriepolitisch geboten, sondern auch sicherheitspolitisch erforderlich.
3. Strategische Erweiterung des STIP mit Blick auf Innovationen, nachhaltige Transportlösungen, Digitalisierung sowie Lade- und Tankinfrastrukturen
Der STIP sollte einen kohärenten und holistischen Rahmen für Investitionen in die Defossilisierung des Verkehrs schaffen. Vorgeschlagene Maßnahmen sollten Kohärenz mit und zwischen bestehenden EU-Regulierungen, Fonds und dem Mehrjährigen Finanzrahmen der EU, aber auch internationalen Organisationen schaffen und stärken. Dazu muss auch eine Rückführung von ETS-Einnahmen in beitragende Sektoren sichergestellt werden, insbesondere für den Luft- und Seeverkehr.
Insgesamt wird die EU-Kommission mit dem bisherigen Ansatz für einen STIP ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht, einen strategischen Rahmenplan für Investitionen in den Klimaschutz für alle Verkehrsträger vorzulegen. Dafür braucht es eine Erweiterung des STIP oder ein analoges Instrumentenpaket für nachhaltige Transportlösungen für alle Verkehrsträger und die Entwicklung entsprechender neuer Technologien und deren notwendiger Infrastrukturen.
Damit der STIP dem eigenen Anspruch eines strategischen Rahmenplans für alle Verkehrsträger gerecht wird, sollten weitere Investitionsfelder inkludiert werden. Dabei sind neben Effizienzsteigerungen bei bestehenden Transporttechnologien und -lösungen, der Nutzung von Digitalisierungspotenzialen sowie dem Aufbau von Lade- und Tankinfrastrukturen auch Investitionen in innovative Technologien gezielt zu fördern.
So kommt beispielsweise dem Verkehrsträger Schiene aufgrund seiner Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit eine besondere Rolle zu. Der STIP sollte daher auch Investitionen in den Blick nehmen, die die Kapazität des Eisenbahnsystems erhöhen. Dazu gehören das Europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem (ERTMS), das digitale Kapazitätsmanagement (DCM) sowie die Digitale Automatische Kupplung (DAK). Zudem sind Projekte zur Defossilisierung des Schienenverkehrs zu berücksichtigen, um den Ausstieg aus dieselbetriebenem Rollmaterial zu unterstützen, sei es durch klassische Streckenelektrifizierung oder durch den Einsatz von Batterie- oder Wasserstoffzügen sowie der dafür notwendigen Lade- / Betankungsinfrastruktur.
In der Schiff- und Luftfahrt ist es wichtig für kurzfristige Emissionseinsparungen an Effizienzsteigerungen bestehender Technologien zu arbeiten. Für langfristige Dekarbonisierung muss auch heute schon an bahnbrechenden neuen Technologien geforscht werden. Investitionen, zum Beispiel mit Hilfe des Clean Aviation Joint Undertakings, werden parallel in beide Felder benötigt. In der Luftfahrt werden Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation insbesondere für hocheffiziente Antriebssysteme, Elektrifizierung und Hybridisierung, kollaborative Plattformen, alternative Kraftstoffe und innovative Flügel- und Rumpfkonfigurationen gebraucht.
Der Hochlauf alternativer Antriebe im Straßenverkehr, v. a. Elektromobilität, setzt den vorauslaufenden, flächendeckenden und bedarfsgerechten Aufbau von Lade- und H2-Tankinfrastrukturen für Pkw und Nutzfahrzeuge einschließlich der erforderlichen Netzanschlüsse voraus. Das geringe Ambitionsniveau der AFIR und die bestehenden europäischen Finanzierungsinstrumente sichern den erforderlichen EU-weiten Hochlauf aktuell nicht ab. Das trifft in besonderem Maße auf Lade- und H2-Tankinfrastrukturen für schwere Nutzfahrzeuge zu. Ein Schwerpunkt muss dabei auf der Förderung von betrieblichen Ladelösungen liegen. Dies muss die EU-Kommission bei einer Erweiterung des STIP berücksichtigen.
Impressum
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Breite Straße 29, 10178 Berlin www.bdi.eu
T: +49 30 2028-0
Lobbyregisternummer: R000534
Redaktion
Marco Kutscher Referent
Mobilität und Logistik
T: +49 30 2028-1751 m.kutscher@bdi.eu
Petra Richter
stellv. Abteilungsleiterin
Mobilität und Logistik
T: +49 30 2028-1514 p.richter@bdi.eu
Anna Baierl Referentin
Mobilität und Logistik
T: +32 2 7921004 a.baierl@bdi.eu
Raffael Kalvelage Referent
Mobilität und Logistik
T: +49 2028-1528 r.kalvelage@bdi.eu
BDI Dokumentennummer: D 2141