10-11/2025
Plug-in-Hybrid: Ist das Doppelherz am Ende?
Das mit Verbrennungs- und Elektromotor ausgestattete Antriebskonzept ist vor allem bei Firmen durchaus beliebt. Da die tatsächlichen Verbrauchswerte aber meist stark von den theoretischen abweichen, ändert die EU die Vorgaben. Mit möglicherweise gravierenden Folgen. ab Seite 6
Großer NutzfahrzeugSchwerpunkt
Wir haben die neuesten Busse, Transporter und Pick-ups unter die Lupe genommen ab Seite 33
Winterreifentests von ÖAMTC und ARBÖ
Welche Modelle Ihre Fahrzeuge sicher von A nach B bringen und welche eher nicht Seite 30
Erfolgreiche Premiere des FLEET Drive
Über 100 Fuhrparkleiter testeten
53 Modelle von 22 Marken in 350 Testslots ab Seite 14




DIE MITARBEITER, DIE NIE PAUSE MACHEN


FINANZIERUNG GRATIS:



*Symbolfoto. Stand 01.10.2025. Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP. Verbrauch kombiniert: 5,4 - 11,1 l/100km; CO2-Emission kombiniert: 142 - 291 g/km. Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß der WLTP ermittelt und sind nur als Richtwerte zu verstehen. Aktionspreis exkl. Ust bei Finanzierung über Stellantis Financial Services. Gültig bei Kaufvertrag bis 31.12.2025 bei teilnehmenden Opel Partnern. Angebot von Stellantis Financial Services - ein Service der Stellantis Bank SA Niederlassung Österreich für Unternehmer - unterliegt nicht dem VKrG. Angebot inkl. Garantieverlängerung gratis für 48 Monate/120.000 km (gemäß den Bedingungen der Opel Austria GmbH). Details bei Ihrem Opel Händler. Winterkompletträder gratis gültig bei Kaufvertrag bis 31.12.2025 bei Finanzierung über die Stellantis Bank. Inkludiert vier Winterkompletträder exklusive Montage und Bolzen. Gültig für Gewerbekunden mit Fuhrparkgröße zwischen 0 – 30 Fahrzeugen. Keine Barablöse möglich. Nur solange der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Editorial
Liebe Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter!
Die FLEET Convention feierte
heuer im Juni ihr 10-jähriges Jubiläum und hat sich als DIE Veranstaltung rund ums Firmenauto in Österreich etabliert. Vor wenigen Wochen hat das zweite große Event der FLOTTE seine Premiere gefeiert, der FLEET Drive. Ausgehend von der Werft Korneuburg, konnten 53 Modelle von 22 Herstellern in 30-minütigen Slots auf öffentlichen Straßen getestet werden, eine Möglichkeit, die über 100 Fuhrparkverantwortliche namhafter Unternehmen gerne annahmen. Und dem FLEET Drive danach ein gutes Zeugnis ausgestellt haben, ebenso wie die Aussteller. Das neue Konzept hat Anklang gefunden, was uns nicht nur sehr freut, sondern auch eine Fortsetzung 2026 planen lässt. Alle Infos und Fotos finden Sie ab Seite 14 in dieser Ausgabe.
Geht’s dem PHEV an den Kragen?
Unser aktuelles Thema dreht sich dieses Mal um den Plug-in-Hybridantrieb. Gerade in Unternehmen eine durchaus beliebte Wahl der Fortbewegung und auch geeignet, um sich der E-Mobilität langsam und
BILD DES MONATS
quasi mit Netz und doppeltem Boden anzunähern. Denn ist der kleinere Akku leer, wird automatisch auf den Verbrenner gewechselt. Problem an der Sache: Viele Firmenautofahrer
Der erste FLEET Drive ist bei
Fuhrparkverantwortlichen und Ausstellern sehr gut angekommen, eine Fortsetzung folgt 2026.“
fahren ausschließlich mit dem Verbrenner und stecken das Auto selten bis nie an. Entsprechend weit sind die tatsächlichen Verbräuche daher vielfach von der Theorie entfernt. Und das wiederum hat die EU auf den Plan gerufen, den Faktor, der die prognostizierte elektrische Nutzung und damit die Ein stufung des CO2-Ausstoßes bestimmt, nach unten zu setzen, was den PHEVAntrieb für Unternehmen wie Autohersteller uninteressant machen könnte. Insofern etwas schade, da in den letzten

Monaten etliche Modelle mit durchaus namhafter E-Reichweite von mehr als 100 Kilometern auf den Markt gekommen sind. Apropos neue Modelle, wir haben in dieser Ausgabe zahlreiche neue Nutzfahrzeuge für Sie unter die Lupe genommen, vom Elektrobus über den Diesel-Transporter bis hin zum Pickup. Und darüber hinaus das größte Nutzfahrzeug-Werk von Stellantis in Italien sowie die Forschungs- und Entwicklungsstätte von Renault in Frankreich besucht und Blicke hinter die Kulissen geworfen. Wie Sie sicher bemerkt haben, liegt dieser Ausgabe der FLOTTE auch wieder unser Nachschlagewerk Fuhrpark-Kompakt bei, in dem Sie Ansprechpartner zahlreicher Unternehmen finden, vom Autohersteller über Fuhrparkmanagementanbieter bis hin zu Ladekarten.
Im Namen des Teams wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung mit der FLOTTE!
Stefan Schmudermaier Chefredakteur FLOTTE

Passend zum Nutzfahrzeug-Schwerpunkt: Dieser Transporter ist im Auftrag der Bierqualität unterwegs. Biertester in ganz Europa? Ein echter Traumjob! ;-)


EXKLUSIV
Aktuelles Thema 06
EU geht PHEV an den Kragen
FLEET Drive 14
Nachbericht der Fahrveranstaltung
Fuhrparkverband Austria 24
Umfrage Negativer Schadensverlauf
Fuhrpark-Portrait 28
Die E-Nutzi-Flotte von TKE
Kolumne 32
Eichen einer Ladestation
Rückblick 65
NSU Ro 80
Kurzmeldungen 10
Aktuelles aus der Mobilitätswelt
Dacia Produkttag 12
Updates von Spring bis Bigster
FLEET Drive 2025 14
Der Fahr-Event von FLOTTE
FLEET Drive: Impressionen 16
Der Tag in Bildern



FLEET Drive: Statements 19 Meinungen und Stimmung
Ausbau des Schnellladenetzes
Flotten-Übergabe an Biogena Wiener Elektro Tage 22
Volles Programm am Rathausplatz
& A1 23
E-Auto als Notfallakku für Handynetz
Fuhrparkverband Austria 24 Umfrage Negativer Schadensverlauf
aus der Industrie
patzt beim Crashtest
Das war der Business Travel Day
E-Nutzi-Flotte von TKE
als Risiko
bringt Premium-Grip
einer Ladestation
aus der Transporterwelt
auf Herz und Nieren
für den Movano
Schnell laden, viel beladen
im Werk Atessa
Jahre Sprinter & Zukunftsvisionen



FREIZEIT
Bott 41
Nachhaltige Lösungen
Toyota Hilux 42
Pick-up in GR-Sportausführung
VW Caddy 43
PHEV und innovative Klapp-Bank
Ford Ranger PHEV & e-Transit 44
Matsch fun unter Strom
VW Crafter 46
Mehr Technik für den Laderiesen
Toyota Proace Max 48
Mit Diesel auf die Langstrecke
AUTO
Auto-News 49
Wichtige Neuerscheinungen
Schon gefahren
KIA EV4 50
E-Kompakter aus Südkorea
Nissan Leaf 51
Neuauflage des E-Pioniers
Seat Ibiza 52
Update für den kleinen Katalanen
Alfa Romeo Tonale 53
Facelift für den Italo-Feschak
KGM Torres & Musso 54
Hybrid-SUV & E-Pick-up
Citroën C5 Aircross 55
Komfortbetontes SUV
Nissan Qashqai 56
Update für den E-Power-Antrieb
DS N°4 57
Auch der Diesel bleibt an Bord
Im Test
Ford Puma Gen-E 58
Neue Talente dank E-Power
Audi A6 Avant e-tron 59
Luxusstromer mit Ladeheck
Toyota Land Cruiser 60
Es kann nur einen geben
Fiat 600e 61
Wenn Charme Grenzen bricht
Mercedes EQE 62
Innere Werte über alles
Freizeit-News
Was sonst noch wichtig ist
63
Škoda Elroq RS 64
Die sportlichste Ausbaustufe
Rückblick 65
NSU Ro 80
Abschluss und Impressum 66




Beilage Fuhrpark-Kompakt
Das Nachschlagewerk für Ihren Fuhrpark
Droht ein doppelter Herzinfarkt?
Geht es nach aktuellen EU-Plänen, soll es Plug-in-Hybriden nun stärker an den Kragen gehen.
Das Ende der Fabelverbräuche hätte zugleich weitreichende Folgen für Hersteller und Kundschaft.
Steht die Kraft der zwei Herzen vor dem Aus?
Text: Roland Scharf, Stefan Schmudermaier
Es klang immer schon fast zu gut, um wahr zu sein: Im Ortsgebiet fährt man leise und sauber mit dem Elektroantrieb, und auf der Autobahn, wenn es mal weiter weggeht, kommt der Verbrenner – zumeist ein Benziner – zum Einsatz. Je nach Effizienz und Einsatzgebiet der passende Antrieb, dazu eine unschlagbare kombinierte Reichweite – mit dem Plug-inHybrid, so scheint es, hat man die perfekte Schnittmenge der Technologien, das Beste beider Welten kombiniert. Je moderner die Modelle, desto größer wurden Akkus und E-Reichweiten, sodass heutzutage dreistellige Kilometerleistungen auch in der Praxis erreichbar sind. Kein Wunder, dass die eigentlich schon fast totgeglaubte Technologie derzeit wieder ein Comeback feiert.
Fahren ohne Laden
Und dennoch bleibt ein ureigenes Problem bestehen, das sich die EU nun endgültig vorknöpfen möchte: Ist die Batterie einmal leer, muss man sie nicht mehr aufladen, sondern kann auch nur mit dem Verbrenner weiterfahren. Und der große Vorteil von Akku und Elektromotor an Bord würde sich ins Gegenteil kehren.
Gerade viele Fuhrparkverantwortliche können davon ein Lied singen, oft war das Ladekabel bei der Rückgabe des Autos nach Jahren noch originalverpackt, der durchschnittliche Verbrauch

dafür mitunter deutlich höher als beim guten alten Diesel. Vorteil für den Dienstnehmer bleibt der geringere Sachbezug von 1,5 Prozent, der freilich auf einem oft praxisfernen WLTP-Verbrauch basiert.
Sonderbarer Sonderstatus
Im Vergleich zu Fahrzeugen mit Mono-Antrieben wie Benziner, Diesel oder auch E-Autos werden PHEV (Plug-in-Hybrid-Vehicle) nicht nur in einem Fahrzyklus gemessen. Es gibt schließlich zwei Verbräuche zu messen, weswegen zuerst der Stromspeicher leergefahren wird, egal, wie viele Zyklen dafür gebraucht werden. Erst dann wird mit dem Verbrenner weitergemessen, ebenfalls mindestens einen gesamten Zyklus lang. Anders kommt man sonst schließlich nicht auf die getrennten Verbrauchswerte. Am Verfahren an


sich gibt es auch nichts zu kritisieren, in der Kritik steht aber der Utility Factor, jener Wert also, der festlegt, wie hoch der E-Anteil an der Gesamtfahrstrecke ist und nach dem sich der WLTP-Verbrauch richtet. Je nach elektrischer Reichweite variiert dieser: Bei PHEV mit 60 Kilometern E-Reichweite setzte man zum Beispiel einen Stromanteil am Antriebsmix von 80 Prozent voraus, bei Modellen mit höheren E-Reichweiten entsprechend mehr. Das führte schnell zu fabelhaften Normverbräuchen von teils unter einem Liter. Nicht sehr realistisch, wie sich dank des On-Board Fuel Consumption Monitor (OBFCM) herausstellen sollte.
Datenbanküberfall

Im Schnitt stoßen
PHEV 139 Gramm CO2 pro Kilometer aus, nicht wie angegeben lediglich 28 Gramm.“
Der OBFCM (siehe Kasten Seite 8) liefert nun nämlich erstmals verwertbare Daten, um herauszufinden, wie häufig PHEV an den Stecker kommen. So wurden konkret auf Basis von 127.000 im Jahr 2023 neu zum Verkehr zugelassenen PHEV die real erfahrenen Verbräuche ermittelt. Und diese Daten von der Europäischen Umweltagentur ergaben, dass die Fahrzeuge im Schnitt 139 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen – und nicht wie angegeben lediglich 28 g. Ein eklatanter Unterschied, der aber nicht unbedingt damit zu tun haben muss, dass die Fahrzeuge technisch nicht in der Lage wären, die WLTP-Angaben einzuhalten. Das Problem ist eher, dass die elektrisch gefahrenen Strecken weit geringer sind als ursprünglich angenommen. Und genau hier wird der Utility Factor nun entsprechend angepasst: In einem ersten Schritt soll von 60 auf 54 Prozent reduziert werden. Nach einer erneuten Evaluierung der Daten soll es in zwei Jahren dann zu einer nächsten Anpassung kommen. Konkret wird dann von nur mehr 34 Prozent E-Anteil gesprochen. Die Folgen wären natürlich spürbar.
Hersteller & Kunde
Als erstes kämen die Hersteller unter Druck. Plug-ins stellen einen wichtigen Teil zur Erreichung der CO2-Vorgaben dar – kann der EV-Anteil als ausgleichendes Element nicht schnell erhöht werden, drohen hohe Strafzahlungen. Zudem wäre die Attraktivität beim Kunden rasch dahin, da der Status als Low Emission Vehicle
verloren ginge und man somit etwa in Umweltzonen nicht mehr einfahren dürfte. In Österreich hat man sich mit solchen Limitierungen zwar noch nicht herumzuschlagen, dennoch würden die Verkaufszahlen von PHEV wohl spürbar sinken. Dass diese Fahrzeuge bei uns nämlich recht beliebt sind, liegt zum einen an der NoVA-Befreiung anhand ihres geringen Normverbrauchs, zum anderen wie erwähnt am niedrigeren Sachbezug. Beide Vorteile wären dann im Nu dahin. Da ein großer Anteil der PHEV in Flotten eingesetzt, wird und eine Tankkarte nicht sonderlich zum Aufsuchen einer Ladesäule motiviert, könnten ausgerechnet die steuerlichen Vorteile dieser Technologie dieser zum Verhängnis werden.
Methodik-Trick
Kritik an den EU-Plänen ließ nicht lange auf sich warten. Neben all den üblichen Meldungen über die Wichtigkeit dieser Brückentechnologie und den wertvollen Beitrag zu CO2-Reduktion kristallisierte sich die konkrete Frage heraus, ob die angewandte Methodik denn wirklich aussagekräftig sei. Diese basiere nämlich auf „unsicheren und teilweise veralteten Daten“, wie zum Beispiel das Baden-Württembergische Wirtschaftsministerium verkünden ließ. Ebenso sollten noch keine Schlüsse gezogen werden, solange die Evaluierung noch nicht abgeschlossen ist – und was
Analyse der Emissionen in der Praxis im Vergleich zu WLTP-Emissionswerten nach Zulassungsjahr
3,5
4

noch schwerer wiegt: Die zu Rate gezogenen Daten sind nur wenig aussagekräftig für Neufahrzeuge. Die Basisdaten stammen aus OBFCM-Auswertungen von 2023, nachdem ein Auto erst nach drei Jahren das erste Mal zur Überprüfung muss, wird hier somit mit Daten gearbeitet, die teils noch von 2020 stammen.
Elektrische Reichweiten steigen
Doch welchen Unterschied machen die teilweise deutlichen Fortschritte bei den E-Reichweiten wirklich? Fakt ist, dass bei aktuellen Modellen Strecken von mehr als 100 Kilometern durchaus realistisch sind. Die Akkugröße bewegt sich mittlerweile auch schon bei oftmals 20 kWh, zudem gibt es bei vielen auch schon eine Schnellladefunktion, womit die Problematik mit dem langsamen Nachladen bald nur mehr als Ausrede gewertet werden kann. Ein erstes Entgegenkommen gibt es jedenfalls: So wurden die Berechnungsformeln insofern gelockert, als dass die Zielvorgaben nun über drei Jahre hinweg gemittelt werden dürfen. An der grundsätzlichen Problematik, dass ein PHEV auch nach wie vor mit leerem Akku betrieben werden kann, ändert all das aber auch nichts.
Neue E-Autos machen der PHEVTechnik immer mehr einen Strich durch die Rechnung

PHEV versus Elektroauto
Da das Redaktionsteam der FLOTTE die neuesten Fahrzeugmodelle regelmäßig testet, verfügen wir auch über eine langjährige Expertise rund um Plugin-Hybride. Vor knapp 15 Jahren waren die rein elektrisch zu erzielenden Reichweiten mitunter sehr bescheiden, vor allem der Unterschied des damaligen NEFZ-Zyklus verglichen mit der Praxis war mitunter eklatant. Oftmals war der Akku schon nach weniger als 20 Kilometern leer, entsprechend gering auch der Anreiz, das Fahrzeug zu laden, erst recht, wo Ladestationen und Wallboxen alles andere als weit verbreitet waren. Über die Jahre
wurden die Batterien und entsprechend die Reichweiten größer, mittlerweile ist sogar die 100-Kilometer-Marke geknackt.
Oder gleich ein E-Auto?
Wirtschaftlichkeit und Ökobilanz stehen und fallen freilich auch hier mit der Häufigkeit des Nachladens. Wer zum Beispiel während der Woche 25 Kilometer ins Büro und wieder zurück pendelt, kann von Montag bis Freitag völlig emissionsfrei fahren, der längere Wochenendtrip oder Urlaub ist unproblematisch mit dem Verbrenner zu bewerkstelligen. Allerdings machen die neuen E-Autos der PHEV-Technologie immer mehr einen Strich durch die Rechnung. Schließlich sind die Reichweiten deutlich gestiegen, parallel dazu haben auch die Ladegeschwindigkeiten spürbar zugelegt. Zutaten, die die vielzitierte Reichweitenangst Jahr für Jahr kleiner machen. Und last but not least muss man auch noch den Wartungsaufwand in die Waagschale werfen, der bei einem Konzept mit zwei Antrieben naturgemäß deutlich höher ausfällt. •
Was ist der OBFCM?
Alle neuen Fahrzeugtypen müssen ab 2021 und alle neu zum Verkehr zugelassenen Pkw müssen ab 2022 über einen sogenannten On-Board Fuel Consumption Monitor (OBFCM) verfügen, eine Software-Einrichtung, die im laufenden Betrieb permanent den Kraftstoffverbrauch aufzeichnet. Im Falle der PHEV heißt das, dass sowohl der konsumierte Strom als auch die verbrannte Menge Benzin exakt verzeichnet werden. Für den Fahrer sind diese Daten nicht einsehbar. Sie können nur beispielsweise bei Überprüfungen wie der jährlichen § 57a-Begutachtung ausgelesen werden. Sinn dieser Einrichtung: ein Abgleich, ob die angegebenen Normverbräuche der Realität entsprechen. Zu diesem Zweck müssen die OBFCM-Werte an die Europäische Umweltagentur (EEA) in Kopenhagen gesendet werden, die diese auswertet und an die Europäische Kommission übermittelt. Auf Basis dieser Werte wird dann nachreguliert, beispielsweise eben der E-Anteil am WLTP-Zyklus für Plug-in-Hybride.
Machen Sie den Schritt zu besserer Mobilität.
ALD Automotive und LeasePlan sind jetzt Ayvens, Ihr führender Partner für Leasing und betriebliche Mobilität.

Better with every move.


WKW reduziert Verkehr in Inzersdorf
Sechs Wiener Unternehmen nehmen an der überbetrieblichen Mitfahrbörse der Wirtschaftskammer teil.
Haben zwei den gleichen Weg, spart gemeinsames Fahren nicht nur Sprit, sondern auch Verkehrsfläche. Ein simples Prinzip, das mit der ersten überbetrieblichen Mitfahrbörse der Wirtschaftskammer Wien in einem Pilotprojekt im Betriebsgebiet Inzersdorf umgesetzt wird. „Unsere Betriebe werden nicht nur in der Produktion und der Logistik immer nachhaltiger“, sagt Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Industrie. „Sie suchen auch nach innovativen Lösungen für ihre Mitarbeiter, die über das eigene Unternehmen hinausgehen.“ Aktuell sind sechs Unternehmen an Bord: Blaguss Reisen, Post, Prangl, Tele Haase Steuergeräte, Wiener Lokalbahnen und Wojnar’s Delikatessenerzeugung. Mit
Spendenaktion
Pro verkaufter Dose Diesel- oder BenzinSystemreiniger (bis 2. Dezember) spenden der ARBÖ und Datacol zwei Euro für den Sterntalerhof. In 90 ARBÖ-Prüfzentren stehen die Produkte bereit. Das Kinder- und Familienhospiz Sterntalerhof hilft in herausfordernden Lebensphasen. „Hoffnung ist das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann. Mit unserer Spende an den Sterntalerhof möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und ihre Familien in schweren Zeiten Lichtblicke erleben dürfen“, so KommR Mag. Gerald Kumnig vom ARBÖ.

einer kostenlosen App des Wiener Softwareentwicklers Fluidtime Data Services schließen sich Fahrer und Mitfahrer zusammen, um den Weg in die Arbeit gemeinsam anzutreten, nachdem die öffentliche Anbindung nicht gerade optimal ist. „Gerade in der Mobilität zeigt sich, wie wertvoll überbetriebliche Kooperationen sind“, sagt Michael Kieslinger, Geschäftsführer des App-Entwicklers. Die eingesparten CO2-Emissionen sind am Smartphone ersichtlich und natürlich gibt es auch Belohnungen. Wer fleißig Punkte sammelt, kann diese in Preise der teilnehmenden Unternehmen umwandeln. Firmen, die mitmachen wollen, melden sich unter bmm@wkw.at
Preis für Inklusion in der Unternehmenskultur
Im Rahmen der „Women Automotive Awards“ wurde Katherine Zachary, Regional Vice President Communications der Nissan AMIEO-Region, mit einem Preis ausgezeichnet, der ihr Engagement, gleiche Chancen für alle zu schaffen, würdigt. Sie möchte bei Nissan eine Kultur schaffen, „in der sich jeder gesehen, unterstützt und gestärkt fühlt. Inklusion entsteht nicht zufällig – sie ist das Ergebnis täglicher Handlungen, einer umsichtigen Führung und eines gemeinsamen Engagements für den Fortschritt“, so Zachary.


Vienna Drive, die
zweite
Vom 15. bis zum 18. Jänner präsentiert sich der Wiener Fahrzeughandel erneut im Rahmen der Vienna Drive in der Messe Wien. Die viertägige Veranstaltung –parallel findet wieder die Ferienmesse statt – zählte im Vorjahr 71.000 Besucher. Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels und Initiatorin der Vienna Drive, betont, dass auf diverse Wünsche und Verbesserungsvorschläge von Ausstellern und Besuchern eingegangen wird. 2025 war es schließlich die Premiere der Veranstaltung, die sich von der früheren Vienna Autoshow schon vom Konzept als echte Verkaufsmesse stark abhebt. Auch rund um das Automobil wird einiges geboten: Bei Dekra wird ein Batteriekapazitäts-Check für E-Autos vorgestellt, ein Stand klärt über Elektroautos und Anhängerkupplungen auf, ein anderer erklärt RDKS-Systeme und auch ÖAMTC und ARBÖ stehen bereit.


Bedeutender Schritt
Vor allem im Bereich für Hochleistungsanwendungen zählen Axialfluss-Elektromotoren als wichtiger Schritt in die Zukunft. Dr. Tim Woolmer (im Bild rechts) hatte die Idee dazu und sorgte mit der Gründung von YASA für deren Industrialisierung. Nun wurde Woolmer dafür mit dem „Porsche Preis der Technischen Universität 2025“ ausgezeichnet.

Time kürt Erfindungen
Ab 2026 wird ein neuer multi-adaptiver Sicherheitsgurt im Elektro-SUV Volvo EX60 dazu beitragen, Menschenleben zu retten. Schon jetzt zeichnete das Time Magazin das System als eine der „Erfindungen des Jahres“ aus. Bei größeren Insassen oder einem schweren Unfall wird die Gurtkraft erhöht, bei kleineren Insassen oder einem nicht so schweren Unfall wird die Gurtkraft verringert. Rippenbrüche und Co können so vermieden werden. Spannend: Mit OTA-Updates fließen laufend neue Erkenntnisse ein.
Forstinger-Sanierung abgeschlossen
Im September wurde die letzte Quote gezahlt, nach dem Sanierungsverfahren mit hartem Sparkurs für Mitarbeiter und Handelspartner möchte Forstinger nun sprichwörtlich wieder Gas geben. „Vor diesem Hintergrund und obwohl die Belastungen für die österreichische Wirtschaft hoch sind, hat es besonderen Symbolcharakter, ein solches Projekt umsetzen zu können“, sagt Geschäftsführer Rudolf Bayer in Bezug auf die Eröffnung der neuen Flagship-Filiale in Neunkirchen (NÖ). In ganz Österreich sucht Forstinger derzeit 40 Mitarbeiter.

1.000.000
Cupra feierte die Marke Mitte Oktober. Das Fahrzeug, ein Formentor, rollte im Stammwerk Martorell vom Band.
Spannend: Nur sieben Jahre seit Gründung waren nötig, um diesen Meilenstein zu feiern. Nun wird ein Formentor unter den Mitarbeitenden verlost.
Leonie gewinnt als erste Kfz-Mechanikerin Gold
Bei den EuroSkills in Dänemark zeigte Österreich, dass die duale Ausbildung höchste Qualifikation bringt. Eine Premiere gab es auch noch: Leonie Tieber vom ÖAMTC Steiermark setzte sich gegen 17 männliche Konkurrenten durch und holte erstmals Gold für eine Kfz-Mechanikerin. „Eine Spitzenleistung, die Geschichte geschrieben hat“, heißt es aus der Bundesinnung.

Das hybriddynamische Duo
Dacia kombiniert bei Duster und Bigster 4x4 und Automatik als Hybrid mit E-Power im Heck. Plus: Spring nun deutlich stärker, Facelift für Sandero und Jogger.
Text: Roland Scharf, Fotos: Dacia
Mit dem Bigster betrat Dacia das bei Flottenkunden sehr beliebte C-Segment bei den SUV, indes: Es gibt nur die Möglichkeit für Automatikgetriebe oder Allradantrieb, nie gemeinsam – bis jetzt. Denn der e4x4 kombiniert die beiden sehr beliebten Optionen mit einem völlig neuen Antriebsstrang. Vorne steckt der allseits bekannte 1200er-Dreizylinder mit Turbo und 131 PS, der an das übliche Renault-Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Gängen geflanscht ist. Am Heck hingegen sitzt ein E-Motor mit 31 PS und 87 Newtonmetern Drehmoment, der seine Power über ein elektronisch geregeltes Zweiganggetriebe (Stufe 1 für Offroad, Stufe 2 für die Straße bis 140 km/h) direkt an die Hinterräder abgibt.
Mal so, mal so
Heißt also: Man erspart sich nicht nur Verteilergetriebe und Hinterachsdifferenzial, sondern auch die daraus resultierende Verlustleistung. Den Platz nehmen die Hybrideinheit und der 0,8-kWhAkku ein, der nicht nur vom Dreizylinder mit Strom versorgt wird, sondern auch vom E-Aggregat im Falle der Rekuperation. Wann welche Räder angetrieben werden? Normalerweise die hinteren nur nach Bedarf, man kann aber etwa auch auf permanenten Durchtrieb schalten. Cool: Nicht nur Ganzjahresreifen sind ab Werk montiert, auch blieb die Bodenfreiheit mit 21 Zentimetern unverändert hoch. Die Gänge können nach Bedarf per Schaltwippen gewechselt werden und die Anhängelast liegt bei 1,5 Tonnen. Los geht es Mitte 2026, da die e4x4 normalerweise mit LPG-Zusatztank auf die Weltmärkte kommen. Die für uns interessante reine Benzinerversion lässt aufgrund der geringeren Nachfrage noch auf sich warten.
Schnuffi zeigt Muckis
Ja, stimmt, seit der Lancierung des Spring anno 2021 haben wir es hier schon mit der vierten Überarbeitung zu tun. Aber, so versicherte man uns, bleibt optisch bis auf ein paar Kleinigkeiten alles beim Alten. Dafür klotzte man bei der Technik: Es gibt eine komplett neue Batterie, die nun auf LFP-Bauweise setzt, beheizbar ist und auf 24,3 kWh kommt, mit denen eine WLTP-Reichweite von 225 Kilometern möglich sein soll. Zudem sitzt der Stromspeicher nicht mehr im Heck, sondern zentral im Unterboden für eine bessere Gewichtsverteilung, was bei der zweiten Neuerung nicht schaden kann: Der neue E-Motor kombiniert nicht nur zahlreiche Komponenten bis hin zur Leistungselektronik platz- und kostensparend in einem Gehäuse, die Leistung klettert zudem auf 70 oder wahlweise 100 PS, was für Spring-Verhältnisse eine Verdoppelung der Motorleistung darstellt! Und da auch das Drehmoment nicht nur deutlich höher ist und über einen längeren Drehzahlbereich gehalten wird, gab es sicherheitshalber einen Stabilisator an der Vorderachse und ein Heckspoilerchen dazu. Ärgerlich bei all dem Aufwand, dass auf eine P-Stellung des Wählhebels nach wie vor verzichtet wurde. Marktstart? Anfang 2026. •

Duster und Bigster kommen 2026 mit Automatik und Allrad mit Benzinmotor vorne und Elektro im Heck. Für Offroad gibts auch starren Durchtrieb


Beim Spring hat Dacia die Motorleistung fast verdoppelt. 100 PS und mehr Reichweite gibt es dank neuem E-Motor und neuem LFP-Akku. Rechts: Bigster-Allradstrang

Jogger und Sandero bekommen für 2026 ein sanftes Facelift inklusive Upgrade auf das neue Familiengesicht


Die Zukunft fährt Rad
Was früher als „nice to have“ galt, wird heute zum strategischen Bestandteil moderner Fuhrparkpolitik: Diensträder. Sie senken Kosten, entlasten den Fuhrpark, reduzieren Emissionen –und kommen bei Mitarbeitenden hervorragend an.
Immer mehr Unternehmen in Österreich setzen auf Fahrräder und E-Bikes als Teil ihrer Mobilitätsstrategie. Dabei geht es nicht um romantische Öko-Ideen, sondern um handfeste betriebliche Vorteile. Dienstfahrräder sind steuerlich attraktiv, fördern die Gesundheit der Belegschaft, entlasten den innerstädtischen Verkehr – und stärken das Image als nachhaltiger Arbeitgeber.
Poolrad & Jobrad
Diensträder im Unternehmen gibt es in zwei Varianten: Poolräder sind betriebliche Allrounder – sie stehen allen Mitarbeitenden zur Verfügung, etwa für kurze Wege zwischen Standorten, Botendienste oder Kundentermine. Sie sind unkompliziert zu verwalten, vielseitig einsetzbar und ideal für Betriebe mit wechselnden Einsatzbereichen. Personenbezogene Räder – das klassische „Jobrad“ – werden dagegen einzelnen Mitarbeitenden zugeordnet. Sie dürfen auch privat genutzt werden, was die Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen stärkt.
Emissionsfrei transportieren
Besonders spannend für Fuhrparkverantwortliche sind E-Transporträder, die in vielen Bereichen bereits Lieferwägen ersetzen. Der Samariterbund Wien zum Beispiel zeigt vor, wie das funktioniert: Für Botendienste, lokale Einsätze und die Zustellung von „Essen auf Rädern“ kommen dort elektrisch unterstützte Lastenräder zum Einsatz – leise, emissionsfrei und überraschend effizient. Ebenso positive Erfahrungen haben die Unternehmen des Projekts klimaentlaster.at gemacht. Sie haben ein Jahr lang E-Transporträder kostenlos getestet und in ihren Arbeitsalltag integriert.
Steuervorteile nutzen
Auch die steuerlichen Rahmenbedingungen sprechen klar für das Dienstrad: Fahrräder und E-Bikes sind vorsteuerabzugsberechtigt, die private Nutzung ist lohnsteuerfrei – es fällt also

kein Sachbezug an. Die Anschaffungskosten können wie bei Firmenfahrzeugen abgeschrieben werden, in der Regel über fünf Jahre. Positiv: Mitarbeitende behalten trotz Dienstrad weiterhin ihre Pendlerpauschale.
Rundum gut bedient
Wer keine großen Investitionen tätigen will, kann auf das Fahrrad-Abo oder Leasingmodell setzen. Wartung, Versicherung und Service sind dabei meist inkludiert – ein Rundumsorglos-Paket für Unternehmen, die flexibel bleiben wollen. Zudem lassen sich diese Modelle hervorragend in bestehende Fuhrparks integrieren, etwa als Ergänzung zu E-Autos oder Carsharing-Angeboten. •
Jetzt zur klimaaktiv mobil Förderung einreichen! Für 2025 stellt das Mobilitätsministerium 77 Millionen Euro an Fördermitteln für Aktive Mobilität zur Verfügung. Betriebe und Organisationen können sich bei der Entwicklung von nachhaltigen Mobilitätslösungen kostenlos beraten lassen und sich bei der Maßnahmenumsetzung mit bis zu 30 Prozent der förderfähigen Kosten aus Mitteln des Klima- und Energiefonds unterstützen lassen.
Kontakt & Infos: HERRY Consult GmbH
E-Mail: betriebe@klimaaktivmobil.at
Tel: +43 1 504 12 58 – 50 klimaaktivmobil.at/betriebe umweltfoerderung.at/betriebe jobrad.at

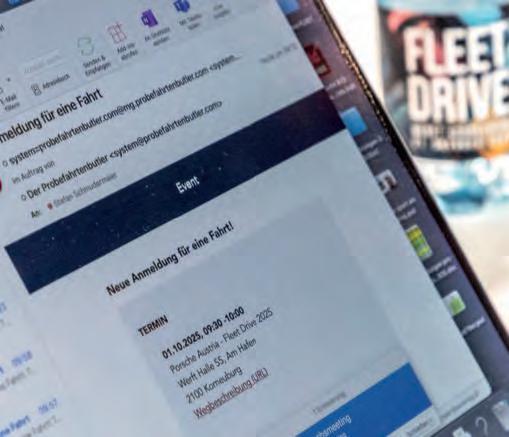






Erfolgreiche Premiere des 1. FLEET Drive
Die erste Auflage des FLEET Drive ging am 1. Oktober in der Werft Korneuburg erfolgreich über die Bühne. Mehr als 100 Fuhrparkentscheidungsträger konnten 53 Fahrzeuge von 22 Marken ausgiebig Probe fahren und ausprobieren, das Resümee von Besuchern und Ausstellern fiel durchwegs positiv aus.
Text: Roland Scharf, Stefan Schmudermaier, Fotos: Chris Hofer, Kevin Kada
Im Jahr 2015 ging die erste FLEET Convention über die Bühne, bereits damals haben wir über die Möglichkeit, Testfahrten anzubieten, nachgedacht. Allerdings sind sowohl das Setup der Veranstaltung als auch die Location in der Wiener Innenstadt keine guten Voraussetzungen dafür. Da uns aber von beiden Seiten der Branche immer wieder Nachfragen zum Thema Testfahrten erreichten, haben wir uns im Herbst 2024 dazu entschlossen, eine eigene, neue Veranstaltung ins Leben zu rufen, den FLEET Drive. Nach dem Besuch etlicher Locations fiel die Wahl schlussendlich auf das Gelände der Werft Korneuburg, die mit der Halle 55 nicht nur einen entsprechenden Rahmen bot, sondern auch verkehrstechnisch leicht zu erreichen ist und damit auch sehr gute Möglichkeiten für die Testfahrten mitbrachte.
53 Fahrzeuge von 22 Herstellern
Am 1. Oktober war es dann so weit, der Wettergott meinte es gut mit der Premiere des FLEET Drive, just zum Startschuss brach die Sonne durch die Wolkendecke über der Werft Korneuburg. Als Zeremonienmeister der ersten Fahrveranstaltung der FLOTTE fungierte Chefredakteur Stefan Schmudermaier, der das Programm zum offiziellen Start verkündete: 53 Fahrzeuge von 22 Herstellern standen zu Probefahrten bereit.
350 Testslots zu 30 Minuten
ging. Wie zum Beispiel funktioniert genau das Laden? Was muss ich da tun? Um auch hier praxisgerechte Situationen zu bieten, fungierte Smatrics als offizieller Ladepartner, und so konnte man im Rahmen der Testrunden im Schnellladepark Korneuburg auch das Befüllen der Akkus ausprobieren.
Ungezwungene Atmosphäre ohne Warteschlangen
Insgesamt wurden beim 1. FLEET Drive 350 Testfahrten mit 53 Fahrzeugen von 22 Herstellern zu je 30 Minuten durchgeführt.“
Durch die ungezwungene und entspannte Atmosphäre und die eingangs erwähnte Möglichkeit der Vorbuchungen der Slots ergab sich ein angenehmer Nebeneffekt: Dank des permanenten Kommens und Gehens an Probefahrtinteressierten gab es nie eine Warteschlange, weder bei den zu testenden Fahrzeugen noch beim Catering, wo es – schließlich war ja schon Oktober – u. a. Weißwürste und frische Brezn gab. Beliebt war auch das EspressoMobil, das fast schon zur Trademark der FLOTTE-Veranstaltungen wurde, dient es schließlich bei der FLEET Convention ebenso als Treffpunkt zum Fachsimpeln und Austausch unter Kollegen. Für die – glücklicherweise nicht nötige – medizinische Betreuung der Besucher stand Prof. Dr. Harald Hertz (im Bild links mit FLOTTE Chefredakteur Stefan Schmudermaier) zur Verfügung, der in den letzten Jahrzehnten als Notfallmediziner bei vielen Motorsport-Events tätig war.
FLEET Drive 2026 gilt als gesetzt
Drei Routen auf öffentlichen Straßen – vom Stadtgebiet bis zur Autobahn – standen zur Auswahl, natürlich war auch eine individuelle Routenwahl möglich. Jedem Fahrer stand eine Ansprechperson des jeweiligen Importeurs bzw. Händlers als Beifahrer zur Seite, um alle relevanten Details zum Fahrzeug zu liefern und die wichtigsten Fragen zu beantworten. Das Konzept sah auch vor, dass die interessierten Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter bereits vorab über das Tool des Partners Probefahrtenbutler 30-minütige Testslots buchen konnten, selbstverständlich war dies auch vor Ort noch möglich. Insgesamt wurden stolze 350 Probefahrten durchgeführt, was umgerechnet 175 Stunden an Tests bedeutete.
Starke Nachfrage nach elektrischen Modellen
Was sich bereits früh herauskristallisierte: Besonders gefragt waren die batterieelektrischen Modelle. Neue Technik kann auch heute noch faszinieren, wobei es hier nicht nur um das Fahren an sich
Kurzum: Das neue Konzept der begleitenden Probefahrten kam bei Ausstellern und Besuchern gleichermaßen gut an, was sich auch in der im Nachgang durchgeführten Befragung beider Zielgruppen gezeigt hat. Womit sich die Frage nach einer Neuauflage des FLEET Drive im Jahr 2026 fast von selbst beantwortet, jetzt gilt es nur noch das geeignete Datum zu finden.
Probefahrtenbutler als praktisches Online-Buchungstool Wie bereits erwähnt, war es den Besuchern möglich, bereits in den Wochen vor dem Event ihr individuelles Testprogramm zusammenzustellen, von dieser Möglichkeit wurde auch reger Gebrauch gemacht. Die technische Abwicklung dieses Termintools hat dabei unser Partner Probefahrtenbutler übernommen, mittels einer eigenen App hatten auch die Aussteller während der Veranstaltung jederzeit den Überblick, wer wann fährt und welche Slots noch verfügbar sind und vor Ort vergeben werden können. •
Beste Stimmung in Korneuburg
Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter hochkarätiger Unternehmen sowie motivierte Aussteller haben den Tag zu einem vollen Erfolg für alle Beteiligten gemacht.
Fotos: Chris Hofer






































Statements zum FLEET Drive
Nach erfolgten Testfahrten wollten wir von den Besuchern wissen, was sie von der Premiere des FLEET Drive halten. Einige Wortspenden finden Sie hier. Text & Fotos: Mag. Severin Karl

Neue Modelle für die Car Policy Gut, dass man hier eine breite Palette an Modellen von ganz klein bis luxuriös fahren kann. Mich interessieren hauptsächlich die Elektroautos: Es tut sich einfach viel am Elektro-Sektor, da muss man immer am Ball bleiben. Beim FLEET Drive kann ich neue Modelle finden, die in die Car Policy reinpassen.
Martin Zündel, Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH
Live statt nur am Papier
Kontakte schließen
Beim FLEET Drive kann ich neue Modelle kennenlernen und direkt mit den Importeuren Kontakte schließen. In den nächsten fünf Monaten stehen einige Kaufentscheidungen an, so kann ich unseren Mitarbeitern ein viel besseres Feedback geben.
Birgit Ertl, iC Consulting Ziviltechniker GesmbH
Auch hochpreisige Autos testen
Super, dass man so viele unterschiedliche


Look & Feel in der Praxis

Im Vergleich zur FLEET Convention, wo man alles theoretisch erlebt, kann man beim FLEET Drive das Look and Feel in der Praxis umsetzen und ein bissl was über die neuen Technologien herausfinden. Ich bin 1,97 Meter groß, man sieht in einem Prospekt nicht, ob man in ein Auto ergonomisch hineinpasst.
Helmut Steinkellner, Otis GmbH

Wir sind da, um zu sehen, was wir sonst nur vom Papier kennen, denn Fuhrparkleiter sitzen die meiste Zeit im Büro und bestellen, was sie nur auf Bildern sehen. Wenn man branchenfremd herkommt, ist es gut, verschiedene Modelle allein schon von den Größen her einmal live zu erleben.
Melanie Sommer (l.), Bettina Scheriau, SSI Schaefer IT Solutions GmbH
E-Entwicklung
anschauen

Marken Probe fahren kann –vor allem auch die hochpreisigen! Durchwegs positive Erfahrungen beim FLEET Drive, er ist gut organisiert und es sind engagierte Leute vor Ort.
Doris Pauller, Wiener Städtische Versicherung

Schön, dass wir mit so vielen Autos fahren dürfen. Es gibt kompetente
Betreuung mit gut geschultem Personal, das die Fahrzeuge erklärt. Autos sind unser tägliches Brot. Wir wollten uns anschauen, wie so ein Event läuft und wie sich die Elektrofahrzeuge entwickelt haben.
Susanne Haidinger (l.), Kerstin Glaser, Logistik Service GmbH
Kleine im Fokus Mir taugt das Testfahren, die Möglichkeit des Ausprobierens, der persönliche Kontakt mit den Firmen. Was mir fehlt, sind ein oder zwei Vorträge und mehr Kleinfahrzeuge im Testfuhrpark. Ich glaube, ich habe mich schon für ein Auto entschieden!
Hannelore Kurz, Caritas der Diözese St. Pölten
Ermöglicht Planung
Ich teste heute von den Marken her quer durch die Bank, auch die Antriebe sind gemischt, aber die elektrifizierten Modelle interessieren mich schon mehr.
Durch die Testmöglichkeit hat man eine Planung für die nächsten Jahre.
Dietmar Reuter, Flussbauhof Plosdorf

Ein guter Überblick
Man bekommt einen guten Überblick über die aktuellen Modelle. Ich bin erstaunt, wie gut viele Dinge bei einigen funktionieren und wie beharrlich andere an alten Dingen festhalten. Wenn man beruflich mit dem Auto verbunden ist, muss man zur eigenen Sicherheit immer auf dem Laufenden bleiben.


Kurt Ginner, Ginner GmbH
Kein Warten auf Testslots
Meine Erwartungen an den FLEET Drive haben sich erfüllt, man muss nicht auf seine Slots zum Testfahren warten und man kann Kollegen treffen und netzwerken. Ich finde es super, dass jemand mitfährt, damit man während der Fahrt Erklärungen bekommt.
Christian Haselbacher, immOH
Danke an die Partner des FLEET Drive 2025!








Ultraschnelles Laden wird immer wichtiger
Zwei Drittel der Österreicher sehen ultraschnelles Laden als wichtig an, Smatrics reagiert darauf mit Ausbau.
Text: Redaktion, Foto: Smatrics
Mit den steigenden Ladeleistungen der neuen E-Auto-Generationen wächst auch der Anspruch auf eine dementsprechende Ladeinfrastruktur. Waren bei der Gründung von Vorreiter Smatrics 2012 noch 50 kW das Maß aller Dinge und für damalige Verhältnisse richtig flott, erntet man dafür heute nicht mehr als ein mildes Lächeln. „Ende 2025 werden wir die Anzahl unserer HPC-Ladepunkte in nur zwei Jahren in Österreich mehr als verdreifacht haben. Damit schaffen wir Vertrauen in die E-Mobilität – und halten diese auf Wachstumskurs“, betont Thomas Landsbek, CEO von Smatrics EnBW.
44 neue Ultraschnellladepunkte
Die Verbund-Tochter knüpft an den Ausbau vom ersten Halbjahr an und konnte in den vergangenen drei Monaten 44 Ultraschnellladepunkte (HPC) an fünf Standorten in Betrieb nehmen. Fast drei Viertel der Ladepunkte verfügen über eine Leistung von 400 Kilowatt und ermöglichen damit das Laden von 400 Kilometern Reichweite in nur 15 Minuten. Ein Fortschritt, der bei einer Befragung auch für mehr als zwei Drittel der Bevölkerung als sehr wichtig erachtet wird. Bei E-Mobilisten liegt der Wert sogar über 90 Prozent. Eine Reservierungsmöglichkeit und die Serviceausstattung bei öffentlichen Lademöglichkeiten sind für jeden Zweiten sehr bis eher wichtig. Smatrics setzt auf neuralgische und stark frequentierte Standorte beim Handel und entlang von Autobahnen. Alle Standorte, die im letzten Quartal in Betrieb gingen, wurden bei Handelspartnern wie KGAL, Zgonc, Metro, Rewe oder Bauhaus errichtet. •
126 elektrische Minis
Biogena hat kürzlich 126 E-Mini übernommen und damit die zweitgrößte Flotte Europas. Text: Redaktion, Fotos: Mini
Das österreichische Familienunternehmen Biogena setzt seit Jahren auf eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, die auf verantwortungsvolles Handeln, ressourcenschonende Prozesse und umweltbewusstes Wirtschaften baut – von der Produktion bis zur Verpackung. Bereits 2021 übernahm das Unternehmen 82 Mini Cooper SE Dienstwagen. Julia Hoffmann, COO Biogena: „Mit der größten E-Mini-Flotte Österreichs setzen wir ein starkes Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit. Schon 2021 haben wir den Weg in Richtung Elektromobilität eingeschlagen – heute sparen wir damit rund 84.000 Kilogramm CO2 pro Jahr. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz, Teil dieser Entwicklung zu sein – und das macht uns als Arbeitgeber ebenso stolz.“ Stefan Klinglmair, COO Biogena, ergänzt: „Nachhaltigkeit ist bei uns tief verwurzelt. Allein hier am Standort produzieren wir bereits rund 50 Prozent des Stroms für unsere E-Fahrzeuge selbst. Damit verbinden wir Innovation mit Verantwortung.“

AutoFrey Geschäftsführer Josef Roider (li.) mit den beiden Biogena COOs Julia Hoffmann und Stefan Klinglmair
Über 50 Prozent der elektrischen Minis an Flotten Mit der Übergabe setzen Mini Austria und Retailpartner AutoFrey einen Meilenstein im neuen Agenturmodell, das im Oktober letzten Jahres in Österreich eingeführt wurde. Maximilian Stelzl, Head of Mini Austria: „Wir sind stolz auf die Weiterführung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren starken lokalen Partnern Biogena und AutoFrey. Die Auslieferung der größten E-Mini-Flotte in Österreich im Agenturmodell ist ein Meilenstein für uns und unser Retail-Partner-Netzwerk.“ Im vollelektrischen Segment verzeichnet die Marke ein Plus von über 160 Prozent. Eine wichtige Rolle kommt den Flottenkunden zu: Rund 56 Prozent der Mini-Neuzulassungen in Österreich sind in diesem Bereich zu verzeichnen. •


E-Erfolg am Rathausplatz
Mit mehr als 80.000 Besuchern können die Wiener Elektro Tage, erstmals inklusive PHEVs, als gelungen bezeichnet werden.
Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Mag. Severin Karl (8), Porsche Media Creative (1)
Über 60 Modelle von 22 Herstellern waren vom 25. bis zum 28. September auf dem Rathausplatz in der Bundeshauptstadt zu sehen. Die Wiener Elektro Tage haben sich somit zur echten Automesse gemausert. Nur dass man sich nicht durch Hallen schieben und erst recht keinen Eintritt zahlen muss. Und der Name stellt klar: Reine Verbrennermodelle kommen nicht in die Zelte der Aussteller!
Echte Vielfalt auf dem Markt
Im Vergleich zu den bisherigen Ausgaben des Events gab es in dieser Hinsicht aber eine kleine Änderung: PHEV-Modelle waren erlaubt – ein Zeichen der Zeit. Zu sehen waren diese etwa bei VW mit Golf und Tayron als eHybrid, den entsprechenden Varianten von Superb und Kodiaq bei Škoda oder dem Cupra Terramar und dem Ford Ranger mit Doppelherz und Steckeranschluss. Bei den heißesten Premieren haben dann doch eher die Elektroautos hervorgestochen: Vom Toyota Urban Cruiser bis zum Lexus RZ 550e, vom Leapmotor B10 bis zum Mazda6e oder vom Microlino bis zum Citroën ë-C5 Aircross wurde verdeutlicht, dass es mittlerweile eine Riesenpalette an Auswahlmöglichkeiten auf dem österreichischen Markt gibt. Auch unter den Modellen, die keine Premiere feierten, gab es Auffälliges:
Mit dem eTerron 9 konnte man bei Maxus einen vollelektrischen Pickup bestaunen und bei DS Automobiles stand die N°8, die in der idealen Batterie-Ausstattung-Kombination 749 Kilometer Reichweite ermöglicht. Ebenfalls ein „Wow!“ wert: Der Porsche Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket. Er beschleunigt schneller als ein Formel-1-Rennwagen, in 2,2 Sekunden sind 100 km/h geknackt.
Ein Schritt Richtung Inklusion
Thomas Beran, Leitung Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage, betont „zahlreiche Lösungen rund um Laden, Energie und Finanzierung“, mit denen die Veranstaltung mehr als nur eine Autoausstellung wurde. Moon Power, Wien Energie, Porsche Bank Group, Hankook, ÖAMTC, Autoscout24 und Bikeleasing Service zählten zu den Ausstellern. Beran weiter: „Die große Besucherzahl (Anm.: mehr als 80.000 Personen) zeigte eindrucksvoll, dass das Automobil nach wie vor großes Interesse weckt. Als Österreichs größtes E-Mobility-Event setzten wir damit ein starkes Zeichen und verdeutlichten, dass die Mobilitätswende längst in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist.“ Sehr gelungen fanden wir das neue Standkonzept ohne Podeste: So einfach ist ein Schritt Richtung Inklusion gesetzt! •


Das neue Standkonzept war im Wortsinn niederschwellig. Neben den Importeuren waren auch Aussteller wie Hankook und Co zu sehen







A1-Notbetrieb dank V2L
Ohne Kommunikation geht bei einem Blackout nichts mehr. Deswegen starten Renault und A1 ein Pilotprojekt, Mobilfunkstationen mittels V2L-tauglicher E-Mobile zu betreiben.
Text: Roland Scharf, Fotos: A1/APA/Hörmandinger
Der große Stromausfall in Spanien diesen Sommer ließ bei Mobilfunkbetreiber A1 das Licht aufgehen: Was, wenn etwas Vergleichbares in Österreich passiert? Schließlich könnten selbst Einsatzkräfte nicht mehr koordiniert werden. Christian Laqué, Chief Technology Officer für Technik- und Infrastruktur, hatte daraufhin den passenden Einfall: Warum nicht einen der herumfahrenden 200.000 Akkus als Notstromquelle verwenden?
12 Stunden Notbetrieb
Gemeint sind jene batterieelektrischen Fahrzeuge, die über die Vehicle-to-Load-Technologie (V2L) verfügen, über den Ladeport also auch Strom an externe Verbraucher abgeben können. Auch Renault gefiel die Idee so gut, dass man nun gemeinsam ein Pilotprojekt startete, bei dem man mittels Renault 5 und Renault 4 E-Tech Electric zwei Mobilfunkstationen im Raum Wien autark betreibt. Und das erstaunlich lange: 12 Stunden Betrieb sind bei einem voll aufgeladenen Akku möglich, wobei die Versionen mit den größeren Batterien zum Einsatz kamen. „Bei einem Akku-
Tanken und Laden mit der DKV Card
Sparen Sie Zeit und Geld mit dem größten energieunabhängigen Akzeptanznetzwerk in Europa mit rund 70.000 Tankstellen und rund 1 Millionen EVLadepunkten, davon alleine mehr als 2.400 Tankstellen sowie über 29.000 EVLadepunkte in Österreich.

v. l.: Christian Laqué, CTO A1; Ralf Benecke, GF Renault Österreich, Lukas Zehetbauer, BM Raasdorf, Christian Zeindlhofer, Resilienz-Leiter A1
stand von 15 Prozent beendet der Wagen den Vorgang dann automatisch. Mit den verbliebenen 60 Kilometern Reichweite kann man dann noch locker zur nächsten Ladestation fahren“, ergänzt der neue Generaldirektor von Renault Österreich, Ralf Benecke.
Kaum Anpassungen
Die Anpassungsmaßnahmen sind simpel: An den Sendemasten sind die Module für die Stromaufnahme zu tauschen, da über V2L nur mit 220 Volt gespeist wird. Das ist aber an einem Tag locker zu bewerkstelligen und kann innerhalb einer routinemäßigen Wartung durchgeführt werden, da diese Geräte ohnehin alle zehn Jahre gewechselt werden müssen. An den Renaults gibt es nichts zu verändern. Hier funktioniert V2L so simpel, wie wenn man eine Espressomaschine anhängen würde. Die einzige Einschränkung: Die volle Bandbreite kann theoretisch dank Autostrom zwar erreicht werden, dann wäre der Akku aber viel zu schnell leer. •
dkv-mobility.com


Negativer Schadenverlauf
Mehr als 80 Prozent der österreichischen Unternehmen sehen sich aktuell mit steigenden Kfz-Versicherungsprämien konfrontiert. Der Fuhrparkverband Austria möchte mit einer aktuellen Umfrage erheben, wie stark diese Entwicklung Fuhrparkbetreiber tatsächlich betrifft – und welche Faktoren hinter den Kostensteigerungen stehen. Text: Redaktion, Fotos: stock.adobe.com/Kadmy
Gemäß heise fleetconsulting GmbH müssen rund 80 Prozent der heimischen Unternehmen derzeit Prämienerhöhungen bei ihren Kfz-Versicherungen hinnehmen. Der Grund: Die Versicherungen schreiben insbesondere im Bereich der Kaskoversicherung rote Zahlen.Ein zentraler Kostentreiber sind die stetig steigenden Reparaturkosten. Die Stundensätze in Werkstätten und Lackierereien wuchsen zuletzt mit rund dem Doppelten der Inflationsrate. Hinzu kommen höhere Preise für Ersatzteile, Lacke und Materialien. Eine Auswertung langjähriger Erhebungen von heise fleetconsulting GmbH zeigt: Rund 60 Prozent der Reparaturkosten entfallen auf Arbeitszeit, rund 40 Prozent auf Material.
Teurer, komplexer, anfälliger Zudem wird die Fahrzeugtechnik immer aufwendiger. Etwa Windschutzscheiben mit Assistenzsystemen lassen die Schadenssummen rasch steigen. Parallel dazu lässt sich eine höhere Schadenquote bei Firmenflotten feststellen: Während Privatfahrer im Schnitt auf 0,3 Schäden pro Jahr kommen, liegen Flotten zwischen 0,8 und 1,2 Schäden. Auffällig ist, dass über 60 Prozent davon Bagatellschäden unter 1.500 Euro sind – meist verursacht durch Unachtsamkeit. Für die Betriebe sind Unfälle trotz Versicherung teuer: Inklusive Selbstbehalt, Ersatzmobilität und Verwaltungsaufwand summiert sich der durchschnittliche Schaden auf 1.750 Euro. In vielen Unternehmen tragen Fahrer keine oder nur geringe Selbstbehalte, was zu einem Gewöhnungseffekt führen kann. Die Folge: Negative Schadensverläufe

nehmen zu, weil die Versicherer für Reparaturen mehr zahlen als sie mit Prämien einnehmen.
Prävention statt Reaktion
Eine wirksame Gegenmaßnahme ist das proaktive Schadensmanagement. Dabei werden Schadensdaten analysiert, Risikofaktoren ermittelt und gezielte Trainingsprogramme abgeleitet. Ein bewährter Ansatz ist die Kombination aus Online-Fahrsicherheitstraining, Risikoevaluierung und Praxistraining. Unternehmen, die diesen Weg gehen, können ihre Unfall- und Schadenskosten um 30 bis 50 Prozent reduzieren. Spitzenwerte lagen sogar bei minus 65 Prozent. •
Jetzt mitmachen: FVA-Mitgliederumfrage
Der FVA möchte nun erheben, inwieweit sich die Ergebnisse von heise fleetconsulting GmbH widerspiegeln – und welche Maßnahmen bereits ergriffen werden. Dazu bittet der FVA mit dieser Umfrage um Ihre Einschätzung.
Mit Ihrer Stimme helfen Sie, ein präzises Stimmungsbild der Branche zu zeichnen. Die Umfrageergebnisse werden in der nächsten Ausgabe der FLOTTE und auf der Website www.fuhrparkverband.at veröffentlicht.

EU bringt neue Führerscheinregeln
Geht es nach dem EU-Parlament, soll der Führerschein nicht nur digital werden. Auch gibt es gezielte Maßnahmen zur Strafverfolgung und gegen Berufsfahrermangel.
Drei Jahre plus ein Jahr Übergangszeit, so lange haben die EU-Mitgliedstaaten nun Zeit, die neuen Führerscheinvorgaben in nationales Recht umzusetzen. Bis 2030 müssen die Maßnahmen also umgesetzt werden, die das EU-Parlament nun final abgesegnet hat. Einer der Hauptpunkte ist der digitale Führerschein, der über das Smartphone abzurufen sein muss. Zudem soll es künftig möglich sein, bei besonders schwerwiegenden Verkehrsdelikten, etwa Trunkenheit oder hohen Geschwindigkeitsübertretungen, ein EU-weites Fahrverbot
verhängen zu können. Als gezielte Maßnahme gegen den Fahrermangel ist geplant, das Mindestalter für LkwFahrer von 21 auf 18 Jahre zu senken, Busfahrer müssen künftig nicht mehr mindestens 24, sondern nur mehr 21 Jahre alt sein. Und gute Neuigkeiten für Camper gibt es auch: Wer ein spezielles Training in Anspruch nimmt, darf künftig Wohnmobile mit 4,24 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht fahren. Was definitiv nicht kommen wird, sind hingegen verpflichtende und regelmäßig wiederkehrende Gesundheits-Checks.


Neue Markierungen für Radfahrer im Test
Können Mehrzweckstreifen mit schmaler Kernfahrbahn als Sonderlösung für Verkehrsteilnehmer auf dem Fahrrad Sinn ergeben? Im Burgenland, in Kärnten und in Vorarlberg starten erste Pilotuntersuchungen. „Wir brauchen neue Ansätze, um Lücken im Radwegenetz abseits der Städte zu schließen, wo die örtlichen Gegebenheiten keine baulich getrennten Fahrradwege ermöglichen“, erläutert Sven Leitinger, Projektleiter bei Salzburg Research.

Flottenverwaltung mit Telematik à la Göteborg
Mit den strategischen Partnern Echoes, Geotab und High Mobility wurde Polestar Fleet Telematics entwickelt. Ein vernetzter Dienst, der „die Art und Weise verändern soll, wie Flottenbetreiber ihre Elektrofahrzeugflotten verwalten, überwachen und optimieren“, so eine Aussendung aus Göteborg. Die Möglichkeit, smarte und datenbasierte Entscheidungen zu treffen, soll laut Ramon Lingen (Head of Global Fleet and Pre-owned) sowohl dem jeweiligen Unternehmen als auch dem Planeten zugutekommen.
Zum Abschied in Rot
Hier führt das Jubiläum direkt in die Pension: 30 Jahre nach ihrer Einführung verschwindet die Klebevignette 2027 von den Windschutzscheiben. Ab dann gibt es sie nur mehr digital. 2026 kann man sich also zum letzten Mal die Autobahn- und Schnellstraßenmaut zum Preis von 106,80 Euro analog und feuerrot auf die Scheibe picken. Österreich folgt damit anderen europäischen Ländern wie Slowenien, der Slowakei, Ungarn und Tschechien mit rein digitalen Mautsystemen.

Nachhaltigkeit macht vor Bremssätteln nicht Halt
Mehr als fünf Jahre Forschung und Entwicklung hat es benötigt: Nun kann Brembo eine Legierung aus 100 Prozent recyceltem Aluminium vorstellen. Über den gesamten Lebenszyklus eines Bremssattels können die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Legierungen so um 70 Prozent reduziert werden. Die stilistischen Merkmale der italienischen Marke bleiben gleich, eine breite Farbpalette ist möglich. „Die von uns auf den Markt gebrachte Innovation ist ein Beitrag für die Zukunft, in der unsere neuen Produkte intelligenter, sicherer und nachhaltiger sind als ihre Vorgänger“, sagt

China-BEV versagt beim Crashtest
Im Rahmen des Euro-NCAP-Tests wurden neun Neuerscheinungen getestet. Der Dongfeng Box schnitt hierbei –im Vergleich zu den anderen – nur mit drei Sternen ab. Text: Roland Scharf, Fotos: ÖAMTC
Passive und aktive Sicherheit – es ist der Mix aus beidem, damit ein neues Modell beim Euro-NCAP-Crashtest die volle Punktezahl von fünf Sternen erreichen kann. Oft klappt dies bei allen Kandidaten. Heuer stach ein Newcomer aber negativ hervor: Der Dongfeng Box, ein günstiger E-Kompaktwagen aus China, erzielte lediglich drei von fünf Sternen. ÖAMTC-Techniker
Thomas Hava: „Im Frontalcrash gegen ein anderes Auto versagten mehrere Schweißverbindungen der Karosseriestruktur. Das ist ein ernstes Problem, denn die daraus folgende Deformation der Fahrgastzelle kann eine massive Gefahr für die Insassen darstellen.“ Entdeckt wurde das Problem beim Crashtest gegen eine mobile Barriere, simuliert wurde dabei ein Zusammenstoß mit einem anderen Auto bei 50 km/h.
Zahlreiche Fünfstern-Bewertungen
Zudem öffnete sich beim Neuling nach besagtem Aufprall die automatische Türverriegelung nicht, was Rettungskräfte entscheidende Sekunden kosten könnte. „Außerdem baute der Airbag zu wenig Druck auf, was im Test dazu führte, dass der Kopf des Dummies das Lenkrad berührte – und auch das Fehlen eines Schutzes, der beim Seitenaufprall verhindert, dass Lenkende gegen die Tür auf der Beifahrerseite geschleudert werden, muss bemängelt werden“, so Hava.
„Im Vergleich zu anderen kleinen E-Autos zeigt sich der Box deutlich schwächer: Modelle wie der BYD Dolphin Surf, Mini Cooper E, Lynk & Co 02 sowie die neuen Renault 4 und 5 erzielten vier oder fünf Sterne – ein klares Zeichen für die Sicherheitslücke beim Dongfeng Box.“ Bei den anderen Kandidaten gab es kaum Beanstandungen, wobei der Cadillac Optiq hervorstach. Ein kompaktes Elektro-SUV, konnte mit durchwegs guten Ergebnissen punkten. Fünf Sterne gab es zudem für Audi Q3, BMW X3, Hongqi EHS5, IM IM5, Mazda6e und MG MGS6 EV, vier Sterne für den DS N°8.
Erfolgreich nachgebessert
Ebenfalls positiv fiel der Tiggo des chinesischen Herstellers Chery auf: Nachdem bei früheren Tests Probleme mit dem Kopfschutz von Kindern in verschiedenen SeitenaufprallSzenarien festgestellt wurden, wurde das System überarbeitet. Die Modelle Tiggo 7 und Tiggo 8 erhielten nun –genau wie die baugleichen Ebro s700 und s800 – jeweils fünf Sterne. Hava abschließend: „Eine sehr konstruktive Reaktion des Herstellers – und einmal mehr ein Beweis dafür, wie wichtig unabhängige und strenge Tests im Sinne des Konsumentenschutzes sind.“ •













Webfleet zeigt KI-gestützte FP-Managementsoftware
Der Fleet Advisor inkludiert KI in das WebfleetFlottenmanagement für noch effizientere und einfachere Datenerfassung und -auswertung.
Text: Redaktion, Fotos: Webfleet, stock.adobe.com/Metamorworks
DGute Verbindungen schaffen gute Reisen
Unter dem Motto „Connect“ bot die ABTA ein weiteres Mal Treffpunkt und Bühne für die Community.
Text: Redaktion, Fotos: ABTA / Ulrike Rauch
Es war ein besonders großer und bunter Mix an Mitgliedern der heimischen Geschäftsreisewelt, den die Austrian Business Travel Association vergangene Woche im Novotel Wien Hauptbahnhof versammelte. Zahlreiche Speaker vermittelten Know-how und gaben Insights zu aktuellen Branchenthemen. Julian Jäger, Vorstand des Wiener Flughafens und Präsident des AIA, eröffnete nach Begrüßungsworten von ABTAPräsident Roman Neumeister das offizielle Programm und gab Einblicke in aktuelle LuftfahrtThemen, ÖBB Business Development Manager Fabian Maier zeigte Wege zu nachhaltiger Mobilität für Unternehmen auf.


Erstmals verlieh ABTA im Rahmen des Travel Day den President’s Award. Sieger war voestalpine, vertreten durch Bettina Leibetseder

KI hiflt bei Webfleeet bei der Analyse von Fahrer- und Fahrzeugdaten in Sekundenschnelle
er Clou des Fleet Advisor: Er kombiniert generative KI mit Echtzeit-Flottendaten, um Fragen in Sekundenschnelle zu beantworten. Anfragen in einfachen Worten eingeben, schon erhält man Antworten, etwa in Tabellen- oder Diagrammform. So kommt man im Nu zu Fahrereignissen, Kilometertrends, Leerlaufzeiten, aber auch Geschwindigkeitsüberschreitungen, starkes Bremsen, Kraftstoffverbrauch und mehr. Zudem gibt der Advisor Tipps zur Verbesserung und unterstützt mit Eingabeaufforderungen und Folgefragen. Etwa, um maßgeschneiderte Tabellen zu erstellen, Kennzahlen oder Daten zu vergleichen – beispielsweise nach Fahrzeug und Fahrer. „Webfleet ist als äußerst vielseitige Plattform bekannt. Mit dem Webfleet Fleet Advisor lassen sich nun sämtliche Informationen aus den Daten ganz einfach abrufen, wodurch die Entscheidungsprozesse im Fuhrpark einfacher, schneller und intelligenter werden“, sagt Jan-Maarten de Vries, President of Fleet Management Solutions. „Der gesamte Prozess verläuft wie ein einfaches Gespräch. Es müssen keine Berichte durchforstet oder Filter eingestellt werden, und man muss kein Datenexperte sein, um auf die Informationen zugreifen zu können. Jedes Teammitglied im Fuhrpark kann schnell Trends erkennen, Risiken identifizieren und datengestützte Entscheidungen treffen, um die Sicherheit für Fahrer und Fahrzeuge zu gewährleisten, die Produktivität zu verbessern und Kosten zu senken. Es ist ein großer und wichtiger Schritt in Richtung unserer zukünftigen Arbeitswelt, in der KI als Berater in jedem Flottenbetrieb präsent ist. Webfleet ist stolz darauf, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen.“
BT4Europe-Chairman Patrick Diemer und GBTA-CEO Suzanne Neufang steuerten der Veranstaltung internationale Perspektiven bei. Weiters präsentierte Anouar Mrissa von ehotel neue Technologien und Potenziale im Hotelbereich, Mert Coskun, Business Development Manager bei visumPOINT, verriet, was aktuell für USA-Reisen essenziell ist, und Wolfgang Hofmann (International SOS) beleuchtete das Thema Duty of Care. Der „Botfather“ des WienBot, Sindre Wimberger, gab ein Update rund um KI-Themen und Kirsten Hauft-Tulic, Strategic Purchaser Mobility & Travel Services bei Fronius International, zeigte auf, wie man in der Praxis für das Wohlergehen von rund 7.000 Mitarbeitern in 36 Ländern Verantwortung übernimmt. Der erstmals verliehene ABTA-President’s Award ging an Bettina Leibetseder von der voestalpine. Das Team des weltweit führenden Stahl- und Technologiekonzerns teilt seit vielen Jahren als Mitglied der ABTA Know-how sowie Insights und unterstützt mit persönlichen Besuchen bei zahlreichen Events im ganzen Land. •

Aufzeigen bei Aufzügen
Stets vollbeladen unterwegs zu sein, verlangt von Nutzfahrzeugen spezielle Talente, vor allem von den elektrischen. Für TKE fiel hier die Wahl auf ein bestimmtes Modell, das sich zum Liebling der Techniker mauserte.
Text: Roland Scharf, Fotos: TKE
Wie der Fuhrpark bei TK Elevator in Österreich gemanagt wird? Klar und strategisch: Eine Abteilung. Eine Frau. Die sich um alles kümmert, was rund um die 150 Pkw und 250 Nutzfahrzeuge tagtäglich anfällt. „Ja es gibt immer was zu tun“, kommentiert Doris Pabeschitz, die seit knapp zwei Jahren den Posten innehat, ihr Aufgabengebiet. Wobei: Eigenständigkeit ist bei TKE quasi Programm. Seit der Abspaltung von der thyssenkrupp AG 2021 agiert TK Elevator eigenständig, mit Niederlassungen in mehr als 100 Ländern. In Österreich mit neun Standorten vertreten, arbeiten 460 Mitarbeiter neben Neuanlagen und Modernisierung vor allem im Bereich Service, wo auch am meisten zu tun ist. Und das spiegelt sich auch am Schreibtisch von Frau Pabeschitz wider. Mehr als 400 Fuhrpark-User, 110 Ladestationen, 25 Werkstattpartner und sonstige Dienstleister sorgen für Kurzweile.
Vorwiegend Elektro

TKE setzt auf Nachhaltigkeit.“
Mag. Doris Pabeschitz
hat man alles im Blick.“ Gibt es Personal-, oder auch Fahrzeugrochaden, kann schnell und flexibel gehandelt werden. Ein Ansatz, der auch bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge von Vorteil ist. „Nach einem Marktscreening wird ein passendes Konzept erarbeitet, das Umweltaspekte, Kosten und Anforderungen an die Fahrzeuge beinhaltet. Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung funktioniert sehr gut, weshalb wir flexibel bleiben und die neuesten Fahrzeugmodelle am Markt in die Flotte aufnehmen können.“ Je nach Marktlage wird ein halbes Jahr im Voraus geordert und über eine Leasingvariante finanziert.
Je nachdem

Zu„Nachdem wir eine recht große Fahrzeugflotte haben, ist es von Vorteil, wenn alles an einem Punkt zusammenläuft, bei mir. So
Die generelle Strategie? „Wir möchten vor allem unsere Nutzfahrzeugflotte auf elektro umstellen, im Sinne der Nachhaltigkeit. Gerade Klein-LKW haben einen sehr hohen CO2-Ausstoß, den es zu reduzieren gilt.“ Die Elektro-Nutzfahrzeugflotte beinhaltet bei TKE derzeit 50 VW ID. Buzz, was 20 Prozent der Nutzfahrzeugflotte entspricht. „Darauf sind wir natürlich sehr stolz.“ Die Fahrzeuge sind auch ein Hingucker, der einem ins Auge sticht und im Gedächtnis bleibt. Von Vorteil im Hinblick auf eventuelle Umweltzonen, die in Städten eingerichtet werden sollen, sind sie auch. Natürlich kann nicht jeder Servicetechniker ein Elektroauto

fahren. Gerade in ländlichen Gegenden ist es essenziell, dass man eine Lademöglichkeit zu Hause installieren kann. Wenn das nicht möglich ist, kann sich das Elektroauto, je nach Weitläufigkeit des Servicegebietes als schwierig und das Laden desselben als zeitaufwendig und mühsam gestalten. In diesem Fall muss ein Verbrenner eingesetzt werden. Prinzipiell erhalten alle Elektroautofahrer eine Wallbox, um daheim zu laden – sofern dies eben für sie möglich ist. Die Abrechnung funktioniert automatisch und der Zeitaufwand ist gering. Zusätzlich haben wir an allen unseren Standorten Ladepunkte eingerichtet. Am Standort Wien Liesing werden die Ladepunkte sogar über die eigene PV-Anlage gespeist, die nicht nur die Elektroautos, sondern auch den gesamten Standort mit grünem Strom versorgt. Alle Elektroautofahrer sind angehalten vorwiegend an den Standorten zu laden. „Das klappt super, die Fahrer wechseln sich je nach Dringlichkeit und Batteriestand ab.“
Komplexe Anforderungen
Pkw werden auch fast ausschließlich elektrische angeschafft. Ob es Probleme bei der Umstellung gab? Ganz im Gegenteil meint Pabeschitz: „Bis auf ein paar Skeptiker wollten fast alle auf ein Elektroauto umsteigen. Die Fahrzeuge bieten eben einen viel höheren Fahrkomfort als Verbrenner und Sachbezug gibt es auch noch keinen.“ Dass auf dem Parkplatz vorwiegend Produkte aus dem VW-Konzern stehen, ist natürlich kein Zufall. „VW hat für uns einfach das beste Preis-/Leistungsangebot was sowohl Nutzfahrzeuge als auch Pkw betrifft. Dennoch gibt es auch andere Marken auf dem Firmengelände: „Man muss den Automarkt im Blick haben und offen sein für neue Anbieter und Möglichkeiten.“
Zurück aber zu einem Fahrzeug auf dem Parkplatz, das dann doch auffällt: dem VW ID. Buzz Cargo, der wie maßgeschneidert für TKE scheint. Pabeschitz: „Der Elektrobus von VW ist derzeit die einzige Variante am Markt, die unsere doch komplexen Anforderungen erfüllen kann, hinsichtlich Nutzlast, Reichweite und technischen Eigenschaften. Wir sehen uns natürlich regelmäßig um, und testen auch neue Modelle, aber bis dato hat kein anderes vollelektrisches Nutzfahrzeug unsere Ansprüche erfüllen können. Modelle mit höherer Nutzlast, jedoch mit Frontantrieb, punkten bei uns nicht, da wir nun Mal das meiste Gewicht im Heck geladen haben. Der kleine Wendekreis des ID. Buzz bietet vor allem in der Stadt große Vorteile.“
Keine Reichweitenthemen
Tatsächlich ist es so, dass die knapp 600 Kilo Nutzlast der ID. Buzz` meist voll ausgereizt werden, mit all dem Werkzeug an Bord. Und da kommt der nächste entscheidende Punkt zum Tragen: die Batteriegröße. „Modelle mit 50 Kilowattstunden Batterie sind einfach uninteressant für uns, da ist der VW mit den 77 oder jetzt 89 kWh passender. Reichweitenthemen hatten wir bis dato noch gar keine, obwohl wir unsere E-Transporter in ganz Österreich einsetzen.“ Für die Auswahl welcher Servicetechniker einen Elektrobus haben darf, gibt es neben der verpflichtenden Lademöglichkeit zu Hause Vorgaben zur täglichen Wegstrecke: „Die tägliche Route sollte nicht mehr als 150 Kilometer Autobahn oder 200 Landstraße umfassen. Das ist eine sehr konservative Vorgabe,

Dank großer Batterie ist der ID. Buzz bei TKE häufig im Einsatz. Bei den Pkw setzt man auf Škoda, aber auch BYD oder Hyundai. Vereinzelt im Feld gibt es auch Opel
aber so sind wir auf der sicheren Seite.“ Natürlich braucht so eine Umstellung auch ein Maß an Flexibilität: Techniker deren tägliche Kilometer gering sind, kommen auch ohne Lademöglichkeit zu Hause aus. „Es gibt Servicetechniker, die lediglich 100 Kilometer pro Woche fahren – sie kommen mit einer öffentlichen Ladekarte gut zurecht, da das Fahrzeug dann ja nur rund zwei Mal im Monat geladen werden muss.“
Schwarz auf weiß
Eine Strategie mit Erfolg. „Unsere Servicetechniker lieben ihren Elektrobus. Alleine wegen des unvergleichlichen Fahrkomforts, der Automatik und weil er einfach eine Liga für sich ist,“ ergänzt Pabeschitz. Bei Übernahme des Autos gibt es ein Info-Sheet mit allen Tipps zum Betrieb, „darin sind Fotos und eine Beschreibung enthalten, wie zum Beispiel das Fahrzeug zu bedienen ist und wo sich das Ladekabel befindet (in einer versteckten Bodenklappe). Zusammenfassend ist zu sagen, dass wir Anfang 2024 mit der Umstellung der Nutzfahrzeugflotte auf elektro begonnen haben und ich nur positives Feedback von unseren Mitarbeitern bekommen habe! Der VW ID. Buzz ist einfach top!“ •
TK Elevator in Fakten
Unternehmen
TK Aufzüge GmbH
Fuhrpark
Marken: Volkswagen, Ford, Škoda, Opel, BYD, Hyundai
Anzahl Pkw: 150; Anzahl Nutzfahrzeuge: 250
Laufleistung: durchschnittlich 30.000 km/Jahr
Behaltedauer: 4 Jahre (Leasing)
Mehr als ein Drittel „nicht genügend“
Heuer nahmen der ÖAMTC und seine Partnerclubs 31 Modelle unter die Lupe. Das Ergebnis: Preiswerte Pneus zeigten zum Teil besorgniserregende Ergebnisse.
Text: Roland Scharf, Fotos: ÖAMTC
Für den diesjährigen Winterreifentest haben der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen erstmals 31 Modelle von nur einer einzigen Dimension getestet. Bislang staffelte man die Kandidaten auf zwei Größen auf: „225/40 R18 ist eine zunehmend an Beliebtheit gewinnende Größe für Fahrzeuge der unteren Mittelklasse. Die 31 getesteten Modelle sind in sechs Premium-, elf Qualityund 14 Budget-Reifen aufgeteilt“, sagt ÖAMTC-Experte Steffan Kerbl. Und nicht nur das Starterfeld war bunt gemischt, auch die Ergebnisse: Alle Premium-Reifen konnten das Ergebnis „gut“ für sich beanspruchen, „befriedigend“ wurde zehn Mal vergeben, außerdem gab es vier Mal „genügend“ und satte elf Mal „nicht genügend“.
Premium-Reifen überzeugt


Zwei der getesteten Budgetreifen konnten zumindest das Ergebnis ‚befriedigend‘ erreichen.“
Steffan Kerbl
Ergebnis erzielen. Am besten schnitt der Goodyear UltraGrip Performance 3 ab, der sich somit als bester Allrounder hervortat, vor dem Michelin Pilot Alpin 5 und dem Bridgestone Blizzak 6. Nicht ganz so souverän schnitten die Modelle des Segments „Quality-Reifen“ ab, die heuer größere Probleme zeigten als noch im Vorjahr: „Drei der elf Produkte dieser Kategorie erreichten nur ‚genügend‘ und somit keine Kaufempfehlung. Die übrigen acht Quality-Reifen wurden immerhin mit ‚befriedigend‘ bewertet, was sie zumindest für eine eingeschränkte Kaufempfehlung qualifiziert“, so Kerbl.
Nur für Wenigfahrer akzeptabel
auch bei Umweltbilanz
Die Ergebnisse im Detail: Die Reifen der Premium-Kategorie konnten insgesamt überzeugen, wenn auch nicht auf ganzer Linie. Alle sechs getesteten Modelle erreichten „gut“, wobei der Kleber Krisalp HP3 und der Nokian Tyres WR Snowproof P leichte Probleme auf winterlicher Fahrbahn hatten und in dieser Kategorie knapp am guten Ergebnis vorbeischrammten. Da die Kategorien „Umweltbilanz“, Laufleistung, Abrieb und Effizienz stark gewichtet werden, konnten aber doch alle sechs ein gutes
Die elf Reifenmodelle, die die Bewertung „nicht genügend“ erhielten, hatten vor allem in der Kategorie „Fahrsicherheit“, die im Test am stärksten gewichtet wird, große Probleme. „Diese Reifen sind absolut nicht empfehlenswert und stellen ein echtes Sicherheitsrisiko dar. Auffallend war diesmal, dass alle diese elf Reifenmodelle aus dem Budget-Segment stammen. Wobei man der Vollständigkeit halber auch erwähnen muss, dass zwei BudgetReifen zumindest das Ergebnis ‚befriedigend‘ erreichen konnten –also leichte Schwächen aufwiesen, für Wenigfahrer aber dennoch eine akzeptable Alternative sein könnten“, so Kerbl weiter. Besonders negativ fiel der Syron Everest 2 auf, der dem klassischen Zielkonflikt der Winterreifen zum Opfer fällt. Kerbl: „Einerseits erzielt er das beste Ergebnis auf winterlicher Fahrbahn, andererseits ist er auf trockener und nasser Fahrbahn

nahezu unbrauchbar und gefährdet damit stark die Fahrsicherheit. Das sorgt letztlich auch dafür, dass er das schlechteste Ergebnis des gesamten Feldes erzielt hat.“
Große Unterschiede bei Nässe Besonders deutlich werden die Unterschiede beim Bremstest auf nasser Fahrbahn – ein Wert, der im ÖAMTC-Test besonders hoch gewertet wird: Während der Goodyear nach 31,7 Metern zum Stehen kam, brauchte der Syron 47,1 Meter – und damit immer noch rund fünf Meter mehr als der vorletzte Testkandidat. Zur besseren Verdeutlichung: Während der Goodyear schon zum Stehen gekommen ist, hat man mit dem Evergreen noch 40 km/h und mit dem Syron sogar knapp 46 km/h auf dem Tacho.
Je teurer der Reifen, desto besser sind also seine Eigenschaften? Oder wie lässt sich das Ergebnis besser interpretieren? Technikexperte Kerbl hat das letzte Wort: „Trotz der Ergebnisse dieser Testrunde lässt sich festhalten, dass man grundsätzlich nicht pauschal von der Preisklasse auf die Qualität der Reifen schließen sollte. Auch vermeintlich günstigere Modelle können immer wieder mit zufriedenstellenden Leistungen aufwarten und sich somit einen Platz unter den empfehlenswerten Reifen sichern.“ •
Grip auf Schnee als entscheidende Größe
Der ARBÖ und seine Partnervereine baten dieses Mal Winterreifen der Dimension 245/45 R19 zum Test. Die vorderen Plätze gehen ausschließlich an altbekannte Hersteller.
Text: Roland Scharf, Fotos: ARBÖ
Dass sich Premium-Winterreifen von günstigen Importprodukten teils gravierend unterscheiden, fand der ARBÖ im aktuellen Winterreifentest heraus. Dazu schickte man elf Reifen der Dimension 245/45 R19 in den Härtetest.

Billige Reifen fielen beim heurigen Winterreifentest des ÖAMTC fast alle durch, nur wenige waren o. k. Teure Produkte wiesen hingegen kaum Schwächen auf, waren aber auch nicht durchwegs fehlerfrei
Kritische Unterschiede
Gravierende Unterschiede gab es bei Nässe: Goodyear und Pirelli sind klar an der Spitze, dicht gefolgt von Continental, Bridgestone und Michelin. Abstriche gibt es bei Vredestein, Yokohama und Triangle. Besonders kritisch: Der Maxxis patzt bei Fahrsicherheit und beim Bremsen. Während der Pirelli aus 100 km/h bereits steht, zeigte der Tacho mit Maxxis-Bereifung noch knapp 40 km/h, auf Linglong und Vredestein sind es noch 30 km/h. Bei Trockenheit liegen die Resultate enger beieinander. Allerdings disqualifiziert sich der Maxxis durch überdurchschnittlich lange Bremswege. Der Triangle überrascht mit dem zweitbesten Ergebnis im Trocken-Bremstest.
Premium zahlt sich aus

Beim Bremsen auf Schnee waren Diskont-Pneus deutlich schlechter als Premium-Reifen
Die Testsieger
Winterreifen 225/40 R18 gesamt
1. Goodyear UltraGrip Performance 3
2. Michelin Pilot Alpin 5
3. Bridgestone Blizzak 6
Umweltbilanz
1. Goodyear UltraGrip Performance 3
2. Hankook Winter i*cept evo3 W339
3. Michelin Pilot Alpin 5
Die Tabellen sowie alle Details finden Sie unter www.oeamtc.at
In der Gesamtwertung setzt sich der Goodyear durch, der Michelin belegt den zweiten Platz, knapp dahinter der neue Pirelli. Dieser punktet zusätzlich mit einem Anteil von mindestens 55 Prozent recycelten oder biobasierten Materialien. „Wer beim Reifenkauf spart, muss sich bewusst sein, dass damit auch ein Qualitätsverlust einhergeht. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die Premiumhersteller den Erwartungen gerecht werden und gerade auf Schnee und vor allem nasser Fahrbahn, dem wohl häufigsten Fahrbahnzustand auf österreichischen Straßen, beste Brems- und Fahreigenschaft bieten“, zieht Erich Groiss, technischer Koordinator vom ARBÖ, Bilanz. •

Kommentar Überprüfen Sie Ihre Ladestation!
Ladestationen unterliegen vielen Anforderungen. Soll eine Ladung an einer Ladestation nach der abgegebenen Energie abgerechnet werden, müssen Ladestationen dem nationalen (Maß- und) Eichrecht entsprechen.
Text: Andreas Forster, Foto: Primephoto – Juana
Die Europäische Union arbeitet derzeit zwar an einer EU-weit einheitlichen Vorgabe für Ladestationen, bis dahin gelten jedoch die innerstaatlichen Regelungen. In Österreich legt die Verordnung über Ladetarifgeräte die eichrechtlichen Anforderungen für ebendiese fest. Diese Verordnung soll in einem weitreichenden Detail geändert werden.
Ein kleiner Schubser für Ladestationsbetreiber
Der Begutachtungsentwurf sieht vor, dass die Übergangsbestimmungen geändert werden. Nach den derzeit gültigen dürfen ab dem 01.01.2026 nur noch Ladetarifgeräte geeicht werden, die den Anforderungen der Verordnung entsprechen. Ladetarifgeräte, die einen MID-Zähler beinhalten, aber der Verordnung nicht vollständig entsprechen, dürfen bis 31.12.2025 geeicht werden und bis 31.12.2032 verwendet werden. Die Zahl der Ladestationen, die der Verordnung nicht vollständig entsprechen, ist hoch. Entspricht eine Ladestation nicht der Verordnung und nicht der Übergangsbestimmung (das heißt die Ladestation verfügt über keinen MID-Zähler), dürfen Ladungen an dieser Ladestation nicht nach der abgegebenen Energie abgerechnet werden. Um eine Ladung wieder nach der abgegebenen Energie abrechnen zu dürfen, müssen Betreiber die Ladestation umrüsten oder gänzlich austauschen. Das ist eine sehr teure Lösung.
die Fristen verlängert werden. Konkret sollen statt ab 01.01.2026 erst ab 01.01.2027 nur noch Ladestationen erstgeeicht werden dürfen, die der Verordnung vollständig entsprechen. Außerdem sollen Ladestationen, die den Anforderungen der Verordnung nicht vollständig entsprechen, aber über einen MID-Zähler verfügen, bis 31.12.2036 verwendet werden.
Eichungen nach Reparaturen weiterhin möglich
Ladestationen können wesentlich länger genutzt werden, ohne dass Konsequenzen drohen, falls Sie einen MID-Zähler haben.“
Andreas Forster

Ende der Übergangsbestimmungen
Die Übergangsbestimmungen haben daher eine hohe Bedeutung, da sie Betreibern von Ladestationen erlauben, Ladungen auch nach dem 31.12.2025 (weiterhin) nach der abgegebenen Energie abzurechnen, ohne die gesamte Ladestation austauschen oder nachrüsten zu müssen. Ein Ende der Übergangsbestimmungen naht und um eine mehrfache Umrüstung oder Ersetzung zu verhindern, sollen
Bei einer Reparatur eines eichrechtsrelevanten Teils, z. B. einer Reparatur innerhalb der Messkapsel, ist es notwendig, die Ladestation neu zu eichen. Die Verordnung hat dies bis dato ausgeschlossen, sodass Ladungen an reparierten Geräten, die der Verordnung nicht entsprechen, nach 31.12.2025 nicht mehr nach der abgegebenen Energie abgerechnet werden durften. Auch dieses Problem soll behoben werden. Nach einer Reparatur ist eine Neueichung unbegrenzt lange möglich, theoretisch damit auch über das Ende der Verwendungsfrist hinaus. Es besteht daher keine Gefahr mehr, dass eine zu reparierende Ladestation ersetzt werden muss.
Wann besteht Handlungsbedarf?
Das (Maß- und) Eichrecht ist ein Rechtsgebiet, das für die Elektromobilität wichtig und richtig ist. Es sollte selbstverständlich sein, dass Ladungen an Ladestationen nach der abgegebenen Energie abgerechnet werden. Noch selbstverständlicher sollte sein, dass die Messwerte, nach denen eine Abrechnung erfolgt, richtig sind. Das Eichrecht möchte Letzteres sicherstellen.
Betreiber von Ladestationen können mit diesem Begutachtungsentwurf ein wenig aufatmen. Sämtliche Fristen sollen verlängert und Ladestationen dadurch faktisch wesentlich länger genutzt werden können, ohne dass Konsequenzen drohen, vorausgesetzt, die Ladestation verfügt zumindest über einen MID-Zähler und damit über eine Energiezählung, die sich in sehr engen Fehlergrenzen bewegt. Der Begutachtungsentwurf ist ein sehr guter Anlass für Betreiber oder Eigentümer von Ladestationen, zu überprüfen, ob die eigenen Ladestationen der Verordnung entsprechen oder nicht und im letzten Fall zumindest über einen MID-Zähler verfügen. Ist einer der beiden Fälle zutreffend, besteht kein Handlungsbedarf. •
Andreas Forster ist Jurist mit langjähriger Berufserfahrung, der sich mit großer Leidenschaft rechtlichen Fragen rund um Mobilität und Elektromobilität widmet. Zudem ist er Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens iusbote, das seine Kunden effizient und proaktiv über relevante Rechtsänderungen in individuell bestimmbaren Themenbereichen informiert hält





Konvoi-Weltrekord zum Jubiläum
Der Ford Transit feierte 60. Geburtstag, bei der Transporter-Parade im UK waren 201 Fahrzeuge zu sehen.
Ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde ist ein feines Geburtstagsgeschenk. Genau dazu kam es im September, als Transit-Besitzer aus ganz Großbritannien zur großen Parade aufgerufen wurden. 60 Jahre Ford Transit wurden schließlich mit 201 Fahrzeugen gefeiert – die längste Transporter-Parade der Welt startete am Ford Dunton Technical Centre in Essex. Spannend war die Bandbreite der Modelle, mit der die Historie des kultigen Wegbegleiters abgedeckt wurde. Selbst die ersten Generationen aus den 1960er-Jahren waren zu sehen und natürlich auch die

Transporter Entry nun bestellbar
Mit einem Nettopreis von 27.900 Euro bietet der VW Transporter Entry einen besonders niedrigen Basispreis. Wählen lässt sich zwischen langem und kurzem Radstand sowie Dieselmotoren mit 110 bzw. 150 PS. Bei Trennwand und Heckklappe wird auf ein Fenster verzichtet. Bald folgt der Bestellstart für den Transporter als Doppelkabine mit Pritsche.

jüngsten E-Transit und Transit Custom mit Plug-in-Hybridantrieb. Zur Verfügung gestellt wurden die Fahrzeuge von Ford-Händlern, Um- und Aufbauspezialisten, Privat- und Gewerbekunden sowie Ford-Angestellten und Medienvertretern. „Dieser Rekord beweist die Leidenschaft, die seine Fans dem Transit entgegenbringen, und unterstreicht die Vielseitigkeit des weltweit meistverkauften Transporters“, sagt Lisa Brankin, Geschäftsführerin Ford of Britain and Ireland. Jeder Fahrer bekam ein digitales Zertifikat, nun Rekordhalter zu sein.
Erstmals Triple A
Ein Reifenlabel, das AAA bei den Bewertungen zeigt, gab es bei Ganzjahresreifen für Transporter bisher noch nicht. Continental meint, dass der neue VanContact A/S Eco der erste Pneu ist, der diese Bewertung aufweist. Mit dem EV-Checkmark-Symbol auf der Seitenwand ist er sowohl für Verbrenner- als auch für Elektromodelle geeignet.


Laden am Dach der Alpen
Auf 2.504 Metern Höhe hat die GROHAG am Hochtor die höchstgelegene DC-Ladestation Österreichs errichtet – ausgestattet mit Keba-Technologie. Beim Test durch einen E-Lkw von Hofmann & Neffe überzeugte die Station mit konstanter Leistung von 160 kW und bewies, dass sie auch für Schwerlastverkehr unter extremen Bedingungen taugt. Gefertigt wurde die Station im Osttiroler Keba-Werk.

Produktion der Vorserie gestartet
Der Mercedes VLE wird das erste Fahrzeug auf Basis der neu entwickelten, modularen und skalierbaren Van Architektur. Im umfassend modernisierten Werk Vitoria (Spanien) fährt gerade die Vorserienproduktion hoch, die von ausführlichen Produktionstests begleitet wird. 2026 kommt der VLE vollelektrisch auf den Markt, später auch als Verbrenner.

Quälerei für Qualität
Das Entwicklungszentrum der leichten Renault Nutzfahrzeuge in Villiers-Saint-Frédéric feiert seinen 60. Geburtstag. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen und gesehen, worauf es bei einem neuen Fahrzeug ankommt, wie weit die Digitalisierung fortgeschritten ist und welchen Stellenwert die Akustik hat. Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Renault
Fahrzeughersteller gewähren in der Regel nicht allzu gern einen Blick hinter die Kulissen, erst recht, wenn es dabei um Forschung und Entwicklung geht. Renault hat vor kurzem eine Ausnahme gemacht und nach Villiers-Saint-Frédéric, ein beschauliches Städtchen westlich von Paris, eingeladen. Denn dort ist seit 60 Jahren das Entwicklungszentrum der leichten Nutzfahrzeuge untergebracht. In den von außen unscheinbaren Industriehallen arbeiten über 1.000 Menschen an intelligenten Lösungen und Fahrzeugen, die den Nutzern einen echten Mehrwert bieten. Bereits 1965 erkannte Renault die speziellen Herausforderungen und gliederte die zuvor in der Pkw-Sparte angesiedelte Nutzfahrzeug-Entwicklung aus.
Physisch und digital
Im Laufe der Jahre wurden in VilliersSaint-Frédéric echte NutzfahrzeugLegenden zum Leben erweckt, dar-
unter Modelle wie der Kangoo oder der Trafic, um nur zwei Beispiele zu nennen. Bevor die Transporter aber zum Kunden rollen dürfen, wird jahrelang geforscht und entwickelt. Was zu Beginn noch mühsame Handarbeit in Form von Prototypen war,
Die Qualitätsanforderungen an unsere Nutzfahrzeuge sind gleich hoch wie jene an die Renault-Pkw-Modelle.“
Jean-François Vial, Leiter Nutzfahrzeugprogramm
wird mittlerweile virtuell deutlich erleichtert. Die dafür zuständige Abteilung nennt sich „phygitale Werkstatt“ und kombiniert physische Vorgänge mit digitalen. Die neue Estafette – der elektrische Lieferwagen mit Spezialaufbau für Paketdienste, der 2026 auf den Markt kommt – wurde in diesem Labor ent-
wickelt. Vorgabe war es, die Arbeitsabläufe des Paketboten möglichst effizient, ergonomisch und sicher zu gestalten. Im Gegensatz zum klassischen Lieferwagen geht dieser dann direkt vom Führerhaus in den Laderaum, holt sich das entsprechende Paket und verlässt das Fahrzeug durch die Schiebetür auf der Beifahrerseite. Dieser komplette Vorgang wurde „phygital“ entwickelt, ehe der erste klassische Prototyp gebaut wurde.
Akustik im Fokus
In einem eigenen, entsprechend großen Akustiklabor geht’s unerwünschten Geräuschen an den Kragen. Da die Fahrer oft den gesamten Arbeitstag im Auto verbringen, hat die Akustik eine ganz besondere Bedeutung. Schließlich bedeutet Lärm Stress und davon hat diese Berufsgruppe im Regelfall ohnedies schon mehr als genug. Oder wie es Amélie Malpot,
Managerin des Acoustics Performance Teams, ausdrückt: „Wenn ein Fahrzeug zum Arbeitsplatz wird, ist der akustische Komfort nicht länger Luxus, sondern eine Notwendigkeit.“
24 Stunden Testbetrieb
Nicht minder bedeutend ist die Robustheit und Verlässlichkeit der Fahrzeuge. Hält man sich vor Augen, dass Nutzfahrzeuge in einem 10-jährigen Einsatz bis zu 900.000 Türöffnungs- und -schließvorgänge, 450.000 Ein- und Ausstiege und bis zu 120.000 Kilometer im Jahr durchstehen müssen, weiß man, wie hoch die Ansprüche sind. Im Testund Entwicklungszentrum altern die Fahrzeuge deutlich schneller, 400.000 Kilometer oder 20 Jahre Nutzung werden hier in nur 18 Monaten abgebildet. Vor allem das Fahrwerk wird hier richtig gequält, auf eigenen Prüfständen wird der Alltag mit Hydraulikstempeln abgebildet und penibel festgehalten, wie sich das auf die einzelnen Komponenten auswirkt. 2.000 Sensoren liefern die Daten, die von 80 Ingenieuren ausgewertet werden, 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr.

In der sogenannten phygitalen Werkstatt werden Arbeitsvorgänge der Nutzer analysiert, bevor noch der erste Prototyp des Fahrzeuges gebaut wird
Auf- und Umbauten
Großes Augenmerk wird in VilliersSaint-Frédéric aber auch auf die Auf- und Umbauten gelegt, kein Wunder, werden doch 60 Prozent beim Kangoo, 55 beim Trafic und 50 beim Master modifiziert, ob klassische Fahrzeugeinrichtung, Kipper-Umbau, Rettungswagen, Behindertentransporter oder sogar Wohnmobil. „Es ist unerlässlich, die Bedürfnisse unserer Kunden zu antizipieren und sie bereits in den frühen Phasen von Fahrzeugprojekten zu integrieren, so Sébastien Alix, Leiter Umbauten. •


Im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Villiers-SaintFrédéric westlich von Paris testet und entwickelt Renault seit 60 Jahren die unterschiedlichsten Nutzfahrzeuge




Unser Servicepaket:
■ Individuell für alle Branchen
■ Praxisorientierte Planung
■ Nachgewiesene Sicherheit
■ Felxibles Baukastensystem
■ Immer perfekt organisiert
Jetzt online konfigurieren oder unsere Experten stellen Ihnen die passende Lösung vor.

Bott Austria GmbH
Telefon: +43 (0) 2236 660-431 office@bott.at www.bott.at
Mehr Platz für Waren und Personen
Unterschiedliche Gewerke haben unterschiedliche Anforderungen. Opel bietet den Movano nun auch mit Kofferaufbau an, zudem steht eine siebensitzige Doppelkabine zur Verfügung, beides ab Werk. Text: Redaktion, Fotos: Opel
Natürlich gibt es etliche Auf- und Umbaufirmen, die unterschiedliche Nutzfahrzeuge so adaptieren, dass sie den jeweiligen Ansprüchen gerecht werden. Alles aus einer Hand zu bekommen, ist dennoch der angenehmere Weg, wenngleich Lösungen ab Werk nicht immer verfügbar sind. Opel bietet den Movano mit der neuen Cargo Box, dem Leichtbaukoffer von Gruau, ab sofort in dieser Werkslösung in der Länge L4 an. Als Motorisierungen stehen Dieselmotoren mit wahlweise 140 PS und 180 PS mit 6-Gang-Schaltgetriebe an, für die stärkere Variante steht auch ein 8-Gang-Automatikgetriebe zur Verfügung.
Ladebordwand serienmäßig
Das Ladevolumen beträgt 21,5 m3, der Opel Movano Cargo Box ist dabei serienmäßig mit einer Ladebordwand mit einer Traglast von 750 Kilogramm ausgestattet. Besonders praktisch: Eine zusätzliche Schwenktür auf der rechten Seite erweitert die Funktionalität. Zur Serienausstattung zählen ein rutschhemmender Holzboden, Verzurrschienen, eine LEDDeckenbeleuchtung sowie robuste
Seitenwände. Auch die Nutzlast kann sich sehen lassen: Der Movano mit konventionellem Antrieb und 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht bietet eine maximale Zuladung von 810 Kilogramm. Das Fahrzeug ist ab sofort bestellbar, der Listenpreis beträgt ab 56.140 Euro netto, NoVA fällt keine an.
Mehr Platz für Team & Transport
Mit der neuen DoppelkabinenLösung von Durisotti wird der Opel Movano Kastenwagen zum flexiblen Mannschaftstransporter. Das vorgefertigte Modul mit vier zusätzlichen, vollwertigen Sitzplätzen inklusive Sicherheitsgurten und Kopfstützen wird hinter den Vordersitzen integriert. Die Sitzbank ist für Fahrzeuge in der Länge L3 und L4 verfügbar. Durch den Umbau entsteht Platz für bis zu sieben Personen – und dennoch bleibt je nach Fahrzeuglänge ein Ladevolumen von bis zu 12,5 m3 erhalten. Clever: Getränkehalter für alle Plätze und ein integrierter Stauraum unter der Sitzbank sorgen für zusätzlichen Komfort. Eine thermogeformte Trennwand mit Fenster trennt Fahrgast- und Laderaum.

Ab sofort gibt es den Opel Movano auch als siebensitzige Doppelkabine mit Diesel- und Elektroantrieb sowie bis zu 12,5 m3 Stauraum
Diesel- und Elektroantrieb

Als Verbrenner-Motorisierungen stehen die identen Motor- und Getriebevariationen wie beim Modell mit Cargo Box zur Verfügung. Darüber hinaus ist der Movano Kastenwagen Doppelkabine auch als Elektrofahrzeug mit 110 kWh Batterie und 200 kw/270 PS Elektromotor zu haben. Dies ermöglicht eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern nach WLTP. Der Listenpreis startet bei 45.740 Euro netto, auch hier ist keine NoVA fällig. Sowohl der Opel Movano Cargo Box Leichtbaukoffer von Gruau als auch der Opel Movano Kastenwagen Doppelkabine sind ab sofort in Österreich bei den Opel-Händlerpartnern bestellbar. Beide Modelle sind in die Opel Modellpalette integriert und von der Werksgarantie abgedeckt. •
Der Kofferaufbau des Movano Cargo Box bietet 21,5 m3 Stauraum, die serienmäßige Ladebordwand hat eine Traglast von 750 Kilogramm

Breiter, schneller, weiter
Mit dem neuen Transporter startet Volkswagen Nutzfahrzeuge in eine neue Ära, entstammt der Bulli doch nun einer Kooperation mit Volkswagen. Seine Markengene hat er dennoch behalten.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
Bei der Bekanntgabe der Zusammenarbeit von VW und Ford im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge ging ein Raunen durch die Branche. Ist der Bulli dann überhaupt noch ein echter Bulli? Mittlerweile können wir Entwarnung geben, auch für eingefleischte VW-Fans. Schließlich hat VW deutlich mehr getan, als nur die Markenembleme zu tauschen. Das Design stammt übrigens vom Österreicher Albert Kirzinger, außen und gerade auch innen ist der neue Transporter ein VW. Punkt.
Eiltransporter
Was die Technik betrifft, so hatte Ford den Lead, alles andere als ein Beinbruch, schließlich gibt es dort


geballte Nutzfahrzeug-Kompetenz. Die Antriebe – egal, ob Diesel, Plugin-Hybrid oder vollelektrisch – sind allesamt up to date und sehr effizient. Unser Testwagen rollte leise und vollelektrisch über die Straßen, angetrieben von einem 160 kW starken Elektromotor, der seine Kraft auf die Hinterräder überträgt. Und den Kastenwagen beinahe zu einem Sportwagen macht, handgestoppte acht Sekunden auf 100 km/h sind alles andere als alltäglich bei Nutzfahrzeugen. Die Ladekapazität hat im Vergleich zum T6.1 von 5,5 auf 5,8 m3 zugelegt, auch ein Verdienst der um 12,8 Zentimeter gestiegenen Fahrzeugbreite von nun 2,03 Metern.
Rund
300 Kilometer Reichweite
Die Batterie mit 64 kWh ermöglicht eine WLTP-Reichweite von 318 Kilometern, womit sich der VW e-Transporter auch für Einsätze außerhalb des urbanen Bereichs empfiehlt. Unser Praxisverbrauch lag mit 22,7 kWh etwas unter der Werksangabe, was – ohne Zuladung – eine Praxisreichweite von rund 280 Kilometern bei gemäßigten Temperaturen ergibt, im Winter ist davon freilich noch etwas abzuziehen. Dank einer Ladeleistung von maximal 125 kW

Cockpit und Lenkrad unterscheiden sich deutlich vom Schwestermodell Ford Transit Custom. Praktisch: Ausklappbare Querstreben erleichtern den Transport längerer Gegenstände auf dem Dach

ist der Akku des Kastenwagens in 38 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt. Mit 59.117 Euro netto ist der E-Transporter freilich kein Schnäppchen, diverse Aktionen nähern den Preis aber jenem der Dieselvariante an. •
Volkswagen Transporter Diesel-Alternative: TDI 125 kW L1H1
Testmodell: 160 kW L1H1
Leistung | Drehmoment 170 PS (125 kW) | 390 Nm218 PS (160 kW) | 415 Nm
Dauerleistung | Gewicht – | 1.944 kg 85 kW | 2.202 kg
0–100 km/h | Vmax k. A. | 175 km/hca. 8,0 s | 150 km/h
E-Reichweite | Antrieb – | Vorderrad 318 km | Hinterrad Ø-Verbrauch | Batterie 7,6 l D | – 23,2 kWh | 64 kWh
Laden AC – 11 kW, 7:00 h (0–100 %)
Laden DC – 125 kW, 38 min (10–80 %)
Laderaum | Nutzlast 5,8 m3 | 856 kg5,8 m3 | 1.023 kg
Basispreis | NoVA 45.663 € (exkl.) | 0 %56.422 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Reichweite, Beschleunigung, Laderaumgröße
Das vermissen wir: Allradantrieb (soll 2026 folgen)
Die Alternativen: Ford Transit Custom, Opel Vivaro, Renault Trafic Werksangaben (WLTP)

So behandelt man Könige
Ein Werksbesuch bei Stellantis Pro One in Atessa verdeutlicht, dass „Der Kunde ist König“ kein leerer Spruch ist. Auf einem 15 Kilometer langen Montageband können 1.200 Konfigurationen der Nutzfahrzeug-Palette hergestellt werden. Neuestes Modell ist die geräumige Cargo Box als Diesel und – nicht in Österreich – BEV. Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Stellantis
Warum man eine Visite in den Abruzzen planen sollte: Bergsteigen, Skifahren, einen der Nationalparks besuchen. An der Adriaküste gibt es auch Badeorte. All das lassen wir links liegen und fahren nach Atessa, wo Stellantis Pro One das größte Werk für leichte Nutzfahrzeuge in Europa betreibt. Dort werden mit dem CustomFitProgramm Kundenwünsche mehr oder weniger direkt von den Lippen abgelesen.
Hier bestellt Amazon selbst
Ein schönes Beispiel dafür ist die Sonderbestellung von Amazon: eine eigene Tür zwischen Innen- und Laderaum. Nachdem so etwa 20 Sekunden pro Lieferung gespart werden können, ermöglicht diese Individualisierung drei Lieferungen pro Tag mehr. „Zeit ist Geld“ wird so also Realität und der ebenso alte Spruch „Der Kunde ist König“ findet mit CustomFit seine Erfüllung.
Auch die Royal Mail nutzt die Möglichkeit, mit dem Umbau- und Personalisierungsprogramm Extrawürste zu bestellen: Magnethalter für geöffnete Türen sollen an besonders windigen Tagen die Sicherheit erhöhen.Werden sämtliche Konfigurationen zusammengezählt, die in Atessa vom Band laufen können – mit 15 Kilometern Länge eine ganz schöne Ansage – kommt man auf die

Zahl 1.200. Mit dabei: 14 Motoren, 4 Getriebetypen, mehr als 300 Optionen und 8 Transportergrößen.
Drastisch reduzierte Zeit
Die Einladung nach Atessa, nur zwei österreichische Medien durften die heiligen Hallen betreten, hatte einen brandaktuellen Grund: den Start der Produktion der Cargo Box, einer L4-Aufbauvariante mit einem Ladevolumen von 19,7 m³ und besonders geräumigen Abmessungen. Der Innenraum misst 4.400 Millimeter in der Länge, 1.950 Millimeter in der Breite und 2.300 Millimeter in der Höhe. Modelle mit Cargo Box sind für Citroën, Fiat Professional, Opel und Peugeot als Diesel bestellbar, die Preise starten bei 56.140 Euro netto. Keine BEV-Variante für Österreich.
Anne Abboud, Head of Stellantis Pro One, der Nutzfahrzeug-Einheit des Konzerns, spricht von einer „proaktiven und schnellen Erfüllung der Bedürfnisse professioneller Kunden“

Anne Abboud hat im Februar 2025 die Leitung der Nutzfahrzeugsparte bei Stellantis übernommen. Im Gespräch mit der FLOTTE vor Ort erklärt sie, dass die Zeit, bis ein Fahrzeug vom Werk zum Kunden kommt, drastisch reduziert werden konnte. Atessa wird aber eigentlich nicht mehr bloß als Werk gesehen, sondern als großes Ökosystem. Hier findet sich die größte Karosseriewerkstatt innerhalb von Stellantis und eine ständig modernisierte Lackieranlage, die den neuesten Kriterien der Energie- und Umweltverträglichkeit entspricht.
Umwelt, das passt gut zu den Klimazielen, die – von allen Herstellern – erreicht werden müssen. Abboud sieht hier ein kleines Dilemma, denn dafür müsste die Produktion von Verbrennermodellen runterfahren und verstärkt auf Elektromodelle gesetzt werden. Atessa ist dafür vorbereitet, auch die Modelle weisen immer bessere Reichweiten und Ladezeiten auf. „Doch der Markt ist noch nicht wirklich bereit“, sagt Abboud.
Freizeitfreund Ducato
„Wir müssen ready sein!“, heißt es von ihr auch bezüglich EV-Camper. Basisfahrzeuge dafür werden in logistisch sinnvoller Back-to-BackManier zu den Camper-Produzenten



Hier rollen sie vom Band, die leichten Nutzfahrzeuge der Konzernmarken: unten links zwei Basisfahrzeuge für Camperumbauten, rechts davon der L4 Cargo Box

gebracht. Die janusköpfigen Gefährte – natürlich auch mit Verbrenner – sind bei jeder Besichtigung ein beliebtes Motiv. Bezüglich
Atessa ist mehr als bloß ein Werk, es ist das größte Ökosystem von Stellantis.“
Anne Abboud, Head of Stellantis Pro One
Transformationswille seitens der Kunden heißt es auch hier, dass die E-Nachfrage niedrig ist. Insgesamt ist Stellantis Pro One aber unangefochtener Marktführer, wenn es um Freizeitfahrzeuge geht, vor allem der Fiat Ducato sticht hervor – nicht zuletzt mit zahlreichen Auszeichnungen.

Knapp 45 Jahre am Laufen Eingeweiht wurde das Werk Atessa 1981, über 7,5 Millionen Einheiten wurden bisher produziert. Mit dem CustomFit-Programm für Werksumrüstungen zählt es zu den Aushängeschildern des Konzerns. Arnaud Leclerc, Global Head von Stellantis CustomFit, unterstreicht am Ende noch das große Ganze: „Die direkten Produktionskapazitäten unserer Werke im Bereich CustomFit werden durch ein weltweites Netz von 550 autorisierten Partnern integriert und erweitert, die mit unserem offiziellen Netz zusammenarbeiten und so ein extrem weit verzweigtes Netz von Berührungspunkten gewährleisten.“ Auch auf Fahrzeuge mit PartnerAusstattungen gelten die gewohnten zwei Jahre Werksgarantie. •
Die Zukunft ist in Stein gemeißelt
Ende nächsten Jahres kommt die neue Sprinter-Klasse –pünktlich zu einem runden Jubiläum. Erste Details gibt Mercedes Vans, wenn auch sehr spärlich, nun bekannt.
Text: Roland Scharf, Fotos: Mercedes-Benz Vans
Wenn man es ganz streng nimmt, ist Mercedes Benz seit 130 Jahren in der Welt der Transporter vertreten. Damals, 1886, noch als „Lieferungs-Wagen“ tituliert, reichten 6 PS, 20 km/h und 300 kg Nutzlast, um den größten Konkurrenten, das Fuhrwerk mit zwei Pferden, das Fürchten zu lehren. 100 Jahre später musste es schon etwas mehr sein. Und so begab es sich nach dem Legendenschatz der Stuttgarter, dass man 1996 mit dem Sprinter das Segment der großen Lieferwagen neu definierte: Hoher Nutzwert trifft auf Pkw-hafte Fahreigenschaften. Und tatsächlich: Der Sprinter bildete sich quasi sein eigenes Segment, was vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass es ihn in allen erdenklichen und unerdenklichen Varianten gab. Zahlreiche Radstände, Höhen, Längen, Sonderaufbauten, es gibt wohl nur wenige, die nicht schon einmal in einem Sprinter gesessen sind – oder gelegen, falls es ein Rettungswagen war. Das ging wunderbar über drei Jahrzehnte und mehr als fünf Millionen Exemplare. Nun aber scheint es, als müsste man für die Neuauflage wieder ein wenig weiter ausholen.


Kommerz bestimmt
So zimmerte man für das große Jubiläum nicht nur in Handarbeit den allerersten Transporter der Firmengeschichte quasi aus dem Nichts zusammen. Auch meißelte man aus massivem Stein erste Design-Clous der neuen Sprinter-Generation und ließ auch ein paar Details aus. So gibt es nicht nur diverse Höhen und Längen, Diesel und Elektro. Die zivilen Busversionen werden auch optisch einen eigenständigen Aufbau bekommen. Die echten Nutzfahrzeuge gehen dafür noch mehr Richtung Vierkantbau, um den Nutzwert so hoch wie möglich auszulegen. Keine schlechte Idee, wenn man bedenkt, dass die geschäftlich genutzten Varianten gut 80 Prozent der Sprinterverkäufe ausmachen.
Volle Kontrolle
Die Optik geht in Richtung aktuelle Pkw-Designsprache mit mächtigem Kühlergrill und robustem Auftreten. Der Aufbau wird wirklich vierkantig – über Eckdaten, Abmessungen oder Gewichte schweigt man sich hingegen noch aus. Zu früh wäre das Entwicklungsstadium. Das glauben wir auch, denn während die Personenvariante schon Anfang des nächsten Jahres vorgestellt werden wird, lässt der Kommerzsprinter noch bis Jahresende 2026 auf sich warten. Sehr wohl gibt man Einblicke in den digitalen Antriebsstrang. MB.OS heißt das brandneue Betriebssystem, das alle Informationen und Daten bündelt und weiterverwurstet. Mercedes


Skulptur „The Boulder“ gibt Einblicke in neues Sprinter-Design. Erster Benz-Lieferwagen von 1886 und die aktuellen Modelle

Mit Fünfgangschaltgetriebe und 78 Saugdiesel-PS war der erste Sprinter keine echte Rakete. Aber auch nach heutigen Maßstäben lässt er sich sehr kommod fahren
selbst spricht über ihren neuen Bordzentralrechner von einem Superhirn, der all die einzelnen verbauten Steuerkastln ersetzt. Die Vorteile für den Nutzer? Er hat volle Kontrolle über die Fahrzeugdaten, kann etwa Fuhrparkmanagementsystem-Software problemlos integrieren und kommt ohne viel Aufwand auf alle buchhalterisch notwendige Nenngrößen. Außerdem soll künstliche Intelligenz das Arbeitsleben leichter machen, indem mühsame Tätigkeiten automatisch erledigt werden. Ein Beispiel? Läuft die 12-Volt-Batterie Gefahr, einzugehen, erkennt das unser Superhirn Tage vorher und kann die betreuende Werkstatt darüber in Kenntnis setzen. Ergo gibt es dann auch flotter einen Reparaturtermin, die Ausfallzeiten werden reduziert. Das spart Zeit und Geld – und das war 1886 ja auch schon ein guter Grund, sich einen Lieferungs-Wagen zu kaufen. •
Sanieren mit Weitblick
WABS Objektsanierung GmbH denkt langfristig und setzt auf nachhaltige Qualität. Bott Austria unterstützt mit Ausbau und Erhalt der Serviceflotte.
Text: Redaktion, Fotos: Bott
Mit Sitz in Linz und einer Niederlassung in Amstetten decken die etwa 100 Mitarbeiter von WABS ein großes Einzugsgebiet ab: Von Ober- und Niederösterreich bis Wien sowie im Norden Salzburgs saniert das Unternehmen Wohn- und Gewerbebauten. Der geschäftsführende Gesellschafter Ing. Mario Spiegl verfolgt eine nachhaltige Strategie, die sich sowohl unternehmensintern als auch auf die Kundenzufriedenheit positiv auswirkt. Beständigkeit ist hierzu ein wesentlicher Schlüssel – und ein wichtiger Grund, warum die WABS Objektsanierung GmbH bereits seit etwa 5 Jahren auf Fahrzeugeinrichtung von Bott setzt.
Restlos überzeugt
Es wird gerne behauptet, jeder sei austauschbar“, sagt der kaufmännische Leiter Roland Riegler, „aber ich bin da anderer Meinung.“ Der 34-Jährige ist sich des Wertes langjähriger Geschäftsbeziehungen und Mitarbeiterloyalität bewusst. Er sieht sie als einen wesentlichen Grundpfeiler des Unternehmenserfolgs und gemeinsam mit Paul Lindenbauer, der den Fuhrpark koordiniert und für dessen Servicierung verantwortlich ist, sowie den Lagerleitern Thomas Kirchmeier in Linz und

Christian Maierhofer in Amstetten steht er für das Wohlergehen der Mitarbeiter ein. „Der besondere Stellenwert einer guten Mannschaft kommt dann richtig zur Geltung, wenn die Arbeitsprozesse eingespielt und starke Bande geknüpft sind“, ist Riegler überzeugt. „Deshalb wollen wir, dass unsere Mitarbeitenden mit Stolz auf ihre Arbeit und WABS als Arbeitgeber blicken und hier ihre Zukunft sehen. Eine wichtige Rolle spielen dabei gute Fahrzeuge und eine hochwertige Ausrüstung – schließlich soll die Arbeit Freude machen und gleichzeitig unsere Kunden restlos überzeugen“, so Riegler weiter.
Flexibel geplant
vario3 passt in diese Philosophie. Sie ist bereits in nahezu allen der rund 75 Nutzfahrzeuge umfassenden Flotte eingebaut. „Wir haben uns unter anderem für Bott entschieden, weil die Einrichtung auf uns den hochwertigsten Eindruck gemacht hat“, sagt Riegler. „Hinzu kommt, dass wir die hohe Flexibilität bei der Planung gut gebrauchen können, um eine passende Lösung für alle Mitarbeitenden zu finden.“ Neben Trocknungstechnikern beschäftigt das Unternehmen auch Maurer, Trockenbauer, Maler und Tapezierer sowie Fliesen- und Bodenleger und Tischler – sowohl in Form von Spezialisten als auch von branchenübergreifend erfahrenen Fachkräften. „Die freie Gestaltbarkeit von Bott vario3, verbunden mit der Expertise unseres Ansprechpartners Herrn Stefan Hollrieder, hat uns zu einer Konfiguration verholfen, die allen Gewerken gerecht wird. Diese verwenden wir nun als Standardlösung in unseren Fahrzeugen – und planen dies auch in Zukunft“, erklärt Riegler. Im Sinne nachhaltiger Ressourcennutzung will das Unternehmen die langlebigen Einrichtungen für jeweils drei Fahrzeuggenerationen des Kauffuhrparks wiederverwenden. •

Mehr Gelände wagen
Im Kern ganz der Alte, haucht Hybrid-Power und GR-Auftreten dem Hilux eine ungeahnte Leichtigkeit ein. Das hat natürlich seinen Preis.
Text & Fotos: Roland Scharf
Das, was Toyota beim überarbeiteten Hilux besonders gut hingebracht hat: Er fühlt sich nach wie vor so an wie der knochige Haudegen, der er immer schon war. Mit großem Diesel, manueller Schaltkulisse, analogen Instrumenten und einer Lenkung, die noch beide Hände verlangt. Ganz können aktuelle Entwicklungen aber auch an ihm nicht vorbeigehen, sodass der Pick-up als einer der letzten Toyotas überhaupt nun hybridifiziert wurde. Und eigentlich konnte ihm nichts Besseres passieren.
Knackig grün
Zur Anwendung kam nämlich nur ein Mild-Hybrid-System, das 65 zusätzliche Newtonmeter Drehmoment beisteuert und die genau dort eingreifen, wo es dem Selbstzünder bislang immer etwas gemangelt hat: am unteren Ende des Drehzahlbands, wodurch der Hilux spontaner und leichter wirkt und sogar beim Fahrkomfort spürbar zugelegt hat. Die Drehzahl bleibt in vielen Fällen nun niedriger, somit auch Geräuschkulisse und Vibrationen. Noch ein Pluspunkt des kompakten MHD: Nutzlast, Wattiefe und Bodenfreiheit blieben unverändert, genauso die ganzen Geländefahrhilfen wie Untersetzung oder Diffsperren. Außer, man greift zum neuen Topmodell GR Sport. Sichtbar breiter und etwas höher,


kommt dieser zwar ohne Mild-Hybrid (das System bleibt in Österreich dem Invincible vorbehalten), dafür aber mit 30 Grad Böschungswinkel und 323 Millimeter Bodenfreiheit, was man vor allem beim Ein- und Aussteigen merkt. Nicht aber auf der Straße, denn dank überarbeitetem Fahrwerk und ebenso knackiger Sportsitze bleibt auch hier alles im grünen Bereich.
NoVA rockt
An Verarbeitung und Qualität gibt es nichts auszusetzen, wogegen aber selbst der Hilux nicht ankommt, ist eine andere Hürde: die NoVA. Als Pkw eingestuft, kassiert der alubefelgte, teilgelederte und topausgestattete GR den Steuersatz von 37 Prozent und kommt auf 87.090 Euro. Zum Vergleich: In Deutschland kommt man mit mehr als 20.000 Euro weniger davon. Zwar kann man Geld sparen, wenn man auf das GR-Paket verzichtet. Unter 60.000 Euro kommt aber nicht einmal mehr die Basis-Einzelkabine. •



Nur der GR hat den Toyota-Schriftzug im Grill. Knöpfe und Schalter arbeitshandschuhtauglich groß ausgelegt. Platz im Fond eher spärlich, dafür gibt es rote Gurte!
Toyota Hilux Flotten-Tipp: Invincible MHEV

Testmodell: GR Sport
Hubraum | Zylinder2.755 cm3 | 42.755 cm3 | 4
Leistung 204 PS (150 kW) 204 PS (150 kW)
Drehmoment 500 Nm ab 1.600/min500 Nm ab 1.600/min
0–100 km/h | Vmax10,7 s | 175 km/h10,7 s | 175 km/h
Getriebe | Antrieb 6-Gang aut. | Allrad6-Gang aut. | Allrad Ø-Verbrauch | CO2 10,1 l D | 264 g/km10,7 l D | 280 g/km
Ladefläche | Nutzlast 2,4 m2 | 1.100 kg2,4 m2 | 1.080 kg
Basispreis | NoVA81.972 € (inkl.) | 34 %87.090 € (inkl.) | 37 %
Das gefällt uns: das unverwüstliche Auftreten
Das vermissen wir: das deutsche Steuersystem
Die Alternativen: Ford Ranger Wildtrak

Werksangaben (WLTP)

Die 400-Prozent-Philosophie
Mehr Caddy als beim eHybrid mit Flexible-Option ist derzeit einfach nicht möglich. Doch macht all die aufwändige Technik den kleinen Transporter auch wirklich besser?
Text & Fotos: Roland Scharf
Steiles Heck, langer Radstand, Schiebetüren seitlich und große Heckklappen – ein Caddy ist und bleibt ein Caddy, weil er all das auf möglichst kurzer Außenfläche bietet, worauf es vor allem im urbanen Transporteinsatz tagtäglich ankommt. Im Falle des Flexible eHybrid haben es wir aber mit einer Version zu tun, die gleich im doppelten Sinn doppelten Nutzen bieten möchte. Einmal der Plug-in-Hybrid-Antrieb. Und dann die aufwändige Faltrücksitzbank. Aber macht das den Caddy auch gleich zweimal doppelt so gut?
Kalkuliert sparen
Starten wir mit den Motoren: Gegen den 116-PS-Benziner mit Turboaufladung kann man nichts Schlechtes sagen. Ruhiger Lauf, angenehme Kraftentfaltung, ausreichende Power für alle Lebenslagen. Der E-Motor pumpt teilweise da sogar etwas zu viel Extradrehmoment an die Vorderräder, was die Traktion leiden lässt und einen sanfteren Gasfuß erfordert. Wirklich glänzen kann der eHybrid dann, wenn die 19-kWh-Batterie vollgeladen ist, was in unter zwei Stunden geschafft ist: 100 Kilometer sind rein elektrisch nämlich immer drin, was für einen ganzen Arbeitstag locker
ausreicht. Auch eine Schnellladefunktion gibt es. Zwar nur mit 40 kW Ladeleistung, aber für den kleinen Akku reicht das meist. Verbrauch? Wir kamen auf rund 6 Liter, alles in allem, was voll o. k. ist, aber nicht bahnbrechend. Ob sich der Mehrpreis des PHEV von gut 10.000 Euro netto also auszahlt, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Weniger oder mehr
Gleiches trifft auf die Flexible-Sitzbank zu, die sich mit zwei Handgriffen und ein wenig Muskelschmalz nämlich vorklappen und senkrecht an die Vordersitze arretieren lässt. Cool, weil man so doch fünf Sitzplätze oder 1,4 bis 2,5 m3 Laderaum zur Verfügung hat. Nicht ganz so cool, weil ein normaler N1-Caddy auf 3,1 m3 Volumen kommt und gleich einmal um 2.000 Euro günstiger ist, dem man das doch etwas billig wirkende Hartplastik im gesamten Innenraum eher verzeiht als einer Version, die – so wie wir sie fuhren – auf schlanke 53.000 Euro kam. Entscheidend ist vielleicht eher: Beim Caddy hat man nun noch mehr die Wahl, wie man ihn für seine speziellen Bedürfnisse konzipieren kann. Einmal doppelt so gut reicht ja schließlich auch, oder? •


Die Rückbank lässt sich komplett aufstellen, was einen riesigen Laderaum ergibt. Nur als Flexible hat der Caddy Cargo im Fond Seitenscheiben



Volkswagen Caddy Flotten-Tipp: Cargo TDI DSG
Testmodell: Flexible eHybrid
Hubraum | Zylinder1.968 cm3 | 41.498 cm3 | 4
Leistung 122 PS 116 PS + 55 kW E-Motor
Drehmoment 320 Nm 250 Nm + k.A.
0–100 km/h | Vmax11,2 sec. | 184 km/hk.A. | 181 km/h
E-Reichweite | Batterie – 117 km | 19,7 kWh
Laden AC – 11 kW, 2,3 h (0–100 %)
Ø-Verbrauch | CO2 5,5 l D | 144 g/km0,5 l S | 11 g/km
Laderaum | Nutzlast 3,1 m3 | 696 kg1,4–2,5 m3 | 528 kg
Basispreis | NoVA28.788 € (exkl.) | 10 %40.478 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: die Idee des Transporters mit zwei Sitzreihen
Das vermissen wir: schönere Materialien, bessere Heckübersicht
Die Alternativen: mit so einer Fondbankkonstruktion? Keine! Werksangaben (WLTP)
Der Strom, der bergwärts fließt
Mittlerweile gibt es kein Modell von Ford Pro mehr, das nicht in elektrifizierter Version zu haben ist. Eine Testrunde mit dem Ranger PHEV und dem e-Transit Custom durch den Matsch des Bergischen Lands auf einem Gutshof mit klingendem Besitzer.
Text: Roland Scharf, Fotos: Ford Pro
Wie Sie hören, hören Sie: nichts. Es ist zugegeben ein wenig ungewohnt, in ein so großes Auto aufzusteigen wie den Ranger Wildtrak und dann weder das Brummen eines Diesel noch das Grummeln eines V6 zu hören. Stattdessen wühlt sich der Allrad-Pick-up durch den Matsch rund um Lohmar lautlos gen Sonne, als wäre die Steigung gar nicht vorhanden. Das Geheimnis lauert tief drin im Antriebsstrang: Beim PHEV schlummert zwischen den Streben des Leiterrahmens nämlich neben einem Vierzylinder-Benziner mit Turboaufladung und 233 PS auch ein E-Motor, der seine Kraft aus einem 11,8 kWh großen Akku schöpft und auch primär in Aktion tritt. Erst bei höherem Tempo oder wenn der Stromspeicher aufgebraucht ist, übernimmt der Schüttelhuber alleine das Zepter, was ebenfalls ungewohnt ist: Zumindest der Geräuschkomfort des Focus ST hat überlebt.
Fell in love with an alien Und während man sich Richtung Gipfel des Bergischen Lands wühlt, tauchen ein paar schlanke Fragen auf: Warum eigentlich hier? Zum Beispiel, weil wir uns auf den Gründen von Joey Kelly befinden. Richtig, dem Mitglied der Kelly Family, Extremsportler, Crash-Car-Fahrer und Allrounder, der diesen 1512 erbauten Hof vor fünf Jahren erwarb und zu einem hippen

Event-Center umfunktionierte. Mit Ford habe er lange und gute Kontakte, da lädt man natürlich gerne für ein paar Testrunden ein. Und zugegeben, bei all den Arbeiten, die auf so einem Gut anfallen, hätte der Plug-in-Ranger durchaus seine Vorzüge. Man muss ihn nur richtig einsetzen. Tatsächlich ist der verbaute Akku im Vergleich zu anderen Plug-in-Hybriden mit seinen 11,8 kWh nicht üppig groß. Mehr Platz gab es aber nicht im Unterbau, meinen die Techniker, zudem hätte man sonst beim Platz und vor allem

bei der Nutzlast sparen müssen, was bei einem Nutzfahrzeug natürlich auch nicht sehr schlau wäre. So aber gibt es Strom für rund 50 Kilometer, was in echt knapp über 30 sind. Ausreichend für die Einsätze am Kelly-Hof, und zudem unverzichtbar für Arbeiten am Feld: So gibt es auf der Ladefläche nämlich Power-Outlets mit 2,3 und 6,9 kW, womit man sich den Dieselgenerator erspart und selbst große Geräte locker mit dem Ford antreiben kann. Und zwar stundenlang, wenn es sein muss.
Cover the road Nachdem kaum ein Pick-up dieser Tage aber großartig auf losem Untergrund bewegt wird, lassen wir Joey auf seinem Anwesen zurück und begeben uns auf asphaltierte Straßen für weitere Erprobungen. Die Pkw-hafte Atmosphäre im Innenraum täuscht nicht: Von der Größe und dem Leergewicht von 2,6 Tonnen abgesehen, fühlt sich der Ranger Wildtrak zivilisiert und exakt an. Kein Wanken oder Schwanken, dazu eine Federung, denen Schlaglöcher genauso egal sind wie etwas

zu motiviert gefahrene Kurven – ein echtes Lob, wenn man bedenkt, dass die verbauten Reifen nicht unbedingt die besten für den Einsatz auf der Straße sind. Und der Motor? Ohne E-Unterstützung wirkt der Ford beim Losfahren ein wenig nervös, was auch an der zappeligen Zehngang-Automatik liegt, die aus dem Gangwechseln gar nicht mehr herauskommt. Bei der Überlandfahrt aber entspannt sich die Lage, das Dröhnen der Reifen übertönt im Nu das Nuscheln des Benziners und die Verbräuche sind bei bedachtem Einsatz des Gaspedals sogar unter neun Liter zu bekommen. Ein idealer Straßen-Pick-up also? Jein. Zwar gibt es auch eine MS-RT-Variante davon, mit ausgestellten Radläufen, Breitbereifung und Sportfahrwerk, aufgrund der mühsamen Zulassungsverordnungen in Österreich und der ewigen NoVA-Thematik wird dieser in Österreich aber gar nicht erst angeboten.
Peace on earth
Dass Ford Pro derzeit blendend unterwegs und bei den leichten Nutzfahrzeugen in Deutschland sogar Marktführer ist, liegt aber eher am guten Modellmix. Ranger, Connect, Courier, der Transit – alle gibt es als Verbrenner und in elektrifizierter Version, wobei es eine Variante gibt, die wir an dieser Stelle besonders hervorstreichen wollen: den E-Transit Custom. Die Allzweckwaffe aus Köln, gebaut in der
Türkei, erhältlich in unterschiedlichen Längen und Höhen, als nackter Kasten oder so wie hier als hübsch gemachter Cruiser mit dezenter Verspoilerung und schicken Alurädern. Seine Eckdaten: 64-kWh-Akku, 329 Kilometer Reichweite nach WLTP, Heckantrieb für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und 125 kW Ladeleistung, womit der verbaute Stromspeicher in vier 39 Minuten wieder zu 80 Prozent voll ist. Wem das nicht genügt, der kann noch in eine Wärmepumpe investieren, womit die Reichweite noch einmal um zehn Prozent gesteigert werden kann. Ähnlich variabel die wichtigste Größe: der Laderaum. Von 5,6 bis 6,8 Kubikmeter sind möglich, da steht der EV den Rudis in nichts nach.
An angel
Dem giftgrünen Custom MS-RT, der optisch einen auf besonders dicke Hose macht, nähern wir uns lieber gar nicht erst, weil auch der keine Chance auf eine Markteinführung bei uns hat. Indes: Schon die normalen Versionen lassen sich direkt und knackig fahren, was bei einem Nutzfahrzeug besonders wichtig ist: Ein wenig Spaß bei der Arbeit soll ja bekanntlich sehr motivierend wirken. Und somit bleibt bei all dem natürlich die ewig und einzig entscheidende Frage: Wie weit kommt man wirklich? „Oh it hurts“ braucht Joey jedenfalls nicht anstimmen. 250 Kilometer gehen easy. Der Rest liegt im rechten Fuß des Fahrers. •



Alle Ford-Nutzis gibt es in elektrifizierter Variante. Custom hübsch zurechtgemacht als Trans-Sporter, Gastgeber Joey Kelly mit CvD Roland Scharf, Ranger PHEV ideal für Glamping
Ford
Pro Pick-up: Ranger Wildtrak PHEV Transporter: e-Transit Custom Leistung | Drehmoment 281 PS (207 kW) | 697 Nm136 PS (100 kW) | 415 Nm 0–100 km/h | Vmax9,2 s | 170 km/hk.A. | 112 km/h
Getriebe | Antrieb 10-Gang aut. | Allrad 1-Gang aut. | Hinterrad
Reichweite | Batterie43 km | 11,8 kWh328 km | 64 kWh
Ø-Verbrauch | CO2 6,4 l S | 70 g/km22,4 kWh/100 km
Laden AC 11 kW, 4 h (0–100 %) 11 kW, 3:90 h (10–100 %)
Laden DC – 125 kW, 39 min (10–80 %)
Laderaum | Nutzlast 2,24 m2 | 940 kg5,6 m3 | 970 kg
Basispreis | NoVA45.780 € (inkl.) | 0 %49.100 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: für jeden Zweck der passende E-Transporter
Das vermissen wir: die MS-RT-Versionen am österreichischen Markt
Die Alternativen: zum PHEV-Ranger keine. Custom: VW Transporter & Co Werksangaben (WLTP)

Des Platzmeisters neue Talente
Dass der geräumige Crafter eine Modellpflege bekommen hat, fällt fast nicht auf. Erst wenn man Platz genommen hat und sich (beinahe) wie in einem Passat fühlt.
Text & Fotos: Roland Scharf
Grundsätzlich: Dass sich bei der Überarbeitung des aktuellen Crafter, den VW ja doch schon 2015 lancierte, kaum etwas verändert hat, ist eine gute Nachricht. Platz gab es immer schon in Hülle und Fülle, Übersicht und Verarbeitung sind tadellos und das Fahrverhalten ist nahe dran an einem großen und etwas übergewichtigen Pkw, wenn man sich einmal an die Dimensionen gewöhnt hat. Es gab also nichts Zwingendes, das es zu verbessern gegeben hätte, somit konzentrierte man sich hauptsächlich auf die Anpassung des Cockpits an die aktuelle VWN-Soft- und Hardware-Struktur. Kenner der Marke wissen, dass dies viele Sonnen-, aber auch ein wenig Schattenseiten hat.
Sympathisch ehrlich
Das volldigitale Kombiinstrument zum Beispiel ist eine sinnvolle Ergänzung für ein echtes Arbeitstier. Viele Informationen werden schnell und klar angezeigt, und allein die Tatsache, dass so die Öltemperatur stets im Blick ist, kann verhindern, den Zweiliter-Diesel nicht unnötig überzustrapazieren. Der kämpft mit den 2,4 Tonnen Lebendgewicht eh schon genug. Nicht dass man zu wenig Power hätte. Es darf aber schon
eifrig im Sechsganggetriebe gerührt werden, um zügig voranzukommen. Umso faszinierender, dass der Verbrauch mit 9,3 Litern – genauso wie der Geräuschlevel übrigens – dennoch sympathisch niedrig bleibt.
Bescheiden gut
Der VW-typische Touchscreen in der Armaturenbrettmitte und das dazugehörige Bedienkonzept ist auch grundsätzlich o. k., hat aber bei der Menüführung nach wie vor seine Schattenseiten, die aber (genauso wie der leidige Slider für die Lautstärke- und Klimaregelung) insofern abgeschwächt werden, als dass das Lenkrad nach wie vor über haptische Knöpfe verfügt. Und auch die elektrisch zu bedienende Handbremse ist für ein so großes Nutzfahrzeug nicht von Nachteil: So bleibt doch mehr Platz für Ablagemöglichkeiten und auch die Autohold-Funktion kann in der Hektik des Zustellalltags vor unnötigem Feindkontakt schützen. VWN tat also gut daran, nur das Nötigste am Crafter zu ändern. So kam nämlich genau das Quäntchen Luxus und Wohlfühlatmosphäre dazu, das dem braven und bescheidensten Arbeiter in der Palette immer schon gefehlt hat. •

Innenraum mit vielen Elementen aus den VW-Pkw, inklusive Infotainment-System. Schaltknauf riesig, Schaltung sehr exakt. Das Superhochdach bietet stattliche 16 Kubikmeter Laderaum



Volkswagen Crafter
Flotten-Tipp: 35 L3H2

Testmodell: 35 L4H4
Hubraum | Zylinder1.968 cm3 | 41.968 cm3 | 4
Leistung 140 PS (103 kW) 140 PS (103 kW)
Drehmoment 340 Nm ab 1.600/min340 Nm ab 1.600/min 0–100 km/h | Vmaxk. A. | 160 km/hk. A. | 155 km/h
Getriebe | Antrieb 6-Gang man. | Heck6-Gang man. | Heck Ø-Verbrauch | CO2 8,4 l D | 220 g/km9,1 l D | 239 g/km
Laderaum | Nutzlast 9,9 m3 | 1.295 kg16,1 m3 | 1.099 kg
Basispreis | NoVA40.814 € (exkl.) | 0 %51.719 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Variantenvielfalt, Platz, Komfort, Verbrauch
Das vermissen wir: auch hier: den Lautstärkedrehknopf
Die Alternativen: Mercedes Sprinter, Renault Master, Ford Transit Werksangaben (WLTP)




• Daten der aktuellen Kastenwagen, Busse und Pick-ups
• Praktische Suchfunktion nach Zuladung, Sitzplätzen, Anhängelast etc.
• Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben
• Fahrzeugausbauten und -zubehör

Viel Raum auf der Langstrecke
In unserem letzten Nutzfahrzeug-Schwerpunkt hatten wir den vollelektrischen Toyota Proace Max zu Gast, nun haben wir dem klassischen Diesel auf den Zahn gefühlt.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
Vielleicht erinnern Sie sich an unseren Test des Toyota Proace Max mit E-Antrieb und auf 4,25 Tonnen erhöhter Nutzlast. Mit auf 80 km/h beschränkter Höchstgeschwindigkeit und anderen Einschränkungen empfiehlt sich dieser ganz klar für die Kurzstrecke, im Gegensatz zum dieselbefeuerten Bruder, den wir jetzt im Fuhrpark hatten. Der ist vor allem als L3H2 mit einer Länge von 6,13 Metern und einer Höhe von 2,52 Metern innerstädtisch mitunter eine Herausforderung.
Goldene Mitte
Technisch und optisch weitgehend ident sind die Proace Mäxe mit den Nutzfahrzeugen aus dem Haus Stellantis, dort zum Beispiel als Fiat Ducato oder Opel Movano im Einsatz. Unter der Haube arbeitet ein 2,2 Liter Turbodiesel mit in unserem Fall 140 PS, gekoppelt an ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Gegen einen Aufpreis von rund 5.000 Euro netto gäbe es alternativ auch 180 PS samt 8-Gang-Automatik, bis zur L2H2-Variante auch einen 120-PS-Diesel. Rein leistungsmäßig ist unsere Empfehlung die goldene Mitte, die 140 Pferde stehen gut im Saft, selbst mit 1,5 Tonnen (maximal dürfen es je nach Ausführung bis zu drei Tonnen
sein) am Haken, wie wir uns selbst überzeugen konnten. Der Testverbrauch lag bei rund 8,5 Litern und damit lediglich ein paar Kommastellen über der Werksangabe.
Die Auswahl ist groß
Der Laderaum unseres Testtransporters in L3H2 liegt bei stattlichen 13 m3, die Range reicht von 10 m3 (L2H1) bis 17 m3 (L4H3). Bei den erwähnten vier Motoren (inkl. E-Motor) und den insgesamt sechs Varianten aus Länge und Höhe ist gewährleistet, dass jeder Unternehmer jenes Fahrzeug bekommt, das seinen Anforderungen bestmöglich entspricht. Das gilt auch für die Komfortausstattung, die bis hin zum 10-Zoll-Touchscreen und adaptiven Tempomaten reicht. Sehen lassen kann sich auch die Serienmitgift, hier sind Dinge wie Rückfahrkamera, Einparksensoren hinten, Fernlichtassistent oder Regensensor Serie, je nach Ausstattungsvariante sogar LEDScheinwerfer, Navi oder TotwinkelAssistent. Der Preis ist durch den Wegfall der NoVA gesunken, los geht’s bei netto 36.690 Euro für den L2H1 Duty, unser L3H2 Prowork startet bei netto 43.990 Euro. Dass sich die E-Version mit halber Zuladung für 61.690 Euro schwer tut, wundert wenig. •

Das Cockpit des Toyota Proace Max ist aufgeräumt und bietet viele Annehmlichkeiten serienmäßig. Der Laderaum variiert je nach Aufbaulänge und -höhe zwischen 10 m3 (L2H1) und stattlichen 17 m3 (L4H3)



Toyota Proace Max
Grundmodell: 2,2 D L2H1 Duty 33
Testmodell: 2,2 D L3H2 Prowork 35 Hubraum | Zylinder2.184 cm3 | 42.184 cm3 | 4
Leistung
Getriebe | Antrieb 6-Gang man. | Vorderrad6-Gang man. | Vorderrad Ø-Verbrauch |
Laderaum | Nutzlast
Basispreis |
Das gefällt uns: Variantenvielfalt bei Aufbau und Antrieb
Das vermissen wir: Automatik für den mittleren Diesel
Die Alternativen: Renault Master, VW Crafter, alle Stellantis-Modelle Werksangaben (WLTP)

Auto



Nur noch elektrifiziert
Der neue VW T-Roc setzt zum Marktstart im November auf Mild-Hybride mit 115 oder 150 PS ab 34.590 Euro (brutto). Zwei komplett neu entwickelte Vollhybride sind für Herbst 2026 avisiert, ebenso ein 204 PS starker Mild-Hybrid mit 204 PS und Allradantrieb. Das Topmodell R (333 PS, samt Elektro-Baustein) rundet das Modellprogramm in späterer Folge ab. Mit einem neuen Ausstattungsmix soll das Angebot überschaubarer werden, der Einsteiger „Trend“ steht unter dem Motto „Budget und Funktionalität“ und wartet bereits mit App-Connect Wireless, Kreuzungsassistent sowie Einparkhilfe vorn und hinten auf. Über „Life“ und „Style“ geht es zu „R-Line“ mit Sportfahrwerk, 18-Zoll-Felgen und mehr.


Die Zeichen stehen auf Erfolg
Anfang Oktober enthüllte der frischgebackene WEC-Sieger Ferdinand Habsburg die Alpine A390.
Ein besseres Omen hätte man sich kaum wünschen können: Zur Premiere der A390 in der Wiener Hofburg kam AlpinePilot und -Markenbotschafter Ferdinand Habsburg nahezu direkt nach seinem Sieg beim 100. Rennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft in Fuji. Es war der erste Sieg für die Marke und entsprechend bedeutend. Auf einer Teststrecke bei Dieppe (F) konnte Habsburg dem 4.615 Millimeter langen Neuzugang bereits auf den Zahn fühlen. Sein Urteil: „Es hat mich echt schockiert, kein Bullshit, das Fahrerlebnis ist wie bei der A110. Darüber hinaus ist die A390 super practical.“ Mit dem 11-kW-Onboard-Charger ist bidirektionales Laden möglich, an der DC-Ladesäule fließt der Strom mit maximal 190 kW. Die Preise für das vollelektrische Crossover-Modell mit wahlweise 400 oder 470 PS – Allradantrieb mit insgesamt drei Elektromotoren ist immer dabei – werden bei der Bestellöffnung im Jänner 2026 genannt, die ersten Fahrzeuge werden wohl Ende März in Österreich landen.
Der CX-5 ist gewachsen
Ende des Jahres rollt die dritte Generation des Mazda CX-5 nach Österreich, bereits die Basis ab 36.380 Euro setzt auf Automatik. Verbessert wurde nicht nur das Platzangebot im Fond: Der Importeur spricht von einem 381-Liter-Plus beim Kofferraum (jetzt maximal 2.019 Liter). Erstmals taucht Google built-in bei den Japanern auf, der Touchscreen misst je nach Version 12,9 oder 15,6 Zoll. Vorerst gibt es ein Triebwerk, einen Mild-Hybrid-Benziner mit 2,5 Liter Hubraum und 141 PS.



Günstiger Stromer H2-BMW ab 2028
Citroën liefert die versprochene kleinere Batterie für den ë-C3 nach: Mit 30 kWh Kapazität sinkt der Preis drastisch – natürlich auch die Reichweite. Wer neben einem aktuellen Aktionsbonus auch den Finanzierungs- und den Versicherungsbonus in Anspruch nimmt, kommt auf 18.990 Euro. Die WLTP-Reichweite beträgt 212 Kilometer. Für den reinen City-Alltag ist das okay.
Wenn BMW 2028 den iX5 Hydrogen auf den Markt bringt, sind insgesamt fünf Antriebsvarianten für den X5 zu bestellen. Benziner und Diesel stehen dann neben dem PHEV, dem Stromer und der Wasserstoff-Variante. Alle Antriebe kommen – unter anderem – aus dem BMW Group Werk Steyr. BMW engagiert sich mit Partnern beim Aufbau eines H2-Tankstellennetzes.
Kia spielt Elektro-Golf
In die 4,5-Meter-Klasse setzen die Südkoreaner ihren EV4. Bei der Konfiguration muss man seine automobilen Bedürfnisse gut abwägen.
Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Kia
Auch wenn es sich beim EV4 um kein SUV handelt, fügt er sich harmonisch in die aktuelle Designwelt der vollelektrischen Kia-Modelle ein – diese besteht ja vor allem aus SUV- und Crossover-Modellen. Wie der EV3 ist auch das Kompaktmodell mit 400-Volt-Technologie ausgerüstet. Wer etwa vom EV6 downsizen möchte, muss somit auf das superschnelle Laden verzichten.
625 Kilometer als starke Ansage
Wem überschaubare Reichweiten genügen, findet die kleinere Batterie nur in der Basisversion. Sobald man etwas mehr Luxus an Bord wissen möchte, ist die größere Kapazität zu bezahlen. Leistung, Topspeed, Kofferraum: Hier sind alle Versionen gleich. Die minimal schnellere DC-Ladeleistung bei der großen Batterie? Merkt man im Alltag wenig. Weder 101 noch 128 kW sind heute erwähnenswert. Genau hinsehen lohnt sich also, wenn man den EV4 konfigurieren möchte!
Beim Fahren kommt ihm die Bauweise des Fahrzeugsegments zugute, Kurven können zügig durchmessen werden. Mit weniger Batteriekapazität und somit weniger Gewicht beschleunigt die Basisversion etwas flotter. Und auch wenn deren 440 Kilometer Reichweite voll konkurrenzfähig ist: Sind regel-

mäßig Kundentermine im weiteren Umkreis zu bewältigen, ergibt ein Mehr an kWh schon Sinn. Und 625 Kilometer mit der 81,4-kWh-Batterie sind eine richtig starke Ansage für dieses Segment.
Ausstattung gefällig?
Lenkrad- und Sitzheizung, 12,3-ZollNavi, Klimaautomatik, Rückfahrkamera und Co: Schon die Grundausstattung Air ist nicht nackt. Ab 42.117 Euro (netto) bringt Earth Plus jedoch ein ordentliches Paket an Assistenten mit. Von der Vermeidung von Ausparkunfällen über den 360-Grad-Monitor bis zum Autobahnassistenten sind wichtige Features an Bord, selbst ein V2L-Adapter zum Betreiben externer Geräte ist dabei. Klar: GT-Line bringt Luxus. Hier erfreuen HarmanKardon-Sound, Head-up-Display, 19-Zoll-Felgen, Sitzventilation und zahlreiche weiteren Feinheiten. Schade: vom Lenkradkranz verdeckte Klima-Bedienung am Touchscreen. •



Die GT-Line macht sich innen besonders fein, das Gepäckvolumen ist in jeder Variante gleich. Themenwelten (hier: Marvel) für Nerds, Kontrolle des Fahrzeugzustands per App
Kia EV4 Flotten-Tipp: Standard Range Air Testmodell: Long Range GT-Line Leistung | Drehmoment 204 PS (150 kW) | 283 Nm204 PS (150 kW) | 283 Nm
Dauerleistung | Gewicht 50 kW | 1.736 kg50 kW | 1.821 kg 0–100 km/h | Vmax 7,4 s | 170 km/h7,7 s | 170 km/h
Reichweite | Antrieb 440 km | Vorderrad625 km | Vorderrad Ø-Verbrauch | Batterie 14,7 kWh | 58,3 kWh14,6 kWh | 81,4 kWh
Laden AC 11 kW, 5:20 h (0–100 %)11 kW, 7:15 h (10–100 %)
Laden DC 101 kW, 29 min (10–80 %)128 kW, 31 min (10–80 %)
Kofferraum | Zuladung 435–1.391 l | 453 kg435–1.391 l | 445 kg
Basispreis | NoVA 32.992 € (exkl.) | 0 %45.867 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: mehr Angebot in diesem einstmals wichtigen Segment
Das vermissen wir: vor allem bei der teuren GT-Line schnelleres Laden
Die Alternativen: von MG4 Electric über VW ID.3 bis Volvo EX30 Werksangaben (WLTP)



Zurück zu alten Tugenden
Die erste Generation des Nissan Leaf war ein Vorreiter der E-Mobilität, der Nachfolger konnte daran nicht anknüpfen. Das will der nunmehr dritte Leaf vergessen machen.
Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Stefan Schmudermaier, Nissan
Als der erste Nissan Leaf Anfang 2011 auf den Markt kam, gab es einen für E-Autos streng genommen noch gar nicht so richtig. Fahrzeuge wie ein Mitsubishi i-MIEV oder die Ableger von Citroën und Peugeot kamen kaum 100 Kilometer, kosteten über 40.000 Euro und waren keine wirklich vollwertigen Autos. Mit dem Leaf änderte sich das. Das erste Großserien-Elektroauto hatte eine Reichweite von deutlich über 100 Kilometern (160 laut Werksangabe) und konnte dank des CHAdeMO-Steckers auch das Schnellladen, 50 kW waren damals eine Ansage. Kein Wunder, dass der Leaf damals das meistverkaufte E-Auto seiner Zeit war, 2015 übernahm Tesla den Thron mit dem Model S.
Bis zu 622 Kilometer Reichweite
Die zweite, 2018 auf den Markt gebrachte Generation des Nissan Leaf war dann ein Problemkind und konnte nicht an die Erfolge des Vorgängers anschließen. Zum einen holte die Konkurrenz rasch auf, zum anderen waren die technischen Daten im Hinblick auf Batterie und Ladeleistung kein großer Fortschritt. Aus diesen Fehlern will Nissan nun gelernt haben und präsentiert mit dem neuen Leaf ein Fahrzeug der beliebten Crossover-Kategorie mit
einem für den europäischen Markt angepassten Design und vielen technischen Komponenten vom Partner Renault, genauer gesagt vom Megane E-Tech Electric. Zwei Batteriegrößen (52 und 75 kWh) ermöglichen WLTPReichweiten von 440 bzw. 622 Kilometern, die Ladegeschwindigkeiten von 105 bzw. 150 kW sind mittlerweile eher am unteren Ende angesiedelt, reichen aber, um den Akku in 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent zu füllen. Fein: Der Leaf ist für bidirektionales AC-Laden vorbereitet.
Start bei rund 31.000 Euro netto
Bei ersten Testkilometern in Dänemark bei nicht allzu hohem Tempo waren die WLTP-Werte von 13,8 kWh auch in der Praxis zu erfahren, ein Praxisverbrauch lässt sich davon aber nur bedingt ableiten. Das Fahrverhalten des Leaf ist jedenfalls harmonisch, besonders gefallen haben die vier Rekuperationsstufen sowie der adaptive Tempomat, schade, dass die One-Pedal-Funktion nicht bis zum Stillstand funktioniert. Preise gibt es offiziell noch keine, in Deutschland werden 31.000 netto für die kleine und 35.000 netto für die große Batterie angepeilt, das sollte auch für Österreich ein Richtwert sein. •


Die Farben sind gewagt, es gibt aber auch andere Kombinationen. Das neue InfotainmentSystem weiß zu gefallen, das Platzangebot ist durchschnittlich. Der Kofferraum fasst 437 bis 1.052 Liter


Nissan Leaf Grundmodell: 52 kWh Testmodell: 75 kWh
Leistung | Drehmoment 177 PS (130 kW) | 345 Nm218 PS (160 kW) | 355 Nm
Dauerleistung | Gewicht k. A. | 1.789–1.942 kgk. A. | 1.789–1.942 kg
0–100 km/h | Vmax 8,3 s | 160 km/h7,6 s | 160 km/h
Reichweite | Antrieb 440 km | Vorderrad622 km | Vorderrad Ø-Verbrauch | Batterie 13,8 kWh | 52 kWh13,8 kWh | 75 kWh
Laden AC 11 kW, 5:30 h (0–100 %)11 kW, 7:30 h (0–100 %)
Laden DC 105 kW, 30 min (20–80 %)150 kW, 30 min (20–80 %)
Kofferraum | Zuladung 437–1.052 l | k. A.437–1.052 l | k. A.
Basispreis | NoVA ca. 31.000 € (exkl.) | 0 %ca. 35.000 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Verarbeitung, Infotainment, variable Rekuperationsstufen
Das vermissen wir: One-Pedal bis zum Stillstand, höhere Ladeleistung
Die Alternativen: Hyundai Kona, Kia EV3, Peugeot 2008, Opel Frontera Werksangaben (WLTP)

Topseller mit neuer Nase
Er ist eines der meistverkauften Autos Österreichs und wird nun frisch gemacht. Gemeinsam mit seinem ebenso gelifteten SUVKumpel Arona startet der Seat Ibiza ab Jänner 2026 neu durch.
Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Seat
Auch wenn der schnittige Markenbruder Cupra mit auffälligerem Design über Österreichs Straßen rollt: In den ersten drei Quartalen 2025 rangiert Seat am Pkw-Neuwagenmarkt auf Platz 6 und Cupra auf Platz 8. Essenziell ist der Ibiza: Nach Škoda Octavia und VW Golf ist er aktuell das meistverkaufte Auto Österreichs.
Benziner von 80 bis 150 PS
Nun sorgt frischer Wind für höhere Attraktivität des Modells und der Seat Arona wird gleich mitgenommen. Wir konnten beide Modelle bei der Weltpremiere auf Ibiza fahren, um gleich einmal zu entdecken: Geändert hat sich am Fahrgefühl nichts. War auch nicht nötig, beide Modelle sind grundsätzlich auf der braven Seite unterwegs, erst mit dem 150 PS starken Topmotor wird die würzigkantige Optik in entsprechenden Fahrspaß übersetzt. Wobei das überhaupt nicht das Metier des Duos ist, bisher griffen beim Ibiza teils 45 Prozent der Kunden zum Basismodell namens Reference, das nach wie vor mit einem 80-PS-Motor und Fünfgang-Schaltgetriebe angeboten wird. Dem etwas schwereren SUV-Bruder wird bereits das turbobefeuerte 90-PS-Aggregat als Einstieg gegönnt. Alle Motoren sind Benziner.
Preisdrücken per Boni Design, Innenraum, Ausstattung sind die Faktoren, die bei den aufgewerteten Katalanen auffallen. Kühlergrill und Frontschürze sprechen eine bulligere, erwachsenere Sprache, bessere Materialqualität erfreut die Fingerkuppen und erstmals halten einen serienmäßige Sportsitze bei der FR-Version, wenn man zum nächsten Termin eilt. Der Ausstattungsmix wird sich laut Importeur nach oben verschieben, für die mittlere Linie Style werden bis 29 Prozent (Ibiza) erwartet, die Dynamikfraktion klettert mit FR bis auf 39 Prozent (Arona).
„Als meistverkauftes Seat-Modell und Nummer 1 im Kleinwagen-Segment steht der Ibiza wie kein anderes Fahrzeug für den erfolgreichen Einstieg in die Welt des VW Konzerns“, meint Markenleiter Timo Sommerauer. Und über den Arona: „Mit seinem kompakten Format und dem markanten SUV-Charakter trifft er genau den Nerv der Zeit und überzeugt als das günstigste SUV in Österreich.“
Ab 19. November 2025 ist Bestellstart der beiden Modelle, die Mitte Jänner 2026 in Österreich landen. Unser Datenkasten zeigt die Listenpreise, die mit drei Boni (Porsche Bank, Versicherung, Service) zu drücken sind. Beim Ibiza sind dann nur 13.490 Euro, beim Arona 16.490 Euro fällig. •


Im Viermeter-Segment kommt man kaum am Ibiza vorbei, der Arona erweitert das Portfolio seit 2017 mit SUVTugenden. Geschickt gestaltete Oberflächen lassen die Cockpits wertig wirken, Version FR mit Schalensitzen


Hubraum | Zylinder999 cm3 | 3 999 cm3 | 3
Leistung 80 PS (59 kW) 95 PS (70 kW)
Drehmoment 93 Nm ab 3.700/min175 Nm ab 1.600/min 0–100 km/h | Vmax15,3 s | 175 km/h11,1 s | 182 km/h
Getriebe | Antrieb 5-Gang man. | Vorderrad5-Gang man. | Vorderrad Ø-Verbrauch | CO2 5,2 l S | 119 g/km5,2 l S | 119 g/km
Kofferraum | Zuladung 355 l | k. A. 400 l | k. A.
Basispreis | NoVA16.490 € (inkl.) | 6 %19.490 € (inkl.) | 6
Das gefällt uns: automobile Zurückhaltung im besten Sinne
Das vermissen wir: Wer etwas vermisst, gehört nicht in die Zielgruppe
Die Alternativen: werden in der Preisklasse immer weniger Werksangaben (WLTP)
Italomotione
Das Kompakt-SUV Tonale bekommt ein Facelift verpasst, das den Alfa Romeo in vielen Details verfeinert und mehr italienischen Stil und Charakter auf die Straße bringt.
Text:
Achim Mörtl, Fotos: Alfa Romeo
Schon die neuen Farbnamen klingen wie ein Versprechen:
Rosso Brera, Verde Monza und Ocra Amalfi – allein diese Töne wecken mehr Emotion als ein ganzer Fuhrpark an grauen SUVs. Sie stehen für Stil, Sonne, Rennsport – und dafür, dass Alfa Romeo zumindest optisch wieder mehr Alfa geworden ist. Der Tonale steht jetzt wieder mehr so da, wie man sich es von Alfa wünscht, nicht laut, aber mit Charakter. Das Facelift zur Lebensmitte soll wieder mehr Lust auf den Italiener machen, blickt man auf die Verkaufszahlen, ist das auch dringend nötig.
Innenraum mit italienischem Flair
Auch im Cockpit hat Alfa nachgelegt. Hochwertigere Materialien, sportlichere Gestaltung und mehr Varianten – vom schwarzen Stoff/Kunstleder im Basismodell Tonale bis zum edlen roten Leder im Ti, das optisch schon fast GT-Niveau erreicht. Besonders gelungen ist die Launch Edition „Sport Speciale“: eine Kombination aus weißem Kunstleder und schwarzem Alcantara, dazu Alcantara an Armaturentafel und Türverkleidungen, kontrastierende weiße Nähte und dezente Ambientebeleuchtung im Schlangen-
Design – ein tolles Statement zwischen Moderne und Emotion. Hinter dem Tonale steht freilich die große Stellantis-Plattformstrategie und es ist nicht leicht, eine Marke mit solcher Historie und eigenem Spirit in modulare Strukturen einzubetten. Aber man merkt, dass Alfa kämpft, um sich selbst treu zu bleiben – und das verdient Respekt.
Auf der Straße – Alfa zum Spüren Fahrdynamisch zeigt der Tonale, dass Emotion und Alltag kein Widerspruch sein müssen. Im Dynamik-Modus präsentiert sich das Fahrwerk straff, die Lenkung präzise und die Balance stimmig. Durch die breitere Spur wirkt der Wagen stabiler, das Einlenkverhalten ist direkter. Unter der Haube stehen drei Antriebsvarianten zur Wahl. Der Plug-in-Hybrid Q4 mit 270 PS und elektrischem Allradantrieb –die kräftigste, gleichzeitig kultivierteste Version. Der Mild-Hybrid 1.5 mit 175 PS und 48-Volt-System – harmonisch, leise und perfekt für den Alltag. Und der 1,6-Liter-Diesel mit 130 PS, ideal für Vielfahrer, die in Sachen Effizienz und Reichweite punkten wollen. Der überarbeitete Tonale ist kein radikaler Neuanfang, aber ein ehrlicher,




Alfa Romeo hat den Tonale behutsam aufgefrischt, zu sehen vor allem an der neuen Frontschürze und dem hochwertigeren Innenraum. Technisch macht sich die breitere Spur bemerkbar spürbarer Fortschritt. Er sieht noch mehr nach Alfa aus, fühlt sich auch so an und beweist, dass man selbst in Zeiten von Konzernplattformen noch ein Stück Seele in die Serie bringen kann. Das mag im Stellantis-Kosmos nicht immer einfach sein – aber Alfa versucht es. Und das merkt man in jedem Detail. Ein SUV mit Stil, Emotion und Charakter, der zeigt, dass Leidenschaft auch heute noch ihren Platz auf der Straße hat. Preise und Daten standen zu Redaktionsschluss noch nicht bereit, folgen aber in Kürze. •


Neuer Name, neues Glück
SsangYong kehrt unter neuer Flagge als KGM zurück und belebt gleich zahlreiche Modelle. Eines der Ersten: das Hybrid-SUV Torres und der vollelektrische Pick-up Musso.
Text: Roland Scharf, Fotos: KGM
Darf man heutzutage noch etwas als maskulin bezeichnen, ohne online dafür gerügt zu werden? Die Designer von KGM meinen: na logo! Und außerdem war das Männliche, Robuste immer schon typisch für SsangYong, das wolle man beibehalten. Und so war es für die KG Group aus Seoul ganz klar, dass man nach der Übernahme des ältesten Autobauers Koreas dessen Kernwerte und Modellnamen weiterführen wollte.
Flachmann, zeige Kante
Da wäre zum einen der neue Musso als Vollelektriker: Optisch ein typischer Pick-up mit Doppelkabine, kommt er als Hecktriebler mit einem Motor und 150 kW oder als Allradler mit zwei 150-kW-Motoren (einer vorne, einer hinten), wobei jeweils eine 80,6-kWh-Batterie für rund 400 Kilometer Reichweite sorgt. Das wuchtige Design täuscht über die Dimensionen hinweg: Der Musso ist zwar 5,2 Meter lang, aber nicht einmal 1,8 Meter hoch, passt also in alle Tiefgaragen und bietet 2,1 m2 Ladefläche. Was gefällt, sind zahlreiche schlaue Detaillösungen: etwa das LED-Licht für die Ladefläche oder die vorklappbare Rücksitzbank, hinter der es Platz für Ladekabel gibt. Der niedrige Schwerpunkt und auch der Verzicht auf eine Starrachse machen den Musso zudem
erstaunlich fahraktiv und komfortabel, alles arbeitet leise und smooth. Wenn man so will, hat man es hier also mit einem SUV-Pick-up zu tun. Jedenfalls verzichtet man so gern auf ein paar Geländetalente, zumal die Preise bei moderaten 34.908 Euro netto anfangen.
Dezente Talente
Innen baugleich präsentiert sich der Musso, KGMs Interpretation eines klassischen Kompakt-SUV mit 4,7 Metern Länge und stattlichen 703 Litern Kofferraum. Neu hier ist der Hybrid-Antrieb, der ähnlich wie bei Toyota mehrere Spielarten zulässt: Primär zum Befeuern des 1,8 kWh großen Akkus zuständig, geht es im Stadtgebiet vor allem elektrisch dahin, was übrigens bis 100 km/h möglich ist. Über Land und bei starkem Beschleunigen tritt der Vierzylinder dann erst in Erscheinung, wobei wir hier von einer sehr dezenten Geräuschkulisse sprechen. Nichts zu meckern gibt es bei Verarbeitung und Materialwahl, alles wirkt wie aus einem Guss, sodass nur Kleinigkeiten etwas nerven, allen voran das Bedienkonzept mit null Knöpfen und einem dafür mit Knöpfen überladenen Lenkrad. Preise? Bei 37.990 Euro brutto geht’s los, inklusive Rückfahrkamera und LED-Licht. •

Der elektrische Pick-up Musso fährt wie ein Pkw, das SUV Torres ist sehr gediegen. Beide haben den gleichen Innenraum, alles wirkt sehr solide und gut verarbeitet



KGM SUV: Torres Dual Tech Hybrid Pick-up: Musso EV 4WD
Leistung | Drehmoment 150 PS (110 kW) | 220 Nm237 PS (175 kW) | 630 Nm 0–100 km/h | Vmaxk. A. | 180 km/h8 s | 177 km/h
Getriebe | Antrieb 220 Nm + 300 Nm E-Motor 1-Gang aut. | Allrad
Reichweite | Batterie– 379 km | 80,6 kWh Ø-Verbrauch | CO2 – 25,9 kWh/100 km
Laden AC – 11 kW, 10:2 h (0–100 %) Laden DC 6 l S | 137 g/km 300 kW, 36 min (10–80 %)
Kofferraum | Zuladung 703–1.662 l | 580 kg2 m2 l | 905 kg
Basispreis | NoVA37.990 € (inkl.) | 9 %38.242 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: ganz SsangYong, nur moderner und hübscher
Das vermissen wir: mehr Knöpfe am Armaturenbrett
Die Alternativen: Toyota RAV4, Maxus eTerron9 Werksangaben (WLTP)

Poliermaschine
Citroën möchte sich neu erfinden, zu alten Werten zurückkehren und unterstreicht das Qualitätsversprechen in Form einer achtjährigen Garantie. Der C5 Aircross ist das neue Flaggschiff.
Text: Stefan Schmudermaier, Fotos: Citroën
Tradition verpflichtet, dieses Motto hat sich nun auch Citroën auf die Fahnen geheftet. Und möchte so auch das durch große Rückrufaktionen zuletzt etwas angekratzte Image wieder aufpolieren. So gibt es für alle Modelle nun bis zu acht Jahre Garantie, vorausgesetzt, man kommt zum Service brav in die Markenwerkstatt. Die Modellpalette wurde in letzter Zeit ordentlich aufgefrischt, mit dem neuen C5 Aircross ist nun auch das Flaggschiff dran.
Schicker Innenraum, viel Platz Und das legt zunächst optisch einen schicken und selbstbewussten Auftritt hin. Erstmals bei Citroën gibt es (optional) 20-Zoll-Räder, die die Radhäuser satt füllen, das Karosseriedesign mit seinen Sicken und Kanten stößt ebenso auf breite Zustimmung. Einen besonderen Kniff haben sich die Designer bei den Heckleuchten einfallen lassen. Die Dreiteilung entspricht der aktuellen Linie der Franzosen, neu – und so auch bis dato nirgendwo anders gesehen – ist die Dreidimensionalität, die beiden äußeren Elemente wachsen wie Finnen aus dem Fahrzeug heraus. Innen zeigt sich der C5 Aircross aufgeräumt, auf Höhe des Lenkrades läuft eine geschäumte Stoffoberfläche bis in den Fond und soll – so Citroën –
Wohnzimmeratmosphäre vermitteln. Nicht ganz so hochwertig sind sämtliche Kunststoffe, egal, ob am oberen Armaturenbrett, der Mittelkonsole oder der Türvertäfelung, hier regiert Hartplastik. Positiv: Das Platzangebot im Fond ist üppig, je nach Modell gibt es vorne Sitzlüftung, Lehnenbreitenverstellung und Massage und auch der Kofferraum ist mit 565 bis 1.668 Litern ordentlich.
Rund 400 Kilometer Reichweite Motorisch warten drei Varianten, ein Mild-Hybrid, ein Plug-in und eine vollelektrische Version. Die letzteren beiden konnten wir bereits ausgiebig testen, beide wissen zu gefallen und zeigen sich leise und sehr komfortabel. Der PHEV kam auf ordentliche 80 Kilometer im Überlandverkehr, mit leerer Batterie lag der Verbrauch bei rund sechs Litern. Der Vollelektriker wurde mit etwa 17 kWh auf ähnlichen Straßen bewegt, was eine Reichweite von rund 400 Kilometern bedeutet. Geladen wird mit 160 kW, von 0 auf 80 ist man in rund 30 Minuten. Die Preisliste für den Plug-in-Hybrid startet bei 40.590 Euro, der Elektro bei netto 35.825 Euro. Ein Modell mit 97 kWh Akku und 680 Kilometern Reichweite folgt demnächst. •


Die optionalen 20-Zoll-Räder füllen die Radkästen des C5 gut aus, das eckige Karosseriedesign weiß zu gefallen. Platz im Fond üppig, Materialwahl nicht ganz so toll
C5 Aircross
|


Reichweite | Antrieb 86 km | Vorderrad409 km | Vorderrad

Basispreis | NoVA
Das gefällt uns: Platz, Komfort, Reichweite, verstellbare Rekuperation
Das vermissen wir: einen Frunk, mehr Zuladung
Die Alternativen: Opel Grandland, Peugeot 3008, VW Tiguan Werksangaben (WLTP)
Noch einmal etwas ausgeklügelter
Geht es um das Thema Hybrid, sind japanische Hersteller große Tüftler. Nissan hat den e-Power-Antrieb für den Qashqai weiter verbessert.
Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Nissan
Hybridautos werden in der allgemeinen Wahrnehmung in einen großen, gemeinsamen Topf geworfen. Hersteller wie Nissan seufzen da auf und betonen, dass ihre Antriebsvariante doch weit näher an einem Elektroauto dran ist. Die Motorisierung e-Power, um die es hier im Qashqai geht, bringt ab sofort gleich auf mehreren Ebenen Verbesserungen.
Benziner: keine direkte Art Woher die Ähnlichkeit zum Elektroauto? Wie bei anderen Hybriden arbeiten auch hier Benziner und Elektromotor zusammen. Doch nachdem der Turbobenziner nur den E-Motor oder die 21,kWh-Batterie mit Kraft versorgt und nie die Räder direkt antreibt, kann er stets im besten Arbeitsfenster laufen. Das typische Aufheulen beim Beschleunigen gibt es daher nicht. Ab und an hört man den 1,5-Liter, wenn man gerade nicht aufs Pedal tritt. Dann lädt er vielleicht die Batterie auf, an dieses Eigenleben gewöhnt man sich. Mit 205 PS ist der e-Power das kräftigste Modell der Palette, die sonst aus Mild-Hybriden besteht. Wer Schaltgetriebe mag oder unbedingt Allrad (kombiniert mit der Xtronic) benötigt, muss zu einem dieser 1,3-Liter-Modelle greifen.
An allen Ecken optimiert
Beim Hybrid-Tüfteln von Nissan kam ein neuer 5-in-1-Antrieb heraus. Komponenten wie E-Motor, Generator etc. hocken platzsparend in einem Gehäuse, was das Gewicht senkt. Dazu kommt ein größerer Turbolader für niedrigere Drehzahlen. Der speziell konstruierte Benziner (42 Prozent thermischer Wirkungsgrad!) schluckt nun nur noch 4,5 Liter (WLTP), beim reellen Autobahnverbrauch spricht der Importeur von 7,2 statt bisher 8,5 Liter. Im Schnitt sollten sich 1.000 Kilometer Reichweite ausgehen (1.200 laut WLTP). Reduzierte Vibrationen sorgen gemeinsam mit aerodynamischen Verbesserungen für -5,6 dB an Innenraum-Geräuschen. Im menschlichen Ohr kommt das als Halbierung an. Die Service-Intervalle wurden von 15.000 auf 20.000 Kilometer erhöht.
Auf ersten Testfahrten zeigte sich, dass man sich – wie gewohnt – auch auf diesen Hybrid einstellen muss. Soll heißen: Beim Kollegen zeigte der Bordcomputer deutlich mehr an, wir kamen mit 5,5 Liter zurecht. Ansonsten ist der 4,43 Meter lange Nissan ein SUV von der kommoden Sorte, manche Aussttattungen wirken innen richtig luxuriös. •

e-Power, aktualisiert mit größerem Turbolader und weniger Vibrationen. Aktualisiert wurde auch der Google Assistant, es gibt zudem neue Apps. Die Topvarianten bieten ein Panoramaglasdach



| Zylinder1.332
Drehmoment 240 Nm ab 1.650/min330 Nm
0–100 km/h | Vmax10,2 s | 196 km/h7,6 s | 170 km/h
Getriebe | Antrieb 6-Gang man. | Vorderrad 1-Gang aut. | Vorderrad
Ø-Verbrauch | CO2 6,3 l S | 142 g/km4,5 l S | 102 g/km
Kofferraum | Zuladung 455–1.447 l | 515 kg455–1.440 l | 523 kg
Basispreis | NoVA 38.790 € (inkl.) | 10 %47.490 € (inkl.) | 2 %
Das gefällt uns: Alcantara-Bezug am Armaturenbrett (N-Design, Tekna+)
Das vermissen wir: das Hybrid-Aufheulen des Benziners. Späßchen!
Die Alternativen: Toyota Corolla Cross, Honda ZR-V Werksangaben (WLTP)


Sportliche Avantgarde
DS Automobiles nimmt einen neuen Anlauf in der PremiumKompaktklasse, der N°4 zeigt sich durch und durch selbstbewusst – auch beim Preis – und mit vier Antriebsvarianten.
Text: Achim Mörtl, Fotos: DS Automobiles
DS Automobiles ist jung, aber gereift, und bringt mit dem N°4 das Facelift des bis dato DS4 benannten Modelles auf dem Markt. Geboren aus dem Geist der legendären Citroën DS von 1955, steht die Marke heute eigenständig für ein modernes, französisches Premiumverständnis, mit drei Punkten als Markenidentität: Eleganz, Technologie und Komfort. Seit der offiziellen Ausgliederung von Citroën im Jahr 2014 verfolgt DS das Ziel, Premium neu zu interpretieren und agiert emotionaler, mutiger, feiner im Detail. Mit dem DS N°4 beweist die Marke, dass sie in einem der wichtigsten europäischen Segmente angekommen ist – der Premium-Kompaktklasse. Im Premium-Segment liegen 25 Prozent des Marktes und 38 Prozent des Profits in Europa, wobei das C-Segment hier mit 38 Prozent den Hauptanteil abdeckt.
Premium-Niveau
Mit seiner längeren Motorhaube, der neu gestalteten Stoßstange und der aerodynamisch optimierten Front wirkt der DS N°4 kraftvoll, aber nie aggressiv, elegant, aber nie kitschig. Die beleuchtete Front im Stil des E-Tense Performance-Concepts, das illuminierte DS-Logo und die präzisen
Linien ziehen sich wie eine Signatur durch das gesamte Fahrzeug. Die breite Spur und die großen Räder (19 bis 20 Zoll) ergeben eine muskelbetonte Eleganz. Im Innenraum liefert DS kompromisslos Premium bei Materialqualität, Verarbeitung und Haptik. Selbst im Vergleich zu den deutschen Premiumherstellern muss sich der DS N°4 nicht verstecken. Bis zu 430 Liter Kofferraumvolumen sind auch im Alltag ein echtes Argument.
Diesel feiert Comeback
Das Antriebsportfolio ist den meisten Mitbewerbern deutlich überlegen, gibt es doch Hybrid, Plug-in-Hybrid, Elektro und – man höre und staune –ab 2026 auch einen Diesel! In puncto Fahrwerk weiß der N°4 zu überraschen, er fährt sich erstaunlich lebendig, sogar sportlich. Das Fahrwerk ist präzise abgestimmt, nimmt Bodenwellen sauber auf, bleibt aber spürbar verbunden mit der Straße. Besonders Spaß macht die E-Variante, 213 PS, 343 Nm, 0–100 km/h in rund acht Sekunden. Laut WLTP geht es 449 Kilometer weit, die DC-Ladeleistung von 120 kWh ist leider unterdurchschnittlich. 40.725 Euro netto sind kein Schnäppchen, dennoch den 38.150 brutto des Hybrids vorzuziehen. •

Der neue DS N°4 zeigt sich elegant und sportlich, bietet einen ordentlichen Kofferraum (430 bis 1.240 Liter) und 449 Kilometer WLTPReichweite



DS N°4 Grundmodell Hybrid: Pallas Grundmodell Elektro: Pallas
Leistung | Drehmoment 145 PS (107 kW) | 230 Nm213 PS (156 kW) | 345 Nm
Dauerleistung | Gewicht – 141 kW | 1.792 kg
0–100 km/h | Vmax 9,5 s | 202 km/h7,1 s | 160 km/h
E-Reichweite | Antrieb – | Vorderrad 449 km | Vorderrad Ø-Verbrauch | Batterie 5,2 l S (116 g CO2) | –15,0 kWh | 60 kWh
Laden AC – 11 kW, 6:20 h (0–100 %)
Laden DC – 120 kW, 31 min (20–80 %)
Kofferraum | Zuladung 430–1.240 l | 542 kg390–1.260 l | 458 kg
Basispreis | NoVA 38.150 € (inkl.) | 4 %40.725 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Verarbeitung, Fahrverhalten
Das vermissen wir: eine höhere DC-Ladeleistung
Die Alternativen: Kia EV4, Opel Astra Elektro, VW ID.3 Werksangaben (WLTP)

Spätzünder mit Nachbrenner
Das Facelift macht den Puma gleich doppelt besser. Er bekam nicht nur E-Antrieb, sondern auch zahlreiche
Detailverbesserungen, die eine große Wirkung haben.
Text & Fotos: Roland Scharf
In Gelb wirkt der Puma schon wieder so schräg, dass auch das viereckige Lenkrad wie die Faust aufs Auge passt. Vor 50 Jahren wurde Austin dafür beinahe gesteinigt, beim Ford ist es aber ein cleveres Detail von vielen. Was aber nicht heißt, dass man sich ein halbherziges Facelift erwarten darf, das Verbrennern, die zum Elektro umgerüstet werden, gerne nachgesagt wird. Hier trifft eher das Gegenteil zu: War der Puma bislang immer o. k., aber nie so wirklich lässig, läuft er in aktuellster Fassung endlich zur Höchstform auf. Optik, Performance, Ausstattung – man könnte sich fragen, warum Ford sein aktuell kleinstes Modell nicht gleich so konzipiert hat. Wichtiger ist, was den Puma jetzt so viel besser macht.
Verzicht? Nicht!
Zum einen das Grundkonzept: Mit 4,2 Metern Länge und 1.563 Kilogramm Gewicht ist der Gen-E getaufte Elektriker im Vergleich angenehm klein und leicht, was sich fahraktiv sehr positiv bemerkbar macht. Kaum ein anderer Stromer lässt sich ähnlich agil fahren, hat nichts von der Behäbigkeit anderer, weit stärkerer Modelle. Beim Antrieb muss dafür auf wenig verzichtet werden: 168 PS marschieren
ordentlich, der 43-kWh-Akku ist zwar nicht einer der Größten, reicht aber für 300 Kilometer im Alltag, womit man ausreichend bedient ist, zumal die 100 kWh Schnellladeleistung fehlende Kapazität wieder wettmachen.
Fit im Schnitt
Und dann wäre da noch die Optik: Die kühlergrilllose Front steht dem Puma genauso gut wie die neuen Räder und etwas aufgepimpte Scheinwerfer, wobei sich der Innenraum stärker modernisiert zeigt: Die neuen Displays für Cockpit und Infotainment sind angenehm groß, die Software nun wesentlich schneller und beherrscht jetzt auch Apple CarPlay drahtlos, was für einen reibungsloseren Alltag genauso wichtig ist wie zum Beispiel der größere Kofferraum: Die Unterflurbox fasst jetzt nämlich 145 Liter, was auch ein wenig schräg ist – möglich wurde das nämlich erst durch den Entfall des Auspuffs. All das hat natürlich seinen Preis, wobei schnell nachgerechnet: Für mindestens 30.741 Euro netto erhält man eine gelungene Schnittmenge aus Verbrenner- und Elektrotalenten – die genauso einzigartig und Geschmacksache ist wie ein viereckiges Lenkrad, oder? •

Puma solide verarbeitet, aber etwas eng geschnitten, vor allem im Fond. Kofferraum deutlich größer als im Benziner, Knackhintern schränkt die Übersicht ziemlich ein


Ford Puma Gen-E
Flotten-Tipp: Basis

Testmodell: Premium
Leistung | Drehmoment 168 PS (124 kW) | 290 Nm168 PS (124 kW) | 290 Nm
Dauerleistung | Gewicht 52 kW | 1.563 kg52 kW | 1.563 kg
0–100 km/h | Vmax 8,0 s | 160 km/h8,0 s | 160 km/h
Reichweite | Antrieb 376 km | Vorderrad364 km | Vorderrad Ø-Verbrauch | Batterie 13,1 kWh | 43 kWh13,7 kWh | 43 kWh
Laden AC 11 kW, 4:45 h (0–100 %)11 kW, 4:45 h (0–100 %)
Laden DC 100 kW, 23 min (10–80 %)100 kW, 23 min (10–80 %)
Kofferraum | Zuladung 523–1.283 l | 449 kg523–1.283 l | 449 kg
Basispreis | NoVA 30.741 € (exkl.) | 0 %32.825 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Fords coolstes EV war ein Benziner!
Das vermissen wir: eine ST-Version natürlich
Die Alternativen: Peugeot E-2008, MG4, BYD Atto 2 Werksangaben (WLTP)

Schnörkellos elektrisch
Audi beweist mit dem elektrischen A6 Avant, dass es nicht nötig ist, ein Modell komplett umzukrempeln, nur weil es elektrisch angetrieben ist. Wir haben den Business-Kombi getestet.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
Wer beruflich eine höhere Position erreicht hat, darf sich oft auch ein Firmenauto aussuchen, das in Sachen Prestige und Preis über vielen anderen steht. Eine sehr begehrte Klasse ist jene der großen Premium-Kombis vom Schlag eines Audi A6, BMW 5er oder Mercedes E-Klasse. Während die Stuttgarter den EQE nur als Limousine und SUV anbieten, gibt es den neuen 5er auch als elektrischen Touring, mit dem A6 Avant e-tron rückt ein weiterer Hersteller in die Riege der edlen E-Kombis auf.
Keine optischen Experimente
Rein optisch muss man schon zwei Mal hinsehen, um den Elektriker vom normalen A6 Avant zu unterscheiden, die Designer der vier Ringe sind keine Experimente eingegangen und das ist auch gut so. Schließlich sind radikale Elektroauto-Designs schon öfter nach hinten losgegangen, auch im VWKonzern. Innen folgt der Ingolstädter der klassischen Linie, auch die Bedienung gibt keine Rätsel auf, wenngleich die Touchtasten am Lenkrad ergonomisch nicht perfekt sind. Selbiges gilt auch für die digitalen Außenspiegel, deren Nachteile klar überwiegen. Die flach in die Tür integrierten Monitore
lassen vor allem beim Rückwärtsfahren jegliches Raumgefühl vermissen, je nach Lenkrad- und Armhaltung werden diese überhaupt verdeckt (Bild rechts). Kurzum, sparen Sie sich diese 1.705,20 Euro. Das Platzangebot ist ordentlich, wenn vor allem im Fond nicht wirklich üppig, der Kofferraum fasst 502 bis 1.422 Liter, der 27 Liter fassende Frunk bietet Platz fürs Ladekabel.
Power und Reichweite
Antriebsseitig stehen vier Versionen zur Verfügung, 210 bzw. 270 kW mit Heckantrieb, der von uns gefahrene quattro mit 315 kW und der Überflieger S6 mit 370 kW E-Leistung. Unser Allradler ist dabei mehr als ausreichend, 4,5 Sekunden auf 100 km/h belegen das eindrucksvoll, Traktionsprobleme gibt’s dabei klarerweise keine. Die Batterie verfügt über eine NettoKapazität von 95 kWh und ermöglicht eine WLTP-Reichweite von satten 681 Kilometern, um die 500 bleiben in der Praxis übrig. Nachgeladen wird mit bis zu 270 kW, nach 21 Minuten ist der Akku von 10 auf 80 Prozent gefüllt. Das alles hat freilich auch seinen Preis, das Basismodell kommt auf netto 57.167 Euro, der quattro ist mit einem Bruttopreis ab 81.200 Euro nicht mehr vorsteuerabzugsfähig. •



Der elektrische A6 Avant ist ein echter Audi mit hoher Qualität und guter Ergonomie, auf die optionalen virtuellen Außenspiegel kann man getrost verzichten
Audi A6 Avant e-tron


Flotten-Tipp: Basismodell
Testmodell: quattro
Leistung | Drehmoment 286 PS (210 kW) | 435 Nm428 PS (315 kW) | 580 Nm
Dauerleistung | Gewicht 100 kW | 2.185 kg138 kW | 2.370 kg
0–100 km/h | Vmax 7,0 s | 210 km/h4,5 s | 210 km/h
Reichweite | Antrieb 594 km | Hinterrad681 km | Allrad
Ø-Verbrauch | Batterie 14,5 kWh | 75,8 kWh15,6 kWh | 94,9 kWh
Laden AC 11 kW, 8:00 h (0–100 %)11 kW, 10:00 h (0–100 %)
Laden DC 225 kW, 21 min (10–80 %)270 kW, 21 min (10–80 %)
Kofferraum | Zuladung 502–1.422+27 l | 500 kg502–1.422+27 l | 500 kg
Basispreis | NoVA 57.167 € (exkl.) | 0 %81.200 € (inkl.) * | 0 %
Das gefällt uns: Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Fahrleistung
Das vermissen wir: konventionelle Außenspiegel & Lenkradtasten
Die Alternativen: BMW i5 Touring, Mercedes EQE (kein Kombi)
* über 80.000 Euro brutto kein Vorsteuerabzug möglich Werksangaben (WLTP)

Die unendliche Geschichte
Ein neuer Land Cruiser ist immer eine große Sache. Vor allem, wenn er den Talenten seiner Ahnen treu geblieben ist, aber alles besser macht.
Text & Fotos: Roland Scharf
Die wichtigste Erkenntnis nach den ersten gemeinsamen Kilometern: Der Land Cruiser ist auch in jüngster Fassung durch und durch ein Land Cruiser geblieben. Nichts von all den SUV-Weichspülern oder krampfhaft modernem Fahrzeugbau, was so viele Haudegen der Autogeschichte dahingerafft und kastriert haben. Der große Toyota hat immer noch einen Leiterrahmen, eine Starrachse hinten, ausbordende Dimensionen und einen 2,8 Liter großen Turbodiesel, der sich in Kombination mit der schussfesten Verarbeitung so unerschütterlich loyal anfühlt, dass man das Gefühl bekommt, auch mit der Neuauflage gleich zum Lachsfischen in den Jemen aufbrechen zu können. Der Clou ist aber, dass er abseits dessen alles besser als seine Vorgänger macht.
Jungbrunnen
Heißt: Man spürt, dass man es mit einem echten Offroader zu tun hat. Aber einem – typisch Toyota – fast schon zu Tode perfektionierten. Der Ansatz, Bewährtes besser zu machen, zeigt sich vor allem beim praktisch unverändert übernommenen Motor, dem das neue Achtgang-Automatikgetriebe zu völlig neuem Leben verhilft. Die zwei zusätzlichen Gänge wirken wie ein Jungbrunnen, stets liegt die richtige Drehzahl für elasti-

sches Fahren an, was perfekt zum Rest passt: Das Fahrwerk lässt an Federweg nichts missen, bleibt aber auch in flotten Asphaltkurven erstaunlich agil. Lenkung, Bremsen, alles stellt den wohl besten Kompromiss aus beiden Welten dar, sodass den Land Cruiser so schnell nichts erschüttern kann. Und wenn es echt einmal hart auf hart kommt, kann man ganz bequem per Knopfdruck Differenziale sperren, Untersetzungen einlegen und sogar die Stabis entkoppeln.
Kleiner Haken
Wir haben uns natürlich im legalen Bereich ein wenig offroad versucht und können sagen, dass den Toyota so schnell nichts erschüttert. Nicht einmal ein leises Knarzen ist zu vernehmen, wenn sich die Achsen anfangen zu verschränken. Viel kann ihn also nicht erschüttern, außer eine Sache vielleicht: der Preis. Knapp 130.000 Euro sind schon eine selbstbewusste Ansage. •


Eckige Optik gefällt und bietet massig Platz im Innenraum. Cockpit herrlich übersichtlich mit vielen Knöpfen. Geländefahrhilfen gibt es sonder Zahl, cool auch die separat zu öffnende Heckscheibe


Toyota Land Cruiser Flotten-Tipp: Elegance Testmodell: First Edition
Hubraum | Zylinder2.755 cm3 | 42.755 cm3 | 4
Leistung 204 PS (150 kW) 204 PS (150 kW)
Drehmoment
0–100 km/h | Vmax12,7 s | 165 km/h12,7 s | 165 km/h
Getriebe | Antrieb 8-Gang aut. | Allrad8-Gang aut. | Allrad Ø-Verbrauch | CO2 10,3 l D | 275 g/km10,7 l D | 281 g/km
Kofferraum | Zuladung 1.151–1.934 l | 820 kg104–1.833 l |
Das gefällt uns: ein Auto wie damals, nur topmodern und cooler
Das vermissen wir: einen geschmeidigeren Preis, leider
Die Alternative: Land Rover Defender

|
Werksangaben (WLTP)

Rockwork Orange
Die Technik ist bekannt, die Mischung überraschend kreativ. Der Fiat 600e schafft es, deutlich gewitzter als seine Konzernkollegen zu sein. Und das mit erstaunlich einfachen Mitteln.
Text & Fotos: Roland
Scharf
Es ist ja nicht so, dass man den elektrischen 600er nicht schon kennen würde. Plattform, Akku, Motor, auch die gesamte Elektronik –alles teilt sich der Fiat mit zahlreichen anderen Stellanten vergleichbarer Größe, sei es der Opel Mokka oder der Jeep Compass oder der Peugeot 2008. Somit weiß man schon einmal: Beschleunigung und Fahrwerte sind nach dem Update von 136 auf 156 PS absolut tadellos, dazu bietet der nun 54 kWh fassende Akku ausreichend Reserven, um echte 300 Kilometer weit zu kommen. Klingt nicht nach viel. Wird aber relativiert durch die Tatsache, dass er diesen Wert praktisch immer erreicht, was die Planung der Ladestopps natürlich deutlich erleichtert.
Bunte Herzen
Was den Fiat aber jetzt zum Fiat macht, ist die Art, wie die bekannte Technik serviert wird. Ähnlich, wie ein toskanischer Spitzenkoch rudimentäre Zutaten zum Dahinschmelzen zubereitet, wirkt der 600e erfrischend kreativ: Die knuddelige Form mag ein wenig Platz im Innenraum verschenken, lässt das Vehikel aber automatisch ein wenig sympathischer wirken. Auch im Innenraum:
Kein Mensch braucht Sitze mit Ziernähten in 600er-Form, aber es wirkt gleich flauschiger und freundlicher. Ein Ansatz, der sich durch das gesamte Auto zieht und dermaßen viel Herz einhaucht, dass das trockene Thema E-Mobilität etwas an Schrecken verliert.
Reichweitengerumpel
Simpel und kreativ auch die Modellpalette: Es gibt den Red für 30.000 und den La Prima für 35.000 Euro netto, fertig. Aufpreispflichtige Optionen? Zwei Pakete, das war’s, wobei schon der einfachere 600 alles bietet, was es für den Alltag benötigt. Fahrvergnügen bereiten sie beide, aber hey: Wir reden ja von einem Italiener, und da kann ein wenig Extra-Schick nicht schaden, oder? Eben. Und außerdem ist der Mehrpreis des La Prima dank 18-Zoll-Alus, zahlreicher Assistenzsysteme und großen Touchscreens auch angenehm freundlich ausgefallen. Wenn das immer noch zu teuer ist: Da gäbe es auch noch den 600 Hybrid mit 110 oder 145 Benzin-PS, der schon bei 25.790 Euro brutto beziehungsweise 27.490 Euro für den stärkeren startet. Und der natürlich mehr Reichweite bietet, dafür aber auch dieses nervige Dreizylinder-Gerumpel. •



Gelungene Optik trifft auf brauchbares Platzangebot. Verarbeitung großteils gut. Abdeckklappe lieb gemeint, aber nervig. Cockpit übersichtlich


Fiat 600e
Flotten-Tipp: RED
Testmodell: La Prima
Leistung | Drehmoment 156 PS (115 kW) | 260 Nm156 PS (115 kW) | 260 Nm
Dauerleistung | Gewicht 62 kW | 1.520 kg62 kW | 1.520 kg
0–100 km/h | Vmax 9,0 s | 150 km/h9,0 s | 150 km/h
Reichweite | Antrieb 409 km | Vorderrad406 km | Vorderrad Ø-Verbrauch | Batterie 15,1 kWh | 54 kWh15,2 kWh | 54 kWh
Laden AC 11 kW, 5:45 h (0–100 %)11 kW, 5:45 h (0–100 %)
Laden DC 100 kW, 27 min (20–80 %)100 kW, 27 min (20–80 %)
Kofferraum | Zuladung 360–1.231 l | 505 kg360–1.231 l | 505 kg
Basispreis | NoVA 30.000 € (exkl.) | 0 %35.000 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: wie sympathisch E-Mobilität verpackt werden kann
Das vermissen wir: eine stabilere Laderaumabdeckung
Die Alternativen: Jeep Compass, Peugeot e-2008 Werksangaben (WLTP)
Eine (zu) runde Sache
Schönheit liegt zwar im Auge des Betrachters, das Design des Mercedes-Benz EQE SUV ist aber umstritten. Schade, denn die inneren Werte können sich sehen und fahren lassen.
Text & Fotos:
Stefan Schmudermaier
Wie einige andere Hersteller hat auch Mercedes bei den elektrischen Modellen auf eine neue Formensprache gesetzt. Ein Experiment, das – zumindest unserer Meinung nach – schiefgegangen ist, das EQE SUV bildet da keine Ausnahme. Die rundgelutschte Optik hat (zu) wenige Fans, kein Wunder, dass die Sternenflotte da künftig andere Pfade einschlagen wird. Unter dem Blechkleid gibt’s kaum Anlass zur Kritik, das Reisen im Riesen ist eine Freude.
Komfort auf höchstem Niveau
Das beginnt zunächst mit der Geräuschdämmung und dem aufpreispflichtigen Luftfahrwerk. Die Passagiere werden so richtig in Watte gepackt, passend, dass die Kopfstützen mit flauschigen Überzügen bestückt sind und sogar zwei Extra-Polster im Fond unseres Testautos lagen. Wie auf Wolken geht’s dahin, akustisch gibt’s kaum einen Unterschied zwischen Stadt und Autobahn, da setzt sich Mercedes von der Konkurrenz doch spürbar ab. Mit den leidigen Touchfeldern am Lenkrad haben wir uns zwar mittlerweile angefreundet, hoffen aber dennoch, dass sie in der nächsten Generation rausfliegen, VW hat es vorgemacht. Der große Touchscreen ist indes gut zu bedienen, wenngleich wir auch hier echte Tasten für die Klimaanlage begrüßen würden. Praktisch: Im integrierten Shop (Bild rechts) lassen
sich etwa auf Knopfdruck Autobahnvignetten für mehrere Länder kaufen, Österreich ist nicht dabei. Bei der Verarbeitung und der Materialwahl hat Mercedes zuletzt wieder zugelegt, hier gibt der EQE SUV jedenfalls keinen Anlass zur Kritik. Weniger schön: Wer nicht zum optionalen Hyperscreen –der bis zum Beifahrer reicht – greift, bekommt dort eine große, klobig wirkende Fläche.
Bis zu 400 Autobahnkilometer Zurück zum Fahren. Passend zur komfortbetonten Anmutung gibt es auch bei voller Beschleunigung keinen Tritt ins Kreuz, sechs Sekunden auf 100 km/h sind dennoch alles andere als lahm. Ein Muss ist die optionale Hinterachslenkung, der Wendekreis von 10,5 Metern lässt so manchen Kompaktwagen alt aussehen. Mit Allradantrieb liegt die WLTP-Reichweite bei 555 Kilometern, in der Praxis lassen sich selbst auf der Autobahn deren 400 knacken. 170 kW Ladeleistung sind in der Klasse mittlerweile eher unterdurchschnittlich, 32 Minuten dauert es, von 10 auf 80 Prozent nachzuladen. Preislich startet der EQE 350 4Matic bei 84.030 Euro, unser Testwagen brachte es auf satte 111.028 Euro. •


Über das Außendesign lässt es sich vortrefflich streiten, innen ist der das EQE SUV über alle Zweifel erhaben, der Komfort ist auf höchstem Niveau




|
Reichweite | Antrieb 574 km | Hinterrad555
Laden
Laden
Kofferraum | Zuladung 520–1.675 l | 610 kg520–1.675 l | 610 kg
Basispreis | NoVA
Das gefällt uns: Komfort, Hinterachslenkung, Verarbeitung
Das vermissen wir: höhere Ladeleistung, Frunk
Die Alternativen: Audi Q6 e-tron, BMW iX * über 80.000 Euro brutto kein Vorsteuerabzug möglich Werksangaben (WLTP)




Freizeit

Erstmals in Action
Öffentlich wurde der Renault 5 Turbo 3E vorab noch nie gefahren.
Vom 7. bis zum 11. Oktober fand die Tour de Corse Historique statt. Zwei Prototypen des Renault 5 Turbo 3E waren vor Ort, um sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft zu feiern. Denn mit einem Maxi 5 Turbo gewann Jean Ragnotti 1985 die als besonders kurvig bekannte Rallye. Rallye-Spezialist Julien Saunier bewegte das 555 PS starke Mini-Supercar auf einem abgesperrten Gelände im Hafen von Calvi und auf der Strecke der legendären Sonderprüfung Notre Dame de la Serra und Montegrosso. „Er hat wirklich alles, was man von einem Supersportwagen erwartet – er ist ein echtes Rallye-Biest“, so der Franzose im Anschluss. „Ich war begeistert von der Beschleunigung, die auch bei hoher

Geschwindigkeit nicht nachlässt, der extrem kraftvollen und dennoch leicht zu dosierenden Bremsleistung und der Fähigkeit zu spektakulären, aber kontrollierten Drifts. Es hat so viel Spaß gemacht, ihn zu fahren, und so viele neue Fahreindrücke geweckt.“ Es waren die ersten öffentlichen Fahrten mit dem streng limitierten E-Renault. Aufgelegt werden 1.980 nummerierte Exemplare.

Kia stellt E-Rekord am Red Bull Ring auf
2024 wurde mit dem MG4 XPower (435 PS) ein Rundenrekord mit Rennfahrer am Steuer auf dem Red Bull Ring aufgestellt. Nun hat Kurt Praszl, Manager im Finanzbereich und Motorsportfan, seinen 650 PS starken Kia EV6 GT um die Rennstrecke gescheucht. Unter Mithilfe des Kia-Händlers Greinecker (OÖ) und des Importeurs konnte der neue Rekord für Elektroautos mit Straßenzulassung aufgestellt werden: 1 49,39 Minuten für eine Runde.

Honda zeigt sein erstes Elektromotorrad
Nach dem E-Moped EM1 e: Ende letzten Jahres kommt bei Honda das erste ausgewachsene Elektromotorrad dran. Die WN7 wurde auf europäischen Straßen getestet, um ein emotionales Fahrerlebnis sicherzustellen. Es soll sich von Verbrennermodellen bewusst abheben. Die Abkürzung verbindet das „W“ für Wind und das „N“ für Naked mit der Zahl 7 für die Leistungsklasse. „Das Leistungsvermögen lässt sich mit einem 600-cm³-Verbrenner-Motorrad vergleichen, die Drehmoment-Entfaltung entspricht jedoch einem 1000-cm³-Motor“, meint der Hersteller über das Gerät, das 217 Kilogramm auf die Waage bringt. An einer Wallbox dauert die AC-Ladung unter drei Stunden, am Schnelllader geht es in 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent. Reichweite: 130 Kilometer. Marktstart: 2026.
Ferrari stromert los
Am Capital Markets Day 2025 hat Ferrari das serienreife Chassis und weitere Komponenten des künftigen Elettrica vorgestellt. 60 patentierte, firmeneigene Technologielösungen sollen in diesem Modell zu finden sein und erstmals ist die Rede von 75 Prozent recyceltem Aluminium für Chassis und Karosserie, was zu 6,7 Tonnen CO2-Einsparung pro Fahrzeug führt. Unabhängige Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse ermöglichen Torque Vectoring für hohe Fahrdynamik, die Vorderachse lässt sich jederzeit entkoppeln, um dem Italiener Hinterradantriebscharakter zu verleihen. Spitzentempo sind 310 km/h, mehr als 1.000 PS stehen im Boost-Modus bereit. 530 Kilometer Reichweite, 350 kW Ladeleistung.



Undercover Agent
Mit dem RS bringt Škoda die sportliche Speerspitze der Elroq-Baureihe. Auf dicke Hose macht der aber dennoch nicht, zumindest optisch. Preis/Leistung sind Škoda-typisch gut.
Text & Fotos: Stefan Schmudermaier
Ist das auch wirklich der RS? Diese Frage haben wir uns bei der Übernahme des Testautos gestellt, so unschuldig weiß, wie er da steht. Noch dazu gibt’s hinten kein RS-Logo, hat das jemand mitgehen lassen? Auch innen zeigt sich das derzeit erfolgreichste Elektroauto von Škoda dezent, ein paar RS-grüne Nähte und Einlagen, Sportsitze, fertig. „Nur nicht auffallen“, könnte das Motto lauten. Dabei müssen sich die zweifellos vorhandenen sportlichen Gene nicht verstecken. Ein Tritt aufs Bremspedal erweckt den Wolf im Schafspelz zum Leben, bereits auf den ersten Metern wird klar, dieses Auto hat es durchaus faustdick hinter den Ohren.
Flott und ergonomisch
Bereits im Modus „Normal“ geht ordentlich was weiter, die Kennlinie des Fahrpedals ist fast eine Spur zu scharf, jedenfalls in der Stadt. Der Wechsel zum immer noch potenten EcoModus verschafft Abhilfe, schade, dass der nach jedem Start aufs Neue aktiviert werden möchte. Wer die RS-Gene voll auskosten möchte, wählt natürlich den Sportmodus, der Tscheche liefert sofort. Nur 5,4 Sekunden vergehen, bis das Head-up-Display 100 km/h anzeigt, die hierzulande theoretische Spitze liegt bei 180 km/h.
Dankenswerterweise haben die Ingenieure in Mladá Boleslav, der tschechischen Škoda-Hauptstadt, beim Fahrwerk Gnade walten lassen, wodurch der Komfort auch im sportlichen Topmodell nicht zu kurz kommt. Wer noch mehr Feinabstimmung möchte, greift zur optionalen dynamischen Fahrwerksregelung DCC. Gute Arbeit wurde auch im Innenraum geleistet, eines der besten Lenkräder im VW-Konzern kommt nicht nur mit klassischen und gut zu bedienenden Tasten, auch die gute alte Walze zur Steuerung der Lautstärke wurde hier nicht wegrationalisiert oder gegen vermeintlich bessere Lösungen getauscht. Das Raumgefühl ist Škoda-typisch großzügig, selbst hinter großen Piloten ist reichlich Platz, im Kofferraum mit 470 bis 1.580 Litern ebenso.
400 Kilometer Praxisreichweite
542 Kilometer Reichweite verspricht der WLTP-Wert, um die 400 sind es in der Praxis, wenn man den RS einigermaßen artgerecht bewegt. Ist der Stromspeicher leer, wird mit bis zu 185 kW geladen, von 10 auf 80 Prozent in 26 Minuten. 11 kW an der ACWallbox kann er natürlich auch. Mit netto 45.158 Euro ist der RS 15.583 Euro teurer als das Grundmodell, aber immer noch fair eingepreist. •




Der Innenraum überzeugt mit hochwertigen Materialien und sehr guter Ergonomie sowie einem großzügigen Platzangebot für Passagiere und Gepäck (470 bis 1.580 Liter)
Škoda
Elroq Flotten-Tipp: 60 Testmodell: RS
Leistung | Drehmoment 204 PS (150 kW) | 310 Nm340 PS (250 kW) | 679 Nm
Dauerleistung | Gewicht 70 kW | 1.975 kg77 kW | 2.226 kg
0–100 km/h | Vmax 8,0 s | 160 km/h5,4 s | 180 km/h
Reichweite | Antrieb 427 km | Hinterrad552 km | Allrad Ø-Verbrauch | Batterie 15,8 kWh | 59 kWh16,1 kWh | 79 kWh
Laden AC 11 kW, 6:30 h (0–100 %)11 kW, 8:30 h (0–100 %)
Laden DC 165 kW, 24 min (10–80 %)185 kW, 26 min (10–80 %)
Kofferraum | Zuladung 470–1.580 l | 482 kg470–1.580 l | 506 kg
Basispreis | NoVA 33.325 € (exkl.) | 0 %45.158 € (exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Preis/Leistung, Verarbeitung, Reichweite, Fahrleistung
Das vermissen wir: abschaltbare Adaptivfunktion beim Tempomaten
Die Alternativen: Peugeot 3008, Volvo EX40, Mini Countryman Werksangaben (WLTP)

Der zu große Traum
Es hätte ein fulminanter Start in eine neue Ära sein können. Doch blöderweise wurde es das stattdessen für einen völlig anderen. Der Ro 80 wurde zum Sargnagel für NSU, weil zu viel Vorsprung schnell einmal ins Geld gehen kann.
Text: Roland Scharf, Fotos: Audi
Ende der 1960er wollte man bei NSU nicht nur ein neues Modell auf den Markt bringen, sondern gleich zwei. Doch während der K 70 einfach nur ein normales und gutes Auto werden sollte, wollte man mit dem Ro 80 alles neu und anders machen. Und das als kleiner Hersteller in einem zunehmend komplexeren Automarkt. So war es, dass man mit dem Ro 80 zu weit in die Zukunft blickte. Damals, unmittelbar nach dem Atomzeitalter, ging die Suche nach neuen (aber realistischeren) Konzepten gerade los, und NSU wollte mit dem Rotationskolbenmotor (daher auch der Name des Wagens) ganz vorne mit dabei sein. Leicht, kompakt, vibrationsarm, drehfreudig – auf dem Papier ein traumhaftes Konzept.
Konservative Kniffe
Claus Luthe zeichnete eine atemberaubende Form, von der man bis heute nicht glaubt, dass sie bereits zu Beginn der 60er zu Papier gebracht wurde. Dazu kam eines der aufwändigsten Fahrwerke seiner Zeit, vier Scheibenbremsen (vorne innen am Getriebe angeschlagen) und obendrauf geriet der ganze Wagen so aalglatt, dass auch der cw-Wert überraschend niedrig war. Wenn man sich jetzt vorstellt, was 1967 sonst so neu auf den Markt kam (das erste echte Facelift vom Käfer etwa), musste der Ro 80 wie von einem anderen Stern gewirkt haben. Ja, und genau das war eines der Hauptprobleme der Wagens: So stach NSU in ein doch ziemlich konservatives Segment, wo man klassische Formen einfach mehr schätzt. Zum anderen aber hatte man die neuartige Technik einfach noch nicht im Griff.
Bis zum Spruch
Für eine längere Erprobungsphase fehlte aber einfach die Kohle und die Probleme ließen sich vorab selbst auf den tapfersten Prüfständen nicht simulieren. Es krankte an der Zündanlage, den Dichtleisten der Rotationskolben, und sogar der Drehmomentwandler sorgte für Ärger, da er sich gerne auflöste und Metallspäne in den Ölkreislauf kamen. Manchmal waren auch die Kunden selber schuld, weil sie den luftig hochdrehenden Motor überdrehten, da es noch keinen Drehzahlbegrenzer gab, und alles führte meist zu einem kapitalen Motorschaden. Jetzt steckte man aber in einer Klasse fest, wo man kulanterweise immer gleich einen neuen Motor spendieren musste – und das ging über die Jahre natürlich massiv ins Geld. Viele Werkstätten waren schon so flink darin, dass sie für den Tausch der Aggregate kaum länger benötigten als für einen herkömmlichen Kundendienst. Jedenfalls wäre es unfair, zu sagen, dass die NSU-Ingenieure das auf




sich sitzen gelassen haben. Stück für Stück eliminierte man alle Sperenzchen, nur war es da für den Ro 80 schon zu spät, der gewaltige Imageschaden nicht mehr wegzukonstruieren. Anfang der 1970er gab es keinen Ausweg mehr, als von Volkswagen geschluckt zu werden. Tatsächlich blieb der Ro 80 als einziger Wagen unter dem alten Firmenlabel noch bis 1977 im Programm – sein Erbe hingegen blieb bei Audi, die sich in der Zwischenzeit im Werk in Neckarsulm immer breiter machten. Prototypen des Audi 100 mit überarbeitetem Wankelmotor blieben zwar nur im Versuchsstadium, da sich der Antrieb als unrentabel und zu durstig erwies. Das schnörkellose Design hingegen, Luthes Idee vom großen Glashaus, dünnen Dachsäulen und schlichten Linien, hielt sich bei der Marke mit den vier Ringen noch bis weit in die 1990erJahre. Genauso wie der Werbespruch: Vorsprung durch Technik. •

Der NSU Ro 80 war seiner Zeit weit voraus, das war sein Fehler. Audi übernahm von der Designsprache bis zu Werbespruch nach der Übernahme alles

DAS DOCH NICHT GEBAUTE FIRMENAUTO

AUS DER REDAKTION
Tiefflug statt Überflieger
Eintages-Termin von Dacia in Paris. In der Früh hin, abends zurück, keine große Sache – außer, der Rückflug wird eine Stunde vor Boarding annuliert.
Auf Hektik folgt Panik, nachdem die serviceorien tierte Fluglinie nur ein Standby-Ticket für nächsten Morgen offeriert und die Hotline des Reisebüros in Indien endet. Da vormittags darauf ein wichtiger Termin anstand, war es Zeit für drastische Maßnahmen: Statt Flughafenhotel entschied man sich für einen Mietwagen und startete um 20 Uhr Rich tung Wien. 1.300 Kilometer waren zu bewältigen, verteilt auf vier Personen. All das führte zu interessanten Erkenntnissen: Jedem wurde erst Stunden später bewusst, was das eigentlich für eine Tour ist. Brillenputzen zahlt sich bei Nachtfahrten aus. Bei meinen Erzählungen schlafen alle ein. Französische Tankstellen sind appetitlicher als deutsche. Nie auf die Uhr und Restfahrzeit schauen, dann wird man nicht müde. Und wir waren wohl die Einzigen, denen im Morgenverkehr auf der S1 bei Schwechat zum Lachen zumute waren. Nach elf Stunden Fahrt. • (RSC)

Illustration: Reichel CarDesign
VORSCHAU

Škoda Roomster (2015)
Handyfotos infiltrierten 2015 das Internet mit Aufnahmen einer ungetarnten ŠkodaVersion des damaligen VW Caddy, welche den Roomster hätte beerben können. Das Projekt verschwand wieder in der Schublade. Der spätere Erfolg der SUV-Modelle offenbart wohl, warum Škoda sich alternativ doch klar auf diese Gattung konzentrierte. •
In unserer Rubrik „Das doch nicht gebaute Firmenauto“ stellen wir Fahrzeuge vor, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Illustration durch Reichel CarDesign durchaus Chancen aufSerienfertigunghatten,dann aber doch verworfen wurden.
Die kommende FLOTTE widmet sich Anfang Jänner den Themen Fuhrparkmanagement & Finanzierung sowie Connected Car. Dazu gibt es neben aktuellen Tests und News als Beilage das beliebte Nachschlagewerk „Nutzfahrzeug KOMPASS“ mit allem Nützlichen, was Sie rund um Kastenwagen & Co wissen müssen.




Impressum: MEDIENINHABER, VERLEGER UND ANZEIGENVERWALTUNG A&W Verlag GmbH (FN 238011 t), Inkustraße 1-7/Stiege 4/2. OG, 3400 Klosterneuburg, +43 2243 36840-0, www.flotte.at, redaktion@flotte.at; Verleger: Helmuth H. Lederer (1937–2014); Geschäftsführer: Stefan Binder, MBA (Kfm. Verlagsleiter), +43 664 528 56 61, stefan.binder@awverlag.at, Verlagsleiter B2C, Prokurist & Chefredakteur: Stefan Schmudermaier, +43 664 235 90 53, stefan.schmudermaier@awverlag.at; Chef vom Dienst: Roland Scharf; Redaktionelle Mitarbeit: Mag. Severin Karl, Mag. Bernhard Katzinger, Achim Mörtl, Roland Scharf; Fotos: Werk, Hersteller, Archiv; Coverfoto: stock.adobe.com/sa-photo/Aisyaqilumar/MHT Visuals/ImageNest Hub; Lektorat: Katharina Schaller, www.lektorat-schaller.at; Anzeigenmarketing: Xaver Ziggerhofer (Ltg.), +43 664 235 90 51, xaver.ziggerhofer@awverlag.at; Winfried Rath, Alexander Keiler; Grafik: graphics – A. Jonas KG, Inkustraße 1-7/Stiege 4/2. OG, 3400 Klosterneuburg, office@jonas.co.at; Druck: Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 3580 Horn, Wiener Straße 80; Bezugspreis: Jahresabonnement (6 Ausgaben), Inland: 56,40 Euro inkl. Steuern und Porto; Gerichtsstand: LG Korneuburg; Verbreitete Auflage: 20.806 Stück; Erscheinungsweise: Februar/ März, April/Mai, Juni/Juli, September, Oktober/November, Dezember/Jänner mit Supplements laut Mediadaten 2025; Grundlegende Richtung: unabhängige Fachzeitschrift für österreichische Firmenautobetreiber; Der besseren Lesbarkeit halber verzichten wir auf die Verwendung mehrerer Geschlechtsformen, bei Personenbezeichnungen sind immer alle Geschlechter (m/w/d) gemeint.
Vertrauen Sie auf eine Druckerei, die Ihre Anforderungen versteht. Wir kombinieren exzellente Technik mit persönlichem Service, um Ihre Ideen perfekt umzusetzen. Qualität, Verlässlichkeit und Nähe – das ist unser Anspruch, damit Sie überzeugen.
Ihr Peter Berger



NATURAL BORN WORKER



BEREITS AB € 29.490,- (EXKL. UST.)*



INKLUSIVE 4 JAHREN GARANTIE* UND GRATIS WINTERKOMPLETTRÄDERN*
BEI FINANZIERUNG.

Symbolfoto. Verbrauch: 7,2-11,1 l/100km; CO2-Emission: 189-291 g/km. Die angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf die Serienausstattung und sind als Richtwerte zu verstehen. *Aktionspreis exkl. USt. für DUCATO MCA BlueHDi 120 S&S 6-Gang bei Finanzierung über Stellantis Financial Services. Gültig bei Kaufvertrag bis 30.11.2025 bei teilnehmenden Fiat Professional-Partnern. Angebot von Stellantis Financial Services - ein Service der Stellantis Bank SA Niederlassung Österreich für Unternehmer - unterliegt nicht dem VKrG. Angebot inkl. Garantieverlängerung gratis für 48 Monate/120.000 km (gemäß den Bedingungen der FCA Austria GmbH) und vier Winterkompletträdern exklusive Montage und Radbolzen. Keine Barablöse möglich. Solange der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand 10/2025. www.fiat.at/professional





