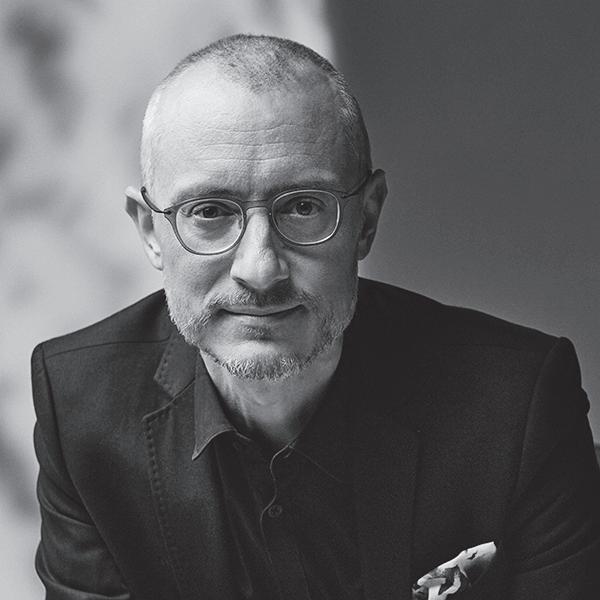JOHANNES HARTL Gott ungezähmt
Raus aus der spirituellen Komfortzone
Mit einem Vorwort von Bischof Hermann Glettler
Neuausgabe 2021
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau
Alle Rechte vorbehalten www.herder.de
Umschlaggestaltung: wunderlichundweigand, Stefan Weigand
Umschlagmotiv: fotana/shutterstock
Satz: mittelstadt 21, Vogtsburg-Burkheim
Herstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN Print 978-3-451-03183-0
ISBN E-Book 978-3-451-82646-7
3 . Priorität
Gast in einem sonderbaren Restaurant
4 . Herrlichkeit
Ein selbstvergessener Gott?
Ein göttlicher Egoman?
dreifaltig
zum Dessert der Lobpreis
Wo ist der Haken?
Die Wurzeln des Misstrauens und das Pendel
Der Tag, als mein bester Freund starb
Die einzige Wahrheit über Gott?
Unbefugt auf heiligem Boden
Gott ist nicht beliebig, sondern heilig
ist nicht relativ, sondern ewig
Gott ist nicht hilflos, sondern allmächtig
Tränen in Riga
Gott ist kein Kumpel, sondern der Richter
Hoffnung für die alte Elisabeth
Kleine Übung
7
Exodus
Begegnung mit der Schönheit
Geheiligt werde
Die Wurzel des Problems
Herzens-Götzen
Der Auszug aus der Sklaverei
Wer du bist und wer ich bin
Vor Sonnenaufgang
Raus aus der Komfortzone!
Anmerkungen
Vorwort
Ein Spiritualitäts-Defi
Es gibt Bücher, die wie Defibrillatoren (umgangssprachlich Defi genannt) im Mainstream der theologischen und spirituellen Literatur unserer Zeit wirken. Das vorliegende Buch von Johannes Hartl zählt dazu. Wie das medizinische Gerät, das mittlerweile in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden bereitgestellt ist, verabreicht es gezielte Stromstöße. Verstörend und belebend, biblisch klar und unvermutet zugleich. »Gott ungezähmt« ist eine wohltuende Alternative zu einer verharmlosenden Rede von Gott. Diese macht Gott zum nostalgischen Teddybären unserer Vorstellungen und emotionalen Erwartungen, ermutigt oder ermächtigt aber niemanden zu einer Neuorientierung des Lebens. Ähnlich verhält es sich mit der von Johannes Hartl scharfsinnig kritisierten Wohlfühl-Spiritualität, die letztlich nur ein religiöses Konsumverhalten verfestigt. Von einem Mündigwerden der Töchter und Söhne des einen himmlischen Vaters kann keine Rede sein.
Sich Gott aussetzen
Wir müssen an Gott Maß nehmen – so der Duktus des engagierten Textes – nicht an unseren Sehnsüchten, spirituellen Bedürfnissen und Erwartungen. Wir beobachten doch vielerorts, dass eine nur wohlmeinende, auf eine rasche Harmonie be-
dachte Spiritualität nicht einzulösen vermag, was sie verspricht. Als Wohlfühlprogramm, das Gott letztlich außen vor hält, verkommt sie rasch zu einer subjektiven Täuschung – auf Dauer weder Trost noch Nahrung für die Seele. Angesichts vielfältiger Verflachungen in der Gottesrede und einer geschmäcklerischen Vermarktung von Spiritualität provoziert die schnörkellose Theologie von Johannes Hartl. Gegen eine zu gefällige Mainstream-Spiritualität spricht das Buch von Gottesfurcht und Anbetung. Gott anbeten! Ein klares Korrektiv zur »Wasmir-guttut«-Verbrämung des Glaubens. Wirkliche Lebensrelevanz erlangt unser Glaube erst dann, wenn wir uns in aller Brüchigkeit und Nervosität heutiger Zeit Gott neu aussetzen. Zuerst Gott lieben
Die Notwendigkeit einer vielfachen Konversion (Papst Franziskus) ist uns auch aus der globalen Krisen-Debatte bekannt. Es wird keine nachhaltige ökologische Neuorientierung geben können, wenn wir weiterhin unsere überzogenen Wünsche zum Maßstab des Handelns machen. Ähnliches gilt für die Frage nach einer global fairen Verteilung von Gütern und Zukunftschancen. Christliche Spiritualität könnte für alle jetzt anstehenden, lebensnotwendigen Umkehr- und Veränderungsprozesse eine wichtige Rolle spielen. Wenn wir sie in ihrer geistvollen Radikalität ernst nehmen. Es geht nicht zuerst um das eigene Ich, das bedient und versorgt werden muss, sondern um das Du des Nächsten, um das Du der Schöpfung und –Johannes Hartl ruft es uns in Erinnerung – an erster Stelle um das Du Gottes. Zuerst Gott lieben und verherrlichen! Dieses Zuerst erneuert den Herzrhythmus, der für die Zukunft unserer
Welt entscheidend sein kann. Mit einem kraftlosen Kammerflimmern dürfen wir uns nicht begnügen. Umkehr ist nötig!
Neue Freiheit wagen
Entscheidend bei der Defibrillation ist der frühestmögliche Einsatz, da die durch das Kammerflimmern hervorgerufene Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff binnen kurzer Zeit zu massiven neurologischen Defiziten führen kann. Dieses Faktum verpflichtet. Auf den Spiritualitäts-Hunger unserer Zeit dürfen wir nicht fahrlässig reagieren. Es braucht im unbestimmten, nervösen Herzflimmern unserer Gesellschaft eine geistvolle Unterbrechung. Und eine neue Herzensbildung angesichts einer vorherrschenden Zerstreutheit in den wesentlichen Lebensfragen. Kritisch zu hinterfragen und zu entthronen sind die vielen »Herzens-G ötter«, die uns innerlich besetzen. Wirkliche Freiheit stellt sich erst dann ein, wenn wir Gott als bestimmende Mitte unseres Daseins wählen, als Ziel, Quelle und Fluchtpunkt. In Jesus hat Gott uns definitiv von aller Entfremdung befreit. Lobpreisende Anbetung ist die Antwort darauf – und die entsprechende Haltung zur präventiven Vermeidung aller Zwänge und Ängste, die aus der Anbetung der falschen Götter resultieren. Persönlich antworten
Ohne das »heilsame Erschrecken vor Gottes Souveränität« verkommt christliche Frömmigkeit doch rasch zu einem religiösen Dekor eines wohlanständigen bürgerlichen Lebens. Johan-
nes Hartl verbirgt in seinen Ausführungen auch nicht sein persönliches Ringen mit den großen Enttäuschungen, die niemandem erspart bleiben, der sich auf den anspruchsvollen Weg mit Gott einlässt. Vor allem der Tod seines besten Freundes Tom, der eine schwangere Frau und ein weiteres Kind zurücklassen musste, hat den Autor zu einem verständnisvollen Zeugen gemacht. Er spricht nicht theoretisch über Gottes tröstende Gegenwart, sondern als jemand, der sich in die herausfordernde Schule Gottes nehmen ließ. Das vorliegende Buch ist ein heilsamer Defi – anregend, inspirierend und lustvoll einladend zu einer persönlichen Beziehung mit Gott selbst.
Ein faszinierender Ausstieg aus der Komfortzone ist dafür notwendig.
Hermann Glettler
Prolog
Berstendes Glas. Die dünnen Scheiben halten dem Druck nicht mehr stand. Das heulende Untier holt uns ein, vor dem wir geflohen waren. Jetzt auch krachend splitternde Fenster aus dem dunklen Gang oben, eingedrückt vom Sturm. Wieder Flucht vor dem Sturm aus dem kalten Gang in den kargen Schlafsaal der Gäste. Die weißen Wände vom flackernden Licht kahler Glühbirnen gelb erleuchtet, die Rucksäcke am Boden. Hier ist noch alles heil. Doch wohin soll man sich legen, wenn jedes der klapprigen Eisenbetten in der Nähe eines Fensters steht? Würden plötzlich klirrend Scherben über das Bett und meinen Kopf schleudern, mitten in der Nacht?
Begonnen hatte es mit einem besorgten Blick auf das Meer. Lange vor Sonnenaufgang aufgestanden hatten Tom und ich unten bei der Feuerstelle zu beten begonnen. Hinter uns die Skiti Hagia Anna, eine kleine Klostersiedlung an der klippenreichen Südostspitze der Halbinsel Athos, dem Staat in Nordgriechenland, der nur aus orthodoxen Mönchen besteht und einer mediterranen Wildnis, in der die Zeit seit Jahrhunderten stehengeblieben scheint. Tagelang waren wir gewandert. Schweigend, betend. Bis heute, dem Abreisetag und dem besorgten Blick auf das Meer: Denn weg kamen wir hier nur mit der Fähre, kein Landweg führt auf den Athos. Oder zumindest kein gefahrloser, frei zugänglicher, bekannter, auf Kar-
ten eingezeichneter. Doch die Ägäis zeigte sich an jenem frühen Morgen anders im Dämmerlicht, als ich das Meer je zuvor gesehen hatte. Wellen peitschten schaumgekrönt, Reihe um Reihe. So dicht an- und ineinander, dass Grau sich brodelnd ins Grau stürzt. Eine einzige Gischt, dort weit unter uns. Die Stunden der Dämmerung verstrichen. War es vielleicht ein stürmischer Nachtwind, der mit der aufgehenden Sonne einer sanfteren Brise weichen würde? Pflegt nicht die Brandung sich mit unter morgens zu besänftigen? Trügerische, schnell vernichtete Hoffnung.
Dies war kein stürmischer Nachtwind. Das Meer selbst war aus dem Schlaf erwacht und hatte brüllend sein Haupt erhoben. Es schien unsere Hoffnung auf Beruhigung mit nachlässiger Gebärde zu ignorieren. Berauscht von der eigenen Macht, schien das Meer gerade erst Fahrt aufzunehmen, und zwar gegen uns. Wir, ein knappes Dutzend gestrandeter Besucher. Westler, moderne Weltmenschen, in dieser Wildnis unter ein kleines Vordach geflüchtet. Dort, wo die Fähre anlegen sollte, nur heute gewiss nicht würde. Wir, ein französischer Soldat und sein Kollege, ein italienischer Bauingenieur und ein paar Deutsche. Zunächst wählt jeder seine eigene Strategie der Beruhigung. Ruft zu Hause an. Ruft bei der Hafenbehörde an. Dort wird zwar nur Griechisch verstanden, aber alles lässt sich regeln. Klar, ein Sturm. Doch man hat Pläne, man hat Rückflüge zu erreichen. Für unseren bleibt uns genau noch ein Tag, an dem wir bis nach Thessaloniki kommen müssen. Stattdessen verstreichen die Stunden und der ganze Tag versickert im Warten. Ein kleiner Pick-Up bringt uns schließlich in das Hauptdorf des Athos. Die schmale Straße windet sich höher und höher durch den herbstlichen Wald. Steiler die Klüfte unter und neben uns.
Umgestürzte Bäume. Der Sturm fegt durch die Wipfel wie ein achtloser Junge über die Ähren. Seit Kindheitstagen hatte ich keine Angst mehr vor der Natur gehabt. Doch diese entfesselte Gewalt schien auch das kein bisschen zu interessieren. Und sie entließ uns nicht aus ihrem Griff. Auch in Karyes nicht, im Zentrum der Insel, auch dort nicht, wo mehr Menschen wohnen. Drohende Wolken fahren in Schwaden dunklen Rauchs über den aufgewühlten Himmel. Der Regen setzt prasselnd ein und wir flüchten uns in das halbverfallene russische Kloster, das uns dampfende Nudeln in großen Blechtöpfen und ein kurzfristig hergerichtetes Nachtlager beschert. Berstendes Glas an diesem Abend. Berstendes Glas zum sonoren mehrstimmigen Bass russischer Mönchsgesänge. Und nur die Literflasche harzigen Weißweines verhilft in den unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen strahlt der Himmel hell. Frohen Schrittes erreichen wir abermals den kleinen Hafen. Heute geht unser Flugzeug! Wieder versammelt die zwei Franzosen, der Italiener und wir Deutsche. Der Wind hat nachgelassen und die Hoffnung kam mit dem Sonnenaufgang. Endlich, ein Uniformierter. Im brüchigen Englisch erklärt er, es sei unsicher, ob die Fähre heute fahren könne. Man müsse warten. Und so warten wir. Stunde um Stunde. Der Vormittag verstreicht und mit ihm die allerletzte Möglichkeit, vielleicht noch unser Flugzeug zu erreichen. Überall werden die Handys gezückt. Wetterbericht. Anrufe bei der Wetterbehörde, der Fährengesellschaft, der Fluggesellschaft. Fassungslose Blicke. Der Sturm sei doch vorbei! Ja, aber das Meer sei noch zu unruhig. Aber die Wellen wirken doch nicht mehr groß, protestieren wir und fühlen uns ungerecht behandelt. Ob die in der Hafenbehörde überhaupt wüssten, wie wichtig das sei? Wie wichtig die Termine seien, die wir zu erreichen hätten? Der eine hat eine Vorlesung
in Medizin zu halten, der andere ein entscheidendes Treffen für ein großes Bauprojekt. »Aber ich muss morgen in Mailand sein!«, oder in München, Paris, Athen. Alternativrouten werden erwogen. Ein Waldarbeiter lässt sich breitschlagen, uns für einige hundert Euro tief in den Wald bis zur Grenze des Athos-Gebiets zu fahren. Von dort könne man es zu Fuß versuchen. Allerdings sei das nicht ungefährlich, immer wieder seien Wanderer tief in diesem unwirtlichen Urwald verloren gegangen. Die Alternative: ein kleines Boot von der anderen Seite der Insel. Doch auch daraus wird nichts: Das Meer sei noch immer zu unruhig. Der Tonfall wird wütender, der Blick des Hafenaufsehers immer gleichgültiger. Vielleicht werde das Seewetter ja noch besser. Aber es sei doch schon besser! Ja, aber wir verstünden einfach nichts vom Meer. Ob es eine Frage des Geldes sei, startet der französische Soldat seinen letzten verzweifelten Versuch. Doch die Hafenbehörde zeigt sich unbestechlich. Und selbst wenn sie bestechlich wäre: Das Meer kann man nicht bestechen. Schreie. Tränen der Wut. Hier lässt sich nichts mit Geld kaufen, mit Verhandeln ändern. Wir sind ausgeliefert und hängen fest. »Wenn aber wieder ein Gott mich schlägt auf dem weinroten Meer, ertragen will ich’s (…), denn schon viele Leiden litt ich und viele Mühen auf den Wogen und im Krieg«, lässt Homer den Odysseus der Göttin Kalypso zum Abschied sagen – ein wenig nachfühlen kann ich dem attischen Helden in seiner Sehnsucht, endlich nach Hause zu kommen. All unsere Pläne von einem Sturm aus der Hand gerissen. In Scherben zu unseren Füßen wie das dünne Fensterglas. Vor uns schlicht die unbeugsame Macht der See. Und wir vor ihr.
Stets liebte ich das Meer. Der Blick in die grenzenlose Weite. Dort, wo die schnurgerade Kimm die Unendlichkeit der Was-
serfläche mit der des blauen Himmelsraumes zu verbinden und von ihr scharf zu trennen versteht. Ich liebte den Ozean mit seinen Schätzen. Den Korallen und eiskalten Tiefen. Den schattigen Palmenstränden und dem millionenfachen Glitzern des blendenden Sonnenuntergangs auf den glatten Wogen. Und seit jenen Tagen zwischen Bangen und Hoffen, zwischen ratlosem Warten und mürrischem Sich-Ergeben, seit jenen Tagen im Sturm auf Athos, sage ich: Ich liebe und fürchte das Meer. Das Watt, das mit seiner Weite lockt und mit seinen Mustern und kleinen Geheimnissen im Schlick, und das Watt, in dem man sich tödlich verlieren kann. Die Flut, die jauchzend in die Klippen kracht und Kinder in den Wellen toben lässt, und die, in der man ertrinken kann. Ich liebe und fürchte das Meer. Und nur weil ich es fürchte, staune ich so recht darüber. Ich meine nicht Angst, aber ich habe Respekt davor. Und hätte ich das nicht, so würde ich es nicht kennen. Je mehr man es kennt, desto mehr liebt und fürchtet man es. Und es kennt wohl jener am besten und weiß auch um seine Gefahren, der auf einer Insel lebt. Der vom Meer umgeben ist. Dem der Landweg nicht offensteht. Sein Auge schweift permanent hinaus ins Grenzenlose und er gerät immer wieder ins Staunen. Die frische Brise und die Hoffnung auf neue Ausfahrt ist ihm immer neu, wie der Schrei der Möwe. Zugleich weiß er, womit er es zu tun hat. Selbst der Tauglichkeit des Schiffes und selbst dem Wetterbericht wird er nur bedingt Bedeutung zumessen. Denn er hat schon zu viel gesehen von dem, wie das Meer sein kann. Verschmitzt schüttelt er den Kopf, murmelt sein »wer weiß, wer weiß« und meint damit: Am besten macht man Frieden mit dem Meer, findet sich ab mit Gezeiten, Wetter und Strömungen. Der Mann auf der Insel ahnt: All das wird sich niemals ändern lassen. Und trotzdem liebt er das Meer, obwohl, gerade weil er es auch fürchtet.
Ich liebe und fürchte Gott wie das Meer. Ich staune über Gott wie über das Meer. Früh schon begann ich mit dem Staunen. Doch er ist mir immer größer geworden, so wie das Meer. Das Staunen ist der Anfang der Philosophie, das wussten schon Plato und Aristoteles.1 Doch es ist auch der Anfang des Betens. Dem Betenden wird Gott immer größer. Und er hat mehr zu staunen, mehr zu lieben und – mehr zu fürchten.
Denn was man nicht fürchten kann, darüber staunt man nicht recht. Nicht Angst ist gemeint, doch das Spüren, dass da etwas viel Größeres ist als man selbst. Wovor man nicht zittern kann, das kann man nicht anbeten. Das jedenfalls ist die These dieses Buches. Und selbst das, was man aus ganzem Herzen liebt, lässt auch erbeben. Dem Betenden wird all das über Gott klar, so wie dem Fischer von der See. Freilich lebt der Inselbewohner in besonderem Bewusstsein des Meeres. Und so vielleicht der betende Gläubige im Bewusstsein Gottes. Wie von einer anderen Insel mag der erscheinen, wenn er am Festland davon erzählt, was er gesehen hat. Wie einer gar, der Seemannsgarn spinnt. Dessen Geschichten, falls sie wahr sind, von etwas handeln, was unendlich weit weg ist. Weit weg von hier, wo es feste Straßen gibt, Wettervorhersagen und Mobiltelefone. Er wiederum kann sie nicht ernst nehmen, die Einwände derer, die es sich sicher und warm eingerichtet haben auf dem Festland. Ihre trockene Stubenseligkeit. Er weiß, was er zu fürchten hat. Er weiß am besten: Jeder Kontinent ist vom Wasser umgeben. Und jede Straße, fährst du sie nur lang genug, grenzt an den Ozean. Du kannst ihm nicht ausweichen. Du kannst Gott nicht ausweichen. Keine Chance. Lass dein Handy ruhig stecken. Er ist unbestechlich. Er ist real. Und er ist nicht harmlos. Er ist – ungezähmt.
Phantomschmerz
Geplantes Leben
»Klar werde ich zum Meeting nächste Woche kommen, außer ein Sturm hindert mich daran«, ist ein Satz, den man in einem Bürogebäude in Deutschland wohl nicht so oft hören wird. Genauso unerhört klänge die Aussage, man könne ein Projekt für das nächste Jahr nicht mit letztgültiger Sicherheit terminieren, weil ja noch nicht einmal klar sei, ob man bis dahin nicht schon gestorben, in eine schwere psychische Krise geraten oder ein Krieg ausgebrochen sei. Es gibt gewisse Dinge, von denen geht man einfach nicht aus. Obwohl Leiden und Tod in der Menschheitsgeschichte ständige, allgegenwärtige Begleiter sind, verwundert das fassungslose Erstaunen, wenn es das eigene Leben oder das unmittelbarer Mitmenschen bedroht. »Wie konnte gerade mir das passieren«, hallt wieder die gleiche ungläubige Überraschung, die in unseren Reaktionen auf eine Todesnachricht mitschwingt: »Ich kann es nicht glauben, gerade war sie doch noch da!« Das Ungeplante ist nicht eingeplant in unser Leben.
Das ist einerseits auch gut so. Menschen können nicht jeden Tag und jede Stunde im festen Bewusstsein eines möglichen unmittelbar bevorstehenden Unglücks leben. Und wer so lebt, um dessen geistige Gesundheit darf man wohl zu Recht besorgt sein. Doch das grundsätzliche Gefühl der Vorhersagbarkeit und Verlässlichkeit des natürlichen Lebens ist ein überdeutliches Kennzeichen der heutigen westlichen Zeit. So überdeutlich, dass es nähere Betrachtung verdient. Dass ein Sturm – eben nur ein Sturm auf dem Meer – die eigenen Pläne so ohne jedes Achselzucken über den Haufen wirft, versteht ein Mensch besonders wenig, der es gewohnt ist, sein Leben in der Hand zu haben. Und die moderne Welt liefert dem Menschen eine Unmenge von Anlässen, davon auszugehen, das Leben in der Hand zu haben. Wir sprechen von Lebensplanung. Welchen Beruf ich ergreife, wann ich den Arbeitsplatz wechsle, wann ich in Rente gehe und wohin ich in den Urlaub fahre, sind allesamt Gegenstand der eigenen Planung und der eigenen Vorstellungen. Auch ob und wann man Vater oder Mutter wird, ist kalkuliert, dafür gibt es schließlich die Familienplanung.
Für das, was man nicht planen kann, gibt es Versicherungen. Gegen Blitzschlag und gegen Wasserrohrbruch. Welch trügerisches Spiel mit den Worten: Eine »Lebensversicherung« sichert ja eben nicht das Leben vor dem Tod ab, sondern bedeutet in Wahrheit nur, dass jemand Geld bekommt, falls ein Ereignis eintritt, das man nicht verhindern kann. Trotzdem gibt es irgendwie ein gutes Gefühl und suggeriert, man lebe völlig abgesichert. Und wenn etwas nicht funktioniert, wird der Arzt gerufen. Oder der Polizist. Oder der Hausmeister. Oder der Rechtsanwalt oder die Politiker. Denn grundsätzlich erscheint das Leben uns organisierbar. Fragt einer genauer nach, gilt er
schnell als Pessimist oder Grübler. Hinterfragt einer die angeblichen Sicherheiten unserer Realität, ist er vielleicht schlicht realitätsfern.
Das grundlegendste Mittel der Orientierung des Menschen in der Welt und seiner Absicherung darin ist die Sprache. Es beruhigt, wenigstens den Namen der Krankheit zu wissen. Die Diagnose heilt nicht, doch der Schrecken ist zumindest etwas geworden, über das man sprechen kann. Das Wort ermöglicht weitere Information. Zwar ändert der Wetterbericht das Wetter nicht, doch zumindest zu wissen, wie es wahrscheinlich wird, lässt die Realität ein wenig planbarer erscheinen. Statistiken über prognostizierte Krankheitsverläufe reihen das Unbegreifliche dieses Einzelschicksals ein in das topographisch erfasste Terrain dessen, was schon andere Menschen erlebt haben und deshalb etwas darüber wissen. Selbst wenn die Statistiken ein düsteres Bild zeichnen: Wir wollen sie kennen. Denn selbst diese Zahlen zu wissen, ist besser als die undurchdringliche Ungewissheit. Freilich: Sie heilen nicht.
Das Vertrauen in menschliche Technik und menschliche Wissenschaft ist groß in unserer Zeit. Und sie gibt uns guten Grund dazu. In den letzten Jahrzehnten wurde das All bereist, das menschliche Genom entschlüsselt, das HiggsTeilchen und ein Mittel gegen den Herpesvirus entdeckt. Die Welt ist, so könnte man meinen, erforschter, heller und dem Menschen freundlicher geworden. Und daran ist etwas Wahres. Die Errungenschaften der technischen Vernunft sollen an keiner Stelle von jemandem kleingeredet werden, der sich ihrer so fraglos und täglich bedient. Es ist jedoch weise, einschätzen zu können, wo man steht. Um den Weg zu wissen, den man gegangen ist und den, den man nicht kennt. Es ist
weise, unterscheiden zu können zwischen dem eigenen Sichtfeld und dem tatsächlichen Horizont. Und es ist weise, zu erkennen, wie weit die Straße führt, auf der man fährt, bevor das Meer beginnt.
Technische Vernunft
Was genau geschieht, wenn der Mensch sich in der Welt orientiert? Was geschieht, wenn ein Wissenschaftler »etwas erforscht«? Im Wesentlichen Zweierlei: Phänomene werden einsortiert und Umgangsweisen mit ihnen werden entwickelt. Das helle Leuchten am Himmel wird »Blitz« genannt und, auf Grund von Messung und Beobachtung, in die Kategorie der elektrischen Phänomene eingeordnet. Wir wissen dann, weil wir um andere elektrische Phänomene wissen, was das Auftreten von Blitzen wahrscheinlich macht. Daraus folgern kann man, dass es sinnvoll ist, einen Blitzableiter an ein Hausdach anzubringen. So orientieren wir uns in der Welt. Ein Blick auf Wikipedia gibt uns Informationen, mit denen wir dann arbeiten können.
Die Frage ist: Was genau wissen wir, wenn wir einen Wikipedia-Artikel gelesen haben? Was genau weiß der Wissenschaftler? Um welche Art von Wissen handelt es sich?
Die technisch-beschreibende Vernunft des Menschen gibt Phänomenen Namen und lehrt, mit ihnen umzugehen. Sie nennt das Leuchten »Blitz« und verwaltet dadurch menschliche Erfahrung. Sie klebt ein Namensschildchen auf den Gegenstand. Doch »kennt« sie den Gegenstand dadurch? Erfasst sie ihn? Kann sie ihn selbst greifen?