VERNÜNFTIG GLAUBEN
Argumente zum Weiterdenken
Daniel Facius
Vernünftig glauben
365 Argumente zum Weiterdenken
Best.-Nr. 271977
ISBN 978-3-86353-977-1
Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg
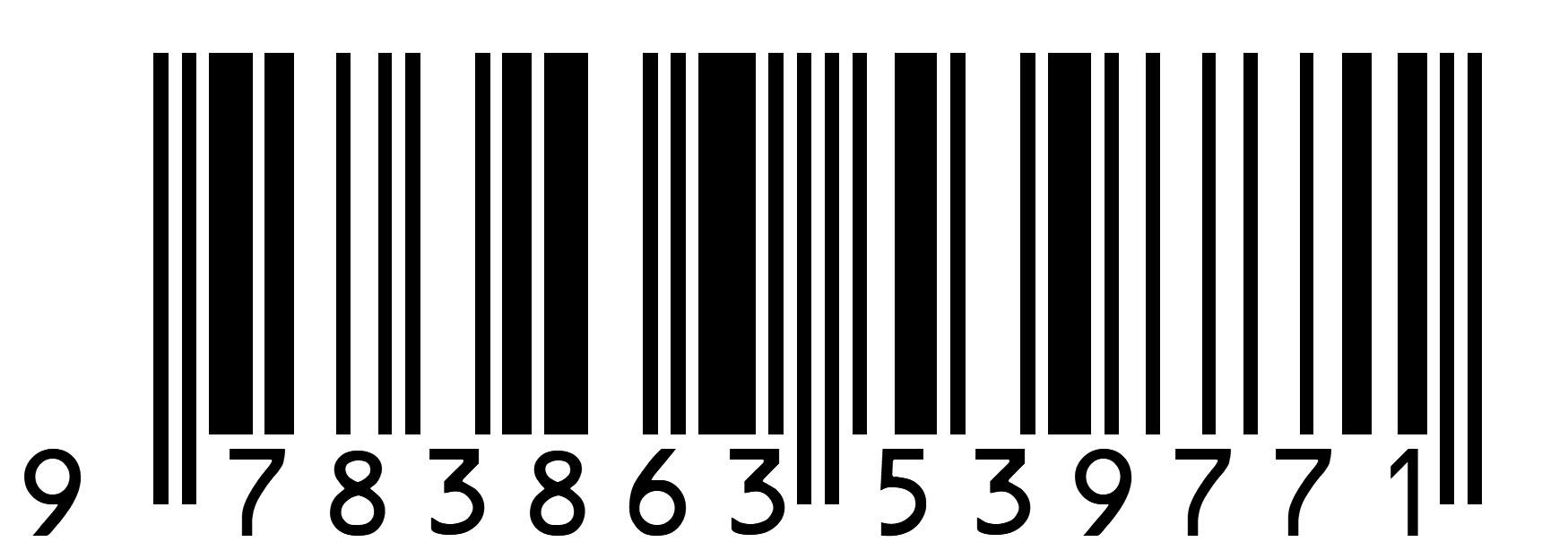
Die angegebenen Bibelverse wurden vom Autor selbst aus dem Grundtext übersetzt.
1. Auflage
© 2024 Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg www.cv-dillenburg.de
Satz und Umschlaggestaltung: Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
Wenn Sie Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler entdeckt haben, können Sie uns gern kontaktieren: info@cv-dillenburg.de
Vorwort
Der christliche Glaube wird mehr denn je kritisch hinterfragt. Wir als überzeugte Christen müssen und wollen uns diesen kritischen Anfragen stellen.
Es gilt selbst für Evangelikale nicht mehr als selbstverständlich, dass Gottes Wort absolut zuverlässig, zeitlos gültig und immer zutreffend ist. Die uralte Frage der Schlange im Paradies wird immer wieder gestellt: „Sollte Gott gesagt haben? Sollte das heute noch gültig sein? Widersprechen die biblischen Aussagen nicht den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft?“
Aber für mich gilt:
Es gibt nichts, was die Wissenschaft wirklich weiß, das im Widersprich zu dem steht, was die Bibel wirklich sagt.
Dieser Grundsatz wird in diesem apologetischen Andachtsbuch bestätigt. „Apologetik“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Verteidigung, Rechtfertigung“. In diesem Fall bedeutet das: Der Glaube an unseren HERRN Jesus Christus auf der Grundlage der Bibel wird gestärkt.
Dabei hat der Autor zahlreiche Fakten zusammengetragen, für die man sonst Fachbücher zu Rate ziehen müsste. Durch die gut verständliche Darstellung werden sie so einer breiten Leserschaft zugänglich.
Jeder Monat steht dabei unter einem besonderen Schwerpunkt:
Januar: Was ist Wahrheit?
Februar: Lässt sich Gott beweisen?
März: Vergiftet Religion die Welt?
April: Hat die Wissenschaft Gott widerlegt?
Mai: Ist die Bibel zuverlässig?
Juni: Was wissen wir über Jesus?
Juli: Was bedeutet „Auferstehung“?
August: Führen nicht alle Wege zum Ziel?
September: Was genau glauben Christen?
Oktober: Wie sieht ein gelingendes Leben aus?
November: Wieso lässt Gott das Böse zu?
Dezember: Spuren des Glaubens
Pädagogisch wertvoll sind die vertiefenden Fragen zum Abschluss jeder Andacht.
Dieses Andachtsbuch ist ein apologetisches Meisterwerk. Ich danke Daniel und dem Lektorat für die hervorragende Arbeit.
Hartmut Jaeger, Geschäftsführer des Verlags
Dillenburg, im Juni 2024


Was ist Wahrheit?
Können wir eigentlich unseren Sinnen trauen?
Gibt es so etwas wie „Wahrheit“, und wenn ja:
Wie können wir sie erkennen?
Die Geschichte vom blutenden Toten geht auf den Theologen und Philosophen Greg Bahnsen zurück. Eines Tages tauchte, so die Geschichte, ein merkwürdiger Patient in einer Arztpraxis auf. Er behauptete, dass er bereits tot sei, auch wenn es so scheine, als lebe er. Der Arzt glaubte zuerst an einen Scherz, merkte dann aber schnell, dass es seinem Patienten mit dessen Aussage tatsächlich ernst war. Der Doktor war schon kurz davor, den Patienten an einen Psychiater zu überweisen, bemühte sich aber zunächst, ihm klarzumachen, dass er unmöglich tot sein könne, da er quicklebendig mit ihm rede. Tote, so das Argument, könnten so etwas nicht. Der merkwürdige Patient ließ sich davon allerdings nicht überzeugen. Schließlich kam dem Arzt eine Idee: „Können tote Menschen bluten?“, fragte er. Der Patient verneinte das: „Jeder weiß, dass Tote nicht bluten können!“ Daraufhin ritzte ihn der Arzt in einen Finger, bis Blut herauströpfelte. Der Scheintote sah ungläubig auf seinen blutenden Finger, während der Arzt zufrieden lächelte. Doch er hatte sich zu früh gefreut, denn plötzlich rief der Patient voller Erstaunen: „Unfassbar –Tote können doch bluten!“
Die Moral dieser Geschichte? Es ist möglich, von einer Tatsache derart überzeugt zu sein, dass selbst klarste Gegenbeweise und Fakten diese Überzeugung nicht erschüttern können.
Gibt es Tatsachen, von denen Sie so sehr überzeugt sind, dass Sie meinen, ausschließen zu können, dass diese Überzeugung jemals erschüttert werden kann? Worauf beruht diese Überzeugung?
Als Jesus dem römischen Statthalter Pilatus in seinem Verhör erklärt, er sei gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben, erhält er die zynische Rückfrage: „Was ist Wahrheit?“ Auch wenn es Pilatus wohl eher um die Frage ging, welche Relevanz Wahrheit haben soll, so gilt er oft als Vorläufer der postmodernen Denker, die Wahrheit für ein Konstrukt halten. Nach dieser Auffassung liegt Wahrheit, wie früher die Schönheit, im Auge des Betrachters. „Wahr“ ist, was hilft, was nützlich ist oder was sich für jemanden „als wahr erweist“. Die Philosophie kennt verschiedene Definitionen von „Wahrheit“. Der Korrespondenztheorie zufolge ist etwas wahr, wenn es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Einer der berühmtesten Philosophen des Mittelalters, Thomas von Aquin, hat erklärt, dass „Wahrheit in der Übereinstimmung von Verstand und Sache besteht“. Die Kohärenztheorie hält eine Theorie dann für wahr, wenn ihre Aussagen untereinander stimmig sind, sich also widerspruchsfrei zusammenfügen. Wir werden die einzelnen Wahrheitskonzepte in diesem Monat genauer betrachten.
Gibt es Dinge, die Sie für „wahr“ halten? Ist 2 + 2 = 4? Geht die Sonne morgens auf? Lieben Sie Ihre Eltern, Kinder, Freunde? Hat Ihr Haus ein Dach? Ist es falsch, jemanden zu ermorden?
Haben Sie darüber nachgedacht, warum Sie diese Dinge für wahr halten? Glauben Sie, dass diese Behauptungen oder Tatsachen nur für Sie wahr sind, für jemand anderen aber möglicherweise nicht? Oder denken Sie, dass diese Tatsachen für alle wahr sind? Warum?
Zwei Juden streiten sich und wenden sich an ihren Rabbiner. Dieser hört den einen an und sagt: „Du hast recht.“ Dann hört er den anderen an und meint: „Du hast recht.“ Da kommt die Frau des Rabbiners herein und meint, es könne doch nicht sein, dass beide recht hätten. Daraufhin sagt der Rabbi zu ihr: „Und du hast auch recht.“ – Wenn man davon ausgeht, dass bestimmte Dinge für den einen Menschen wahr sein können, für den anderen aber nicht, dann unterstellt man damit, dass eine bestimmte Behauptung oder Tatsache wahr und unwahr zugleich sein kann. Wenn ein Mensch glaubt, dass es außerirdisches Leben auf dem Mars gibt, ein anderer Mensch das aber verneint – können dann beide recht haben? Kann es sein, dass beide Tatsachen „wahr“ sind, obgleich sie sich widersprechen? Galileo Galilei, ein italienischer Universalgelehrter, der es als Mathematiker, Ingenieur, Physiker und Astronom zu Weltruhm gebracht hat, hält es für „ganz klar“, dass sich zwei Wahrheiten nie widersprechen können. Dieser „Satz vom Widerspruch“ gilt als Grundprinzip der klassischen Logik. Aristoteles, der wahrscheinlich einflussreichste Philosoph überhaupt, hält ihn sogar für „das sicherste Prinzip von allen“.
Wem stimmen Sie zu? Dem Rabbiner oder seiner Frau? Ist es für Sie „ganz klar“ oder eher zweifelhaft, dass zwei Wahrheiten sich nie widersprechen können? Welches Prinzip halten Sie für „das sicherste von allen“?
In einer immer komplizierter und unübersichtlicher werdenden Welt, in der der Einzelne verloren zu sein scheint, setzen manche auf das Konzept der „Schwarmintelligenz“. Wo Individuen überfordert sind, intelligente Entscheidungen zu treffen, da hilft die Weisheit der vielen. Wenn sich Tausende Menschen zusammentun und gemeinsam ein Problem bearbeiten, dann muss dabei doch etwas Gutes entstehen – so der Gedanke. Studien, die diese Theorie untersucht haben, konnten sie zumindest zum Teil bestätigen. So ließ sich etwa das Gewicht eines Objekts recht gut bestimmen, wenn man es von vielen Menschen schätzen ließ und dann den Mittelwert der Schätzungen errechnete. Allerdings offenbarte sich ein großes Problem: Diese Vorgehensweise funktionierte nur so lange, wie die Schätzungen unbeeinflusst voneinander abgegeben wurden. Sobald einige Teilnehmer der Studie über die Schätzungen der anderen informiert wurden, beeinflusste das ihre eigene Schätzung. Warum? Wenn alle anderen dasselbe machen wie man selbst, glaubt man, auf dem richtigen Weg zu sein. Diese Art von Anpassung führte aber regelmäßig zu einer Verschlechterung der Ergebnisse.
Wie denken Sie über Mehrheitsentscheidungen? Liegt die Mehrheit Ihrer Meinung nach häufig „richtig“?
Z. B. bei Wahlen? Bei moralischen Fragen? Haben Sie schon einmal Ihre Meinung geändert, weil Sie das Gefühl hatten, mit dieser Meinung „allein“ dazustehen?
Gestern haben wir uns über das Konzept der Schwarmintelligenz Gedanken gemacht. Heute wollen wir die Meinung des dänischen Philosophen und Theologen Søren Kierkegaard untersuchen, der dem Konzept der Schwarmintelligenz eher ablehnend gegenübersteht. Er sagt: „Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist. Menschen, die recht haben, stehen meistens allein.“ Kierkegaard nimmt also an, dass die Mehrheit meistens falschliegt. Für diese These spricht zum Beispiel, dass Erkenntnisfortschritt immer nur dadurch zustande kommt, dass Einzelne die bis dahin als nicht falsifizierbar geltenden Annahmen der Mehrheit infrage stellen. Dass wir wissen, dass sich die Erde um die Sonne dreht, verdanken wir den Arbeiten von Kopernikus, Kepler und Newton, die das bis dahin vorherrschende geozentrische Weltbild verwarfen. Descartes, ein französischer Philosoph und Naturwissenschaftler, begründet dieses Phänomen damit, dass es gerade bei schwierigen Fragen weniger wahrscheinlich ist, dass sie von vielen beantwortet werden können. Vielmehr könne man davon ausgehen, dass nur wenige die richtige Antwort finden.
Was halten Sie von Kierkegaards Ansatz? Stehen Menschen, die recht haben, meistens allein? Gibt es einen Sachverhalt, bei dem Sie sich im Recht fühlen, obwohl Sie „allein“ mit dieser Haltung sind? Oder teilen Sie grundsätzlich die Meinung der Mehrheit?
Nachdem wir uns dem Thema „Wahrheit“ angenähert haben, wird es Zeit, sich die Frage zu stellen, ob wir die Wahrheit – wo auch immer sie zu finden ist – überhaupt wissen wollen. Der Schriftsteller Mark Twain ist der Meinung, dass niemand die Wahrheit wirklich wissen will. Er schreibt: „Noch niemals sah ich einen Menschen, der wirklich die Wahrheit sucht. Jeder, der sich auf den Weg gemacht hatte, fand früher oder später, was ihm Wohlbefinden gewährte. Und dann gab er die weitere Suche auf.“ Das wirft die Frage nach dem Motiv auf: Warum genau wollen wir die Wahrheit suchen? Einfach um der Wahrheit willen oder weil wir hoffen, dass sie uns irgendwie beruhigt oder unser Wohlbefinden steigert? Wollen wir die Wahrheit um jeden Preis wissen, oder kann es sein, dass sie uns „zu teuer“ wird?
Nehmen Sie an, Sie seien wegen schmerzhafter Symptome ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach einigen Tests kommt ein Arzt zu Ihnen ins Zimmer, um mit Ihnen die Diagnose zu besprechen. Was würden Sie von ihm hören wollen? Die reine Wahrheit? Eine „geschönte“ Version, bei der Ihr Arzt mit den Erfolgsaussichten einer möglichen Behandlung übertreibt? Oder gar eine falsche Diagnose, die Sie mehr beruhigen würde als die tatsächliche?
Wie sieht es mit übernatürlichen Dingen aus? Wenn es wirklich einen Gott gibt, würden Sie das wissen wollen, selbst wenn das für Ihr Leben mit Komplikationen verbunden ist?
Wir haben gestern über das Verhältnis von „Wahrheit“ zu „Wohlbefinden“ nachgedacht. Der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson hat eine ähnliche These wie Mark Twain formuliert: „Du kannst wählen zwischen der Wahrheit und der Ruhe, aber beides zugleich kannst du nicht haben.“ Hinter dieser Aussage steckt offenbar die Vermutung, dass Wahrheit das Potenzial hat, Unruhe in unser Leben zu bringen. Ist es manchmal nicht viel beruhigender, wenn man von bestimmten Dingen nichts erfährt? Wäre es nicht besser, wenn wir nicht wissen würden, dass unser Partner uns betrügt, was unsere Kinder wirklich tun, wenn wir nicht dabei sind, und wie unsere Kollegen hinter unserem Rücken über uns reden? Im Englischen gibt es das Sprichwort „Ignorance is bliss“ – „Unwissenheit ist Segen“.
Stimmen Sie diesem Sprichwort zu? Inwiefern ist es „besser“, von bestimmten Dingen nicht zu wissen? Inwiefern könnte es nachteilig sein?
?Sind Sie der Meinung, dass Wahrheit und Ruhe nicht gleichzeitig zu haben sind, oder halten Sie es für denkbar, dass Wahrheit auch beruhigend sein kann? Wenn Sie zwischen Wahrheit und Ruhe wählen müssten, wofür würden Sie sich entscheiden?
„Die Wahrheit widerspricht unserer Natur, der Irrtum nicht, und zwar aus einem sehr einfachen Grunde: Die Wahrheit fordert, dass wir uns für beschränkt erkennen sollen, der Irrtum schmeichelt uns, wir seien auf die eine oder andere Weise unbegrenzt.“
Auch diese Beobachtung von Johann Wolfgang von Goethe könnte ein Grund dafür sein, dass wir die Wahrheit manchmal nicht wissen wollen. Seine Darstellung, dass die Wahrheit nicht nur unangenehm sei, sondern sogar unserer Natur widerspreche, ist nicht weit weg von dem, was die Bibel über dieses Thema sagt. Paulus erhebt in seinem Römerbrief (Kapitel 1, Verse 18 und 25) die Anklage, dass die Menschen die Wahrheit „durch Ungerechtigkeit unterdrücken“ und in Lüge verkehren. Das bedeutet, dass wir die Wahrheit zwar kennen, sie aber bewusst nicht hören wollen und deshalb durch etwas anderes ersetzen: eine Lüge, die uns mehr „schmeichelt“ als die Wahrheit.
Ist es schon einmal vorgekommen, dass Sie Dinge „geglaubt“ haben, weil diese Ihnen geschmeichelt haben, aber eigentlich wussten – oder bei kurzer Überlegung hätten wissen können –, dass diese Dinge unwahr waren?
Haben Sie schon einmal gelogen, ohne dass es dafür einen Grund gab? Glauben Sie, dass das etwas über unsere „Natur“ aussagt?
