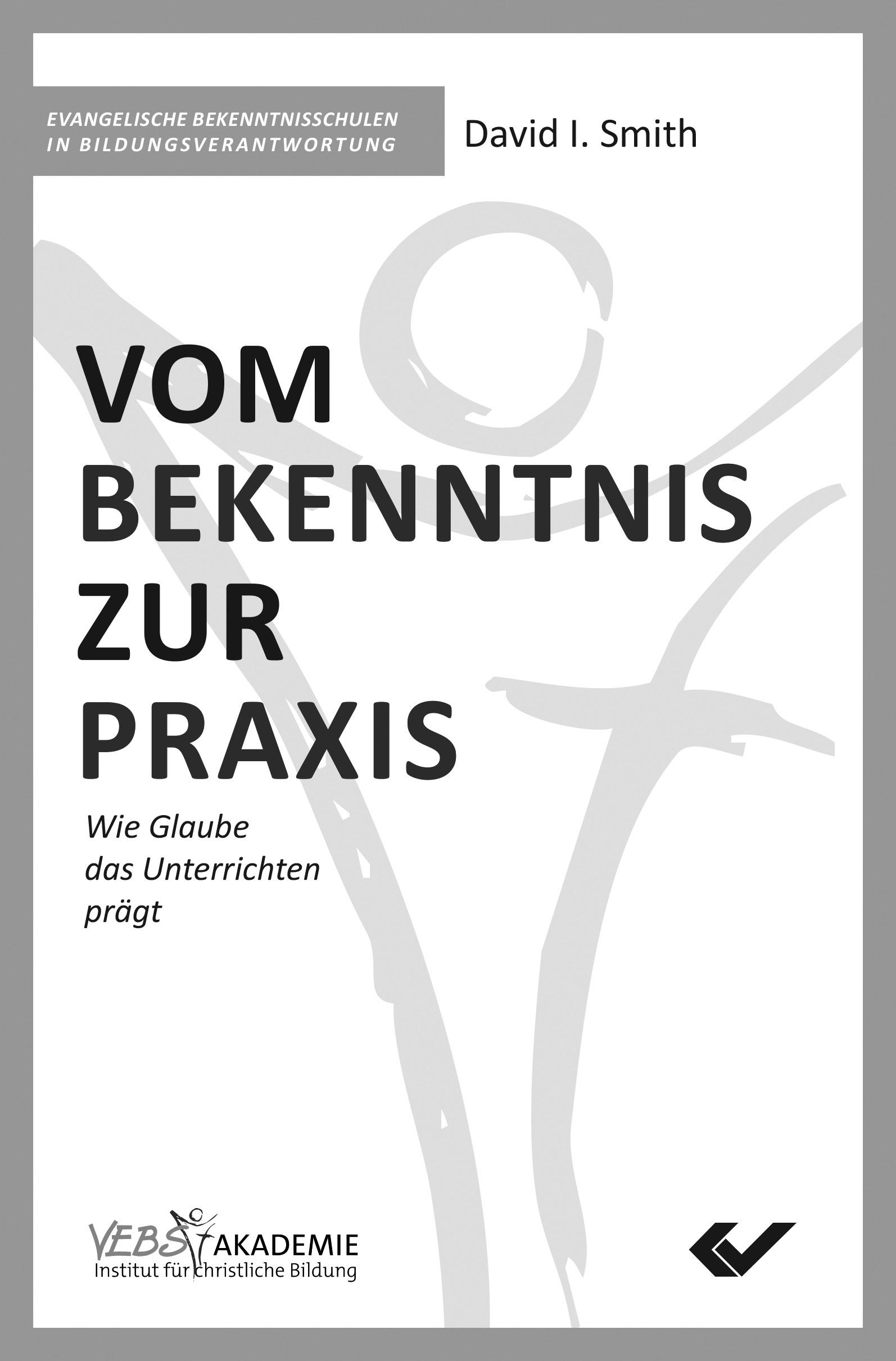1 Pädagogische Brüche
In einem Lied von Bruce Cockburn gibt es eine Zeile, die die „wilden Hunde“ beschreibt, die sich „Tag für Tag“ an unsere Fersen heften.1 Das Bild ist bei mir hängen geblieben. Es lenkt meine Aufmerksamkeit auf die Kluft, die sich hartnäckig zwischen den christlichen Erklärungen zum Bildungsauftrag und den täglichen Realitäten der Bildungspraxis auftut. Die Höhenflüge christlicher Absichtserklärungen, philosophischer Perspektiven, Weltanschauungserklärungen und dergleichen können unseren Blick erheben und uns daran erinnern, dass es um etwas Größeres geht, wenn wir einen Klassenraum betreten. Doch so vieles von dem, was wir dort tun, wird letztlich näher an den Füßen entschieden, auf dem Boden der Realität, wo uns die materiellen Zwänge und Tücken unserer Unterrichtsbedingungen durcheinanderbringen und vor sich her treiben. Unsere Glaubenserklärungen stimmen eine mitreißende Melodie an, aber oft sind es die wilden Hunde, die im Tagesverlauf unsere Schritte bestimmen. Begleitet von ihrem ständigen Schnappen und Knurren wird eine Kluft zwischen unseren Bestrebungen und unserer Praxis sichtbar.
„Ich hasse dieses Buch.“
Als mein Sohn an der High School war, belegte er einen Leistungskurs in Naturwissenschaften. Das Buch, das er mit nach Hause brachte, war ein monumentaler Wälzer mit kleinen Bildern, noch kleinerem Druck und, wie es schien, einem Abschnitt für jede einzelne Pilzart, und sei sie noch so klein und unscheinbar. Ich lieh mir das Buch aus und begann darin zu blättern.
Bald stieß ich auf Abschnitte, bei denen ich mich fragte, wie der Lehrer meines Sohnes sie wohl im Unterricht behandeln würde. Auf einer Seite wurden die Belege für große Meteoriteneinschläge in der Vergangenheit des Planeten Erde und ihre katastrophalen ökologischen Auswirkungen beschrieben. Es wurde darauf hingewiesen, dass wir, gemessen an den durchschnittlichen Zeitabständen zu diesen Ereignissen, unmittelbar vor einem weiteren großen Einschlag stehen, und es wurde suggeriert, es sei statistisch gesehen ein reiner Zufall, dass überhaupt noch jemand am Leben ist, der das Buch lesen kann. Auf einer anderen Seite wurden sämtliche Chemikalien im menschlichen Körper aufgelistet und mit ihrem aktuellen Marktwert in Dollar versehen. Dabei kam man auf einen eher bescheidenen Wert für einen Menschen. Die Schule meines Sohnes war eine christliche Schule. Man braucht nicht allzu viel Theologie, um sich zu fragen, ob Passagen, die besagen, dass der Fortbestand des menschlichen Lebens ein statistischer Zufall sei oder dass der Wert eines menschlichen Körpers nach seinem Gewicht und seiner chemischen Zusammensetzung bestimmt werden könne, nicht zumindest eine gewisse Einordnung erfordern.
Mir kam sofort der Gedanke, dass wir es hier eigentlich mit einem hervorragenden Text für christlichen Unterricht zu tun haben. Neben der großen Fülle an gründlichen Informationen gab es Momente, in denen eine naturalistische Weltsicht zum Vorschein kam, ein Bild der Welt als reiner Materie in Bewegung. Das könnte sicherlich zu interessanten Diskussionen führen. Hier bot sich den Schülern die Gelegenheit, über große Fragen nachzudenken und konkurrierende Ansichten über den Sinn der menschlichen Existenz abzuwägen. Ich war neugierig, wie dies im Unterricht umgesetzt werden würde. Würde es den Schülern helfen, sich mit Fragen über Glauben und Wissen, über Vorsehung, Wert und Wunder auseinanderzusetzen?
Als ich bei Gelegenheit meinen Sohn fragte, wie es im Biologieunterricht lief, erfuhr ich, dass der Unterricht gut lief, aber dass mein Sohn, ein hervorragender Schüler, das Lehrbuch nicht besonders spannend fand. Sein Urteil war kurz und bündig: „Ich hasse dieses Buch. Es ist so was von langweilig.“ Ich fragte ihn, wie viel er davon gelesen habe. Er schätzte, vielleicht ein paar Seiten, und wandte sich wieder seinen Hausaufgaben zu.
Ich war ein wenig verwirrt. Der Unterricht lief schon seit mehreren Wochen. Ich wusste, dass die Hausaufgaben auf diesem Lehrbuch basierten und dass bereits mehrere Kapitel behandelt worden waren. Er gab an, nur wenige Seiten gelesen zu haben, war aber ein fleißiger und offensichtlich erfolgreicher Schüler. Ich begann, genauer hinzusehen.
Die Hausaufgaben waren ziemlich standardmäßig, so wie ich sie selbst schon oft zusammengestellt habe. In der Regel sollte er ein bestimmtes Kapitel des Lehrbuchs lesen und einige Fragen beantworten, um zu zeigen, dass er es verstanden hatte. Mein Sohn und seine Mitschüler erwiesen sich als sehr geschickt darin, effizientere Wege zum gewünschten Ergebnis zu finden. Warum mühsam zwanzig oder dreißig Seiten Text lesen, um diesem Informationen zu entnehmen, wenn man weiß, wie man eine Suchmaschine benutzt? Es geht sogar noch einfacher: die Fragen in der Gruppe per Online-Chat durcharbeiten, wobei jeder Schüler unterschiedliche wissenschaftliche und allgemeine Webseiten durchsucht, und die Antworten auswählen, die in mehreren Quellen übereinstimmen. Aus dem pädagogischen Ansatz des individuellen Lesens und einer schriftlichen Zusammenfassung wurde eine Kombination aus Recherche, Online-Gruppenarbeit und Faktenüberprüfung. Mit diesen Strategien füllten die Schüler ihre Arbeitsblätter schnell und angemessen korrekt aus. Offensichtlich war dies im Hinblick auf die Anforderungen der Lehrerin recht effektiv; mein Sohn erhielt ausgezeichnete Noten. Ich fragte mich, wie vielen meiner eigenen Aufgaben es so erging und sie sich in etwas ganz anderes verwandelten, als ich mir vorgestellt hatte, sobald die Schüler meinen Unterrichtsraum verließen. Ich vermute, dass so etwas häufiger passiert, als mir lieb ist. Schließlich kommt so etwas sogar dann vor, während die Schüler noch im Klassenraum sind und ich angeblich die Verantwortung trage.
Ich erzähle diese Geschichte hier, um eine Frage aufzuwerfen, die im Mittelpunkt dieses Buches steht. Wenn wir verstehen wollen, wie der Glaube Bildung und Erziehung beeinflusst, inwiefern müssen wir dann dem Lehr- und Lernprozess mehr Aufmerksamkeit widmen als den Sichtweisen, die durch die Unterrichtsinhalte vermittelt werden?
Weltweit werden enorme Anstrengungen, Zeit und Ressourcen in die unterschiedlichsten Formen christlicher Bildung und Erziehung
investiert, und damit meine ich nicht nur die direkte Vermittlung des christlichen Glaubens, sondern auch das umfassende Bestreben, Bildung zu allen Themen innerhalb eines christlichen Bezugsrahmens zu vermitteln. Mehr als ein Fünftel der akkreditierten amerikanischen Hochschulen betonen ihre religiöse (meist christliche) Ausrichtung.2
Ein noch größeres Netz christlicher Grund- und Sekundarschulen verspricht auf verschiedene Weise eine eindeutig christliche Erziehung. In vielen anderen Ländern besucht ein beträchtlicher Prozentsatz der schulpflichtigen Jugendlichen bekenntnisorientierte Einrichtungen, und die Zahl christlicher Schulen und Hochschulen nimmt an vielen Orten der Welt beständig zu.3 Die Existenz solcher Schulen setzt eine fortgesetzte Diskussion darüber voraus, was „christlich“ mit „Bildung“ zu tun hat, und hält sie in Gang, eine Diskussion, in der Forschung und eingefahrene Standpunkte und Annahmen miteinander um Aufmerksamkeit wetteifern.4
Ein Großteil der vorhandenen protestantischen Literatur zu dieser Frage tendiert zu der Annahme, dass Unterricht christlich sei, wenn die Ideen, die gelehrt werden, christlich sind. Fachunterricht ist nach dieser Auffassung christlich, wenn er Dinge aus einer christlichen Perspektive lehrt, wenn er erörtert, wie der Glaube mit dem untersuchten Thema zusammenhängt, wenn die Bibel auf ein Thema angewendet wird oder wenn er eine christliche Weltsicht vermittelt – wie auch immer es ausgedrückt wird. Es gibt jedoch eine Menge Bücher über christliche Bildung und Erziehung, in denen der pädagogische Prozess oder die Art und Weise, wie Schüler das Lernen erleben und interpretieren, nicht einmal erwähnt wird. Der Schwerpunkt liegt eher auf den Anschauungen, die den Rahmen für das Unterrichten bilden, sowie auf den Sichtweisen und Weltanschauungen, um die es geht. Es ist leichter, Veröffentlichungen zu finden, die sich auf Geistesgeschichte und ideologische Vorgaben konzentrieren, als solche, die all das in den Griff bekommen, was in unseren tatsächlichen Lehr- und Lernpraktiken mitschwingt und vermittelt wird.5
Dieser übliche Ansatz ging mir durch den Kopf, als mir das Biologiebuch meines Sohnes ins Auge fiel. Ich fragte mich, welche Sichtweise das Buch vermittelte. An welchen Stellen der Darstellung der Lehrinhalte
kam eine Weltanschauung zum Vorschein? Würde im Unterricht wenigstens eine sorgfältige Auseinandersetzung aus christlicher Perspektive mit den zugrunde liegenden Annahmen des Buches stattfinden? Letztendlich gingen die Lernpraktiken meines Sohnes und seiner Freunde über diese Fragen hinweg. Die Gestaltung der Hausaufgaben, die Verfügbarkeit von Internettechnologien, die sozialen Interaktionen der Schüler außerhalb des Unterrichts, die wenig einladende Ansprechbarkeit des Lehrbuchs, der Zeitdruck eines hektischen Teenagerlebens – Faktoren wie diese machten die Weltanschauung des Lehrbuchs weitgehend irrelevant. Ich weiß nicht, ob die Abschnitte, die mir aufgefallen waren, jemals im Unterricht besprochen wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass mein Sohn deutlich machte, dem Lehrbuch wenig Beachtung geschenkt zu haben, bezweifle ich das. Zumindest in diesem Fall war es nicht die Sichtweise des Lehrbuchs – geschweige denn das beredte Leitbild der Schule –, die das Lernen bestimmte. Das lag nicht an einem mangelnden Glauben des Lehrers, sondern einfach an dem normalen Durcheinander des Lehrens und Lernens, wie ich es auch in meinem eigenen Klassenzimmer erlebe. Ein weiterer Sieg für die „wilden Hunde“. Natürlich können Lehrbücher einen bedeutenden Einfluss ausüben, und die verantwortungsvolle Aufbereitung von Unterrichtsinhalten ist sicherlich wichtig. Doch es ist die Art des Lehr- und Lernprozesses, die sich darauf auswirkt, wie die Schüler auf diese Inhalte zugreifen und sie erleben, und die dazu beiträgt, das Netz von Werten, Beziehungen und Handlungen zu spannen, in dem Lernen sinnvoll wird. Eine Darstellung christlicher Bildung, die sich nur auf die Wahrheit dessen konzentriert, was gelehrt wird, und nicht auf das eingeht, was durch die Art und Weise entsteht, wie gelehrt und gelernt wird, ist bestenfalls unvollständig. Doch sieht man sich die Veröffentlichungen über christliche Bildung an, ist das die häufigste Art der Darstellung.6 Was geschieht, wenn wir den Schwerpunkt verlagern und nicht nur fragen, welche christlichen Ideen gelehrt werden sollen, sondern auch, was an den Lehr- und Lernpraktiken, mit denen unsere Schüler leben sollen, christlich sein könnte? Dieses Buch versucht, diese Frage zu beantworten. Doch zunächst wollen wir unseren Blick zurück auf den Boden der Tatsachen richten.
„So genau muss ich das nicht wissen.“
Die Konzentration auf den Lehr- und Lernprozess kann uns an eine andere Standardbehauptung erinnern über das, was Bildung christlich macht. Dieser Ansicht nach ist der Unterricht christlich, wenn er einen christlichen Geist oder ein christliches Ethos widerspiegelt, wenn er von Liebe, Demut oder Geduld durchdrungen ist oder wenn wir echte Fürsorge für die Schüler zeigen. Unterricht ist vielleicht auch dann christlich, wenn er aus einem christlichen Herzen und einer liebevollen Beziehung heraus entstehen darf.7 Das klingt alles so, als sei damit schon alles in Ordnung, aber bevor wir mit Feuereifer zu dieser zweiten Strategie greifen, erlauben Sie mir noch eine weitere kurze Geschichte über die Hausaufgaben meines Sohnes.
Diesmal handelte es sich um Hausaufgaben aus dem Religionsunterricht. Die Klasse wurde von einem freundlichen, engagierten, fürsorglichen und kreativen Lehrer mit einem guten christlichen Charakter unterrichtet. Mein Sohn kam eines Tages zu mir und bat mich, ihm beim Lernen für einen Test zu helfen. Er zeigte mir ein Informationsblatt mit zwei parallelen Spalten. Auf der linken Seite befand sich eine Liste mit etwa einem Dutzend theologischer Schlüsselbegriffe; zu jedem dieser Begriffe gab es auf der rechten Seite eine Definition in Absatzlänge. Er musste diese Begriffe und ihre Definitionen für den Test am nächsten Tag beherrschen. Wir setzten uns ins Wohnzimmer, und ich begann, sein Verständnis mit Fragen zu überprüfen. Bedeutet „Himmelfahrt“ bloß ein Aufsteigen im physischen Raum? Was ist der Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung? Fällt dir eine Geschichte oder ein Bibeltext ein, um einen dieser Begriffe zu illustrieren? Er ließ diese Prozedur einige Minuten lang über sich ergehen, bevor er mir das Blatt wegnahm und mit einem leichten Anflug von Verärgerung sagte: „So genau muss ich das gar nicht wissen! Im Test muss ich nur die Wörter den Definitionen zuordnen!“
Halten Sie kurz inne und überlegen Sie, was hier geschieht! Beachten Sie, dass er behauptet, die Zukunft vorhersagen zu können; der Test liegt noch vor ihm, aber er glaubt zu wissen, wie er aussehen wird. Was lässt ihn so zuversichtlich sein, diese Vorhersage machen zu können? Um es
etwas förmlicher auszudrücken: Ich glaube, dass er in Wirklichkeit so ungefähr Folgendes sagen wollte: „Oh Papa, du verstehst nicht, wie das funktioniert. Während meiner Zeit an der High School habe ich bestimmte Muster im Verhalten meiner Lehrer festgestellt. Wenn sie mir Informationen geben, die nach diesem Muster formatiert sind, gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Art des Tests, den sie schreiben lassen. Aufgrund dieses Zusammenhangs kann ich mit einiger Sicherheit vorhersagen, dass ich die Begriffe nur ihren Definitionen zuordnen muss. Ein einfaches Erkennen des Musters reicht aus. Das Nachdenken über all die Unterscheidungen und Folgerungen nimmt mehr Zeit in Anspruch, als es die Art der Aufgabe rechtfertigt.“ Bestimmte Muster im Verhalten des Lehrers machten die Art des Tests vorhersehbar, und der erwartete Test verlangte nur Wissen, nicht Verstehen. Ich machte es ihm zu schwer und verschwendete seine Zeit.
Wenn dies tatsächlich seinem Gedankengang zugrunde lag, dann war seine Schlussfolgerung durchaus richtig.8 Stellen Sie sich ein ähnliches Informationsblatt vor, das auf dieselbe Weise gestaltet ist, aber in einer Sprache verfasst ist, die Sie nicht beherrschen. Mit einem Aufwand von zehn Minuten – wenn Sie die ersten paar Buchstaben jedes Wortes und der dazugehörigen Definition auswendig lernen – könnten Sie bei jedem Zuordnungstest und vielen Multiple-Choice-Tests sehr gut abschneiden. Wenn die Regelmäßigkeit des Formats es erlaubt, das Testverfahren vorherzusagen, und der Test sich stark auf Zuordnung stützt, ist das Verstehen oft optional. Dies deutet darauf hin, dass die Antwort meines Sohnes nicht einfach nur auf Faulheit beruhte; genauso wie in Biologie war er auch in Religion gut. Es war die rationale Reaktion eines viel beschäftigten Menschen, der den effizientesten Weg sucht, eine Aufgabe zu erledigen. Ich frage mich, wie viele meiner eigenen Teststrategien zu Schülerantworten geführt haben, die sich auf die erfolgreiche Erledigung der Aufgabe konzentrierten, aber tiefgreifendes Lernen außen vor ließen. Ich vermute, es waren ziemlich viele. Beim Entwerfen eines Tests sind meine kreativen Energien nicht immer besonders stark ausgeprägt. Die „wilden Hunde“ sind zurück.
Wie bei der Hausaufgabe in Biologie liegt das Problem hier nicht in der Weltanschauung begründet, die der Unterrichtsinhalt nahelegt. Der
Lehrer hätte es kaum geschafft, mehr christliche Gedanken auf dieser einen Seite unterzubringen, ohne eine kleinere Schrift zu verwenden. Wie wäre es, wenn wir stattdessen auf Herz und Charakter verweisen, also darauf, wie der Glaube des Lehrers in seiner Beziehung zu den Schülern erkennbar wird? Hilft es hier, wenn wir christlichen Unterricht nicht nur in Form von Gedanken und Sichtweisen, sondern auch in Form von gelebten christlichen Tugenden betrachten? In diesem Fall: nein.
Sicherlich spielen Tugenden und Beziehungen ebenso wie Gedanken und Sichtweisen eine Rolle, doch in diesem speziellen Fall war nicht der Charakter des Lehrers das Problem. Hier ging es nicht um den Charakter oder die Qualität der Beziehung, sondern um die Gestaltung der Aufgabe, die Struktur der Lernmaterialien und die Anwendungsmuster. Mein Sohn behauptete nicht, dass er seinem Lehrer misstraute, sondern schlicht und einfach, dass er eine ziemlich genaue Vorstellung davon hatte, wie viel Anstrengung erforderlich war für diese besondere Art von Aufgabe im Rahmen der üblichen Muster des pädagogischen Verhaltens der Lehrer und der Testpraxis der Schule.
Dabei kam ein unbeabsichtigtes Lernergebnis heraus. Ich bin sicher, dass im Unterricht nie verkündet wurde, das Erlernen zentraler Begriffe der Theologie sei nicht besonders wichtig. Doch es scheint, dass das Muster, das durch die Gestaltung der Arbeitsblätter und die Testverfahren geschaffen wurde, genau diese Botschaft vermittelte. Mein Sohn sah sich eine Seite an, auf der etwa ein Dutzend der wichtigsten theologischen Begriffe für das Verständnis des Neuen Testaments aufgelistet waren, und kam zu dem Schluss: „So gut muss ich die nicht kennen.“ Dieses Ergebnis scheint ein wenig markanter zu sein als die Entscheidung, sich biologische Informationen effizienter online anzueignen. Es beeinflusst unmittelbar den Fortschritt im Glauben. Ich vermute jedoch, dass die meisten von uns, wenn man sie fragen würde, was ihre Schulen tun, um Glauben zu fördern, auf Andachten, Schülerbeteiligung bei Gottesdiensten und Lehrpläne für den Religionsunterricht verweisen würden, lange bevor wir auf die Idee kämen, die eingefahrenen Muster in unseren Arbeitsblättern und Testverfahren zu erwähnen. Wir betrachten diese Dinge als mechanische Angelegenheiten, die mit Glauben wenig zu tun haben. Wir sind zu Recht der Meinung, dass es keine bestimmte,
von Gott vorgegebene Vorgehensweise gibt, kein „biblisches“ Muster für die Anordnung von Informationen auf Arbeitsblättern. Meistens gestalten wir sie bei allem Zeitdruck gerade gut genug, dass sie funktionieren. Doch wenn wir nicht in der Lage sind, uns sorgfältig mit den Botschaften zu befassen, die durch die spezifischen, wiederkehrenden Muster der Lehrmethoden vermittelt werden, wird es schwer sein, angemessen darüber Rechenschaft abzulegen, wie oder ob unser Bildungsangebot christlich ist. Denn unsere Schülerinnen und Schüler leben und lernen gerade innerhalb dieser Muster.
„Der Weg des geringsten Widerstands“
Wechseln wir ein wenig den Fokus und betrachten wir einen Vorfall aus einem Hochschulkurs. Vor einigen Jahren erhielt ich eine E-Mail von einem ehemaligen Studenten, der ein ausnehmend kluger, nachdenklicher und engagierter Mensch war. Er hatte ein Studium an einem angesehenen theologischen Seminar absolviert. Während seines Studiums schrieb er mir das Folgende:
In einem Kurs über die angloamerikanische Postmoderne hat mich die Art und Weise, wie die Aufgabenstellungen gestaltet waren, frustriert. Vor Kurzem haben wir unsere erste Arbeit zurückbekommen, und ich war überrascht und etwas amüsiert, dass fast alle Studenten, die sich am meisten für den Stoff interessierten, die intelligentesten Fragen gestellt haben und mit denen ich mich im Allgemeinen gerne hinsetzen und ein längeres Gespräch über das Thema führen würde, ziemlich miese Noten bekommen haben. Von etwa fünf Studenten, mit denen ich gesprochen habe, die ich allesamt für intelligenter halte als mich selbst und die ich gerne einen Blick auf meine Arbeit werfen lassen würde, schnitt nur einer gut ab, und mehrere andere hatten eine miserable Bewertung erhalten. Nach Gesprächen mit verschiedenen Leuten habe ich den Verdacht, dass der Grund dafür darin liegt, dass diese Studenten sich nicht damit begnügt hatten, Informationen einfach nur wiederzukäuen. Uns wurde bewusst,
dass der Professor und der Assistent im Grunde genommen eine Unmenge von Zitaten zur Beantwortung der relativ einfachen Fragen haben wollten. Das Ergebnis hat mich ein wenig amüsiert, denn es hat die Letzten zu Ersten und die Ersten zu Letzten gemacht –die Studenten, die normalerweise mittelmäßig abschnitten, hatten sehr gute Noten erhalten, die, die normalerweise sehr gute Noten erhielten, hatten mittelmäßige Beurteilungen bekommen. Aber es ist auch frustrierend, denn der Weg des geringsten Widerstands zu einer guten Note hin bedeutet intellektuelle Mittelmäßigkeit. Wir haben alle über uns selbst gelacht, weil wir Stunden zur Vorbereitung auf eine Arbeit verwendet hatten, die für ein „Sehr gut“ hätte reichen können, wofür wir letztlich jedoch nur eine mittelmäßige Note erhalten hatten. Das führt zu Resignation und intellektueller Gleichgültigkeit. Ich habe das jetzt in einigen Kursen erlebt und mache mir langsam Sorgen, ob ich das Seminar noch mit einem Funken intellektueller Sorgfalt überleben werde.9
Der Kontext ist ein anderer, aber auch hier führen gewohnte Muster der Unterrichtspraxis zu unbeabsichtigten Ergebnissen. Die Botschaft, dass theologisches Studium und exaktes Denken nicht gut zusammenpassen, war sicherlich nicht von dem Professor beabsichtigt, der den Kurs unterrichtete. Wie in den zuvor geschilderten Fällen habe ich keinen Grund, den Charakter des Professors oder die Gewichtigkeit des Kursinhalts in Zweifel zu ziehen, auch nicht die Absicht des Professors, eine christliche Betrachtungsweise auf diesen Inhalt zu bieten. Wieder einmal geht es nicht um den Inhalt oder den Charakter, sondern um die Art und Weise, wie wir das pädagogische Mobiliar anordnen. Das Muster hinter der pädagogischen Praxis führt zu einem Bruch zwischen Intention und Ergebnis. Ich möchte diese Geschichte nicht als Beispiel für einen besonders schlechten Unterricht anführen; ich bin sicher, dass ich ähnliche unbeabsichtigte Botschaften gesendet habe. Niemand von uns, hoffe ich, strebt unreflektierte Konformität an oder möchte andere von sorgfältigem Nachdenken abhalten. Dennoch senden die Muster unserer Unterrichtspraxis ihre eigenen Botschaften. Die Schüler und Studenten empfangen Botschaften durch die Art, wie wir unterrichten. Es sind
vielleicht nicht die Botschaften, die wir beabsichtigt haben, aber sie sind in der Lernumgebung zu finden, die wir geschaffen haben. Wieder einmal spüren wir, dass sich etwas an unsere Fersen heftet.
Glaube und Pädagogik
Bisher habe ich drei Beispiele für Unterrichtspraktiken beschrieben, die ein wenig schiefgelaufen sind. Jedes von ihnen sieht für mich ganz normal aus, so wie es in meinem Unterricht und im Unterricht anderer immer wieder vorkommt. Wir alle könnten weitere Geschichten über solche Diskrepanzen erzählen. Ich könnte noch hinzufügen, wie ein Schüler mich zu Recht fragte, warum eine bestimmte Fähigkeit, die für meinen Unterricht von zentraler Bedeutung zu sein schien, vernachlässigt wurde, ohne dass mir bewusst war, dass ich selbst dieses Defizit verursachte. Oder das eine Mal, als ich mich von ganzem Herzen über die kreative, fesselnde Lernaktivität freute, die ich in einer Klasse in Gang gebracht hatte, nur um später von einem Schüler zu erfahren, dass die Gruppe sie zwar unterhaltsam fand, aber keiner von ihnen in der Lage war, herauszufinden, was sie eigentlich vermitteln sollte. Brüche zwischen Absicht und Ergebnis sind ein grundlegender Teil des Lebens, und niemand von uns hat je perfekt unterrichtet. Viele der Prozesse, an denen wir beteiligt sind, sind so komplex, dass man nicht erwarten kann, dass wir die Auswirkungen vollständig im Griff haben, die wir für andere und für die Welt um uns herum verursachen.
Doch in jedem dieser Beispiele geht es offensichtlich um mehr als nur um zufällige Ecken und Kanten. Der Ausrutscher in jedem dieser Fälle ist kein bloßer Zufall. Jede Diskrepanz ergibt einen Sinn, wenn wir uns das Muster der pädagogischen Praxis ansehen, das zu ihr geführt hat. Der Bruch entsteht nicht trotz, sondern wegen der Entscheidungen des Lehrers. Es ist nicht so, als ob man Wasser in einen Eimer schüttet und ein paar Tropfen versehentlich danebengehen. Es ist eher so, als würde ich ganz normale Haushaltschemikalien in einen Abfluss schütten und feststellen, dass ich das lokale Ökosystem geschädigt habe. Das Problem ist nicht einfach Komplexität oder mangelnde Beherrschung des Stoffes,
sondern die Wahl der Mittel und der Strategie. In jedem Fall ist der Glaube als Teil der Mischung auf unterschiedliche Weise in das Räderwerk des Unterrichts geraten. Das verweist uns wiederum auf die zentrale Frage dieses Buches: Wie kann sich der christliche Glaube auf den pädagogischen Prozess selbst beziehen und nicht nur auf die Themen und institutionellen Kontexte des Lernens?
Während mich diese Frage umtrieb, bin ich regelmäßig auf Kollegen gestoßen, die bezweifeln, dass diese Frage sinnvoll ist. Lehren ist, so meinen sie, vielleicht nur das „Wie“, nur eine Reihe von Techniken und Routineabläufen, die empirisch getestet und für größere Ziele und Themen genutzt werden können. Die intellektuelle Schwerstarbeit ist vielleicht eher mit diesen größeren Zielen und Themen verbunden als mit den bloßen Mitteln und praktischen Strategien. Beim Unterrichten geht es vielleicht nur darum, die Strategien der Lehrer auf die aktuellen Erkenntnisse der Neurowissenschaften oder die Ergebnisse der Schüler abzustimmen, um die Aufnahmekapazität der Gehirne der Schüler zu optimieren.10 Vielleicht ist Unterrichten so wie das Fahrradfahren keine Sache, für die es eine christliche Version gibt – funktionieren die Pedalen nicht etwa für alle gleich und drehen sich die Räder nicht unabhängig vom Glauben des Fahrers?11 Vielleicht führt der Versuch, herauszufinden, was am Lehren und Lernen christlich sein könnte, zwangsläufig zu einer bizarren Entwicklung, indem man eine seltsame „biblische“ Weise vorschreibt, wie man chemische Reaktionen vorführt oder Gedichte erklärt, und sie jedem aufzwingt, ungeachtet fachlicher Bedürfnisse, der Unterschiedlichkeit von Schülern, des institutionellen Kontexts, persönlicher Stärken oder empirischer Beweise. Vielleicht wird die Frage, wie der Glaube die Pädagogik beeinflusst, deshalb relativ wenig diskutiert, weil es nicht viel zu diskutieren gibt. Wie ein christlicher Kollege einmal zu mir sagte: Vielleicht will dieser Hund gar nicht bellen.
Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ich meine sogar, dass alle diese Annahmen verfehlt sind. Dieses Buch wird eine umfassende Argumentation für eine andere Sichtweise liefern: Der Glaube kann und sollte die Pädagogik prägen und mitgestalten. Ich werde Beispiele sowohl aus dem Hochschulbereich als auch aus Grund- und weiterführenden Schulen sowie aus verschiedenen Fachbereichen anführen, ohne den
Anspruch zu stellen, jede Art von Unterricht zu berücksichtigen. Ich werde weder starre Rezepte noch Perfektion anstrebende Strategien anbieten, sondern vielmehr versuchen, eine bestimmte Art der Reflexion und des Gesprächs zu modellieren und zu beschreiben.12 Mein Ziel ist kein Rezept, das ich für andere zur Nachahmung bestimme, sondern eine differenziertere, beweglichere Fähigkeit zur fruchtbaren Auseinandersetzung mit christlichem Lehren und Lernen. Die Kernthesen, die ich zu entfalten und zu illustrieren hoffe, sind folgende:
– Es ist wichtig, einen inhaltsreichen, interessanten und wichtigen Austausch über Glauben und Pädagogik zu führen. Er geht über Fragen der Weltanschauung oder der Betrachtungsweise, die im Unterrichtsinhalt zum Ausdruck kommt, hinaus und lässt sich nicht auf Fragen des Charakters oder des freundlichen Umgangs mit Schülern reduzieren.
– In diesem Austausch voranzukommen, bedeutet nicht, eine Reihe von gottgewollten Techniken vorzuschreiben. Es muss ein Austausch darüber sein, denn es gibt keine einfache Formel für christliches Unterrichten, und es sollte auch keine geben.
– Ein solcher Austausch ist für das Wohlergehen und die künftige Entwicklung der christlichen Bildung auf allen Ebenen und für das Gedeihen der Schüler und Studenten notwendig. Wir brauchen eine besondere Art der Aufmerksamkeit für die Unterrichtspraxis, die unseren üblichen Fokus auf klares Denken nicht aufgibt, sondern den Kontext erweitert.
– Dieses spezielle Thema wurde in der protestantischen Diskussion über Bildung und Erziehung eher vernachlässigt. Wir gehen derzeit nicht besonders geschickt damit um, und viele der intellektuellen Instrumente, die für die Diskussion über die „Integration von Glauben und Lernen“ entwickelt wurden, sind für eine Vertiefung nicht wirklich geeignet.
Ich werde auf eine Reihe von Beispielen aus meiner eigenen Unterrichtspraxis zurückgreifen, einfach deshalb, weil sie mir einen unmittelbaren Zugang zum Prozess der vom Glauben geprägten Reflexion über
das Lehren und Lernen bieten. Beispiele sind keine allgemeingültigen Beweise, aber sie können veranschaulichen, klären, provozieren und wichtige Fragen aufwerfen. Ich hoffe auch, dass uns die Konzentration auf Beispiele weiter bringt als allgemeine Vorschriften und Grundsatzerklärungen. Selbst wenn wir aus theologischen Gründen sagen wollen, dass der Glaube sich in der Tat auf den Unterricht auswirken muss, können wir uns dann vorstellen, wie er sich auf die pädagogischen Prozesse im Französisch- oder Mathematikunterricht auswirken würde, ohne einfach nur Andachten hinzuzufügen oder in ein eigentümliches Verhalten abzugleiten? Diese konkrete Fähigkeit, sich vorzustellen, wie der Glaube die Pädagogik beeinflussen könnte, möchte ich fördern.
Ein Zuhause schaffen
Ein Beispiel aus der Geschichte des Bildungswesens kann unsere Vorstellungskraft auf das ausrichten, was nun folgt. In der heutigen Zeit neigt man dazu, sich das Unterrichten in der Begrifflichkeit von Methode und Technik vorzustellen. Eine Pädagogik wird als eine „Routine der Effizienz“13 angesehen, die zweckmäßige, wiederholbare Schritte anbietet, um zu pragmatischen Ergebnissen zu gelangen – eine Art und Weise, Dinge zu tun, losgelöst von den Bindungen von Zeit, Ort und Engagement. Eine „Methode“ soll für jeden und überall funktionieren, ohne durch unsere Überzeugungen und Vorlieben getrübt zu werden. Die Pariser Universität des vierzehnten Jahrhunderts zeigt uns ein anderes Bild vom Lehren und Lernen, eines, das diese Technik in ein größeres Bild einordnet.14
Bevor sich im fünfzehnten Jahrhundert die zentral organisierten Hochschulen durchsetzten, hatten die Studenten, die an der Universität studieren wollten, grundsätzlich die Wahl, eine Privatunterkunft zu mieten oder in einem gemeinschaftlichen Studentenhaus zu wohnen. Ein solches Haus war sowohl ein Teil der Universitätsstruktur als auch ein eigenständiger Ort des Lernens. Ein Magister Artium beaufsichtigte das Haus und erteilte akademischen Unterricht, war aber auch für die Verpflegung, die Ausstattung und die gemeinsamen Regeln und Routinen der Gemeinschaft verantwortlich und erhielt dafür ein wöchentliches
Honorar. Diese Häuser trugen unterschiedliche Namen. Ein solches Haus konnte als Hospicium oder Hospiz bezeichnet werden, ein Begriff, der vor seiner Assoziation mit der Sterbebegleitung seit dem neunzehnten Jahrhundert ein Rasthaus für Reisende bedeutete. Die Studenten waren Hospites, Gäste, was auf die Gastfreundschaft gegenüber Fremden hinweist. Das Haus, in dem die Studenten lebten und lernten, wurde auch Paedagogium, Ort der Pädagogik, genannt.
Ich erwähne dies nicht, um eine Rückkehr zu den Lehrstrategien oder der Organisation der mittelalterlichen Universität vorzuschlagen oder anzudeuten, dass sie denen von heute überlegen waren. Ich spreche es einfach an, weil die Wahl des Namens vielsagend ist. Nach dem siebzehnten Jahrhundert wurde eine Pädagogik zu einer Methode, zu einer systematischen Abfolge von Schritten. Das Bild des Pädagogiums deutet darauf hin, dass eine Pädagogik eher ein Haus, ein Heim, ein gemeinsamer Wohnbereich sein könnte.
Die wirtschaftliche und administrative Struktur des mittelalterlichen Herbergswesens hat sich nicht auf Dauer gehalten. Dennoch liegt in der Idee eines Hospiciums, das auch ein Pädagogium ist, eine Wahrheit, die im Reden über „Lehrmethoden“ meist verborgen bleibt. Lehren bedeutet selbstverständlich, einen Inhalt, einen Plan, Strategien und Fähigkeiten zu haben. Lehren bedeutet aber auch, Entscheidungen darüber zu treffen, wie Zeit und Raum genutzt werden, welche Interaktionen stattfinden, welche Regeln und Rhythmen sie bestimmen, welche Nahrung angeboten und zur Entwicklung gemeinsamer Vorstellungen genutzt wird und innerhalb welcher Strukturen die Schüler sich bewegen sollen. Eine Pädagogik bietet einen vorübergehenden Raum, in dem wir gemeinsam leben, während wir lernen. Es kann ein Raum sein, in dem es viel oder wenig Zeit für stilles Nachdenken gibt, in dem die Schüler lernen, intensiv zusammenzuarbeiten oder passiv zuzuhören, in dem die Probleme der Umgebung aufgegriffen oder zugunsten anderer Angelegenheiten beiseitegeschoben werden, in dem Stimmen von außen willkommen sind oder gemieden werden, in dem der Schwerpunkt auf Nutzen oder Staunen liegt. Eine Pädagogik kann einschließen oder ausschließen, sie kann gastfreundlich oder ungastlich sein, sie kann aktivieren oder abstumpfen.
Wir sollten uns davon lösen, Unterrichten als ein Repertoire von Techniken zu betrachten, als etwas, das ein Lehrer den Schülern antut. Wenn wir unterrichten, wenn wir das Lernen gestalten, bieten wir den Schülern ein vorübergehendes Zuhause, in dem sie eine Zeit lang leben, und wir gestalten die Strukturen des gemeinsamen Lebens, in denen sie wachsen. Eine Pädagogik ist ein Haus, in dem Lehrer und Schüler eine Zeit lang zusammenleben können, ein Ort, an dem Schüler als Gäste willkommen sind und an dem sie wachsen können. Wie jedes Zuhause bietet es Mittel und Muster für die Interaktion, sowohl beabsichtigte als auch unbeabsichtigte, die die Art und Weise formen, wie die Menschen darin wachsen und sich die Welt vorstellen.15
Ab dem nächsten Kapitel werden wir das eine oder andere pädagogische Zuhause besuchen und überlegen, wie es sein könnte, darin zu leben und zu lernen, und ob es eine Hilfe gegen die „wilden Hunde“ sein kann, die uns Tag für Tag auf den Fersen sind und nach uns schnappen.
Zum Nachdenken und zur Diskussion
z Welches der Beispiele in diesem Kapitel fanden Sie am interessantesten? Warum?
z Glauben Sie, dass es spezifisch christliche Unterrichtsmethoden gibt oder dass Unterrichten für alle gleich funktioniert? Inwiefern könnten sich Ihre anfänglichen Annahmen, mit denen Sie an das Buch herangegangen sind, darauf auswirken, wie Sie den Rest des Buches lesen?
z Wie können Sie herausfinden, wie die Schüler Ihre Unterrichtsstrategien interpretieren und darauf reagieren? Welche Vorkehrungen können Sie treffen, um ehrliche Rückmeldungen von ihnen zu erhalten?
z Betrachten Sie einige grundlegende Aspekte des Unterrichts: Ziele, Lerninhalte, Beziehungen, Unterrichtsstrategien, Leistungsbewertung. Bei welchem dieser Aspekte ist es am wahrscheinlichsten, dass Sie die Rolle des Glaubens über- oder unterbewerten?
z Wenn wir uns eine Pädagogik als ein Zuhause vorstellen können, was sind dann die grundlegenden Rhythmen und Werte dieser Pädagogik? Was glauben Sie, wie es sich in dem von Ihrer eigenen Pädagogik geschaffenen Zuhause lebt?
Tagebuch
Nehmen Sie sich Zeit an einem Ort, wo Sie in Ruhe nachdenken können. Wählen Sie einen bestimmten Aspekt Ihrer Unterrichtspraxis aus, z. B. Ihre typischen Hausaufgaben oder Ihre Benotungspraxis. Notieren Sie, was der jeweilige Aspekt über die Bedeutung des Lernens aussagen könnte. Wenn möglich, holen Sie sich Anregungen von einem Ihrer Schüler und/oder einem Kollegen. Vergleichen Sie Ihre Notizen mit Ihren Zielen für den Unterricht. Passt beides zusammen?