Flugakrobaten VON
Verwandlungskünstlern UND



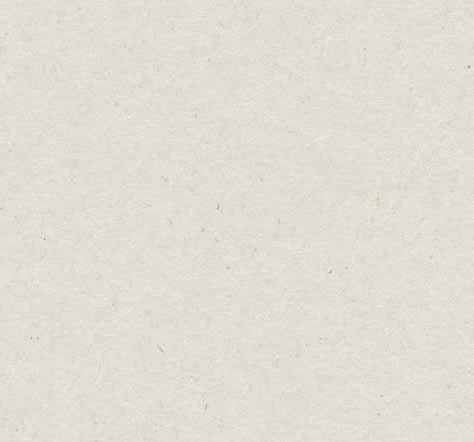






GESCHICHTEN AUS DER WELT DER INSEKTEN
Matthias Mross
Von Flugakrobaten und Verwandlungskünstlern Geschichten aus der Welt der Insekten
Best.-Nr. 271871
ISBN 978-3-86353-871-2
Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg
In Kooperation mit dem Verband evangelischer Bekenntnisschulen e.V. (VEBS), www.vebs-online.de und der Studiengemeinschaft Wort und Wissen www.wort-und-wissen.org
Es wurde folgende Bibelübersetzung verwendet: bibel.heute, Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ), © 2010 Karl-Heinz Vanheiden und Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg.
1. Auflage
© 2023 Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg www.cv-dillenburg.de
Satz und Umschlaggestaltung: Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg Umschlagmotiv: © Shutterstock.com/SveKoc (Heupferde/Heuschrecke), Mara008; Rawpixel.com (Blätter); © unsplash.com/kiwihug (Hintergrund)
ARKA, Cieszyn
Printed in Poland
Wenn Sie Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler entdeckt haben, können Sie uns gerne kontaktieren: info@cv-dillenburg.de

1 Wunder in den eigenen vier
Wänden

Flugakrobatin
Ein Luftzug transportiert Musca domestica, die gemeine Stubenfliege, durchs geöffnete Fenster ins Haus. Das behagliche Raumklima sagt ihr zu, und sogleich steuert sie einen Tisch mit Essensresten an. Nach präziser Landung auf einem Tellerrand läuft sie emsig hin und her. „Wie wohlgesonnen man mir doch ist“, denkt sie angesichts des Überflusses.
Mit ihren Füßchen fühlt – besser: schmeckt – sie, dank eingebauter Chemorezeptoren, Zuckerkrümel. Aus ihrem Rüssel gibt sie Speichel darauf und saugt die so verflüssigte Nahrung auf. Lecker!
Dann nimmt sie etwas anderes wahr, diesmal mithilfe ihres borstigen Fühlers, auf den durch die Luft schwebende Moleküle treffen. Das ist eindeutig Schweiß! Mit einem Senkrechtstart verlässt die Fliege den Teller – und findet schon bald, im Lehnstuhl sitzend, denjenigen, der zu diesen Ausdünstungen gehört: ein Mensch, der zufälligerweise gerade ein Buch zum Thema „Insekten“ liest. Beim Kapitel über den Flugapparat der Fliege ist er ziemlich ins Schwitzen gekommen.
Seine erste Erkenntnis: Das Fliegen funktioniert bei Insekten ganz anders als bei Vögeln, deren aerodynamisch geformte Flügel durch eine Flugmuskulatur mit der Brust verbunden sind. Bei den Insekten setzen keine Muskeln an den Flügeln an. Die Flugmuskeln befinden sich im Innern des Brustsegments, das sie durch Kontraktionen in Bewegung bringen. Es handelt sich um Auf- und
Abwärtsbewegungen, die nun auf die Flügel übertragen werden müssen. Aber wie? Es genügt ja nicht, einen Flügel beliebig an ein sich hebendes und senkendes Gebilde zu heften. Trotz der Bewegungen würde der Flügel schlaff nach unten hängen.
Der Trick ist, den Flügel am Deckel des Brustsegments zu befestigen – denn nur der bewegt sich auf und ab. An der starren Seitenwand des Brustsegments nun gibt es einen Fortsatz, der für den Flügel einen fixen Auflagepunkt darstellt. Damit das Ganze gut zusammenpasst, hat der Flügel an der Auflagestelle eine Vertiefung. Vertiefung und Fortsatz bilden zusammen also ein Gelenk. Da sich dieses sehr nahe an der Befestigungsstelle des Flügels befindet, bewirken kleine Auslenkungen des Deckels große Flügelschläge, und da die Brustmuskulatur sehr stark und effizient arbeitet, sind die Flügelschläge extrem schnell. Bis zu 300-mal pro Sekunde können die Flügel der Stubenfliege auf- und ab gehen.
Das ist nicht alles. Im Stubenfliegenflügel befindet sich eine weitere Vertiefung, die ebenfalls auf den Fortsatz gelegt werden kann. Da diese zweite Vertiefung einen größeren Abstand zum Deckel hat als die erste, ist die Hebelwirkung etwas kleiner. Die Folge sind schwächere Flügelschläge. Die Fliege verfügt also über einen „ersten Gang“, den sie beim Losfliegen nutzen kann. Während sie Geschwindigkeit aufnimmt, schaltet sie in den „zweiten Gang“.
Noch etwas: An der Stelle des Körpers, an der andere Insekten ein zweites Paar Flügel haben, sind bei der Fliege sogenannte Schwingkölbchen angebracht. Diese schwingen, während die Fliege ihre Luftakrobatik ausführt, fleißig mit und messen Geschwindigkeit und Lage im Raum.
In Wirklichkeit sind die Zusammenhänge noch komplizierter, doch schon bei dieser Darstellung wird dem Menschen schwindelig. Der Flugapparat funktioniert ja nicht einfach nur so. Alle seine Bestandteile sind exakt aufeinander abgestimmt. Die Muskeln benötigen eine kontinuierliche Energiezufuhr und müssen minutiös arbeiten. Vertiefung und Auflagepunkt des Flügelgelenks müssen an der richtigen Stelle liegen, die Schwingkölbchen müssen präzise Informationen liefern, und Nervenknoten und Fliegengehirn müssen in der Lage sein, diese zu verarbeiten und die Steuerung des Flugapparates danach zu richten.
„Natürlich“, denkt der Mensch, „sind Wissenschaftler, die vor Hunderten von Jahren lebten und annahmen, dass Fliegen und anderes Geschmeiß spontan aus Misthaufen entstehen, zu entschuldigen. Sie kannten all diese Details noch nicht und hielten Insekten für etwas recht Primitives. Heute wissen wir es anders.“
Währenddessen ist die Fliege einige Male um seinen Kopf gesurrt, hat sich auf den Buchrand und dann auf den Unterarm des Menschen gesetzt. „Du kommst ja wie gerufen“, sagt sich dieser und zieht eine Lupe aus der Tasche. Vorsichtig nähert er sich damit dem Insekt und betrachtet in eindrücklicher Vergrößerung die jetzt angelegten Flügel, den behaarten Körper, den Rüssel, die Augen ... Ja, auch diese Augen, bestehend aus 3000 sechseckigen Linsen, sind für die Flugkünste unabdingbar. Mit ihnen sieht die Fliege zehnmal schneller als der Mensch, nimmt kleinste Bewegungen wahr und kann darauf in Blitzesschnelle reagieren.
Auch jetzt reagiert sie, hebt ab, saust davon – und landet wenig später auf einem an der Wand hängenden Kunstdruck. Dass der sich hinter einer Glasplatte befindet,
stört sie nicht im Geringsten. Munter krabbelt sie darüber, ohne abzurutschen. Auch hierüber klärt das Insektenbuch auf: Die Fliegenfüßchen sind nicht nur mit Chemorezeptoren und Krallen ausgestattet, sondern auch mit MiniSaugnäpfen. Mit diesen hält sich die Fliege auf noch so glatten Oberflächen fest. – Nun hat sie den Kunstdruck schon wieder verlassen und hängt kopfüber an der Deckenlampe. Welches Ziel wird sie als Nächstes ansteuern?
: Danke, Herr, dass ich in meinen vier Wänden ein so großes Wunder wie die Stubenfliege bestaunen darf. Danke für all die verblüffenden Eigenschaften, die du ihr verliehen hast.

Abflugbereite Stubenfliege
` Zum Weiterdenken
] Stubenfliegen legen ihre Eier vorzugsweise in verfaultes Fleisch. Davon können sich die geschlüpften Maden dann ernähren.
] Nach kurzer Zeit verpuppen sich die Maden zu sogenannten Tönnchenpuppen, aus denen schließlich Fliegen schlüpfen.
] Eine Fliege hat eine Lebensdauer von ungefähr 30 Tagen. In dieser Zeit kann so ein Tier eine Menge anstellen – beispielsweise Menschen bei der Arbeit stören oder Krankheiten übertragen.
] Stubenfliegen sind aber durchaus auch nützlich, etwa beim Abbau von Aas. Außerdem ist eine dickgefressene Fliege ein guter Köder beim Angeln.
Das perfekte Versuchstier
George-Louis Leclerc de Buffon, einer der bedeutenden Köpfe der französischen Aufklärung, schrieb einmal an den Insektenforscher René Antoine Ferchault de Réaumur: „Eine Fliege soll im Kopf eines Naturforschers nicht mehr Platz einnehmen, als sie es in der Natur tut.“
Insekten, so meinte er, seien ebenso unbedeutend wie klein, weder der Rede noch der wissenschaftlichen Beschäftigung wert. Ein mit Fangnetz bewaffneter Insektenforscher sei etwas Lächerliches; lohnende Forschungsobjekte seien Löwen, Elefanten, Eisbären und Wale.
Die Geschichte hat dem großen Buffon nicht recht gegeben. Lohnenswerte Wissenschaft findet eben nicht nur da statt, wo tonnenschwere Dickhäuter die Erde erschüttern oder meterlange Schwanzflossen das Wasser aufpeitschen. Wissenschaftler verbringen heutzutage einen Großteil ihrer Zeit in Laboratorien, wo Masse und imposantes Auftreten wenig gelten. Versuchsobjekte werden passend zu den wissenschaftlichen Fragestellungen gewählt, also nach ganz anderen Kriterien.
Als Thomas Hunt Morgan im Jahr 1910 die Gültigkeit der Mendelschen Vererbungsgesetze überprüfen wollte, entschied er sich für ein winziges Versuchstier namens Drosophila melanogaster. Auf Deutsch wird es „Kleine Essigfliege“, „Taufliege“ oder „Fruchtfliege“ genannt und ist im Spätsommer und Herbst überall dort anzutreffen, wo überreifes oder angefaultes Obst herumliegt. Kaum hat man eine Schale mit Pflaumen, Pfirsichen oder gar Weintrauben aufgestellt, schon treffen die Plagegeister ein, bilden in Küche und Esszimmer ganze Wolken und sind nur loszuwerden, indem man sämtliches Obst entfernt.
Thomas Morgan erkannte die Vorteile, die diese Fliege für seine Arbeit bot. Überall, wo Menschen leben, gedeiht auch Drosophila. Raumtemperaturen von ungefähr 24 Grad Celsius schätzt sie besonders. Als Nahrung benötigt sie nichts weiter als ein wenig Obst, am besten in fermentiertem Zustand. Ein Drosophila-Weibchen legt auf einen Schlag Hunderte von Eiern. Daraus schlüpfen nach etwa einem Tag Larven, die sich nach zwei weiteren Tagen verpuppen. Es folgen noch ungefähr vier Tage, dann schlüpft das Vollinsekt – die fertige Essigfliege. Drosophila benötigt also knapp zehn Tage, um eine neue Generation herauszubilden.
Man vergleiche dies mit dem Lebenszyklus eines Elefanten. Die Tragezeit einer Elefantenkuh beträgt fast zwei Jahre. Das Junge entwickelt sich langsam und ist erst mit zehn Jahren geschlechtsreif. Bis es sich fortgepflanzt hat, sind bereits mehrere Tausend Essigfliegen-Generationen entstanden, die der Wissenschaftler auf die verschiedensten Eigenschaften hin untersuchen konnte.
Ein weiterer Vorteil der Essigfliege: Ihr Erbgut besteht aus nur vier Chromosomenpaaren, die übersichtlich angeordnet sind und deren Mutationsrate relativ hoch ist. Das bedeutet, dass Änderungen des Erbguts in einer überschaubaren Zeit auftreten. Diese können sich im Erscheinungsbild der Essigfliege bemerkbar machen. Die erste Mutation beobachtete Thomas Morgan an einem Drosophila-Männchen, dessen Augenfarbe sich von rot zu weiß geändert hatte. Andere Mutationen führten zu Stummelflügeln.
Die Untersuchungen von Thomas Morgan brachten Erstaunliches zutage und lösten eine ganze Welle von weiteren Forschungsprojekten aus. Deshalb wird Morgan als „Vater der Genetik“ bezeichnet. Im Jahr 1933 erhielt er
für seine Ergebnisse den Nobelpreis in Medizin. Diesen hatte er nicht nur seinem Verstand und Durchhaltevermögen, sondern auch der Wahl seines Versuchstieres, also der Essigfliege, zu verdanken. Hätte er statt ihrer Elefanten gewählt, um die gleiche Anzahl an Generationen zu untersuchen, wären erste Ergebnisse erst in 1000 Jahren zu erwarten.
Daran will ich denken, wenn ich das nächste Mal einen Essigfliegenschwarm über einer Obstschale sehe. Diese Winzlinge haben eine Wissenschaft ermöglicht, die weitreichende Folgen in Biologie, Medizin und Landwirtschaft hat. Weitere Forschungen zeigen zudem, dass Drosophila, so unbedeutend sie auf den ersten Blick erscheinen mag, in allen Teilen hoch kompliziert gebaut ist. Sie hat Facettenaugen, mit denen sie 265 Bilder pro Sekunde auflöst, was ihr eine extrem hohe Fluggeschwindigkeit erlaubt. Ihre Antennen tragen Mechanorezeptoren, mit denen sie fühlt, außerdem Chemorezeptoren, mit denen Geruchsmoleküle eingefangen und in elektrische Signale umgewandelt werden. Nervensystem und Gehirn verarbeiten diese Reize weiter, steuern das filigran gebaute Flügelpaar und lenken die Fliege zur Nahrungsquelle. Hier tauchen die Tierchen ganz plötzlich auf, ernähren und vermehren sich. Mögen sie uns auch lästig erscheinen, so sind sie doch harmlos, stechen nicht und übertragen keine Krankheiten.
Sobald es kälter wird, verlassen sie uns wieder. Es bleibt aber ein Geheimnis: Wohin gehen sie? Wie überwintert die Essigfliege? Darauf hat bislang niemand eine Antwort. Nur eines ist gewiss: Im nächsten Jahr kommen sie zurück.
: Bitte bewahre mich, Herr, vor vorschnellen Urteilen! Hilf, dass ich auch den unscheinbaren Geschöpfen gerecht werde und nichts verwerfe, was bei dir großen Wert hat!
` Zum Weiterdenken
] Die „Kleine Essigfliege“ Drosophila melanogaster ist nur zwei Millimeter groß. Es gibt noch eine „Große Essigfliege“ (Drosophila funebris), die bis zu vier Millimeter groß werden kann.





Essigfliege mit roten Augen

