Reinhard Junker
Schöpfung Evolution Schöpfung Evolution oder oder
Ein klarer Fall!?
Studiengemeinschaft Wort und Wissen
Impressum
Reinhard Junker
Schöpfung oder Evolution – ein klarer Fall!?
Die Bibelstellen wurden der Menge-Bibel entnommen.
Bestell-Nr.: 271746
ISBN: 978-3-86353-746-3
© Copyright 2021
Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg www.cv-dillenburg.de Herausgegeben von der Studiengemeinschaft Wort und Wissen www.wort-und-wissen.org
Satz: Johannes Weiss, SG Wort und Wissen, Freudenstadt Umschlaggestaltung: Johannes Weiss, SG Wort und Wissen, Freudenstadt Umschlagmotiv: AdobeStock.com
Druck: Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH, 30851 Langenhagen
Schöpfung Evolution Schöpfung Evolution oder oder
Fall!?


INHALT
Vorwort 6
1. Ursprungsfragen 9
2. Schöpfungsindizien 17
3. Ersetzen Mutation und Selektion den 39 Schöpfer?
4. Jedes nach seiner Art? 57
5. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – 71 Ähnlichkeiten
6. Ein Schöpfer hätte das nicht so gemacht – 87 Konstruktionsfehler?
7. Die vorgeburtliche Entwicklung – 99 Baustellen der Evolution?
8. Fossilien – tote Zeugen 111
9. „Urmenschen“, Neandertaler & Co 129
10. Kann das Alter des Lebens bestimmt werden? 143 werden?
11. Der Anfang des Lebens – aus Nichtleben? 159
12. Schöpfung oder Evolution – was steht 173 auf dem Spiel? Anhang 183 Anmerkungen, Quellen und weiterführende Literatur, Bildquellen Ein klarer
Vorwort
Schöpfung oder Evolution – ein klarer Fall!?
Wie kann man herausfinden, was gestern, vor einer Woche, vor einem Jahr oder vor 100 Jahren passiert ist? Für einen Unbeteiligten kann die Antwort bereits dann schwierig sein, wenn ein Ereignis nur einen Tag zurückliegt – zum Beispiel, wenn geklärt werden soll, was sich letzte Nacht am Bahnhofsvorplatz zugetragen hat. Um zu einem schlüssigen Urteil zu gelangen, braucht man verlässliche Informationen. Man kann Augenzeugen befragen oder sachdienliche Hinweise sammeln. Passt alles widerspruchsfrei zusammen, scheint der Fall gelöst zu sein. Ein klarer Fall!
Je weiter ein Ereignis zurückliegt, desto schwieriger wird die Rekonstruktion. Die Meinungen darüber, was wirklich passiert ist, können stark auseinandergehen. Augenzeugen, die man befragen könnte, stehen nicht zur Verfügung. Man kann nur noch auf schriftliche oder archäologische Quellen zurückgreifen. Und es kann sein, dass ein „Fall“ gar nicht geklärt werden kann, weil es einfach zu wenige klare Indizien gibt.
Gehen wir sehr weit zurück – an den Anfang des Lebens auf unserer Erde oder sogar ganz an den Anfang unserer Welt –, stehen uns bestenfalls nur noch Spuren zur Verfügung: vor allem Merkmale der heutigen Organismen oder Versteinerungen früherer Lebewesen. Kann man daraus erschließen, wie die Welt ihren Anfang genommen hat? Stand am Anfang ein Schöpfer, der willentlich mit klarem Ziel die Werke der Schöpfung hervorgebracht hat? Oder war am Anfang einfach nur tote Materie, aus der aufgrund ihrer Eigenschaften und Wechselwirkungen alles von alleine hervorgegangen ist, was wir heute beobachten: Sterne, Steine, Steinböcke, aber auch Musik, Freude und Leid, Freundschaften und Feindschaften, Gut und Böse? Wie kann man das herausfinden, da es doch keine Augenzeugen gibt?
Doch halt, es gibt eine eindrucksvolle Erzählung vom Anfang: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ (1. Mose 1,1). So beginnt die Bibel. Hat uns der Schöpfer selbst mitgeteilt, wie die Welt ins Dasein kam? Dann wäre der Fall klar. Aber viele sind skeptisch und schenken der Bibel keinen Glauben.
Es gibt aber noch einen anderen Zugang: Das, was wir heute in der Schöpfung beobachten. Für den Fall, dass Gott die Welt mit Plan und Ziel erschaffen hat, sollte man erwarten, Spuren zu finden, die zu einer Schöpfung passen. Und wenn man glaubt, dass kein Schöpfer seine Finger im Spiel hatte, sollte man eben keine Spuren finden, die auf einen Schöpfer hinweisen.
In der Geschichte der Menschheit war dieser Fall schon immer umstritten. In der christlich geprägten Welt war er dagegen lange Zeit klar – zugunsten eines Schöpfers! Doch Mitte des 19. Jahrhunderts wendete sich ausgerechnet in der Biologie das Blatt: Der britische Naturforscher Charles Darwin behauptete, mit „Evolution“ und „Selektion“ einen natürlichen Mechanismus gefunden zu haben, der ohne Plan und Ziel die phantastischen Designs der Lebewesen hervorgebracht haben soll. Ein Schöpfer, der „jedes nach seiner Art“ geschaffen hat, erschien nun überflüssig. Der zeitgenössische Biologe Richard Dawkins triumphierte gut 100 Jahre spä-
ter: Seit Darwin könne man guten Gewissens Atheist sein, ohne dass es verstandesmäßige Probleme gibt.1 Der Fall sei jetzt endgültig klar – zu Ungunsten eines Schöpfers! Das sehen heute die meisten Naturwissenschaftler so.
Anmerkungen und Quellenangaben sind im Anhang zusammengestellt.
Charles Darwin hat sich immerhin mit dem Schöpfungsgedanken argumentativ auseinandergesetzt. Heute macht sich diese Mühe kaum noch jemand. Der Fall ist für viele so klar, dass man ausschließlich so forscht und denkt, als könne es keinen Schöpfer geben – als habe die Natur das Leben aus sich selbst hervorgebracht.
Doch ausgerechnet Evolutionsbiologen haben – ohne es zu wollen – in den letzten Jahrzehnten zunehmend Eigenschaften an den Lebewesen entdeckt, die Evolution stark in Frage stellen, aber problemlos zu Schöpfung passen. Es gibt daher gerade aufgrund neuerer naturwissenschaftlicher Daten guten Grund, den Fall „Schöpfung oder Evolution“ neu aufzurollen!
In diesem Buch soll dies in allgemeinverständlicher Form erfolgen. Es hat einführenden Charakter und soll einen leichten Einstieg in das Thema „Schöpfung und Evolution“ ermöglichen. Entlang des roten Fadens „Was sagen die Indizien?“ erfolgt ein Gang durch die wichtigsten Teilgebiete der Biologie und Paläontologie.
Naturgemäß müssen die Fakten und Argumente in einem einführenden Text vereinfacht dargestellt werden. Mancher wird die Ausführungen mit Stirnrunzeln lesen, andere sind vielleicht neugierig, mehr Details zu erfahren. Dazu sind im Anhang ab Seite 183 weiterführende Publikationen zusammengestellt, die detaillierte Darstellungen und ausführliche Begründungen zu den einzelnen Themen bieten. Um dabei zielgenau fündig zu werden, werden an entsprechenden Stellen im Text Verweise in Form hochgestellter Zahlen gegeben.
Danken möchte ich auch all den Mitarbeitern der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, die mich beim Verfassen dieses Buches unterstützt haben: Dr. Peter Borger verdanke ich Informationen zum Erbgut des Menschen, Dr. Michael Brandt unterstützte mich beim Abschnitt über den Ursprung des Menschen, Dr. Martin Ernst beim Kapitel über das Alter des Lebens, Dr. Boris Schmidtgall beim Thema „Entstehung des Lebens“ und Prof. Dr. Henrik Ullrich im Bereich Embryologie. Deutliche Spuren hinterlassen hat auch Prof. Dr. Nigel Crompton, dessen Expertise über Mendel‘sche Artbildung in die Darstellungen dieses Buches eingeflossen ist. Die Eingangsabschnitte über Methodenfragen und das Design-Argument haben sehr von der langjährigen Zusammenarbeit mit Dr. Markus Widenmeyer profitiert. Mein besonderer Dank geht an Katharina Ziegler, die das komplette Manuskript aus dem Blickwinkel einer Lehrerin gründlich durchgearbeitet und in eine einfachere Sprache übersetzt hat, an Marlies Rother für gründliches Korrekturlesen und an den Grafiker Johannes Weiss, der durch seine Gestaltung und sein engagiertes Mitdenken das Buch in eine sehr ansprechende Form gebracht hat.
Reinhard Junker, im Dezember 2020

1. Ursprungsfragen
Weshalb gibt es unsere Welt? Weshalb existieren Sterne, Steine und Steinböcke? Woher kommt der Mensch? Woher kommen unsere Vorstellungen von Gut und Böse, unsere Empfindungen wie Liebe und Hass?
Auf Fragen dieser Art – Ursprungsfragen – gibt es zwei grundlegende Antworttypen. Entweder ist die Welt geplant und erschaffen worden oder sie ist ausschließlich Ergebnis von Naturgesetzen und Zufällen, also ungeplant.
Die eine Erklärung geht von Überlegung, Zielsetzung und dem kreativen Handeln eines Schöpfers aus.
Für die andere Erklärung ist ein Schöpfer überflüssig. Zufällige und ungesteuerte Naturprozesse genügen, um das Weltall, die Erde und alle Lebewesen, einschließlich des Menschen, hervorzubringen.
Beide Antworttypen werden zwar oft miteinander kombiniert, aber im Kern gibt es dennoch nur „geplant“ oder „ungeplant“ bzw. „kreativ und beabsichtigt“ oder „rein natürlich und unbeabsichtigt“.
Für den Menschen bedeuten diese beiden Möglichkeiten: Seine besonderen Kennzeichen wie Bewusstsein, Kreativität, Vorstellungen von Gut und Böse und Gottesglaube verdankt er entweder seinem Schöpfer oder sie sind zufällige Nebeneffekte seines überaus kompliziert gebauten Gehirns, das sich ohne Plan und Ziel irgendwie aus natürlichen Vorstufen entwickelt hat.
Die Sichtweise, dass es einen Schöpfer gibt, einen Gott, der die Welt erschaffen hat und auch weiterhin in ihr wirkt, nennen wir Theismus (nach
Theismus: Es existiert ein Schöpfer-Gott, der die Welt erschaffen hat und auch weiterhin in ihr wirkt.
Naturalismus: Außer der materiellen Natur gibt es nichts und die Naturdinge sind aus sich selbst heraus entstanden.
gr. theos, Gott). Damit gehört die Schöpfungslehre zum Theismus. Der Begriff „Schöpfung“ bezeichnet also ein willentliches, bewusstes, zielorientiertes Hervorbringen durch einen personalen, willensbegabten, kreativen Schöpfer (vgl. Tab. 2-1, S. 18).
Evolution: Alle heutigen Lebewesen stammen von andersartigen Vorfahren ab und sind in einem gemeinsamen Stammbaum aller Lebewesen verbunden.
Die zweite Sichtweise wird als Naturalismus bezeichnet, d. h. die Natur ist alles, was existiert und je existiert hat. Hier gibt es keinen Schöpfer, jedenfalls keinen, der aktiv und kreativ tätig ist. Nach dem Naturalismus beruht alles, was existiert, alleine auf physikalisch-chemischen Kräften und Gesetzmäßigkeiten. Es ist auch alles ausschließlich durch solche natürlichen Kräfte entstanden, ohne jedes Wirken eines Schöpfers. Diese Sicht führt automatisch zur Evolutionsanschauung, die heute in aller Regel naturalistisch verstanden wird. Evolutionstheoretiker verfolgen nämlich das Ziel, die Entstehung des Lebens und aller Lebewesen so zu rekonstruieren, dass ein Schöpfer dafür nicht benötigt wird. Entsprechend definiert man „Evolution“ so: Alle heutigen Lebewesen stammen von andersartigen Vorfahren ab und sind in einem gemeinsamen Stammbaum aller Lebewesen verbunden (Abb. 1-1). Veränderungen erfolgten demnach ausschließlich durch natürliche Vorgänge, ohne Planung und Zielorientierung. Auch das Leben selbst ist alleine durch physikalisch-chemische Prozesse aus leblosen Stoffen entstanden.
Der Erklärungsansatz Evolution und der Erklärungsansatz Schöpfung sind somit Gegensätze. Nach dem Schöpfungsansatz ist die Kreativität des Schöpfers entscheidend dafür, dass die Welt überhaupt existiert. Befürworter der Evolutionslehre wollen dagegen gerade ohne einen schöpferischen Einfluss auskommen.
Evolutionstheorien, die nur Bezug auf natürliche Faktoren nehmen, sind daher mit dem Schöpfungsansatz nicht vereinbar. Natürliche Evolution und Schöpfung können also auch nicht miteinander harmonisiert werden; das wäre ein Widerspruch in sich.1
Auf Überlegungen, ob man Evolution und Schöpfung dennoch miteinander harmonisieren kann, gehen wir in Kapitel 12 ein.
Schöpfung: Die Lebewesen wurden willentlich, planvoll und zielorientiert in fertiger Form hervorgebracht.
Warum Evolution und Schöpfung nicht zusammenpassen
Befürworter der Evolutionslehre versuchen, die Geschichte der Lebewesen alleine durch Zufall und Naturgesetze zu erklären – ohne Plan und Ziel. Sie kalkulieren daher das Handeln eines Schöpfers bewusst nicht ein. Schöpfung dagegen verfolgt ein Ziel und beruht auf einem Plan und einer Absicht. Schöpfung beruht daher gerade darauf, dass der Zufall weitestgehend ausgeschaltet wird: „Intelligenz vernichtet effektiv den Zufall“ (Arthur Ernest Wilder Smith).
Wie können wir herausfinden, wie die Welt entstanden ist?
Um herauszufinden, wie die Welt tatsächlich entstanden ist, gibt es zwei sehr verschiedene Zugänge. Der erste ist eine persönliche Mitteilung:
Evolution: allgemeine Abstammung natürlicher Mechanismus kein Plan und kein Ziel
Schöpfung: handelnder Schöpfer mit Plan und Ziel heute
Geschichte des Lebens
Anfang


Abb. 1-1: Zum Anfang und zur Geschichte der Lebewesen gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze: „Evolution“ heißt: Von einfachsten Anfängen zur Vielfalt aller Lebewesen. Entsprechend gibt es einen einzigen Baum des Lebens, der sich ohne Plan und Ziel entfaltet.
„Schöpfung“ bedeutet umgekehrt einen Beginn mit planvoll und kreativ hervorgebrachten Lebewesen, die als Grundtypen bezeichnet werden. Deren unterschiedliche Ausprägungen (kleine Bäumchen) beruhen auf schöpfungsgemäßer Programmierung. Dies wird genauer in Kapitel 4 erklärt.
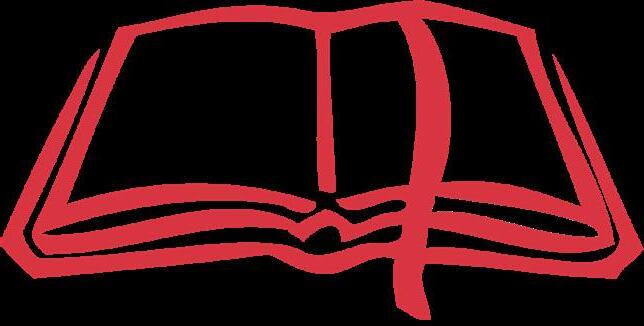
Wenn es einen Schöpfer gibt, könnte es sein, dass er seinen Geschöpfen mitgeteilt hat, dass und auch wie er die Welt und die Lebewesen erschaffen hat. Genau das behaupten die Schreiber der Bibel. Theologen sprechen von Offenbarung, also von einer persönlichen
Mitteilung Gottes. Glaubt man den Autoren des Alten und Neuen Testaments, so hat uns Gott tatsächlich einiges über die Schöpfung mitgeteilt und er stellt sich selber als der Schöpfer vor.
Der zweite Zugang ist unsere eigene, menschliche Erkenntnis. Dazu zählen unsere Erfahrungen, Beobachtungen, die wir machen können, und alle unsere Überlegungen, die wir dazu anstellen. Das führt auf das Gebiet der Naturwissenschaften. Wir können die Natur bzw. die Schöpfung mit unseren Sinnen und mithilfe verschiedener Messgeräte und Methoden untersuchen. Wir können erforschen, wie der Kosmos, die Erde und die Lebewesen aufgebaut sind und wie die Prozesse funktionieren, die im Weltall und in der belebten und unbelebten Welt ablaufen. Und wir können dann beurteilen, ob die Forschungsergebnisse eher zu Schöpfung oder zu Evolution passen.
Entscheidend für die Methode der Naturwissenschaft sind sogenannte empirische Daten. „Empirisch“ heißt „auf Er-

Empirische Daten:
Beobachtungen in der Natur, im Freiland oder im Labor.




Abb. 1-2 Naturwissenschaftler arbeiten empirisch, d. h. sie untersuchen die belebte und unbelebte Natur durch Beobachtung und Experiment. Die Vergangenheit ist nur indirekt erschließbar. Denn die Prozesse, die zum Beispiel zur Bildung von Schichtgesteinen oder zur Entstehung von Fossilien geführt haben, können nicht beobachtet werden. Naturwissenschaftler versuchen, die vergangenen Prozesse so zu rekonstruieren, dass die mutmaßlichen Szenarien durch die Beobachtungen unterstützt werden und ihnen nicht widersprechen.
fahrung beruhend“; gemeint sind damit Beobachtungen in der Natur – sei es im Freiland (Abb. 1-2) oder im Labor. Naturwissenschaftliche Beschreibungen nehmen also Bezug auf empirische Daten, auf Dinge, die beobachtbar bzw. erfahrbar sind.
Die empirischen Daten der Naturwissenschaften können als Indizien genutzt werden, um den Fall „Schöpfung oder Evolution?“ aufzuklären.
Mit den Methoden der Naturwissenschaft kann man jedoch nicht direkt untersuchen, ob die Welt auf irgendeine Weise erschaffen wurde oder ob sie Ergebnis rein natürlicher Vorgänge ist. Weder Schöpfung noch eine vergangene Evolution sind beobachtbar. Die Geschichte des Lebens ist einmalige Vergangenheit. Wir können nicht wie in einer Zeitmaschine zurück in die Erdgeschichte reisen und direkt beobachten, was passiert ist – so spannend das auch wäre. Naturwissenschaftler können nur den heutigen vorläufigen Endzustand der Naturgeschichte direkt untersuchen: die Natur, wie sie sich heute darstellt, seien es Sterne, Steine oder Steinböcke, und welche gesetzmäßig beschreibbaren Vorgänge in ihr ablaufen. Das bedeutet aber ganz und gar nicht, dass Naturwissenschaften keinen Beitrag zur Klärung von Ursprungsfragen leisten könnten. Im Gegenteil: Das Wissen, das wir durch naturwissenschaftliche Forschung gewinnen, also die empirischen Daten, können wir als Indizien nutzen, um den Fall „Schöpfung oder Evolution?“ aufzuklären. „Indiz“ bedeutet „Anzeiger“. Man erhofft sich von Indizien, dass sie anzeigen, was passiert ist. Solche Indizien sollten mindestens zur bevorzugten Weltsicht passen (also ihr nicht widersprechen). Am aussagekräftigsten sind jedoch Indizien, die zu
einer Sicht besser passen als zur anderen, also Beobachtungen, die entweder besser zu Schöpfung oder zu Evolution passen. Das können wir uns durch einen anschaulichen Vergleich deutlich machen: durch den Vergleich mit einer Kriminalgeschichte.
Der Fall „Schöpfung oder Evolution“ als Kriminalgeschichte
Wenn Wissenschaftler vergangene Ereignisse (in unserem Fall: Schöpfung oder Evolution) rekonstruieren möchten, arbeiten sie ähnlich wie ein Kriminalist, der einen Todesfall aufzuklären hat. War es Mord oder Selbstmord? Oder trat der Tod auf natürlichem Weg ein? Wenn ein natürlicher Tod und Selbstmord ausgeschlossen werden können, stellen sich die Fragen nach dem Täter und dem Tathergang.
Hier wird es spannend, wenn Augenzeugen fehlen und wenn der Täter kein Geständnis ablegt. Dann ist nur ein Indizienbeweis möglich. Das ist kein Beweis im mathematischen Sinne, sondern eine zu den Indizien passende Erklärung der am Tatort gefundenen Spuren; im Idealfall gibt es nur eine einzige stimmige Erklärung, und der Fall scheint damit gelöst zu sein. Unter Umständen bleibt der Fall aber mangels aussagekräftiger Indizien ungelöst, weil die Indizien zu mehreren Szenarien passen. Bei einem Strafprozess heißt es dann „mangels Beweisen freigesprochen“. Mit „Beweis“ sind hier sachdienliche Indizien gemeint.
Der Kommissar nutzt bei seinen Recherchen auch naturwissenschaftliche Forschung, z. B. Kenntnisse über Vorgänge, die nach dem Tod einsetzen, um den Todeszeitpunkt zu ermitteln. Er untersucht möglichst genau und umfassend die Spuren am Tatort und bezieht sie in seine Versuche ein, den Tathergang zu rekonstruieren.
Wenn der Kommissar seine Arbeit unvoreingenommen macht, sammelt er nicht nur so viele Indizien wie möglich, um zu einem möglichst vollständigen Gesamtbild zu kommen. Er wird auch nach allen Seiten ermitteln und allen Spuren nachgehen. Ganz wichtig dabei ist, dass er für alle möglichen Antworten offen ist. Niemand würde einen Kommissar ernst nehmen, der eine der möglichen Erklärungen grundsätzlich ausschließen würde. Oder was würden Sie von einem Kommissar halten, der „Mord“ von vornherein ausschließt, mit der Begründung, es müsse unter allen Umständen eine Erklärung dafür geben, dass der Tod auf natürlichem Weg eingetreten sei? Die Möglichkeit, dass ein Täter absichtsvoll gehandelt habe, dürfe nicht berücksichtigt werden? Ein solcher Kommissar hätte seinen Beruf verfehlt.

Genauso seltsam wie ein Kommissar, der sich von vornherein auf eine natürliche Todesursache festlegt, ist aber tatsächlich die Herangehensweise der überwältigenden Mehrheit der heutigen Naturwissenschaftler
Die Mehrheit der Wissenschaftler berücksichtigt die Möglichkeit einer Schöpfung nicht. Damit aber geben sie die Wahrheitssuche auf.
in ihren Forschungen zur Entstehung des Lebens und zur Geschichte der Lebewesen. Die Möglichkeit, dass ein Schöpfer absichtsvoll gehandelt hat und dass daher Schöpfung die korrekte Erklärung für die Existenz der Lebewesen ist, wird fast durchweg grundsätzlich ausgeschlossen. Der amerikanische Immunologe Scott C. Todd drückt das so aus:
„Selbst wenn alle Daten auf einen intelligenten Schöpfer weisen, würde eine solche Hypothese aus der Wissenschaft ausgeschlossen werden, weil sie nicht naturalistisch ist.“2
Wir erinnern uns: „Naturalistisch“ bedeutet, dass Gott als Schöpfer überflüssig ist.
Der berühmte Genetiker Richard Lewontin hat sich ähnlich geäußert (wobei „Materialismus“ und „Naturalismus“ praktisch gleichbedeutend sind):
„Wir sind … durch unsere von vornherein getroffene Grundsatzentscheidung für den Materialismus dazu gezwungen, Forschungsansätze und Erklärungskonzepte zu entwickeln, die sich auf materialistische Erklärungen beschränken. Dabei spielt es keine Rolle, wie sehr sie der Intuition der Nichteingeweihten entgegenstehen oder ob sie ihnen rätselhaft erscheinen. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen.“3
Die Mehrheit der Wissenschaftler hat sich darauf festgelegt, dass es auf alle Ursprungsfragen eine naturalistische Antwort geben muss. Ein Schöpfer muss ausgeschlossen werden.
Es gibt viele ähnlich lautende Zitate, auch wenn selten so offen zugegeben wird, dass es nicht um die Suche nach der Wahrheit geht, sondern um die Verteidigung eines naturalistischen bzw. materialistischen Weltbildes, in dem ein handelnder Gott unerwünscht ist. Stattdessen wird meistens behauptet, man müsse Gottes Handeln aus methodischen Gründen ausschließen. Man könne Gott mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht erfassen. Die Annahme eines Schöpfers sei unwissenschaftlich.
Doch hier liegt ein Missverständnis vor: Es geht hier nicht um die Methode der Naturwissenschaft, sondern um Ursprungsfragen, um vergangene Geschehnisse, die niemand beobachtet hat und die uns nur durch verbliebene Spuren indirekt zugänglich sind.
Naturwissenschaft kommt erst ins Spiel, wenn es darum geht, Spuren des vergangenen Geschehens (sei es Schöpfung oder Evolution) zu entdecken und auszuwerten (s. o.). Es ist natürlich korrekt, dass man die Schöpfungstätigkeit Gottes weder beobachten noch in eine naturwissenschaftliche Beschreibung einbauen kann. Aber auch die vergangene Evolution – sofern es sie gegeben hat – ist nicht beobachtbar. Es kann hier grundsätzlich nur darum gehen, relevante Indizien zusammenzutragen und zu
bewerten. Auf das naturwissenschaftliche Arbeiten an sich hat das gar keine Auswirkungen.
Wer einen Schöpfer bei der Suche nach Antworten auf Ursprungfragen grundsätzlich ausschließt, hat sich vor jeder Beweisaufnahme bereits auf den einen Antworttyp festgelegt. Damit aber wird ein Grundprinzip wissenschaftlichen Arbeitens aufgegeben, nämlich die Orientierung an der zutreffenden Antwort.4 Stattdessen findet Forschung heutzutage – mit viel wissenschaftlicher Genauigkeit und großem Aufwand – nur im naturalistischen Denkrahmen statt. Alle empirischen Daten werden ausschließlich naturalistisch interpretiert. Diese Festlegung ist nicht wissenschaftlich begründet, sondern eine weltanschauliche Entscheidung, die man auch anders treffen könnte.
Wir werden im Folgenden sehen, dass die Suche nach Antworten ausschließlich im Rahmen des Naturalismus ein Holzweg ist. Genauso wie man auf der falschen Spur ist, wenn man die Existenz eines Mörders ausschließt, obwohl die Indizien am Tatort auf einen Mord hinweisen.
