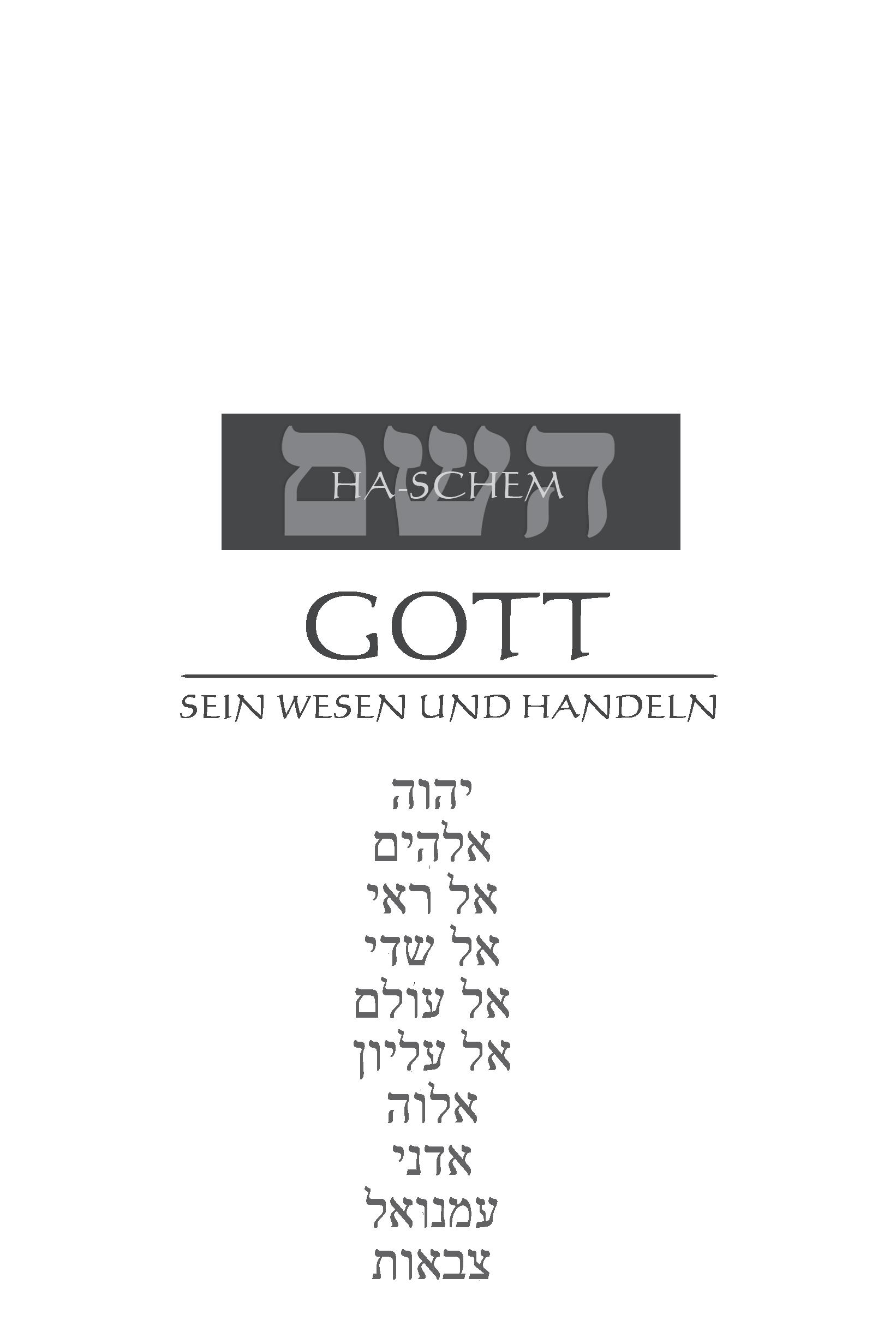
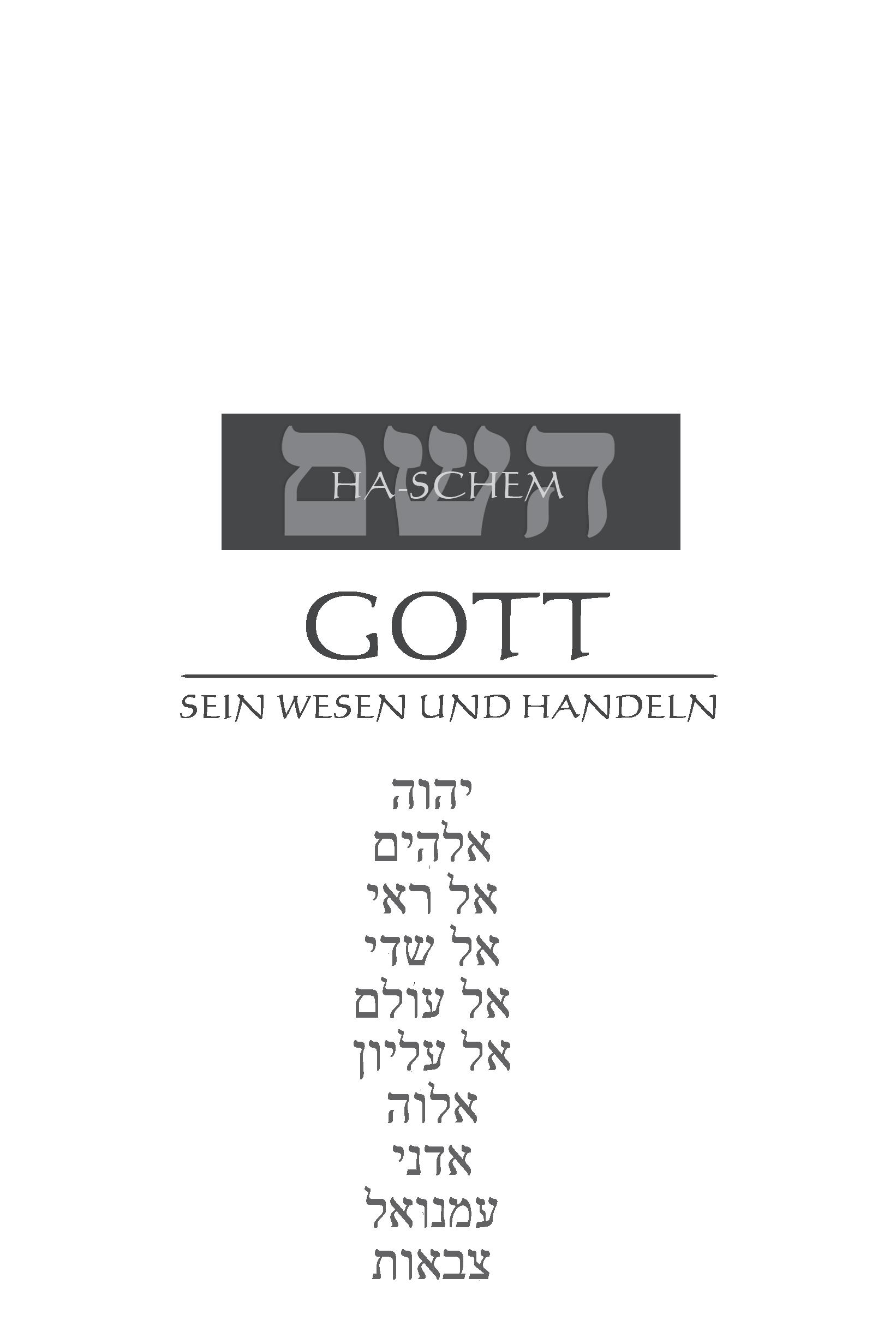
Arnold G. Fruchtenbaum
Copyright des amerikanischen Originals von 2020 Ariel Ministries USA (www.ariel.org).
Copyright der deutschen Ausgabe:
CMV Hagedorn
Postfach 30 04 30 · 40404 Düsseldorf www.cmv-duesseldorf.de info@cmv-duesseldorf.de
1. Auflage 2025
Übersetzung: Markus Jost
Umschlaggestaltung und Satz: Susanne Martin
ISBN: 978-3-96190-085-5
Druck: buecherdrucken24
Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation darf weder ganz noch in Teilen (außer in Form von kurzen Zitaten in Rezensionen und anderen nichtkommerziellen Verwendungsweisen, die im Rahmen des Urheberrechts gestattet sind) ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des Herausgebers reproduziert, verbreitet oder in irgendeiner anderen Form (auch nicht durch Fotokopien, Aufnahmen oder sonstige elektronische oder mechanische Methoden) weitergegeben werden. Anfragen nach Genehmigungen richten Sie bitte an die unten stehende Adresse des Herausgebers.
Alle Bibelzitate stammen, falls nicht anders vermerkt, aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Die Wörter Jesus und Christus wurden weitgehend durch Jeschua und Messias ersetzt.
B.
D.
Einleitung
Was ist „Komm und sieh!“?
Der vorliegende Band ist Teil 2 einer mehrbändigen Sammlung von Bibelarbeiten aus der Sicht eines messianischen Juden unter dem Titel „Komm und sieh!“ („Come and See“), die aus Dr. Arnold Fruchtenbaums Radiosendungen verschriftlicht wurden.1 Für die Buchreihe wurden die Manuskripte dieser Mitschriften überarbeitet und ergänzt. Jede dieser Bibelarbeit kann als ein festes Fundament dienen, auf dem man stehen kann, von dem aus man lehren kann und die unverfälschte Wahrheit der Gemeinde predigen kann. Diese umfangreiche Sammlung ist angefüllt mit Fachwissen über Hebräisch, Griechisch, den Talmud, die Geschichte der Juden, die Geografie von Eretz Yisrael (dem Land Israel); es ist geprägt von den Erkenntnissen eines Bibellehrers und der Erleuchtung durch Ruach HaKodesh (den Heiligen Geist). „Komm und sieh“ ist auch für das persönliche Bibelstudium oder für die Kleingruppenarbeit geeignet und soll jeden, egal, welches Thema er wählt, im Glauben weiterbringen.
Was wirst du in diesem Band entdecken?
In diesem Band 2 der Reihe „Komm und sieh!“ wird untersucht, was wir über Gott wissen. In der „Systematischen Theologie“ nennt man das die „Eigentliche Theologie“ oder die „Lehre von Gott“ und wird folgendermaßen definiert: Die „Eigentliche Theologie“ ist die wissenschaftliche Untersuchung dessen, was man über die Existenz, die Personen und die Eigenschaften des dreieinigen Gottes wissen kann, abgesehen von seinen Werken.
1 Siehe auch Band 1 der Reihe: Ha Dawar – Das Wort Gottes, 2. Aufl. 2021, Düsseldorf: CMV Hagedorn.
In der „Eigentlichen Theologie“ werden zwei Themenbereiche angesprochen: Theismus und Trinitarismus. Im Theismus geht es die Existenz und das Wesen Gottes. Wir erforschen Gott als Schöpfer, als Erhalter und als Beherrscher des Universums. Der Begriff „Trinitarismus“ kommt von dem Wort „Trinität“; hier geht es um die Einheit, die Pluralität und die Dreieinheit in der Gottheit. Wir untersuchen die unterschiedlichen Aufgaben und Merkmale der einzelnen Personen. Es geht uns auch um die Beziehungen innerhalb der Gottheit. Wir konzentrieren uns vor allem auf Gott den Vater, da Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist in der „Christologie“ bzw. der „Pneumatologie“ besprochen werden.
Um die Themenbereiche Theismus und Trinitarismus gut auseinander zu halten, haben wir das Buch in zwei Teile gegliedert, wobei wir die Nummerierung der Kapitel darin weiterführen.
Fragen und Lernanregungen für diesen Kurs
Am Ende eines jeden Kapitels findet man Fragen und Vorschläge zum Weiterstudium. Durch die Fragen, die in diesen Kurs eingearbeitet sind, sollen Anregungen zur Anwendung der Themen gegeben werden.
Das Ziel von „Komm und sieh!“ ist, dass die Jünger Yeshuas (Jesu) in ihrem Glauben wachsen und ihre Berufung ausleben, Jünger zu machen.
Teil I Theismus
Kapitel 1
Die Existenz Gottes
Kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die Vollkommenheiten des Allmächtigen ergründen? (Hi 11,7)
Was kann ein Mensch über Gott wissen, der von seinem Wesen her so anders ist als der Mensch? Gibt es Gott wirklich? Was sind sein Charakter, seine Persönlichkeit und seine Eigenschaften?
Der Mensch hat sich schon immer danach gesehnt, Gott zu kennen. Aber die Bibel bezeugt, dass Gott unbegreiflich ist. Der menschliche Verstand kann Gott einfach nicht erfassen. Gleichzeitig bezeugt die Bibel aber auch, dass man Gott erkennen kann. Es scheint, als wolle er von den Menschen erkannt werden, und deshalb ist Gott selbst unsere größte Quelle des Wissens über ihn. Durch seine Begegnungen mit den Menschen hat er seine Selbstoffenbarung bewirkt. Als Mittel für diese Offenbarung gab er die Sprache. Er schuf den Menschen nach seinem Bild, damit der Mensch durch die Intelligenz eines rationalen Wesens zumindest ein Minimum dessen erfassen kann, wer Gott ist. Schließlich gab Gott den Heiligen Geist, der dem Gläubigen weitere Wahrheiten offenbart. Mehr darüber wird im nächsten Punkt gesagt.
A. Quellen des Wissens
Wenn wir uns näher mit der Frage beschäftigen, wie der Mensch Gott erkennen kann, dann können wir vier Quellen für unser Wissen unterscheiden.
1. Intuition
Intuition ist bis zu einem gewissen Grad eine gültige Quelle des Wissens über Gott. Das zeigt sich in Apostelgeschichte 17,28: Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: „Denn wir sind auch sein Geschlecht.“
Der normale, natürliche Verstand stellt mehrere Vermutungen über Gott auf. Er hat gewisse Vorstellungen von Zeit und Ewigkeit und richtig und falsch. Er verfügt auch über gewisse Fähigkeiten, um mathematische Genauigkeiten festzustellen. Der natürliche Verstand weiß etwas über seine eigene Existenz. Durch Intuition weiß er etwas von der Existenz der Materie. Es gibt auch gewisse Dinge, die der natürliche Verstand über Gottes Persönlichkeit schlussfolgern kann. Daher bietet die Intuition ein gewisses Maß an direktem Wissen, da es eine rationale Wahrnehmung gibt, die allen Prozessen der Beobachtung und Schlussfolgerung vorausgeht. Durch Intuition kommen alle Menschen überall zu einem Punkt, an dem sie gewisse Schlussfolgerungen über Gott ziehen. Einige sind wahr, andere nicht. Aber die Tatsache, dass der Mensch fähig ist, bestimmte Wahrheiten über Gott auch losgelöst von der Bibel abzuleiten, und auch an Orten, wo die Bibel nicht bekannt ist, zeigt, dass die Intuition in irgendeiner Form als Quelle des Wissens über Gott in Betracht kommt.
Allerdings müssen intuitive Wahrheiten durch zuverlässige Faktoren überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie wahr sind. Die erste Frage, auf die man eine Antwort finden muss, ist, ob die Wahrheit allgemein gültig ist. Ist sie allen Menschen gemeinsam? Dabei geht es nicht darum, ob sie von allen Menschen verstanden oder bejaht wird, sondern darum, ob alle Menschen bewusst oder unbewusst nach dieser Tatsache handeln. Ist es eine allgemein anerkannte Wahrheit? Handelt es sich um ein allgemein nachgewiesenes Konzept? Die zweite Frage, auf die man eine Antwort finden muss, ist, ob die Wahrheit eine Notwendigkeit ist. Ist es unmöglich, sie zu leugnen? Die dritte und letzte Frage ist, ob die Wahrheit offensichtlich und ausreichend ist. Ist sie von keinen anderen Wahr-
heiten abhängig, die selbst lediglich durch Intuition und Wahrnehmung belegt sind? Mit anderen Worten: Ist die Vorstellung von Gott wirklich allgemeingültig? Offensichtlich ist die Antwort im Großen und Ganzen ja. In allen Gesellschaften weltweit, ob die Bibel nun ein Teil der Kultur ist oder nicht, gibt es eine Vorstellung von Gott. Sie entspringt der menschlichen Intuition und zeigt, dass die Intuition, so beschränkt sie auch sein mag, tatsächlich eine Quelle des Wissens über Gott ist.
2. Tradition
Eine zweite Quelle für unser Wissen ist die Tradition. Eine Tradition kann entweder historisch oder gegenwärtig sein. Historische Traditionen sind die frühen Eindrücke der Menschheit über Gott. Die moderne Sichtweise in der Welt scheint so zu sein, dass die Menschheit ihre Glaubensreise mit dem Polytheismus begann, der sich dann zu einem Monotheismus entwickelte. Die biblische Sicht ist genau andersherum. Der Mensch begann mit dem Monotheismus und glaubte an nur einen Gott, um dann in den Polytheismus zu verfallen und an viele Götter zu glauben.
Beide Sichtweisen sind von Generation zu Generation weitergereicht worden. Das zeigt, dass die Tradition sowohl Wahrheit als auch Irrtum weitergeben kann. Die Tradition, die die Ansicht übermittelt hat, dass es nur einen Gott gibt, ist wahr. Die Tradition aber, die die Vorstellung von vielen Göttern weitergegeben hat, ist falsch. Obwohl die Tradition also wie die Intuition eine Quelle des Wissens über Gott sein kann, ist auch sie begrenzt, weil sie gleichzeitig sowohl Wahrheit als auch Irrtum überliefern kann.
Bei der gegenwärtigen Tradition geht es darum, was wir unseren Kindern beibringen. Wenn es um Wahrheiten über Gott geht, können Kinder ihr Wissen leichter und schneller anwenden als Erwachsene. Die Traditionen, die an Kinder weitergeben werden, sind das, was durch die Intuition gelehrt wurde. Es lässt sich eine Entwicklung feststellen: Die menschliche Intuition leitet bestimmte Vorstellungen – sowohl wahre als auch falsche – über Gott ab. Durch die Tradition werden diese an die nächste Generation weitergegeben, die ihrerseits sowohl Wahrheit als auch Irrtum erhält. Folglich können sowohl die Tradition als auch die Intuition eine Quelle des Wissens über Gott sein. Aber sie ist äußerst begrenzt.
3. Vernunft
Die dritte Quelle unseres Wissens ist die Vernunft. Vernunft ist abgesehen von der Offenbarung die höchste Fähigkeit des Menschen, etwas über Gott zu erfahren. Hier nutzt der Mensch seine Fähigkeit, logisch zu denken, indem er die Vernunft gebraucht, um noch mehr Wahrheiten über Gott abzuleiten. Die Vernunft hat einen besonderen Wert, denn sie ist eine der Eigenschaften, die Gott in vollkommener Form zu eigen sind. Vernunft gibt dem Universum seine Ordnung und ist daher für den Menschen nachvollziehbar.
Die Vernunft ist eine gute Quelle des Wissens über Gott, weil sie vernünftige, nachweisbare, logische und philosophische Argumente für die Existenz Gottes liefern kann. In diesem Sinne ist die Vernunft besser als Intuition und Tradition. Aber so hoch die Vernunft auch gehen und so viel die Vernunft auch leisten kann auf dem Gebiet der Gotteserkenntnis, eine persönliche Beziehung zu Gott kann sie nicht herstellen. Daher ist auch sie begrenzt.
4. Offenbarung
Die bei weitem wichtigste verfügbare Quelle des Wissens ist die göttliche Offenbarung. Sie kommt direkt von Gott. Offenbarung ist von der menschlichen Intuition unabhängig. Sie beruht nicht auf Tradition. Sie kann durch die menschliche Vernunft nicht erreicht werden. Bei der Offenbarung geht es einfach um die Dinge, die Gott den Menschen mitteilen wollte.
In dem Buch „Ha-Dawar: Das Wort Gottes“2, dem ersten Band der Reihe „Komm und sieh!“, geht es u.a. um die göttliche Offenbarung. Dort findet man eine tiefgehende Untersuchung der allgemeinen, besonderen und fortschreitenden Offenbarung. Für das Studium des Theismus ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Gott wirklich die Initiative ergriffen hat, sich selbst zu offenbaren. Tatsächlich kommt nahezu alles, was der Mensch über Gott weiß, aus dieser Quelle.3
Wenn wir die Offenbarung Gottes untersuchen, führt uns das zu drei Argumentationsmustern, die für oder gegen die Existenz Gottes sprechen: die naturalistischen Argumente, die biblischen Argumente und die entgegengesetzten Ansichten.
2 Arnold Fruchtenbaum, Ha-Dawar: Das Wort Gottes, Düsseldorf: CMV Hagedorn.
3 Das ist wichtig für die Konsequenz der Frage 1 auf Seite 33.
B. Naturalistische Argumente
Es gibt zwei Arten von naturalistischen Argumenten. Das eine ist bekannt unter der lateinischen Bezeichnung a posteriori, was wörtlich „was danach kommt“ bedeutet – das heißt von der Wirkung zur Ursache. Argumente, die in diese Kategorie fallen, beziehen sich auf das, was man durch Beobachtung wahrnehmen kann, und nicht auf das Verstehen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Die Argumentation beruht auf induktiver Schlussfolgerung bzw. indirekten Überlegungen und ist von der Erfahrung abhängig. Bei diesen naturalistischen a-posteriori-Argumenten für die Existenz Gottes geht man von der Wirkung zur Ursache, von der Folge zur Vorgeschichte, von den Einzelheiten zum Prinzip und von Ereignissen zum Beweggrund.
Es gibt drei naturalistische a posteriori Hauptargumente für Gott, die man als das kosmologische Argument, das teleologische Argument und das anthropologische Argument bezeichnet. Wir werden uns gleich mit jedem Einzelnen von ihnen beschäftigen.
Die zweite Art der naturalistischen Argumente für die Existenz Gottes ist unter der lateinischen Bezeichnung a priori bekannt, was wörtlich „was davor ist“ bedeutet – das heißt von der Ursache zur Wirkung. Diese Art der Argumentation beruht auf deduktiven Schlussfolgerungen bzw. logischen Überlegungen und ist unabhängig von der Erfahrung. A-priori-Argumente beziehen sich auf das, was man durch ein Verstehen der Funktionsweise bestimmter Dinge wissen kann aber nicht durch Beobachtung. Bei dieser Art der Argumentation führt das Argument von der Ursache zur Wirkung, von der Vorgeschichte zur Folge, vom Prinzip zu den Einzelheiten und vom Beweggrund zum Ereignis. Das naturalistische a-priori-Hauptargument nennt man auch das ontologische Argument.
Wir müssen darauf hinweisen, dass naturalistische Argumente für die Existenz Gottes seine Existenz nicht wissenschaftlich beweisen. Sie ermöglichen es aber dem natürlichen Verstand, sowohl die Tatsache des Theismus als auch die Vorstellung, dass Gott wirklich existiert, zu akzeptieren. Wir sollten außerdem bedenken, dass naturalistische Argumente nicht ausreichen, um einen Menschen aus der Trennung von Gott heraus zu retten. Nur der Beweis, dass Gott existiert, rettet niemanden. Durch diese Argumente können wir vielleicht jemanden davon überzeugen, dass Gott existiert, aber die Argumente werden ihn nicht retten. Andererseits reichen sie allerdings aus, um jemanden zu verurteilen. Je mehr Erkenntnis der Mensch
über Gott hat und trotzdem nicht an seinen Sohn glaubt, desto schwerer wiegt die Last des Urteils, das er tragen werden muss.
1. Das kosmologische Argument
Das kosmologische Argument beschäftigt sich mit der Tatsache, dass das Universum eine Wirkung ist. Wenn das so ist, dann braucht es eine angemessene Ursache. Die einzige angemessene Ursache für die Existenz des Universums ist Gott. Die Bibel gebraucht das kosmologische Argument in Hebräer 3 und Psalm 19:
Denn jedes Haus wird von jemand erbaut; der aber alles erbaut hat, ist Gott. (Hebr 3,4)
Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis – ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde, und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. In ihm hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor; sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Am einen Ende des Himmels ist ihr Aufgang und ihr Umlauf bis zum anderen Ende, und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. (Ps 19,2-7)
Es steht außer Frage, dass das materielle Universum tatsächlich existiert. Angesichts dieser Tatsache gibt es nur zwei Erklärungsmöglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass die Materie selbst ewig ist. Wer Atheist ist, muss an die Ewigkeit der Materie glauben.
Die zweite Möglichkeit ist, dass Materie eine Wirkung ist. Wenn das so ist, welche Möglichkeiten gibt es dann für die Ursache? Eine mögliche Ursache ist blinder Zufall. Eine weitere ist reine Naturgewalt. Eine weitere Möglichkeit ist Gott plus einige natürliche Kräfte. Die letzte Möglichkeit ist die biblische Sicht: Gott allein. Entweder ist die Materie ewig, oder sie ist es nicht. Wenn sie nicht ewig ist, dann hat etwas die Materie hervorgebracht, und die aufgezeigten Optionen scheinen die einzig möglichen zu sein.
Die Gültigkeit des kosmologischen Arguments hängt von drei Wahrheiten ab:
1. Jede Wirkung muss eine Ursache haben.
2. Die Wirkung ist in ihrer Existenz von der Ursache abhängig.
3. Die Natur kann sich nicht selbst aus dem Nichts erschaffen.
Der Grundsatz, der dem kosmologischen Argument zugrunde liegt, ist der lateinische Satz ex nihilo nihil fit. Er bedeutet: „Aus dem Nichts kann nichts entstehen“. Wenn dieses Argument wahr ist, dann ist die erste Ursache selbstexistent, ewig und mächtig, und dann ist diese erste Ursache Gott selbst.
Wenn wir das kosmologische Argument zusammenfassen, dann sagt es einfach nur aus, dass das Universum existiert. Entweder ist es ewig oder es ist eine Wirkung. Wenn es eine Wirkung ist, dann muss es eine wirksame Ursache haben. Diese wirksame Ursache ist Gott.4
2. Das teleologische Argument
Das zweite naturalistische Argument ist als das teleologische Argument bekannt. Es leitet sich ab von den griechischen Begriffen telos, was „Ziel“ oder „Zweck“ bedeutet, und logos, was „Lehre“ oder „Abhandlung“ bedeutet. Es geht also um die Lehre der Zweckmäßigkeiten oder die Lehre vom vernünftigen Grund. Im Wesentlichen verläuft dieses Argument folgendermaßen: Jedes Design weist auf einen Designer hin. Im Universum zeigt sich sehr deutlich ein Design; es ist geordnet. Deshalb verdankt das Universum seine Existenz einem intelligenten Designer. Dieser intelligente Designer muss Gott sein. Bibelaussagen wie in Psalm 94 und Römer 1 weisen auf das teleologische Argument hin:
Der das Ohr gestaltet hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? (Ps 94,9)
Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. (Röm 1,18-20)
4 Frage 2 auf Seite 33.
Das teleologische Argument baut auf dem kosmologischen Argument auf, berücksichtigt aber auch den Sinn und Zweck des Universums. Das kosmologische Argument versucht einfach, vernünftig zu beweisen, dass das Universum von Gott hervorgebracht wurde. Das teleologische Argument fügt dem kosmologischen Argument das Element der Bedeutung und des Zwecks für das Universum hinzu. Aus dem Vorhandensein von Ordnung und Design im Universum leitet es ab, dass Gott existiert. Wenn das Argument also wahr ist, dann ist die erste Ursache aller Dinge intelligent. Während das kosmologische Argument also aussagt, dass die erste Ursache mächtig ist, sagt dieses Argument aus, dass die erste Ursache intelligent ist.5
3. Das anthropologische oder moralische Argument
Das dritte naturalistische Argument für die Existenz Gottes ist unter zwei verschiedenen Bezeichnungen bekannt. Man nennt es manchmal das anthropologische Argument und manchmal das moralische Argument. Hier stützt sich der Beweis für die Existenz Gottes auf die Beschaffenheit des Menschen. Der Mensch hat eine Persönlichkeit, und die drei Facetten seiner Persönlichkeit sind Verstand, Gefühl und Wille. Der Mensch ist auch ein moralisches Wesen mit einem Bewusstsein für Recht und Unrecht. Dies erfordert eine erste Ursache, die ebenfalls eine Persönlichkeit, einen Verstand, Gefühle und einen Willen hat und Entscheidungen über richtig und falsch treffen kann. Dieses Argument wird in Apostelgeschichte 17,29 gebraucht: Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen, gleich sei.
Wenn dieses Argument wahr ist, dann lehrt es, dass die erste Ursache eine Persönlichkeit hat und ein moralischer Gott ist.6
4. Das Ontologische Argument
Das vierte naturalistische Argument für die Existenz Gottes wird als ontologisches Argument bezeichnet. Dieses a-priori-Argument beruht auf der Tatsache, dass der Mensch eine Vorstellung von Gott hat, und das wiederum beweist, dass Gott existieren muss. Die Vorstellung des Vollkommenen
5 Frage 3 auf Seite 33.
6 Frage 4 auf Seite 34.
muss aus einer vollkommenen Quelle stammen und diese vollkommene Quelle muss Gott sein. Die Existenz Gottes wird also dadurch bewiesen, dass der menschliche Verstand an seine Existenz glauben kann und glaubt. Das ist natürlich eins der schwächsten naturalistischen Argumente, denn der Mensch kann viele Vorstellungen haben, die einfach nicht wahr sind. Zum Beispiel kann der Mensch sich vorstellen, dass es Heinzelmännchen gibt, aber das bedeutet nicht, dass Heinzelmännchen tatsächlich existieren. Trotzdem wurde das ontologische Argument in bestimmten philosophischen Kreisen verwendet. Die berühmteste Person, die sich dieses Argument zu eigen machte, war wahrscheinlich Anselm von Canterbury. 1078 schlug dieser Benediktinermönch und Philosoph ein Argument vor, das in etwa so lautete: Niemand kann sich etwas vorstellen, was größer ist als Gott; das erfordert die Vorstellung eines absolut perfekten Wesens. Wenn das, was perfekt ist, nur in Gedanken existieren würde, dann wäre es nicht das absolut Größte. Was existiert, muss auch real sein, Wirklichkeit sein. Eine Eigenschaft dessen, was perfekt ist, ist die reale Existenz. Also folgt daraus, dass das Wesen, „über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“, unbedingt real existieren muss. Das absolut perfekte Wesen muss existieren.
Obwohl das ontologische Argument schwach ist, tauchte es im 17. Jahrhundert wieder auf, als der französische Philosoph René Descartes es einsetzte. Er erklärte in etwa so: Der Mensch entwickelt die Vorstellung, dass es ein unendliches Wesen gibt. Da der Mensch begrenzt, d.h. endlich ist, kann diese Vorstellung nicht von ihm kommen. Vielmehr muss sie von Gott kommen, dessen Existenz dadurch zwingend bewiesen ist.
Ein weiterer Philosoph, dem dieses Argument gefiel, war Samuel Clarke. Diesem anglikanischen Geistlichen zufolge gehören Raum und Zeit zur Materie bzw. Substanz und zum Sein. Sie sind beide unendlich und ewig. Es muss deshalb eine unendliche und ewige Substanz oder ein Wesen geben, zu dem diese Attribute gehören. Und natürlich handelt es sich dabei um Gott.
Zusammenfassend besagt das ontologische Argument, dass der Mensch sich nicht von der Vorstellung von Gott losreißen kann. Wenn man sich also ein solches Wesen vorstellen kann, beinhaltet das automatisch die reale und objektive Existenz Gottes. Also beweist die bloße Vorstellung von Gott, dass er existiert. Es gibt zwar Bibelaussagen, mit denen die anderen drei naturalistischen Argumente unterstützt werden, aber keine, die das ontologische Argument stützen. Eins der Probleme liegt darin, dass eine Vorstellung über etwas Vollkommenes noch nicht dessen Exis-
tenz beweist. Der Mensch hat alle möglichen Vorstellungen über Dinge, die schlicht nicht existieren.
C. Biblische Argumente
Die biblischen Argumente sind natürlich der Hauptbestandteil dieser Studie, und wir werden sie ausführlich erläutern, wenn wir uns die verschiedenen Bibelstellen anschauen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bibel die Existenz Gottes nicht nur voraussetzt, sondern sie auch lehrt. Das ist im Wesentlichen das biblische Argument.
D. Gegensätzliche Ansichten
Es gibt verschiedene Ansichten, die die Existenz eines persönlichen Gottes ablehnen. Das größte Problem für diejenigen, die Gottes Existenz ablehnen, ist die Tatsache, dass ein sichtbares Universum existiert. Sie müssen das Universum durch irgendeine ungewöhnliche Form von Theismus oder durch irgendeine Art von Atheismus erklären. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. In 1. Korinther 2,14 erklärt Paulus, dass der natürliche Mensch nicht fähig ist, die Dinge Gottes zu verstehen, und dass sie ihm eine Torheit sind: Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird.
Trotzdem muss der Mensch einen Weg finden, um die Existenz des sichtbaren Universums zu erklären. Die Sichtweisen, die der biblischen Lehre der Existenz Gottes entgegenstehen, kann man in zwei Kategorien einteilen: theistische Ansichten und atheistische Ansichten.7
1. Zehn falsche theistische Ansichten
a. Polytheismus
Polytheismus ist der Glaube an mehr als einen Gott. Diese Götter haben
7 Frage 5 auf Seite 34.
in der Regel nur eine begrenzte Macht. Über 250 Mal wird in der Bibel erwähnt, dass die Heiden viele Götter anbeten. Römer 1,21-23 erklärt den Ursprung dieser falschen Vorstellung:
²¹ weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. ²² Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden ²³ und haben die Herrlichkeit des ungänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren.
Die menschliche Verderbtheit ist der Ursprung der Lehre vom Polytheismus. Andere Bibelstellen definieren Polytheismus auf drei Arten:
1. Sie beschreiben die falschen Götter als nichtig (Ps 106,28; Jes 41,24.29; 42,17; 44,9-20; Jer 2,26-28).
2. Falsche Götter sind von vornherein keine echten Götter (Gal 4,8).
3. Götzendienst ist in Wirklichkeit Dämonenanbetung. In 1. Korinther 10,20 wird der Götzendienst mit dem Opfern für daimonion bezeichnet, und das bedeutet, dass die wahren Götter heidnischer Verehrung nicht Götzen, sondern Dämonen sind.
b. Henotheismus
Henotheismus ist eine Form des Polytheismus, der besagt, dass es für jede Region einen Gott gibt. Jede Volksgruppe oder Nation oder Region hat ihren eigenen Gott. Da der Planet in viele verschiedene Regionen aufgeteilt ist, gibt es auch viele Götter. Diese Auffassung können wir erkennen in 1. Könige 20,23, wo die Knechte des Königs von Aram einen Unterschied machten zwischen den Berggöttern und den anderen Göttern.
c. Pantheismus
Pantheismus bedeutet „Alles ist Gott“. Einfach ausgedrückt ist Gott alles und alles ist Gott. Gott ist das Universum, und das Universum ist Gott. Alles geht in Gott auf, und Gott ist die Summe aller Dinge. Pantheismus hat mehrere theologische Merkmale. Er lehrt:
1. Gott ist immanent, nicht transzendent, um es mit Fachbegriffen auszudrücken.
2. Es gibt im Universum keinen Dualismus. Der Pantheismus verneint die Dualität von Geist und Materie, Seele und Körper, Gott und der Welt.
3. Materie ist unvergänglich.
4. Es gibt nur eine Substanz und ein Sein.
5. Gott hat keine Persönlichkeit.
6. Sünde ist nicht möglich; so etwas wie Sünde gibt es nicht.
7. Der Mensch ist in Wirklichkeit ein Teil von Gott.
8. Das Gut und das Böse sind ein Teil von Gott.
9. Der Mensch hat kein persönliches Dasein, sondern er ist nur ein Moment im Leben Gottes.
10. Der Mensch ist nur eine Form der Existenz Gottes. Deshalb sind unsere Taten die Taten Gottes.
11. Gott ist begrenzt.
12. Es gibt keine Grundlage für eine wahre Moral.
Es gibt drei verschiedene Arten von Pantheismus. Die erste Form nennt man materialistischer Pantheismus, der lehrt, dass das materielle Universum Gott ist und dass die Materie die ewige Ursache allen Lebens ist. Eine zweite Form ist der naturalistische Pantheismus, der lehrt, dass die Realität letztlich weder Geist noch Materie ist, sondern neutral, und dass der Geist und die Materie nur Erscheinungen sind. Eine dritte Form ist der idealistische Pantheismus, der leugnet, dass das materielle Universum real existiert; er identifiziert Gott einfach als die Summe von Verstand und Geist. Die letztendliche Wirklichkeit liegt in der Natur des Geistes und nicht in der materiellen Welt. Die Welt ist das Produkt des Gesites; entweder des individuellen Geistes oder des unendlichen Geistes.
d. Deismus
Der Deismus ist die Religion einen abwesenden Gottes. Er lehrt, dass Gott persönlich, unendlich und der Schöpfer aller Dinge ist. Aber er lehrt auch, dass Gott absichtlich und bewusst seine Schöpfung nach ihrer Vollendung im Stich gelassen hat. Er wollte, dass sie von ihren eigenen Kräften sich selbst erhält und vorangetrieben wird. Also ist Gott transzendent, aber er ist nicht immanent. Er hat die Erde sich selbst überlassen - deswegen kommt auch keine besondere Offenbarung von Gott, wie z. B. die Bibel. Es gibt also einen Gott im Deismus, aber er ist abwesend.
e. Monismus
Der Monismus lehrt, dass das Universum eine begrenzte, unvollständige, erschaffene Erscheinungsform des göttlichen Lebens ist. Jede Existenz und alle Aktivitäten, einschließlich der physischen, psychischen und geistlichen Wesen und der Entwicklung des Universums, kann durch ein einziges grundlegendes Prinzip oder eine grundlegende Substanz erklärt werden.
Der Monismus widerspricht sowohl dem Dualismus als auch dem Pluralismus. Gott ist weder transzendent noch persönlich; er ist begrenzt und unpersönlich.
Es gibt drei Arten von Monismus. Der idealistische Monismus lehrt, dass das Prinzip oder die Substanz das persönliche Leben ist. Der materialistische Monismus lehrt, dass das Prinzip physisch oder Materie ist. Der pantheistischer Monismus lehrt, dass Erscheinungen eine Ausdruckform eines unpersönlichen Gottes sind.
f. Dualismus
Der Dualismus lehrt die radikale Zweiteilung der Natur. Er glaubt nicht an einen persönlichen Gott, sondern an zwei Naturkräfte.
Es gibt vier verschiedene Arten von Dualismus. Der theologische Dualismus kennt zwei ewige, einander entgegengesetzte Prinzipien oder göttliche Wesen: Gut und Böse bzw. Gott und Satan. Der philosophische Dualismus lehrt, dass das Universum aus zwei unabhängigen, nicht voneinander zu trennenden und unverringerbaren Elementen besteht. Der psychologische oder psychophysische Dualismus sagt, dass Körper und Geist zwei verschiedene, unabhängige Existenzen sind. Gott ist die Seele der Welt; die Seele ist nicht das Leben des Körpers, sondern hat eine eigene Existenz. Der ethische Dualismus lehrt ein Moralsystem, das ein bestimmtes Verhalten gegenüber seinem Nächsten
in der gleichen sozialen Gruppe verlangt und rechtfertigt, aber ein anderes Verhalten gegenüber anderen Menschen.
g. Pluralismus
Der Pluralismus ist das gleiche wie der Dualismus, hat aber drei oder mehr Elemente und verneint die wesentliche Einheit der Welt.
h. Dynamismus
Der Dynamismus lehrt, dass Glücksbringer und Amulette das einzig Wahre sind.
i. Fetischismus
Der Fetischismus glaubt, dass mächtige Geister materielle Gegenstände bewohnen.
j. Animismus
Der Animismus ist der Glaube an Naturgeister.
2. Fünf atheistische Ansichten
Es gibt fünf Sichtweisen, die die Existenz Gottes abstreiten und auf einer atheistischen Weltanschauung beruhen.
a. Allgemeiner Atheismus
Der allgemeine Atheismus erklärt einfach, dass es keinen Gott gibt. Diese Form des Atheismus wird in Epheser 2,12 erwähnt. Die Existenz Gottes wird offen und ausdrücklich geleugnet. Für Atheisten kann das materielle Universum durch Zufall entstanden sein, und es kann auch ewig sein.
Es gibt zwei Formen des allgemeinen Atheismus. Die erste Form wird auch praktischer Atheismus genannt und lehrt eine Existenz ohne Gott. Man lebt das Leben so, als ob es keinen Gott gäbe. In Psalm 10,4; 14,1 und 53,2 beschreibt die Bibel die Anhänger dieser Form des Atheismus als böse und stolze Narren.
Die zweite Form des allgemeinen Atheismus wird spekulativer oder theoretischer Atheismus genannt und wird unterteilt in den dogmatischen Atheismus, den skeptischen Atheismus und den praktischen Atheismus. Der dogmatische Atheismus lehnt die Existenz Gottes kategorisch ab und stellt diese Annahme als Tatsache dar. Die menschliche Wahrneh-
mung ist definitiv nicht in der Lage, die Existenz Gottes festzustellen oder zu beweisen, weil es ihn schlicht nicht gibt. Der skeptische Atheismus bezweifelt die Existenz Gottes. Jeder Beweis, auf den sich Menschen stützen, um die Existenz Gottes zu beweisen, wird als unzureichend verworfen. Er bezweifelt die Fähigkeit des menschlichen Verstandes zu wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Der praktische Atheismus hält an Prinzipien fest, die mit dem Glauben an Gott unvereinbar sind. Er definiert Gott in Begriffen, mit denen seine wesenhafte Existenz geleugnet wird. Seine Erklärung des Universums schließt das Handeln eines Schöpfers oder Erhalters aus. Charles Darwin war ein praktischer Atheist.
b. Agnostizismus
Der Agnostizismus besagt, dass es keine ausreichende Grundlage für die Bejahung oder Verneinung der Existenz Gottes. Der Mensch ist einfach nicht fähig, irgendetwas außerhalb der natürlichen Phänomene zu erkennen. Die Frage ist natürlich, wie ein Agnostiker so etwas wissen kann. Der Agnostizismus ist in gewisser Weise logisch widersprüchlich. Jedenfalls sagt der Agnostizismus, dass der Mensch nur durch Analogie etwas erkennen kann. Es gibt keine Analogie zwischen etwas Begrenztem und etwas Unbegrenzten; deshalb gibt es keine Gotteserkenntnis. Aber die Bibel sagt, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde, und deshalb gibt es dort eine Analogie. Der Mensch lernt nicht nur durch Analogien, sondern auch durch Unterschiede und Gegensätze. Der Agnostiker sagt, dass der Mensch nur das erkennen kann, was er in seiner Gesamtheit erfassen kann. Wenn Gott existiert, dann ist er unbegrenzt und weil das Begrenzte das Unbegrenzte nicht erfassen kann, kann der Mensch nicht wissen, ob Gott existiert. Es stimmt, dass der Mensch kein vollständiges Wissen über irgendetwas hat, aber trotzdem kann ein Teilwissen immer noch ein echtes Wissen sein. Der Agnostiker verlässt sich oft auf das, was nur Teilwissen ist.
c. Materialismus
Der Materialismus lehrt, dass das Universum mit den Atomen gleichzusetzen ist. Man kann alle menschlichen Erfahrungswerte dadurch erklären, indem man sie in Bezug setzt zu den Wirklichkeiten, den Wesensverwandtschaften und den Gesetzen der physischen und materiellen Substanz. Der Materialismus streitet die Notwendigkeit der Annahme ab, dass Gott ein absoluter Geist ist. Er ignoriert die Unterscheidung zwischen Geist und Materie und bezieht alle Phänomene auf der Welt, seien
es physische, vitale oder psychische, auf die Funktion von Materie. So wird der Materie der Vorrang vor dem Geist gegeben.
d. Idealismus
Der Idealismus lehrt, dass das Universum aus Kraft plus Vorstellungen besteht. Er erklärt das ganze Universum als eine Zusammenstellung von Vorstellungssystemen. Die fortschreitende Evolution führt dann also zum Ideal selbst. Nichts existiert außer dem Gedanken oder Eindruck, den der Geist hervorbringt. Daher wird dem Geist Vorrang vor der Materie eingeräumt.
e. Positivismus
Der Positivismus lehrt, dass die menschliche Erkenntnis auf physikalische Phänomene begrenzt ist. Die Sinne sind die einzige Erkenntnisquelle. Nur die Materie existiert. Darum ist das Metaphysische unmöglich, und Phänomene stehen durch die Naturgesetze miteinander in Bezug.
Das sind die atheistischen Sichtweisen, die der biblischen Sicht der Existenz Gottes gegenüberstehen. Einige von ihnen sind auch heute noch sehr verbreitet.
E. Fragen und Lernanregungen
Frage 1:
Im Verlauf unseres Lebens entwickeln wir alle eine Vorstellung davon, was wir als das höchste Gut im Leben betrachten. Für manche ist das höchste Gut die soziale Gerechtigkeit. Für andere ist es das Streben nach Glück, nach Bildung oder körperlicher Kraft. Für andere wiederum ist es die Familie. Was ist Ihr höchstes Gut? Lesen Sie jetzt Jeremia 9,22-23. Was bezeichnet Gott in diesen Versen als das höchste Gut im Leben? Sind Sie der Meinung, dass Gott zu erkennen eine so wertvolle Betätigung ist, dass Sie bereit sind, alle anderen Ziele aufzugeben, um ihn zu erkennen? Welche Vorzüge hat es, Gott zu erkennen?
Frage 2:
Das kosmologische Argument beruht auf der einfachen Tatsache, dass Dinge existieren. Sogar die Wissenschaft, die von einem atheistischen Weltbild bestimmt wird, erkennt die Tatsache an, dass das Universum einen Anfang hatte. Wie beweist die Tatsache, dass es einen Anfang gab, die Existenz Gottes? Lesen Sie Psalm 19,2; Psalm 97,6 und Kolosser 1,16 und versuchen Sie, aus diesen Versen Gottes Sichtweise und den Grund herauszuarbeiten, warum er den Himmel und die Erde geschaffen hat.
Frage 3:
In den letzten Jahren hat man sich immer mehr darum bemüht, auf anderen Planeten Bedingungen zu finden, die die Existenz von Leben zulassen, was riesige Geldsummen verschlungen hat. Bis jetzt haben die Ergebnisse immer die Tatsache bestätigt, dass Hunderte von Bedingungen gegeben sein müssen, damit Leben existieren kann. Das System, das uns das Leben auf der Erde ermöglicht, ist hochkomplex. Wie lässt sich damit die Existenz Gottes beweisen?
Frage 4:
Selbst diejenigen, die nicht an die Existenz Gottes glauben, sind sich einig, dass Adolf Hitler ein böser Mensch war. Aber wie können sie zu einer solchen Schlussfolgerung kommen, wenn sie nicht an einen obersten Richter über Recht und Unrecht glauben? Lesen Sie Römer 2,14-15 und finden Sie heraus, wie Gott diese Frage beantwortet.
Frage 5:
Lesen Sie 1. Petrus 3,15-16. Da unsere Hoffnung abhängig ist von der Existenz Gottes - was müssen wir tun, um das Gebot in diesem Gedankengang des Petrus anzuwenden?
Frage 6:
Wie hilft uns das Studium der verschiedenen Weltanschauungen dabei, 1. Petrus 3,15-16 anzuwenden?
Kapitel III
Die Namen Gottes
Jeder einzelne der Namen Gottes offenbart etwas über seine Person und sein Wirken. Das Studium dieser Namen ist deshalb wichtig, wenn wir ein umfassendes Verständnis davon entwickeln wollen, wer Gott wirklich ist. Deshalb werden wir uns verschiedene Namen Gottes anschauen und uns mit ihren Bedeutungen, Auswirkungen und Anwendungen beschäftigen.
A. Hebräische Hauptnamen
Die erste Kategorie der Namen Gottes beinhaltet die drei hebräischen Hauptnamen: JHWH, Elohim und Adon (bzw. Adonaj).
1. JHWH oder JHVH
Der häufigste Name Gottes im hebräischen Text besteht aus vier hebräischen Buchstaben, die im Deutschen die vier Buchstaben JHWH ergeben. Dieser Name Gottes wird auch als „Tetragramm“ bezeichnet, was „vier Buchstaben“ bedeutet. Er kommt ca. 7.000 Mal im Alten Testament vor. Es ist nicht ganz sicher, wie dieser aus vier Buchstaben bestehende Name genau ausgesprochen wurde, denn das jüdische Volk weigerte sich, diesen Namen Gottes auszusprechen. Um das Gebot aus 2. Mose 20,7 („Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen“)
zu beachten, sprachen sie an diesen Stellen ein anderes hebräisches Wort aus, das „Herr“ bedeutet. Im Laufe der Zeit geriet die richtige Aussprache dieses Namens Gottes JHWH in Vergessenheit. Die fundierteste Vermutung ist, dass man es Jahwe aussprechen muss, und das ist höchstwahrscheinlich richtig, aber es bleibt eine Vermutung. Das Tetragramm wird in den deutschen Bibeln unterschiedlich wiedergegeben, z.B. als Jehova oder auch Jahwe, meistens aber mit Herr oder HERR bzw. HErr, selten mit GOTT in vier Großbuchstaben. Der hebräische Buchstabe Waw wurde zu biblischen Zeiten als „w“ und im modernen Hebräisch als „v“ ausgesprochen. Deshalb schreibt man das Tetragramm meistens JHWH, manchmal aber auch JHVH.
a. Die Bedeutung des Namens
Die Grundbedeutung von JHWH steht in 2. Mose 3,14: Da sprach Gott zu Mose: „Ich bin, der ich bin.“ Dann sprach er: So sollst du zu den Kindern Israel sagen: Der „Ich bin“ hat mich zu euch gesandt.
Die Wurzel dieses Namens Gottes ist das hebräische Wort hajah. Es bedeutet „sein“ oder „existieren“. Es erscheint normalerweise in der dritten Person und klingt dann an an JHWH, was übersetzt werden kann mit: „Er ist, der er ist“. Aber in 2. Mose 3,14 erscheint es in der ersten Person, nämlich in der Formulierung: „ehjeh ascher ehjeh“, was bedeutet: „Ich bin der ich bin“. Dieser Name Gottes beinhaltet, dass Gott ständig ins Dasein tritt. Die Betonung liegt auf der Existenz – nicht einer statischen Existenz, sondern einer dynamischen Existenz. Der Name drückt aus, dass Gott der ewige, selbst existierende Eine ist.
Der Name wird auch in 2. Mose 6,2-3 gebraucht:
2 Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin Jahwe. 3 Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige; aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben.
Laut dieser Bibelstelle kannten Abraham, Isaak und Jakob den Namen Gottes JHWH nicht. Sie kannten Gott als den allmächtigen Gott (El Shaddaj), aber nicht als Jahwe oder JHWH. Das erscheint etwas seltsam, denn wenn man das erste Buch Mose durchliest, reden Abraham, Isaak und Jakob ihn alle mit JHWH an. Das hebräische Wort für erkennen bedeutet „aus Erfahrung wissen“. Aus dem ersten Buch Mose wird ziemlich deutlich, dass sie tatsächlich wussten, dass Gottes Name aus diesen vier hebräischen Buchstaben bestand. Also meinte Moses damit, dass diese Patriar-
chen ihn nicht als JHWH erlebt hatten, sondern als den allmächtigen Gott d.h. El Schaddaj.
b. Die Merkmale des Namens
Der Name JHWH beinhaltet fünf Merkmale. Erstens unterstreicht er Gott als denjenigen, der seine Bündnisse hält und bewahrt. Die Unveränderlichkeit Gottes in seiner Beziehung zu Israel bedeutet, dass er sich an die Bündnisse hält. So hat er sich den Patriarchen vorgestellt. Obwohl Abraham, Isaak und Jakob den Namen Gottes kannten, haben sie diesen Aspekt des Namens nicht erlebt, denn sie starben, bevor sich der abrahamitische Bund erfüllt hat. Sie erlebten vielmehr den Aspekt eines anderen Namens, nämlich El Schaddai, d.h. Gott, der Allmächtige, der die Autorität und Macht hat, Bündnisse zu schließen. Sie kannten also den Namen JHWH, aber sie erlebten nicht den errettenden Aspekt in der Bedeutung des Namens. Ein Merkmal des Namens JHWH besteht also darin, dass es der Bundesname Gottes ist; der Name bringt die gesamte Offenbarung Gottes in seiner Beziehung zu Israel zum Ausdruck. Einige Bibelstellen, die Gott, JHWH, als den Halter und Bewahrer der Bündnisse hervorheben, sind 2. Mose 10,3; 20,1-2 und Jeremia 31,31-34.
Ein zweites Merkmal des Namens JHWH liegt in seiner Einzigartigkeit; kein anderer Gott hat diesen Namen. 2. Mose 20,7 betont die Tatsache, dass es Gottes einzigartiger Name ist; er wird ihn keinem anderen geben. Die gleiche Betonung wird in Psalm 8,2; 48,11; 76,2 und in Jesaja 42,8 vorgenommen.
Das dritte Merkmal des Namens JHWH besteht darin, dass er mit seinen göttlichen Eigenschaften zu tun hat. In 2. Mose 33,19 verspricht Gott Mose:
Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen: Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme.
Was Gott Mose in 2. Mose 33,19 versprochen hatte, das erfüllte er in 2. Mose 34,5-7:
5 Da stieg der Herr in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. 6 Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, 7 der Gnade bewahrt an Tausenden
von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation.
Diese Verse betonen eindeutig die Verbindung des Namens JHWH mit seinen göttlichen Eigenschaften, die alle auf eine bestimmte Weise mit der Einzigartigkeit seines Namens verbunden sind. Aber seine Heiligkeit wird am häufigsten herausgestellt. Einige Beispiele dafür sind 3. Mose 11,44-45; 19,1-2 und 20,26.
Das vierte Merkmal des Namens JHWH weist darauf hin, dass Gott die Sünde hasst. Das finden wir in 1. Mose 6,3-6; 2. Mose 34,6-7 und Psalm 11,5-6.
Das fünfte Merkmal dieses Namens betont sein Erlösungswerk. Einige Beispiele sind 1. Mose 3,15, 2. Mose 12,12-14 und Jesaja 53,1.6.10.11
2. Elohim
Der zweite Hauptname, Elohim, erscheint im hebräischen Text in drei Formen. Erstens finden wir ihn als El, was eine Einzahlform ist. Der Name wird ungefähr 250 Mal gebraucht, hauptsächlich in den poetischen Abschnitten des Alten Testaments. Einige Beispiele dieser Form finden wir in Hiob 5,8; 9,2; 15,4.
Die zweite Form derselben Wurzel ist auch eine Einzahlform, Eloah, und bedeutet: „Gott“. Es wird nicht sehr oft gebraucht und findet sich vor allem in der poetischen Literatur wie z. B. Hiob 9,13; 31,6.
Die dritte und mit Abstand am meisten vorkommende Form dieses Namens Gottes ist Elohim. Das ist die Pluralform, die sowohl für den wahren Gott als auch für falsche Götter gebraucht wird. Wenn es für den wahren Gott gebraucht wird, wurde es in der Bibel als Substantiv im Singular übersetzt – Gott. Wird es nicht für den wahren Gott gebraucht, wurde es als Substantiv im Plural übersetzt – Götter. Elohim finden wir 2.555 Mal im Alten Testament. In den meisten Versen, in denen Elohim vorkommt, bezieht es sich auf den wahren Gott, aber dasselbe Wort wird auch für die heidnischen Götter verwendet (1Mo 31,30; 2Mo 12,12; Ri 5,8; Ps 82,1; 96,5; 97,7).
11 Frage 1 auf Seite 56.
a. Der Ursprung des Namens
Der Name Elohim hat seinen Ursprung in zwei verschiedenen hebräischen Wortstämmen. Der erste Wortstamm bedeutet „stark und mächtig sein“. Der zweite Wortstamm bedeutet „von Furcht ergriffen sein“. Wenn man beide Wortstämme miteinander verbindet, dann lautet die Bedeutung von Elohim: „der Starke und Mächtige, der zu fürchten ist“.
b. Die Merkmale des Namens
Mit dem Namen Elohim (bzw. El, Eloah) sind drei grundlegende Merkmale verbunden. Erstens betont er Gottes Macht (4Mo 23,22). Zweitens betont er, dass Gott der Schöpfer ist (1Mo 1,1). Drittens betont er, wie Gott ist (Ps 86,15).12
3. Adon oder Adonai
Der dritte hebräische Hauptname Gottes ist Adon als Singularform oder Adonai als Pluralform.
a. Die Bedeutung des Namens
Der Wortstamm von Adon bzw. Adonai bedeutet „richten“ oder „herrschen“. Es handelt sich um ein Wort mit drei grundlegenden Bedeutungen: „Herr“, „Meister“ und „Besitzer“.
Wie schon im Zusammenhang mit dem Namen JHWH erwähnt, hat Adon auch die Bedeutung von „Herr“. In den deutschen Bibeln erkennt man den Unterschied zwischen den beiden hebräischen Begriffen dadurch, dass beim Gebrauch des Tetragramms alle vier Buchstaben mit Großbuchstaben bzw. Kapitälchen übersetzt werden, d.h. HERR bzw. Herr. Wenn das Wort Adon für Gott gebraucht wird, dann steht in der deutschen Übersetzung nur der erste Buchstabe als Großbuchstabe: Herr. Adon wird, wie auch der Name Elohim, nicht nur für Gott gebraucht. Wenn es für den Menschen gebraucht wird, lautet die Übersetzung trotzdem „Herr“ in normaler Schreibweise. Adon kann einen Menschen im Sinne von „Meister“ meinen, wie in 4. Mose 11,28 und 5. Mose 23,16. Es kann sich auch auf einen Menschen im Sinne von „Besitzer“ beziehen, wie in 1. Könige 16,24. Aber in den meisten Fällen, wo der Name in seiner Pluralform steht, bezieht er sich auf den wahren und einzigen Gott.
12 Lernanregungen 1 auf Seite 56.
Auch wenn der Name Adon allein verwendet wird, wie in 5. Mose 10,17 und Josua 5,14, so finden wir Adonai manchmal auch in einem Vers zusammen mit JHWH, wie in 2. Mose 4,10 und Maleachi 1,6, oder sogar in direkter Verbindung miteinander, wie in Richter 6,22 oder Jesaja 25,8. In diesen Fällen, wenn er zusammen mit dem Tetragramm gebraucht wird, lautet die Übersetzung z.B. „Herr, Herr“ oder auch „GOTT, der Herr“, vgl. B.2: Adonaj JHWH.
b. Die Merkmale des Namens
Das erste Merkmal verdeutlicht die grundlegende Bedeutung von „Herr“. Gott ist der allmächtige Herrscher, dem alles unterworfen ist und zu dem der Mensch als Diener in Beziehung steht.
Das zweite Merkmal betont die grundlegende Bedeutung von „Meister“. Gott hat als der Meister das Recht, Gehorsam zu erwarten. Da dieser Name die Beziehung eines Knechtes zu seinem Herrn bzw. seinem Meister betont, hat der Meister offensichtlich jeden Anspruch darauf, dass seine Diener ihm vollkommen gehorsam sind. Wenn die Gläubigen die Diener Gottes sind und wenn Gott tatsächlich ihr Meister ist, dann hat er als ihr Meister auch jedes Recht, absoluten Gehorsam zu erwarten. Also ist es in Bezug auf diesen Namen die Pflicht der Gläubigen, ihrem Herrn zu gehorchen und die Gebote zu befolgen, die er ihnen gegeben hat. Sie können seine Gebote entweder aus einer Furcht heraus befolgen, womit die Bedeutung von Elohim stärker betont wird. Oder sie können seinen Geboten aus Liebe gehorchen, so wie Jeschua selbst seine Jünger in Johannes 14,15 lehrte: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Die Antwort auf die Frage, die oft gestellt wird: „Wie können Gläubige ihre Liebe zu Gott zeigen?“, lautet also: „Kinder Gottes zeigen ihre Liebe zu Gott nicht durch eine Emotionalität. Sie zeigen ihre Liebe zu Gott durch ihren Gehorsam“. Das ist die Art und Weise, wie Jeschua seine Liebe zum Vater gezeigt hat. Er gehorchte seinem Vater; er lernte den Gehorsam. Auf diese Weise sollen Kinder Gottes ihre Liebe zum Vater zeigen.
Das dritte Merkmal dieses besonderen Namens entwickelt sich aus den ersten beiden Namen heraus, nämlich, dass der Diener Anspruch auf Anweisungen hat. Der Meister hat das Recht, Gehorsam zu erwarten, aber der Diener hat das Recht, Anweisungen zu erwarten. Darin besteht Gottes Verantwortung, wenn er das erfüllen möchte, wofür sein Name steht. Wenn er wirklich der allmächtige Herrscher ist, dem alles unterworfen ist und zu dem der Mensch als Diener in Beziehung steht, dann hat sein Diener das Recht darauf, Anweisungen von seinem Herrn
zu erwarten. In der Tat hat der Herr den Gläubigen durch die Heilige Schrift Anweisungen gegeben. Das bedeutet also: Gott hat den Gläubigen Gebote und Prinzipien gegeben, die sie befolgen sollen, und das ist ihre Pflicht in Bezug auf den Namen Adonai. Aber als Diener Adonais haben die Gläubigen das Recht darauf, Anweisungen zu erwarten, die sie auch tatsächlich durch das Wort Gottes erhalten haben.13
B. Zusammengesetzte Hauptnamen Gottes
In der zweiten Kategorie der Namen Gottes geht es um die Zusammensetzung der drei Hauptnamen JHWH, Elohim und Adonai auf zwei Arten: JHWH Elohim und Adonai Elohim.
1.
JHWH Elohim
Dieser Doppelname wird in der Regel mit „Gott, der Herr“ übersetzt. Der Begriff „Herr“ hat hier vier Großbuchstaben bzw. Kapitälchen und zeigt damit an, dass das hebräische Wort hier der Name Gottes mit den vier Buchstaben ist, JHWH, während der Begriff „Gott“ das Wort Elohim wiedergibt. Beispiele für diese zusammengesetzten Hauptnamen als „Gott, der Herr“ sind 1. Mose 2,4-5.7-9.15-16.18-19.21-22.
Der Doppelname JHWH Elohim hat zwei Beziehungen: die erste ist die Beziehung Gottes zur Menschheit im Allgemeinen und die zweite ist seine Beziehung zu Israel im Besonderen.
Wenn man sich Gottes Beziehung zur Menschheit anschaut, fallen vier Aspekte auf. Der erste Aspekt ist der des Schöpfers, den man in 1. Mose 2,7-15 sehen kann. Der Zusammenhang dieser Verse ist die Erschaffung des Menschen durch Gott, und da der Doppelname JHWH Elohim hier so häufig gebraucht wird, wird er damit als der Schöpfer des Menschen hervorgehoben.
Der zweite Aspekt dieses Doppelnamens ist, dass Gott die Autorität über seine Schöpfung hat. In 2. Mose 2,16-17 gibt Gott den Menschen seine Anweisungen. Er gibt ihnen Gebote und sagt ihnen, was sie tun und was sie nicht tun dürfen, und zeigt damit, dass er die Autorität über den Menschen hat.
13 Frage 2 auf Seite 56.
Der dritte Aspekt betont, dass Gott die Beziehungen der Menschen untereinander und zu Gott erschafft und bestimmt (1Mo 2,18-24; 3,16-24).
Der vierte Aspekt betont, dass Gott der Erlöser ist (1Mo 3,8-15.21). Unter diesem zusammengesetzen Hauptnamen versprach Gott, den Erlöser zu schicken, den Samen der Frau, der eines Tages das Problem der Sünde, das in die Menschheit eingedrungen war, endgültig lösen würde.
Die zweite Beziehung, die dieser Doppelname betont, ist die Beziehung Gottes zu dem Volk Israels. Davon finden wir Beispiele in 1. Mose 24,7; 2. Mose 3,15-18; 5. Mose 1,11.21; Josua 7,13.19-20; Richter 5,3.
2. Adonai JHWH
Diese Kombination wird auch unterschiedlich übersetzt. Oft steht in den deutschen Bibeln „Herr, Herr (oder HERR)“, in anderen aber auch „Gott, der HERR“ oder „GOTT, der Herr“. Wenn bei dem Begriff „Herr“ nur erste Buchstabe als Großbuchstabe steht, verbirgt sich dahinter das hebräische Wort Adonai. Das Wort Herr bzw. HERR oder GOTT (nur in Großbuchstaben) gibt dagegen den Namen JHWH wieder.
Beispiele dieses Doppelnamens finden wir in 1. Mose 15,2; 2. Samuel 7,18-20; Jesaja 7,7; Jeremia 1,6.
Worin liegt die Betonung bei der Kombination dieser beiden Hauptnamen? Der Name Adon oder Adonai betont, dass Gott der Meister, Eigentümer oder Herr ist. Also betont der erste Name dementsprechend, dass er derjenige ist, der die Kontrolle über sein Universum und seine Schöpfung hat. Der Name JHWH betont, dass Gott seine Bündnisse hält und bewahrt. Wenn diese beiden Hauptnamen miteinander verbunden werden, betonen sie, dass Gott derjenige ist, der die Macht und die Stärke hat, seine Bündnisse zu erfüllen, weil er über alles die völlige Kontrolle hat. Der alleinstehende Name JHWH betont u.a. ja, dass Gott seine Bündnisse hält und bewahrt, aber er kann manchmal auch lediglich seine Absicht betonen, die Bündnisse zu erfüllen. Hätte er aber nicht die Macht oder die Kontrolle darüber, sein Wort zu erfüllen, dann hätten seine besten Absichten wenig praktischen Wert. Die Kombination dieser beiden Namen betont also die Tatsache, dass Gott seine Bündnisse hält und bewahrt, und dass er aufgrund seiner Macht, Kraft und Kontrolle über seine Schöpfung auch in der Lage ist, seine Bündnisse endgültig zu erfüllen.
Ein gutes Beispiel für dieses Konzept finden wir in 2. Mose 2,23-25, wo Gott verspricht, dass er etwas auf der Grundlage des abrahamitischen Bundes tun wird:
Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Kinder Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel, und Gott kümmerte sich um sie.
Hier wird sehr deutlich, dass Gott seine Bündnisse hält und bewahrt und dass er an dieser Stelle auch beabsichtigt, seinen Bund zu erfüllen. Normalerweise ist es der Name JHWH, der betont, dass Gott derjenige ist, der seinen Bund halten und bewahren wird, und Adonai betont seine Macht, das auch tun zu können. In diesem Abschnitt wird dieser Inhalt jedoch mit dem allgemeineren Name Elohim zum Ausdruck gebracht.
In 2. Mose 3,6-8 sagte Gott zu Moses:
6 Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 7 Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Schreien wegen seiner Antreiber habe ich gehört; ja, ich kenne seine Schmerzen. 8 Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hewiter und Jebusiter.
Die Einzigartigkeit des zusammengesetzten Hauptnamens Adonai JHWH besteht darin, dass er Gott sowohl als den Halter und Bewahrer der Bündnisse als auch als denjenigen hervorhebt, der die große Macht hat, um diese Bündnisse zu erfüllen.
C. Weitere hebräische Doppelnamen
In diesem Abschnitt schauen wir uns die hebräischen Hauptnamen an, auf die ein anderer hebräischer Begriff folgt, wodurch ein Wesenszug Gottes dargestellt wird. Der Abschnitt wird in zwei Kategorien unterteilt: die hebräischen Namen, die mit JHWH verbunden sind, und diejenigen, die mit Elohim.
1. Die hebräischen Doppelnamen mit JHWH
Insgesamt nennen wir zehn Doppelnamen aus der hebräischen Bibel, die den Namen JHWH enthalten.
a. JHWH Zebaoth
Der erste Name ist JHWH Zebaoth, was Herr der Heerscharen bedeutet. Das Wort Heerscharen bedeutet „Armeen“, gemeint sind die himmlischen Armeen. Einige Beispiele dieses Doppelnamens sind 1. Samuel 1,3; 4,4; Jesaja 6,3; Hosea 12,6. Dieser Name betont zweierlei: erstens weckt er Vertrauen (1Kö 18,15; Ps 46,8.12), zweitens gewährt Gott Israel besondere Hilfe ( Jes 1,9; 10,24-27; 31,4-5; Hag 2,4; Mal 3,16-17; 1Kö 19,14, wobei hier JHWH Elohim Zebaoth steht).
b. JHWH Jireh
Der zweite hebräische Doppelname ist JHWH Jireh, was „der Herr wird ersehen“ oder „der Herr wird (dafür) sorgen“ bedeutet. Er betont, dass Gott derjenige ist, der für das Opfer sorgen wird. Der Name meint nicht eine allgemeine Versorgung, sondern dass Gott für ein stellvertretendes Blutopfer sorgen wird. Der Name befindet sich in 1. Mose 22,14.
c. JHWH Rofeka
Der dritte hebräische Doppelname ist JHWH Rofeka, bedeutet „der Herr, der dich heilt“ bzw. „dein Arzt“ und betont, dass Gott sowohl physisch als auch geistlich heilt. Dieser Name befindet sich in 2. Mose 15,26.
d. JHWH Nissi
Der vierte hebräische Doppelname ist JHWH Nissi, bedeutet „der Herr mein Feldzeichen“ bzw. „Banner“ oder „Panier“ und betont, dass Gott derjenige ist, der beschützt. Dieser Name befindet sich in 2. Mose 17,15.
e. JHWH Mekaddischkem
Der fünfte hebräische Doppelname ist JHWH Mekaddischkem, was „der Herr, der euch heiligt“ bedeutet und Gott als denjenigen betont, der zur Heiligung absondert. Dieser Name befindet sich in 2. Mose 31,13 und 3. Mose 20,7-8.
f. JHWH Schalom
Der sechste hebräische Doppelname lautet JHWH Schalom und bedeutet „der Herr ist Friede“. Er betont die Tatsache, dass Gott trotz aller Widrigkeiten Frieden schenkt. Dieser Name befindet sich in Richter 6,24.
g. JHWH Roi
Der siebte hebräische Doppelname ist JHWH Roi und bedeutet „der Herr, mein Hirte“. Er betont, dass Gott derjenige ist, der bewahrt und beschützt. Der Name wird in Psalm 23,1 gebraucht.
h. JHWH Zidkenu
Der achte hebräische Doppelname ist JHWH Zidkenu und bedeutet „der Herr, unsere Gerechtigkeit“. Er betont, dass Gott derjenige ist, der im messianischen Reich in Gerechtigkeit regieren wird. Dieser Name befindet sich in Jeremia 23,6 und 33,16.
i. JHWH Makke
Der neunte hebräische Doppelname ist JHWH Makke. Er bedeutet „der Herr zerschmettert“ und betont, dass Gott derjenige ist, der die Sünde bestraft. Dieser Name wird in Hesekiel 7,9 gebraucht.
j. JHWH Schamma
Der zehnte hebräische Doppelname ist JHWH Schamma. Er bedeutet „der Herr ist hier“ und betont die Gegenwart Gottes. Dieser Name befindet sich in Hesekiel 48,35.
2. Die hebräischen Doppelnamen mit Elohim bzw. El
Die zweite Kategorie der Doppelnamen beinhaltet den Namen Elohim, auf den ein hebräischer Ausdruck folgt. Es gibt fünf Kombinationen mit dem Wort Elohim.
a. El Schaddai
Der erste Doppelname ist El Schaddai und bedeutet „der allmächtige Gott“. Er wird insgesamt 48 Mal im Alten Testament gebraucht. Der Begriff Schaddai hat zwei Wurzeln. Die erste Wurzel bedeutet „mächtig sein“ und betont die Tatsache, dass er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Es stellt Gott als denjenigen dar, dem alle Naturgewalten unterworfen sind und der sie dem Wirken der göttlichen Gnade unterordnet. Die zweite Wurzel für das Wort Schaddai ist „Brust“ und betont, dass Gott derjenige ist, der nährt und erhält. Als der Allgenügende ist er die Quelle des Segens und des Trostes. Als Doppelname betont El Schaddai also die Größe Gottes. Dieser Name setzt Gott mit den Segnungen seiner Bündnisse in Beziehung. Es war ein sehr früher Name für Gott, den vor allem die Patriarchen aus eigener Erfahrung kannten; er wird gebraucht in 1. Mose 17,1; 28,3; 2. Mose 6,3.
b. El Elyon
Der zweite Doppelname ist El Elyon und bedeutet „Gott, der Allerhöchste“. Das Wort Elyon kommt von einer hebräischen Wurzel, die „erhöht sein“ bedeutet. In erster Linie wird damit Gott als der Erhabene betont. Von dieser Hauptbetonung leitet sich eine weitere Betonung ab, die hervorhebt, dass Gott der souveräne Herrscher über den Himmel ( Jes 14,13-14) und über die Erde ist (2Sam 22,14-15; Ps 21,8; 83,17-19; 91,9-12). Drittens wird Gottes Beziehung zu den Nationen betont (1Mo 14,18-19; 4Mo 24,16; 5Mo 32,8-9).
c. El Olam
Der dritte Doppelname ist El Olam und bedeutet „der ewige Gott“. Die Wurzel für das hebräische Wort Olam bedeutet „(Zeit)alter“ oder „verborgen“. El Olam betont, dass Gott der Gott der Ewigkeit, der Gott der Zeitalter ist und dass er derjenige ist, der souverän über Zeit und Ewigkeit herrscht. Beispiele dafür finden wir in 1. Mose 21,33 und Jesaja 40,28.
d. El Rohi
Der vierte Doppelname ist El Rohi und bedeutet „der Gott des Sehens“. Er betont Gott als denjenigen, der Wache hält. Dieser Name wird in 1. Mose 16,13 verwendet.
e. El Gmulot
Der fünfte Doppelname ist El Gmulot. Er bedeutet „der Gott der Vergeltung“ und betont ihn als denjenigen, der Rache übt. Dieser Name befindet sich in Jeremia 51,56.14
D. Hebräische Bezeichnungen für Gott
Es gibt eine vierte Kategorie der Namen Gottes, wo hebräische Begriffe für Gott gebraucht werden. Insgesamt gibt es 15 solcher Bezeichnungen, und die meisten davon werden als eine Art Titel gebraucht.
1. Schild in 1. Mose 15,1
2. Richter in 1. Mose 18,25
3. Der Mächtige und der Allmächtige, was seine Allmacht und seine göttliche Hilfe für die von Feinden Unterdrückten in Israel betont, in 1. Mose 49,24 und Ruth 1,20-21
4. Festung in Psalm 18,3
5. Burg in Psalm 18,3
6. Erretter in Psalm 18,3
7. Hirte in Psalm 23,1
8. Schöpfer in Prediger 12,1; Jesaja 40,28; 42,15
9. Der Heilige Israels, was seine besondere Bundesbeziehung zu Israel betont, in Jesaja 1,4
10. Weingärtner in Jesaja 5,1-7
14 Frage 3 auf Seite 56.
11. König in Jesaja 43,15
12. Erlöser in Jesaja 44,6.24
13. Fels in Jesaja 44,8
14. Vater in Jesaja 63,16
15. Ehemann; (Ehe)herr in Jeremia 31,32
E. Namen im Neuen Testament
Im Neuen Testament gibt mehrere zusätzliche Namen, Titel und andere Bezeichnungen für Gott.
1. Griechische Namen
a. Theos
Der erste griechische Name im Neuen Testament lautet Theos, entspricht dem hebräischen Wort Elohim und bringt das Wesen Gottes zum Ausdruck. Es wird über 1000 Mal im Neuen Testament für den wahren Gott gebraucht. Ein Beispiel ist Johannes 1,1. Wie das hebräische Elohim, wird es auch für die heidnischen Götter gebraucht, wie in Apostelgeschichte 28,6 und 2. Thessalonicher 2,4.
b. Kyrios
Der zweite griechische Name im Neuen Testament ist Kyrios und bedeutet „Herr“. Es ist gleichbedeutend mit den beiden Namen JHWH und Adonai im Alten Testament. Die Wurzel für Kyrios bedeutet im Griechischen „Kraft“. Es betont, dass Gott der Allmächtige, der Herr und Besitzer, der Herrscher und derjenige ist, der da ist und der da war und der da kommt (Off 1,4; 2,8; 21,6; 22,13). Das Wort wird sowohl für menschliche (Mt 6,24), als auch für göttliche Beziehungen (Eph 6,9; Kol 4,1) gebraucht. Es wird 650 Mal als Titel für Jeschua gebraucht und identifiziert ihn klar mit Elohim und JHWH im Alten Testament, wie in Matthäus 3,3.
c. Despotes
Der dritte griechische Name im Neuen Testament ist das Wort Despotes und bedeutet „Herr“, „Meister“ und „Besitzer“. Das deutsche Wort Despot kommt von diesem griechischen Wort. Es wird sowohl in Bezug auf Gott, als auch auf den Menschen gebraucht. Wenn es für menschliche Beziehungen gebraucht wird, betont es, dass der Mensch ein Eigentümer ist – insbesondere ein Sklavenhalter (1Tim 6,1-2). Wenn es für Gott gebraucht wird, betont es auch das Konzept des Besitzes. Es wird in Lukas 2,29 und Apostelgeschichte 4,24 für Gott dem Vater und in 2. Petrus 2,1 für den Messias gebraucht.
d. Logos
Der vierte griechische Name im Neuen Testament ist der Begriff Logos und bedeutet „Wort“. Der Wortstamm bedeutet „Gedanke“, „Vorstellung“, „Ausdruck“ oder „Äußerung“. Er wird in Johannes 1,1-14 vom Messias gebraucht. Es betont den Offenbarer in Johannes 1,18, das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes in Johannes 6,46 und Hebräer 1,3 und Jeschua als Verkörperung der göttlichen Weisheit und der kollektiven Gedanken Gottes in 1. Korinther 1,24; Epheser 3,10-11 und Kolosser 2,2-3.
e. Hypsistos
Der fünfte griechische Name im Neuen Testament ist Hypsistos und bedeutet „der Höchste“. Er betont, dass Gott der Höchste im Himmel ist (Mt 21,9). Er wird in Hebräer 7,1 Gott, der Höchste genannt. Es wird in Lukas 1,32 für den Messias gebraucht.
f. Pantokrator
Der sechste griechische Name im Neuen Testament ist Pantokrator, bedeutet „der Allmächtige“ und betont, dass Gott derjenige ist, der allmächtig ist. Das Wort wird nur für Gott gebraucht, z. B. in Offenbarung 1,8.
2. Die Titel der Trinität
Alle drei Titel der Trinität befinden sich in Matthäus 28,19: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
a . Vater
Das griechische Wort für den Titel Vater lautet Pater. Es bezeichnet Gott den Vater auf verschiedene Weise:
✡ Der Vater unseres Herrn Jeschua Messias (2Kor 1,3; Eph 1,3; Kol 1,3)
✡ Der himmlische Vater ( Joh 17,1)
✡ Der Vater der Geister (Hebr 12,9)
✡ Der heilige Vater ( Joh 17,11)
✡ Der gerechte Vater (Joh 17,25)
✡ Der Vater der Lichter (Jak 1,17)
Wenn die erste Person der Trinität Vater heißt, werden damit seine drei Beziehungen betont: erstens als Vater der Schöpfung (1Kor 8,6; Eph 3,14-15); zweitens als Vater des Messias (Lk 2,49); und drittens als Vater der Gläubigen ( Joh 1,12; Röm 8,15; Gal 4,5-6).
b. Sohn
Der zweite Titel der Trinität ist Sohn. Das griechische Wort lautet Hyios und wird speziell für Jeschua Messias unseren Herrn (Röm 1,4) gebraucht. Herr, im Griechischen Kyrios und im Hebräischen Adon, betont, dass er Gott ist. Jesu Name lautet im Hebräischen Jeschua und bedeutet „Rettung“. Es wird im Griechischen als Iesous transliteriert. Dadurch wird betont, dass er ein Mensch ist. „Christus“ (wurde in diesem Vers durch die besser geeignete Bezeichnung „Messias“ ersetzt) wird im Deutschen von dem griechischen Wort Christos transliteriert und bedeutet „Gesalbter“ genauso wie das hebräische Maschiach und das betont sein Amt.
c. Heiliger Geist
Der dritte Titel der Trinität ist der des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat verschiedene Bezeichnungen:
✡ Der Geist Gottes (Röm 8,14)
✡ Der Geist der Wahrheit ( Joh 16,13)
✡ Der Geist des Lebens (Röm 8,2)
✡ Der Geistes des Messias (Röm 8,9)
✡ Der Geist der Sohnschaft (Röm 8,15)
✡ Der Heilige Geist der Verheißung (Eph 1,13)
3. Andere Bezeichnungen
Schließlich gibt es im Neuen Testament noch andere Bezeichnungen Gottes wie z. B. Schöpfer in Römer 1,25, Machthaber in 1. Timotheus 6,15, Hirte in Hebräer 13,20, Aufseher in 1. Petrus 2,25 und König in Offenbarung 15,3.15
15 Lernanregungen 2 auf Seite 57.
F. Fragen und Lernanregungen
Frage 1:
Versuchen Sie, die Konzepte von „kennen“ und „erleben“ zu durchdenken. In welchen Bereichen „kennen“ Sie Gott intellektuell, wenn man das mal so formulieren kann, aber Sie haben ihn nicht „erlebt“?
Lernanregungen 1:
Schauen Sie sich mindestens die in diesem Kapitel erwähnten Verse an, in denen Elohim gebraucht wird, und versuchen Sie, ein gutes Verständnis dieses wichtigen Namens Gottes zu entwickeln. Was sagt das Ihnen darüber, wer Gott ist?
Frage 2:
Was kann Ihnen dabei helfen, Gottes Geboten, so wie wir sie im Neuen Testament finden, zu gehorchen, ohne gesetzlich zu werden?
Frage 3:
Lies Psalm 148,13. Gottes Name ist von höchster Bedeutung. Wer ist er für dich? Gott, der Höchste? Der Gott der Vergeltung? Der ewige Gott? Der ersehen wird? Gott kennt unsere Namen. Sollten wir seine nicht kennen?
Frage 4:
Im Alten Testament wird Gott 15 mal als „Vater“ bezeichnet. Im Neuen Testament wird dieser Titel 245 mal gebraucht. Tatsächlich ist das Jeschuas
Lieblingsname für Gott. Warum denkst du, dass er diesen Namen öfter als die anderen Namen Gottes benutzt?
Lernanregungen 2:
Damit du die Betrachtung der Namen Gottes wirklich verinnerlichen und die Bedeutung, die sie für dein Leben haben können, entwickeln kannst, empfehlen wir dir, dass du alle genannten Namen aufschreibst. Warum lernst du sie nicht auswendig, damit du während deiner nächsten Gebetszeit Gott mit seinen anderen wunderbaren Namen ansprechen kannst?
Es gibt einige weitere Bibelstellen, die sich mit der Eigenschaft beschäftigen, dass Gott wahr ist:
✡ 4. Mose 23,19, wo gesagt wird, dass Gott nicht lügen kann.
✡ Psalm 31,6, wo er der Gott der Wahrheit ist.
✡ Psalm 86,15, wo er groß an Wahrheit ist.
✡ Jeremia 10,10, wo Jehova Gott Wahrheit ist.
✡ Johannes 3,33: Wer sein Zeugnis angenommen hat, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist.
✡ Johannes 17,3, wo er der allein wahre Gott ist.
✡ Römer 3,4, wo er wahrhaftig ist.
✡ 1. Thessalonicher 1,9, wo wir dem lebendigen und wahren Gott dienen.
✡ Titus 1,2 wiederholt, dass Gott nicht lügen kann.
✡ Hebräer 6,18 fügt hinzu: wobei es unmöglich war, dass Gott lügen würde.
✡ Offenbarung 6,10, wo er der Herrscher ist, der du heilig und wahrhaftig bist.
Die Anwendung, die wir von dieser speziellen Eigenschaft Gottes ableiten können, ist dass alle Wahrheit in seiner Wahrheit ist. Alles das, was wirklich wahr ist, ist die Wahrheit Gottes. Egal was ein weltlicher ungläubiger Mensch über die Wahrheit herausfindet – es ist immer noch Gottes Wahrheit. Wenn ein Arzt herausfindet, dass ein bestimmtes Medikament eine besondere Krankheit kurieren kann und das wahr ist, dann ist es Gottes Wahrheit. Egal was ein Wissenschaftler als tatsächliche Wahrheit entdeckt, es ist auch Gottes Wahrheit. Das macht Gottes Wahrheit zur Grundlage für die Wahrheit des Menschen. Es ist die Grundlage für die Wahrheit, die wir entdecken, so dass jede Wahrheit, die wir entdecken in Wirklichkeit Gottes Wahrheit ist.
Weil Gott wahr ist, können wir seinen Verheißungen vertrauen. Wenn Gott lügen könnte, könnten wir ihm nicht vertrauen. Dass Gott wahr ist, bedeutet, dass er nicht fähig ist zu lügen und deswegen können wir darauf vertrauen, was er verheißen hat.
Wir müssen wahrhaftig sein und dürfen nicht lügen (Spr 6,16-17; Mt 5,37). Wir sollten uns durch Wahrhaftigkeit auszeichnen – selbst bei dem, was wir in unsere Steuererklärung schreiben!
Wir können beurteilen, was richtig ist und was nicht (1Joh 4,6). Wir haben die Fähigkeit zu beurteilen, was der Wahrheit entspricht und was nicht.37
37 Lernanregung auf Seite 99.
Nachdem wir die Eigenschaften Gottes besprochen haben, haben wir den ersten Hauptbereich der eigentlichen Theologie abgeschlossen – den Theismus. Der nächste Bereich befasst sich damit, was wir über die Trinität wissen.
E. Fragen und Lernanregungen
Frage 1:
Wie sehr hängt die Existenz Gottes von der Wahrnehmung der Menschheit ab? Macht seine Existenz aus sich selbst unsere Existenz bedeutungslos?
Frage 2:
Mit deinen eigenen Worten: Was bedeutet es, Gott in Geist und Wahrheit anzubeten (Joh 4,24)?
Frage 3:
Lies 2. Mose 20,4-5. Wie kannst du die Wahrheit von Gottes Eigenschaft der Freiheit mit der Tatsache in Einklang bringen, dass er ein eifersüchtiger Gott ist?
Frage 4:
Die Zeit ist Teil von Gottes Schöpfungsakt. Er übersteigt sie. Da Gott Geist ist, lebt er außerhalb des Bereiches der Zeit. Psalm 90,4 und 2. Petrus 3,8 wird oft von denjenigen zitiert, die den Bericht aus 1. Mose mit der Evolutionstheorie verbinden wollen. Wie kannst du mit ihnen argumentieren?
Frage 5:
Wie kann Gottes Unwandelbarkeit Trost in Zeiten der Krankheit und des Todes bringen?
Frage 6:
Bereitet dir die Eigenschaft der Allgegenwart eher Trost oder Unbehagen? Warum?
Frage 7:
Gottes Souveränität wirft einige schwierige Fragen für die Gläubigen auf. Wenn Gott tun kann, was ihm wohlgefällt (Ps 115,3), warum nimmt er dann nicht die Sünde weg? Warum erlaubt er Terroristen, dass sie Gräueltaten in dieser Welt begehen können? In deinem persönlichen Leben fragst du dich vielleicht, warum deine Angehörigen sterben mussten, warum du deine Arbeitsstelle verloren hast oder warum du immer noch unter einer bestimmten Krankheit leidest, wenn du nach seinem Willen gebetet hast. Versuche solide Antworten auf schwierige Fragen wie diese zu finden.
Frage 8:
Welche Rolle spielt Gottes Eigenschaft der Allwissenheit in deinem Verständnis des Schöpfungsberichts?
Frage 9:
Wie kann der Gläubige gemäß 2. Petrus 1,3-11 von Gottes Kraft Gebrauch machen?
Frage 10:
Wie ergeht es dir im Licht der Tatsache, dass Gott gerecht ist? Hilft dir Römer 3,23-26 oder entmutigt es dich in diesem Kontext?
Lernanregungen:
Voller Liebe, gnädig, gütig, wahr – die Eigenschaften, die wir uns gerade angeschaut haben, haben enorme Auswirkungen auf unser Leben. Erstelle eine Liste auf einem anderen Blatt Papier und versuche sie nach Wichtigkeit zu ordnen. Schau dir das Blatt in ein paar Monaten noch einmal an und frage dich, ob du immer noch mit der Reihenfolge übereinstimmst, die du heute aufgeschrieben hast. Kann es sein, dass sich im Lauf der Zeit unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und unsere Situationen so sehr verändern, dass die verschiedenen Eigenschaften uns mehr – oder weniger –wichtig werden?
Maranatha – Unser Herr komme!
Eine umfassende Studie zur Entrückung der Gemeinde
Renald E. Showers ca. 472 Seiten, Hardcover, 2022
€ 16,90
ISBN 978-3-96190-076-3
Renald E. Showers hat über drei Jahre recherchiert, um das Buch Maranatha – Unser Herr komme! zu verfassen. Das Buch beantwortet praktisch alle ihre Fragen über die Entrückung der Gemeinde sowie die wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema der Entrückung.
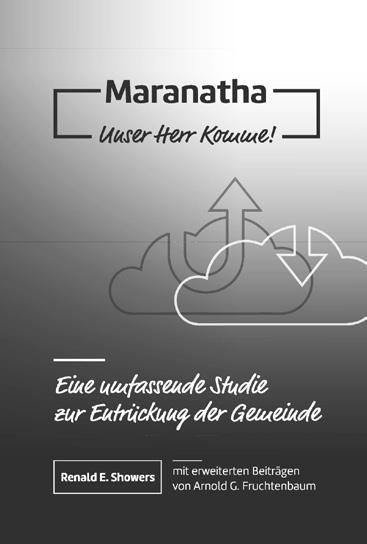
Dr. Renald E. Showers (1935 – 2019) war weithin anerkannt als einer der fundiertesten Theologen in den USA. Der Absolvent der Cairn University verfügte über einen Bachelor Abschluss in Geschichte am Wheaton College, einen Master Abschluss in Kirchengeschichte am Dallas Theological Seminary sowie einen Doktortitel in Theologie am Grace Theological Seminary. Er war internationaler Konferenzsprecher für The Friends of Israel Gospel Ministry und Mitredaktuer der Zeitschrift Israel My Glory.
Blutopfer im Alten Testament – mit abschließendem Essay von Dr. A. Fruchtenbaum
T. Ernest Wilson
160 Seiten, Taschenbuch, 2021
€ 5,90
ISBN 978-3-943175-98-1
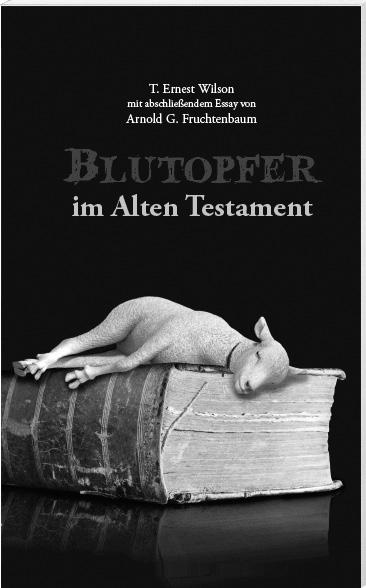
Was haben uns die vielfältigen Opfer des Alten Testaments zu sagen? Haben sie eine Bedeutung für uns, oder spiegeln sie nur das Wirken Gottes in einer längst vergangenen Geschichte der Väter Israels? Den faszinierenden Schlüssel für das Verständnis dieses Geschehens gibt uns der Sohn Gottes selbst, wenn Er sagt, dass das Alte Testament von Ihm redet (Joh. 5,39).
Die Opfer sprechen in eindrücklicher Weise vom Weg Gottes zu den Menschen, wie sich Seine rettende Liebe einen Weg bahnt, der am Kreuz von Golgatha zum Finale führt. Jesus, Gottes Lamm, erfüllt die alten Opfer indem Er als das endgültige Opfer dort Sein kostbares Blut vergießt. Dem sündigen Menschen wird es nun möglich, in die Gegenwart und Gemeinschaft des heiligen Gottes zurückzufinden.
Sichtbar ist Gottes Plan zur Erlösung der gefallenen Menschheit über die Jahrhunderte hinweg in den Büchern des Alten Testaments. Von Mose an bis zu den Psalmen und Propheten nimmt T. Ernest Wilson den Leser mit auf die Reise durch die Schriften, um die Opfer und damit die ewigen Absichten, Ziele und Zusagen Gottes zu beleuchten.
Der Leser wird ermutigt, beständig die Bibel zur Hand zu nehmen und im Studium der Opfer zu einem tieferen Verständnis zu gelangen, wie unendlich kostbar das Blut Jesu, unseres Erlösers, ist.
3-fach befreit
Dennis Rokser
126 Seiten, Taschenbuch, 2021
€ 3,90
ISBN 978-3-943175-54-7
Welche genaue Bedeutung hat der biblische Begriff ‚Errettung‘? Sind wir errettet worden oder werden wir gerettet? Und können wir mit Gewissheit sagen, dass wir einmal gerettet werden?
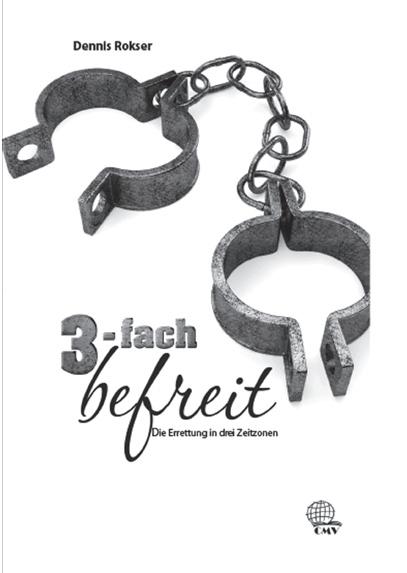
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes (Röm 5,1-).
Welche genaue Bedeutung hat der biblische Begriff ‚Errettung‘? Sind wir errettet worden oder werden wir gerettet? Und können wir mit Gewissheit sagen, dass wir einmal gerettet werden?
Das vorliegende Buch erklärt, warum Gottes Geschenk der Errettung zu den wunderbarsten und wichtigsten Themen der Bibel gehört und warum es bedeutsam ist, zwischen den drei Zeitformen der Errettung zu unterscheiden. Der Autor zeigt auf, dass dies Auswirkung auf die persönliche Gewissheit des Gläubigen, auf sein geistliches Wachstum und konsequente Auslegung von Gottes Wort hat.
Anhand der Bibel wird auf anschauliche Weise dargelegt, dass Gott dem Gläubigen in Christus die Errettung in Vergangenheit und Zukunft sicherstellt und ihm darüber hinaus alles zur Verfügung stellt, was er zur Errettung in der Gegenwart benötigt.
Der kommende Tempel des Messiast Hesekiels prophetische Schau auf den zukünftigen Tempel
John Schmitt/Dr. J. Carl Laney/ Dr. Arnold G. Fruchtenbaum
320 Seiten, Taschenbuch, 2020
€ 9,50
ISBN 978-3-943175-67-7
Zu den eindrucksvollsten Voraussagen des Alten Testaments zählt die Vision des Propheten Hesekiel hinsichtlich eines neuen, wiederhergestellten Tempels in Jerusalem. Doch manche Gelehrte halten diese Aussagen über einen wiederaufgebauten Tempel nicht nur für biblisch irrelevant, sondern sogar für eine Gefährdung der Friedensbemühungen im Nahen Osten. Doch was, wenn Hesekiels Prophezeiung zutreffend ist und sich einmal wörtlich erfüllen wird? Wie würde der vorausgesagte Tempel aussehen und welchen Zweck würde er erfüllen? Wann genau würde er gebaut und in welcher Beziehung stände er zu der Wiederkunft des Messias? Aufgrund intensiver Nachforschungen und Unterredungen mit führenden Rabbinern sowohl in wie auch außerhalb von Israel zeigen uns die Autoren ein detailliertes und zutreffendes Bild dieses zukünftigen Gotteshauses auf. In der vorliegenden überarbeiteten und erweiterten Ausgabe werden die neuesten archäologischen Funde in Jerusalem und auf dem Tempelberg berücksichtigt.
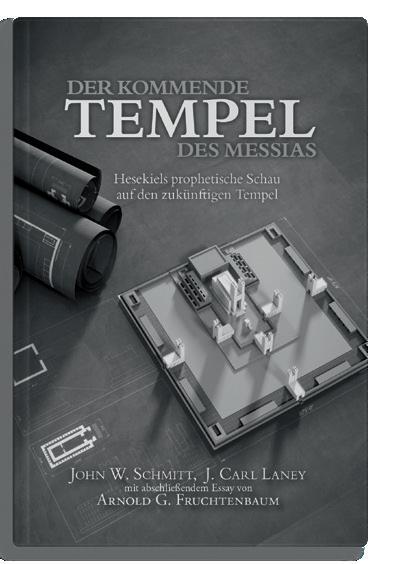
10 schlagkräftige Argumente für die Entrückung vor der Drangsal
Lee W. Brainard
172 Seiten, Taschenbuch, 2025
€ 7,50
ISBN 978-3-96190-125-8
Die Entrückung ist ein „explosives“ Thema und Gegenstand hitziger Diskussionen: Ist die Gemeinde während der Großen Drangsal noch auf der Erde? Oder wird sie bereits davor dem Herrn entgegen-gerückt?
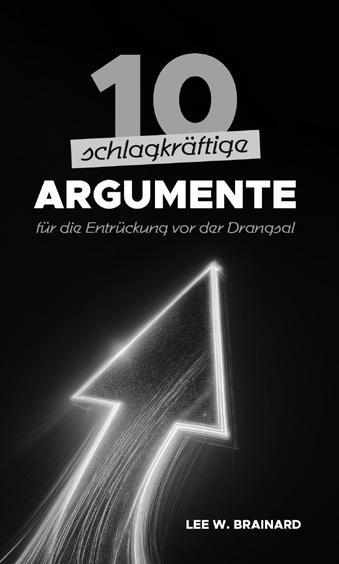
Lee Brainard war als junger Christ mehr als zehn Jahre lang überzeugter Anhänger einer Entrückung nach der Drangsal, weshalb er die Argumen-te dieses Standpunktes aus eigener Erfahrung kennt. Im Lauf der Zeit kam er anhand der Bibel jedoch zu einer anderen Überzeugung.
In diesem Büchlein legt er zehn schlagkräftige Argumente dafür vor, dass sich die Entrückung noch vor der Drangsal (d.h. vor der 70. Jahrwoche) ereignen muss. Stets eng an die Heilige Schrift gebunden untersucht er unter Berücksichtigung von Kontext und Grundtext:
• die eigenständige Zukunft und Rolle Israels;
• biblische Verheißungen und Darstellungen bezüglich der Gemeinde;
• eher unerwartete Typologien auf die Entrückung;
• und einiges mehr.
CMV Hagedorn
www.cmv-duesseldorf.de

