

INHALT
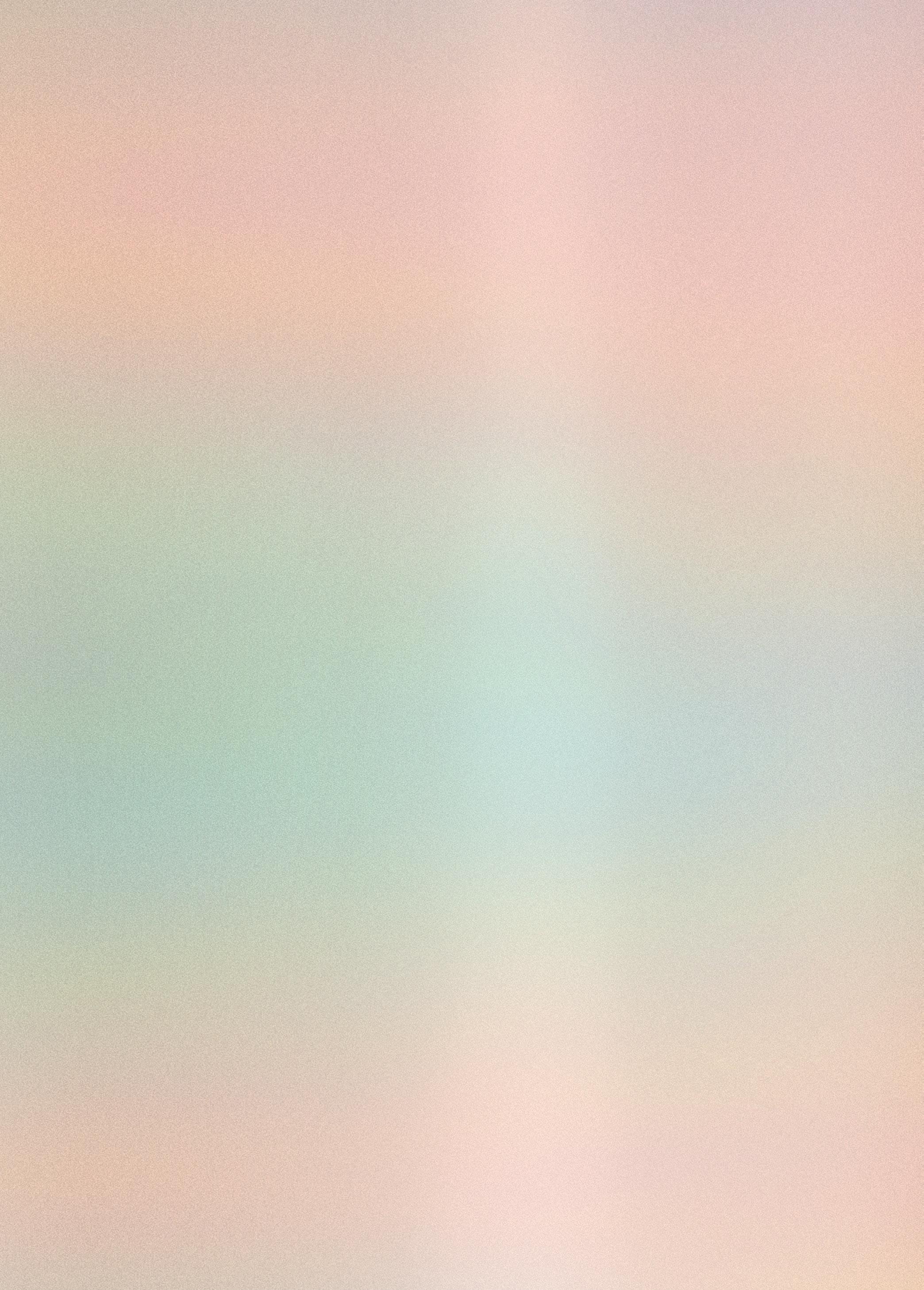
7 Über uns
8 Prolog – Werden statt können 12 Noch ein Prolog – Werden dank singen 15 Das Kreuz mit dem Kreuz
1 Simon, der Kreuzträger –Überrascht von Gott
2 Maria von Magdala –Ihm nahe sein
3 Dismas, der Verbrecher –Erbarmungslose Gnade 88 4 Abenadar, der Hauptmann –Gott ist Liebe. Punkt.
5 Pilatus, der Königsmacher –Die Schalomatisierung der Welt
6 Maria von Nazaret –Großzügig glauben 161 Und viele mehr –Brennend zweifelnd 168 Mehrdeutig und unverkürzt –Das Pferd im Sattel reiten 183 Durchs Kreuz blicken
Amen – So sei es
DAS KREUZ MIT DEM KREUZ

Das Kreuz ist ein Affront. Ein Skandalon. Falls es das nicht mehr ist, dann nur, weil wir alle Ecken und Kanten über die Jahrhunderte glatt gehobelt haben. Oder weil unsere Sensoren abgestumpft sind und wir uns zu sehr an es gewöhnt haben.

Das geschieht manchmal mit Dingen. Im Auto von Bekannten riecht es penetrant nach Hund. Ein Umstand, den sie aber selbst gar nicht mehr wahrnehmen, weil es schlicht normal geworden ist.
Ich nenne das den »Notfallaufnahme-Betäubungseffekt«. Für eine Frau, die an der Rezeption der Notfallaufnahme sitzt, sind üble Verletzungen normal geworden, weil sie tagtäglich mit ihnen konfrontiert ist. Den Dialog stelle ich mir dann jeweils ungefähr so vor: »Grüezi. Ah, Sie haben ein Beil im Kopf. Ja, ich sehe es. Bitte füllen Sie dieses Formular aus: Name, Adresse, Versicherungsnummer, vegetarisch oder nicht, und dann bitte hier unten unterzeichnen. Der Arzt kommt in einer halben Stunde …« Mir fehlt diese professionelle und abgebrühte Coolness in solchen Situationen. Mein Gesicht weist bereits Anzeichen von bleichen Stellen auf, wenn es jemandem nur mal eben den Fingernagel nach hinten umlegt.
Das Kreuz entwickelte sich über die Jahrhunderte vom unmenschlichen Folterinstrument über ein wichtiges Glaubenssymbol hin zu einem schmucken Accessoire. Und wir erliegen dabei dem Notfallaufnahme-Betäubungseffekt. Wir haben uns an die zwei gekreuzten Balken gewöhnt. Oder versuchen, die Schwierigkeiten wegzutheologisieren. Aber das Kreuz muss sperrig und kratzig bleiben –es hat das Bequemlichkeitslevel eines Kaktuskissens.
An diesem Kreuz prallt alles ungebremst aufeinander. An ihm kristallisiert sich die Fähigkeit des Menschen zur abgrundtiefen Bosheit. Gleichzeitig kondensiert sich an ihm aber auch der Charakter Gottes, seine überfließende und unverschämte Gnade. Es kollidieren Dunkelheit und Licht, Tod und Leben, die Vergangenheit und die Zukunft, das Noch-nicht und das Schon-jetzt. Die menschliche Attacke auf Gott wird entkräftet durch seine Nichtrache und seinen Nichtzorn. Seine Vergebungsbe-
reitschaft zerstört wuchtig alle Vorstellungen von einem Gott, der uns im Leben eins auswischen möchte und uns abstrafend ansieht. An diesem Holz stoßen die Fronten zusammen wie zwei tektonische Platten, die eine vulkanische Eruption auslösen.
Der Tiefpunkt der Menschheit prallt auf den — Höhepunkt der Göttlichkeit. Es ist der Ort, wo sich die Fähigkeit des Menschen zur Unmenschlichkeit manifestiert und dabei den Dammbruch des himmlischen Gnaden-Stausees erzeugt. Es ist der Ort, wo die Versöhnung aus der anderen Welt in der unseren aufschlägt, die versöhnungsbedürftig danach lechzt. Der Ort, wo der Vorhang zerreißt, der das Irdische vom Himmlischen trennt.
Es ist der dramatische Höhepunkt der Missio Dei, der göttlichen Geschichte seiner nie endenden, sehnsüchtigen Bewegung auf uns Menschen zu, die in der Selbsthingabe gipfelt. Es ist der Knotenpunkt, an dem die Pläne des Bösen durchkreuzt werden, wo sich alles verbindet und klärt. Der Brückenschlag zu Gottes ursprünglichem Plan – der von Liebe durchdrungenen, tiefen Gemeinschaft von Gott und Menschen – geschieht wie der Durchstoß bei einem Tunnelbauprojekt: auch wenn der Tunnel damit noch nicht ganz fertiggestellt ist, ist der Weg unausweichlich gebahnt.



Während das Kreuz unter Kaiser Konstantin zu einem Symbol der Stärke und der Macht erhoben wird, signalisiert es in seiner ursprünglichen Form vor allem
den Nichtkampf und die Kapitulation –das Nichteingehen Gottes auf die Forderung des Bösen, dass etwas Böses mit etwas Bösem vergolten werden muss. Gott durchbricht diesen Teufelskreis der Zerstörung, den Vergeltungsmechanismus des Bösen, indem er nicht zurückschlägt. Sondern sich hingibt. Und damit die Menschheit nicht aufgibt. Gott reagiert anders.
Sein Herz ist von Mitleid für uns Menschen entbrannt Hosea 11,7-9 – so redet Gott über sich selbst durch den Propheten Hosea. Und gerade weil er Gott ist und nicht ein Mensch, weil er heilig ist, wird uns sein Zorn nicht treffen. Sein vermeintliches Scheitern am Kreuz, dieser scheinbar ungöttliche Eklat, diese vermeintlich größte Niederlage der Weltgeschichte, entpuppt sich als bedeutendster Sieg. Mit der Auferstehung als triumphaler Krönung der Kreuzigungsgeschichte. Damit überwindet Gott die Trennung zwischen sich und uns Menschen selbst. Er schafft Erlösung für die Schöpfung, die durch Sünde korrumpiert ist. »Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft; Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten.« 1. Korinther 1,25* Dass ein mächtiger Gott schwacher Mensch wird und am Ende an ein Holz genagelt stirbt, um dadurch auf das Recht auf einen Gegenschlag zu verzichten und Liebe in Reinkultur zu demonstrieren sowie Versöhnung zu ermöglichen, ist mehr als nur ein bisschen kantig. Es ist eklatant und empörend. Unbegreiflich und einzigartig. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass damals wie heute Menschen mit dem Kreuz und dem Kreuzgeschehen ringen.
Die älteste bildliche Darstellung der Kreuzigungsgeschichte ist bezeichnenderweise eine Karikatur: ein Mann mit Eselskopf am Kreuz. Es ist ein 1857 entdecktes Graffito aus dem zweiten Jahrhundert, eingeritzt in eine Hauswand auf dem Palatin in Rom, dem am längsten besiedelten Hügel Roms. Links vom Kreuz steht in dieser Abbildung ein zweiter Mann, der seine Arme zur Anbetung erhebt. Und darunter lassen sich in krakeliger Schrift die Worte »ALEXAMENOS CEBETE THEON« entziffern, »Alexamenos huldigt Gott«. Es ist eine Karikatur, die sich darüber belustigt, einen Gott zu verehren, den man der Lächerlichkeit preisgegeben und gekreuzigt hat. Paulus spricht von dieser Spannung und dem gekreuzigten Christus, dass es für die einen »Torheit« 1. Korinther 1,18 und für die anderen, die daran glauben, »Gotteskraft« ist.
Es ist wichtig, uns immer wieder vor Augen zu malen, dass dieser Christus, der Gekreuzigte, am Ende der Stolperstein am Glauben ist. Dass er es immer schon war und immer bleiben wird. Dabei schreibt Paulus nicht, dass sich für uns die Torheit durch Offenbarung und Erkenntnis auflösen wird – sondern dass genau in dieser vermeintlichen »Dummheit Gottes« unsere Gotteskraft liegt. Dieser Gott, der Mensch wird, sich für uns hingibt – das ist das Unvorstellbare, das Skandalöse, das Unerträgliche. Und nicht etwa all die Lieblingsthemen von uns Christen heute, mit denen wir immer wieder innerkirchlich, aber auch gesellschaftlich auf Kreuzzüge gehen, um unsere theologischen Lieblings-Hochburgen zu verteidigen.
Wenn etwas skandalträchtig ist, dann ist es ein Gott, der Mensch wird, um uns so richtig nahezukommen, und der sich dann von uns ans Kreuz schlagen lässt. Ein
Messias, der am Kreuz endet. Und doch ist es nicht das Ende, sondern vielmehr der große Neustart. Weil sein Sterben und die Auferstehung alles – das Böse und selbst den Tod – überwindet und dadurch Leben und Gotteszugang freisetzt. Und Vergebung – eines der großartigsten christlichen Schätze überhaupt. Deshalb kann man das Kreuz nur in untrennbarer Verbindung mit der Auferstehung sehen. Sie ist der unüberbietbare und sichtbare Beweis der alles überwindenden Macht Gottes, die selbst im Sterben noch neues Leben erschafft. Eine unerschütterliche Hoffnung für alle, die leiden. Die Wirklichkeit des Heils wurde durch das Kreuz und die Auferstehung geschaffen. Immer wenn das Wort »Kreuz« fällt, muss »Auferstehung« als Echo dazu in unserer Ohrmuschel widerhallen.



Das Kreuzgeschehen kann zu kognitiven Dissonanzen führen, denn es ist multidimensional. Es wird von vielen Bildern eskortiert, die uns jeweils einen anderen Blickwinkel ermöglichen. Die verschiedenen Bilder sind für sich allein stehend manchmal schwierig zu greifen, gleichzeitig können sie nebeneinanderstehend auch Spannungen erzeugen. Noch schwieriger wird es, wenn wir die Bildwelt ungeschickt überlagern und vermischen. Zudem werden manche der Schwierigkeiten oder scheinbaren Widersprüche erst durch unsaubere historische Herleitung erzeugt.
Auf der einen Seite geht es darum, Kritik zuzulassen. Ehrlich zu werden und
auszusprechen, dass es schwierige, vielleicht aufwühlende Themenkomplexe gibt. Die Kraft des Kreuzes liegt genau in dieser Vielschichtigkeit und seinem Bilderreichtum. Es ist so facettenreich, dass es immer einen Anknüpfungspunkt in die reale Gegenwart hinein gibt.
Auf der anderen Seite müssen wir anerkennen, dass das Kreuz für den christlichen Glauben zentral ist und dass dort mehr geschehen sein muss als nur die symbolische und sinnbildliche Manifestation eines lieben Gottes. Ich kann die schwierigen Bilder in der Bibel stehen lassen, ohne dass sie dabei mein Gottesbild ankratzen. Ohne alles verstehen zu müssen, kann ich es dabei belassen, dass dort am Kreuz etwas Großes geschehen ist. Etwas dermaßen Einschneidendes, dass es den Lauf der Zeit für immer verändert hat. Man kann dem irrigen Glauben verfallen, dass man mit genügend hermeneutischer Arbeit den christlichen Glauben glatt gestrichen bekommt, und deshalb versuchen, zu viel der Spannung aufzulösen. Das ist etwa so hilfreich, wie wenn ich beim Trampolin im Garten auf einer Seite alle Federn entferne. Das Trampolin wie auch der Glaube leben von Spannung.
Es geht nicht um die eine korrekte Theologie, die wir verteidigen müssen, um so etwas wie dem Zerfall der Kirche oder der Gesellschaft vorzubeugen. Die Kirche steht oder fällt, die Gesellschaft macht Schwankungen durch, genauso wie auch das Christentum selbst. Wir pendeln durch die Zeitgeschichte und schießen dabei immer mal wieder übers Ziel hinaus, um dann wieder umzukehren. »Kehrt um, denn das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen« Matthäus 3,2, ruft uns Jesus deswegen bis heute zu.
Am Ende wird sich das Wahre und Gute durchsetzen, denn das ist Gott selbst. Und immer wieder werden Menschen den Weg zum Licht finden. Das Kreuz markiert schon jetzt den vollbrachten Sieg. Gott ist »groß« genug, um für sich selbst zu kämpfen. Das entbindet uns nicht von der Verantwortung, für unsere Überzeugungen aufzustehen. Nur ist entscheidend, dass wir nicht fälschlicherweise unsere eigene Agenda zu »Gottes heiligem Kampf« deklarieren. Dass wir unseren Kampf anderen aufzwingen. Und am Ende, anstatt für etwas zu kämpfen, gegeneinander kämpfen.
Man ist dann leicht so überzeugt von der eigenen Stoßrichtung, dass alle, die diese nicht mittragen, automatisch in ein Feindbild gepresst werden. Wie leicht vergisst man dann, sich um ein Verstehen zu bemühen, warum diese Personen in die andere Richtung ziehen. Dabei würde sich durch ehrliches Zuhören sehr oft ebenfalls Gutes und Wahres ausmachen lassen, selbst wenn man mit dem Endresultat nicht übereinstimmt. So mancher »Kampf« führt deshalb trotz bester Absichten nicht ins Leben. Selbst Jesus hat den ungesunden Kaiserkult von damals nicht bekämpft, wie viele es erwartet hätten, sondern seine Zeitgenossen mit seiner Aussage verblüfft: »So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!« Matthäus 22,21 Wir sollten unseren Hill to die on äußerst sorgfältig und weise wählen. Und wir können uns dabei auch eine Scheibe Entspanntheit von Jesus abschneiden.



Ich habe mich deshalb für den Weg entschieden, die Spannungen auszuhalten, die das Kreuz erzeugt. Die Spannung zwischen Torheit und Gotteskraft, wie es Paulus nennt. Hilfreich finde ich dabei, zu verstehen, dass wir es bei den Begrifflichkeiten ums Kreuz mit einer Bildsprache zu tun haben, derer sich die Autorenschaft der Bibel bedient hat, um Licht auf das Ganze zu werfen. Es ist vom Opferlamm die Rede, vom Sühnetod, vom reinigenden Blut, vom Versöhnungsfest, der Erlösung, der Rechtfertigung, von Stellvertretung, Loskauf, Hingabe, einem Bund, der Rettung und von vielem anderen. Die Begriffe beziehen sich auf verschiedene Kontexte, die den Menschen damals sehr geläufig waren. Alltagssprache, alltägliches Leben: der jüdische Tempel mit den Opferritualen, der Sklavenhandel und der Loskauf aus der Sklaverei, das Strafrecht und der Gerichtssaal.
Jede Metapher ist wie eine Taschenlampe, mit der wir das Kreuz von einer bestimmten Seite aus beleuchten. Und während es uns diesen Bereich des Kreuzes im Lichtkegel erhellt, fällt auf der anderen Seite ein Schatten. Jedes Bild, das als Erklärung verwendet wird, ist deshalb immer nur eine Annäherung und hat immer auch eine Begrenzung. Es ist so, wie wenn mich jemand fragt, der noch nie einen Hund gesehen hat, was ein Hund ist. Ich kann ihm erklären, dass ein Hund wie eine Katze ist, nur mit mehr Wuff. Oder er will wissen, was ein Baum ist, und ich sage ihm, dass das so etwas wie ein überdimensionaler Brokkoli ist, nur mit mehr Holz. Beide Erklärungen sind nicht schlecht, aber werden am Ende der eigentlichen Sache nicht gerecht.
Wir können das auch an den Bildern erkennen, die für Gott gebraucht werden:
Löwe, Hirte, Vater, Henne, Lamm, König … alles starke Bilder, die Licht auf einen Aspekt von Gott werfen. Aber am Ende werden sie alle Gott nicht gerecht. Er jagt keine Gazellen wie ein Löwe, er lässt sich nicht scheren wie ein Schaf und wird auch kaum Eier legen wie ein Huhn. Wenn man sich zu stark auf das eine Bild konzentriert, kann man es überstrapazieren und dabei Gott in eine Box hineinzwängen, die viel zu klein ist. Genauso ist es auch beim Kreuz. Wenn man die Deutung überdehnt, kommt man dann bei Bildern wie »Opferlamm«, »Lösegeld« oder »Stellvertretertod« gern mal ins Straucheln. Die Irritationen werden jedoch oft nur deshalb hervorgerufen, weil wir die verschiedenen Bilder übereinanderlegen und dabei zum Beispiel durch die Überlagerung von »Opferlamm« und »Loskauf aus Sklaverei« neue Aussagen entstehen können, die so nicht im ursprünglichen Bild enthalten sind.
Die Bibel wirkt manchen der möglichen Stolpersteine klärend entgegen, wie zum Beispiel hier:
»Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung.«
2. Korinther 5,19
Gott war in Christus, das bedeutet, dass er sich selbst ans Kreuz hat nageln lassen – was den Vorwurf von einem Vater, der seinen Sohn opfert, entkräftet. Es geht nicht darum, dass Gott am Kreuz eine unschuldige dritte Partei, Jesus, bestraft hat. Das wäre barbarisch. Nein, Gott selbst kam auf diese Erde in der Person seines Sohnes. Gott war in Christus und hat uns mit sich versöhnt. Beim Kreuz geht es auch nicht etwa um einen Gott, der irgendwie versöhnt werden müsste, sondern um die Welt, die Menschheit und die Schöpfung, die versöhnungsbedürftig sind. Was bei diesem Vers ebenfalls ins Auge springt, ist die Tatsache, dass Gott durch Christus und das Kreuz das Wort der Versöhnung aufgerichtet hat. Dazu passt als eine treffende NeoMetapher das Bild einer Injektionsnadel. Dieses Bild ist nicht in der Bibel zu finden (oder du schaust mal in 1. Andreas 19,79 nach), aber es gefällt mir gut, um zu greifen, was da eigentlich vor sich ging. Wir leben in einer Welt, die unter dem Bruch, der sich zwischen ihr und Gott ereignet hat, ächzt und leidet. Römer 8,22 Sie ist wie ein Körper, in dem sich nach dem Biss einer Schlage das Gift ausbreitet. Und genauso, wie man dort eine Spritze mit dem Gegenmittel setzt, wurde das Kreuz in den Boden gerammt, um dieses
Gegengift in die Schöpfung zu injizieren. Es ist das Antiserum der Erlösung von allem, was die Welt vergiftet – nicht nur unsere persönliche Seele. Die Erlösungsund Versöhnungskraft, der große Schalom, der den Urzustand der Schöpfung ausgemacht hat und den Gott nun wieder ins System eingespeist hat.
Für mich erübrigt sich die Frage, ob Gott denn nicht schon vor dem Kreuz vergeben konnte. Natürlich konnte er. Jesus selbst vergibt vor seinem Sterben Sünden Markus 2,1-12 und bereits im Alten Testament kann ein David in Psalm 51 um Vergebung bitten. Das darf uns aber nicht automatisch darauf schließen lassen, dass das Kreuz überflüssig geworden ist, Jesus nur Opfer der Menschen war und die Kreuzigung somit nur noch symbolisch angesehen werden sollte. Am Kreuz ist etwas Geheimnisvolles passiert, etwas unerklärlich Großes, ein Versöhnungsakt, der mit nichts anderem in der Menschheitsund Weltgeschichte zu vergleichen ist.
Ich glaube, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit existiert – auch wenn er sich selbst ins Zeitgeschehen hineinbegibt, sich in der Zeit verwirklicht und in den Raum hinein zum Menschen wird. Deshalb konnte sich dieses Versöhnungswirken von der Einstichstelle der Kreuzinjektion aus in alle Richtungen ausbreiten. Rückwirkend in die Vergangenheit hinein, vorwärtsbewegend durch die Zukunft, bis in unsere Gegenwart und besonders stark sichtbar rund um die »Einstichstelle«, wo sich augenscheinlich zahlreiche Transformationserlebnisse abgezeichnet haben.



Verschiedene Gruppierungen werfen sich gegenseitig vor, mit dem Kreuz nicht angemessen umzugehen. Die einen hören den Vorwurf, alles kritisch zu sezieren, bis kein Leben mehr darin auffindbar ist, während anderen vorgeworfen wird, nicht denkend und naiv alles abzunicken und unkritisch zu schlucken. Dabei bergen sowohl das unkritische wie auch das überkritische Lesen von Gottes Wort gleichermaßen Gefahren. Beidem ist geschichtlich viel Unheil entwachsen. Ich wünsche uns allen, dass wir die Ehrfurcht vor dem, was am Kreuz geschah, nicht verlieren.
Anstatt darüber zu streiten, was genau am Kreuz geschehen ist, und sich gegenseitig den Glauben abzusprechen oder sich ein »Du kannst mich kreuzweise!« anzuhängen, schlage ich vor, eine Kultur der »hermeneutischen Demut« anzustreben. Das beginnt mit Zuhören. Wir wissen viele Dinge nicht, können sie nur miteinander und im Gespräch umkreisend ergreifen. Jedoch: Ob Gott schon vor dem Kreuz oder erst nach dem Kreuz vergeben konnte, ändert nichts an dem Fakt, dass er ein Gott ist, der vergeben will. Ich werde nicht an der Himmelstüre anklopfen und ankreuzen müssen, wie viele dieser theologischen Metaphern ich geliebt und verstanden habe. Ich werde nicht beantworten müssen, wo ich meine den Zeitpunkt der wahren Vergebung verortet zu wissen, wie das Kapitel von Dismas gut beleuchtet.
Das Kreuz lässt sich denkerisch nicht glatt hobeln. Es lässt sich nicht menschlichem Verstehensdurst unterwerfen. Wir werden nie an den Punkt gelangen, an dem wir Gott und sein Heilswirken durchdringend verstanden haben. Epheser 2,7 verdeutlicht, dass Gott uns bis weit in die
Ewigkeit hinein immer neu und immer weiter die Größe seiner Gnade aufzeigen muss. Wir sind zu Lebzeiten nicht fähig, den ganzen Reichtum von dem zu erfassen, was er in Christus getan hat. Genauso wird es wohl auch mit anderen Wesenszügen von Gott sein. Mit seiner Liebe, seiner Vergebung, seiner Schöpfungskraft. Weil Gott als Schöpferwesen auch außerhalb meines Verstandes und meines Denkhorizonts immer noch Gott ist und nicht etwa durch diesen begrenzt wird. Deshalb scheint mir das einzig Richtige, dass wir die Spannung des Nichtverstehens aufrechterhalten und maximal fröhlich aushalten. Dass wir Gott nicht irgendwie denkend besitzen oder verzwecken wollen. In dem Moment, in dem wir Gott so klein bekommen haben, dass er in unsere Glaubensbox hineinpasst, haben wir ihn verloren. Und das, was dann in unserer Box drin ist, ist nicht Gott, sondern nur unser klein skaliertes Zerrbild.
Meister Eckhart, Theologe und Mystiker (1260–1328), hat einmal den Ausspruch geprägt: »Gott ist keine Kuh.« »Manche Leute wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen, und wollen Gott lieben, wie sie eine Kuh lieben. Die liebst du wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten’s all jene, die Gott um äußeren Reichtums oder innerer Tröstungen willen lieben. Die aber lieben Gott nicht recht, sondern sie lieben ihren Eigennutz.«5 Man kann Gott nicht verzwecken – genauso wenig besitzen. In der gedanklichen Erblinie von Eckhart sage ich deshalb: »Gott ist keine Qualle.«
Ich hatte als Jugendlicher im Meer eine Qualle gefangen und wollte sie im Spülbecken des Campingplatzes aufbewahren. Am nächsten Morgen fand ich
jedoch nur noch Wasser im Spülbecken und war überzeugt, dass mir jemand meine Qualle gestohlen hat. Leider war ich biologisch-physikalisch damals noch nicht ganz so versiert, weshalb ich nicht auf die Idee kam, dass es keine gute Idee war, eine Qualle, die zu 99 Prozent aus Wasser besteht, in ein Süßwasserbecken zu legen. Die Osmose tat dann ihren Dienst und die Qualle »quoll« bis zur vollständigen Selbstauflösung auf. Hätte ich sie in Salzwasser gelegt, hätte ich sie mir allerdings halten können.
Gott ist keine Qualle – man kann ihn weder verzwecken wie eine Kuh noch besitzen wie eine Qualle. Wir müssen ihn deshalb nicht durch alle möglichen menschlichen Erklärungen des Göttlichen berauben und ihn oder das Kreuzgeschehen am Ende entmystifizieren. Sondern die Spannung und das dadurch pulsierende Leben genießen, die er erzeugt. Die Realität Gottes wird immer unser Denken und Verstehen übersteigen. Epheser 3,19 Das heißt nicht, dass wir nicht versuchen sollen, zu verstehen. Wir dürfen Denken als Anbetung entdecken, das, was Gott uns offenbart, verstehen. Ein demütiges Verstehen wird uns aber vielmehr und immer wieder zum Staunen führen und weniger zum »Jetzt habe ich es begriffen«. Wie wir es drehen oder wenden – die Spannung von Torheit und Gotteskraft bleibt. Bei den hitzigen Diskussionen über das Kreuz ringen oftmals der Eifer um das Wahre und der gefühlte innere Auftrag, dem falschliegenden Gegenüber die Augen öffnen zu müssen, eine Kultur des Respekts und des Zuhörens nieder. Die Debattierenden würden sich am liebsten mal kreuzweise.



KREUZWEISE ist mehr als ein Buch mit Musik und Illustrationen. Es ist ein Aufruf, den Blick von dem wegzuwenden, was immer Bestandteil von Diskussionen und Vermutungen bleiben wird, und auf das zu blicken, was augenscheinlich ist: das transformatorische Versöhnungswirken, das die Menschen immer und immer wieder erfasst und durchdrungen hat.
Gottes Versöhnungskraft durchdringt seit der Kreuzigung von Jesus die letzten Winkel des Universums, die letzten Winkel dieser Erde, die letzten Winkel meines Herzens. Sie bestimmt meine Zukunft genauso wie den Atemzug, während ich diese Worte hier schreibe.
Für diese Briefzeilen an die Korinther würde ich Paulus gerne einmal heftig umarmen: »An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken – auf Jesus Christus, den Gekreuzigten.« 1. Korinther 2,1-2* Gerne konzentriere ich mich gemeinsam mit Paulus auf Christus, den Gekreuzigten. Er betont die Person Jesus Christus, es geht ihm um eine Beziehung zum gekreuzigten und auferstandenen Christus. Ich würde das etwas weiten und sagen, dass ich nichts anderes bringen möchte als Christus, den Lebenden, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Der Blick aufs Kreuz ist deshalb so zentral, weil es alles zusammenhält, das Vorher und das Nachher. Und genau deshalb liebe ich diesen Schnittpunkt im Versöhnungsgeschehen Gottes. Mir ist wichtig, nicht
eine aufs Kreuz reduzierte Sichtweise zu postulieren – sondern lieb zu machen, durchs Kreuz und durch Christus, den Gekreuzigten, auf alles zu blicken. Das Kreuz hält alles zusammen. Es ist der Ort der Versöhnung, der Rettung, der Vergebung, der Wiederherstellung, der Heilung, der Befreiung, der Ent-Schämung, der Trennungsüberwindung, des Sieges, des Lebens und der Hoffnung.
Der Blick durch Jesus am Kreuz lässt uns kreuzweise werden.
Dazu werfen wir einen Blick auf einzelne Begegnungen mit Jesus, die rund ums Kreuz stattgefunden haben. Bewegen wir uns gemeinsam also ein Stück weg von der Deutung und hin zur Wirksamkeit des Kreuzes. Das ist für mich eine sehr persönliche und intime Angelegenheit. Denn nichts im christlichen Glauben bewegt mich tiefer und eindringlicher, als die Transformation miterleben zu dürfen, die eine persönliche Begegnung mit Christus damals wie heute in einem Menschenleben hervorruft.
Die Serie The Chosen hat das an vielen Stellen herausragend ausgemalt – und bei so ziemlich jeder Folge saß ich mit Tränen in den Augen auf meinem Sofa und vergaß dabei, meine Paprikachips weiterzukauen. Dieselben Erfahrungen mache ich, wenn ich die Personen in den biblischen Texten studiere. Ab und zu sitze ich dann bewegt von Gottes Wirken im Leben der Marias, Dismasses und Abenadars vor meiner Bibel und wische mir ein paar Tränen aus den Augenwinkeln. Dankbar dafür, dass dieser Jesus seine Wirkungskraft auch in meinem Leben entfaltet. Gerne möchte ich dich mit hineinnehmen. Weil sich beim Blick auf und durchs Kreuz vieles neu sortiert. Und nicht selten erstaunlicherweise wohltuend auflöst.
SIMON, DER KREUZTR Ä GER
Ü BERRASCHT VON GOTT
Eine Person, die rund ums Kreuzgeschehen auftaucht und dabei eine der wohl berühmtesten und gleichzeitig zu Unrecht ignorierte Nebenrolle in der ganzen Dramaturgie eingenommen hat, ist Simon von Kyrene. Die Evangelien-Autoren widmen ihm nur einen einzigen Vers. Er taucht in dem biblischen Geschehen
auf, wie ein Wal, der kurz nach Luft schnappt, um dann gleich wieder unter die Wasseroberfläche der biblischen Ereignisse abzutauchen. Nichtsdestotrotz hat sein kurzer Besuch an der Oberfläche ein paar Wellen geschlagen, denen es sich nachzublicken lohnt.
Mit welchen Gefühlen Simon die Szenerie beobachtete, bleibt Spekulation. Was in ihm abging, als er nachher das Kreuz tragen musste und plötzlich unerwartet nicht mehr der passive Zuschauer war, sondern für kurze Zeit eine der bedeutendsten historischen Nebenrollen spielen musste? Das können wir nur erraten. Und eigentlich könnte man das Kapitel deshalb hier bereits wieder beschließen. Wären da nicht ein paar unscheinbare Indizien, die den Vorhang doch noch einen Spaltbreit aufziehen und uns hinter die Kulisse blicken lassen. Dorthin, wo sich schemenhaft eine eindrückliche und lebensverändernde Begegnung zwischen Simon und Jesus abzeichnet.
Simon war aus Kyrene, einer römischen Kolonie im heutigen Ostlibyen. Dort gab es damals eine jüdische Minderheit. Er war aufgrund dieser Herkunft wohl dunkelhäutig. Lukas berichtet, Lukas 23,26 dass Simon vom Feld kam, wo er wahrscheinlich gearbeitet hatte, und mehr oder weniger ins Passionsgeschehen hineingestolpert ist. Später wurde er von den römischen Soldaten gezwungen, den Kreuzbalken für Christus zu tragen. Markus erwähnt gefühlt wie nebenbei, dass Simon der Vater von Alexander und Rufus ist. Markus 15,21
Simon war bis dato wohl kaum ein glühender Anhänger von Christus. Markus beschreibt, dass er an diesen kreuzschleppenden Männern und dem dichten Gedränge der Schaulustigen »vorüberging«. Ein Nachfolger von Christus hätte von der Kreuzigung gewusst und wäre nicht unbekümmert seiner Arbeit nachgegangen, während der Rabbi gefangen genommen, gefoltert und für die Kreuzigung nach Golgatha zur Schädelstätte geführt wurde. Simon hatte sich also
nicht von der Arbeit abgemeldet, um seinem Meister beizustehen, vielmehr schien ihm diese Kreuzigung gleichgültig zu sein. Gut möglich, dass er vom Radau der Menschenmasse angezogen wurde, die am Morgen nach seiner Feldarbeit zufällig seinen Nachhauseweg kreuzte, während er vielleicht auf ein störungsfreies und ereignisloses Mittagessen gehoff t hatte.
Ich versuche uns einmal das Bild zu malen, wie es sich hätte abspielen können.



Ich habe vor Augen, wie Simon wie an jedem normalen Tag mit knurrendem Magen nach Hause zieht. Dabei spürt er schon erste Anzeichen von einem Hungerast – was bei mir zu ganz unschönen Situationen führen kann, da mein Aggressionspotenzial exponentiell anschwillt, meine Frustrationstoleranz in gleichem Ausmaß sinkt. Eigentlich will er nach Hause, aber von Neugier übermannt drückt er sich dann doch zwischen den sensationsgierigen Gaffern nach vorne, um zu sehen, was da los ist.
Er war Jesus nie direkt begegnet, hatte aber vereinzelte Geschichten und Gerüchte über diesen Wundertäter gehört. An einer Stelle in der Menge kann er sich ganz nach vorne schieben und landet mitten im Geschehen: Direkt vor sich sieht er drei Verurteilte, die ihre Kreuzbalken nach Golgatha schleppen müssen. Dabei ist unschwer zu erkennen, dass sich die Aufmerksamkeit der Masse stark auf einen konzentriert. Der Mann ist kurz
vor dem Zusammenbruch – der Rücken blutig und zerfetzt, ein Dornenkranz in die Kopfhaut eingedrückt, mit schwankendem Schritt und starrem Blick. Er wird von den einen bespuckt und getreten, während andere um ihn zu weinen scheinen.
Simon hat dann auch rasch genug gesehen. Schon früh hat er gelernt, dass man bei Menschenaufläufen besser fährt, wenn man sie meidet. Und dass man bei der römischen Besatzungsmacht besser schaut, dass man nicht auffällt. Seit seiner Jugendzeit hat er immer versucht, sich mit leicht gesenktem Kopf und abwesendem Blick ein bisschen durchsichtiger zu machen, wenn wieder eine Person gesucht wurde, um eine ungeliebte Aufgabe auszuführen. So dreht er sich auch jetzt auf seinem Absatz weg, um sich wieder seinem Hungergefühl und dem Nachhauseweg zu widmen. Da packt ihn ohne Vorwarnung eine starke Pranke an der Schulter.
»Hey!«
Als Simon sich umdreht, schreit ihn einer der Soldaten mit energisch gerötetem, leicht aufgedunsenem Gesicht an. Er soll den Balken von diesem Jesus für ihn tragen.
Simon unterdrückt die negativen Emotionen, die hochkommen. Er wischt sich die Spucke des Römers mit einem Ärmel von der Backe und linst über dessen Schulter. Dabei fällt sein Blick auf
den am Boden kauernden Mann, den sie Jesus nennen. Am liebsten hätte er in diesem Moment seine Stirn ein paar Mal an den Holzbalken gedonnert. Wieso hat er es nicht geschafft, seine Neugier zu unterdrücken und einfach vorbeizugehen? Er säße bereits jetzt schon zu Hause bei Fladenbrot und Dattelsirup. Wieso musste er da in die vorderste Reihe drängen, wo er mit seiner kräftig gebauten Arbeiterstatur und der Hautfarbe natürlich auffallen würde?
Aber es war zu spät. Innerhalb einer Sekunde änderte sich für Simon alles. Die Gegenwart wie auch die Zukunft. Vom passiven Beobachter wird er ungewollt zum Mitträger. Die Römer zwingen ihn, das Kreuz für diesen einen geschundenen Mann zu tragen.
Ekel durchzuckt Simon, als er sich den Balken auf seine breiten Schultern hievt, an dem bereits eine Mischung aus Blut, Schweiß und Hautfetzen vom ausgepeitschten und misshandelten Körper klebt. Während er die ersten Schritte geht, übermannt ihn Selbstmitleid. Wieso ich? Wieso immer und jedes Mal wieder ich? Wieso bin ausgerechnet ich am falschen Tag zur falschen Zeit am falschen Ort – und mit den falschen Menschen zusammen? Und wenn ich dann irgendwann nach Hause komme, muss ich mir auch noch die Vorwürfe meiner Frau anhören, wo ich gewesen bin … Eine unglückliche Verkettung von Falschheiten hat dazu geführt, dass er nun in dieser leidigen Situation neben Verbrechern mitleiden muss. Männer, die ihr Schicksal bestimmt verdient haben, nicht so wie er.
Wie ein aufkommendes Sommergewitter beginnen sich in ihm Wut- und Abneigungswolken gegenüber Jesus
aufzutürmen, dem er die Situation zu verdanken hat. Aber womöglich ist es nie zum Gewitterausbruch der Gefühle gekommen – denn wenn wir die Geschichte von Simon vorwärtsspulen, können wir ein lebensveränderndes Ereignis erahnen.
Interessanterweise taucht nämlich ziemlich unerwartet bei der ersten Missionsreise von Paulus, die ihn von Antiochia über Zypern nach Antiochia in Pisidien führte, wieder ein Simon auf. Apostelgeschichte 13,1 Wir lesen da von diesem Simeon, oder Simon, genannt Niger, und von einem Luzius aus Kyrene. Niger war damals das gebräuchliche Wort für dunkelhäutige Menschen. Das deutet darauf hin, dass dieser Simeon ebenfalls aus Afrika stammte, womöglich ebenfalls aus Kyrene, weil er mit Luzius aus Kyrene zusammen genannt wird. Gut möglich, dass es Freunde waren, die da gemeinsam zu der abenteuerlichen Reise antraten. Der Gedanke liegt auf der Hand, dass wir es hier womöglich mit demselben Simon von Kyrene zu tun haben, der den Kreuzweg kreuzte. Und falls ja, muss die adäquate Folgefrage lauten: Was genau ist ihm zwischen dem Hineinstolpern in die Passionsgeschichte und der Missionsreise mit Paulus passiert? Die Antwort ist naheliegend:



Ob Simon und Jesus überhaupt Worte miteinander gewechselt haben oder ob sie beide schweigend und schmerzversunken nebeneinander hergingen, ist nicht übermittelt. Vielleicht haben sich ihre Blicke gekreuzt und Jesus hat ihm dabei kaum merklich dankbar zugenickt. Vielleicht hat er ihm in einem Satz auch seine Dankbarkeit ausgedrückt, weil es eine der allerletzten Gesten von Menschlichkeit war, die ihm jemand zu Lebzeiten so kurz vor seinem Tod noch zukommen ließ – wenn auch unfreiwillig. Vielleicht war Simon auch von der Tatsache verwirrt oder beeindruckt, dass dieser zu Tode verurteilte Mann die weinenden Frauen, die sie umgaben, dazu aufforderte, nicht um ihn zu weinen, sondern sich der eigenen Situation bewusst zu werden. Lukas 23,27-28
ist ihm passiert.
Wir wissen nicht, ob sich Simons Selbstmitleid gewandelt hat, ob er am Ende doch noch übermannt von Mitleid diesen Kreuzbalken nach Golgatha getragen hat. Unabhängig davon, ob die Römer es zugelassen hätten oder nicht, schien ein eigeninitiatives Eingreifen, um dem leidenden Christus zu Hilfe zu kommen, bei niemandem sonst vorhanden gewesen zu sein. Jedenfalls wird davon nichts berichtet. Der BystanderEffekt bezeugt, dass bei einer Notsituation die Wahrscheinlichkeit, dass einer Person geholfen wird, mit steigender Anzahl der anwesenden Personen abnimmt. Jeder Passant durchläuft laut den Sozialpsychologen Latané und Darley einen inneren Prozess von fünf Schritten, bevor er hilft – und andere Menschen bilden
aus verschiedenen Gründen ein zusätzliches Hindernis bei diesen Stufen. Man denkt sich dann so etwas wie: »Wäre es wirklich ganz schlimm, hätte bestimmt schon jemand anderes eingegriffen« (pluralistische Ignoranz). Man will sich nicht blamieren, oder man wartet einfach darauf, bis jemand anderes den ersten Schritt macht, weil bei so vielen Menschen das Gefühl der Eigenverantwortung abnimmt.
Aber Simon musste helfen. Und er fand sich so ungewollt ganz nah bei Jesus wieder. Eine Begegnung, von der ich glaube, dass sie den Lauf seines Lebens und den seiner Familie für immer verändert hat. Denn die Tatsache darf uns aufhorchen lassen, dass die Söhne von Simon mit Namen genannt werden. Es gibt zahlreiche andere Personen in der Bibel, deren Namen wir nicht kennen –wie die Frau am Brunnen, die einfach die Frau am Brunnen ist und bleibt. Oder auch den Jungen, der bei der wunderhaften Essensvermehrung die fünf Brote und zwei Fische brachte, und der einfach als namenloser Junge in der Geschichte auftaucht.
Genau wie der Junge war auch Simon unverhofft ins Zentrum des Geschehens gerückt und hat dabei Dinge erlebt und wahrgenommen, die nur aus dieser Perspektive möglich gewesen sind. Dass er und seine Söhne mit Namen genannt werden, während andere Namen verborgen bleiben, ist bestimmt nicht grundlos so. Eine sehr naheliegende Erklärung dafür ist, dass die damaligen Adressaten der Texte diesen Simon und die beiden Söhne gekannt haben mussten. Ein großer Unterschied zu einem Jungen, der in der Masse anonym geblieben ist, und zu einer unbekannten Frau aus Samarien,
einem Gebiet, in das man als Jude kaum freiwillig den Fuß gesetzt hat.
Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom einen Brief und dabei taucht an einer Stelle, an der er Grüße an die römische Gemeinde übermittelt, plötzlich wieder ein bekannter Name auf: »Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist.« Römer 16,13 Rufus taucht als Name nur genau an zwei Stellen in der Bibel auf –als Sohn von Simon im Markusevangelium und dann in diesem Schreiben an die römische Gemeinde. Die Wissenschaft vermutet, dass Markus als Schreiber des Evangeliums aus der urchristlichen Gemeinde in Jerusalem stammt und sein Buch dann in Rom verfasst hat. Damit schließt sich ein erstaunlicher Kreis. Es macht absolut Sinn, im Markusevangelium Simon, Alexander und Rufus mit Namen zu erwähnen, wenn dieses Buch in Rom verfasst worden ist, wo man diesen Simon, den Alexander und den Rufus auch gekannt hat.
Der Abgleich der Passagen aus der Apostelgeschichte und dem Römerbrief weckt in mir die Überzeugung, dass die Begegnung mit Jesus das Leben von Simon auf den Kopf gestellt hat und sein Denken verwandelt wurde. Die Wirkungskraft von Christus war dermaßen stark, dass Simon und seine Familie zum Glauben kamen. Sie wurden zu wichtigen Pfeilern der ersten Jesus-Gemeinde. Und Simon durchlebte wortwörtlich, was Nachfolge und »das Kreuz auf sich nehmen« bedeutet.
Wir bewegen uns hier zwar auf dem sanft wackeligen Terrain der Vermutungen und die Indizienlage ist nicht erschlagend, sodass das verwendete Material –würden wir uns mit einer Mordanklage
befassen – wohl eher zu einem Freispruch führen müsste. Trotzdem besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es sich so ähnlich abgespielt haben könnte. Diese Erkenntnis hat mein Herz erwärmt. Mit Tränen in den Augen lese ich immer wieder diesen einen unscheinbaren Vers in den Evangelien, der uns wie durch ein Schlüsselloch in Simons Leben hineinblicken lässt:
»Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen.«
Markus 15,21**



Dass sich die Geschichte von Simon und seiner Familie so abgespielt haben könnte, verdeutlichen mir all die vielen Begegnungen von Menschen mit Christus.
Und die Wirkungskraft, die Christus auf Menschen damals wie heute ausgeübt hat.
Es ist die Begegnung mit dem Göttlichen, die uns zu einer Reaktion zwingt. Man kann sich von ihm abwenden oder sich ihm zuwenden – aber die Möglichkeit, ihm gegenüber gleichgültig zu bleiben, hat er uns nicht gelassen.
Christus selbst hat gesagt: »Wer mich sieht, sieht den Vater.« Johannes 14,9 Ein Blick von Simon auf diesen Christus, ein sich kreuzender Blick, mag genügt haben, um seine Gedanken, seine Gefühle, seine Sicht auf die Situation und sich selbst bleibend zu verändern. Durch alle Zeiten hindurch und bis heute ist dieses Phänomen von veränderten Leben rund um den Globus sichtbar. Persönlich habe ich erlebt, wie mein Glaube an Gott mein verhärtetes Innenleben aufgeweicht und verändert hat und wie er spürbar auch immer wieder in äußere Situationen hineingekommen ist.
In unzähligen Lebensgeschichten lässt sich genau diese Transformationskraft ausmachen – wie auch in derjenigen von Zachäus, einem Zöllner und Zeitgenossen von Jesus. Da sind der Christus, der mit Zachäus eine kurze Zeit bei einem Essen verbringt – verbringen »muss«, wie Jesus es selbst nennt Lukas 19,5 –, und das Leben einer Person, das sich massiv und bleibend verändert; mit unübersehbaren Auswirkungen für das Umfeld. Weil Zachäus in und durch Christus einen Blick, einen ungefilterten Blick, auf Gott und Gottes Wesen erhaschen konnte und schlicht darauf reagiert hat. Genauso verlangt die reine Existenz Gottes eine Reaktion von jedem menschlichen Leben. Wie diese Reaktion ausfällt, ist uns überlassen.
Ich habe immer wieder gestutzt, dass es nach der Auferweckung des toten Lazarus ganz unscheinbar heißt, dass »viele nun an ihn glaubten«. Johannes 11,45 Oft schon habe ich mich gefragt, wie es möglich ist, dass man so einem Ereignis beiwohnen kann, ohne von der Wirkungskraft von Christus überzeugt zu werden. Ich hatte da den Satz erwartet, dass die gesamte zuschauende Menge in staunendes »Ooh!« und »Aah!« ausbrach und alle nun begannen, an Christus zu glauben. Außer vielleicht Max in der zweiunddreißigsten Reihe, der gerade damit beschäftigt war, auf TikTok ein Video von seinen neuen Lederschnürsenkeln abzusetzen. Aber alle anderen können das doch unmöglich nicht mitgeschnitten haben oder die Tragweite von dem Erlebten einfach ausgeblendet haben! Doch Gott hat den »Akt des Glaubens« uns überlassen. Deshalb kann man selbst bei einer Auferstehung von Lazarus noch zweifelnd in der siebten Reihe stehen und sich fragen, ob der Kerl denn überhaupt wirklich so richtig ganz tot gewesen ist. Natürlich heißt es, dass er schon begonnen hat zu stinken, Lukas 11,39 aber vielleicht tat er das ja vorher auch schon. Oder es hat einfach der Arzt gepfuscht bei der Diagnose. Oder es war einfach ne Inszenierung, weil sich wieder mal so ein Möchtegern-Messias ins Rampenlicht schieben wollte.
Wir haben die Fähigkeit, zu sehen und doch nichts zu sehen. Wir haben die Fähigkeit, zu hören und doch nichts zu hören. Darüber mokiert sich bereits der Prophet Jeremia Jeremia 5,21 und auch Jesus selbst wirft seinen Jüngerinnen und Jüngern in einer Situation vor, zu sehen, ohne zu sehen, und zu hören, ohne zu hören. Es scheint so, als wäre das ein unrühmliches Attribut, das das Menschsein
mit sich bringen kann. »Wer Ohren hat, der höre.« Matthäus 13,9 Dummerweise scheinen die Ohrmuscheln entwicklungsbiologisch über die Jahrzehnte nicht wirklich größer geworden zu sein. Eher geschrumpft.
Wir haben bei Gott immer die Möglichkeit, uns von ihm ungläubig-zweifelnd abzuwenden oder uns ihm suchendzweifelnd und hoffend zuzuwenden. Auf dass uns Ohren und Augen geöffnet werden. Letztere Wahl scheint Simon von Kyrene getroffen zu haben. Mit Auswirkungen, die ihn und seine ganze Familie erfasst haben.
Simon war am falschen Tag zur falschen Zeit am falschen Ort mit den falschen Menschen unterwegs. Und am Ende trotzdem goldrichtig. Und überrascht von Gott.
