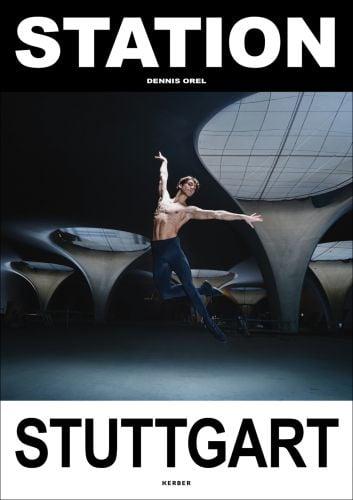


Kunst, nicht ohne Kontext. Herausforderungen und Potentiale einer Kunst im öffentlichen Raum
Stuttgarts
Sebastian Schneider
Die 30. Sitzung des Bundestags im Jahr 1950 hatte weitreichende Folgen für die Verbreitung von Kunst im öffentlichen Raum in Deutschland. Auf Empfehlung des Deutschen Städtetags beschloss man, bei Bauvorhaben des Bundes fortan ein Prozent der Bausumme für Kunstwerke bereitzustellen. Mit der sogenannten Kunst am Bau knüpfte die junge Bundesrepublik an ein Fördermodell an, das bis in die Zeit der Weimarer Republik zurückreicht und im Nationalsozialismus zu propagandistischen Zwecken instrumentalisiert worden war.1 Auch in Stuttgart lässt sich die Genese zahlreicher Skulpturen, Reliefs und Wandbilder im Stadtraum auf das Kunst am Bau-Programm zurückführen. Allerdings wurden mit staatlichen Mitteln auch Kunstwerke gefördert, die sich autonom im Stadtraum behaupteten und keine additive Funktion an Baukörpern erfüllten.
Das Aufstellen von Kunstwerken im öffentlichen Raum muss im Kontext eines umfangreichen städtischen Transformationsprozesses betrachtet werden, den Stuttgart nach 1945 durchlebte. Unter Arnulf Klett, dem damaligen Oberbürgermeister, war die kriegsversehrte Stadt in rasantem Tempo autogerecht und zweckmäßig wiederaufgebaut worden.
Die breiten Durchgangsstraßen und die unprätentiöse Architektur der 1950er Jahre prägen das Stadtbild bis heute. Die staatliche Förderung von Kunst im öffentlichen Raum verfolgte in Stuttgart – und der gesamten Bundesrepublik – neben der monetären Unterstützung von Künstler*innen aus der Region auch das ideologische Ziel, in der Nachkriegsmodernität zur ästhetischen Bildung der Gesellschaft beizutragen. Außerhalb des Museums sollten sämtliche Bevölkerungsschichten durch frei zugängliche Skulpturen zu einer Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst angeregt werden.2
Dieser pädagogisch-fördernde Anspruch geriet in den frühen 1970er Jahren in eine Krise. Im gesellschaftspolitischen Klima der sozialen Protestbewegungen setzte sich zunehmend der Wunsch nach einer Reform des Kulturbegriffs durch. Es wurden Stimmen laut, die das bildungsbürgerliche Ideal einer elitären Hochkultur ablehnten und stattdessen ein ganzheitliches Verständnis von Kultur propagierten. Die Gesellschaft solle durch Kultur demokratisiert werden, forderten Hermann Glaser und Karl-Heinz Stahl, und prägten damit im deutschen Sprachraum den Begriff Soziokultur.3 In der Verschmelzung des lateinischen Worts ›socius‹ (dt.: gemeinsam) und Kultur deutet sich bereits an, dass es Glaser und Stahl darum ging, die Kunst mit dem Leben zu versöhnen, anstatt – wie bisher geschehen – nur die Welt des Geistes als Sphäre der Kultur zu adeln.4 Eine so verstandene Kulturpolitik machte es zu ihrem Auftrag, Teilhabe, Mitbestimmung und Chancengleichheit zu ermöglichen und fand in der Forderung des Kulturpolitikers Hilmar Hoffmann nach ›Kultur für alle‹ eine griffige Formel.
Ungefähr zu derselben Zeit traten Künstler*innen mit Werken in die Öffentlichkeit, die sich nur noch schwer Gattungen wie Malerei oder Plastik zuordnen ließen. Neuartige Kunstformen wie Performance, Happening oder Fluxus zeichneten sich gerade dadurch aus, dass sie eher zwischen als innerhalb von

Joseph Beuys: 7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung als Eichen in der Wahlerhäuser Straße Pflanzjahr: ab 1982 (2019)
Gattungen operierten. Anstatt sich als in sich geschlossenes Werk zu präsentieren, öffneten sie sich strukturell für Teilhabe und Prozesshaftigkeit und adressierten damit Themen, die auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene verhandelt wurden. Als prominentes Beispiel sei auf Joseph Beuys verwiesen, dessen Schaffen im Deutschland der Nachkriegszeit besonders große Aufmerksamkeit erfahren hat. Seine Soziale Plastik entgrenzte sich weit in den Bereich des Gesellschaftspolitischen und artikulierte sich in Formen, die als prozessual, gemeinschaftlich und anti-monumental bezeichnet werden können. So entwickelte er beispielsweise für die documenta 7 das Projekt 7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung (1982). Abb. 1 Auch wenn der Titel vermuten lässt, dass es sich hier um ein Kunstwerk gigantischen Ausmaßes handelt, bestand die Arbeit zunächst nur in dem Vorhaben, eine auf mehrere Jahre angelegte Baumpflanzaktion in Kassel zu initiieren, deren Vollendung erst durch den Einsatz zahlreicher Teilnehmer*innen erreicht werden konnte.
Man könnte meinen, dass eine Kunst, deren eigentliches Material das Soziale ist, im öffentlichen Raum eine ideale Arena fände, um zur vollen Entfaltung zu kommen. Tatsächlich gelangten aber selbst in den von einem kulturpolitischen Paradigmenwechsel geprägten 1970er Jahren nur selten kritisch engagierte Kunstwerke in den Stadtraum.5 Bei der Förderung von Kunst im Außenraum hielt die öffentliche Hand lieber an einem etablierten
Werkbegriff fest. So verbreiteten sich in der Nachkriegszeit in Deutschland flächendeckend Skulpturen, die vor allem in formal-ästhetischer Hinsicht gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. »Die reitenden, schreitenden, liegenden, thronenden, gestikulierenden Figuren wurden ersetzt durch dynamische, statische, gebündelte, verspannte, farbige, verschränkte oder ausgreifende Formen und Akzente«, schreibt Jean-Christophe Ammann in seinem Plädoyer für eine neue Kunst im öffentlichen Raum und schildert damit treffend einen Ist-Zustand, der mindestens bis in die 1980er Jahre anhielt.6
Das Zitat liest sich auch als Kritik an der Formensprache einer zeitgenössischen Kunst, die es sich nach ihrer Verfemung durch die Nationalsozialist*innen als Weltsprache der Abstraktion im Unpolitischen bequem gemacht hatte. Die ›drop sculptures‹ – ein abschätziger Begriff, den Ammann verwendet, um das scheinbar beliebige Aufstellen abstrakter Skulpturen im städtischen Außenraum zu bezeichnen – befördern die ungelösten Fragen nach der gesellschaftspolitischen Funktion von Kunst jedoch mit Vehemenz an die Oberfläche. Was kann Kunst im öffentlichen Raum wirklich für die Stadtgesellschaft leisten? Entgegen den hehren Ansprüchen der Kulturpolitik, neue Zugänge und Partizipation zu ermöglichen, setzt eine formal-ästhetisch ausgerichtete Kunst im öffentlichen Raum ein hohes Maß an Distinktion voraus, und bleibt damit all jenen verschlossen, die nicht mit den Codes der Kunst vertraut sind. Die Hoffnung, eine Interaktion mit allen Stadtbewohner*innen herzustellen, nur weil man Kunst an öffentlich zugänglichen Orten platziert, erweist sich vor diesem Hintergrund als zu naiv. Vielmehr manifestiert sich in den ›drop sculptures‹ ein Konsens des Geschmacks und des Zeitgeists, der durch die Wahl von Materialien wie Stahl oder Stein noch den Anspruch erhebt, die Zeit zu überdauern.7
In Stuttgart gelangten in den frühen 1990er Jahren durch Projekte wie Platzver führung (1992/93) Abb. 2 oder die Inter-























Löffelstraße 3–7 Stuttgart Degerloch
1986–91, Keramik, glasurbemalt, Beton
Wolfgang Thiel Die Lehnend Wartende
3–7 Stuttgart Degerloch
Löffelstraße
1986–91, Keramik glasurbemalt, Beton
Wolfgang Thiel Die große Recamier







Alle Fotos von Matter Of, außer:
18 © Dana Wyse
29 rechts oben: CC BY-SA 3.0 MSeses
30 rechts unten: Andrea Welz
34 rechts oben: Andreas Schmid
38 links oben: Andrea Welz
39 rechts oben: Andrea Welz
44 links oben: CC BY-SA 3.0 de Baummapper
45 rechts oben: CC BY-SA 4.0 pjt2
46 rechts oben: Kurt Grunow
47 Henning Rogge
50 rechts unten: Fabian Kassner
52 Fabian Kassner
56 Delphine Reist
57 rechts unten: © Kunstverein Wagenhalle
58 Stadtlücken
59 © Interventionsraum, Demian Bern
60 links oben: © Rainer Schneemann
60 rechts oben: © Demian Bern
61 Andreas Mayer-Brennenstuhl
62 links oben: Günter Brombacher
62 rechts oben: Regina Brocke
63 oben: Fotosommer Stuttgart
63 unten: Wolfgang Seitz
64 Wolfgang Seitz
65 oben: Pepper and Salt
65 unten: Fabrice Weichelt, bildhübsche fotografie
66 Pepper and Salt
71 Georg Winter
72 Georg Winter
73 Georg Winter
75 Georg Winter
76 Georg Winter
71 unten: CC BY-SA 4.0 Manfred Niermann
119 oben: Staatsgalerie Stuttgart
126 Staatsgalerie Stuttgart
127 Staatsgalerie Stuttgart
181 Frank Kleinbach
214 unten: CC BY-SA 3.0 MSeses
216 unten: CC BY-SA 3.0 MSeses
217 oben: CC BY-SA 3.0 MSeses
218 unten: CC BY-SA 4.0 MSeses
235 oben: mit freundlicher Genehmigung der Sparkassen-Versicherung
310 CC BY 3.0 qwesy qwesy
316 CC BY-SA 3.0 BenzTownRocker
353 Andrea Welz

© VG Bild-Kunst, Bonn 2020 für:
Axel Anklam, Horst Antes, Hans Arp, Ulrich Bernhardt, Ernst-Reinhart Böhlig, Lothar Fischer, Günther Förg, Otto Herbert Hajek, Renate Hoffleit, Erich Hauser, Wolfram Isele, Nikolaus Kernbach, Hubert Kiecol, Henri Laurens, Anja Luithle, Camill Leberer, Thomas Lenk, Olaf Metzel, Christine Nägele, David Rabinowitch, Karin Sander, Andreas Schmid, Fritz Schwegler, Richard Serra, Ben Willikens, Eva Zippel
126 mit freundlicher Genehmigung von Atelier Avramidis/Julia Avramidis
124 unten: mit freundlicher Genehmigung von Sabine Kricke-Güse
Alle anderen Werke:
§ 59 Werke an öffentlichen Plätzen (1) Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht. (2) Die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk vorgenommen werden.
Der Nachlass von Otto Herbert Hajek wird von der Galerie Stadtatelier Urban Hajek gepflegt und betreut: +49 172 712 74 82 stadtatelier-urban.hajek@arcor.de www.galerie-uhajek.de

