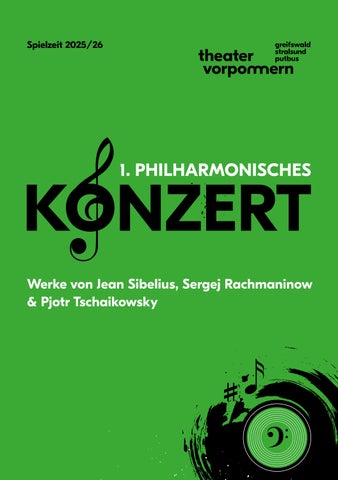Spielzeit 2025/26
KONZERT 1. PHILHARMONISCHES
Werke von Jean Sibelius, Sergej Rachmaninow & Pjotr Tschaikowsky
„Studieren Sie die Meisterwerke jedes großen Komponisten, und Sie werden jeden Zug der Persönlichkeit des Komponisten finden und den Hintergrund in seiner Musik. Die Zeit mag die Techniken von Musik ändern, aber sie kann nie ihre Mission ändern.“
Sergej Rachmaninow
Roden Noel
Jean Sibelius (1865-1957)
„Finlandia“, Tondichtung op. 26
Sergej Rachmaninow (1873-1943)
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 c-Moll op. 30
1. Moderato
2. Adagio sostenuto
3. Allegro scherzando - Pause -
Pjotr Tschaikowsky (1840-1893)
Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64
1. Andante – Allegro con anima
2. Andante cantabile, con alcuna licenza
3. Valse. Allegro moderato
4. Finale. Andante maestoso – Allegro vivace
Liebe Gäste, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen aus urheberrechtlichen Gründen untersagt sind. Vielen Dank.

Solist: Joseph Moog, Klavier
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia
Öffentliche Generalprobe
Mo 08.09.2025 Greifswald: Stadthalle / Kaisersaal
Konzerte
Di 09.09.2025 Greifswald: Stadthalle / Kaisersaal
Mi 10. & Do 11.09.2025 Stralsund: Großes Haus
Fr 12.09.2025 Putbus
JOSEPH MOOG
Joseph Moog gehört zu den herausragenden Pianisten seiner Generation.
Internationale Aufmerksamkeit erlangte er durch Soloauftritte bei renommierten Konzertreihen und Festivals, darunter die Meesterpianisten im Concertgebouw Amsterdam, das New Ross Piano Festival in Irland, das Festival La Roque d’Anthéron, die Istanbul Recitals, das Fribourg International Concert Series und das Eesti Kontsert Piano Festival in Tallinn. In den USA war er mehrfach zu Gast, u. a. bei der Frick Collection in New York, der Gilmore International Piano Series, Washington Performing Arts sowie beim Miami International Piano Festival. Auf seiner Asientournee spielte er u. a. in Seoul, Tokio, Singapur und mit der Hong Kong Sinfonietta.
Er arbeitet regelmäßig mit namhaften Orchestern weltweit zusammen – darunter das Philharmonia Orchestra London, das Royal Philharmonic Orchestra, das Hallé Orchestra, die Stuttgarter Philharmoniker, das Bruckner Orchester Linz, das Philharmonische Orchester Helsinki, das Orchestre Métropolitain de Montréal, die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sowie Orchestern in Moskau, Paris, Prag und den Niederlanden.
Dabei musizierte er unter der Leitung renommierter Dirigenten wie Yannick Nézet-Séguin, Matthias Pintscher, Michael Sanderling, Philippe Entremont, Ryan Bancroft, Lawrence Foster und vielen anderen.
Innovative Programme und eine preisgekrönte Diskografie dokumentieren Joseph Moogs umfangreiches Repertoire und stehen für seine einzigartige Künstlerpersönlichkeit. 2009 erhielt er die Auszeichnung als Steinway Artist und wurde mit dem Prix Groupe de Rothschild geehrt. Er lebt in der Nähe von Luxemburg, ist Mitbegründer des Konz Musik Festivals und wirkt als Kulturbotschafter seiner Heimatstadt Neustadt an der Weinstraße.
Am Theater Vorpommern war Joseph Moog bereits zweimal im Rahmen der Philharmonischen Konzerte als Solist unter der Leitung von Generalmusikdirektor Florian Csizmadia zu erleben: im April 2019 mit dem 5. Klavierkonzert von Camille Saint-Saëns und zuletzt im Juni 2022 mit dem 3. Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow.
JEAN SIBELIUS:
„FINLANDIA“ OP. 26
„Finlandia. Warum erzeugt dieses Tongedicht so eine Resonanz? Vermutlich wegen seines ‚Plein-air‘-Stils. Es ist tatsächlich nur auf Themen gebaut, die mir zugeflossen sind. Reine Eingebung! Herrlich, herrlich!“
Jean Sibelius, Tagebucheintrag vom 23.12.1922
Finnland am Ausgang des 19. Jahrhunderts: ein Land mit einer jahrhundertealten kulturellen Tradition, aber noch zwei Jahrzehnte von der Unabhängigkeit entfernt und – nach langer politischer Zugehörigkeit zu Schweden –seit 1809 Teil des Russischen Reichs im Rang eines Großfürstentums. Wie auch in anderen europäischen Ländern kam den Künsten im Zuge eines erstarkenden Nationalbewusstseins eine herausgehobene Position zu, da sich in ihnen die kulturelle Identität des Landes ausdrücken ließ, ohne allzu offensiv in den politischen Diskurs einzugreifen. Jean Sibelius hatte bereits mit der KullervoSinfonie (1892) und den LemminkäinenLegenden (1896) – letztere haben wir 2024 im Rahmen unseres Sibelius-Zyklus aufgeführt – wichtige Beiträge zur finnischen Nationalromantik geleistet. 1899 schränkte das „Februarmanifest“ von Zar Nikolaus II. die finnische Auto-
nomie und die Pressefreiheit spürbar ein. Die in Helsinki stattfindenden „Pressefeiern“ dienten der finanziellen Unterstützung der durch das Verbot zahlreicher Zeitungen arbeitslos gewordenen Journalisten, gestalteten sich aber unübersehbar als theatralische Veranstaltung zur Glorifizierung der finnischen Kultur, indem in einer Folge von lebenden Bildern Szenen aus der finnischen Geschichte dargestellt wurden. Hierfür schuf Sibelius eine sechssätzige Begleitmusik, deren Finale mit „Finnland erwacht“ betitelt ist und die Urfassung der Tondichtung „Finlandia“ darstellt.
Diese entstand ein halbes Jahr später durch eine geringfügige Überarbeitung des Schlusses, als das Philharmonische Orchester Helsinki für eine Europatournee bei Sibelius ein Orchesterwerk bestellte. Die Uraufführung fand am 2. Juli 1900 in Helsinki unter dem Titel „Suomi“ (Finnland) statt, firmierte in der Presse aber bereits als „Finlandia“. Allerdings wurde das Stück zur Vermeidung von politischen Schwierigkeiten auf der Tournee auch unter dem Namen „Vaterland“ annonciert, womit der finnische Bezug verschleiert wurde, da damit das gesamte Vaterland (inklusive Russland)
gemeint sein konnte. Im zaristischen Einflussbereich außerhalb Finnlands war der Titel „Finlandia“ verboten; dort wurde das Werk unter dem ebenso unverfänglichen wie nichtssagenden Titel „Impromptu“ aufgeführt.
Der Bezug von „Finlandia“ zu Werken wie Franz Liszts „Hungaria“, Milij Balakirevs „Russia“ und natürlich Bedřich Smetanas „Mein Vaterland“ liegt auf der Hand. Eine deutliche Verwandtschaft besteht zudem zu Edward Elgars fast zeitgleich entstandenem ersten „Pomp and Circumstance“-Marsch: Hier wie dort löste man später die im Zentrum erklingende hymnische Melodie heraus, die in textierter Form zur inoffiziellen Nationalhymne des jeweiligen Landes wurde und den Komponisten zu einer nationalen Ikone werden ließ –mit allen Vor- und Nachteilen, die in der späteren Rezeption daraus erwachsen sollten.
Sibeliusʼ Tondichtung ist klar zweigeteilt: Der langsame erste Teil hebt mit wuchtigen Bläserklängen an, die unschwer das Lasten des Schicksals auf dem finnischen Volk darstellen. Der zweite Teil beginnt mit Bläserfanfaren, in die sich zunächst eine Reminiszenz des ersten Teils einmischt, ehe sich die Fanfarenmotivik endgültig durchsetzt und den Charakter eines Geschwindmarschs annimmt. Kontrastierend dazu wird –
zunächst in den Holzbläsern, dann in den Streichern – ein gesangliches Thema eingeführt, das hier den Charakter eines innigen Gebets hat, und das –nach einer kurzen Reprise des Marschs – die Tondichtung im Gestus einer triumphalen Hymne abschließt.
Sibelius hatte ein gespaltenes Verhältnis zu dem Werk, das er einerseits oft selbst aufführte, andererseits aber bereits 1911 als „im Vergleich zu meinen anderen Werken eine unbedeutende Komposition“ bezeichnete. Als er 1943 im Rundfunk die Übertragung des Europakonzerts aus Berlin hörte, notierte er in seinem Tagebuch: „Alle Komponisten waren mit ihren besten Werken repräsentiert – ich mit Finlandia.“ Daraus spricht ein Unwohlsein angesichts der Popularität dieses einen Werkes. Aus gebührender zeitlicher Distanz betrachtet muss man aber auch konstatieren, dass „Finlandia“ weit mehr ist als ein zeitverhaftetes Gelegenheitswerk: In seinem „Open-air“oder (in Sibelius‘ Worten) „Plein-air“-Stil mit betont einfacher Faktur, hinter der sich gleichwohl hohes kompositionstechnisches Handwerk verbirgt, und unwiderstehlich mitreißendem Schwung hat das Stück Qualitäten, die mehr als rechtfertigen, dass es auch außerhalb Finnlands zu den Paradestücken der Konzertliteratur zählt und insbesondere als Ouvertüre eines Konzertabends seine Wirkung nie verfehlt.
SERGEJ RACHMANINOW:
KLAVIERKONZERT
NR. 2 C-MOLL OP. 18
„Im Sommer begann ich zu komponieren. Das Material wuchs, und neue musikalische Ideen begannen sich in mir zu regen.“ Sergej Rachmaninow über die Entstehung seines 2. Klavierkonzerts
Kaum ein Werk der klassischen Musik ist so eng mit dem inneren Leben seines Schöpfers verknüpft wie Sergej Rachmaninows Zweites Klavierkonzert. Es ist mehr als ein Meisterwerk der romantischen Klavierliteratur – es ist ein klingendes Selbstporträt, ein musikalischer Befreiungsschlag und ein Zeugnis davon, wie aus künstlerischem Schweigen wieder Klang erwachsen kann.
Nach dem Fiasko der Uraufführung seiner Ersten Sinfonie im Jahr 1897 fiel der damals 24-jährige Rachmaninow in eine schwere Depression. Der Absturz war brutal: Von der Kritik zerrissen, öffentlich verspottet – ein Kritiker sprach gar von „krankhaft perverser Harmonisierung“. Rachmaninow, ein sensibler junger Künstler, verstummte. Fast drei Jahre lang war er nicht in der Lage zu
komponieren. „Ich fühlte mich leer, völlig unfähig, weiterzuarbeiten“, schrieb er später.
Erst Anfang 1900 kam die Wende –durch die Hilfe des Arztes Dr. Nikolaj Dahl, eines einfühlsamen Hypnotherapeuten und Musikliebhabers. In täglichen Sitzungen versuchte Dahl, das zerbrochene Selbstvertrauen des Komponisten zu heilen. Rachmaninow selbst erinnerte sich:
„Ich hörte die gleichen hypnotischen Formeln Tag für Tag wiederholt, während ich schlafend in Dahls Behandlungszimmer lag. ‚Du wirst dein Konzert schreiben … Du wirst mit großer Leichtigkeit arbeiten … Das Konzert wird von exzellenter Qualität sein …‘ Es waren immer dieselben Worte ohne Unterbrechung. Auch wenn es unglaublich erscheint, diese Therapie half mir wirklich.“
Und tatsächlich: Im Sommer 1900 begannen Rachmaninows musikalische Ideen zurückzukehren. In Italien und auf
dem russischen Landgut Krasnenkoje entstanden erste Skizzen – zunächst für den zweiten und dritten Satz. Nach einer Teilaufführung im Dezember in Moskau fand er die Kraft, auch den ersten Satz zu vollenden. Die vollständige Uraufführung am 27. Oktober 1901 in Moskau, mit dem Komponisten selbst am Klavier, wurde zu einem überwältigenden Triumph. Rachmaninow war zurück –nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch. Aus tief empfundener Dankbarkeit widmete er sein neues Werk jenem Arzt, der ihm geholfen hatte, die Dunkelheit zu überwinden und seine schöpferische Kraft wiederzufinden.
Das Konzert beginnt nicht mit einem orchestralen Paukenschlag, sondern mit einsamen, schweren Klavierakkorden – „glockenartig“ aufgebaut, meditativ, fast beschwörend. Rachmaninow, der sein Leben lang von Glockenklängen fasziniert war, entwickelt hier ein Motiv der Sammlung, des Innehaltens. Erst danach setzt das Orchester ein –leidenschaftlich, drängend, mit einem Thema, das voller innerer Bewegung ist. Der russische Komponist Nikolai Medtner nannte es „eine der russischsten Melodien überhaupt – ohne folkloristische Pose, aber ganz Russland erhebt sich in ihr“.
Dieser Satz ist mehr als Musik – er ist eine Selbstvergewisserung. Rachmaninow selbst sprach von seiner Musik als
„Kampf zwischen Herz und Verstand“. Das erste Thema ringt sich durch düstere Harmonien, entwickelt sich, erhebt sich – ein seelischer Kraftakt in Tönen. Der zweite Satz ist ein poetisches Innehalten. In E-Dur – einer tonalen Aufhellung – schwebt die Musik wie ein lichter Traum durch den Raum. Eine tastende Flöte, gedämpfte Streicher, ein sanftes Klavier – alles wirkt wie ein vorsichtiges Herantasten an eine Erinnerung.
„WIE
SCHÖN KANN ER DIE STILLE ZUM KLINGEN BRINGEN!“,
staunte Maxim Gorki über Rachmaninow – ein Satz, der sich auf dieses Adagio wie kaum ein anderer anwenden lässt. Und doch ist auch hier Bewegung, innere Unruhe, ein Sich-Aufbäumen gegen das Verschwinden – bevor das Hauptthema in erlöster Schönheit zurückkehrt.
Das Finale beginnt mit einem marschartigen Motiv, das sich bald in virtuose Kaskaden und rhythmische Energie auflöst. Doch mitten in diesem Spiel taucht sie auf: eine der berühmtesten Melodien des 20. Jahrhunderts – zuerst in den Bratschen, dann im Klavier. Breit, gesanglich, bittersüß. Eine Melodie, die später nicht nur Kinofilme untermalen, sondern auch in der Popularmusik überleben sollte – etwa in Frank Sinatras „Full Moon and Empty Arms“ oder Eric Carmens „All by Myself“. Rachmaninow führt diese Melodie durch immer größere Bögen, steigert sie bis zu einem ekstatischen Schluss. Das Werk endet nicht in Resignation, sondern in einer fast triumphalen Geste – als feiere sich die Musik selbst, nicht aus Eitelkeit, sondern aus purer Lebensfreude.
Trotz seines Erfolgs war Rachmaninow zu Lebzeiten nicht unumstritten. Zeitgenössische Kritiker warfen ihm „Rückständigkeit“ vor, sahen ihn als überlebten Romantiker in einer Welt der musikalischen Moderne. Er selbst hielt dagegen:
So blieb er sich treu – und wurde gerade dadurch zum Publikumsliebling. Seine Musik wirkt bis heute unmittelbar – nicht nur wegen ihrer technischen Brillanz, sondern wegen ihrer emotionalen Tiefe. Sein Klaviersatz verlangt höchste Virtuosität: Rachmaninow selbst hatte eine enorme Handspanne (er konnte mit einer Hand Intervalle bis zur Dezime greifen), aber er verlangte vom Interpreten nie leere Show. In seiner Musik liegt eine Seele – die Seele eines Suchenden, eines Verletzten, der den Mut fand, weiterzugehen.
Rachmaninows Zweites Klavierkonzert ist längst zum Kultstück geworden. Es begleitet Menschen durch Liebesgeschichten, durch Krisen, durch Lebenswenden. In der britischen BBC-Sendung „Desert Island Discs“ zählt es seit Jahrzehnten zu den meistgewählten „Überlebenswerken“ – Musik, die man mitnehmen würde, wenn man auf einer einsamen Insel nur ein paar Aufnahmen wählen dürfte.
„MELODIE IST DAS FUNDAMENT ALLER MUSIK. EINE VOLLKOMMENE MELODIE ENTHÄLT
BEREITS IHRE EIGENE HARMONIE.“
Und vielleicht ist das das größte Kompliment, das Musik je bekommen kann: dass sie bleibt, tröstet, spricht – wo Worte versagen. Rachmaninow selbst sagte einmal:
„ICH
BEGANN WIEDER MUSIK ZU HÖREN –IN MEINEM INNERN. NEUE FORMEN ENTWICKELTEN SICH – BEREIT, ZU KLINGEN.“

Mit seinem Zweiten Klavierkonzert fand Rachmaninow musikalisch zu sich selbst zurück – und schuf eines der ausdrucksstärksten Werke der Klavierliteratur.
JOTR TSCHAIKOWSKY:
SINFONIE NR. 5
E-MOLL OP. 64
„Ich arbeite ziemlich beharrlich, nämlich an einer Sinfonie, die, wenn ich mich nicht irre, nicht schlechter sein wird als die vorherigen. Aber vielleicht scheint es mir nur so; Gott gebe, dass es so ist, aber in letzter Zeit verfolgt mich ständig der Gedanke, dass ich mich ausgeschrieben habe, dass der Kopf leer ist, dass es Zeit ist aufzuhören.“
Pjotr Tschaikowsky an Wladimir Nápravnik, 7.6.1888
Mit diesen offenen Worten lässt uns
Tschaikowsky an den Zweifeln teilhaben, die seine Fünfte Sinfonie wie ein dunkler Schatten begleiteten – und die bis zur Uraufführung und darüber hinaus nicht ganz weichen sollten. Der Weg zu diesem Werk, das heute zu den populärsten Kompositionen des russischen Meisters zählt, war keineswegs geradlinig. Die Fünfte Sinfonie entstand unter dem Eindruck intensiver innerer Spannungen und eines künstlerischen Selbstverständnisses, das sich zunehmend von den zeitgenössischen ästhetischen Dogmen emanzipierte.
Nach der 1877 abgeschlossenen Vierten Sinfonie geriet Tschaikowsky in eine kompositorische Lähmung – besonders im Hinblick auf die Gattung der Sinfonie. Er fühlte sich hin- und hergerissen zwischen den Polen absoluter und programmatischer Musik. Der früher so scharf gezogene Gegensatz zwischen beiden löste sich für ihn zunehmend auf. Bereits 1878 verteidigte er gegenüber seinem einstigen Schüler und Freund Sergej Tanejew die Notwendigkeit eines inneren Programms – „ähnlich wie Beethovens Fünfte“ – als Bedingung für die künstlerische Tiefe einer Sinfonie.
Nach der „Manfred-Sinfonie“ (1885) wandte sich Tschaikowsky 1888 erneut der Gattung zu – nun ohne programmatischen Bezug. Angeregt durch Eindrücke seiner ersten Europatournee, schrieb er seinem Bruder Modest: „Im Sommer werde ich unbedingt eine Sinfonie schreiben.“ Der kreative Funke wollte dennoch nicht recht überspringen – „Keinerlei Gedanken und Stimmungen!“ notierte er im Mai. Erst im Juni be-
gann er, die Sinfonie aus seinem „dumpfen Hirn zu quetschen“, und bereits zehn Tage später lag das Particell vor. In einem beispiellosen Kraftakt arbeitete Tschaikowsky mit solcher Intensität, dass er nebenbei noch eine Ouvertüre zu „Hamlet“ entwerfen konnte.
Die Entstehungsgeschichte der Fünften ist nicht nur eine Chronik kompositorischer Arbeit, sondern auch eine Geschichte emotionaler Berg- und Talfahrten. Zunächst hatte Tschaikowsky geplant, das Werk Edvard Grieg zu widmen – schließlich war es jedoch Theodor Avé-Lallemant, ein betagter Hamburger Musikfreund, der die Ehre erhielt. Die Londoner Philharmonische Gesellschaft musste sich mit einem späteren Versprechen zufriedengeben, wenngleich man dort hoffte, dass die Sinfonie als „die Londoner“ bekannt werden würde. Tatsächlich aber wurde sie zu Tschaikowskys „Hamburger Sinfonie“.
„HABE ICH MICH, WIE MAN SAGT, AUSGESCHRIEBEN? HAT LE COMMENCEMENT DE LA FIN [der Anfang vom Ende] BEREITS BEGONNEN?“
Die Uraufführung fand im November 1888 in St. Petersburg statt, unter der Leitung des Komponisten selbst. Während das Publikum begeistert reagierte, war die Kritik gemischt – und Tschaikowsky selbst schon bald enttäuscht. Er empfand sein Werk als „zu bunt, massiv, unehrlich“, ja sogar „missglückt“. Die Selbstkritik kulminierte in der Frage:
Erst die Aufführung in Hamburg im März 1889 brachte die Wende. Der Komponist, bis dahin vom eigenen Werk entfremdet, schrieb euphorisch an seinen Neffen: „Ich habe sie wieder zu lieben begonnen – ich hatte doch eine übertrieben schlechte Meinung von ihr.“
Doch ist diese Wandlung allein musikalisch zu erklären? Oder war es die Resonanz eines Publikums, das ihm in Westeuropa mit offenen Armen begegnete? Sicher ist: Tschaikowsky begann, das Werk zu überarbeiten. Insbesondere nahm er zwei Kürzungen im Finale vor, um dessen Struktur zu straffen.
In unserem Konzert erklingt diese besondere „Hamburger Fassung“ – eine rekonstruiert überlieferte Version, die Tschaikowskys letzte bekannte Änderungen an der Fünften Sinfonie berücksich-
tigt. Grundlage dafür sind Hinweise in Tagebuchnotizen, Briefen und nicht zuletzt die Partitur des Dirigenten Willem Mengelberg, dem Tschaikowskys Bruder Modest später offenbar Einblick in die heute nicht mehr erhaltene Dirigierpartitur des Komponisten gewährte. So enthalten diese Aufführungsmaterialien etwa einen zusätzlichen Beckenschlag sowie zwei markante Kürzungen im Finale. Auch der Dirigent Arthur Nikisch, ein weiterer prominenter Förderer der Sinfonie, übernahm einige dieser Änderungen in seinen Interpretationen – was zusätzlich für ihren Ursprung bei Tschaikowsky selbst spricht.
Im Zentrum von Tschaikowskys Fünfter Sinfonie steht ein zyklisches Hauptmotiv. Wie ein roter Faden zieht es sich durch alle vier Sätze, was dem Werk eine starke innere Geschlossenheit verleiht. Der Komponist selbst soll dieses Thema, den Erinnerungen Willem Mengelbergs zufolge, als „Schicksals- oder Todesmotiv“ bezeichnet haben. In einem anderen Zusammenhang sprach Tschaikowsky von einem Ausdruck des „völligen Beugens vor dem Schicksal“. Diese Deutungen verweisen auf die zentrale Bedeutung des Motivs: Es ist mehr als ein musikalisches Element – es steht sinnbildlich für die existenzielle Auseinandersetzung mit dem eigenen Schicksal, die sich durch die ganze Sinfonie zieht.
Besonders im zweiten Satz, einer der innigsten und leidenschaftlichsten Eingebungen des Komponisten, verdichten sich emotionale Tiefe und persönliche Erfahrung. Die weit ausschwingende Melodie der Solo-Hornstimme ist oft als Ausdruck einer unerfüllten Liebe gedeutet worden – und ein überliefertes Textfragment, das Tschaikowsky diesem Thema möglicherweise unterlegte („Oh, wie ich dich liebe, bis ans Ende meines Lebens“), legt nahe, wie stark diese Musik emotional aufgeladen ist. Was genau das Finale bedeutet – ob es einen Sieg des Individuums über das Schicksal darstellt oder vielmehr eine letzte, erzwungene Affirmation –, bleibt letztlich offen.
Trotz – oder vielleicht gerade wegen –des Fehlens eines offiziellen Programms bleibt Tschaikowskys Fünfte ein musikalisches Rätsel von zeitloser Faszination.
In ihr spiegeln sich die Zweifel, Sehnsüchte und Kämpfe eines Komponisten, der in der Auseinandersetzung mit dem westlichen Sinfoniemodell zugleich seine russische Identität, seine persönliche Ausdruckskraft und seine existentielle Fragilität zu einem einzigartigen Klangbild vereinte – „nicht schlechter als die vorherigen“, sondern, wie Tanejew beharrlich betonte, vielleicht sogar sein bestes Werk.
TSCHAIKOWSKY

DREI KOMPONISTEN
Ein musikalisches Netzwerk der Spätromantik
„FÜR IHN PROPHEZEIE ICH EINE GRO ß E ZUKUNFT.“
Tschaikowsky über Rachmaninow
Rachmaninow und Tschaikowsky verband eine enge künstlerische Beziehung. Tschaikowsky erkannte früh Rachmaninows Talent, unterstützte ihn öffentlich und setzte sich für die Uraufführung seiner Oper „Aleko“ ein. Rachmaninow bewunderte Tschaikowsky zutiefst, widmete ihm nach dessen Tod sein Trio élégiaque Nr. 2 und dirigierte sowie spielte seine Werke zeitlebens. Ihre Musik verbindet emotionale Tiefe und russische Klangsprache. Tschaikowsky war Rachmaninows wichtigster Mentor und Vorbild.
Sibelius und Tschaikowsky kannten sich nicht persönlich, doch Tschaikowskys Musik, insbesondere die 6. Sinfonie („Pathétique“), beeinflusste Sibelius stark. Vor allem in seinen frühen Sinfonien zeigt sich Tschaikowskys Einfluss in Melodik und Orchestrierung. Beide Komponisten teilten die spätromantische Klangwelt, wenn auch mit unterschiedlichen Zielen. Während Tschaikowsky das Dramatische suchte, fand Sibelius später zu einer naturverbundenen, eigenen Tonsprache.
„IN DIESEM MANN IST VIEL, WAS ICH AUCH IN MIR ERKENNE.“
Sibelius über Tschaikowsky
Sibelius und Rachmaninow begegneten sich nie persönlich und standen stilistisch für sehr unterschiedliche Haltungen. Rachmaninow blieb seiner spätromantischen Tonsprache treu, während Sibelius ab seiner Vierten Sinfonie einen eigenständigen modernen Stil entwickelte, der ihn zu einem der bedeutendsten Erneuerer der Musik im frühen 20. Jahrhundert machte. Ihre Werke spiegeln zwei unterschiedliche Wege wider, mit den Herausforderungen einer sich wandelnden Musikwelt um 1900 umzugehen.

VORSCHAU
2. PHILHARMONISCHES
KONZERT
Maurice Ravel „Alborada del gracioso“, „Ma mère l’oye“ (Suite), „La valse“
Modest Mussorgsky / Maurice Ravel „Bilder einer Ausstellung“
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia
Öffentliche Generalprobe
Mo 13.10.2025, 19.00 Uhr Greifswald: Stadthalle / Kaisersaal
Konzerte
Di 14.10.2025, 19.30 Uhr Greifswald: Stadthalle / Kaisersaal
Mi 15. & Do 16.10.2025, 19.30 Uhr Stralsund: Großes Haus

Noch
mehr zu entdecken
gibt es auf unserem Instagramkanal: www.instagram.com/phil_vorpommern @phil_vorpommern
Impressum
Herausgeber: Theater Vorpommern GmbH
Stralsund – Greifswald – Putbus
Spielzeit 2025/26
Geschäftsführung: André Kretzschmar
Textnachweise:
Redaktion: Stephanie Langenberg Gestaltung: Öffentlichkeitsarbeit TVP / Bartels
1. Auflage: 500
Druck: Flyeralarm www.theater-vorpommern.de
Die Texte sind Originalbeiträge für dieses Programmheft von Dr. Florian Csizmadia (Sibelius’ Tondichtung „Finlandia“) und Stephanie Langenberg (Rachmaninows 2. Klavierkonzert und Tschaikowskys 5. Sinfonie sowie die Texte auf den Seiten 14/15).
Bildnachweise:
S. 2: Joseph Moog, Copyright Thommy Mardo; S. 9: Sergej Rachmaninow, George Grantham Bain Collection, undatiert; S. 13: Pjotr Tschaikowsky, 1888, vermutlich von Leonard Berlin im Atelier E. Bieber Hamburg; S. 15: Jean Sibelius, Daniel Nyblin, 1913.
Das Theater Vorpommern wird getragen durch die Hansestadt Stralsund, die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und den Landkreis Vorpommern-Rügen
Es wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und EU-Angelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern.