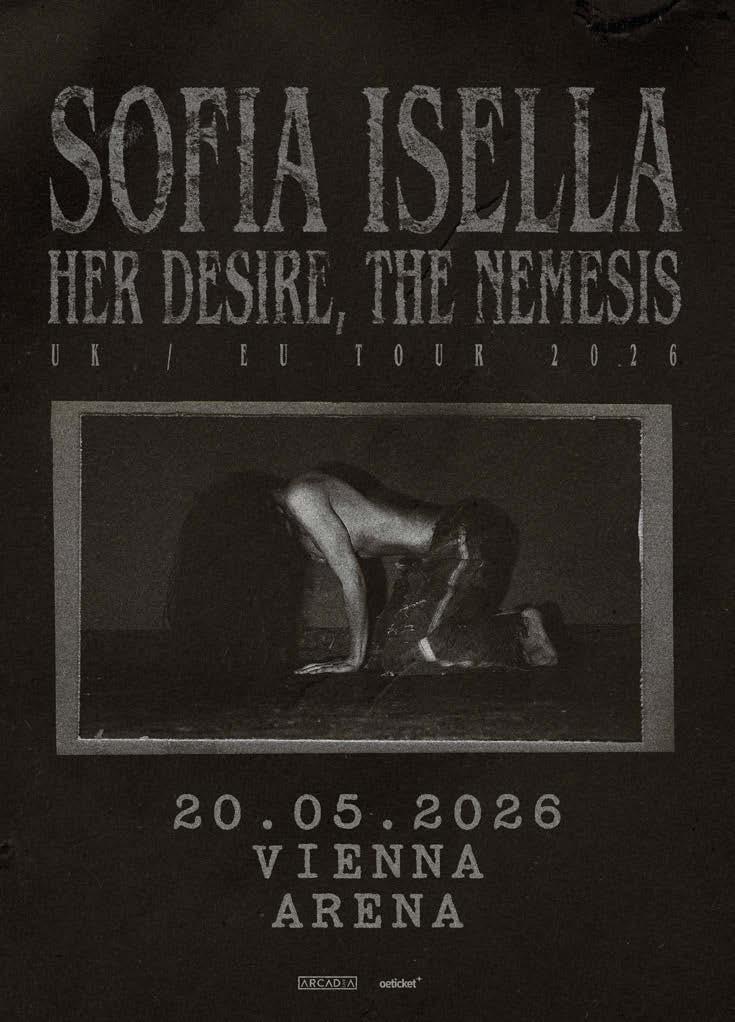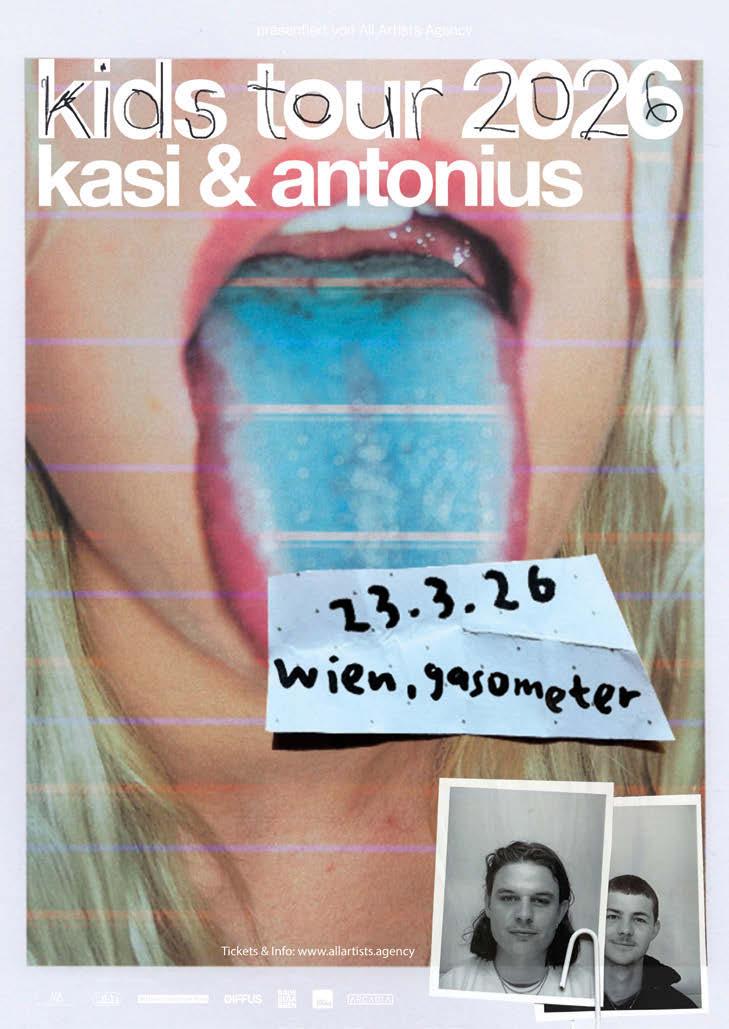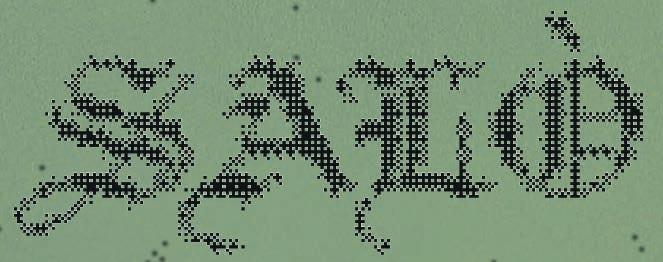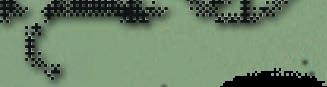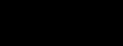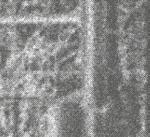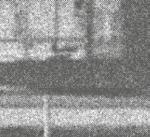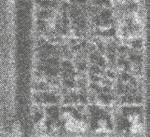Hypekultur hat Hochkonjunktur
Warum uns der Zeitgeist Labubus, Dubai-Schokolade und Matcha Latte auf die For-You-Page spült






Warum uns der Zeitgeist Labubus, Dubai-Schokolade und Matcha Latte auf die For-You-Page spült





























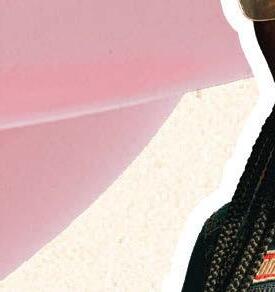
































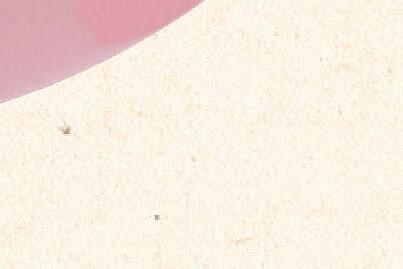



Wir leben in einer extrem visuellen Gesellschaft – das stellt nicht nur unsere Autorin Ania Gleich in ihrem Bericht über die aktuelle LisetteModel-Retrospektive fest. Auch die Berufsfotograf*innen, mit denen Sarah Aberer für diese Ausgabe geredet hat, sehen das ähnlich. In der Tat sind wir heute von einem permanenten Bilderstrom umgeben, den wir selbst ständig mitproduzieren. Schuld ist mal wieder das Internet. Digitale Bilder wiegen nichts, nehmen keinen Platz ein und kosten –quasi – nichts. Also lieber gleich noch drei, vier mehr geschossen und in den Instagram-Photo-Dump inkludiert.
Das hat natürlich auf den Wert des einzelnen Bildes einen Einfluss. Nicht nur in Hinblick auf dessen Produktionskosten, sondern auch, was den ökonomischen sowie insbesondere den immateriellen Wert angeht. Von Ersterem können die Pressefotograf*innen im Artikel von Jannik Hiddeßen ebenfalls ein Lied singen. Zweiteres merken wir alle, denn die Zeit, in der wir Bilder unserer Partner*innen in den Geldtaschen mit uns herumtrugen, ist großteils vorbei.
Oder doch nicht? Denn analoge Fotografie, Fotoautomaten, Polaroids und Co liegen wieder im Trend. Ob das jedoch nur eine weitere Ausformung jener Hypezyklen ist, über die Anja Linhart in der Coverstory schreibt, oder Teil einer nachhaltigen Gegenbewegung, bleibt abzuwarten. Bislang scheinen die meisten dieser Slow-Movements jedoch eher Inseln für Bobos mit genug disposable income zu sein als wahre Alternativen für die breite Gesellschaft. Bewusst zu leben, ist halt einfacher, wenn man sich mehr Sorgen um das »bewusst« als um das »leben« machen kann.
Was also tun? Müssen wir etwas tun? Sollten wir uns lieber dem Bilderstrom hingeben und völlig in ihn eintauchen? Zwischen einer solchen totalen Resignation und der Verweigerung moderner Technologien gibt es wohl doch noch ein paar Schattierungen. Hito Steyerl hat da schon vor einigen Jahren mit ihrem Text »In Defense of the Poor Image« in eine ähnliche Richtung gestikuliert. Anstatt über pixelige, wertlose Bilder zu jammern, sollten wir ausloten, welche Potenziale in ihnen stecken. Und sie dann – gegebenenfalls – für unsere (politischen/ künstlerischen) Zwecke subvertieren.

Bernhard Frena Chefredakteur • frena@thegap.at
Web www.thegap.at
Facebook www.facebook.com/thegapmagazin
Twitter @the_gap
Instagram thegapmag
Issuu the_gap
Herausgeber
Manuel Fronhofer, Thomas Heher
Chefredaktion
Bernhard Frena
Gestaltung
Markus Ra etseder
Autor*innen dieser Ausgabe
Sarah Aberer, Luise Aymar, Barbara Fohringer, Ania Gleich, Jannik Hiddeßen, Selma Hörmann, Anja Linhart, Kamia Liu, Veronika Metzger, Tobias Natter, Dominik Oswald, Helena Peter, Simon Pfeifer, Sarah Wetzlmayr
Kolumnist*innen
Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner
Coverillustration
Lisa Arnberger/missfelidae.com
Lektorat
Jana Wachtmann
Anzeigenverkauf
Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl
Distribution
Wolfgang Grob
Druck
Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.
Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien
Geschäftsführung
Thomas Heher
Produktion & Medieninhaberin
Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien
Kontakt
The Gap c/o Comrades GmbH
Hermanngasse 18/3, 1070 Wien o ice@thegap.at — www.thegap.at
Bankverbindung
Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX
Abonnement
6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at
Heftpreis
€ 0,—
Erscheinungsweise
6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.
Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.
016Momentaufnahmen
Lukas Oscar im Porträt
020Ein romantischer, makabrer Liebesfilm
Elsa Kremser und Levin Peter über »White Snail«
022Zwischen Trend und Removal Tattoos im Wandel
026Warum mehr manchmal doch mehr sein darf
Kitsch, Kunst und Weiblichkeit
030Das ungeplante Sehen Wie Lisette Model die Street-Photography prägte
034»Jede Woche sieht anders aus« Das Berufsfeld Fotografie
038Auf der Suche nach dem anderen Foto Pressefotografie zwischen Kunst und Dokumentation



Fotografie Der Alltag im Foto und Fotograf*innen im Alltag
003 Editorial/Impressum
006 Comics aus Österreich: Viktoria Strehn
007 Charts
014 Golden Frame
040 Gewinnen
041 Rezensionen
044 Termine
008 Gender Gap: Toni Patzak
052 Screen Lights: Christoph Prenner
058 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl
Selma Hörmann
»Am liebsten höre ich Genres mit Gitarren«, fasst unsere aktuelle Praktikantin ihren Musikgeschmack zusammen. Sie meint damit alles von Metal, Punk und Hardcore (vorwiegend) bis hin zu Divorced-Dad-Rock (Guilty Pleasure!). Kein Wunder also, dass sie vor einigen Jahren das Cello gegen die elektrische Klampfe eingetauscht hat. Schon seit September kümmert sich Selma liebevoll um Website und Social Media von The Gap. Wie sie in ihrem Tattooartikel beweist, meistert sie aber auch umfangreiche Reportagen mit Aplomb.
Kamia Liu
Okay, eine 21-Jährige nach ihren Jugendsünden zu fragen, ist vielleicht nicht besonders clever. Zu Recht erwidert Kamia, dass sie wohl noch so einige vor sich habe. Angesichts dieses Fauxpas freut uns umso mehr, dass ihr unser »jugendlicher, unterhaltsamer« Schreibstil zusagt. How do you do, fellow kids? Aber Spaß und Alter beiseite, wie gut sie es schafft, gesellschaftliche Mechanismen hinter Oberflächen wie Kitsch zu hinterfragen, zeigt sie in ihrem ersten längeren Artikel. Wir hoffen auf viele weitere!



Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal demonstriert Viktoria Strehn die Tragweite von gutem Paneling. ———— Was der Schnitt im Film macht, leistet das Paneling im Comic. Es taktet die Handlung, gibt einzelnen Szenen mehr oder weniger Raum, liefert neue Blickwinkel und fokussiert auf Details. Doch während der Schnitt die Handlung linear in der Zeit organisiert, ordnet das Paneling sie im Raum an. Was das in der Praxis bedeutet, kann man in Viktoria Strehns Comic auf der folgenden Seite sehen. Denn anstatt des automatischen Ablaufs eines Films, bei dem zu jedem Zeitpunkt immer nur ein Frame sichtbar ist, kann hier die gesamte Seite auf einmal wahrgenommen werden. So ergibt sich die erzählerische Struktur auf einen Blick und sie funktioniert gleichzeitig als Organigramm des Urlaubsfotofrusts als auch als detailverliebte Slice-of-Life-Erzählung. Viktoria Strehn ist Comiczeichnerin und Illustratorin. Ihren behänden Umgang mit dem Medium stellt sie nicht nur in ihren eigenen Arbeiten unter Beweis, sondern sie gibt ihn auch in Comickursen weiter. Nähere Infos unter www.lernezeichnen.com.
Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com




TOP 10
Lebensessentials: kleine Dinge für inneren Seelenfrieden
01 Morgens Ka ee mit ganz viel Hafermilch
02 Warme, indirekte Beleuchtung aka viele Lampen (Deckenlicht verboten!)
03 Nachts Fahrrad zu fahren
04 Die Farbe Rot
05 Yoga (Ommm)
06 Konzerte allein zu besuchen
07 Vanillekipferl von Oma
08 (M)ein frisch überzogenes Bett
09 Linsensuppe (selbstgekocht)
10 Ohne Reservierung ein leeres Abteil im Nachtzug zu ergattern
TOP 03
Bücher
01 »Life According to Vincent. 150 Inspiring Quotes« von Vincent van Gogh
02 »Normal People« von Sally Rooney
03 »Big Magic« von Elizabeth Gilbert
Auch nicht schlecht:
Einmal im Jahr vom Meer durchgewirbelt zu werden
Jo the Man the Music ist das Musikprojekt der Steirerin Johanna Gußmagg.
Ihre Debüt-EP »Soft Skin« erscheint am 16. Jänner bei Ink Music.

Songs zum Aus-dem-Fenster-Schauen
01 Madison Cunningham »Song in My Head«
02 Orla Gartland »Mina«
03 Maggie Rogers »Don’t Forget Me«
04 Sam Evian »Wild Days«
05 The War on Drugs feat. Lucius »I Don’t Live Here Anymore«
06 David Bowie »Moonage Daydream«
07 Big Thief »Incomprehensible«
08 Billie Marten »Feeling«
09 Flyte »Even on Bad Days«
10 Änn »Didn’t Know Back Then«
Nervenaufreibende Dinge
01 Wenn nur ein Teil des Sockens nass wird
02 Menschen, die laut Kaugummi kauen
03 Wenn einem die perfekte Antwort drei Tage zu spät einfällt
Auch nicht schlecht
Wochenende, langsame Tage und Herbstspaziergänge
Filiah macht Musik zwischen Indierock und Folk. Im Rahmen des diesjährigen Waves Vienna hat sie den XA – Export Award gewonnen. Zuletzt ist im Oktober ihre EP »Sad Girl With a Punchline« erschienen.

Der Stress vor Weihnachten ist ja bekanntlich groß, aber wir haben trotzdem noch einen wichtigen Termin für euch: Am Samstag, den 6. Dezember, um 19 Uhr findet im Wirr in der Burggasse die nächste Ausgabe des The-Gap-Popquiz statt.
Bereitet euch vor auf Fragen wie diese:
Aus welchem Kultmusical stammt das Lied, das Jay-Z für »Hard Knock Life (Ghetto Anthem)« gesampelt hat?
#A »Annie«
#B »Billy Elliot«
#C »Cabaret«
Im Anschluss ans Quiz gibt es noch eine Weihnachtsfeier mit DJ-Line.
Anmeldung unter o ice@thegap.at

Toni Patzak
hakt dort nach, wo es wehtut
Ich habe mir mein soziales Umfeld so gestaltet, dass ich Menschen jeglicher Couleur in meinem Leben habe. Freund*innen mit unterschiedlichen Hintergründen, politischen Orientierungen und G ender-Expressions. Freund*innen, die älter sind als ich, und solche, die meine restliche Auswahl an Freund*innen fragwürdig finden. Meine Geburtstagsfeiern sind dementsprechend chaotisch. Was mir aber vor Kurzem aufgefallen ist: Ich habe immer mehr Freund*innen, die in nicht-monogamen Beziehungsstrukturen leben. Nichtmonogam heißt, dass eine Beziehung nicht ausschließlich zwei exklusive Partner*innen umfasst, sondern mehrere Beziehungskonstrukte beinhalten kann (aber nicht muss). Meine Geburtstagsfeiern werden dadurch jedenfalls nicht einfacher, weil das klassische +1 plötzlich nicht mehr ausreicht.
Entgegen zahlreicher Klischees steht bei Polyamorie zumeist nicht die Möglichkeit im Vordergrund, mit mehreren Menschen schlafen zu können, sondern das Interesse, sich bewusst mit der Struktur von Beziehungen auseinanderzusetzen. In einer monogamen Partner*innenschaft weiß man ja ungefähr, was von einem erwartet wird: Romantische Gefühle nach außen sind tabu, Flirts können zum Konfliktpunkt werden, selbst mit engen platonischen Freund*innenschaften stößt man schnell an Grenzen. Natürlich möchte ich nicht alle monogamen Beziehungen über einen Kamm scheren, es gibt viele monogame Paare, die sich mit Eifersucht, Angst und Verletzlichkeit reflektiert auseinandersetzen.
Aber in offenen Strukturen kommt man um genau diese Auseinandersetzung gar nicht erst herum. Monogame Beziehungen können sich auf gesellschaftlich vorgegebene Normen stützen. Bei Polyamorie muss man hingegen vieles selbst definieren: Wollen wir Hauptpartner*innen sein, während andere lose Dates möglich sind? Sind spontane OneNight-Stands erlaubt oder müssen sie vorher abgesprochen werden? Ist es okay, sich mit
weiteren Menschen auf eine romantische Dynamik einzulassen? Welche Verantwortung, Pflichten und Privilegien darf man außerhalb der »Hauptbeziehung« aufbauen? Und was bedeutet »betrügen« in diesem Kontext überhaupt? Diese und ähnliche Fragen muss man sich zu Beginn sowie im Verlauf einer nichtmonogamen Beziehung zwangsläufig stellen.
Wie in den Hunderttausenden von SlopBowl-Shops kann man sich so eine Build-YourOwn-Beziehung zusammenbauen. Während man sich bei den überteuerten Reisschüsseln überlegt, ob man braunen Reis oder doch Quinoa als Basis nimmt, kann man in einer nicht-monogamen Beziehung wählen, ob hierarchisch oder non-hierarchisch, ob KitchenTable-, Garden-Party- oder doch Parallel-Polyamorie. Die enorme Auswahl an möglichen, sich dynamisch verändernden Komponenten kann dabei überfordernd sein. Viele Menschen in meinem Umfeld sind anfangs blauäugig hineingestolpert und waren überrascht, wie viel Zeit mit Reden und Aushandeln draufgeht. Schritt für Schritt vorzugehen, ist daher vielleicht kein foolproof Plan, aber oft der einzige machbare Weg. Denn es gibt kaum Vorbilder oder Anleitungen für glückliche nicht-monogame Beziehungen.
Doch nicht so frei?
Das schlägt sich auch im Umgang mit Gefühlen wie Eifersucht nieder. Im Kopf kann man solche Gedanken zwar wunderbar wegtheoretisieren, aber im Bauch bleibt das ungute Gefühl. Die Aussage eines Freundes, der schon länger polyamor lebt, hilft mir allerdings in Neidsituationen: »Es geht nicht darum, gar nicht mehr eifersüchtig zu sein. Eine PolyBeziehung kann dir den Rahmen geben, herauszufinden, woher das Gefühl kommt, und mit deinem*deiner Partner*in oder deinen Partner*innen daran zu arbeiten.« Das Fundament hierfür ist eine unfassbare Verletzlichkeit. Dabei gruselt mich schon der Gedanke, so emotional nackt vor jemandem zu stehen und zu sagen: »Schauen wir uns das jetzt einmal ganz genau an, während wir andere Personen
gleich mit ins Boot nehmen.« Aber genau das macht diese Beziehungsform aus: Sie zwingt zu Gesprächen, zum Ausmachen klarer Regeln und zu intensiver Reflexion.
Was von vielen innerhalb, aber noch viel mehr außerhalb der Community als ultimativer Hedonismus verkauft wird, stellt sich in der Realität als eine Menge emotionaler Arbeit heraus. Da reicht ein kurzes Auskotzen bei den engsten Freund*innen längst nicht mehr. Wenn in einem der »Polycules« um mich herum ein Beziehungsdrama ausbricht, brauchen wir mindestens ein Whiteboard und fünf Meter roten Faden, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. All diese gewachsene Komplexität steht aber der Freiheit gegenüber, sich zunächst einfach mal auf Beziehungen einzulassen und dann zu schauen, was sie am Ende werden: Freund*innenschaft, Liebschaft oder doch eine längerfristige Partner*innenschaft.
Doch bevor der Verdacht aufkommt, ich würde hier nur Werbung für Nicht-Monogamie machen: Es gibt genug daran zu kritisieren, wie solche Strukturen ausgelebt werden. Manche Menschen konnte ich direkt dabei beobachten, wie sie sich selbst ein Rebranding gaben. Plötzlich waren sie nicht mehr der*die »böse Betrüger*in«, sondern einfach nicht-monogam. Die alten, ungesunden Dynamiken blieben aber bestehen. Nur dass der*die Partner*in jetzt offiziell nicht mehr wütend sein durfte, wenn man nach der Bar mit jemand anderem nach Hause ging.
Unterm Strich ist Nicht-Monogamie weder besser noch schlechter als Monogamie. Am Ende sind Beziehungen immer nur so gut wie die Menschen, die sie leben. In einer privilegierten Studiumsbubble wie meiner stellt Polyamorie aber auch eine Möglichkeit dar, sich einmal auszuprobieren und die komplexe Beziehungslandschaft für sich nutzbar zu machen. So lässt sich vermutlich am einfachsten herausfinden, was einen tatsächlich eifersüchtig macht und wie viele +1 man letztlich zur Geburtstagsfeier mitnehmen möchte. patzak@thegap.at @tonilolasmile











Alle paar Monate scheint sich die gesamte Menschheit via Social Media auf ein Kultobjekt zu einigen, das dann kollektiv konsumiert wird – zumindest, bis der nächste Hype auftaucht und den bisherigen plötzlich verdrängt. Was steckt hinter dem vermeintlich neuen Phänomen der popkulturellen Hypemaschinerie? ———— »Wir kennen es wohl alle: Nach einem langen Tag verheißt nichts mehr Entspannung, als auf der eigenen Couch in den Untiefen des Internets zu versinken. Wir finden Zuflucht bei Instagram, Tiktok und Co, um wieder einmal Stunde um Stunde im Loop des Scrollens zu verbringen und unser Gehirn mit einer guten Dosis Dopamin zu füttern. Im Akt des Wischens wird ein Gefühl von Endlosigkeit spürbar, das der sich ständig wiederholende Inhalt der Kurzvideos noch verstärkt: Unboxing-Clips von vergriffenen Labubu-Blindboxen, Verkostungen der begehrten Dubai-Schokolade, Live-Reactions auf Szenen der heiß diskutierten Serie »The Summer I Turned Pretty«, alles unterlegt mit dem immer gleichen Songsnippet aus Taylor Swifts »The Fate of Ophelia«.
Solche Massenphänomene verdeutlichen, dass wir uns inmitten einer Blütezeit des Hypes befinden. Sobald ein Kultphänomen vom medialen Zeitgeist Besitz ergriffen
hat, scheint es, unvermeidbar alles zu durchdringen. Gerade in der Popkultur gibt es derartige Trends, Manias und Hypes zwar schon lange, dennoch stellt sich die Frage, warum sie uns gerade jetzt so stark zu beschäftigen scheinen. Was steckt hinter dieser Entwicklung einer regelrechten Hypekultur? Und ist der Trubel um diese Konsumgüter wirklich so banal, wie wir häufig denken?
Rise of Teilö entlichkeiten
Bevor sich die großen Social-Media-Plattformen als primäre Quellen der Informationsbeschaffung etablieren konnten, waren es vorrangig klassische Massenmedien wie Zeitungen, Magazine oder das Fernsehen, die uns über das aktuelle Weltgeschehen und popkulturelle Entwicklungen auf dem Laufenden hielten. Clemens Apprich, Kulturhistoriker sowie Leiter des Weibel Instituts für digitale Kulturen an der Universität für angewandte Kunst Wien, erklärt, wie diese Art Medien ursprünglich über das sogenannte Aktualitätsprinzip funktionierten: »Vor allem Zeitungen hatten diese Idee oder gar Illusion, dass wir alle gemeinsam als Leser*innenschaft immer auf demselben Aktualitätsstand sind. Früher gab es die Morgenausgabe und die Abendausgabe, und
»Durch ständige Hypes entsteht etwas, das ich als Aufgeregtheit beschreiben würde – ein Druck hin zu Aktualität.«
— Clemens Apprich
das war dann die Aktualität, die alle teilen konnten.« Ähnliches lasse sich laut Apprich auch in Hinblick auf die Fernsehökonomie vor der Jahrhundertwende beobachten. »Ein klassisches Beispiel ist etwa die Sendung ›Wetten, dass..?‹«, führt der Medientheoretiker aus. »Alle haben sie am Samstagabend gesehen, um am Montag darüber sprechen zu können.«
Mit der Verbreitung des World Wide Web in den Neunzigerjahren kam schließlich Bewegung in diese Vorstellung von Massengesellschaft. Wegen der verschiedenen Applikationen, die das Internet mit sich brachte – zu denen auch die sozialen Medien zählen – spielte plötzlich das Thema Aufmerksamkeitsökonomie eine zentrale Rolle. Apprich erklärt: »Mit dem Internet gibt es nicht mehr die eine Aktualität, sondern unzählige kleine, die gleichzeitig stattfinden. Dadurch entstehen viele verschiedene Teilöffentlichkeiten.« Aus diesen gilt es als Konsument*in dann auszuwählen, denn nicht allem können wir unsere Aufmerksamkeit schenken.
Rein mediengeschichtlich könne man dies durchaus als positive Entwicklung lesen, meint Apprich, durch die zunehmende Aufspaltung der Informationskanäle verändere sich nämlich, wer I nformationen wie weitergeben könne. »Während zum Beispiel in den Fünfzigerjahren nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung – meistens ältere Männer in den Redaktionen – bestimmt haben, was jetzt die Öffentlichkeit ist, können sich durch das Internet plötzlich auch andere Stimmen einbringen und Aufmerksamkeit für sich generieren.«
Doch gleichzeitig entwickle sich dadurch gerade im Internet schnell eine Überfülle an Informationen, wie Apprich ausführt: »Indem ich ständig in einem neuen Thema oder Hype drinnen sein kann und eben nicht mehr diese Pause habe, wenn an einem Tag mal weniger passiert, entsteht etwas, das ich als Aufgeregtheit beschreiben würde – ein gewisser Druck hin zu ständiger Aktualität.«
Gleich und gleich
Besonders in den um 2004 aufkommenden sozialen Medien spielt die Idee nach verschiedenen Teilöffentlichkeiten eine zentrale Rolle. Mit Applikationen wie Myspace oder StudiVZ wurde es damals plötzlich möglich, unabhängige Communitys auf den unterschiedlichen

Malina
Florentine Sternberg, Content-Creatorin
Plattformen zu organisieren. Und diese Zerstreuung hat sich, wie wir alle wissen, bis heute bewährt. Der vielgerühmte TiktokAlgorithmus schafft es erstaunlich präzise, uns allein anhand unserer wenigen Angaben sowie der Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren in Kategorien zu stecken. Wie ihm das gelingt? »Algorithmen berechnen immer auf Basis des sogenannten homophilic principle, was übersetzt so viel bedeutet wie: ›Gleich und gleich gesellt sich gern‹«, so Apprich. »Und eben darüber werden dann wiederum Vorhersagen getroffen, was uns als Einzelne*n interessieren könnte. So ist es Plattformen schließlich möglich, Aufmerksamkeiten zu kuratieren und wirksam zu steuern.«
Wer passt zu wem? Und welcher Content passt wiederum zu diesen kollektiven Gruppierungen? Interessanterweise spielen soziale Kategorien in Bezug auf dieserart algorithmisierte Annahmen eine ausschlaggebende Rolle: Alter, Gender, Race, sexuelle Orientierung. Algorithmen interessieren sich demnach gar nicht direkt für uns als Einzelpersonen, sondern sind stets darum bemüht, uns wieder in stereotypisierten Kollektiven zusammenzufassen, um schlussendlich Zuordnungen treffen zu können. »Alles, was uns ausgespielt wird oder was uns etwas verkaufen will, tut immer so, als ob es um das Individuum gehen würde. Myspace, Youtube, I-Phone: es ist immer das gleiche Muster. Aber was eigentlich im Hintergrund berechnet wird, ist das plurale ›You‹«, sagt Apprich. Es liegt also durchaus auf der Hand, warum algorithmisierte Plattformen so eine gute Grundlage für das Lostreten von Trends und deren Anwachsen zu unaufhaltbaren Hypes bieten.
Der Aspekt des Kollektiven spielt dabei nicht nur in Bezug auf die technische Dimension der sozialen Medien eine wichtige Rolle. Uns sei, wie Apprich betont, in der Diskussion leider verloren gegangen, wie zentral das Soziale in diesen Medien immer schon drinstecke: »Schlussendlich sind es wir alle, die diese Medien produzieren, nicht nur einzelne Konzerne.« Eben das lässt sich wohl am besten an der immer stärker werdenden Hypekultur in den sozialen Medien ablesen. Denn Labubus, Dubai-Schokolade, Stanley-Cups oder Designfruchttörtchen sind ohne uns – die diese Dinge schlussendlich konsumieren, posten und damit in d ie (digitale) Welt tragen – nichts weiter als banale Produkte. Doch in ihrer Funktion als sozialer Fokus für Communitys seien sie wiederum »alles andere als banal«, wie die Journalistin, Moderatorin und ContentCreatorin Malina Florentine Sternberg darlegt: »Das Ausschlaggebende ist wirklich dieses Communitygefühl. Der Austausch und der Zusammenhalt, die dabei entstehen, sind extrem wichtig. Gerade in Zeiten wie heute, in denen man sich manchmal sehr einsam fühlen kann.«
Erwachsene im Sammelfieber
Das Schaffen von Zugehörigkeitsgefühlen ist also das eine. Hypes und damit verbunden auch das Sammeln von Objekten, können aber gerade im Erwachsenenalter auch noch ganz andere Funktionen haben. Während die plüschige Diddl-Maus mit den großen Ohren Anfang der Nullerjahre vor allem für Kinder interessant war, sind Labubu-Blindboxen, Bag-Charms und Jellycat-Kuscheltiere explizit auch für Erwachsene gedacht. Sternberg erklärt: »Der Hersteller Pop Mart betont selbst, dass Labubus kein Spielzeug für Kinder sind, sondern sogenannte DesignToys. Und auch die Blindbox-Packungen führen als Empfehlung ein Mindestalter von fünfzehn Jahren an.«
Was hat es damit auf sich, dass Hypeprodukte gerade Erwachsene für sich zu gewinnen imstande sind? Für sie liege der Reiz ganz klar in der Möglichkeit, etwas nachholen zu können, das ihr als Kind verwehrt gewesen sei, so die Content-Creatorin. »Damals hatten wir einfach nicht das Geld dafür. Heute bin ich in der privilegierten Situation, auch mal sagen zu können: ›Ich kaufe mir das jetzt einfach
»Wir suchen uns Freude im kleinen Luxus – ob das jetzt ein Matcha Latte ist oder eine Labubu-Blindbox.«
— Malina Florentine Sternberg
»Schlussendlich sind es wir alle, die soziale Medien produzieren, nicht nur einzelne Konzerne.« — Clemens Apprich
nur, weil ich neugierig bin.‹ In meinem Fall reicht das von Lego-Sets über Videospiele bis hin zu Jellycats. Dinge dieser Art hatte ich als Kind einfach nicht.«
Gerade in Hinblick auf Blindboxen –wie etwa im Falle von Labubus – macht ein Mindestalter dabei durchaus Sinn. Der genaue Inhalt dieser Überraschungspackungen ist beim Kauf unbekannt. Man erwirbt also etwas, ohne genau zu wissen, was man schlussendlich bekommt. Erst beim Öffnen stellt sich dann beispielsweise heraus, welche Farbe, Bekleidung oder Accessoires das jeweilige Modell hat. Die Idee dahinter hänge Sternberg zufolge zentral mit der Ausschüttung von Dopamin zusammen: »Das ist psychologisch begründet und ähnelt im Prinzip einer klassischen Glücksspielmechanik.« Das Suchtpotenzial ist also vorprogrammiert. Indem Hersteller*innen zusätzlich auf künstliche Verknappung und seltene secret figures setzen, können sie die Nachfrage konstant hoch halten und so möglichst lange im Gespräch bleiben.
Fandom im Wandel
Mit solchen Kniffen versuchen die Konzerne das Maximum an Profit aus ihren Produkten herauszukitzeln, während die Zyklen, in denen sich Hypes bewegen, zunehmend kürzer zu werden scheinen. »Im Sommer wurden Labubus total gehypt«, so Sternberg. »Jetzt, nur ein paar Monate später, habe ich aber das Gefühl, dass sich kaum noch jemand dafür interessiert.« Auf der offiziellen Website des Herstellers Pop Mart sind die plüschigen Monster zwar immer noch restlos ausverkauft, in den sozialen Medien geht die Resonanz jedoch stark zurück. Aber seien wir ehrlich: Das nächste Plastikspielzeug in Massenfabrikation folgt bestimmt. »Das ist natürlich alles andere als nachhaltig«, wie auch Malina Sternberg betont.
Ein durchwegs positiver Wandel zeichne sich laut ihr jedoch bei Fandoms selbst ab. Besonders das Sammeln sei nämlich lange Zeit ein männlich dominiertes Feld gewesen: »Noch vor ein paar Jahren schienen Dinge wie ›Star Wars‹-Figuren als die einzigen ernstzunehmenden Sammelobjekte zu gelten. Inzwischen ist diese Vorstellung immer mehr aufgebrochen. Das haben wir auch Tiktok zu verdanken.« Zum ersten Mal habe Sternberg das Gefühl, man müsse sich als Frau nicht mehr dafür schämen, kitschige, bunte Objekte zu sammeln. Auch innerhalb ihrer
Follower*innenschaft zeichne sich das ganz deutlich ab: »Die Geschlechterverteilung in meinem Publikum ist sehr eindeutig. Es sind hauptsächlich junge Frauen, die sich meinen Content anschauen und mit mir übers Sammeln ins Gespräch kommen wollen. Gerade in meinen Kommentaren sehe ich sehr oft auch Fotos, auf denen junge Girlies zum Beispiel ihre neuen Jellycats zeigen.«
Die Nachfrage nach kleinen, süßen, bunten Sachen hat aktuell also Hochkonjunktur. Preislich liegen viele der bereits genannten Produkte irgendwo zwischen zehn und dreißig Euro. Gerade in Österreich, wo die Teuerung mit einer Inflationsrate von vier Prozent im Oktober 2025 weiterhin auf hohem Niveau lag, ist das gegenüber klassischen Luxuspro -

Clemens Apprich,
Medienwissenschaftler
dukten noch erschwinglich. Indikatoren wie dem sogenannten Lipstick-Index zufolge gönnen sich Menschen in wirtschaftlichen Krisen eher kleinere Goodies. Laut Clemens Apprich sei es nur logisch, dass der Konsum in Krisenzeiten rein makroökonomisch zurückgehe. »Im Kleinen schafft man sich aber vielleicht gerade dann seine eigene Komfortzone«, so der Experte. Auch Sternberg sieht das ähnlich: »Wir werden uns wahrscheinlich alle kein Haus leisten können, weshalb wir uns Freude im kleinen Luxus suchen –ob das jetzt ein Matcha Latte ist, der sechs Euro kostet, oder eine Labubu-Blindbox; das fällt letztendlich in die gleiche Kategorie.« Content in den sozialen Medien setzt ge -
rade in Krisenzeiten ganz gezielt auf diese Idee von Sehnsucht nach Safe Spaces, indem er immer stärkere Hypewellen forciert und Nutzer*innen über Zugehörigkeitsgefühle an Communitys bindet.
Hypes produktiv nutzen
Natürlich äußern sich popkulturelle Hypes nicht nur in materiellen Produkten, sondern vielfach auch im musikalischen Bereich. Gerade kleinere Artists können stark von dieser wachsenden Hypekultur profitieren und darüber Reichweite beziehungsweise Streams generieren, die sonst für sie unerreichbar wären. Ohne Sichtbarkeit in den sozialen Medien ist es heutzutage sowieso nahezu unmöglich, sich zu etablieren. Die burgenländische Band Lovehead ist wohl ein aktuelles Paradebeispiel dafür, wie man soziale Medien und damit verbunden auch Hypekultur – gerade als Newcomer*innen in Österreich – produktiv für sich nutzen kann. Das Indierocktrio fand nicht nur über Instagram zusammen, sondern auch ihre ersten beiden Songs »Erdnussallergie« und »Denkst du an mich?« wurden auf Internetplattformen in kürzester Zeit zu viralen Hits. Das verschaffte der jungen Gruppe nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch diesjährige Auftritte beim Popfest Wien und beim Waves Vienna.
Trotz der Kurzlebigkeit der aktuellen Hypezyklen ist zu hoffen, dass solche schnellen Aufstiege auch nachhaltig sein können. Denn meist ist es ja leider nur eine Frage der Zeit, bis das, was wir aktuell als größten Hype wahrnehmen, wieder verschwindet und durch etwas Neues ersetzt wird. So lässt etwa die Omnipräsenz der Labubus langsam nach und Dubai-Schokolade stapelt sich unberührt an den Supermarktkassen. Doch es zeigt sich, dass auch Totgesagtes manchmal wiederkehrt: Kultfiguren wie Monchhichis sind plötzlich wieder gefragt, Vinyl, Kassetten und sogar CDs gehen am Flohmarkt weg wie warme Semmeln. Und selbst die DiddlMaus scheint aktuell ein Revival zu erleben. Vielleicht gibt es also doch ein Leben nach dem Hype. Anja Linhart
Content von Malina Florentine Sternberg findet sich unter anderem auf ihrem InstagramKanal @malinaflorentine. Am 5. Dezember erscheint mit »Fanta lustig« die Debüt-EP von Lovehead. Die Band ist am 25. Februar im PPC in Graz live zu sehen. Und Original-Labubus sind langsam wieder im Handel erhältlich.

In der kalten Jahreszeit findet man sich häufig mit der eigenen Insignifikanz konfrontiert. Latent dunkel, latent kalt und nach den goldenen Herbsttagen von Nieselregen und Sturmböen durchzogen, bietet uns der Winterbeginn genug Anlass zu trübem Gemüt. Vincent van Gogh war ein Spezialist für solche Geisteszustände – aber sein Gemälde »Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette« ist weit mehr als ein schlichtes Memento mori. ———— Mit derselben, beinahe plumpen und doch verschmitzten Attitüde wie ein Schuljunge, der dem Skelett im Biologieraum ein Papierhütchen aufsetzt, drückt van Gogh seinem »Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette« den titelgebenden Glimmstängel in die Hand. Ein Ins-Auge-Blicken – der eigenen Sterblichkeit, aber auch dem eigenen Konsum. Van Gogh war begeisterter Raucher. Trotz aller Begeisterung bleibt mit dem Zigarettenqualm jedoch immer ein Mief des Vorwurfs an sich selbst im Raum hängen, genauso hartnäckig und vergilbend wie der Rauch selbst. Man ist sich der Gefahren ja bewusst. Mehr oder weniger. Bestimmt muss man die brennende Zigarette hierfür nicht erst in der Hand des personifizierten Todes sehen, um sich der Dummheit der ganzen Sache klar zu werden. Van Gogh malt sie ihm aber trotzdem in die knöchernen Finger, oder genau deshalb.
Es ist trotzig, das zu tun, verwegen – und sehr bezeichnend für den Lebensabschnitt, in dem van Gogh dieses Bild schuf. Genauso wie ich und sehr viele andere Studierende jetzt befand er selbst sich vor 140 Jahren, also 1885/86, im Wintersemester. Wenn man für die Zukunft lernt, und das womöglich unter großem Stress, wie wohlfeil wohltuend ist da eine Zigarette, wie aufsässig egal sind einem da die Folgen. Die Welt steht einem offen. Und hat man die Weisheit schon nicht mit der Muttermilch aufgesogen, dann mit der Zigarette nach der Vorlesung.
Aber van Gogh trotzt nicht dem Tod allein. Nein, vielmehr trotzt er auch dem Curriculum seiner Universität. (An dieser Stelle kann man sich fragen, wofür es wohl mehr Mut brauchte.) An der Königlichen Akademie der Schönen Künste Antwerpen war es zu dieser Zeit noch Usus, Anatomie an Skeletten zu lernen, anstatt an lebenden Modellen. Das fand er wohl recht langweilig. Mit »Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette« zeigte er nicht nur, dass er Anatomie schon ziemlich gut beherrschte, er signalisierte auch, dass ihm das Ganze zu dumm war. Lieber auf einen Tschick mit dem Tod als einen Moment länger in dieser Vorlesung. Man sollte sich vielleicht nicht vollends ein Beispiel daran nehmen. Aber bei der ganzen kalten Trübe der kommenden Tage tut ein bisschen pubertäre Aufmüpfigkeit und die Forderung nach mehr Wissen wohl ganz gut. Veronika Metzger
Normalerweise befindet sich »Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette« im Van Gogh Museum in Amsterdam. Aktuell kann man das Bild aber, neben anderen mehr oder weniger unheimlichen Gemälden, in der Albertina Wien sehen. Die Ausstellung »Gothic Modern« ist dort noch bis 11. Jänner eine bereichernde Beschäftigung für besonders ungemütliche Wintertage.
Nach seinem gefeierten Debüt verö entlicht der Singer-Songwriter Lukas Oscar nun sein zweites Album, das zwischen Lo-Fi-Pop und Clubsounds changiert. Ein Gespräch über Intuition, die Liebe zum Moment und das Vertrauen in die innere Stimme, die man auf »Everything’s Built to Last!« tatsächlich auch hören kann. ———— Nur wenige Buchstaben trennen die beiden Begriffe Intuition und Intention voneinander. Gleichzeitig liegt zwischen ihnen eine ganze Welt. Müsste sich Lukas Oscar für eine Seite entscheiden, würde er eindeutig im »Team Intuition« spielen. Vielmehr noch: Er wäre garantiert derjenige, der die Kapitänsschleife trägt. Jetzt aber genug mit dem übermäßigen Gebrauch des Konjunktivs, denn im Gespräch mit dem Musiker wird rasch klar, dass er mit der Möglichkeitsform sehr viel weniger anfangen kann als mit den Möglichkeiten, die sich ihm jetzt gerade – in diesem Moment –bieten. Tatsächlich lassen sich die Konjunktive, die er im Interview verwendet, an einer Hand abzählen. Wenn überhaupt.
Er sei ein bisschen aufgeregt, sagt er zu Beginn des Gesprächs. Denn Interviewfragen zu beantworten, fühle sich immer ein bisschen so an, als würde man schnell und unvermittelt nach dem aktuellen Lieblingsartist gefragt werden. Er lacht. Weil die Sonne scheint, sitzen wir im Gastgarten des Café Stein im neunten Wiener Gemeindebezirk. Schließlich gilt: Je weiter das Jahr voranschreitet, umso wichtiger wird es, jede einzelne Möglichkeit, das System mit ein bisschen Vitamin D aufzuladen, unhinterfragt zu nutzen. Womit wir wieder mitten im Thema wären.
Als absoluter Profi in Sachen Eskapismus hat Lukas Oscar mit dem Songschreiben nämlich etwas gefunden, das ihn immer wieder
zurück in den gegenwärtigen Moment bringt. »Die Musik hilft mir dabei, nicht vor meinen Emotionen wegzulaufen und meine Gefühle in Perspektive zu setzen. Sie ist mein Tagebuch«, hält er fest und nimmt einen Schluck von seinem Orangensaft. Das gilt auch bei »Everything’s Built to Last!«, das Ende Jänner erscheinen wird. Sein Debüt »The Fun Never Ends!«, das er im Herbst 2024 veröffentlichte, wurde als reifes, mutiges und tiefgründiges Album gefeiert, im Frühjahr 2025 brachte er die EP »From Under My Bed« heraus. Intuitiver und kindlicher
Um zu verstehen, warum wir im Gespräch immer wieder auf die Bedeutung von Intuition zu sprechen kommen, muss man aber noch ein bisschen weiter zurückspulen: Vor seinem Debüt schrieb der in Fürstenfeld aufgewachsene Musiker, der im Übrigen 2016 das Finale von The Voice Kids für sich entschied, vor allem für andere Musiker*innen. »Das war eine sehr schöne und auch sehr intensive Erfahrung. Man ist bei sehr vulnerablen Momenten dabei, muss abchecken, wann man sich einbringt und wann nicht. Irgendwann landet man aber unweigerlich in bestimmten Boxen und Strukturen, von denen ich mich befreien wollte. Ich habe mich danach gesehnt, wieder Songs für mich selbst zu schreiben. Und nach einem Zugang, der intuitiver und kindlicher ist«, fasst der Musiker diese für ihn wichtige Phase seiner noch jungen Karriere zusammen.
Für Lukas Oscar ist die Musik wie ein Tagebuch, in dem er sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt.


Mit der EP »From Under My Bed« trieb er, gemeinsam mit seinem Mitbewohner, diesen spontanen und intuitiven Zugang zum Musikmachen auf die Spitze. »Die Challenge lautete, jeden Tag einen Song zu schreiben«, erzählt er lachend. Das bedeutet: In jedem der fünf Songs stecken nur jene Dinge, die er an diesem Tag zur Verfügung hatte. »Im ersten Moment klingt das vielleicht so, als würde man den eigenen Standard heruntersetzen, in Wahrheit war es aber ein total befreiendes Gefühl, weil ich dadurch tief in mich hineinschauen und alles zulassen konnte. Für mich ist das die schöne Art, Musik zu machen.«
In der Musik schafft Lukas Oscar auch etwas, womit er sich in seinem Leben abseits seines musikalischen Schaffens eher schwertut, wie er selbst eingesteht: »Ich bewundere Menschen, die direkt sind und sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Mir gelingt das nur beim Songschreiben. Wenn ich über einen Beat freestyle, darf alles fließen, darf alles sein.«
Um den Rest kümmert sich, wenn man so will, irgendwann einmal der Zukunfts-Lukas, von dem wir jedoch nicht viel wissen, weil er sich auch während des Interviews nobel zurückhält, äußerst schemenhaft bleibt. Für den Gegenwarts-Lukas, der einen weiteren großen Schluck Orangensaft trinkt, liegt der Schlüssel zum oft schwierigen Prozess des Zulassens vor allem darin, ohne bestimm-
»Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Emotion gibt, die keine Daseinsberechtigung hat, und das ist Peinlichkeit.«
— Lukas Oscar
te Intention in Songs hineinzugehen. So sei das beispielsweise auch bei »Cereals«, einem der Titel auf »Everything’s Built to Last!« gewesen, wie er erzählt: »Das ist eine Nummer, die ich wirklich nicht dafür geschrieben habe, dass sie irgendwann rauskommt. Ich hatte einen Lo-Fi-Gitarrenloop auf meinem Computer gespeichert, den ich an einem Tag, an dem ich eine mir unerklärliche Schwere fühlte, wiederfand. Daraufhin begann ich, wild draufloszuschreiben und die Vocals anschließend mit meinem Handy aufzunehmen. Plötzlich war auch die Schwere weg.« Es ist auch genau dieses Recording, das man auf dem kommenden Album hören kann, wie Lukas Oscar hinzufügt. Seine innerste

Seine Songs nimmt Lukas Oscar am liebsten in Homestudios von Freund*innen auf.
Stimme. Eine Arbeitsweise, von der man behaupten könnte, sie hätte System, wenn »System« nicht der absolut falsche Begriff wäre, um das Herangehen des 23-Jährigen ans Musikmachen zu beschreiben. Wie das gemeint ist? Er selbst formuliert es folgendermaßen: »Ich nehme Vocals nie neu auf. Ich singe sie ein und genau das ist für mich dann der Vibe. Ich möchte nichts mehr angreifen oder überarbeiten, weil ich mir wünsche, dass genau jene Gefühle rüberkommen, die ich in diesem Moment empfunden habe.« Damit hängt auch zusammen, dass Lukas Oscar nicht gerne in Aufnahmestudios, sondern am liebsten bei befreundeten Produzent*innen schreibt, die ihr Studio – im allerbesten Fall – im Schlafzimmer haben. Stichwort: from under my bed. In Verbindung mit Lukas Oscar und seinem musikalischen Schaffen ist der Begriff »Momentaufnahme« demnach sowohl wortwörtlich als auch metaphorisch zu verstehen. Obwohl seinen Songs häufig persönliche Erlebnisse zugrunde liegen, bieten sie eine Fülle an Anknüpfungs- und Berührungspunkten – und zwar im doppelten Wortsinn, denn im Idealfall entsteht bei den Zuhörer*innen ein ehrlicher Moment der Berührung. »Mir ist es überhaupt nicht wichtig, Songs zu schreiben, die möglichst massentauglich sind oder die nach großer Poesie klingen. Ich wünsche mir, dass meine Musik ihren Weg zu jenen Menschen findet, die ähnlich fühlen und wirklich nachempfinden können, worum es in den Songs geht«, merkt der Künstler mit ruhiger Stimme an.
Mit dem neuen Album im Gepäck wird Lukas Oscar außerdem seine erste Solotour starten. Ausgangspunkt ist der Berio-Saal im Wiener Konzerthaus, wo er am 30. Jänner sein Releasekonzert spielen wird. Zum ersten Mal habe er die Möglichkeit, einen Raum
ganz nach seinen eigenen Vorstellungen zu schaffen, wie er freudestrahlend festhält. Im Falle des Musikers, der sich als Kind bereits über Youtube Konzerte von Beyoncé und Adele reinzog, bedeutet das unter anderem, dass der Showaspekt auf keinen Fall zu kurz kommen wird. »Ich möchte eine Welt kreieren, in die man eintaucht und in der man komplett vergisst, wo man sich gerade befindet. Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam loslassen.«
Sich auf Dinge einlassen
Live zu spielen, heißt für ihn auch, gezielt in Dinge hineinzugehen, die unangenehm sind, wie zum Beispiel das Mikro beim Soundcheck an den Monitor zu halten, um zu schauen, ob es piepst. Um sich später, während des Konzerts, wirklich zu hundert Prozent fallenlassen zu können, wie er hinzufügt. Überhaupt sei er ein großer Fan davon, sich immer wieder gezielt auf Dinge einzulassen, die auf den ersten Blick unangenehm zu sein scheinen. »Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Emotion gibt, die keine Daseinsberechtigung hat, und das ist Peinlichkeit. Das musste ich aber auch erst lernen – und ich lerne es jeden Tag aufs Neue. Es klingt vielleicht banal, aber mir hilft es zum Beispiel, laufen zu gehen, mich verschwitzt und mit rinnender Nase durch die Stadt zu bewegen.«
Das zweite Album, so Lukas Oscar, sei im Übrigen noch mehr in einem Guss entstanden als das erste. »Ich bin wirklich ohne große Intentionen hineingegangen. Umso schöner war es, dass sich alles ganz natürlich gefügt hat, als ob sich ein Kreis schließen würde.« Die Buntheit des Debüts, das sich ebenfalls bereits konkreten Genrezuschreibungen verweigerte, prägt auch den Nachfolger, der sich lose zwischen Lo-Fi-
Groove, Elektropop und Clubsounds bewegt. Immer wieder trifft, wie beispielsweise im Song »Onions«, Melancholie auf Euphorie. Als wichtigen Einfluss erwähnt Lukas Oscar unter anderem den britischen Musiker und Produzenten Labrinth. Thematisch gehe es um Selbstfindung, wie der Singer-Songwriter erklärt. Aber nicht nur um die verzweifelte Suche nach sich selbst, sondern auch um das Abfeiern jenes Moments, in dem man erkennt, dass all die Dinge, nach denen man sucht, schon da sind – dass man einfach nur in sich selbst hineinhören muss.
Genau das tut auch Lukas Oscar – vor allem immer dann, wenn wieder einmal der Profi-Eskapist in ihm durchkommt. Oft werden aus diesen Momenten der Introspektion Songs, aber nicht immer landen sie auf Alben oder werden veröffentlicht. Intuition statt Intention lautet schließlich die Devise.
Dass ein Teil des Musikvideos zu »Onions« in der Ausstellung »Luftballonwelten« in Wien gedreht wurde, sollte vermutlich nicht überinterpretiert werden, verrät aber natürlich trotzdem etwas über den Musiker. Unter anderem, dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass Träume platzen können, dass sie sich, bis sie das tun, aber häufig bunt, leicht und nach Spielwiese anfühlen. Sicher ist: Letztere wird Lukas Oscar bestimmt nicht so schnell verlassen. Sarah Wetzlmayr
Das Album »Everything’s Built to Last!« von Lukas Oscar erscheint Ende Jänner. Am 30. Jänner wird es eine Releaseshow im BerioSaal im Wiener Konzerthaus geben. Weitere Konzerttermine: 5. Dezember, Vöcklabruck, OKH — 6. Dezember, Kirchdorf an der Krems, Hildegard — 21. Mai, Innsbruck, Die Bäckerei — 22. Mai, Salzburg, Jazzit — 23. Mai, Linz, Stadtwerkstatt — 27. Mai, Graz, Music-House.
Der
26/11/25
NENDA live
15/12/25
LYLIT
13/01/26
Anna Mabo & die Buben inn.wien ensemble
26/01/26
Norbert Schneider
30/01/26
Lukas Oscar
08/02/26
Mehr Infos unter konzerthaus.at


Christian Löffler & Sven Helbig






Verschlossene Außenseiter*innen, lange nächtliche Gespräche und das gemeinsame Sinnieren über Leben und Tod – im Spielfilmdebüt des Regieduos Elsa Kremser und Levin Peter finden zwei Menschen zueinander. ———— Ihre Welten könnten nicht unterschiedlicher sein: Masha (Marya Imbro) ist ein junges, aufstrebendes Model, Misha (Mikhail Senkov) arbeitet in einer Leichenhalle. Zu Hause hält er seine Erinnerungen an all die Körper in Gemälden fest, während sie versucht, ihre Sehnsucht nach dem eigenen Tod zu zügeln. Masha wird auf die Leichenhalle sowie auf Misha aufmerksam – und es beginnt die Annäherung zweier scheuer Menschen, die lernen, sich zu öffnen und einander zu vertrauen.
Nach den Dokumentarfilmen »Space Dogs« und »Dreaming Dogs« liefern die beiden Regisseur*innen Elsa Kremser und Levin Peter mit »White Snail« nun ihren ersten Spielfilm ab, der allerdings starken Bezug zur
Levin Peter und Elsa Kremser drehten die Liebesgeschichte von Masha und Misha in Belarus.

Realität aufweist. Die Figuren sind an die beiden Darsteller*innen angelehnt, vorgegebene Dialoge gab es keine. »White Snail« ist ein atmosphärischer Film mit starken Bildern und eigensinnigen Figuren. Im Interview erzählen Elsa Kremser und Levin Peter, wie es war, in einer echten Leichenhalle zu drehen, welchen Eindruck Belarus bei ihnen hinterlassen hat und warum abermals Tiere eine tragende Rolle in ihrem Film spielen.
Wie hat es sich ergeben, dass ihr nach zwei Dokumentationen euren ersten fiktiven Film drehen wolltet? Und inwiefern hat euch eure dokumentarische Arbeit dabei beeinflusst?
elsa kremser: Unsere Dokumentarfilme waren stets vom Magischen Realismus geprägt, dieser zeigt sich nun auch in »White Snail«. Die Idee zum Film hatten wir bereits vor ungefähr zehn Jahren, als ich Mikhail
Senkov kennenlernte. Er ist Maler und arbeitete früher in einer Leichenhalle. Schnell wussten wir, dass wir seine Lebensgeschichte spannend finden, nur fehlte uns anfangs der konkrete Zugang – bis wir auf Marya Imbro trafen. Dann wussten wir, dass es eine Liebesgeschichte werden soll.
levin peter: Aus unserer dokumentarischen Arbeit konnten wir viel für dieses P rojekt mitnehmen, etwa auf der Ebene der Inszenierung sowie beim Umgang mit Menschen. Uns ist es stets wichtig, den Prozess des Filmemachens für alle Beteiligten sichtbar zu machen. Wir wollen, dass sich die Menschen wie auf einem Set fühlen, dass die Kameras nicht versteckt werden. Im Laufe des Projekts sind unsere beiden Darsteller*innen selbstbewusster geworden, sie wurden quasi vor unserer Kamera zu Stars. Es liegt einfach eine Kraft darin, gemeinsam an einem Film zu arbeiten.

In
Der Film erzählt die Geschichte zweier Menschen, die versuchen, ihren Platz in der Welt zu finden: Masha ist Model und kämpft mit ihrer psychischen Gesundheit, Misha arbeitet in einer Leichenhalle in Minsk. Könnt ihr die beiden Figuren und ihre Motivationen kurz skizzieren?
kremser: Es sind zwei Menschen, die viel darüber nachdenken, wie sie wirken. Beide sind zudem Außenseiter*innen und leben nonkonform. Sie sind so unglaublich unterschiedlich, im realen Leben würden sie einander nie begegnen. Auch ihre Begegnung im Film ist ungewöhnlich: Eines Nachts klingelt Masha an der Tür der Leichenhalle. Im Laufe der Handlung fühlen sich die beiden zunehmend voneinander verstanden – und gesehen. peter: Beide sind ziemlich unmöglich. Gerade das mochten wir an den Figuren, deshalb wollten wir sie zusammenbringen. Masha und Misha funktionieren nicht in normalen gesellschaftlichen Bahnen. Gerade in Belarus fallen solche Menschen schnell auf, denn in einem so autokratischen Staat funktionieren die Menschen mehr nach Normen, es gibt weniger Freiheit für das Individuum.
Was ist euch vom Dreh in Erinnerung geblieben? Ihr habt ja in einer echten Leichenhalle gefilmt.
kremser: Das war faszinierend und abstoßend zugleich. Natürlich haben wir uns gefragt, ob wir da wirklich hinwollen. Wir wussten aber, dass es ein wichtiger Beruf ist. Selbst in Filmen sieht man so etwas nur selten. Vor dem Dreh machten wir – gemeinsam mit dem Kameramann – ein Praktikum in der Leichenhalle. Wir wollten die Abläufe und den Raum kennenlernen. Der Mann, der dort arbeitete, meinte, er habe keine Lust, dass wir hier einfach eine Woche herumstehen und schau-
»Habt den Mut, euch zu öffnen, und seid nicht gemein zu denen, die es tun!« — Elsa Kremser
en, wir sollten ihm also helfen. Das war sehr prägend für den Film. Wir durften nicht alles machen, die medizinischen Untersuchungen wurden von den Profis durchgeführt, aber wir holten die Leichen aus dem Kühlraum, zogen sie an und schminkten sie.
peter: Wir lernten auch, die Leichenstarre zu lösen. Dies geschieht langsam und behutsam, mit dem richtigen Gefühl. Leichen sind sehr schwer; man kann sie deshalb nicht so leicht anziehen, die Kleidung ist so eng, die Körper sind nicht mehr beweglich. Es ist ein sehr anstrengender Beruf.
Wir sehen die beiden Figuren in vielen nächtlichen Szenen oder in kaum beleuchteten Innenräumen wie etwa Mishas Arbeitsplatz und Wohnung. Wie war es, so viel in der Nacht zu drehen?
peter: Es hat durchaus seine Vorteile. Man hat seine Ruhe, muss sich weniger Gedanken um Umgebungsgeräusche machen, muss weniger blocken. Es ist einfach intimer. Wir wollten einen romantischen und makabren Liebesfilm drehen. Dafür eignen sich diese Sommernächte gut. Sie haben eine spezielle Energie – gerade, wenn man sich kennenlernt. Diese Momente erinnerten uns an unsere eigene Jugend. Minsk hat auch ein besonderes Licht, das inspirierte uns bei der Motivauswahl.
Wie in euren letzten beiden Filmen spielen auch in »White Snail« Tiere eine wichtige Rolle. Warum?
peter: Für uns sind Tiere Geheimnisträger*innen, wir nutzen das für unser Storytelling. Bei den Filmen davor haben uns die Hunde interessiert: Hunde sind sehr treu, haben aber auch ein eigenes Leben. In diesem Film sind Misha und Masha sehr auf Tiere fokussiert. Beim Dreh haben die beiden sogar immer wieder über Tiere geredet – über Wasserschildkröten oder Ameisen.
kremser: An den Schnecken faszinierte uns, dass man sie so schwer lesen kann. Es ist schwierig, zu verstehen, was in einer Schnecke vorgeht. Die Schnecken im Film sind übrigens sehr speziell, es sind die Haustiere von Marya Imbro. Wir hatten die Tiere auf der Hand, aber nie auf dem Gesicht so wie Masha im Film. peter: Wir hatten auch unsere Limits.
»White Snail« ist ein Film über Nähe und Verbindung sowie die Angst davor. Wieso haben viele Menschen – ob bewusst oder unbewusst – diese Angst?
kremser: Man hat wohl Angst davor, verletzt zu werden. Dieses Risiko besteht immer. peter: Ich hoffe, mehr Menschen trauen sich, sich zu öffnen – das wäre ein großer Wunsch von uns.
kremser: Bei Kindern kann man gut beobachten, dass sie eigentlich noch keine Angst haben, sich zu öffnen, aber sobald sie Ablehnung erfahren, wird es schwieriger für sie. Das könnte auch ein Appell sein: »Habt den Mut, euch zu öffnen, und seid nicht gemein zu denen, die es tun!« Barbara Fohringer
Der Film »White Snail« von Elsa Kremser und Levin Peter ist ab 23. Jänner 2026 in den österreichischen Kinos zu sehen.
Seit einigen Jahren schon scheint es in Österreich einen regelrechten Tattooboom zu geben. Doch nun wird besonders in Social Media zunehmend sichtbar, dass junge Leute ihre Tattoos bereuen oder sogar entfernen lassen möchten. Was steckt hinter dieser Entwicklung? Werden Tattoos wieder zum Tabu? ———— Ob als Andenken aus dem Urlaub, Erinnerung an einen bedeutsamen Moment oder durchgeplanter Körperschmuck – mittlerweile ist laut dem Linzer Institut für Markt- und Sozialanalysen fast jede vierte Person in Österreich tätowiert. Tattoos sind längst vom Randphänomen zum Mainstreamtrend geworden. Gleichermaßen sichtbar auf muskulösen Oberkörpern im Fitnessstudio, als den ganzen Arm bedeckende »Sleeves« bei Punkkonzerten wie in Form kleiner, krakelig gestochener »Ignorant Tattoos« auf der Wade der Bürokollegin. Infolge des Tattoohypes scheint es jedoch auch zu einer gesteigerten Nachfrage nach Tattooentfernungen zu kommen. Das Laser-Removal-Angebot nimmt stetig zu. Und auf die Tiktok-For-You-Page werden immer häufiger Videos von jungen Menschen gespült, die sich ihre Tattoos weglasern
»Die Gestaltung des eigenen Körpers ist für viele eine letzte Bastion der Freiheit.« — Monika Weber
lassen möchten. Sie würden ihre Entscheidung bereuen und betiteln das mit Hashtags wie #tattooremoval, #tattoofails oder #tattooregret. Auffallend häufig sprechen in diesen Videos Frauen, aber auch Männer sind zu sehen. Neigt sich also die Begeisterung für Tattoos langsam dem Ende zu? Und welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat das Tattoo heute?
Körpergestaltung mit Tätowierungen sei ein tiefsitzendes Bedürfnis der Menschheit, erklärt Kultur- und Sozialanthropologe Igor Eberhard von der Universität Wien. In seiner Forschung befasst er sich unter anderem mit
der Stigmatisierung von Tattoos. Er erzählt, wie es nach der Erfindung der elektrischen Tätowiermaschine 1891 zu einem großen und breiten Interesse an Tattoos gekommen ist. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts sei die Tätowierung jedoch vor allem unter Seefahrern, Schausteller*innen und Strafgefangenen beliebt gewesen – neben Handwerkern sowie Teilen des Adels. Das habe dazu geführt, so Eberhard, dass der Ruf von Tattoos zusehends schlechter wurde. Selbst Wissenschaftler hätten damals immer wieder versucht, eine Verbindung zwischen Tattoos und Kriminalität nachzuweisen. Obwohl sich die Klientel im Laufe des Jahrhunderts dann erweitertet habe, habe diese Stigmatisierung lange angehalten: »Es gibt noch einige psychiatrische Studien aus den 1980er-Jahren, in denen es heißt, dass Kriminalität und Tätowierung zusammenpassen würden.«
Vollkommen in der Popkultur angekommen sind Tattoos dann wohl erst Anfang der Nullerjahre, als etwa TV-Sendungen wie »Miami Ink« einen breiteren Zugang zur Tattooszene schufen und sich zahlreiche Stil-

richtungen entwickelten. Heutzutage ist das Handwerk des Tätowierens jedenfalls ganz selbstverständlich als Gewerbe etabliert und weitverbreitete Form des kreativen, individuellen Ausdrucks. Monika Weber, Inhaberin des Studios Happy Needles Tattoo in Wien, ist schon seit 1997 Teil der Szene. Sie hat das Populärwerden von Tattoos hautnah mitverfolgt: »Als ich begann, war selbst die Rose am Schlüsselbein noch etwas ganz Verwegenes. Damals stellten Tätowierungen noch eine Art der Rebellion dar.« Nun habe sich das Stigma rund um Tattoos gebessert, sagt sie. »Selbst klassische ›Job-Stopper-Tattoos‹ werden bereits in vielen Berufen akzeptiert.« Die Tätowierung ist mittlerweile also nicht mehr als Akt rebellischer Provokation zu verstehen. Fußballer, Celebritys – alle tragen sie.
Konsumgut statt Untergrund
Laut Weber würden Tattoos heute vielfach als Modeaccessoire betrachtet werden, wie eine schrille Nagellackfarbe. »Letztens boten wir auf einem Event in den Wiener Werkshallen Gratistattoos an. Wir tätowierten
vierzig Leute mit Minisymbolen, einfachen Pinterest-Motiven. Das war ein Zehntel der dort geladenen Gäste«, erzählt Weber. »Ich hatte das Gefühl, die Leute betrachten das als nettes Gimmick.« Für die Tätowiererin zeige das, dass die Hemmschwelle in den letzten drei Jahrzehnten abgenommen habe. Tattoos sind heute scheinbar einfach ein Konsumgut unter vielen.
Ihr Berufskollege Jakob Kerschbaumer bemerkt diese Veränderungen ebenso. Er klärt auf seinem Instagram-Account über die Geschichte des Tätowierens auf und berichtet über aktuelle Entwicklungen in der Szene. Social-Media-Beiträge von jungen Menschen, die ihre Tattoos bereuen, sind zuletzt auch ihm vermehrt untergekommen.
Plattformen wie Instagram oder Tiktok fungieren als Spiegel gesellschaftlicher Vorlieben und Konsummuster. Besonders sichtbar wird das in den zahlreichen Mikrotrends, die durch spezifische Ästhetiken, Kleidung und Schönheitsstile geprägt sind. Diese üben speziell auf Frauen einen enormen Druck aus. Eine dieser Ästhetiken nennt
sich »Clean Girl«, sie ist davon gekennzeichnet, möglichst »rein« – also natürlich, unberührt und minimalistisch – auszusehen. Tattoos stehen hierzu in einem offensichtlichen Widerspruch. Darüber hinaus propagieren auch explizit konservative, antifeministische Bewegungen wie jene der Tradwives ein makelloses, unauffälliges Äußeres.
Dem Trend hinterher
Derartige Mikrotrends sind vor allem eines: schnelllebig – und damit auch austauschbar. Um mit diesen sich stets verändernden Trends mitzuhalten, muss man sich also ständig anpassen. Tätowierungen erschweren das klarerweise. »Wenn ich mich verändern möchte, um einem aktuellen Trend zu entsprechen, dann liegt es schon im Wesen der Sache, dass ich mich mit dem nächsten Trend gleich wieder in eine andere Richtung verändern werde«, fasst Kerschbaumer zusammen.
Problematisch ist auch, dass sich Mikrotrends meist nur oberflächlich einer Ästhetik bedienen, die eigentlich aus einer bestimm-

Jakob Kerschbaumer tätowiert seit 2013 und informiert zudem auf Social Media über die Szene.
ten Gruppe kommt – oft aus einer Subkultur. »Im Internet komprimiert man Subkulturen durch diese Oberflächlichkeit auf einen Look, den man dann auf Instagram oder Tiktok darstellt«, meint Kerschbaumer. »Die ganzen Werte, die dem zugrunde liegen, haben dann eigentlich keine Bedeutung mehr, sondern es geht ausschließlich um die Ästhetik.«
Monika Weber sieht vor allem extremere Tattootrends als Grund dafür, dass manche ihre Tätowierungen wieder entfernen lassen möchten. »Junge Menschen wachsen in einer Zeit von Maßregelung und Verboten auf«, sagt sie. »Die Gestaltung des eigenen Körpers ist für viele davon eine letzte Bastion der Freiheit. Mit einem Tattoo am Oberarm kann man aber mittlerweile nicht mehr rebellieren, dazu muss man schon ins Extreme gehen.« Tätowierungen an exponierten Stellen wie Hals oder Gesicht scheinen, so Weber, derzeit zuzunehmen. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit, um wahrgenommen zu werden. Gerade 18bis 30-Jährige würden sich oft zu extremen Tattoos verleiten lassen – und diese später bereuen: »Solche Spontanaktionen können dein Leben schon ruinieren, wenn es zu extrem wird. Das wird zum Teil unterschätzt.« Die Beratung durch Tätowierer*innen sei daher das A und O, findet Weber. Aber nicht nur Tattoos an exponierten Stellen nehmen zu: Auch Fineline-Tattoos sind beliebter denn je. Das sind hauchdünne Linienzeichnungen ohne Schattierungen und Farben. Gerade auch darin sieht Jakob Kerschbaumer ein Potenzial für unüberlegte Entscheidungen: »Man kann sich innerhalb von kürzester Zeit eine ziemliche Menge von diesen kleinen Tätowierungen stechen lassen, auch weil die einfach nicht lange dauern. Und es kann sein, dass man sich dann innerhalb eines Jahres oder noch schneller fünfzehn kleine Tätowierungen auf einen Arm stechen lässt.«
»Für eine erneute Tabuisierung sind jetzt viel zu viele Menschen tätowiert.« — Igor Eberhard
Ob diese öffentlich besprochenen TattooRegrets nun auch mit dem Rückgang von Tätowierungen einhergehen, lässt sich nur schwer ermitteln – es gibt dazu keine Zahlen. Auf eine Rückfrage beim Laserstudio The Cottage heißt es aber, dass sich vermehrt Patient*innen melden würden, die das Tattoo aus ihrer rebellischen Jugend bereuen. Tattooentfernungen seien allerdings ein Privileg: Aufgrund der hohen Kosten könnten sich das nicht alle leisten, die es gerne machen lassen würden. Oliver Bergmann von The Cottage: »Insgesamt lässt sich sehr wohl ein Trend weg vom Tattoo erkennen – nicht zuletzt, weil auch Hollywood und internationale Prominente zunehmend ein tattoofreies, ›cleanes‹ Image vermitteln und Tattoos medienwirksam entfernen lassen.«
Zurück zu Igor Eberhard von der Uni Wien: Er sagt, dass es schon immer Tattooentfernungen gegeben habe. »Selbst in der Antike hatte man bereits Rezepte dafür.« Bei wissenschaftlichen Studien über Removals gehe es jedoch meist um problematische Tätowierungen, zum Beispiel politische Botschaften. Oder um Tattoos, die technisch schlecht gemacht wurden, bei denen Narben entstanden. Davon abgesehen vermutet Eberhard, dass vor allem Tätowierungen an Stellen, die man nicht bedecken kann, bereut würden. Gruppendruck könne eine Entscheidung dabei beeinflussen.

Igor Eberhard, Kulturund Sozialanthropologe
Seiner Schätzung nach hat sich die Zahl der Tätowierten in Österreich mittlerweile bei etwa dreißig Prozent eingependelt. Der Trend könne zwar wieder etwas in die Gegenrichtung laufen, aber vor allem sei mit einer anderen Gewichtung zu rechnen: Tätowierungen wieder eher an den subkulturellen Rändern der Gesellschaft und weniger in der breiten Masse. Ein richtiges Verschwinden und eine Tabuisierung kann sich der Wissenschaftler jedenfalls nicht vorstellen: »Dafür sind jetzt viel zu viele Menschen tätowiert.« Also selbst, wenn derzeit wieder einige Menschen ihre Spinne am Hals, ihren Schnurrbart am Finger oder ihr Geweih am Rücken bereuen, die Zeiten in denen Tattoos nur etwas für die verruchte Hafenkneipe waren, sind wohl wirklich vorbei.
Selma Hörmann
Das Tattoostudio Happy Needles feierte im Sommer seine Neuerö nung in der Ramperstor ergasse 57 in Wien. Jakob Kerschbaumer postet regelmäßig auf Instagram unter @jakobkerschbaumertattoo Interessantes zum Thema Tattoos. Igor Eberhards neues Buch »Stigma Tattoo?« erscheint nächsten Herbst im Transcript Verlag.



























Verstaubter Leopardenpelz und Barbie-Pink erblicken wieder das Sonnenlicht, Monchhichis reinkarnieren sich in Labubus, alles glitzert und glänzt. Über Dinge, die so hässlich sind, dass sie wieder schön werden. ———— Während eines Stadtspaziergangs gehe ich an einem Souvenirladen vorbei und mein Blick fällt auf Abbildungen von Mozart, Stephansdom und »Der Kuss« auf Plastikfächern. »Alles Kitsch!«, denke ich. Dabei überkommt mich der Gedanke, dass Kitsch aus Wien schwer wegzudenken ist – und dass ich das nicht immer schlimm finde. Die unvermeidbaren Aida-Cafés, die anhaltende Popularität von Pferdekutschen wie auch der Erfolg von Marken wie Kitsch Bitch überzeugen mich davon, dass ich das nicht als Einzige so sehe. Und dass Kitsch wohl auch für andere ein Guilty Pleasure ist. Doch was fasziniert uns daran? Ist Kitsch Kunst? Und warum gilt »Mädchenhaftes« als kitschig?
Bei der Beantwortung dieser Fragen finden wir uns rasch in den Siebzigerjahren wieder – aber jenen des neunzehnten Jahrhunderts. Damals tauchte der Begriff nämlich zum ersten Mal am Münchner Kunstmarkt auf, als abwertender Ausdruck für billige, minderwertige Kunstwerke. Vermutet wird, dass er vom mundartlichen Wort »kitschen« abstammt, das das Zusammenschieben von Dreck oder Schlamm bezeichnet.
Zeit und Ort sind dabei kein Zufall. Im Gespräch mit Claudia Lomoschitz, Künstlerin und Dozentin an der Akademie der bildenden Künste Wien, erfahre ich, dass durch die Industrialisierung damals zum ersten Mal Produkte massenhaft und preiswert hergestellt werden konnten. In der Gesellschaft war nach der Aufklärung zudem ein Bedürfnis nach Individualität geweckt. Das alles bedeutete, dass Bildung, Moral und Geschmack zu einem Ausdruck von Status wurden. Auch das Zuhause war von da an ein Ort, an dem man sozialen Status zeigen wollte. Wodurch die Nachfrage nach gefälligen Kunstimitaten – also Kitsch – entstand.
Mona Lisa am Klo
Bald sollte sich daraus ein Phänomen entwickeln: eine einfache Symbolsprache, die sentimental geprägt ist und an die Emotion appelliert. Im ästhetischen Sinne handelt es sich meistens um aus der »hohen« Kunst entliehene Motive und Themen, die vereinfacht, verniedlicht oder romantisiert wiedergegeben werden – indem beispielsweise eine Hundekopfbüste zur Keksdose wird oder die Mona Lisa zur Tapete am Klo.
Lomoschitz erläutert, dass im NS-Regime offiziell gegen Kitsch gehetzt worden sei, er wäre »verweichlicht« und »unheldenhaft«. Kitsch habe als Symbol für den Verfall nati-
onalsozialistischer Werte gegolten. Erstaunlich, aus meiner Sicht scheint Kitsch in dieser Zeit nämlich allgegenwärtig. Jedes Propagandaplakat, jede Statue dieser Zeit strotzt geradezu vor verklärtem Nationalkitsch.
Eine Antwort auf diesen Widerspruch findet sich bei Hermann Broch. Dieser veröffentlichte 1933 sein erstes Werk zu Kitsch und setzt sich damit als einer der Ersten aus philosophischer Perspektive explizit mit diesem Phänomen auseinander. In den 1940erJahren stellt er seine Überlegungen dann in den Kontext des Totalitarismus. Broch beschreibt Hitler als den »Prototyp des Kitsch-Menschen«, seine ganze Ideologie bestehe im Heraufbeschwören von grausig kitschigen Stereotypen.
Für Broch ist Kitsch im Gegensatz zur Kunst ein ästhetisches System ohne Ethik: »Nirgends ist die Umschichtung der Werthaltung, die Wirksamkeit des Bösen in der Welt so ausgeprägt wie in der Existenz des Kitsch.« Diese Haltung passt in den generellen Kanon der Zeit. Kitsch wird damals vorwiegend als Antithese der Kunst, unkritisches Trostpflaster und die ungebildete Antwort auf eine Geschmacksfrage gesehen. Und dem kann ich kaum widersprechen. Kitsch ist übertrieben sentimental und erbarmungslos unecht. In
Lisa Zartler hat sich künstlerisch mit Kitsch auseinandergesetzt und sich dabei die Frage gestellt, ob er eigentlich wirklich hässlich ist oder einfach nur ehrlich. Sie nutzt die Ästhetik des vermeintlich Geschmacklosen und zeigt, warum Kitsch mehr sein kann als Glitzer und Gefühl.



































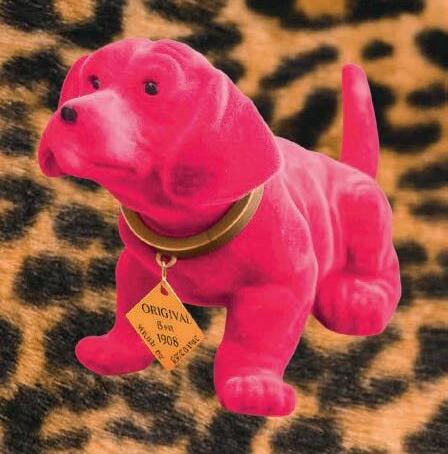

»Spannend ist, dass Kitsch auf jeden Fall etwas Konsumierbares ist und etwas, das sehr eng mit Identität zusammenhängt.«
— Claudia Lomoschitz
all seiner »Verlogenheit« ist er aber vor allem eines: ehrlich. Ganz unverschleiert und grobschlächtig erzählt Kitsch, was er von uns will, oder viel mehr, was wir von ihm wollen.
Wenn ich meine eigene Zuneigung zu Kitsch hinterfrage, ist es vor allem eine Art Affirmation, die Kitsch für mich als kulturelles Phänomen auszeichnet. Kitsch formuliert einen Wunsch, zeigt mir die Welt, wie sie nicht ist, aber sein sollte. Wer Kitsch unironisch konsumiert, sehnt sich vermutlich nach Harmonie, besseren Verhältnissen oder Gerechtigkeit – danach, in jene Welt einzutauchen, der das dicke, rosa Porzellanschwein entsprungen ist.
»Spannend ist, dass Kitsch auf jeden Fall etwas Konsumierbares ist und etwas, das sehr eng mit Identität zusammenhängt«, erläutert Claudia Lomoschitz. »Viele Subkulturen definieren sich über Konsum, durch Geschmacksurteile werten sie sich gegenseitig auf – oder ab.« Die Künstlerin eröffnet damit ein neues Kapitel in unserem Gespräch. Es geht um Kitsch als Klassenfrage: »Geschmack ist ein subjektives Werturteil, das erst im achtzehnten Jahrhundert, nach der französischen Revolution, entsteht. Absurd, dass in dem Moment, in dem Menschen gleich viel wert werden, plötzlich Geschmacksabwertungen aufkommen.«
Stil wurde so zu einem Mittel der sozialen Spaltung und ermöglichte es, in diesem neuen System Hierarchien zu schaffen. Vielleicht stoße ich mich auch deshalb an der Behauptung, Kitsch sei »der schlechte Geschmack«, weil »der gute Geschmack« auch heute noch von einer kleinen, dominierenden Gruppe vorgeschrieben wird. Als aktuelles Beispiel nennt Claudia Lomoschitz Markentaschen. Während diese nur für wenige erschwinglich seien, werde der Kauf eines Imitats als kitschig abgewertet.
Verführerischer Kitsch
Im Wissen, dass Methode hinter der gesellschaftlichen Bedeutung von Kitsch steckt, ist für mich die scheinbare Verknüpfung von Kitsch und Weiblichkeit umso interessanter. Einige Verbindungslinien lassen sich durch die historische Rolle der Frau und die damit einhergehenden Werte wie Emotionalität und Friedfertigkeit erklären. Abgesehen davon fällt mir bei meinen Recherchen auf, dass Zuschreibungen von Kitsch teilweise fast wörtlich altbekannte weibliche Stereotype übernehmen. Sie erinnern mich an ein Frauenbild, wie es bereits die biblische Anekdote vom Sündenfall zeichnet. Kitsch wirkt verführerisch, ist eine Lüge, vulgär und nicht zu eigener Originalität fähig.
Das alles führt uns zur Überlegung, ob Kitsch und Weiblichkeit vielleicht in ihrer Rolle vergleichbar sind. »Women written by men« kennen wir ja nur zu gut. Frauen werden im Patriarchat eindimensional und
funktionalisiert dargestellt sowie abgewertet, weil das System auf Männer zugeschnitten ist. Kitsch gilt analog dazu zwar als Gegensatz zur Kunst, wird aber dennoch durch diese definiert. Frauen und Kitsch werden somit beide an fremden Maßstäben gemessen. Es dauert eine ganze Weile, bis mir auffällt, dass alle Einordnungen von Kitsch, mit denen ich mich bisher befasst habe, von Männern geschrieben worden sind. Erst als ich schließlich in Helga Kämpf-Jansens Artikel »Kitsch – oder ist die Antithese der Kunst weiblich?« über eine feministische Perspektive stolpere, merke ich, wie sehr mir

Claudia Lomoschitz, Künstlerin und Dozentin
diese gefehlt hat. Ihr Text bestätigt mich in einigen Überlegungen und stellt sogar ein »Wörterbuch des Kitsches« zusammen. Resümierend schreibt sie dort: »Auf der Ebene der begrifflichen Bestimmung durch den Mann sind die Einschätzungen des ästhetischen Phänomens ›Kitsch‹ und die Einschätzungen nicht nur der ästhetischen Aktivitäten der Frau, sondern auch ihrer wesensmäßigen Bestimmung weitgehend gleich, wobei das evozierte Frauenbild das ›Andere‹ der Frau darstellt, also die Hure und nicht die Heilige, die Femme fatale und nicht die Femme fragile, die Hexe und nicht die bürgerliche Gattin.«
Der Wert von Weiblichkeit
Dass das Kitsch-Urteil historisch vor allem auf Weibliches fällt, lässt sich belegen. Claudia Lomoschitz erzählt von der BauhausKunstschule der 1920er-Jahre, in der zunächst geschlechtliche Gleichberechtigung angestrebt wurde. Um aber im patriarchalen Diskurs der Zeit mitspielen zu können, seien Frauen ab 1922 nur noch in den Webereiklassen zugelassen worden. Trotz großer Erfolge – die Weberei war laut Lomoschitz die luk-
rativste Klasse des Bauhauses – habe diese kaum Wertschätzung erfahren, sie sei viel eher als »Frauenklasse« abgewertet worden. Die Kunstprofessorin erklärt mir auch, dass sich die geschlechtsspezifischen Farbcodes Rosa und Blau, wie wir sie heute kennen, erst Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts einstellten. Zuvor seien diese beiden Farben sogar gegenteilig konnotiert gewesen. Als Folge solcher Umdeutungen werden dann ganze Epochen aus heutiger Sicht belächelt und als kitschig abgetan. Kaiser Leopold I. in Schleifchen, vergoldeten Rüschen und ausgestelltem Rock – damals der letzte Schrei – hätte heute ohne Zweifel eine andere Wirkung.
Lange habe ich mich gefragt, was Kitsch und Weiblichkeit im Kern verbindet. Denn –ob Fußballkult, Autohype und Barbershops – kitschige Ästhetiken finden sich längst auch in männlichen Sektoren. Doch Kitsch ist eben weniger eine objektive Kategorie als ein Urteil, ein »Weiblichkeitsurteil«. Und das nicht zufällig: »Ich würde gar nicht sagen, Kitsch existiert – Kitsch wird gemacht. Das ist ein Mechanismus«, meint Lomoschitz.
Mehr und mehr wird mir klar, dass Kitsch vor allem eine Ablenkung ist. Wenn ich mir eine Tasche aus Kunstfell zulege und mich dadurch ein Stück besser fühle, lenkt das davon ab, dass sich an meiner Situation durch diesen Kauf substanziell nichts geändert hat. Andererseits wettern Herrscher gegen Kitsch, missbrauchen seine Zugänglichkeit dann aber für eigene Zwecke. Das kulturelle Angebot für die breite Gesellschaft wird eingeschränkt, gleichzeitig werden diese eingeengten Möglichkeiten als Kitsch abgetan. So folgt ein abwertendes Urteil auf das andere. Kitsch hat viele Gesichter, umso wichtiger ist es, Kitsch als Instrument zu verstehen und nicht als Gegebenheit.
Aktuell scheint Kitsch in der Popkultur und der Kunst ein Comeback hinzulegen. Auf Social Media stolpert man über Memes und Trends, die Kitsch als »trashy« Ästhetik zurückbringen, und ich freue mich darüber. Vielleicht ist es ein sinnvoller Umgang mit Kitsch, ihn in der Offensive zu verwenden und nicht mehr als Urteil über andere. »Letztendlich geht es nicht um Konsum, Geschmack oder Kitsch, sondern um Gemeinschaft«, sagt Claudia Lomoschitz und seufzt. »Leider befinden wir uns aber immer noch mitten in Kapitalismus und Patriachat.« Eine Aussage, an die ich wieder denken muss, als ich mir später meine Kaiserin-Sissi-Socken mit Herzchenmuster anziehe. Kamia Liu
Die künstlerische Arbeit von Claudia Lomoschitz findet sich unter www.claudialomoschitz.com. Lisa Zartler hat dieses Jahr die Meisterschule für Kommunikationsdesign an der Graphischen absolviert. Ihre Abschlussarbeit war im Juni im Künstlerhaus zu sehen.



DIE NEUE KOMÖDIE VON ANDERS THOMAS JENSEN
DEM REGISSEUR VON ADAMS ÄPFEL UND HELDEN DER WAHRSCHEINLICHKEIT






„Eine herrlich schwarzhumorige Komödie.“









AB 25. DEZEMBER IM KINO




Model fängt oft mürrische Blicke ein – wie hier in der Lower East Side von New York.
In der Albertina Wien wird das Werk der Fotografin Lisette Model gerade neu betrachtet. Es ist die erste große Ausstellung in Österreich seit 25 Jahren und eine Hommage an eine Wienerin, deren kompromissloser Blick die Fotografie veränderte. ———— Ein Blick zurück und zugleich nach vorn: Mit der großen Retrospektive zu Lisette Model widmet sich die Albertina einer Künstlerin, deren Werk sich über mehrere Kontinente erstreckt und auf eine große Zeitreise durch das zwanzigste Jahrhundert einlädt. Geboren 1901 in Wien, aufgewachsen zwischen verschiedenen Sprachen, Welten und kulturellen Systemen, floh Model 1938 vor dem Nationalsozialismus nach New York. Von dort aus prägte sie die Street-Photography wie kaum sonst jemand. Nun, rund 25 Jahre nach der letzten großen Schau in Österreich, wird ihr Werk hierzulande endlich wieder sichtbar. Und das gerade in einer Zeit, in der man sich mit dem schnellen Bild schwerer tut denn je zuvor: In der Masse visueller Produktion ist ein radikaler Blick wie jener von Model nur mehr schwer aufzufinden.
Kurator Walter Moser sieht in diesem erneuten An-die-Oberfläche-Bringen von Models Arbeiten eine doppelte Chance: »Es war an der Zeit, wieder auf ihr Werk zu schauen

– auch, weil mittlerweile mehr Material zugänglich ist.« In den Archiven der Albertina fanden sich nicht nur berühmte Fotoserien wie die »Promenade des Anglais« oder die Szenen aus »Sammy’s Bar« und »Nick’s Night Club«, sondern auch Fotografien, die bisher kaum jemand gesehen hatte: eine Serie von Museumsbesucher*innen, drei erhaltene Prints einer Hundeschau in New York und Aufnahmen aus Venezuela sowie Reno. Gerade diese unbekannten Kapitel zeigen, wie weit Models Blick reichte: von der mondänen Küstenpromenade über den Rausch der Clubs bis in die Wüsten Nevadas, wo sie Frauen porträtierte, die dort auf ihre
Scheidung warteten. »Diese Serie ist sehr melancholisch und zeigt, wie viel Empathie Lisette Model diesen Frauen entgegenbringt«, meint Moser.
Das Leben im Bild
Lisette Model war eine Fotografin, die jeden einzelnen Menschen ernst zu nehmen schien. Ihre Bilder zeigen keine Pose, kein kalkuliertes Gesicht, sondern den Moment dazwischen. Das Erschrecken, das Nichtwissen, das Innehalten. Fast wie zufällige Begegnungen, festgehalten im Vorübergehen. Ein unkonventioneller, manchmal voyeuristischer Blick, aber nie aufdringlich – eher überraschend, als wären

die Menschen auf ihren Fotos selbst über die plötzliche Aufmerksamkeit erstaunt. Model gilt dabei als kompromisslose Beobachterin, als Fotografin, die das Menschliche in seiner ganzen Widersprüchlichkeit einzufangen wusste. Im Glanz, wie im Scheitern und in den unzähligen Zwischenstufen, die ein menschliches Leben abzubilden vermag. Ihre Aufnahmen entstanden nicht aus Distanz, sondern aus Nähe. In der Bewegung nach dem Stillstand, im Ungeplanten der Momenthaftigkeit, in den Sekunden, in denen die Fassade bricht. Kurator Walter Moser: »Model ist viel mehr als die Künstlerin des bissigen Blicks. Sie hat auch einen empathischen, melancholischen und düsteren Blick entwickelt. Diese Vielseitigkeit sichtbar zu machen, war mir ein großes Anliegen.«
Gerade in ihren späteren Arbeiten, etwa in der Serie »Reno«, tritt dieser Wandel deutlich hervor. Hier begegnen wir Frauen, die in Motels warten, während ihr Leben stillzustehen scheint. Diese Melancholie ist kein Bruch, sondern die Fortsetzung einer Haltung: Lisette Model nahm Menschen sowohl in ihrer Angst als auch in ihrer Würde ernst. Nach den Jahren der McCarthy-Ära, in denen sie verhört worden war und viele Auftraggeber*innen verloren hatte, begann Model zu unterrichten. In der Lehre war sie so kompromisslos wie in ihren Bildern
und zeigte eine leidenschaftliche Hingabe zu ihrer Disziplin. »Schießt aus dem Bauch«, riet sie den Schüler*innen, darunter spätere Fotografiekoriphäen wie Diane Arbus, Bruce Weber oder Larry Fink. Moser beschreibt sie als Lehrerin, die die soziale Wirklichkeit intuitiv und unmittelbar wiedergeben konnte.
Zwischen Nähe und Distanz
Die Direktheit ihrer Bilder täuscht allerdings mitunter: »Man glaubt oft, Model sei ihren Motiven sehr nah gekommen, aber diese Unmittelbarkeit entstand vor allem in der Dunkelkammer«, erklärt Moser. Er erläutert weiter, dass Model mit einer Rolleiflex-Kamera fotografierte, die sie von oben bediente, was einen Blick aus der Unterperspektive bedingte. Lisette Model hat nicht einfach gesehen, sondern mit ihrem Blick die Wirklichkeit geformt. Die Nähe entstand dann in der Nachbearbeitung: Sie schnitt ihre Negative, verdichtete Kompositionen, entfernte Ablenkungen, bis das Wesentliche übrigblieb. Die Fotografien sind dadurch zugleich roh und präzise. Sie sind das Gegenteil des Perfektionismus – und doch durchdrungen von Perfektion. Die Ausstellung legt diesen Prozess offen: Negative, Kontaktbögen, eingezeichnete Bildausschnitte, Scans, die in Loops gezeigt werden.

Selbst als sie ins Visier der Politik geriet, bewahrte Lisette Model ihre Standhaftigkeit.
»Model begann in einem stark politisierten fotografischen Umfeld«, erzählt der Kurator. »Später versuchte sie, diese Lesart zu relativieren – wohl auch als Reaktion auf ihre Erfahrungen in der McCarthy-Ära.« Während dieser Zeit war Lisette Model nämlich ins Visier des FBI geraten, wegen ihrer Mitgliedschaft in der progressiven New York Photo League – einer Fotogemeinschaft, die wegen angeblicher kommunistischer Verbindungen überwacht und 1951 aufgelöst wurde. Die Schau zeigt auch deswegen Models Werdegang chronologisch, immer im Kontext seiner Zeitgeschichte. »Das war bei ihr gar nicht anders denkbar«, so Walter Moser. Sie führt von Frankreich über New York bis zu den späten Serien aus Venezuela und Reno.
In ihren letzten Arbeiten, den düsteren Aufnahmen aus Venezuela, scheint sich Models Blick zu verändern. »Sie fotografiert plötzlich Motive, die sie früher nie interessiert haben – Ölplattformen, Bohrtürme, Industrieanlagen«, erzählt Moser. »Zuvor stand immer der Mensch im Mittelpunkt.« Diese kargen, fast apokalyptischen Bilder wirken wie ein Nachbeben: Die Welt rückt in den Vordergrund, der Mensch verschwindet. Vielleicht sei das ihre Art gewesen, innere Erschütterungen sichtbar zu machen, stellt der Ausstellungskurator in den Raum.
Haltung und Vermächtnis
»Lisette Model war eine streitbare und beeindruckend konsequente Persönlichkeit«, sagt Moser. »Sie wusste, wie sie sich durchsetzen konnte.« Geboren in eine jüdische Familie, floh sie 1938 mit ihrem Mann Evsa Model nach New York. Die Verhöre des FBIs waren existenzbedrohend – »im schlimmsten Fall hätte sie ihre Staatsbürgerschaft verloren«. Doch Model blieb trotz all dieser Widerstände unbeirrbar. In einer Welt wie heute, in der jede Bewegung und jeder Ausdruck zum Selbstbild werden, ihre eigene Echokammer produzieren, wirken Models Fotografien wie ein Gegenentwurf. Sie zeigen Menschen, die nicht für ein Publikum posieren. Keine Gesten, die etwas beweisen wollen. Stattdessen sind da ungeplante Augenblicke, unbemerkte Zwischenräume und Reflexionen über Leben, die nirgendwo gespiegelt werden.
Das Zufällige und Spontane, das vielleicht noch aus ihrer Vergangenheit als Malerin stammt, konserviert dabei bis heute Augenblicke des Vergänglichen – wie eine Hand, die über die Leinwand streicht, streift ihre Linse über das Leben. »Das Entscheidende war für mich, Lisette Models Vielseitigkeit zu zei-

»Model ist viel mehr als die Künstlerin des bissigen Blicks. Sie hat auch einen empathischen, melancholischen und düsteren Blick entwickelt.«
— Walter Moser
gen; ihr Gespür für soziale Verhältnisse, ihre künstlerische Haltung, aber auch ihre Unbeirrbarkeit als Künstlerin in einer politisch schwierigen Zeit«, fasst es Kurator Walter Moser zusammen.
Gegen die Pose
Models Bilder laden ein, sich in vergangene Welten hineinzuträumen. Wer durch ihre Bildwelt geht, denkt unweigerlich an die unzähligen Möglichkeiten des Menschseins. Man sitzt plötzlich dort, auf einer Bank am Meer, in einem verrauchten Club, in einem anderen Jahrhundert und fragt sich, wer man selbst in dieser fremden und doch so nahegerückten Zeit gewesen wäre. In einer Welt, in der die Gegenwart zwischen hundert Selfies zerrinnt, erinnern Lisette Models Fotografien daran, dass das Bild nicht Perfektion, sondern Begegnung sein kann. Sie machen sichtbar,
was sonst verloren geht, und bewahren das, was bleibt: den Moment zwischen den Fassaden, zwischen Angst und Zärtlichkeit, zwischen Pose und Wahrhaftigkeit.
Vielleicht ist das das Schönste an Models Bildern: dass sie uns nicht nur die Menschen ihrer Zeit zeigen, sondern auch etwas von uns selbst. Sie fordern uns auf, zu verweilen und zu beobachten, ohne gleich zu urteilen. In einer Epoche, in der Bilder sich permanent selbst kommentieren, bleibt Models Werk ein stiller Widerspruch und zeigt, dass das Unspektakuläre oft die tiefste Wahrheit trägt. Ihre Fotografien öffnen damit ein Fenster, durch das man für einen Augenblick atmen kann – mitten im Lärm der Gegenwart. Ania Gleich
Die Retrospektive »Lisette Model« – mit rund 160 Arbeiten – ist noch bis 22. Februar in der Albertina Wien zu sehen.




Die Nachfrage nach Fotos war wohl noch nie so groß wie heute. Gleichzeitig ist es dank digitaler Technologien für jede*n schnell und einfach möglich, qualitativ hochwertige Bilder zu machen. Was bedeutet es unter diesen Bedingungen, Berufsfotograf*in zu sein? Wie sieht deren Alltag aus? Und wie kommt man eigentlich an Aufträge?
Technische Entwicklungen, Social Media zur Kundenakquise, KI-generierte Bilder –der Beruf Fotograf*in verändert sich. Fünf Vertreter*innen des Fachs erzählen, was ihren Job ausmacht. Eva Kelety ist Bundesinnungsmeisterin der Berufsfotografie in der Wirtschaftskammer Österreich und hat langjährige Erfahrung in der Branche. Elodie Grethen fotografiert in den Bereichen Porträt und Performance, sie weiß, wie schwer es ist, als Fotograf*in eine Fixanstellung zu bekommen. Max Louis Köbele wiederum findet, dass das Thema Urheberrecht zu wenig ernst genommen wird. Paul Pibernig führt zwei Gewerbe – eines als Künstler, eines als Fotograf. Und Niko Havranek schätzt an seinem Beruf das gemeinsame Schaffen sowie den Austausch mit Menschen.
Der Alltag als Berufsfotograf*in
Eva Kelety: Nach zwanzig Jahren in diesem Beruf kann ich sagen: Für mich gibt es keinen Alltag. Jede Woche sieht anders aus. Ich bin auf Porträt- und Architekturfotografie spezialisiert. Bei Letzterer ist es teils schwierig vorauszuplanen. Man kann den Wetterbericht checken, aber oft kommt es
dann anders als vorhergesagt. Wenn ich ein Gebäude fotografiere, dann muss ich das in einer bestimmten Zeitspanne machen, abhängig vom Sonnenstand. Bei Porträts ist das einfacher. Da ist ein fixer Tag ausgemacht, ich packe meine Sachen, fahre hin, baue ein bis eineinhalb Stunden das Set auf und porträtiere die Personen.
Max Louis Köbele: Über die letzten Jahre habe ich für meine Arbeitswoche eine Struktur etabliert. Man ist als Fotograf*in Teil der kreativen Branche, das heißt, es laufen oft viele Projekte parallel. In meinem Fall sind das in erster Linie Aufträge im Bereich Event- und Sportfotografie. Daneben gibt es aber auch alltägliche Aufgaben, die sich im Hintergrund abspielen. Dafür habe ich mir Routinen geschaffen. Donnerstag ist zum Beispiel mein Buchhaltungstag. Meine Shootings lege ich dann rund um diese administrativen Tätigkeiten, sodass meine Routinen nicht gestört werden. Ich plane gerne drei Wochen vor. Mir ist ein strukturierter Alltag wichtig, denn ich bin ein kreativer Chaot – hätte ich keine Routinen, könnte ich nicht so effizient und professionell sein, wie ich möchte.

Elodie Grethen


Elodie Grethen: Neben meiner Tätigkeit in den Bereichen Porträt und Performance habe ich einen Lehrauftrag an der Angewandten. Dort habe ich ein regelmäßiges Einkommen, was Sicherheit gibt. Es ist aber schwer, als Fotograf*in eine Fixanstellung zu bekommen. Die wenigen Stellen, die es gibt, sind in der Regel befristet. Daher sehe ich meine Anstellung als Privileg. Trotzdem ist mein Alltag herausfordernd: Ich lehre, mache parallel dazu Aufträge im künstlerischen Bereich und bin Mutter. Das alles zu vereinbaren, ist nicht einfach. Meine Tage laufen dementsprechend unterschiedlich ab. An manchen unterrichte ich nur, an anderen erledige ich Aufträge. Ich habe aber auch fixe Abläufe, zum Beispiel mache ich freitags immer meine Fotonachbearbeitung.
Ausbildung – ein Muss?
Elodie Grethen: An sich ist Fotografie sehr demokratisch. Das heißt, es braucht keine Ausbildung, um Berufsfotograf*in zu werden. Eine Ausbildung ermöglicht aber einen Austausch mit anderen Fotograf*innen und hilft, seine eigene visuelle Sprache zu finden. Mir hat meine Ausbildung sehr geholfen, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Um von der Fotografie leben zu können, sollte man einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Du musst wissen, was dich ausmacht und was du anbieten kannst. Außerdem ist der Austausch mit Fotograf*innen aus anderen Sparten wichtig. Das kann aber auf vielen Wegen passieren. Ein Beispiel wären hier Kollektive. Ich bin zum Beispiel Teil des feministischen Kollektivs Femxphotographers.
Max Louis Köbele: Ich durchlief keine Ausbildung, sondern brachte mir alles selbst bei. Mit circa fünfzehn Jahren fing ich an zu fotografieren und verbrachte viele Nächte damit, mir mithilfe von Youtube-Videos technisches Wissen anzueignen. Mein Ansatz war es, Dinge auszuprobieren und Erfahrung zu sammeln. Deswegen entschied ich mich bewusst gegen ein Studium. In dieser Branche habe ich bislang auch noch nie gehört, dass eine Ausbildung Voraussetzung wäre. Wie in vielen kreativen Berufen lassen sich die eigenen Fähigkeiten eben nicht an einem Abschluss
festmachen. Beim Thema Networking ist ein Studium aber sicher von Vorteil. Kontakte sind wichtig, da schafft ein Studium eine Basis. Wie kommt man an Aufträge?
Paul Pibernig: Grundsätzlich läuft viel über Networking und Beziehungen. Besonders, wenn man jung ist und gerade beginnt, im Beruf Fuß zu fassen, bekommt man die ersten Aufträge oft über Kontakte. Es kommt aber auch auf den eigenen Werdegang an. Ich fotografiere zum Beispiel seit einiger Zeit für die Diagonale in Graz. Dementsprechend bin ich gut in der österreichischen Film- und Kulturbranche vernetzt und fotografiere viel im Kultureventbereich.
Niko Havranek: In den letzten Jahren wurde ich vermehrt von Kolleg*innen empfohlen. Es kommt aber auch darauf an, um welche Projekte es geht. Ich habe zum Beispiel mit Virginia de Diego ein Fotobuch über Wien gemacht, dafür wurde ich direkt von ihr kontaktiert. Sie war auf der Suche nach lokalen Fotograf*innen und stieß über Instagram auf mich und meine Straßenfotografie. Wenn es darum geht, saisonale Lücken zu füllen, muss man selbst aktiv werden, indem man sein Portfolio ausschickt und Leute kontaktiert. Man darf dabei allerdings nicht vergessen, dass es in vielen Bereichen dieses Berufs, was Aufträge betrifft, zu Schwankungen kommen kann. Das ist normal. Bei mir ist beispielsweise in den Weihnachtsferien und in den ersten zwei Monaten im Jahr weniger los als sonst. Man braucht da ein gewisses Grundvertrauen und darf sich nicht zu sehr stressen lassen.
Eva Kelety: Ich habe viele Stammkund*innen, die Fotoshootings buchen. Neukund*innen kommen meist über Mundpropaganda. Da ich seit vielen Jahren tätig bin und bereits einen guten Ruf habe, werde ich oft weiterempfohlen. Es ist aber auch eine Frage der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Interessen. Auf Social Media kann man beispielsweise nur gut präsent sein, wenn man das gerne tut.
Die Rolle von Social Media
Niko Havranek: Ich bin schon recht lange auf Social Media aktiv, mittlerweile poste ich auf Instagram, früher war ich viel auf Facebook und Tumblr unterwegs. Bei meinen
»Nach zwanzig Jahren in diesem Beruf kann ich sagen: Für mich gibt es keinen Alltag.« — Eva Kelety
»An sich ist Fotografie sehr demokratisch. Das heißt, es braucht keine Ausbildung, um Berufsfotograf*in zu werden.«
Anfängen als Fotograf hat mir das durchaus geholfen: Da ich so präsent war, wurde ich als Person wahrgenommen, die Fotos macht. Dadurch kam ich an Aufträge. Für mich war das auch immer ein persönliches Ding. Ich wollte zeigen, was ich tue, und anstatt es zu drucken, stellte ich es eben online.
Paul Pibernig: Social Media sind wichtig, um die eigene Arbeit zu präsentieren und um sich mit Menschen in der Branche zu vernetzen. Sie haben zudem die Arbeit in der Hinsicht verändert, dass man bei manchen Aufträgen das Hochformat mitbedenken muss. Mich betrifft das aber eher weniger. Für mich sind Social Media in erster Linie ein Self-Promotion-Tool.
Max Louis Köbele: Um Social Media kommt man heutzutage nicht mehr herum. Ich mache neben meiner Fotografie auch noch kleine Videoproduktionen, etwa Reels für Instagram. Soziale Medien sind außerdem ein gutes Tool, um sich zu präsentieren. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass Menschen hier nur jene Aspekte ihres Lebens zeigen, die sie zeigen wollen. Social Media sind wie ein aufpolierter Lebenslauf. Man darf also nicht glauben, dass Fotograf*innen die ganze Zeit nur reisen und Spaß haben.
Künstliche Intelligenz und Fotografie
Max Louis Köbele: Ich benutze KI, um Moodboards und Mock-ups zu generieren. Generell mache ich mir Gedanken, wie ich künstliche Intelligenz in meine Arbeit integrieren kann, um mit der Zeit zu gehen. Generischer Content wird in Zukunft vermutlich von KI dominiert sein. Beispielsweise Katalogfotos, bei denen immer nur ein Produkt ausgetauscht wird. Allerdings denke ich auch, dass dadurch Menschengemachtes eine höhere Wertigkeit bekommen wird. Grundsätzlich ist mir die Kennzeichnung der Verwendung von künstlicher Intelligenz sehr wichtig. Ich wünsche mir, dass es in Zukunft Richtlinien gibt, wie KI-generierter Content angewendet, veröffentlicht und gekennzeichnet werden soll. Allerdings finde ich nicht, dass die Benutzung eingeschränkt werden soll, weil der Einsatz von künstlicher Intelligenz Zeit sparen kann.
Elodie Grethen: Mich interessieren vor allem die Hintergründe von künstlicher Intelligenz. KI greift schließlich auf bestehende Bilder zurück und generiert daraus neue.
Dadurch reproduzieren wir allerdings kapitalistische und rassistische Strukturen. Oder man denke an KI-generierte Frauenkörper: Wir dürfen als Gesellschaft nicht glauben, dass Frauen so aussehen. Wegen KI müssen wir uns fragen, was ein echtes Bild ist und ab wann es keines mehr ist. Im Kontext der künstlerischen Fotografie gibt es auch sehr spannende KI-Künstler*innen, Charlie Engman zum Beispiel. In meinem eigenen Berufsalltag habe ich nichts mit KI-generierten Bildern zu tun. Allerdings verwende ich künstliche Intelligenz in der Bildbearbeitung, weil es diese Arbeit schneller macht.
Eva Kelety: Finde heraus, was dich interessiert, und spezialisiere dich – am besten in ein bis zwei Bereichen innerhalb der Fotografie. Werde dann Expert*in in diesen Bereichen. Kommuniziere dein Fachgebiet, finde mögliche Ansprechpartner*innen und lerne von älteren, erfahreneren Fotograf*innen. Und ganz wichtig: Netzwerken.
Max Louis Köbele: Sei streng, wenn es um Namensnennung, Urheberrecht und Lizenzen geht. Und damit meine ich nicht nur im Printbereich, sondern auch auf den SocialMedia-Plattformen. Wenn Kund*innen deine Bilder dort posten, dann musst du verlinkt werden oder es muss zumindest dein Name genannt werden. Sichere dich zudem immer rechtlich ab, damit du nicht auf Produktionskosten sitzen bleibst, wenn Kund*innen nicht zahlen möchten. Und vergiss nicht: Fotografieren macht nur etwa zwanzig Prozent deiner Zeit als Fotograf*in aus. Der Rest ist Buchhaltung, Bildbearbeitung, Kundenakquise, Social Media und Datenmanagement.

Paul Pibernig: Sei flexibel. Gerade, wenn du noch jung bist. Manchmal setzt man sich eine bestimmte Ausbildung in den Kopf und ignoriert dann andere Wege. Es gibt aber nicht nur einen richtigen Weg. Abgesehen davon kann ich Praktika empfehlen, um herauszufinden, ob Fotografie der richtige Beruf für eine*n ist.

Sarah Aberer
Weitere Informationen für (angehende) Berufsfotograf*innen bietet die Bundesinnung als gesetzliche Interessensvertretung für gewerbliche Fotograf*innen in Österreich unter www.berufsfotografie-oesterreich.at..
Um ein einzigartiges Foto zu bekommen nimmt Heribert Corn gerne ungewöhnliche Perspektiven ein.
Die Pressefotografie bewegt sich an der Grenze zwischen Handwerk und Kunst. Zwei Fotograf*innen darüber, warum jedes Bild eine Entscheidung ist – und ob sie selbst ihre Arbeit als Kunst verstehen. ———— An einem regnerischen Abend im September ist die Galerie Westlicht gut besucht. Wie jeden Herbst zeigt das Fotografiemuseum die Ausstellung »World Press Photo«, die Jahr für Jahr die eindrucksvollsten Pressefotografien versammelt. In der Halle ist es trotz der vielen Menschen ruhig. Die meisten bewegen sich zu zweit oder dritt durch den Raum, gehen langsam von Bild zu Bild und unterhalten sich mit gedämpfter Stimme. Wenig unterscheidet die Atmosphäre von jeder anderen Kunstausstellung und dennoch drängt sich eine Frage auf: Sind die ausgestellten Fotos überhaupt Kunst? Schließlich geht es bei der Pressefotografie ja primär um die detailtreue Dokumentation des Zeitgeschehens, weniger um Ästhetik und künstlerischen Anspruch. Oder? Einer, der darauf eine Antwort haben könnte, ist Heribert Corn. Seit den Neunzigern arbeitet der 61-Jährige als Pressefotograf, vor allem für Falter und Der Standard, aber auch für internationale Medien wie Die Zeit, Le Monde oder Neue Zürcher Zeitung. Corn ist


Nach Erfahrungen im freien Journalismus wechselte Alissar Najjar zur Pressefotografie.
kein gelernter Fotograf, seine Bilder brechen daher häufig mit Konventionen. »Klischees interessieren mich nicht«, sagt er. »Ich mache einfach Fotos, ohne über Regeln nachzudenken.« Bei Fototerminen mit Politiker*innen fotografiert er statt deren Gesichter gerne ihre Hände oder Schuhe. Lachend erzählt Corn, wie er einmal Vivienne Westwood hinter einer Mauer fotografiert habe, sodass die Modedesignerin nicht zu sehen gewesen sei.
Sind solche avantgardistischen Entscheidungen für ihn Kunst? »Ich bin Handwerker, kein Künstler«, entgegnet Corn prompt, um dann doch noch einmal über die Frage nachzudenken. Er druckst etwas herum, meint, er wolle nicht mit »Jein« antworten. Doch natürlich seien seine Fotos irgendwie auch Kunst. »Aber ich entscheide dabei nicht über viele Dinge«, erklärt er. »Es ist keine konzeptionelle Kunst.«
Im richtigen Moment abdrücken
Wahrscheinlich ist das einer jener Punkte, die die Pressefotografie auszeichnen. So viele Gedanken sich die Fotograf*innen auch machen, am Ende sind sie vollständig abhängig davon, was sich vor der Linse abspielt. In das Geschehen einzugreifen, widerspräche dem journalistischen Selbstverständnis. Pressefotograf*innen müssen daher spontan die richtigen Entscheidungen treffen. Vorbereitungszeit gibt es selten. Die Fotojournalistin Alissar Najjar sieht hier einen der Hauptunterschiede zur klassischen bildenden Kunst: »Maler*innen kannst du nicht sagen, dass sie genau jetzt ein Bild malen müssen. Aber als Fotograf*in musst du immer bereit sein.« Najjar kennt die Branche auch von der Textseite her. Bevor sie 2015 nach Österreich kam, hatte sie in Damaskus als freie Journa-
listin gearbeitet. Fotografiert hätte sie dort höchstens mit dem Handy, erzählt sie. Eine Fortsetzung ihrer Karriere als Autorin in Österreich schien aufgrund fehlender Sprachkenntnisse unmöglich. Sie entschied sich daher, die Welt fortan in der universellen Sprache der Bilder zu dokumentieren, und begann eine Ausbildung zur (Presse-)Fotografin. Geschichten ließen sich schließlich auch mit diesem Medium erzählen, dazu brauche es keine Inszenierung.
»Zwischen dem guten Bild und der Realität gibt es oft keinen großen Unterschied«, sagt Najjar. Im Endeffekt gehe es vor allem darum, im richtigen Moment abzudrücken und Emotionen einzufangen. Ein wenig Nachbearbeitung braucht es dann aber doch: »Ich gebe keine Rohfotos ab«, erzählt Najjar. »Ich möchte meine Sicht einbringen, das Licht und den Kontrast bearbeiten. Das ist ein bisschen Kunst.« Allein durch den Zuschnitt der Bilder könne man ganz unterschiedliche Effekte erzeugen. Heribert Corn hingegen ist eher Purist. Seine Bilder bearbeite er kaum, einen Blitz benutze er grundsätzlich nicht. »Das Licht, das ich verwende, kommt vom Himmel.« Es gehe ihm auch darum, die Darstellung nicht zu verfälschen: »Meine Fotografie ist wirklich die ehrlichste, weil sie nicht künstlich beleuchtet ist und nicht inszeniert.«
Die ewige Frage der Objektivität
Schon vor den ersten Kameras strebten Journalist*innen danach, objektiv zu berichten und die Realität so neutral wie möglich darzustellen. Die Fotografie galt dabei lange als Heilsbringerin. Als Technik, die es vermochte, Situationen unverfälscht einzufangen und wiederzugeben. Ganz im Gegensatz
zum geschriebenen Wort. Kurt Tucholsky sprach in den 1920ern gar von der »Unwiderlegbarkeit« der Fotografie, deren Wirkung »durch keinen Leitartikel zu übertreffen« sei.
Seitdem hat sich die Debatte ein ganzes Stück weiterbewegt. Objektivität gilt mittlerweile weithin als Mythos oder als frommes Ideal, das wohl nie völlig erreicht werden kann. Das gilt für das Foto wie für den schriftlichen Bericht. Allein schon die Auswahl des Bildmotivs ist eine höchst subjektive Entscheidung, die die Wahrnehmung eines Ereignisses massiv beeinflussen kann.
Aber kommt man der Realität durch ein Foto zumindest ein bisschen näher als durch einen Text? »Ich glaube, dass es zumindest ehrlicher ist«, so Heribert Corn. »Das Geschriebene ist immer Interpretation. Das Foto ist das, was es war, in dieser Tausendstelsekunde.« Dennoch zeigt ein Bild nur eine der Perspektiven dieses Moments, das weiß auch Corn. Schließlich sucht er selbst ja ganz gezielt nach neuen Perspektiven, nach dem »anderen Foto«, wie er es formuliert.
Als freier Fotograf konkurriert er mit den großen Nachrichtenagenturen, die den Zeitungsredaktionen ebenfalls hochprofessionelle Bilder zur Verfügung stellen. »Vor zwanzig Jahren waren die Agenturfotos tatsächlich schlechter als meine«, erinnert sich Corn. Mittlerweile sei es umgekehrt: »Die Fotograf*innen bei den Agenturen sind sehr stark und in der Quantität viel besser aufgestellt.« Das »andere Foto« zu liefern, wird daher immer wichtiger. Die eine Perspektive, die sich abhebt von den Agenturfotos. Allein aus diesem Grund investieren die Zeitungen in eigene Fotograf*innen. »Ich möchte nicht, dass Der Standard das gleiche Bild auf der Titelseite hat wie die Salzburger Nachrichten, der Kurier oder die Süddeutsche«, hält Corn fest. Um das zu erreichen, wählt er unterschiedliche Methoden, fotografiert seine Motive zum Beispiel von oben, von der Seite oder aus größerer Entfernung. Manche würden vielleicht sagen, er tobe sich künstlerisch aus. Corn selbst meint: »Ich weiß in der Pressefotografie nie, was mich am nächsten Tag erwartet, und muss aus dieser Situation Kunst machen.« Pressefotograf*innen treffen also viele subjektive, kreative Entscheidungen, die sich zumindest an der Grenze zum künstlerischen Schaffen bewegen. Letztendlich ordnen sich alle ästhetischen Entscheidungen jedoch einem höheren Ziel unter. Alissar Najjar bringt es auf den Punkt: »Ich mache Fotos, die zeigen, was passiert ist.« Jannik Hiddeßen
Arbeiten von Heribert Corn findet man online unter www.corn.at. Alissar Najjars Fotografie ist unter www.alissarnajjar.com zu sehen.

Nach den Dokumentarfilmen »Space Dogs« und »Dreaming Dogs« stellen Elsa Kremser und Levin Peter nun ihren ersten Spielfilm vor. Misha arbeitet als Leichenpräparator in Minsk und erweckt die Toten in seinen Ölgemälden zum Leben, Masha wiederum will Model werden, und zwar in China. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte zweier Außenseiter*innen.
20. Jänner, 19 Uhr
Wir verlosen 10×2 Tickets für die Kinostartpremiere von »White Snail« in Anwesenheit des Regieduos Elsa Kremser und Levin Peter sowie der beiden Hauptdarsteller*innen Marya Imbro und Mikhail Senkov.
Die Gewinnspielteilnahme ist bis 15. Jänner 2026 unter www.thegap.at /gewinnen möglich.
In Kooperation mit
Teilnahmebedingungen: Die Gewinnspielteilnahme kann ausschließlich unter der angegebenen Adresse erfolgen. Die Gewinner*innen werden bis 16. Jänner 2026 per E-Mail verständigt. Eine Ablöse des Gewinns in bar ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter*innen des Verlags sind nicht teilnahmeberechtigt.


1 Well/One




Manchmal möchte man dem Alltagsgetümmel einfach für eine Weile entkommen. Was eignet sich dafür besser als ein privater Spa-Bereich? Einen solchen bietet Well/One. Für zwei bis vier Stunden kann man hier Wellnesskabinen in den Kategorien Classic, Exclusive oder Premium buchen – ausgestattet mit Sauna, Whirlpool, Erlebnisdusche und mehr. Wir verlosen Gutscheine im Gesamtwert von 600 Euro.
2 Funko Pop! × »Stranger Things«
Am 26. November startet die fünfte Sta el von »Stranger Things«. Zur Einstimmung auf das große Finale der Netflix-Kultserie könnt ihr euch das Upside Down direkt ins Wohnzimmer holen. Und zwar mit der neuen Pop!-Nooks-Kollektion. Die Figur von Will Byers im detailreichen 3D-Raum bietet eine spannende Ergänzung für eure Regale. Wir verlosen drei Exemplare.
3 Clara Porák »Alles fühlen«
Gefühlen geben wir oft zu wenig Raum. Denn in patriarchalen und kapitalistisch geprägten Gesellschaften müssen wir stets funktionieren. Die Journalistin Clara Porák fordert in ihrem Debüt »Alles fühlen« das Recht auf das Selbstbestimmen unserer Gefühle. Das Buch erklärt, warum Widerstand gegen Scham wichtig ist – ein Plädoyer für gelebte Fürsorge. Wir verlosen drei Exemplare.
4 »Love Me Tender, Love Me Queer« »Love Me Tender, Love Me Queer« erkundet die vielen Möglichkeiten der queeren Liebe durch eine generationsübergreifende Linse. Das Buch, herausgegeben von Marie-Christin Rissinger und Frida Robles Ponce, bringt Ausschnitte aus Interviews mit queeren, in Wien lebenden Persönlichkeiten in Dialog mit Reflexionen aus verschiedenen theoretischen Positionen. Wir verlosen drei Exemplare.
5 HC Roth, Chris Magerl »Conan City Hardcore« Rund um die Jahrtausendwende entstand in Graz eine aktive Punk-/ Hardcore-Szene, die das international bekannte Kollektiv Conan City Hardcore hervorbrachte. HC Roth und Chris Magerl beschreiben, wie es dazu kam und woran dieses schließlich zerbrach. Durch Interviews mit Szeneprotagonist*innen liefern sie einen tiefen Einblick in die Grazer Subkultur. Wir verlosen drei Exemplare.


Ein Fiebertraum in Pastellfarben. Ein Kinderlied über die Vergänglichkeit. Oder ein Ausgesetztwerden im Innern. All das kann Monsterhearts neues Album »Melody Maker« sein. Und natürlich auch alles, was mittendrin liegt und darüber hinaus geht: alle Zwischentöne, die möglich sind, wenn man berauscht durch die Nacht zieht oder insomniös im Bett an die Decke starrt. In acht knappen Songs entführt die Künstlerin aus Wien, die eigentlich Anna Attar heißt, einen eben dorthin, wo man selbst manchmal bewusst nicht hinschaut. Denn vieles von dem, was irgendwo in uns vergraben liegt, wollen wir im Alltagslärm lieber nicht hören. Aber eben da bohrt sich »Melody Maker« tief ins eigene Unbewusste hinein und erinnert uns an Momente, die wir schon längst unter unzähligen Schichten von Verdrängtem verschüttet haben. Es sind die warmen, fernen Erinnerungen in Sepia. Auch wenn in manchen Songs eine Traurigkeit liegt, wird Attars Musik trotzdem nie pathetisch oder schwer. Es ist die leichte Nostalgie im Jetzt, im Schwebezustand des Möglichen, das sich zu neuen Erinnerungen verdichtet.
Das Monster und das Herz
Dabei lassen die kurz gehaltenen Songtitel genauso viel Spekulationsspielraum o en, wie nötig ist, um seine eigenen Geschichten hineinzulegen. Manchmal hat Attars Sound dabei eine fast fairytale-mäßige Tiefe. In anderen Songs ist es eher das intime, introspektive Schweigen, das man kennt, wenn man nicht ganz aus seiner Haut herauskommt. In jedem Fall wird es trotzdem nie klaustrophobisch oder driftet in eine Zerfahrenheit ab, in der man das Kerngefühl nicht mehr fassen könnte. Passenderweise wird ab »Put the Tempo«, circa bei der Hälfte des Albums, wirklich die Geschwindigkeit verändert. Die Geschichte bekommt eine neue Schattierung und setzt sich anders fort.
Anna Attar scha t es, Ambiguitäten zu vereinen: das Dunkle und das Helle, das Weite und das Enge, das Monster und das Herz. Kaum passender könnte dabei ihre Künstler*innenselbstbezeichnung sein: Monsterheart ist Programm, seit 2011 bis in die Gegenwart. Und es ist erfreulich zu bemerken, in welche Richtungen sich ein künstlerischer Stempel ausdehnen kann, ohne zu verblassen. (VÖ: 21. Jänner) Ania Gleich


Auf Beauchamp*Geisslers zweitem FullLength-Album »2_22__2222____« werfen vierzehn kurze Tracks Schlaglichter auf eine verspielte Wirklichkeit zwischen Electronica der Nullerjahre und urbanen Alltagssounds. Egal, ob herkömmliche Instrumente wie Cello, Gitarre und Piano oder Field-Recordings: Im Vordergrund steht das Experiment. So kontrastieren auf »Die Sprache des Materials« etwa Cellosequenzen mit schnurrendem, gutturalem Gesang, der laut Begleittext im Zusammenleben mit einer Katze erlernt wurde. Marta Beauchamp und Stefan Geissler entlocken neben Synthesizern, die wie von Daft Punk klingen, auch Nicht-Instrumenten Töne. So zum Beispiel in »Flat Tyred« Luftblasen im Wasserglas oder einer Luftpumpe.
Pick-Me-Music
Das Album einzuordnen, fällt schwer, und das soll es auch. Wie schon der unaussprechliche Titel anklingen lässt, will man sich nicht durch Genrekonventionen einschränken, sondern vielmehr nach freien musikalischen Formen suchen und das Gefundene als solches präsentieren. Trotz aller Eigenwilligkeit gelingt der Spagat zwischen Schrägheit und Pop. Die Gitarrenri s sind simpel und catchy, die Melodien fröhlichverspielt. Bevor ein Track nach mehr Komplexität verlangen könnte, endet er einfach, und das nächste Stück beginnt. Der Anspruch, innovativ zu sein, schrammt immer wieder haarscharf daran vorbei, krampfig statt leichtfüßig zu wirken. Und trotzdem kann man sich beim Mitwippen beobachten und muss schmunzeln, wenn beim Hören von »Praterstern« der Groschen fällt und der groovige Beat plötzlich zum Klicken einer Ampel wird.
»2_22__2222____« ist vielleicht das Gegenteil eines Konzeptalbums. Es ist vielmehr eine Soundcollage, die Layer für Layer aus musikalischen Faszinationen und Einfällen zu bestehen scheint. Wie die Kirsche auf dem Cover sind diese Klangideen vielleicht durch eine schöne Farbe oder einen besonderen Glanz der Schale aufgefallen. Begeistert hat man die Arme nach ihnen ausgestreckt, um sie zu pflücken, anzuschauen und schließlich kaum verändert auszustellen.
(VÖ: 5. Dezember) Helena Peter

Sie sagt 1 2 3 4 Konkord

Die Pelzerten machen Schluss mit Lou Reed, mit The Velvet Underground. Mit ihrer neuen Vier-Song-EP »Sie sagt 1 2 3 4«, die nicht nur musikalisch äußerst interessant daherkommt, sondern vor allem in ihrer gestalterischen Vielfalt schon was ziemliches Nettes ist. Weil, du weißt eh, eine EP anhören, daheim am Plattenspieler, ist immer was für die eher Exzentrischen. Und das Auge hört mit, selbst wenn du die Scheibe nur im Regal stehen hast. Aber lass uns einmal bei den Ohren beginnen, wer nur Kunst will, soll ein paar Seiten weiterblättern, dort wirst du sie finden.
Fatale Femmes
Jedenfalls, die Story ist bekannt, aber noch mal ganz langsam für die ganz Depperten: 2015 scha en Pfister, Fuchs und Co mit ihrer Verwienerung von »The Velvet Underground & Nico« einen zeitlosen Klassiker des Burenwurstpops. 2023 wird aus Lou Reeds Soloalbum »Transformer« der »Verwandler«, wo man dann schon auch merkt, dass richtig gute Coverversionen ein richtig gutes Original brauchen. Und – um quasi diese Lou-Reed-Sache abzuschließen, erscheint jetzt eine EP, die auf Basis des bereits verö entlichten »Candy sagt« (Original: »Says«), vier »Frauengeschichten« erzählt. Während es bei Element of Crime vor x Jahren noch »Michaela sagt« war, heißt es bei den Buben im Pelz neben Candy eben: »Kerstin sagt«, »Lisa sagt« und »Stephanie sagt«. Insgesamt vier dunkel-wabernde Lieder, meist fatalistisch-tragische Klavierballaden, die irgendwann ins Multiinstrumentalere und auch von der Dynamik her ins Absurdere abdriften, über Frauen, die, nun ja, ein bisschen zum Tragischen tendieren – da tri t sich der Wiener ja mit dem Reed ganz vorzüglich.
Goated Überleitung, weil ganz vorzüglich, im wahrsten Sinne, ist eben die Aufmachung. Da kommt nämlich das Debütalbum wieder rein. Und der Warhol Andy, denn auch die Campbell’sche Suppendose, die wahrscheinlich in mehr Küchen hängt als handelsübliche Wandtattoos, wird austrifiziert – Stichwort: Inzersdorfer-Konserven. Insgesamt gibt es neun Siebdruckvarianten von Designer Peter Hirth, Sugo und Fleisch in verschiedenen Farben, mit passendem Vinyl, dazu auch Fehldrucke, Stückzahlen zwischen 20 und 230. Ich sag einmal so: Diese Wertanlage bringt deine Kinder durchs College.
(VÖ: 5. Dezember) Dominik Oswald


Clara Luzia dreht mit ihrer neuen Band die Amplituden runter: »Weil ich mit meiner Stammband für viele Spielstätten zu laut geworden bin, habe ich eine zweite Band zusammengestellt, mit der wir nun auch dezibelsensiblere Räumlichkeiten mit Sitzpublikum beschallen können.« The Quiet Version heißt diese neue Combo. Der Name ist freilich folgerichtig und Programm. Der Kontrabass kommt zum Kuscheln mit der ätherisch-seidenen Stimme der Singer-Songwriterin vorbei. Das Album »Horelia« ist sprachlich in eine englische und eine deutsche Hälfte geteilt, widmet sich als soziologische Umschau dem allgemein Komischen des Lebens oder dem individuell Tragischen per Mikroskopie ins Persönliche.
Seelenvoller Tiefgang
Dazwischen ist viel Platz für vertonte Poesie, luftige Arrangements und High-End-Songwriting. Die Trompete klingelt hell, als ob Kristalle vom Ambient-Jazz in die Popkultur rübertropfen. Die Schlagzeugbesen rühren gschmeidig an den Trommeln, der Kontrabass zupft gemächlich. Die Gitarre holt sich Inspiration bei New Country oder bei der kreischenden Distortion des Indierock, während die Keys ein Glockenspiel oder ein Barpiano mimen. Clara Luzias Gesangsmelodien schmeicheln indes dem Gemüt, nur um es dann wieder aufzuwühlen. Eine Art zeitgenössischer »Perrine«-Soundtrack für Fortgeschrittene zeichnet sich ab. So schraubt sich »Horelia« zu emotionalen Gipfeln empor, ohne zur Schmonzette zu verkommen. Lieder mit dem Wohlfühlfaktor eines Onesies oder dem kühlen Hauch des Existenziellen verleihen dem Album seine Klangfarben. Schwermütige Ballade oder sanftmütiges Kleinod, lyrische Nachdenklichkeit oder launisch schunkelnde Varieténummer: Das Repertoire ist breit aufgestellt und greift sowohl musikalisch als auch textlich mitten in die Substanz hinein. »Utopie«, die Singleauskopplung, ist dann so etwas, wie die gelungene Zusammenfassung dieses Longplayers – mit vielen Höhepunkten und seelenvollem Tiefgang. (VÖ: 21. November) Tobias Natter
Live: 5. März, Linz, Posthof — 6. März, Salzburg, Arge Kultur — 7. März, Saalfelden, Nexus — 13. März, Hard, Kammgarn — 21. März, Unterretzbach, Rekura — 23. und 24. März, Wien, Stadtsaal


Punk und Metal waren einst Erzfeinde. Heckspoiler beweisen eindeutig, dass das längst nicht mehr so ist. Nein, es funktioniert sogar großartig, wenn man diese beiden Genres kombiniert. Auf »Bock auf Stress« vereinen sich die besten Seiten beider Kategorien zu einem Gesamtwerk, das der österreichischen Rockszene noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Hier ist der Band ein Album gelungen, das sich mit dem Motto »Volle Kraft voraus!« sehr gut beschreiben lässt. Thomas Hutterer und Andreas Zelko, die das Duo bilden, holen aus lediglich zwei Instrumenten – Bass und Schlagzeug – einen massiven Sound und maximale Wucht heraus. Hämmernde Ri s und bissige Vocals verleihen der Platte eine unerbittliche Härte, die nach Moshpit-Action schreit und an keiner Stelle die elektrische Gitarre vermissen lässt.
Schmähfian und Headbangen
Im Zusammenspiel mit den selbstironischen Texten im oberösterreichischen Dialekt entsteht ein Schmäh, der diese geballte Wucht leichter verdaulich macht. So ist zum Beispiel der Track »Party« eine Satire auf einen Abend, an dem man eigentlich feiern möchte, aber die Couch viel verlockender wirkt. Wer kennt das nicht? »Plenum« wiederum ist eine Ansage an selbstdarstellerische Meinungsmacherei und Performativität in der Großstadt. So geht es immer turbulenter weiter, stets nach vorne preschend. Mit Elementen aus dem Hardcore und ThrashMetal wird der Track »Speed« seinem Namen gerecht. Apropos: Durch die neun Nummern fegt die Platte in 28 Minuten – und mir kommt es vor, als wären es nur fünfzehn. So gut fließt das Ding. Es wird Haltung gezeigt bis zur letzten Sekunde, denn: »Es geht um Leben und Tod«. Diese zynische Punkattitüde verbunden mit sumpfigem Metalflow macht die Band auch für die Stonerrock-Szene interessant. Bereits seit ihrem Song »Stonerband« kennt man Heckspoiler dort. Vergangenen Sommer war das Duo auch beim einschlägigen Blue Moon Festival zu sehen, wo ihr Auftritt für scheppernde Boxen und heftigen Bewegungsdrang sorgte. (VÖ: 5. Dezember) Selma Hörmann
Live: 12. Dezember, Wien, Arena — 13. Dezember, Salzburg, ockhouse — 19. Dezember, Villach, Kulturhof — 20. Dezember, Linz, Kapu — 13. Februar, Innsbruck, PMK



Du liest gerade, was hier steht. Ja, sogar das Kleingedruckte! Und damit bist du nicht allein. Werbung in The Gap erreicht ein interessiertes und sehr musika ines Publikum. Und das Beste daran: Für Bands und Musiker*innen bieten wir besondere Konditionen. Absolut leistbar, auf all unseren Kanälen und nah dran an einer jungen, aktiven Zielgruppe. Melde dich, wir beraten dich gerne! sales@thegap.at

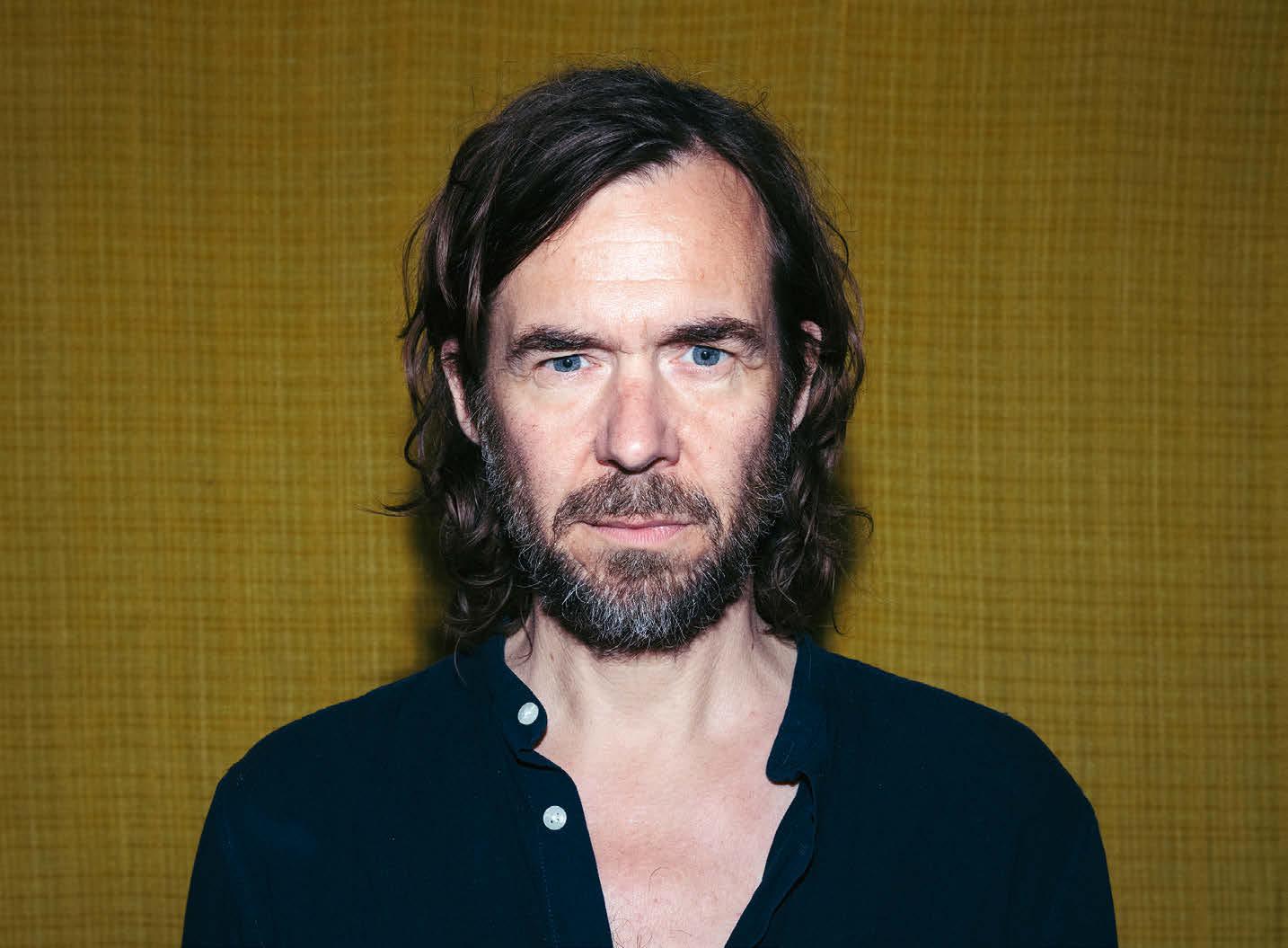
»Alles singt und tanzt so gleich und gleich / Konformität als Rebellion«, singt Fuzzman auf seiner neuen Single »Keine Sterne über Wien« – eine lieb gemeinte Kritik an der Wiener Kreativszene. Er ist aber trotzdem gerne hier. Auf der anstehenden Tour werden zwanzig Jahre Fuzzman gefeiert. 28. November Steyr, Röda — 29. November Lienz, Kolpingsaal — 4. Dezember Graz, PPC — 5. Dezember Ebensee, Kino — 6. Dezember Wien, Wuk — 10. Dezember Salzburg, Arge Kultur — 12. Dezember Dornbirn, Spielboden — 13. Dezember Wels, Alter Schlachthof

Musik im Salzburger Dialekt, die poetisch ist und zugleich etwas Salz in die Wunden streut –Anna Bucheggers neues Album »Soiz« dreht sich um die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat. 23. Jänner Wels, Alter Schlachthof — 24. Jänner Hall in Tirol, Kulturlabor Stromboli — 28. Jänner Wien, Haus des Meeres — 20. Februar St. Pölten, Freiraum — 21. Februar Mauterndorf, Festsaal — 1. März Linz, Musiktheater am Volksgarten — 13. März Mistelbach, Kronen Kino — 14. März Klagenfurt, Kammerlichtspiele





Auf »Adieu Unsterblichkeit« präsentieren sich Kreisky düsterer denn je in ihrer 20-jährigen Geschichte. Die Band wird älter, ihr Rocksound immer raffinierter. 26. November Wien, Wuk — 27. November Graz, Orpheum — 28. November Salzburg, Arge Kultur — 29. November Linz, Stadtwerkstatt — 17. Dezember Innsbruck, Treibhaus — 18. Dezember Dornbirn, Spielboden — 19. Dezember Ebensee, Kino — 20. Dezember Steyr, Röda
Yasmo bringt ihre schlagfertigen Texte erneut gemeinsam mit der Klangkantine auf die Bühne. Haltung zeigen, kompromisslos bleiben – mit einer Prise Selbstironie. Neues Album: »Augen auf und durch«. 28. November Klagenfurt, Kammerlichtspiele — 29. November Graz, Dom im Berg — 12. Dezember Wien, Arena — 17. Dezember Salzburg, Rockhouse — 18. Dezember Bludenz, Remise — 19. Dezember Innsbruck, Treibhaus
Im Dezember ist wieder das Sinfest im B72 angesagt. Diesmal lautet das Motto: »A Night on the Fringes«. Genregrenzen werden überschritten, Trennlinien sind verboten – es geht um Musik, die zum Tanzen bewegt. Mit dabei: Kry, Le Mol und Speck, die alle drei Spaß daran haben, Extreme auszuloten. Bei der Aftershowparty wird dann noch DJ Rob Bobbinson eins drauflegen. 5. Dezember Wien, B72
Die schwedische Musikerin veröffentlicht ihre Alben – bislang elf Stück! – auf ihrem eigenen Label Dark Skies Association. Mit ihrer markanten Stimme, die sie in melancholischen SynthiePop hüllt, sowie mit ihrem DIY-Ethos hat sich Molly Nilsson längst international einen Namen gemacht. »Amateur« führt ihren minimalistischen Stil nun weiter und bedient sich bei den glanzvollen Eighties. 7. Dezember Wien, Flucc
Die Lambrini Girls aus Brighton begeistern mit wilden Livesauftritten – etwa als Support von Amyl and the Sniffers oder beim Glastonbury Festival. Das Punkduo ist derzeit jedenfalls steil nach oben unterwegs. Das 2025 erschienene Debütalbum »Who Let the Dogs Out« überzeugt mit zorniger Attitüde sowie politischen Texten zwischen female Empowerment und Kapitalismuskritik. 16. Dezember Wien, Flucc
»Valve«, das neue Album des Cellisten, führt uns mit sakral anmutendem Sound in ferne Klangwelten. 2. und 3. Dezember St. Pölten, Cinema Paradiso — 4. Dezember Klagenfurt, Villa for Forest – 18. Dezember Linz, Stadtwerkstatt — 19. Dezember Lustenau, Pavian — 20. Dezember Innsbruck, Treibhaus
Der Kanadier Dan Snaith aka Caribou hat sich als kreativer Geist der elektronischen Musik einen Namen gemacht. Seine fein nuancierten Produktionen ziehen mit warmen Lo-Fi-House-Melodien und einer romantischen Note in ihren Bann. Bestes Beispiel: »Can’t Do Without You«. 2. Dezember Wien, Arena



Wäre Chappell Roan in einer Rockband, könnte sich diese wie The Last Dinner Party anhören. Nach ihrem 2024 erschienenen Debütalbum folgte 2025 mit »From the Pyre« gleich der zweite Longplayer, der abermals pompösen Rock und barocken Pop mit expressivem Gesang verbindet. 19. Februar Wien, Gasometer



Veranstalterin Cream Vienna
Kannst du kurz skizzieren, wie es vom Feschmarkt zu Cream Vienna gekommen ist?
Feschmarkt hat klein angefangen und ist zu etwas Großem geworden. Vor zwei Jahren sah ich eine Gelegenheit zu überdenken, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Und da die Marke Feschmarkt bereits eine gewisse Erwartungshaltung beinhaltete, war mir klar, dass ich sie nicht nach meinem neuen, mir näheren Konzept abändern kann. So kam die Entscheidung, mit etwas ganz Neuem zu starten. Cream ist mehr ich. Es war mir wichtig, ein Event zu machen, das kleiner und feiner ist und bei dem ich auch die Zielgruppe besser definieren kann. Auch wenn der Anfang sehr hart ist, bereue ich es keine Sekunde. Und wenn es mir zu viel wird, gehe ich in den Garten.
Was fasziniert dich selbst an kreativer FoodCulture?
Im Bereich Essen und Kochen sieht man das Handwerk sehr stark – und es hat für mich auch sehr viel mit Kunst zu tun. Nicht nur in Bezug auf die Optik, sondern auch auf die geschmackliche Komponente. Spannend finde ich Kombinationen abseits der Standards. Das bestelle ich dann allein wegen der ungewöhnlichen Zutaten. Seit ich selbst einen Garten habe, befasse ich mich sehr viel mit Gemüse, Raritäten und deren ganzheitlicher Verarbeitung sowie Konservierung. Das ist ein neues Hobby von mir, gegen die Geschwindigkeit des Alltags.
Wie bringt Cream Vienna die Lust auf kulinarische Kreationen, Wein und Kunst zusammen?
Allem gemein sind wohl die Kreativität sowie das Handwerk. Für mich war es stimmig, Design, Kunst, Essen und Getränke an einem Ort wie dem ehemaligen »Grand Etablissement Gschwandner« zusammenzubringen, das in seiner Geschichte bereits all diese Bereiche beherbergt hat. Ich bin der Überzeugung, dass Menschen, die den Sinn für das eine haben, auch den Sinn für das andere haben. Mir geht es um die Wertschätzung dessen, was die Aussteller*innen schaffen, sowie ihre Philosophie dahinter. In einer Welt, in der der Onlinehandel präsenter ist denn je, ist es wichtig, Dinge zu zeigen, bei denen Persönlichkeiten dahinterstehen. Dinge, die man anfassen und reparieren kann.
Cream Vienna 6. und 7. Dezember Wien, Reaktor

Ob auf Johann Strauss’ Geburtstagskuchen wohl noch genug Platz ist? Schließlich hätte der berühmte Komponist 2025 bereits 200 Kerzen auspusten dürfen. Statt mit Geschenken und HappyBirthday-Bannern wurde und wird er heuer mit 65 Produktionen geehrt, die sein Schaffen wieder auf die Bühne bringen oder sich davon inspirieren lassen. Von klassischen Inszenierungen über mit Moderne und Vergangenheit spielende Operetten bis hin zu unorthodoxen Performances mit Tanz und Sound wurde hier schon so einiges aufgeführt. Im Schnitt war mehr als eine Premiere pro Woche zu bewundern – und noch sind die Jubliäumsfeierlichkeiten nicht vorbei. Wer also die letzten Höhepunkte des diversen Programms erleben möchte: Bis Ende des Jahres ist Zeit. bis 31. Dezember Wien, diverse Locations

Wer diesen Dezember Lust auf eine Abwechslung zu Glühwein und heißer Schokolade hat, kann sich bei der Roboexotica von Robotern Cocktails aller Art mixen lassen. Ein bewusstes Gegenmodell zu den bösen Blechbüchsen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Die witzige Idee soll zeigen, in welche Bereiche des menschlichen Lebens Robotik integriert werden kann. Mit Fokus auf die kreativen – und insbesondere die Genuss versprechenden – technologischen Innovationen. Keine Sorge: Schrauben, Öl und Altmetall stehen nicht auf der Zutatenliste. Versprochen. 11. bis 14. Dezember Wien, Kunsttankstelle

Klimakrise, teure Mieten und eine aufklaffende Schere zwischen Arm und Reich – zugegeben, unsere Zukunft sieht nicht gerade rosig aus. Die Act Now Conference nimmt das jedoch nicht einfach so hin. Mit ihren offenen Diskussionen und Workshops versammelt sie all diejenigen, die alternative Lösungen für eine bessere Zukunft finden wollen. So motiviert die Konferenz ihre Besucher*innen, für eine gerechtere Welt zu kämpfen – und dabei die richtigen Fragen zu stellen: Denn wer nicht frage, wie wir leben wollen, überlasse anderen die Antwort darauf. 29. und 30. November Wien, Kulturhaus Brotfabrik
Drei Regionen, drei Kinos, drei Kulturräume mit einer Leidenschaft für Film. Mit dem K3 Film Festival werden auf der Leinwand durch die Zusammenführung von Friaul-Julisch Venetien, Kärnten und Slowenien Grenzen überwunden und Brücken gebaut. Mit seinem überregionalen und diversen Programm ebnet das K3 neue Wege, um die kulturelle Kooperation im Alpen-Adria-Raum zu stärken. 3. bis 7. Dezember Villach, Stadtkino
Schluss mit Gutscheinen und immer gleichen Geschenken! Der Edelstoff Xmas Markt liefert für alle Einkaufsfreudigen eine kreative Alternative. Von modischen Kreationen über originelle Kunst bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten – zahlreiche Anbieter*innen präsentieren ihre Produkte und machen so auch Wiens Kreativszene zum festen Bestandteil der Weihnachtszeit. Für eine besondere Bescherung ganz ohne Massenware. 6. und 7. Dezember Wien, Marx Halle
Wer denkt, dass Weihnachtsstimmung filmisch nur bei Aschenbrödel und Ebenezer Scrooge aufkommen kann, wird beim Slash X-Mas alljährlich vom Gegenteil überzeugt. Denn auch wenn die diesjährige Fimauswahl mit »Dust Bunny« und »Fuck My Son!« wieder einmal wenig besinnlich ausfällt, gilt der winterliche Festivalableger aus gutem Grund für viele als vorweihnachtlicher Fixtermin. Das perfekte Kinoevent für festlichen Schock und Schrecken! 16. Dezember Wien, Filmcasino
Keine Ölfarben, kein Aquarell, keine Leinwand aus Holz und Leinen – bei Art on Snow kann Kunst in einer ganz anderen Form bewundert werden. Dort werden Skigebiete zu Galerien unter freiem Himmel, während Kreativität auf atemberaubende Winterlandschaften trifft. Ob Mamuts, Astronaut*innen oder ganze Gebäude – wer die eisigen Skulpturen der Künstler*innen im Schnee bewundern möchte, sollte sich besser warm anziehen. 31. Jänner bis 6. Februar Gasteinertal, diverse Locations
Diese Schau rückt Helmut Langs beinahe radikale Vision von Gestaltung und Identität im Zeitraum von 1986 bis 2005 in den Mittelpunkt. Eine Zeit, in der er Mode, Kunst, Medien und Architektur miteinander verschmolz und damit die Grenzen etablierter Disziplinen sprengte. Die Ausstellung basiert auf dem öffentlichen Helmut Lang Archiv, das seit 2011
Teil der Mak-Sammlung ist. Aber man kann hier mehr als nur Kleidung bestaunen: Langs disziplinübergreifende Haltung wird auch in den musealen Kontext übersetzt, indem Szenografien von Helmut-Lang-Stores rekonstruiert werden und sich das Publikum in orchestrierten Raumund Klanginstallationen bewegt. Für alle Interessierten bietet sich hier die Gelegenheit, die Arbeitsweise eines Designers kennenzulernen, der Identität als zentrales Model über den Laufsteg schickt. 10. Dezember bis 3. Mai Wien, Mak







Schnittpunkte, Verbindungen, Assoziationen, Widersprüche: Zeitgenössische Werke verschiedenster Herkunft werden in »Thinking Through Weibel« zu Peter Weibels Œuvre in Position gebracht. Dabei liegt der Fokus auf Weibels frühen Jahren. Er erkannte nämlich schon bald Chancen und Gefahren, die unser Medienkonsum mit sich bringen kann. Wie sehr er seiner Zeit voraus war und wie man seine Kunst in anderen Kontexten, durch andere Linsen, mit neuen Augen betrachten kann, zeigt sich in dieser vom Weibel Institut für digitale Kulturen initiierten Ausstellung. bis 8. Jänner Wien, Angewandte Interdisciplinary Lab
In der Ausstellung »Visual Echoes. Gegenbilder im Bildstrom« wird untersucht, wie Video, Film, Fotografie und Dia als Medien des Widerspruchs und der Reflexion wirken können. Künstler*innen hinterfragen die Macht der Bilderflut, indem sie alternative Sichtweisen eröffnen: fünf verschiedene Positionen, fünf verschiedene Räume, fünf verschiedene Werke. So entsteht ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Realität und Inszenierung, Wahrnehmung und Kritik. bis 8. März Salzburg, Museum der Moderne
Die Jahresausstellung im Dom Museum beschäftigt sich nach den Themen Tod und Freundschaft in den letzten beiden Jahren nun mit der Arbeit in allen (Un-) Gerechtigkeiten und Facetten. Erwartungsgemäß lohnt es sich auch dieses Mal wieder, mit viel Zeit, Interesse und Muße hinzugehen, denn das feinfühlige Kuratieren von Johanna Schwanberg lädt zum genauen Hinschauen ein. Wer dafür gerade zu viel zu tun hat, kann sich ja zumindest noch bis August gemütlich Zeit lassen. bis 30. August Wien, Dom Museum
Diese Schau der Albertina spannt einen eindrucksvollen Bogen vom fünfzehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart, von Tizian bis Kiefer. Sie zeigt nicht nur traditionelle Kupferstiche und Holzschnitte, sondern auch großformatige und dreidimensionale Papierinstallationen sowie selten gezeigte Werke. So erfährt man, wie fragil dieses Medium ist, aber wie kraftvoll es genutzt werden kann. Die Ausstellung lädt ein, das scheinbar alltägliche Material Papier neu zu entdecken. 11. Dezember bis 22. März Wien, Albertina
Überleben, Handel, Arbeit, Forschung und Erholung: Die zentralen Beweggründe für die rund tausendjährige Mobilität zwischen den Bundesländern Steiermark und Kärnten sind Ausgangspunkt dieser Schau. Historische Routen wie jene über den Pack, die Drau oder die Soboth werden filmisch umgesetzt. »Aufbruch!« umfasst rund 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche und zeigt anschaulich die Verbindungslinien dieser beiden Regionen im Wandel der Jahrhunderte. 12. Dezember bis 6. Jänner Graz, Museum für Geschichte
Noch ein letztes Mal im Jahr 2025, in dem die Wachau ihr 25-jähriges Jubiläum als UNESCO-Welterberegion feiert, kann man bei einer Führung durch die Landesgalerie Niederösterreich Objekte und Gemälde zu dieser Region entdecken. Egal ob man dem Weihnachstress entfliehen, die Natur in beheizten Räumen genießen oder einen Ausflug mit der für Weihnachten angereisten Familie machen möchte. Die Ausstellung »Unterwegs« selbst ist noch bis 19. April zu sehen. 21. Dezember Krems, Landesgalerie Niederösterreich

Wie entstand die Idee zu deinem neuen Film?
Die Idee zu »Elements of(f) Balance« wurzelt in einer tiefen, seit Kindheit bestehenden Verbundenheit mit der Natur. Nach meinem letzten Film »Die Tage wie das Jahr« trat Werner Lampert an mich heran. Als Pionier für ökologische Landwirtschaft und Begründer nachhaltiger Marken wie Ja! Natürlich und Zurück zum Ursprung schlug er vor, gemeinsam einen Film über Nachhaltigkeit zu entwickeln. Ich wandte mich daraufhin an meinen Freund Stephan Settele und wir begannen, ein Konzept zu entwickeln, das Nachhaltigkeit nicht als Schlagwort, sondern als Haltung begreift – als Balance zwischen Mensch und Natur, zwischen Bewusstsein und Verantwortung.
Inwiefern braucht es vor allem auch im Globalen Norden ein Umdenken, was unser Verhältnis zur Natur betrifft?
Es muss ohne jedes falsche Pathos wieder selbstverständlich werden, dass sich die Menschen als vielfach verschlungener Teil dessen verstehen, was Natur genannt wird und nicht als überlegene Opponenten oder Eroberer. In einzelne ökologische Episoden gekleidet, möchte der Film aufzeigen: Die wahrhaft spannende »Science« und auch »Fiction« ereignen sich seit Jahrtausenden genau hier auf diesem unseren Planeten zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren. Es wird wohl mehr brauchen als nur ein mentales »Umdenken«, wenn man an dem Ast sägt, auf dem man sitzt. Es muss sich auch das Erleben ändern, die Wahrnehmung von einer als äußerlich empfundenen Umwelt hin zu einer artenübergreifenden »Unswelt«.
Mit welchem Gefühl sollen die Zuseher*innen deinen Film verlassen?
Zuerst einmal wäre es erfreulich, wenn die Zuseher*innen schon mit einem offenen Geist in den Film hineingehen. Und nichts liegt uns ferner, als Vorgaben zu machen, was man dann mitnehmen soll. Es ist hoffentlich kein Film, bei dem man mit einer bestimmten, vorfabrizierten Botschaft aus dem Kinosaal entlassen wird. Wenn der Film das Gefühl überträgt, einer filmischen Erkundung aus Spuren, Bruchlinien und Möglichkeiten inmitten einer mitunter ratlos machenden Welt beigewohnt zu haben, wären wir mehr als zufrieden.
Start: 5. Dezember 2025

Regie: Nicole Scherg Nicole Scherg begleitet fünf Hebammen aus fünf Ländern bei ihrer Arbeit. Dabei zeigt sie nicht nur deren tägliche berufliche Herausforderungen, sondern auch die unterschiedlichen politischen wie gesellschaftlichen Situationen des jeweiligen Landes sowie die dortige Stellung der Frau. Die Dokumentation präsentiert die Relevanz der Arbeit von Hebammen und wie das Thema Frauengesundheit mit wirtschaftlichen sowie sozialen Rahmenbedingungen zusammenhängt. Der Film wurde in vierzig Tagen gedreht – mit einem reinen Frauenteam. Im Regiestatement hält Nicole Scherg fest: »Geburt ist der alltäglichste Ausnahmezustand der Welt. Eine Grenzerfahrung, eine Naturgewalt, für die Gebärenden, die Geborenen – und die, die sie dabei begleiten. Hebammen nehmen in diesem Prozess eine einzigartige Perspektive ein.« Start: 23. Jänner

Regie: Park Chan-wook Man-soo (Lee Byung-hun) ist seit 25 Jahren in einer Papierfabrik tätig – bis er es nicht mehr ist. Er wird gekündigt und stürzt in eine große Krise. Wie soll er nun seine Frau und seine beiden Kinder ernähren? Er verspricht seiner Familie, innerhalb von drei Monaten einen neuen Job zu finden, doch eineinhalb Jahre später ist er noch immer arbeitslos. Als er bei einem weiteren Bewerbungsgespräch gedemütigt wird, beginnt er seine Konkurrenz nachhaltig aus dem Weg zu räumen. Für Regisseur Park Chan-wook war die Arbeit an »No Other Choice« eine Lebensaufgabe, das erzählte er bereits 2019 beim Busan International Film Festival. Die schwarzhumorige Satire basiert auf dem Krimi »The Ax« des Autors Donald E. Westlake und thematisiert die Brutalität der modernen Arbeitswelt. Start: 6. Februar


















Regie: Eva Victor ———— Eva Victor gibt mit »Sorry, Baby« ihr Debüt als Regisseurin. Sie erzählt die Geschichte einer Frau (von ihr selbst dargestellt), die nach einem traumatischen Erlebnis zurück zu sich selbst finden muss. Ihr Humor und ihre beste Freundin Lydie (Naomi Ackie) helfen ihr dabei. Kritiker*innen zogen bereits Vergleiche mit Künstlerinnen wie Lena Dunham, Ilana Glazer oder Phoebe Waller-Bridge. Start: 18. Dezember
Regie: Kleber Mendonça Filho ———— In »The Secret Agent« kehrt Marcelo (Wagner Moura) in die Küstenstadt Recife zurück. Er hofft, seinen Sohn wiederzusehen – und gerät zugleich in ein Komplott aus Überwachung, Korruption und Misstrauen. »Krimi? Horror? Beides, nämlich Politik«, titelte die FAZ dazu. Kleber Mendonça Filho webt ein dichtes Netz der Paranoia, das die Atmosphäre eines autokratischen Regimes nachdrücklich einfängt. Start: 19. Dezember
Regie: Hafsia Herzi ———— Fußball und Frauen – dafür schlägt das Herz der jungen Fatima (Nadia Melliti). Sie ist die jüngste Tochter, ihre Familie wanderte aus Algerien nach Frankreich aus. Zwischen dem muslimischen Glauben ihrer Verwandten und der Entdeckung ihrer Homosexualität lernt sie, ihren eigenen Weg zu gehen. Eine feinfühligere Alternative zu Filmen wie »Blau ist eine warme Farbe«, basierend auf dem autobiografischen Roman von Fatima Daas. Start: 25. Dezember
Regie: Jafar Panahi ———— Jafar Panahi (»Taxi Teheran«), einer der wichtigsten iranischen Filmemacher*innen, erhielt für diese neueste Arbeit in Cannes die Goldene Palme für den besten Film. Der aserbaidschanische Automechaniker Vahid (Vahid Mobasseri) wurde einst vom iranischen Regime ins Gefängnis gesteckt. Als eines Tages Eghbal (Ebrahim Azizi) in seine Werkstatt kommt, glaubt er in ihm einen seiner ehemaligen Peiniger zu erkennen. Start: 15. Jänner
Regie: Katharina Weingartner, Anette Baldauf, Joana Adesuwa Reiterer, Chioma Onyenwe
———— In »Stoff/Lace Relations« folgt das Regieteam verschiedenen Protagonist*innen aus der Modewelt, während es der jahrhundertelangen Textilbeziehung zwischen Österreich und Nigeria, zwischen Lagos und Lustenau nachspürt. Der Film verhandelt koloniale Macht, Widerstandsfähigkeit und Stoffe als Träger von Bedeutung. Start: 30. Jänner

Idee: Cédric Anger Apple TV+ mausert sich immer mehr zum Anbieter qualitätsvoller Serien, etwa mit »The Morning Show«, »Severance« oder »Slow Horses«. Die neue Produktion »The Hunt« erzählt von einer Gruppe von Freund*innen, die gerne auf die Jagd gehen – und plötzlich selbst gejagt werden. Auch nach gelungener Rückkehr in die Zivilisation scheint die Flucht nicht überstanden. Die französische Thrillerserie thematisiert Gerechtigkeit und Rache. ab 3. Dezember Apple TV+

Idee: Kurt Sutter Oregon, 1850: Mehrere Außenseiterfamilien schließen sich zusammen, um sich ihre eigene, unabhängige Heimat aufzubauen. Als in ihrer Nähe ein wertvoller Bodenschatz gefunden wird, kommen bald Eindringlinge – und ein gefährlicher Kampf beginnt. Kurt Sutter entwickelte zuvor etwa die Serie »Sons of Anarchy«. In seinem neuen Projekt geben sich nun Stars wie Lena Headey (»Game of Thrones«) und Gillian Anderson (»Sex Education«) die Ehre. ab 4. Dezember Netflix



















21.11.2025
OKH, VÖCKLABRUCK
28.11.2025
KAMMERLICHTSPIELE, KLAGENFURT
29.11.2025
DOM IM BERG, GRAZ
DEZEMBER
04.12.2025
KOHI, KARLSRUHE (DE)
05.12.2025
TEXTILMUSEUM, HELMBRECHTS (DE) 12.12.2025
ARENA, WIEN
17.12.2025
ROCKHOUSE, SALZBURG
18.12.2025
REMISE, BLUDENZ 19.12.2025
TREIBHAUS, INNSBRUCK
20.12.2025
CAFE IFNI, FÜSSEN (DE)
21.12.2025
MILLA, MÜNCHEN (DE) 22.12.2025
HEIMAT REGENSBURG (DE)

bewegen bewegte Bilder – in diesem Kompendium zum gleichnamigen Podcast schreibt er drüber
Sich einfach mal hinsetzen und drauflostippen – das ist der große Traum all jener, die eine Kolumne ins Leben heben wollen. Nur bleibt er leider meist unerfüllt. Ablenkung droht schließlich allenthalben. Kaum hat man sich hingesetzt, will logischerweise zuerst einmal passende Musik gewählt werden: Motivierend soll sie sein, aber nicht zu präsent, anregend, aber nicht ablenkend. Nach dem x-ten erfolglosen Versuch mit einem Album oder auch einer Playlist ist man irgendwann dazu verleitet, den allwissenden Algorithmus walten zu lassen.
Doch was liefert mir »Christophs Radio« direkt als einen der ersten Songs? »Bochum (Light Up My Life)« – wohl das am seltsamsten betitelte Liebeslied dieses Jahrtausends, das ich ebenso lange nicht mehr gehört habe wie den Namen der dahinterstehenden Band: Six by Seven. Sogleich findet man sich lost im Pop-Rabbit-Hole wieder: Gibt es die Truppe überhaupt noch? Und wenn eh gerade alle Welt über »6-7« redet – die einen angewidert, die anderen belustigt –, wären diese Kollegen nicht geradezu prädestiniert für die nächste komplett random Wiederentdeckung à la Kate Bush und »Running up That Hill«? Überlegt euch das doch, Tastemaker*innen!
Da wir uns hier ohnehin schon am Numerischen abarbeiten: Auch Jeff Bridges tat dies kürzlich – um genau zu sein, in Bezug auf das Boxoffice. Auf den schleppenden Start des rezenten dritten »Tron«-Teils angesprochen, meinte die Hollywood-Legende, dass man sich bitte vom Eröffnungswochenende nicht täuschen lassen solle. Denn kein Kassenergebnis sage etwas über den langfristigen künstlerischen Wert eines Films aus. Wie Bridges selbst vom Original»Tron« wohl nur zu gut weiß.
Das Verhältnis von Reputation und Rentabilität ist sicherlich ein Dauerbrenner im Kulturdiskurs. Erstaunlich ist jedoch die Hysterie, mit der das Thema aktuell angerissen wird, selbst von Menschen, die vorgeben, Kino zu lieben: Die Erregungsökonomie in Kommentarspalten lässt jedes nur halbwegs moderate Einspielergebnis zum Offenbarungseid gerinnen. Dabei werden

Lässt sich die zerbrochene Beziehung zwischen Vater (Stellan Skarsgård) und Tochter (Renate Reinsve) kitten?
mitunter gar gezielt Flops herbeigeschrieben, nur um sich der eigenen Distinktionshoheit weiter versichert zu wissen. Zuletzt traf es selbst Paul Thomas Andersons »One Battle After Another«: das große Meisterwerk des Jahres 2025, das man als selbsternannter Gourmet des Mediums aber naturgemäß nicht einfach gut finden, sondern höchstens süffisant unter Hinweis auf die »enttäuschenden Zahlen« rezipieren darf.
Wert: sentimental
Wenn sich die Güte eines Films, wie der Dude ja bereits mutmaßte, nicht an Return-on-Investment-Kennzahlen bemisst, sondern in den unvergesslichen Momenten liegt, die von Mund zu Mund und von Herz zu Herz weitergetragen werden, dann sieht die Situation für Joachim Triers jüngste, vermutlich vielsagend betitelte Arbeit »Sentimental Value« gar nicht so schlecht aus.
Das Werk, das am 5. Dezember bei uns startet, sorgt seit Cannes für Begeisterung und löste auch bei der Viennale den lautesten Applaus sowie das kräftigste Seufzen des Festivals aus. Im inoffiziellen vierten Teil seiner Oslo-Trilogie knüpft Trier an dessen grandioses Abschlusskapitel, den internationalen Überraschungserfolg »Der schlimmste Mensch der Welt«, an – dies gelingt ihm auf beeindruckende Weise auch nahezu auf Augenhöhe. Wieder mit Renate Reinsve in der Hauptrolle nimmt der Norweger mit bemerkenswert souveräner Leichtigkeit einen komplexen Stoff ins Visier, der sich mit Themen wie Kunst, Entfremdung und Vergebung beschäftigt. Ja, mitunter meint man gar, in dieser tragikomischen Familienaufstellung eine bergmaneske Aura schimmern zu sehen.
In gewohnt magnetischer Manier porträtiert Reinsve eine aufstrebende Theaterschauspielerin mit Neigung zu Neurose und Panikattacke, deren entfremdeter Vater – eine von Stellan Skarsgård verkörperte alternde Regieikone –nach dem Tod der Mutter ungebeten wieder in ihrem und dem Leben ihrer Schwester auftaucht. Geplagt von Schuldgefühlen wegen vergangener Verfehlungen, bietet er ihr die Hauptrolle in
seinem neuen, autofiktionalen Projekt an. Sie lehnt allerdings sofort ab. Auch wenn sie ahnt, dass ihr Vater – wie sie selbst – auf die Kunst angewiesen ist, um mit anderen in Verbindung treten zu können, übersteigt dieses Friedensangebot ihre emotionalen Reserven. Schließlich wird die Rolle mit einer Hollywood-Diva mit Arthouse-Ambitionen (Elle Fanning) besetzt, die fortan im alten Familienhaus vor der Kamera steht. Bis sich dort zwangsläufig nie ganz verheilte Wunden öffnen und familiäre Traumata Schicht für Schicht freigelegt werden.
Thema: transgenerational
»Sentimental Value« zeigt letztlich, wie sich Geschichten über Generationen hinweg wiederholen, ja vielleicht sogar wiederholen müssen –zumindest in ihren Dynamiken: Sie spiegeln und überlagern sich, bauen aufeinander auf, insbesondere, wenn sie sich in denselben Mauern abspielen. Wie schon in Mascha Schilinskis verwandtem Juwel »In die Sonne schauen« werden auch hier diese steinernen Speicher von Erinnerung zu Resonanzräumen, in denen Zeiten und Perspektiven untrennbar ineinanderfließen, Vergangenes nahtlos in Gegenwärtiges übergeht. Und wenn sich schließlich doch die emotionalen Schleusen öffnen, geschieht dies ohne Pathos, sondern mit jener stillen Empathie, die das Kino von Trier zu einer so besonderen Erfahrung macht. »Zärtlichkeit ist der neue Punk«, ließ dieser in Cannes ausrichten. Es klingt wie eine ironische Parole, ist aber vielleicht die wahrhaftigste, nachahmenswerteste, die das Kino dieser Tage zu bieten hat. Oder, um es mit einem weiteren eigentümlich betitelten Song von Six by Seven zu sagen: »I O U Love«. Vielleicht ist ja auch das eine Erkenntnis von bleibendem Wert, die es weiterzutragen lohnt. prenner@thegap.at • www.screenlights.at
Christoph Prenner plaudert mit Lillian Moschen im Podcast »Screen Lights« zweimal monatlich über das aktuelle Film- und Seriengeschehen.

Unabhängiger Qualitätsjournalismus. Bürgerlich-liberal.
Die Presse Seit 1848

Nachrichten. Meinung. Magazin. Gedruckt. Digital. Audio. Video. Events.


Regisseurin und Choreografin
»Once Upon a Time in the Flames: Our Firebird Ballet«
Das Stück heißt »Once Upon a Time in the Flames: Our Firebird Ballet«. Was macht es zu eurem Ballett? Warum ist es nicht mehr Strawinskys?
Marta Navaridas: Ich habe lange gebraucht, den richtigen Titel zu finden. Wir haben über Märchen aus der Zeit vor und nach dem Katholizismus diskutiert, darum »Once Upon a Time«. Ich wollte »Firebird« miteinbeziehen, weil die Musik ein Klassiker und ein wichtiges Stück im Musikkanon ist. Gleichzeitig wollte ich nicht, dass Strawinsky unsere Arbeit überschattet. Auch wenn ich die Choreografin bin und Regie führe, ist es ein Stück, das auf Gruppenstärke beruht – der Stärke von uns. Darum spielt das »Our« eine zentrale Rolle.
Euer »Firebird Ballet« wird als Punkversion eines Balletts beschrieben. Was bedeutet Punk für dich? Wir verwenden auf der Bühne zwar keine Instrumente, aber mir wurde klar, dass man weder Gitarren noch Schlagzeuge braucht, um eine Punkattitüde zu haben. Als ich als Teenagerin im Baskenland Ballett tanzte, entdeckte ich zur gleichen Zeit auch Punkrock für mich. Sehr unterschiedliche Kunstformen, aber in meiner Biografie gehören sie zum selben Kapitel. Ballett kam mir so hart vor: Egal, wie sehr ich mich auch anstrengte, ich war nie gut genug. Dann ging ich am Wochenende zu Punkkonzerten und dachte: »Oh fuck, das ist Leben, das ist Freiheit.«
In der Aufführung thematisiert das Ensemble Kindheitserinnerungen an das Tanzen sowie patriarchale und nationalistische Traumata. Wie findet man Leichtigkeit und Katharsis in etwas, das auf Disziplin und Kontrolle basiert?
In der Performance gibt es eine dramaturgische Wendung: Im ersten Teil zitieren wir einige Ballettkonventionen. Dann gibt es eine Umbaupause, in der wir Anekdoten austauschen. Dabei war uns wichtig, dass wir uns nicht als Opfer fühlen. Viele von uns waren zu jung, um zu verstehen, wie viel Manipulation und Symbolik in dem versteckt war, was in unserer Jugend so unschuldig erschien. Wenn die Musik wieder einsetzt, wird das Bewegungsvokabular sehr kathartisch. Wir reißen uns die Strumpfhosen vom Leib und von da an wird es wirklich zu unserem Ballett.
23. bis 28. Jänner Wien, Brut Nordwest

Zwischen Supermarkteinkauf, Wohnung aufräumen und Familienbesuch kippt das Alltägliche in etwas Unfassbares. Von fehlender Altersvorsorge über Bettwanzenangriffe bis zur Auferstehung der Toten, die auch noch eine Wohnungsnot auslöst, stehen Mini und Miki alles gemeinsam durch. Doch wie sich zeigt, können die beiden auch einander ein Rätsel sein. Regisseur Branko Janack inszeniert nach Barbi Marković’ gleichnamigem Buch eine Welt, die einem verdächtig bekannt vorkommt, und lässt den Alltagshorror auf der Bühne comichaft aufleben. Der Abend verspricht einen wilden Ritt durch Routinen, der die abenteuerlichen Abgründe des Gewohnten aufmacht und einen nicht mehr loslässt. Kein großer Grusel, sondern eben »Minihorror«. 12. bis 23. Dezember Graz, Schauspielhaus

»Food, Friend or Forced Labor« macht dort weiter, wo der Körper sonst aufhört: im Inneren, das vielleicht doch eher Äußeres ist. Wo verlaufen die Grenzen zwischen Mensch und Mikrobe, falls es sie überhaupt gibt? Verdauen wir uns gegenseitig? Auf der Suche nach der richtigen Scheiße gegen Depression und nach Mikroplastik im Magen nehmen uns drei Performer*innen mit zur Darmspiegelung des US-Präsidenten, stellen uns unsere körpereigenen Haustiere vor und fragen, ob die Würmer aus der Wurmkiste ebenfalls Haustiere sind. Beim Nachwuchswettbewerb 2025 hat das Projekt von Sophie Kirsch, Mila Lyutskanova und Moritz Praxmarer sowohl den Jury- als auch den Publikumspreis gewonnen. 19. bis 31. Jänner Wien, Theater Drachengasse
Wem die Berichterstattung über das Oktoberfest nicht reicht, um zu erahnen, dass hier alles schieflaufen kann, der*die sollte »Kasimir und Karoline« sehen. Zwischen Riesenrad, Bierzelt und Bratwurst kippt nämlich nicht nur die Stimmung, sondern mitunter ein ganzes Leben. Kasimir verliert den Job, den Halt und auch Karoline, die vom sozialen Aufstieg träumt. Fast hundert Jahre alt und noch immer relevant – das Volksstück von Ödön von Horváth verdeutlicht, dass das Oktoberfest unweigerlich im Absturz endet. 27. November bis 31. Dezember Linz, Theater Phönix
Sehr frei nach Friedrich Schiller touren »Die Räuber« ab Dezember durch die Volkstheater-BezirkeSpielstätten. Das Publikum wird mitten in einen Brüderzwist voller Zorn und Intrigen gestürzt: Karl wird enterbt, gründet eine Räuberbande und kämpft für die Entrechteten, während Franz im Schloss sein Unwesen treibt. Unter der Regie von Kaja Dymnicki und Alexander Pschill (Bronski & Grünberg Theater) fliegen Funken von Humor und Tragik, während die Figuren durch ein Leben stolpern, das alles andere als gerecht ist. 28. November bis 14. Jänner Wien, diverse Locations
Wer nicht genug kriegen kann von Barbi Marković, darf sich im Dezember und Jänner glücklich schätzen. Basierend auf dem gleichnamigen Roman kommt dieser Mix aus Coming-of-Age, Science-Fiction und Krimi nun auf die Bühne. »Die verschissene Zeit« wirbelt durch das Belgrad der Neunzigerjahre: Betonburgen, Hyperinflation, Straßenhunde und eine Zeitmaschine, die alles noch absurder macht. Vanja, Marko und Kasandra reisen durch eine Periode, in der Erwachsene fast alles verschissen haben. 11. Dezember bis 10. Jänner Wien, Kosmos Theater
Rose sitzt Schiv’a, ein jüdisches Trauerritual, für ein palästinensisches Mädchen, das ihr Enkel erschossen hat – und macht damit ein ganzes Jahrhundert auf. Mit jüdischem Humor, Klugheit und unerschütterlicher Lebenskraft erzählt sie vom Überleben, von Verlust sowie von den Brüchen zwischen Diaspora und der modernen Welt. Andrea Eckert in der Titelrolle und Regisseurin Ruth Brauer-Kvam lassen Rose in diesem Monologabend lebendig werden, berührend und humorvoll – trotz des komplexen Themas. Theater, das im Gedächtnis bleibt. 21. bis 24. Jänner Wien, Theater Nestroyhof/Hamakom


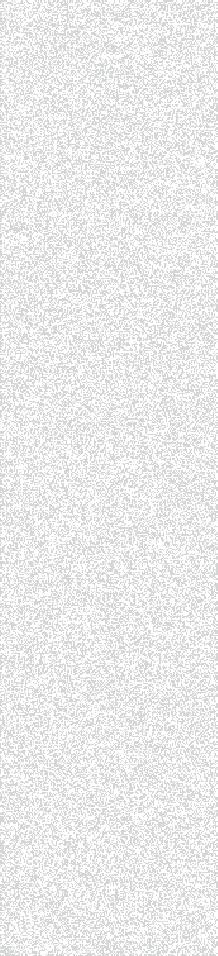























6 Ausgaben um nur € 19,97
Aboprämie: Oska »Refined Believer« (CD)
Ihr mögt uns und das, was wir schreiben?


Und ihr habt knapp € 20 übrig für unabhängigen Popkulturjournalismus, der seit 1997 Kulturscha en aus und in Österreich begleitet?
Dann haben wir für euch das The-Gap-Jahresabo im Angebot: Damit bekommt ihr uns ein ganzes Jahr, also sechs Ausgaben lang um nur € 19,97 nach Hause geliefert.

Gewidmet all denjenigen, die beim Lesen auf die eine oder andere Wissenslücke gestoßen sind.
Um das Meme »6-7« zu erklären, ist der Schreiber dieser Zeilen vermutlich zu alt. Wahrscheinlich muss/kann man das aber auch gar nicht erklären. »All I want is a photo in my wallet / A small remembrance of something more solid« ist eine Zeile aus dem Song »Picture This« von Blondie. Debby Harry fantasiert darin über das Objekt ihrer Begierde. Etwas mit Aplomb zu tun, bedeutet, es mit Nachdruck und sicherem Auftreten zu erledigen. Der Begri kommt aus dem Ballett und bezeichnet den soliden »lotrechten« Stand. Werner Lampert galt als eine der prägenden Figuren der biologischen Landwirtschaft in Österreich. Neben der Gründung der Marken Ja! Natürlich und Zurück zum Ursprung zeichnete er sich durch einen unentwegten Aktivismus für nachhaltige Agrarformen aus. Er verstarb am 7. Oktober 2025. Als Job-Stopper-Tattoos werden Tätowierungen bezeichnet, die es ihren Träger*innen schwer oder gar unmöglich machen, in bestimmten Bereichen oder gar generell eine Anstellung zu finden. Klassische Beispiele sind Tattoos an Stellen wie Hals oder Gesicht, aber es können auch bestimmte, kontroverse Motive darunterfallen. Kitchen-Table-, GardenParty- und Parallel-Polyamorie sind drei gängige Formen polyamorer Beziehungen. Bei der Kitchen-Table-Polyamorie sind alle Involvierten zumindest so gut befreundet, dass sie ohne Probleme gemeinsam am Küchentisch frühstücken können, auch wenn sie nicht direkt miteinander eine romantische oder sexuelle Beziehung haben. Bei der Garden-Party-Polyamorie besteht zumindest im gesamten Polycule eine gemeinsame Gesprächsbasis und unregelmäßige Tre en können stattfinden. Und bei der Parallel-Polyamorie kennen sich einzelne Stränge des Beziehungsgeflechts nicht notwendigerweise. Als Nachrichten- oder auch Presseagentur wird ein Unternehmen bezeichnet, das klassischen Massenmedien vorgelagert ist und diese »mit der täglichen Informationsbasis für deren weitere Berichterstattung« beliefert, wie die Austria Presse Agentur (APA) ihre Arbeit selbst beschreibt. Im Journalismus wird dabei oft von Agenturmeldungen beziehungsweise -fotos gesprochen.


Konservatives Mäuseweltbild tri t auf inexistente Objektivität. ———— »Habt euch lieb (aber keinen Sex!)«, so laute die Botschaft, die uns der Cartoonmäuserich aus seiner Heimat, dem kunterbunten Käsekuchenland, schicke, hieß es vor fast genau zwanzig Jahren im Teasertext zu unserer Coverstory über die Diddl-Maus und dessen »naiv-konservativen Lebensentwurf«. Manfred Gram, sonst unser Mann fürs Literarische, näherte sich in seinem Text der »seltsam proportionierten Monstermaus« an, die damals einen Hype erlebte. Ergänzend dazu sprachen wir mit der Gründerin eines Diddl-Fanklubs für Erwachsene über ihre Sammelleidenschaft und ewiges Fantum. Interviews führten wir auch mit Attwenger – anlässlich ihres sechsten Albums »Dog« – und mit dem Fotografen Paolo Woods, der im Rahmen des World-Press-Photo-Wettbewerbs ausgezeichnet worden war. In der fotografischen Arbeit gebe es keine Objektivität, meinte dieser: »Was ich aber versuche, ist, der Realität so nahe wie möglich zu kommen, und das darzustellen, was tatsächlich passiert.« Satte 177 Rezensionen aus den Bereichen Musik, Film, Comic, Buch und Spiele machten das Heft voll.
Altes Hallenbad Gallneukirchen
Die kleine Gemeinde nordöstlich von Linz gewann mit der 2023 abgeschlossenen Restaurierung ihres alten Hallenbades eine neue Veranstaltungsstätte hinzu. Betrieben vom Kulturpool Gusental dient diese als o ener Raum für Events unterschiedlicher Sparten. Mit der zusätzlichen Location wurde das Kulturangebot in der Region –es wird etwa auch die Alte Feuerwehr genutzt – noch mal erweitert. Vor Kurzem wurde das Alte Hallenbad mit dem Kleinen Landespreis für Kulturarbeit 2025 ausgezeichnet.
Reichenauer Straße 10, 4210 Gallneukirchen
Mangolds Graz
Wer gesundes Essen liebt, ist bei Mangolds an der richtigen Adresse. Hier wird täglich ein frisch gekochtes Veggiemenü aufgetischt – bio, versteht sich wohl von selbst.
Griesgasse 11, 8020 Graz
Burggasse 24 Wien
Der gleichnamige Store in der Burggasse 24 sollte Fans von Vintagekleidung bestens bekannt sein. Im angeschlossenen Café kann man stundenlang frühstücken – und in The Gap schmökern.
Burggasse 24, 1070 Wien
Offenheit hält die Tür offen. Auch für unbequeme Themen. Journalismus, der Welten öffnet.
Macht was.

JETZT STANDARD abonnieren

Josef Jöchl
artikuliert hier ziemlich viele Feels
Es gibt viele Gründe, warum ich froh bin, nicht heterosexuell zu sein. Mit Partnern mühelos Klamotten zu tauschen, ist nur einer davon.
Diesen Sommer zog sich meine Erleichterung sogar über mehrere Wochen, als gerade die performative males durchs digitale Dorf getrieben wurden. Damit sind die cis-männlichen Versionen von pick me girls gemeint: hetero Typen, die öffentlich ihre Männlichkeit aufweichen, indem sie Croptops tragen, in der UBahn feministische Literatur spazieren fahren und ihre lackierten Fingernägel am Rand ihres Matchabechers hervorlugen lassen.
Manche Leser*innen mögen sich nun fragen, was eigentlich so schlimm daran ist. Sollen die Buben doch ein Labubu am Rucksack tragen, wenn sie das möchten! Ist es 2025 überhaupt möglich, sich dem Zauber von Clairo zu entziehen? Ein gemütlicher Cardigan im Schrank hat noch niemandem geschadet! Doch die Kritik an den performative males entzündete sich an ihrem berechnenden Verhalten. Es ginge ihnen vor allem darum, die romantische Aufmerksamkeit junger FLINTA* auf sich zu ziehen. Puh, noch mal Glück gehabt, dachte ich mir, als ich online die letzte Volte des Diskurses nachvollzog, während ich mir mein frisch gecropptes Top zurechtzupfte.
It’s Fashion
Auch ich habe erst heuer den Mut aufgebracht, öffentlich ein zwar boxy fittendes, aber doch deutlich gecropptes Top zu tragen, was für einen elder Millennial außerhalb einer Tally-Weijl-Filiale noch immer ein bisschen daring ist. Vor Kurzem brachte ich ein paar Kleidungsstücke, die ihre besten Zeiten bereits überlebt hatten, in die Änderungsschneiderei meines Vertrauens. Der ältere türkische Herr, der sie betreibt, begutachtete die T-Shirts, die ich an den zu croppenden Stellen mit Isolierband abgeklebt hatte. Dann blickte er über
den Rand seiner Lesebrille und zerschmetterte in drei Wörtern meine neu erworbene Fotzigkeit. Er fragte: »Warum so kurz?«
Sollte ich ihm erklären, dass auch Männer, wie man so schön sagt, ihre oats fühlen und gleichzeitig ihre Körperform affirmieren wollen? Ich entschied mich, keine kostenlose Aufklärungsarbeit zu leisten und es bei einem wohlmeinenden »It’s fashion!« zu belassen. Seither komme ich jedoch nicht umhin, mich zu fragen, wie viele Croptop-Träger wohl ähnliche Erfahrungen machen müssen. Welche T-ShirtLänge gilt denn eigentlich als performativ? Verunglimpft man die progressiv anmutenden Males nicht zu Unrecht? Wie kann man als cis Mann ein Feminist sein, ohne dass es aufgesetzt wirkt? Die Antwort: Unangenehm wird es dann, wenn man(n) mit seinem Feminismus hausieren geht.
Jede Story hat mehr als eine Slide
Mir ist natürlich bewusst, dass auch ich von der patriarchalen Dividende profitiere, wenngleich bedeutend weniger als ein cishet Dude. Dennoch möchte ich hier öffentlich und ferndiagnostisch eine gefühlte Wahrheit umkreisen: Wenn du eine etwas nervige Person bist, bleibst du nervig, selbst wenn du vorgibst, angenehme Dinge zu tun. Es gibt diese Sorte Männer, die sich gerne auf der richtigen Seite der Geschichte wähnt und dafür gratismutig posiert, vermutlich um das eigene schlechte Gewissen zu entlasten und/oder sich anderen überlegen zu zeigen. Wie authentisch dieses Verhalten ist, lässt sich von außen natürlich nicht beurteilen – wie fast immer bei (Anti-)Social Media. Öffentliche Moralbezeugungen sind niemals nicht theaterhaft. Die richtigen Slides in die Story zu geben, kann so schon mal mit feministischer Praxis verwechselt werden. Aber wer bin ich überhaupt, um darüber zu urteilen? Auch mei-
ne Identität ist gelayert aus Performances, die ich in dieser Kombination vielleicht nur einmal trage und schneller wegwerfe, als Sascha Lobo »Ich bin ein Differenzfeminist« in ein Podcastmikro sagen kann. Jede Geste ausgehöhlt, die Ästhetik komplett durchkommodifiziert. »Pretty Girl« von Clairo habe ich zum Beispiel in einem Urban Outfitters shazamt.
Nicht Charli XCX’
In den Siebzigern galtst du vermutlich schon als waschechter Softboi, wenn du nach dem Brunzen die Klobrille wieder runtergeklappt hast. Das reicht heutzutage nicht mehr. Wer sich als Ally in feministischen Kämpfen versteht, sollte zuhören, sich informieren, sich engagieren und reflektieren, hin und wieder auch mal das Maul halten. Wer hingegen nur post, läuft Gefahr, selbst mit schlecht aufgetragenem Nagellack und nackter Taille ein bisschen wie Charli XCX’ Tante rüberzukommen.
Es ist so viel von männlicher Einsamkeit die Rede und dass sie epidemische Ausmaße angenommen habe. Viele progressive cishet Männer suchen vielleicht nach einem Gemeinschaftsgefühl jenseits der altbekannten Männerbünde. Was in dieser ganzen Sache mit den performative males nämlich auch immer miterzählt wird, ist, wie einschränkend die gängigen Ausdrucksformen von Cis-Männlichkeit noch immer sind. Vielleicht sollten cis Heten ihre Clairo-Croptops anfangs nur in Umkleiden oder in Fußballstadien tragen und sich dann gegenseitig fragen, ob sie mehr als drei Clairo-Songs kennen. Es könnte ein Anfang sein. joechl@thegap.at • @knosef4lyfe
Josef Jöchl ist Comedian. Sein aktuelles Programm heißt »Erinnerungen haben keine Häuser«. Termine und weitere Details unter www.knosef.at.