Smart Factory

September ’25


September ’25
Der Vorstandsvorsitzende der SmartFactory Kaiserslautern darüber, wie wettbewerbsfähig die deutsche Industrie wirklich ist.
191 Jahre Unternehmensgeschichte machen uns zum erfahrensten deutschen Schmierstoffhersteller. Mit dieser Erfahrung unterstützen wir Kunden weltweit mit passgenauen Schmierstofflösungen in der Metallbearbeitung und anderen Bereichen.
Zugleich zählen wir zu den modernsten Anbietern und überzeugen durch Innovationskraft. Beispielhaft dafür ist unsere BECHEM Nexus-Technologie, die es uns ermöglicht, in vielen Schmierstoffen auf PFAS zu verzichten – ohne Leistungseinbußen.
Dr. Niels Schmidtke
Liebe Leserinnen und Leser, die industrielle Wertschöpfung steht vor einem Wandel. Wo früher Maschinen vor allem Kraft und Präzision bedeuteten, entwickelt sich heute ein hochdynamisches Zusammenspiel digitaler Technologien. Kollaborative Robotik, digitale Zwillinge und souveräne Datenräume übernehmen zentrale Positionen im industriellen Spielfeld, in dem Daten erzeugt, nutzbringend interpretiert, in Echtzeit bewertet und mit anderen Teamplayern, d. h. Wertschöpfungspartnern, geteilt werden können. Gesteuert wird dieses Spiel durch intelligente Systeme, die vernetzt, lernfähig und im engen Zusammenspiel mit dem Menschen agieren.
Co-Bots, also kollaborative Roboter, übernehmen in diesem Team die Rolle flexibler Mitspieler. Anders als klassische Industrieroboter arbeiten sie nicht hinter Sicherheitszäunen, sondern Hand in Hand mit dem Menschen. Sie unterstützen, ergänzen und lernen durch KI-Steuerung zunehmend von ihrer Arbeitsumgebung. In Produktionshallen entsteht ein neues Miteinander von Mensch und Maschine, bei dem nicht Effizienz, sondern auch Resilienz, Sicherheit und Flexibilität im Mittelpunkt stehen. Hier gewinnt die Robotik allein jedoch noch kein Spiel. Erst

durch digitale Zwillinge, d. h. die virtuellen Abbilder von Produkten, Prozessen oder ganzen Anlagen, lassen sich Produktionsprozesse dynamisch simulieren, Störungen antizipieren und taktische Anpassungen im laufenden Betrieb vornehmen. Perspektivisch können diese, eingebettet in sogenannte Industrial-Metaverse-Umgebungen, immersive Trainings- und Erfahrungsräume schaffen, in denen die physische und digitale Welt zusammenwächst. Entscheidend ist, dass diese Zwillinge lernfähig sind und sich aus Echtzeitdaten speisen, angereichert durch domänenspezifisches Wissen und kontinuierlich weiterentwickelt durch KI.

Brandreport • EMO Hannover
Zentraler Baustein dieser Zukunft ist der souveräne Datenaustausch zwischen Wertschöpfungspartnern. Die industriegeführte und vom Bund geförderte Initiative Manufacturing-X steht exemplarisch für die digitale Transformation industrieller Wertschöpfungsketten in verschiedenen Branchen. Ziel ist es, durch den sicheren und standardisierten Datenaustausch zwischen Unternehmen Effizienz, Transparenz und Resilienz entlang der gesamten Wertschöpfung zu steigern. Im Fokus stehen konkrete Anwendungsfälle wie die Umsetzung digitaler Produktpässe, die Berechnung und Kommunikation des »Product Carbon Footprint« sowie die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Materialien und Komponenten. Diese Funktionen bilden die Grundlage für mehr Nachhaltigkeit, Zirkularität und regulatorische Konformität in der Industrie.
Damit diese Vision Wirklichkeit wird, braucht es mehr als nur technologische Fortschritte. Es braucht vertrauenswürdige Infrastrukturen, klare Standards und Spielregeln, eine starke Open-Source-Kultur und politische Rahmenbedingungen, die Souveränität und Kooperation zugleich ermöglichen. Reallabore und Demonstrationsumgebungen, insbesondere für KMU, spielen hierbei eine zentrale Rolle, um neue Technologien niederschwellig zu erproben, weiterzuentwickeln und sicher in den Produktionsalltag zu integrieren.
Am Ende entscheidet also nicht die Einzelleistung, sondern das Zusammenspiel zwischen Mensch, Maschine, Daten und Organisation. Die nächste industrielle Transformation wird durch koordinierte Teamarbeit ermöglicht. Deutschland hat mit seiner industriellen Stärke, seinem Know-how und seiner Innovationskraft beste Voraussetzungen, das Spiel der Zukunft mitzugestalten. Jetzt kommt es auf kluge Spielzüge, starke Partnerschaften und gemeinsames Handeln an!
Text Dr. Niels Schmidtke, Geschäftsführer, Fraunhofer-Verbund Produktion
Lesen Sie Mehr.
04 Cybersecurity
06 Digital Twins
08 Inter view: Martin Ruskowski
10 Prozessmanagement
12 S upply-Chain
16 Fabrikplanung
Smart Smart Factory Verlag und Herausgeber
Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, 8003 Zürich, Schweiz
Redaktion (Verantwortlich)
Nicolas Brütsch
Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich
Tel +41 44 258 86 10
Layout (Verantwortlich)
Mathias Manner
Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich
Tel +41 44 258 86 10
Anzeigen (Verantwortlich)
Falko Riedel
Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich
Tel +41 44 258 86 10
Druckerei
Handelsblatt Media Group GmbH

Viel Spass beim Lesen! Falko Riedel Project Manager
Vom 22. bis 26. September 2025 findet in Hannover die »Exposition Mondiale de la Machine O util« (EMO) statt, die Weltleitmesse der Produktionstechnologie EMO. Dr. Markus Heering, Geschäftsführer beim EMO-Veranstalter VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) stellt die EMO vor. Dr. Heering, warum ist denn die EMO 25 gerade für Fachbesucher:innen aus der Produktion so relevant? Die EMO in Hannover bietet einen umfassenden Überblick über die gesamte Prozess- und Wertschöpfungskette der Metallbearbeitung. Das ist besonders relevant, da in Europa und vor allem in Deutschland in den letzten zwei Jahren viele Investitionen ausgeblieben sind und ein Investitionsstau entstanden ist. Auf der EMO werden die neuesten Entwicklungen und Innovationen der Branche präsentiert. Unternehmen können sich gezielt informieren, mit welchen Technologien sie
ihre Produktion modernisieren und Wettbewerbsvorteile sichern können. Als internationale Leitmesse mit Ausstellern aus rund 50 Ländern und Besuchenden aus etwa 150 Ländern bietet die EMO die Möglichkeit, sich in ein bis zwei Tagen kompakt über Trends und Marktneuheiten zu informieren.
Welche Trends, die für die Produktion besonders wichtig sind, werden gezeigt?
Wir stellen drei zentrale Trends vor: Automatisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
Die Automatisierung ermöglicht in kleinen wie großen Betrieben eine nahezu durchgehende Produktion rund um die Uhr. Sie hilft, Personalkosten zu senken, dem Fachkräftemangel zu begegnen und gleichzeitig die Effizienz der Maschinen zu steigern. Automatisierte Prozesse reduzieren Fehler, schonen Ressourcen und tragen insgesamt zur Kostensenkung bei.
Nachhaltigkeit wird getrieben durch gesetzliche Vorgaben und die steigende Nachfrage der Kundschaft nach transparenten Informationen zu Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck. Unternehmen müssen offenlegen, wie nachhaltig ihre Produktion ist. Auf der EMO wird gezeigt, wie sich diese Daten erfassen, berechnen und transparent darstellen lassen.
Die Digitalisierung ist der Schlüssel, der Automatisierung und Nachhaltigkeit erst möglich macht. Durch digitale Vernetzung von Maschinen entlang der gesamten Wertschöpfungskette lassen sich Prozesse effizient steuern und Daten gewinnbringend nutzen. Ein wichtiger Treiber ist dabei auch die künstliche Intelligenz, die in den kommenden Jahren in immer mehr Bereichen tiefgreifende Veränderungen bringen wird.
Diese drei Themen bilden gemeinsam das Fundament des sogenannten »Advanced Manufacturing«, der Produktion der Zukunft.
Wie unterstützen Sie die Unternehmen bei diesen Entscheidungen zur Modernisierung?
Die EMO lebt von ihren Ausstellern, die neueste Produkte und Technologien zeigen. Ergänzend gibt es ein zentrales Forum zu den genannten drei Fokusthemen, zu künstlicher Intelligenz sowie tägliche »P.O.P. Talks« zur Zukunft der Produktion. Fachverbände wie die Werkzeuge im VDMA bieten eigene Bühnen und zahlreiche begleitende Konferenzen vertiefen Branchenthemen. Kanada ist dieses Jahr erstmals Alliance Country Canada@EMO 2025. Neu ist eine KI-gestützte Besuchsplanung, die individuelle Empfehlungen gibt. Dennoch lohnt es sich auch, Zeit für spontane Entdeckungen einzuplanen.
Weitere Informationen unter: emo-hannover.de
Maschinenbauer (OEMs) und Automatisierungsingenieure stehen heute vor einem perfekten Sturm: Kundinnen und Kunden fordern höhere Durchsatzraten, kleinere Maschinen und strengere Qualitätskontrollen – und all das trifft auf steigende Systemkomplexität. Gleichzeitig erhöhen globale
Lieferkettenprobleme und Fachkräftemangel den Druck, anspruchsvolle Maschinen schneller und mit weniger Anpassungen vor Ort zu liefern.
Diese zusammenlaufenden Kräfte treiben einen tiefgreifenden Wandel in der Fertigungslandschaft voran. Laut des zehnten Berichts zum S tand der intelligenten Fertigung von Rockwell Automation geben 81 Prozent der Hersteller an, dass externe Marktkräfte und interne Ineffizienzen ihre Digitalisierungsinitiativen beschleunigen. 56 Prozent testen bereits Smart-Manufacturing-Strategien wie digitale Zwillinge und Edge-KI.
In der DACH-Region setzen Hersteller zunehmend auf smarte Technologien, um trotz wachsender Komplexität wettbewerbsfähig zu bleiben. Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Zwillinge haben sich hier als Schlüsseltechnologien etabliert. 95 Prozent der befragten Unternehmen haben bereits in KI/ML, Generative AI oder kausale KI investiert oder planen dies innerhalb der nächsten fünf Jahre. Ziel ist es, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Rund die Hälfte will bis 2025 KI-gestützte Qualitätskontrollen einführen, um Fehler zu erkennen, die regelbasierte Systeme übersehen.
Marktdruck treibt Hersteller in die digitale Transformation Da die Digitalisierung industrielle Abläufe neu definiert, stoßen traditionelle Methoden – etwa zentrale Schaltschranksteuerungen, manuelle Inbetriebnahmeprozesse oder eaktive Wartungsstrategien – zunehmend an ihre Grenzen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, setzen Ingenieure auf Technologien, die Systemleistungen simulieren, äteausfälle vorhersagen und anpassungsfähigere I/O-Architekturen ermöglichen. ung ist damit nicht mehr
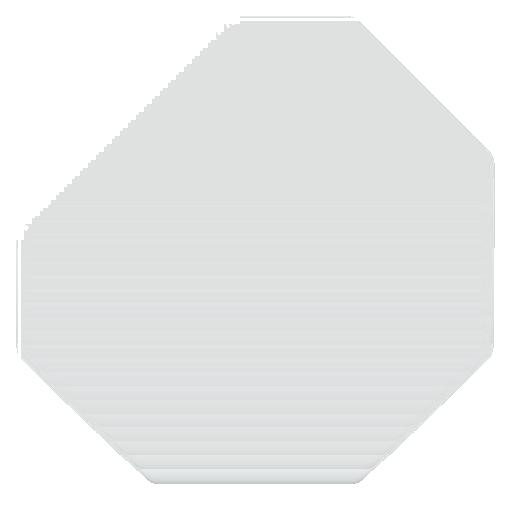
Um konkurrenzfähig zu bleiben, setzen Ingenieure auf Technologien, die Systemleistungen simulieren, Geräteausfälle vorhersagen und anpassungsfähigere I/OArchitekturen ermöglichen.
nur ein strategischer Vorteil, sondern eine grundlegende Notwendigkeit.
Ein Ansatz, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, sind virtuelle Simulationswerkzeuge, die Risiken vor Ort verringern und die Projekteffizienz steigern. Die »Emulate3D Digital Twin Software« ermöglicht es beispielsweise, Inbetriebnahmen und Ablaufvalidierungen in einer virtuellen Umgebung durchzuführen. Auch das Offline-Training von Bedienpersonal ist möglich – ein Vorteil, der Störungen reduziert, Implementier ungen beschleunigt und den Aufwand für technische Nacharbeiten senkt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf zustandsbasierter Überwachung durch intelligente Analysen. »LogixAI« bringt maschinelles Lernen direkt ins Steuerungs system und erlaubt die Echtzeitbewertung
von Anlageleistungen – ohne externe Data-Science-Plattformen. Durch die Integration prädiktiver Modelle in die Steuerung erkennt LogixAI Abweichungen und mögliche Ausfälle frühzeitig, bevor kostspielige Stillstände auftreten. Wartungsteams erhalten dadurch direkt verwertbare Einblic ke an der Quelle. So wird der Schritt von reaktiver zu prädiktiver Instandhaltung vollzogen, was die Zuverlässigkeit und die Gesamtanlageneffektivität deutlich steigert.
KIgestützte digitale Zwillinge mit NextGenI/O
Selbst die fortschrittlichsten digitalen Zwillinge und KI-Werkzeuge sind nur so gut wie die Daten, die sie erhalten – und hier spielt I/O eine Schlüsselrolle. Als Fundament jeder Hochleistungsmaschine bildet

und Daten. In modernen Systemen wird I/O von verschiedenen Anwendungen gemeinsam genutzt, seine Effizienz bestimmt direkt den Gesamtdurchsatz.
Next-Generation-I/O-Plattformen, die speziell für modernes Maschinendesign und hybride Prozessanwendungen entwickelt wurden, sind entscheidend für den Betr iebserfolg. »PointMax I/O« wurde genau dafür konzipiert: Es erfüllt die Anforderungen des modernen Maschinenbaus und liefert zugleich die zuverlässige, hoc hpräzise Datenbasis, die KI und digitale Zwillinge benötigen, um Rohsignale in verwertbare Erkenntnisse zu verwandeln.
Beschleunigung einer intelligenteren, widerstandsfähigeren Fertigung Technologien wie PointMax I/O helfen Herstellern, das volle Potenzial von Echtzeit-KI und digitalen Zwillingen auszuschöpfen, indem sie unterbrechungsfreie Datenströme und prädiktive Einblic ke ermöglichen. Dank des skalierbaren Plug-and-Play-Designs können Teams Maschinenleistungen simulieren, Probleme frühzeitig erkennen und Inbetriebnahmen vereinfachen – und das bei deutlich reduziertem Aufwand für Stillstände und Nacharbeiten.
Da diese Lösung reibungslos mit bestehenden Systemen wie »Logix 5000-Steuerungen« und EtherNet/IP-Netzwerken funktioniert, lässt sie sich nahtlos in vorhandene Infrastrukturen integrieren. Eingebaute Diagnosefunktionen vereinfachen die Einrichtung und beschleunigen l-out, wodurch der gesamte Prozess von Anfang bis Ende flüssiger verläuft.

Die flexible Netzwerkanbindung erlaubt Unternehmen, die passende Topologie zu wählen – ob für Resilienz, Einfachheit oder Geschwindigkeit. Zudem macht die touch-gestützte Inbetriebnahme die Einrichtung und den Modulaustausch so einfach martphones.
Automatisierungsdurchbrüche
Werden diese I/O-Fähigkeiten mit KI-gestützter Analyse und kontinuierlich aktualisierten digitalen Zwillingen mbiniert, entsteht ein virtuelles Abbild des laufenden Prozesses. Dieses ermöglicht schnelle Inbetriebnahmen, vorausschauende Wartung und laufende Performance-Optimierung.
Vincenzo Monaco, Managing Director DACH, Rockwell Automation
Maschinenbauer und Automatisierungsingenieure können auf der SPS 025 in Nürnberg erleben, wie diese Innovationen ihr nächstes Projekt
Rockwell Automation ist in Halle 3C, Stand 320, vertreten und diskutiert dort die drängendsten Herausforderungen in der Automatisierungs-

In der modernen Fertigung schaffen Technologie und Konnektivität neue Chancen. Doch gleichzeitig entstehen auch neue Gefahren. Zentral ist für fertigende Betriebe die Erkenntnis, dass sie ihre IT- und OT-Sicherheit individuell betrachten müssen.
ie Digitalisierung gilt als essenzieller Enabler der deutschen Industrie. Und dies durchaus zu Recht, schließlich schafft sie enorme Effizienzgewinne und ermöglicht den Marktteilnehmenden dank KI und Co. die Erschließung neuer Kundensegmente. Doch es gibt auch eine Schattenseite, wie die neue Studie »Digital Trust Insights 2025« von PwC Deutschland aufzeigt. Denn diese liefert geradezu alarmierende Zahlen zum Thema Cybersicherheit: So hätten 83 Prozent der deutschen Unternehmen Schäden bis zu 9,9 Mio. Dollar durch Datenlecks erlitten, 67 Prozent sehen eine Vergrößerung der Angriffsfläche durch generative KI und 63 Prozent haben keinen vollständigen Überblick über ihre technologischen Abhängigkeiten. Angesichts dieser Bedrohungen planen 72 Prozent der Unternehmen, ihr Budget für Cybersicherheit zu erhöhen. Doch eine einfache Erhöhung der IT-Sicherheit reicht insbesondere in der Fertigung nicht aus. Warum? Weil IT- und OT-Sicherheit grundlegend unterschiedliche Prioritäten, Architekturen und Risikobilder haben. Die fundamentalen Unterschiede Um Cybersicherheit in der modernen Fertigung zu erfassen, müssen die Unterschiede zwischen IT und OT klar definiert und verstanden sein. Grundsätzlich gilt: IT (Information Technology) umfasst sämtliche Systeme und Netzwerke, die der Verwaltung und Verarbeitung von Daten dienen. Dazu gehören
Brandreport • Howden
Unternehmen müssen eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie entwickeln, die sowohl IT als auch OT abdeckt.
Unternehmensnetzwerke, E-Mail-Server, Datenbanken und Bürosysteme. Die Hauptziele der IT-Sicherheit sind die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit von Daten. Der Schutz vertraulicher Informationen steht dabei an erster Stelle. Ein Angriff zielt hier oft auf Datendiebstahl oder -manipulation ab.
OT (Operational Technology) wiederum bezieht sich auf Hard- und Software, die zur Überwachung und Steuerung physischer Prozesse in der Industrie eingesetzt wird. Beispiele hierfür liefern Scada-Systeme (Supervisory Control and Data Acquisition), PLCs (Programmable Logic Controllers) sowie Industrieroboter. Für OT-Systeme sind die Prioritäten anders gesetzt: Die Verfügbarkeit und Integrität der Systeme sind entscheidend. Der Faktor Vertraulichkeit ist hier von geringerer Bedeutung. Ein Angriff auf ein OTSystem kann zur Unterbrechung der Produktion, zu physischen Schäden an Maschinen, Unfällen
oder sogar zu Umweltkatastrophen führen. Die Folgen sind unmittelbar und oft katastrophal.
Warum diese Unterschiede wichtig sind
Die Diskrepanz zwischen IT- und OT-Sicherheit manifestiert sich in vielen Bereichen. Ein essenzieller ist die Lebensdauer: Während IT-Systeme oft alle drei bis fünf Jahre erneuert werden, haben OT-Systeme eine deutlich längere Lebensdauer, die bis zu 20 Jahre und mehr betragen kann. Alte Betriebssysteme und nicht gepatchte Software sind in OT-Umgebungen eher die Regel statt die Ausnahme – und stellen ein entsprechend hohes Sicherheitsrisiko dar. Dies hat Auswirkungen auf das unternehmerische Risikomanagement: Ein Datendiebstahl in der IT ist zwar ärgerlich, potenziell teuer und kann einen Reputationsschaden nach sich ziehen. Ein Angriff auf die OT-Infrastruktur bringt allerdings potenziell die gesamte Produktion zum Erliegen oder führt
dazu, dass Maschinen irreparabel beschädigt werden. Hier entsteht durch die zunehmende Digitalisierung und Konnektivität ein Sicherheitsproblem: Zwar handelt es sich bei OT-Netzwerken traditionellerweise um isolierte, »geschlossene« Systeme – doch im Zuge der digitalen Transformation werden sie vermehrt mit der IT-Welt verbunden, was neue Angriffsvektoren schafft. Fachleute betonen, dass die Vernachlässigung der OT-Sicherheit zugunsten einer reinen IT-Fokussierung einen gefährlichen Fehler darstellt. Die Zahlen von PwC unterstreichen, wie dringlich dieses Problem ist. Unternehmen müssen eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie entwickeln, die sowohl IT als auch OT abdeckt. Dazu gehört unter anderem die Segmentierung der Netzwerke: Durch die strikte Trennung von IT- und OT-Netzwerken lässt sich die Ausbreitung von Angriffen verhindern. Zudem ist es sinnvoll, eine separate und detaillierte Analyse der spezifischen Risiken in der OT-Umgebung vorzunehmen. Auf diese Weise werden die passenden Sicherheitslösungen eruiert, die speziell für OT-Protokolle und -Geräte entwickelt wurden. Und wie auch im IT-Segment gilt: Die Schulung der Mitarbeitenden ist zentral. Durch die Sensibilisierung des Personals für die spezifischen Risiken in beiden Bereichen lässt sich die Chance auf einen erfolgreichen Angriff verringern. Text SMA
Ganzheitliche Resilienz: Mehrwerte einer Cyberversicherung bei der Einbindung in das Risikomanagement

Peter Pillath Director Cyber, Howden Deutschland
Welche Rolle kann eine Cyberversicherung spielen? Steht sie gar in Konkurrenz zu Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit? Was ist zu tun, damit die Versicherung im Ernstfall auch zahlt?
Damit die Cyberversicherung ein fester Bestandteil der Cyberresilienz eines Unternehmens wird, muss der Ansatz ganzheitlich gedacht und in das Risikomanagement eingebunden werden. Es darf keine Budgetdiskussionen zwischen Versicherung und Erhöhung der IT-Sicherheit geben. Vielmehr
ist es ein Miteinander, um das Unternehmen besser auf die täglichen Bedrohungen vorzubereiten.
Der Prozess rund um eine Cyberversicherung kann in vier Phasen aufgeteilt werden: Risikoanalyse, Prävention, Risikotransfer und fortlaufende Optimierung.
Mit der richtigen Fachexpertise auf Vermittlerseite beginnt die Betrachtung bei der Bedrohungsanalyse und Risikoquantifizierung. Die Kenntnis der unternehmenseigenen Angriffsoberfläche und möglichen Auswirkungen eines erfolgreichen Angriffs sind wichtig, um Maßnahmen richtig zu priorisieren. Die Anforderungen der Versicherer an die IT-Sicherheit sind als Marktstandards zu sehen. Hier darf kein Schwarz-Weiß-Denken einsetzen, aber wer keine Cyberversicherung erhält, muss sich ernsthafte Gedanken zur IT-Sicherheit machen. Und im Zuge von NIS2 und Co. erhöhen sich die Haftungsrisiken für Geschäftsführende und Vorstände zusätzlich.
Die hauseigenen Risikoingenieure bei Howden ermöglichen eine gute Einschätzung mit ihrem Blick von außen und den Erfahrungen aus Dutzenden begleitenden Schadenfällen. Mit den Erkenntnissen aus einer Business-Impact-Analyse sind die Grundlagen geschaffen, um Maßnahmen richtig zu priorisieren. Die Roadmap zur Erlangung des nächsthöheren IT-Reifegrads gibt Planungssicherheit für die kommenden Monate. Und das Restrisiko? Absichern oder selbst tragen? Eine Frage von Opportunitätskosten und erwartbaren Schadensummen.
Der Einkauf einer Cyberversicherung darf nicht das Budget für IT-Sicherheitsmaßnahmen mindern. Vielmehr sind die Anforderungen und die Risikoanalyse hilfreich, um die richtigen Schwerpunkte zu setzen und bislang nicht umgesetzte Projekte neu aufleben zu lassen. Und im Schadenfall? Hier hilft das Netzwerk des Versicherers sowie die vorgehaltenen Dienstleister, um den Schaden so gering wie
möglich zu halten und den Geschäftsbetrieb schnellstmöglich wieder aufnehmen zu können. Der finanzielle Schaden wird abgefedert und die IT-Infrastruktur resilienter wieder aufgebaut. Ein Teil der Versicherungsleistung sollte in neue IT-Sicherheitsmaßnahmen fließen.
Ob Schaden oder nicht. Der regelmäßige Dialog zwischen Unternehmen, Howden und dem Versicherer hilft neueste Erkenntnisse in die IT-Sicherheit einfließen zu lassen und Entscheidungen fundierter zu treffen. Am Ende hilft die Cyberversicherung, die Unternehmen sicherer zu machen, auf einen Vorfall vorzubereiten und im Fall der Fälle die Folgen bestmöglich abzufedern.
Weitere Informationen unter: howdengroup.de


Willy Fabritius
Global Head of Strategy & Business Development Information Security Assurance bei SGS

Marcello Walz
Digital Trust Leader DACH bei SGS
Wie gelingt der Spagat zwischen technologischer Innovation und regulatorischer Sicherheit? Zwei Experten von SGS geben Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze für die Industrie.
Was sind aktuell die größten Herausforderungen im Hinblick auf Informations und Cybersicherheit?
Willy: Die Industrie steht unter hohem Innovationsdruck. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen – etwa durch NIS2,
das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder branchenspezifische Standards. Die Herausforderung besteht darin, Innovation und Compliance zu vereinen, ohne Agilität und Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Informationssicherheit ist kein Kontrollmechanismus, sondern ein Enabler. Wer Security-by-Design integriert, schafft Vertrauen, senkt Risiken und sichert seine Zukunftsfähigkeit.
Marcello: Technologien wie KI und IIoT bieten enormes Potenzial – bergen aber Risiken, wenn sie ohne stabiles Sicherheitsfundament eingeführt werden. Ohne klare Governance entstehen schnell Sicherheitslücken mit rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen. Die Zunahme von Cyberangriffen und Systemausfällen zeigt: Das Sicherheitsniveau in der Industrie ist oft unzureichend. Viele Vorfälle ließen sich durch systematische Ansätze bereits in der Produktkonzeption deutlich abschwächen oder sogar verhindern. Sicherheit ist keine Innovationsbremse – sie ist deren Voraussetzung.
Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen gegen neue EU-Vorgaben wie z. B. den Cyber Resilience Act (CRA)?
Marcello: Der CRA definiert strenge Anforderungen für digitale Produkte und Verstöße können Bußgelder bis zu 15 Mio. Euro oder 2,5 Prozent des weltweiten Umsatzes nach sich ziehen. Schon fehlerhafte Angaben oder verspätete Meldungen sind sanktionierbar. Informationssicherheit wird damit zur gesetzlichen Pflicht – und zur
Führungsaufgabe. Wer früh handelt, schützt sich und stärkt seine Marktposition.
Warum scheitern über 80 Prozent der KI-Projekte im Mittelstand?
Marcello: Häufig fehlen klare Ziele, Datenqualität und ein strukturiertes Risikomanagement. KI wird oft als Experiment gestartet –ohne Sicherheits- und Ethikrahmen.
Willy: Genau hier setzen Managementsysteme wie ISO/IEC 27001 (Informationssicherheit) und ISO/IEC 42001 (KI-Management) und die ganz neue ISO 56001 (Innovationsmanagement) an. Diese Normen schaffen verlässliche Strukturen und stärken das Vertrauen von Kunden, Partnern und Behörden – essenziell für den produktiven KI-Einsatz.
Wie bleiben Unternehmen langfristig innovativ und resilient?
Marcello: Sicherheit wird zur strategischen Ressource. Wer heute in Managementsysteme investiert, ist morgen robuster – technologisch, regulatorisch und reputationsseitig. In einer global vernetzten Industrie ist Vertrauen entscheidend –intern wie extern. Standards wie ISO 27001 und 42001 sind zentrale Hebel.
Welche Rolle spielt SGS?
Marcello: SGS begleitet Unternehmen weltweit bei Einführung und Zertifizierung – von der Gap-Analyse bis zur kontinuierlichen
Verbesserung. Unsere Stärke liegt in der Verbindung regulatorischer, technologischer und branchenspezifischer Expertise.
Willy: SGS ist weltweit Marktführer in den Bereichen Test, Inspektion und Zertifizierung und ist die einzige Zertifizierungsstelle, die für ISO/IEC 42001 durch zwei Akkreditierungsstellen anerkannt ist – und damit der ideale Partner für Unternehmen, die Innovation sicher, skalierbar und regelkonform gestalten wollen.
Fazit: Sicherheit ist nicht das Ende von Innovation – sondern ihr Anfang.
Kontakt
SGS Gruppe Deutschland Marcello Walz marcello.walz@sgs.com sgs.com
HiSolutions AG • Brandreport
Der digitale GAU: Wenn Ransomware den Betrieb lahmlegt –und wie Unternehmen wieder auf die Beine kommen
Eine Analyse der modernen Cyberbedrohungen und deren Bewältigung.

Der Moment des Stillstands Es ist typischerweise ein Montagmorgen, wenn die Geschäftsführung erfährt: »Nichts geht mehr!« Computer und Server sind außer Betrieb – alles verschlüsselt. Die Produktion läuft nur noch mit bereits gespeicherten Daten, danach droht der vollständige Stillstand. Sofort stellen sich kritische Fragen: Sind die Back-ups vielleicht auch kompromittiert? Sind Maschinensteuerungen mit veralteten Windows-Versionen ebenfalls gefährdet?
Entscheidungsdruck in der digitalen Brandzone Entscheidungen müssen unter Hochdruck getroffen werden: Systeme abschalten oder weiterbetreiben? Wann Kunden informieren? Der IT-Dienstleister wirkt überfordert, während die interne IT-Abteilung an verschiedenen Fronten kämpft – immer wieder unterbrochen durch drängende Anfragen aus allen Führungsebenen.
In solchen Situationen benötigen Unternehmen Expert:innen mit umfassender Erfahrung in der Krisenbewältigung, die
nicht nur technische Lösungen anbieten, sondern das Gesamtbild verstehen.
Die mehrdimensionale
Krisenbewältigung
HiSolutions hat sich auf eine ganzheitliche Krisenbewältigung spezialisiert, die mehrere Dimensionen umfasst: Unterstützung beim Aufbau einer funktionsfähigen Krisenorganisation, Entwicklung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und fachliche Unterstützung der IT bei Fehleranalyse, forensischen Untersuchungen und Wiederaufbau der Infrastruktur. Der Markt für umfassende Krisenunterstützung ist begrenzt. Während viele Anbieter Remote Support anbieten, kommen nur wenige vor Ort. HiSolutions gehört zu den Anbietern, die neben IT-Expertise auch bei der Fortführung des Geschäftsbetriebs und der Kommunikation unterstützen können.
Bewährte Partnerschaft in der Gefahrenabwehr Seit über 14 Jahren kooperieren der Versicherer Hiscox und HiSolutions, um betroffenen Organisationen kompetente Unterstützung in Notfallsituationen zu bieten. Die Experten sorgen für Kontrolle in Krisensituationen und begleiten Unternehmen zurück in einen stabilen Betriebszustand. Diese Zusammenarbeit bietet mehrfachen Nutzen: Die Versicherung minimiert Schäden durch frühzeitigen Experteneinsatz. Betroffene Unternehmen werden auf allen Ebenen von Spezialist:innen durch die Krise geführt. Und HiSolutions bietet seinen Kunden ein praxiserprobtes Leistungsportfolio.
Erfolgreiche Bilanz gegen digitale Erpresser Dank der gesammelten Erfahrung konnten in zahlreichen Fällen Lösegeldzahlungen
Eine Ransomware-Attacke ist keine reine IT-Krise mehr – sie ist eine existenzielle Unternehmenskrise.
vermieden und Betriebsunterbrechungen verkürzt werden. Das direkt erreichbare Notfall-Lagezentrum von HiSolutions stellt sicher, dass keine wertvolle Zeit verloren geht. Das Leistungsspektrum umfasst nicht nur die Reaktion auf akute Vorfälle, sondern auch präventive Maßnahmen wie IncidentResponse-Pläne und Notfallübungen.
Erfahrung und forensische Expertise in der Rekonstruktion von Angriffswegen und Identifikation potenzieller Datenabflüsse sind wesentlich für eine schnelle Eindämmung der akuten Gefahren, und nicht zuletzt auch für die rechtskonforme Reaktion im Rahmen bestehender Meldepflichten. Mit zertifizierten Expert:innen für IT- und OT-Umgebungen ist das Team von HiSolutions auch auf die besonderen Herausforderungen bei Betreibern kritischer Infrastrukturen vorbereitet.
Weitere Informationen unter: hisolutions.com/incident-response
Eine virtuelle Kopie, die physische Objekte dynamisch abbildet, um sie über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu überwachen und zu optimieren – der Digitale Zwilling macht genau dies möglich. Daraus ergeben sich diverse Vorteile in der Fertigung.

Vor einigen Jahren hätte das Prinzip des Digitalen Zwillings noch wie Science-Fiction angemutet. Denn bei einem Digital Twin handelt es sich um eine virtuelle Repräsentation eines physischen Objekts oder Prozesses. Laut dem Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) kommt diese Technologie vor allem dann zum Einsatz, wenn Unternehmen ihre Produkte oder Systeme über den gesamten Lebenszyklus hinweg beobachten, analysieren, simulieren und optimieren möchten. Hierfür werden vom realen Objekt oder Prozess kontinuierlich Modelle, Informationen und Daten in Echtzeit erhoben, welche es erlauben, Einblicke in den Zustand und das Verhalten zu gewinnen.
Doch wie setzt sich der digitale Zwilling genau zusammen? Beim Fraunhofer IPK spricht man in diesem Zusammenhang vom »Digital Master« sowie vom »Digitalen Schatten«. Ersterer enthält alle relevanten Modelle des physischen Objekts oder Prozesses. Durch geeignete Daten- und Informationsmodelle repräsentiert er auf diese Weise die zu erwartenden Parameter. Je nach Anwendungsfall
Brandreport • Halocline
könne sich dies beispielsweise auf die Geometrie, das Verhalten, die Funktion oder andere Eigenschaften von Produkten, Maschinen oder Prozessen beziehen. Der Digitale S chatten hingegen repräsentiere das »Tatsächliche«: Er bündelt diejenigen Daten, die über den L ebenszyklus des abgebildeten Systems gesammelt werden. Dies können Betriebs-, Zustands- oder Prozessdaten sein, die zum Beispiel über Sensoren erfasst werden.
Was bedeutet das in der Praxis?
Zur Veranschaulichung führen die FraunhoferFachleute die Konstruktion eines Autos an: Sämtliche Autos eines Typs werden anhand der gleichen Zeichnungen und Produktionsanweisungen produziert und weisen im Grundsatz dieselben durchschnittlichen Wartungszyklen auf. Die Modelle, Simulationen und Daten, aufgrund derer all diese Autos hergestellt werden, werden »Master« genannt. Nun gibt es aber auch Daten, welche den Unterschied zwischen den einzelnen Wagen aufzeigen, obschon diese per se baugleich sind. Denn bereits in der Produktion ist jedes Auto spezifischen Besonderheiten unterworfen, wie zum
Beispiel Montageabweichungen. Während des Betriebs könne es daher sein, dass ein Auto in besonders heißen, kalten oder trockenen Regionen genutzt wurde und deshalb kürzere Wartungszyklen benötigt. Diese Daten, welche die Realität jedes einzigartigen Autos darstellen, werden unter dem Begriff »Schatten« zusammengefasst. Eine wesentliche Rolle spielt nun die Verknüpfung des Digitalen Masters mit dem Digitalen Schatten – denn erst durch diesen Prozess entsteht der tatsächliche Mehrwert des Digitalen Zwillings. Durch den Vergleich von Master- und Schattendaten des Autos können zum Beispiel Vorhersagen zum optimalen Wartungszeitpunkt getroffen oder wichtige Verbesserungspotenziale für zukünftige Produktgenerationen abgeleitet werden (Feedback to Design).
Welche Arten von digitalen Zwillingen gibt es?
Die vielleicht gängigste Form stellen die Produktzwillinge dar: Bei ihnen handelt es sich um digitale Abbildungen realer, individueller Wertobjekte. Sie enthalten Daten entlang des Lebenszyklus und eröffnen Einblicke in
Produktverhalten und Optimierungspotenziale. Mit ihrer Hilfe können beispielsweise Daten unternehmensübergreifend ausgetauscht oder Produkte vorausschauend geplant und in allen Lebensphasen überwacht und optimiert werden, etwa hinsichtlich ihres ökologischen Fußabdrucks oder ihrer Energieeffizienz.
Die Maschinen- oder Anlagenzwillinge wiederum bilden den aktuellen Zustand während der Produktion ab. Dadurch lassen sich automatisiert die Energieeffizienz von Anlagen erfassen/steuern sowie Wartungsbedürfnisse frühzeitig erkennen (Predictive Maintenance) und mithilfe von kontextsensitiven Assistenzsystemen bei der Instandhaltung unterstützen. Digitale Prozesszwillinge vernetzen ihrerseits technologische Fabrikprozesse mit unternehmerischen Geschäftsprozessen. So können Systeme als Ganzes betrachtet und auf einer soliden Datengrundlage wichtige Erkenntnisse – zum Beispiel für die Produktionsplanung oder Geschäftsmodelle – abgeleitet werden.
Text SMA
Wirtschaftlichere Möglichkeiten für Produktionsverantwortliche

Christian Völler COO
Herr Völler, warum sollten sich produzierende Unternehmen mit modernen Tools wie Halocline beschäftigen?
Weil es schlicht wirtschaftlich ist. Das Ergebnis der Produktionsplanung ist ein enormer Kostenfaktor – gleichzeitig liegt hier ein riesiges Einsparpotenzial. Mit Halocline können Unternehmen ihre Produktionsprozesse frühzeitig validieren, Risiken erkennen und Investitionen gezielter steuern.
Wie genau funktioniert das?
Statt in klassischen Tools wie AutoCAD oder Expertenlösungen wie 3D-Simluationssoftware
In über 1000 Projekten von Mittelständlern und Großkonzernen eingesetzt.
– Christian Völler, COO
zu planen, versetzen wir Teams direkt in eine virtuelle Fabrik. Dort können sie ihr gesamtes Produktionskonzept in 3D planen, bewerten und gemeinsam weiterentwickeln –bevor überhaupt etwas real gebaut wird.
Welche konkreten Vorteile ergeben sich daraus?
Zum einen werden Planungsfehler früh erkannt, bevor sie teuer werden. Zum anderen sparen Unternehmen im Schnitt 20–40 Prozent Zeit im Planungsprozess. Besonders relevant für Produktionsverantwortliche: In vielen Projekten wurden durch den Einsatz von Halocline sechsstellige Capex-Kosten eingespart – pro Projekt.
Ist die Anwendung denn komplex und benötigt Vorkenntnisse?
Ganz im Gegenteil. Unsere User berichten im Regelfall, dass sie nach rund einer Stunde Onboarding direkt eigenständig arbeiten können. Das ist wichtig, weil wir wollen, dass Planung nicht nur in Spezialabteilungen passiert – sondern dort, wo das operative Wissen sitzt: direkt in der Produktion.
Wie groß ist die Akzeptanz in der Industrie?
Sehr hoch. Unsere Software wird jährlich bereits in über 1000 Projekten
eing esetzt, von Mittelständlern bis hin zu Großkonzernen. Viele berichten uns, dass Halocline nicht nur für effizientere Planung sorgt, sondern auch die Ko mmunikation im Team und mit Personen im Management verbessert.
Ihr Fazit in einem Satz?
Wer heute besser plant, produziert morgen effizienter – und spart dabei bares Geld.
Weitere Informationen unter: halocline.io


Marco Godenschwege
Leiter Region Zentraleuropa (D-A-CH-NL)
Herr Godenschwege, warum hat sich KSB vor zwei Jahrzehnten dazu entschlossen, in diese Technologie einzusteigen?
Bei der Gestaltung einer Komponente mit dieser Technologie steht deren Funktion im Vordergrund: Der Konstrukteur legt zunächst fest, welche Funktionalitäten ein Bauteil haben soll. Die anschließende Gestaltung der Geometrie folgt genau diesen Vorgaben. Das eröffnet den Entwicklern ganz neue konstruktive Freiheiten. Bei klassischen Formgebungsverfahren hingegen war der Konstrukteur gezwungen, den Entwurf den zur Verfügung stehenden Fertigungsmethoden unterzuordnen.
Eignen sich alle Komponenten für die additive Fertigung? Die Anfangseuphorie – die Vorstellung, dass zukünftig alles in der Welt aus dem 3D-Drucker kommen würde – hat sich
gelegt. Heute sieht man die Möglichkeiten realistischer. Denn nicht alle Komponenten sind unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für den 3D-Druck geeignet, insbesondere beim metallischen 3D-Druck.
Es ist z. B. nicht immer sinnvoll, Guss-, Dreh- oder Blechteile sowie schmiedbare Bauteile, die in großer Stückzahl benötigt werden, zu drucken. Ausnahmen gibt es aber auch hier, beispielsweise wenn das Drehteil aus einer teuren Legierung und das Endprodukt nur noch aus zehn Prozent des Rohmaterials besteht.
Besonders interessant ist der 3D-Druck bei der Produktion von komplexen Komponenten, die Funktionalitäten beinhalten, die mit herkömmlichen Verfahren nicht herstellbar sind. Hier hat KSB zum Beispiel mit dem MagnoProtect einen HightechSpalttopf für Magnetkupplungspumpen


entwickelt, der deutlich effizienter ist als herkömmlich gefertigte Spalttöpfe.
Weitere Anwendungen finden sich im Bereich Ersatzteile und Komponenten. Hier kann eine schnelle Verfügbarkeit bei Verzicht auf Lagerbestände realisiert werden.
Auch Reverse Engineering, also der Nachbau nicht mehr erhältlicher Komponenten, sowie der Prototypenbau sind gute Beispiele für den Einsatz der 3D-Druckverfahren.
Am Ende geht es wie überall immer um die Kosten im Verhältnis zum Nutzen.
Wie waren denn die Reaktionen Ihrer Kunden?
Wie bei allen neuen Technologien gab es anfangs eine gewisse Skepsis gegenüber den gedruckten Bauteilen in Bezug auf die Mater ialeigenschaften und das Werkstoffgefüge. Inzwischen haben wir
gedruckte Komponenten aus Metall in sehr kritischen Anwendungen erfolgreich im Einsatz, zum Beispiel in der heißen Z one im Kernkraftwerk oder im Gefahrenstoffbereich von Chemiewerken.
Die Akzeptanz für das Verfahren ist inzwischen sehr hoch – vor allem bei Kunden aus dem technischen Umfeld, die mit den neuen Möglichkeiten häufig ihre Anlagen weiterentwickeln wollen. Die Managementebene hingegen ist noch deutlich zögerlicher, was den Technologiewechsel angeht. Hierbei geht es häufig nicht um das 3D-Druckverfahren selbst, sondern um die Neuerungen, die die eigenen Techniker damit vornehmen wollen. Das bedeutet in der Regel Investitionen und dafür notwendige Budgets.
Weitere Informationen unter: ksb.de/pod

Fortlane Partners • Brandreport
Oliver Grigat, Managing Director bei Fortlane Partners, im Interview über die wachsende Bedeutung von Robotik, Chancen im M&A-Markt und die strategische Rolle Europas.

Oliver Grigat Managing Director
Herr Grigat, Fortlane Partners berät Industrieunternehmen bei Strategie, M&A und Transformation. Warum steht Robotik aktuell so stark im Fokus? Robotik ist längst kein Zukunftsthema mehr –sie wird zum industriellen Rückgrat Europas. Der globale Wettbewerbsdruck, der Fachkräftemangel und steigende Anforderungen an Präzision und Effizienz machen Automatisierung zur Pflicht. Und genau hier entfaltet Robotik ihr Potenzial – technologisch wie strategisch. Was sind die wichtigsten Branchentrends?
Zum einen die Modularisierung – also die Zerlegung klassischer Roboter in spezialisierte Komponenten: Steuerung, Sensorik, Greifer, Motion, Software. Zum anderen der massive Bedeutungsgewinn von Software als zentrales Wertschöpfungselement. Wer die Steuerung und die Schnittstelle zum Nutzer kontrolliert, gewinnt langfristig den Kunden.
Wer frühzeitig investiert – in Software, in Partnerschaften, in strategische Zukäufe – legt das Fundament für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.
– Oliver Grigat, Managing Director
Welche Rolle spielt Europa in diesem Kontext?
Der deutschsprachige Raum ist trotz stark zunehmender internationaler Konkurrenz noch führend in Robotik-Komponenten, Software und Engineering – aber viele Unternehmen stehen vor einem Generationswechsel oder der Frage: »Wachsen oder verkaufen?« Genau dort kommen wir ins Spiel: als Partner auf Augenhöhe, der M&A mit Branchenlogik und unternehmerischem Blick begleitet.
Ihr Ausblick?
Wie wirkt sich das auf M&A-Aktivitäten aus?
Wir sehen ein stark wachsendes Interesse –besonders an Unternehmen, die modulare Architekturen ermöglichen oder proprietäre Softwarelösungen für Steuerung, Simulation oder Flottenmanagement anbieten. Sowohl Strategen als auch Private-Equity-Fonds suchen gezielt nach Technologie-Assets mit Skalierungspotenzial.
Und wo liegen die Stolperfallen?
Viele technologiegetriebene Firmen unterschätzen den Wert ihres geistigen Eigentums oder können diesen nicht überzeugend darstellen. Käufer achten heute nicht nur auf Umsatz, sondern auf IP, Integrationsfähigkeit
und Zukunftssicherheit. Entscheidender Faktor ist auch die Balance zwischen tiefem Domain-Know-how und Standardisierung entlang der Stakeholder im Ökosystem: In der frühen Phase ist branchenspezifisches Wissen oft der Schlüssel zum Markteintritt. Zwar gab und gibt es in der Automatisierung den Hype um offene Schnittstellen wie OPC UA, doch letztlich liegt der wahre Wert im domänenspezifischen IP. Sobald sich – wie bei SAP – ein Standard etabliert, tritt Industriekompetenz im Kernteam in den Hintergrund und wird von Partnern im Netzwerk bereitgestellt. Wir helfen, diese Dynamiken zu verstehen und strategisch zu nutzen – und das richtige Narrativ für die jeweiligen Käufergruppen zu entwickeln.
Die industrielle Automatisierung wird in den nächsten zehn Jahren mehr Konsolidierung und Innovation erleben als in den vergangenen 30. Wer frühzeitig investiert – in Software, in Partnerschaften, in strategische Zukäufe – legt das Fundament für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit. Wir sehen uns als Brückenbauer in diesem Wandel.
Weitere Informationen unter: fortlane.com

• Prof. Dr.Ing. Martin Ruskowski
Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski
Deutschlands Industrie muss technologisch souverän werden – mit mehr praxisnaher Forschung und den entsprechenden Investitionen. Fordert Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski. Ruskowski ist Vorstandsvorsitzender der SmartFactory Kaiserslautern (SFKL), Lehrstuhlinhaber Werkzeugmaschinen und Steuerungen an der RPTU Kaiserslautern und wissenschaftlicher Direktor des Forschungsbereichs »Innovative Fabriksysteme« (IFS) am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).
Herr Prof. Ruskowski, was ist eine »Smart Factory« und was sind die Chancen, die sich durch sie für Unternehmen ergeben?
Bei der Smart Factory geht es nicht darum, auf eine existierende Fabrikstruktur einfach KI draufzupacken. Eine Smart Factory denkt Produktion ganz anders als heute. Sie ist eine extrem flexible Fabrik, die Maschinen mittels KI besser mit anderen Maschinen und Menschen kommunizieren lässt. Wir arbeiten und forschen an der SFKL dazu seit vielen Jahren. Wenn wir uns hierzulande die standortspezifischen Rahmenbedingungen, sprich die hohen Lohnkosten und die demografische Entwicklung, ansehen, ist eines klar: Wenn wir weiter wettbewerbsfähig produzieren wollen, brauchen wir eine innovative und schlanke Produktion. Ein Ziel muss dabei unter anderem die Automatisierung sämtlicher nicht direkt wertschöpfender Prozesse sein. Das Tempo von Forschungsprojekten ist manchmal so schnell, dass eine Lücke zwischen Forschungsergebnissen und der Umsetzung bei Unternehmen entsteht. Wie lässt sich diese Lücke verkleinern oder gar schließen?
Sicher gibt es eine breite Forschungsförderung, die allerdings nicht oft genug zu konkreten Produktionsverbesserungen in Unternehmen führt. Auch Firmen haben eigene Forschungsprojekte und Innovationsabteilungen. Allerdings hapert es auch hier mit der Umsetzung und die Produktion wird nur zögerlich geändert. Man will ja produzieren und Geld verdienen. Da stört es leider, wenn man Neuerungen einführt oder bestehende Prozesse hinterfragt, um sie umzukrempeln und zu automatisieren. Das Hauptproblem ist die fehlende Vernetzung innerhalb der Unternehmen. Es ist manchmal einfacher, diese Vernetzung von außen herzustellen. Wir als Forschungszentrum bauen diese Brücken bei Firmen, weil wir von außen viel besser andere Themen, die gezielt Innovationen diskutieren, platzieren können. Bei Themen, die im Unternehmens- und Produktionsalltag leider zu kurz kommen, können wir entsprechende Unterstützung anbieten.
Wie schätzen Sie das Zusammenspiel Forschung und Industrie aktuell ein?
Wir brauchen mehr Forschung, die in die Anwendung von Unternehmen gebracht werden kann. Beispielsweise sollte es darum gehen, Software weiterzuentwickeln und Open-SourceSoftware kleineren Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Sehr oft landen Forschungsergebnisse im »Valley of Death«, sie bringen nichts, weil sie auf dem Weg von der Erforschung Richtung Unternehmen praktisch verloren gehen und »sterben«. Das liegt auch an einer fehlenden Finanzierung für die Überbrückung.
Woran hakt es in den Unternehmen selbst?
Die Aufmerksamkeit des Managements ist wichtig. Nur wenn das Management Innovationen will, können sich diese auch durchsetzen. Wenn sie nur die unteren Bereichsebenen einbinden, ist das zu wenig. Die unteren

Ebenen können alleine oft nicht überzeugend agieren und werden dann zwangsläufig ausgebremst. Die Potenziale werden nicht erkannt, geschweige denn ausgeschöpft.
Wie können KMU dabei unterstützt werden, Schritte hin zur Smart Factory zu machen? Welche Rolle spielen dabei Forschungseinrichtungen und staatliche Institutionen?
KMU werden durch die Hürden bei öffentlichen Forschungsprojektbeantragungen oft abgeschreckt. Die Beantragung ist oftmals kompliziert und die Durchführung mit Aufwänden verbunden, für die im Normalbetrieb keine Ressourcen vorgesehen sind. Dabei haben wir gute Erfahrungen mit niedrigschwelligen Angeboten gemacht. Beispielsweise lassen sich viele Ideen in kleineren Firmen hervorragend umsetzen, wenn die Ergebnisse per Open Source allgemein verfügbar gemacht werden, ein Konzept, an dem wir in Kaiserslautern schon lange arbeiten. Mit einer solchen Software können neue Produkte entstehen und sie haben als Unternehmen gleichzeitig die Chance, die freie Software aktiv zu steuern und zu verbessern. Das führt zu einem stabilen Ökosystem, in das sich auch die zentralen Komponenten IT und KI viel leichter und verständlicher integrieren lassen.
Was ist in dem Kontext die größere Herausforderung: Technologieakzeptanz oder die
Bereitschaft, zu investieren? Wie kann diese Hürde adressiert werden? Investitionen rechnen sich grundsätzlich langfristig. Leider denken Unternehmen derzeit extrem kurzfristig. Dieses Problem hat in den letzten ein bis zwei Jahren zugenommen. Jeder möchte den Gewinn maximieren, alles, was geht, aus der bestehenden Produktion herauspressen – auf Kosten der Investitionen und ohne weiterzudenken. Wir müssen endlich wieder mittel- und langfristig denken. Wirkliche Technologieakzeptanz meint eine langfristig angelegte Investitionsbereitschaft.
Welche Schritte müsste die Industrie aktuell tun, um deutsche Innovationen nach vorne zu bringen? Wir müssen wieder an uns glauben und investieren. Die deutsche Wirtschaft dreht sich augenblicklich zu sehr um sich selbst, statt sich aktiv mit der Automatisierung und der Steigerung der Produktivität zu beschäftigen. Natürlich können wir mit den richtigen Innovationen gegen China und die USA bestehen. Das ist für mich überhaupt keine Frage. In Kaiserslautern zeigen wir, dass das geht. Die notwendigen Technologien liegen vor, sind relativ niederschwellig und schnell einsetzbar und bringen sofort Nutzen und Ergebnisse. Deutschland ist absolut wettbewerbsfähig. Ich sage gerne: Unternehmen ist das Gegenteil von Unterlassen. Unternehmen müssen wieder nach vorne
blicken – und aktiv Innovationen angehen, umsetzen und davon dann profitieren.
Welche Herausforderungen sehen Sie bezüglich des Verhältnisses von Mensch und Maschine in der Arbeitswelt?
Zunächst einmal: Automatisierung schafft Arbeitsplätze und vernichtet sie nicht pauschal. Das hat sie noch nie getan. Automatisierung kostet zwar erst einmal Geld, erhöht dann jedoch die Produktivität, die dann wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht. Früher hatten wir komplexe Maschinen und der Mensch musste sich an die Automatisierung anpassen. Heute sind wir in der Lage, Maschinen zu bauen, die sich an den Menschen anpassen. Das bedeutet, dass wir ein Miteinander, ein gemeinschaftliches Arbeiten hinbekommen. Die Kommunikation zwischen menschlicher Arbeit und Automatisierung wird einfacher – etwa durch Software-Agenten, die die Vermittlerrolle zwischen Mensch und Maschine einnehmen und verständliche Transparenz schaffen.
Sie haben in der Vergangenheit im Kontext der Automatisierung vom »Kollegen Roboter« gesprochen. Inwiefern muss sich das Skillset der Arbeitnehmenden in der Industrie verändern? Welche Schritte sind dazu nötig?
Das Entscheidende ist, dass sich die Maschinen auf die Menschen zubewegen. Die menschliche Arbeit wird hochwertiger, weil Routine- und Fleißarbeiten durch Maschinen übernommen werden. Das hat massive Auswirkungen auf die Produktion. Wir merken, dass die Vorbehalte gegen Technik deutlich weniger werden. Wo Menschen im Alltag ständig Technik nutzen, erwarten sie diese Technik auch auf der Arbeit. Eine kluge Automatisierung gibt ihnen die Möglichkeit, mit Maschinen zu kommunizieren – und bringt die sozialen Netzwerke, die wir im Alltag nur für Privates nutzen, in die Fabrik.
Sie sind seit Dezember 2024 Mitglied des Forschungsbeirats Industrie 4.0 von acatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften e.V. Haben Sie ein spezielles Thema, das Sie dort voranbringen wollen? Es ist eine Melange aus Themen, die ich dort nach vorne bringen möchte. Vor allem geht es mir um einen Transfer von Forschungsideen und -resultaten in die Realität. Wir entwickeln zu viele Prototypen, die dann nicht breit eingesetzt werden, es wird zu viel verprobt. Wir sollten mehr praktische Lösungen schaffen – und zwar gemeinsam. Am Beispiel Open Source wird klar, dass keiner alles lösen kann. Wir müssen also an einem Strang ziehen und speziell beim Thema Innovationen und Automatisierung das »Valley of Death« überschreiten.

#smartsmartfactory
Von der Fertigungs- auf die Gewinnerstraße: Angesichts hoher Kosten und zu wenig Fachpersonal werden Fertigungsprozesse nur noch mit Robotern gelingen. Christian Piechnick, CEO von Wandelbots, erläutert, wie Automatisierungssysteme und humanoide Roboter den Wirtschaftsstandort Deutschland retten können.

CEO
Herr Piechnick, wie kann Automatisierung die Kostenund Personalprobleme in der Fertigung lösen?
Angesichts der hohen Lohn- und Fertigungskosten und der vielen bürokratischen Hindernisse schien »Made in Germany« tot zu sein. Auf der anderen Seite gibt es nun aber immer mehr geopolitische Risiken. Also setzen immer mehr Unternehmen auf Reshoring. Gleichzeitig gehen in vielen Unternehmen 5 bis 20 Prozent der Belegschaft in den nächsten Jahren in Rente und aus den geburtenschwachen Jahrgängen kommen nicht genügend Arbeitskräfte nach. Wenn Unternehmen weiter am Markt bestehen wollen, müssen sie mehr Wertsteigerung mit weniger Menschen erreichen. Automatisierung ist die einzige Chance.
Sie sagen, Produktionsstätten müssen intelligent und vernetzt werden, Software ist der Treiber dafür. Wie genau sieht das aus?
Deutschland ist eigentlich bekannt für seine Effizienz. Wir müssen Geräte also in die Lage versetzen, effizienter zu werden. Da haben viele Firmen in den letzten Jahren den Anschluss verpasst. Der große Hebel zur Effizienzsteigerung ist die Digitalisierung mitsamt KI-Tools und den entsprechenden Daten. Unternehmen müssen Daten ihrer Maschinen und der entsprechenden Umgebungen sammeln und verarbeiten. Sie müssen Teil des Industrial Metaverse werden. Durch reine Softwareverbesserungen können sie dann durchschnittlich 15 bis 20 Prozent mehr Produkte herstellen.
AI ist in aller Munde, »Physical AI« der logische nächste Schritt. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Robotik?
Wir sind dafür angetreten, die Robotik zu demokratisieren. Alle sollen Roboter bedienen können. Im Zentrum werden allerdings Roboter stehen, die sich Fähigkeiten aneignen und sich dann an die jeweilige Umgebung, in der sie eingesetzt werden, anpassen. Der Anfang ist bereits gemacht.
Roboter werden vielfältiger. Sie lassen sich auch in 50-Personen-Betrieben flexibel einsetzen, lösen völlig neue Aufgaben und verbessern dank neuronaler Netze ihre Lernfähigkeit. Die Zahl der Roboter wird in den nächsten zehn Jahren explodieren – von weltweit derzeit 4 Millionen auf 400 Millionen. Roboter werden die Welt verändern –das ist eine Riesenchance für Deutschland.
Welche Rolle spielen digitale Zwillinge in der Automatisierung?
Sie sind die Grundlage dafür, dass Roboter lernen können. Simulationen und möglichst realistische Modelle können die Lernprozesse von Robotern unfassbar beschleunigen. Mit vergleichsweise geringem Aufwand können skalierbar Daten generiert werden, die beim Erlernen neuer Fähigkeiten verwendet werden.
Welche Rolle spielen humanoide Roboter und Automatisierungssysteme in der Fertigung der Zukunft?
Ohne Roboter wird es in der Fertigung nicht weitergehen. Denn wenn Sie als Unternehmen bestimmte Volumina nicht mehr liefern können, können Sie einpacken. Aber auch in anderen Bereichen werden humanoide Roboter zum Einsatz kommen, bei Facility-Services, im
Werkschutz oder bei Fahrdiensten. Der Fachkräfte- und Personalmangel wird auch bei den Dienstleistungen durchschlagen. Eigentlich hätte man auch hier die Probleme viel früher angehen müssen. 2026 wird das Jahr sein, in dem wir erste Durchbruchmomente in der Robotik sehen werden. Deswegen sollten Unternehmen jetzt ihre Infrastrukturen umstellen, um mit den richtigen Tools eine Automatisierung und den Einsatz von Robotern vorzubereiten. Die große Vielfalt, die es an Robotern geben wird, der Roboter-Zoo, wird Unternehmen vor neue Managementaufgaben stellen, denen sie heute noch im Greenfield mit einheitlichen Plattformen begegnen können. Idealerweise sollte der Umgang mit Robotern schon in der Schule beginnen.
Weitere Informationen unter: wandelbots.com

apctec GmbH • Brandreport

Paul Bocionek Geschäftsführer
Herr Bocionek, Sie führen eine kleine, fast unsichtbare Firma – und sind gleichzeitig auf LinkedIn eine große Nummer. Wie passt das zusammen? Das liegt an unserer Nische. Wir haben uns auf den 3D-Druck von lebensmittelberührenden Teilen spezialisiert. Also Teile, die direkt in Kontakt mit Lebensmitteln kommen und ganz speziellen Anforderungen genügen müssen.
Welche Anforderungen sind das?
Letztlich dürfen die Bauteile das Lebensmittel in keiner Weise beeinträchtigen – keine ungenießbaren oder gesundheitsgefährdenden Stoffe übertragen. Sie müssen strenge hygienische Standards erfüllen, leicht zu reinigen sein und im Idealfall sogar detektierbar sein, falls sich tatsächlich einmal ein Teil lösen sollte.
Das klingt nicht nach »500-EuroDrucker von Ebay und los gehts«?
Nein, wirklich nicht. Es ist ein sehr fragiles Umfeld, weil spezielles Fachwissen nötig ist, das kaum vorhanden ist. Viele wissen zu wenig oder glauben, sie wüssten genug – und dieses Halbwissen ist nicht gut für den Markt.
Von welchem Halbwissen sprechen Sie?
Für einige genügt es, ein als »lebensmittelecht« deklariertes Material einzusetzen – und schon ist alles gut. Andere wissen, dass dies nicht ausreicht, sind sich aber unsicher, was rechtlich abgesichert verwendet werden kann.
Können Sie das genauer erläutern?
Entscheidend ist die EU-Verordnung 10/2011, die den Lebensmittelkontakt regelt. Ein Materialzertifikat allein reicht nicht aus. Für die Konformität muss alles betrachtet werden. Neben Material auch die Verarbeitung, die Nachbearbeitung und die resultierende Oberflächenbeschaffenheit. Ein raues, poröses Teil kann trotz zertifizierten Ausgangsmaterials unsicher sein, weil sich Bakterien ablagern oder Stoffe leichter migrieren. Nur wenn man Bauteil inklusive Prozess dokumentiert und prüft, lässt sich eine rechtssichere Konformitätserklärung ausstellen.
Wo stößt die Lebensmittelindustrie heute an Grenzen?
Die Lebensmittelindustrie braucht maßgeschneiderte Lösungen. Am Beispiel von Greifern zeigt sich: Die geometrische Freiheit des 3D-Drucks ermöglicht Bauteile, die mit klassischen Verfahren nicht herstel lbar sind. Daraus entstehen dann Lösungen, die die Produktivität deutlich steigern und wirtschaftlich herausragende Ergebnisse erzielen. Allerdings ist dies eben nur bei konsequenter Einhaltung der einschlägigen Normen möglich.

Und wo stehen Sie und Ihre Firma APC-TEC in diesem Kontext? Wir haben uns dieser Herausforderung grundlegend angenommen und bereits vor Jahren begonnen, mit renommierten Prüfinstituten zusammenzuarbeiten. Wir gehören daher zu den wenigen Firmen, die Bauteile fertigen können, die »EU 10/2011«-konform sind und Sicherheit geben. Aber genau dieses Alleinstellungsmerkmal muss der Markt erst verstehen: Es geht nicht um schöne Bauteile, sondern um geprüfte, dokumentierte und rechtssichere Lösungen. Wer sind Ihre Kunden? Vor allem Unternehmen aus der Lebensmittelverarbeitung, dem Anlagenbau und
der Verpackungsindustrie. Diese Betriebe wollen Ersatzteile, Vorrichtungen oder Neuentwicklungen additiv fertigen lassen –sind aber auf Sicherheit angewiesen. Ohne gültige Konformitätserklärung riskieren sie Audits, Rückrufe oder Haftungsfälle. Wir beraten und begleiten von der Konstruktion über die Materialauswahl bis hin zur Herstellung und Dokumentation.
Wohin entwickelt sich das Thema?
Die regulatorischen Anforderungen werden eher strenger, die Industrie gleichzeitig innovativer und flexibler. Additive Fertigung kann in diesem Spannungsfeld enorme Vorteile bieten – etwa bei Ersatzteilen oder nachhaltigen Lieferketten. Unser Ziel ist es, Unternehmen genau dabei zu unterstützen. Oder anders gesagt: Lebensmittelberührende Teile im 3D-Druck? Aber sicher!
Kontakt
info@lebensmittelecht3d.de lebensmittelecht3d.de

ie industrielle Fertigung erlebt derzeit eine Zeitenwende. Globale Lieferketten sind unsicher, Märkte schwanken, technologische Sprünge verändern den Alltag im Werk. Wer in dieser Umgebung bestehen will, braucht mehr als automatisierte Maschinen: Erfolgsentscheidend sind schlanke Prozesse, die Fähigkeit zum schnellen Wandel – und Menschen, die den Transformationsprozess aktiv mitgestalten.
Lean als Fundament – neu interpretiert Lean Management ist keine Neuheit. Bereits seit Jahrzehnten gilt es als Leitprinzip effizienter Produktion. Es sorgt für klare Abläufe, vermeidet Verschwendung und richtet die Fertigung konsequent am Kundennutzen aus. Doch in der modernen Industrie erhält Lean eine digitale Erweiterung. Sensoren und IoT-Systeme machen Wertströme in Echtzeit sichtbar, KI-gestützte Analysen decken Muster auf und helfen, Probleme schneller zu lösen.
Beispiele aus der Praxis zeigen, dass diese Kombination messbare Effekte hat: Unternehmen, die Lean-Methodik mit digitalen Tools verbinden, reduzieren ihre Durchlaufzeiten, senken Bestände und erhöhen die Flexibilität – ein entscheidender Vorteil in volatilen Märkten.
Schnelligkeit als Wettbewerbsfaktor Reaktionsfähigkeit ist heute ein Muss. Ob ein Zulieferer kurzfristig ausfällt, ein plötzlicher Nachfrageschub entsteht oder regulatorische Vorgaben angepasst werden – wer nicht schnell umsteuern kann, verliert Marktanteile. Methoden wie Quick-Response-Manufacturing oder Rüstzeitreduzierung nach dem SMED-Prinzip helfen, Produktionsprozesse agiler zu machen.
Digitalisierung verstärkt diesen Effekt: Leitstände, die Lieferketten und Produktionslinien in Echtzeit abbilden, ermöglichen kurzfristige Anpassungen. Damit lassen sich Schwankungen besser abfangen und
Frühzeitige Kommunikation, kontinuierliche Qualifizierung und eine klare Vision schaffen Vertrauen und Akzeptanz. Change-Management ist damit kein Begleitprogramm, sondern ein zentraler Werttreiber.
Engpässe schneller beheben. Geschwindigkeit wird so zu einem strategischen Vorteil.
ChangeManagement – der unterschätzte Erfolgsfaktor Technologie allein reicht nicht. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass rund 70 Prozent aller Veränderungsinitiativen scheitern – nicht, weil das Konzept falsch ist, sondern weil Mitarbeitende nicht ausreichend eingebunden werden. Laut Prosci erreichen dagegen 88 Prozent der Projekte mit starkem Change-Management ihre Ziele.
Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Belegschaften
in den Wandel mitnehmen. Frühzeitige Kommunikation, kontinuierliche Qualifizierung und eine klare Vision schaffen Vertrauen und Akzeptanz. Change-Management ist damit kein Begleitprogramm, sondern ein zentraler Werttreiber.
Praxisbeispiel: smarte Fertigung Wie dieser Ansatz in der Praxis wirkt, zeigt eine Bäckerei in Australien, die im letzten Jahr eine hochmoderne Fertigungshalle eröffnet hat. Mithilfe von KI, autonomen Fahrzeugen und kollaborativen Robotern konnte die Produktionskapazität verdoppelt werden. Gleichzeitig entstanden neue Arbeitsplätze, weil Mitarbeitende in
Es geht um eine Produktion, die effizient, resilient und zugleich menschenzentriert ist.
digitalen Kompetenzen geschult wurden und anspruchsvollere Aufgaben übernahmen.
Das Beispiel beweist, dass Digitalisierung nicht zwangsläufig Rationalisierung bedeutet. Im Gegenteil: Wenn Technologie gezielt eingesetzt wird, können Unternehmen produktiver werden und gleichzeitig Perspektiven für ihre Mitarbeitenden schaffen.
Industrie 5.0 – der Mensch im Mittelpunkt Während die Industrie 4.0 vor allem auf Automatisierung und Vernetzung setzt, rückt Industrie 5.0 den Menschen wieder in den Fokus. Es geht um eine Produktion, die effizient, resilient und zugleich menschenzentriert ist. Technologie soll nicht ersetzen, sondern unterstützen.
Für Unternehmen bedeutet das: Weiterbildung wird zum zentralen Faktor, Ergonomie am Arbeitsplatz gewinnt an Bedeutung und digitale Kompetenzen werden systematisch gefördert. Wer in diese Felder investiert, stärkt nicht nur die Produktivität, sondern auch die Loyalität der Mitarbeitenden.
Der Dreiklang für die Zukunft Beratung, Change-Management und schlanke Prozesse sind heute untrennbar miteinander verbunden. Lean bleibt das Fundament, Digitalisierung macht es schneller und flexibler, und Change-Management sorgt dafür, dass der Mensch zentral bleibt.
Die Smart Factory entsteht nicht allein durch Technologie, sondern durch das Zusammenspiel von Prozessen, Organisation und Kultur. Ziel soll sein, diese drei Elemente zu vereinen, um nicht nur effizienter zu produzieren, sondern auch resilienter auf Veränderungen zu reagieren – und damit langfristig erfolgreich zu sein.
Die Smart Factory braucht mehr als Technologie. Sie braucht Führungskräfte mit digitaler Kompetenz, Veränderungskraft und Resilienz. Dr. Frederik Gottschalck, Partner und Director Executive Search bei Kienbaum, beschreibt, warum diese Future Skills heute und morgen entscheidend sind.

Dr. Frederik Gottschalck Partner und Director Executive Search
Herr Gottschalck, wenn deutsche Produktionsunternehmen an Industrie 4.0 denken, reden alle über Technologien. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen aus Sicht von Führung und Talent? Technologien sind verfügbar. Was wir im Executive Search tagtäglich sehen: Die eigentliche Knappheit liegt nicht bei Robotik, KI oder Automatisierung, sondern bei den Führungskräften, die Technologie, Organisation und Menschen verbinden können. Laut Bitkom-Studie setzen zwar bereits über 40 Prozent aller deutschen Unternehmen KI in der Produktion ein, aber ebenfalls über 40 Prozent berichten über fehlende Expertise. Ohne die Brücke zwischen Maschine und Mensch bleibt jede Investition in die Smart Factory Stückwerk.
Welche Eigenschaften unterscheiden diese gefragten Führungskräfte konkret von den klassischen Technikmanagern?
In den vergangenen Jahren hat sich das Anforderungsprofil an Führungskräfte deutlich verschoben. Gefragt sind heute weniger die rein technisch geprägten Manager mit Prozessfokus, sondern Führungspersönlichkeiten, die technologische Exzellenz mit L eadership-Skills verbinden und zugleich agil in hybriden Umgebungen arbeiten können. Besonders nachgefragt sind drei Dimensionen: Erstens natürlich digitale Kompetenz – also ein klares Verständnis für Daten, künstliche Intelligenz und Automatisierung. Zweitens Change- und Kulturkompetenz – die Fähigkeit, Transformation voranzutreiben und Belegschaften mitzunehmen. Und drittens Resilienz und strategische Weitsicht – Eigenschaften, um schnell zu adaptieren und Unsicherheit zu steuern. Diese Future Skills entwickeln sich zunehmend zur neuen Währung. Laut World Economic Forum werden 44 Prozent der heute relevanten Kompetenzen in den nächsten fünf Jahren durch Technologie- und Marktveränderungen disruptiert – Leadership-Profile müssen diese Dynamik antizipieren.

Wie können Unternehmen im hart umkämpften Markt sicherstellen, dass sie diese Talente nicht nur gewinnen, sondern auch langfristig binden? Unternehmen gewinnen und halten Mitarbeitende, wenn sie klar definierte, messbare Rollenprofile mit echtem Gestaltungsspielraum und Sichtbarkeit im Top-Management bieten. Bindung entsteht in dem Umfeld durch kontinuierliche Weiterbildung in Daten- und KI-Kompetenzen, skillbasierte Karrierepfade mit interner Mobilität sowie eine faire, erfolgsorientierte Vergütung. Unternehmen, die gezielt in Skills und die Balance von Mensch-, Technologie- und Organisationsinvestitionen gehen, sind nachweislich widerstandsfähiger – und attraktiver für Führungskräfte.
Warum bleibt Technologie ohne die passenden Führungskräfte wirkungslos?
Die Smart Factory wird nur dann erfolgreich, wenn Führungskräfte die Brücke schlagen zwischen Robotik, KI und Automatisierung einerseits und Menschen, Organisation und Kultur andererseits. Im Executive Search sehen wir täglich, wie die Nachfrage nach genau diesen Future Skills rapide steigt. Wer jetzt auf Führungskräfte setzt, die digitale Kompetenz, Transformation Skills und Resilienz vereinen, wird die Smart Factory nicht nur betreiben, sondern gestalten und sich damit den Vorsprung für die Zukunft sichern.
Weitere Informationen unter: knbm.net/sf25
Augmented Industries • Brandreport
Der Fachkräftemangel hält an. Gerade in der Smart Factory sind hoch qualifizierte Technikfachkräfte gefragt. Wie Unternehmen ihre Belegschaft mithilfe von KI gezielt befähigen, erklärt Dr. Elisa Roth, Geschäftsführerin der Augmented Industries GmbH.

Dr. Elisa Roth Geschäftsführerin
Frau Dr. Roth, warum fokussieren Sie sich auf das Thema Workforce? Je komplexer die Automatisierung, desto anspruchsvoller sind Inbetriebnahme, Wartung und Optimierung – bekannt als »Ironie der Automatisierung«. Wer eine Maschine bedient, übernimmt schon heute zunehmend mehr Instandhaltungsaufgaben. In der Automobilindustrie etwa müssen Mitarbeitende selbst Roboterzellen betreten und Schweissköpfe tauschen – für viele eine ungewohnte, respekteinflössende Verantwortung.
Welches Knowhow braucht die Smart Factory von morgen? Um Kosten zu senken und gleichzeitig Prozessinnovationen zu fördern, müssen mehr Operators auf das Niveau von Technikfachkräften gebracht werden. Routineaufgaben werden automatisiert. Gefragt sind Kenntnisse in komplexer Elektronik, Hydraulik, Pneumatik, Sensorik, HMIs,
Wir setzen auf einen KI-gestützten Ende-zu-EndeWorkflow.
– Dr. Elisa Roth, Geschäftsführerin
Steuerungstechnik – und zunehmend auch KI. Je breiter das Wissen, desto schneller lassen sich Probleme lösen und Stillstände verkürzen.
Die Anforderungen an die Belegschaft steigen. Was ist Ihr Ansatz mit Augmented Industries?
Ja – und das ist gut so, wenn wir weltweit führend in Advanced Manufacturing bleiben wollen. Wir setzen auf einen KI-gestützten Ende-zu-Ende-Workflow, der Wissensmanagement, digitale Werkerführung und Training integriert. Das Ziel ist, mit dem Menschen im Mittelpunkt Stillstandsund Qualitätskosten zu minimieren.
Haben Sie ein Beispiel für diesen Workflow?
Bei einer Linienverlagerung erfasst das System zunächst Prozessdokumentationen, hier unterstützen wir bei Bedarf. Die KI erstellt daraus interaktive Lernmodule, die das neue Team am Zielort in der Zwischenzeit absolvieren kann. Skill-Checks zeigen, ob zusätzliches Training in Bereichen wie Hydraulik nötig ist. Während der Montage vor Ort liefert ein Chatbot gezielt Informationen aus der vielschichtigen technischen Dokumentation, inklusive Schaltplänen oder CAD-Dateien. Für den Betrieb erstellt die KI eine digitale Schritt-für-Schritt-Anleitung – künftig sogar für verschiedene Produktvarianten. Feedback zu neuen Problemlösungsansätzen im Alltag und neues Wissen fliessen direkt zurück ins System.
Wie begeistern Sie Mitarbeitende für KI-Innovation – gerade in Zeiten von Kurzarbeit?
Die Belegschaft erlebt den Nutzen von KI täglich, etwa durch ChatGPT. Unternehmen, die KI nicht nutzen, werden abgehängt – das versteht auch die Belegschaft. Wichtig ist, echte Erfolgserlebnisse zu schaffen und die Kontrolle bei den Mitarbeitenden zu verankern. Wenn Mitarbeitende in der Instandhaltung dank einem Chatbot 15 Minuten bei der Dokumentensuche sparen, entsteht Vertrauen. Auch die visuelle Montageverifizierung durch KI wird

erst nach der Expertenfreigabe produktiv eingesetzt. Diese Co-Kreation schafft Akzeptanz und Q ualität. Mit der neuen ISO 42001 für KI-Management sichern wir diese Standards ab.
Weitere Informationen unter: augmented-industries.de


Eine einzige Störung genügt und ganze Produktionslinien stehen still. Pandemie, Krieg oder blockierte
Transportwege – die Liste möglicher Gefahren wächst. Resiliente Supply-Chains und eine kluge Intralogistik sind gefragter denn je. Doch welche Strategien machen den Unterschied zwischen Stillstand und Wettbewerbsfähigkeit? Die Suche nach Antworten führt mitten hinein in das Zusammenspiel von globaler Versorgungssicherheit und smarter Logistik im Inneren der Fabrik.
Globale Risiken für die Versorgungssicherheit
Unternehmen bewegen sich in einem Spannungsfeld aus steigender Komplexität und zunehmender Unsicherheit. Lieferketten verlaufen über mehrere Kontinente, Z ulieferer sind oft hoch spezialisiert und Transportwege können durch geopolitische Ereignisse blockiert werden. Beispiele reichen von blockierten Seewegen wie im Suezkanal über Embargos bis hin zu Rohstoff-Engpässen infolge von Kriegen oder politischen Sanktionen. Hinzu kommen Effekte des Klimawandels, die Wetterextreme wahrscheinlicher machen und damit sowohl Transportinfrastruktur als auch Produktionsstätten gefährden.
Strategien für resiliente SupplyChains Resilienz bedeutet nicht, Risiken vollständig auszuschalten – das ist unmöglich. V ielmehr geht es darum, die Widerstandskraft der Supply-Chain zu erhöhen. Dafür existieren verschiedene Ansätze:
1. Diversifizierung von Lieferanten: Unternehmen reduzieren Abhängigkeiten, indem sie mehrere Zulieferer für kritische Materialien aufbauen. Nearshoring und Friendshoring gewinnen dabei an Bedeutung, um Lieferwege zu verkürzen und politisch stabile Regionen einzubeziehen.
Lieferketten verlaufen über mehrere Kontinente, Zulieferer sind oft hoch spezialisiert und Transportwege können durch geopolitische Ereignisse blockiert werden.
2. Transparenz und digitale Vernetzung: Digitale Plattformen und SupplyChain-Management-Systeme schaffen durchgängige Transparenz. Sie ermöglichen Echtzeit-Tracking von Materialien, schnelle Reaktionsfähigkeit bei Störungen und datenbasierte Prognosen.
3. Lag erstrategien und Sicherheitsbestände: Das fr ühere Paradigma »Just in Time« stößt an Grenzen. Unternehmen prüfen wieder verstärkt die Bildung von Pufferbeständen oder regionalen Zentrallagern, um unvorhersehbare Engpässe abzufedern.
4. Kooperation und Partnerschaften: Eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten und Logistikdienstleistern steigert die Resilienz. Wer langfristige, vertrauensvolle Beziehungen pflegt, kann im Krisenfall schneller Lösungen finden.
Die Rolle der Intralogistik Während sich viele Diskussionen auf globale Lieferketten konzentrieren, ist die Intralogistik –also die interne Materialversorgung innerhalb der Fabrik – ein ebenso entscheidender Faktor. Denn selbst wenn die Materialien rechtzeitig am Werkstor eintreffen, entscheidet die interne Logistik über die tatsächliche Produktionsfähigkeit.
Die geopolitische Lage wird auch in Zukunft volatil bleiben. Unternehmen müssen deshalb Resilienz als Daueraufgabe verstehen.
– Automatisierte Systeme wie fahrerlose Transportsysteme (FTS) oder autonome mobile Roboter sorgen dafür, dass Materialien zuverlässig und flexibel an die Montagelinien gelangen.
– Digitale Steuerungssysteme vernetzen Lager, Fertigung und Transportmittel miteinander. So lassen sich Engpässe frühzeitig erkennen und Routen dynamisch anpassen.
– Ergonomische und effiziente Materialbereitstellung erhöht die Produktivität und reduziert Fehler.
Die Intralogistik trägt damit maßgeblich zur Stabilität des gesamten Produktionsprozesses bei und wird zunehmend als strategischer Wettbewerbsfaktor verstanden.
Geopolitische Dimension und Zukunftstrends
Die geopolitische Lage wird auch in Zukunft volatil bleiben. Unternehmen müssen deshalb Resilienz als Daueraufgabe verstehen. Künstliche Intelligenz wird eine zentrale Rolle spielen, um Risiken zu bewerten, Szenarien zu simulieren und Entscheidungen zu unterstützen. Auch Nachhaltigkeitsthemen wie CO2Reduktion oder Kreislaufwirtschaft beeinflussen die Gestaltung von Supply-Chains: Wer Materialien recycelt oder lokal sourct, macht sich unabhängiger von globalen Störungen. Resiliente Supply-Chains sind mehr als nur ein Schlagwort. Sie bilden die Grundlage für einen gesicherten Materialfluss – sowohl auf globaler Ebene als auch innerhalb der Fabrik. Wer frühzeitig in Transparenz, Diversifizierung, digitale Tools und smarte Intralogistik investiert, kann die Auswirkungen globaler Krisen abmildern und bleibt in turbulenten Zeiten handlungsfähig.
Text Aaliyah Daidi

Harry Stiastny Head of Corporate Logistics, Gebrüder Weiss
Ein wichtiges Bauteil bleibt aus, die Produktion steht, aber der Notfallplan fehlt – die multiplen Krisen der vergangenen Jahre haben vielen Unternehmen die Verwundbarkeit ihrer Lieferketten vor Augen geführt. Resilienz ist deshalb für Supply-ChainVerantwortliche zu einem zentralen Thema geworden. Aber wie lassen sich Lieferketten widerstandsfähiger gestalten? Antworten liefert Gebrüder Weiss. Der internationale Logistiker ist seit über 500 Jahren im Transportgeschäft, setzt weltweit komplexe Logistiklösungen um und entwickelt innovative Strategien für das Supply-Chain-Management (SCM). »Im Dialog mit unseren Kunden denken wir Lieferketten neu, identifizieren Schwachstellen und erstellen konkrete Maßnahmenpläne, um Störungen frühzeitig zu erkennen und zu lösen«, erklärt Harry Stiastny, Head of Corporate Logistics bei Gebrüder Weiss. Dabei geht es nicht nur um kurzfristige Lösungen, sondern um den Aufbau nachhaltiger Strukturen für die Zukunft. Denn Disruptionen sind heute keine Ausnahme mehr, sondern ein fester Bestandteil unternehmerischer Realität. Das setzt strategische Anpassungsfähigkeit voraus.

Aber nicht nur Resilienz spielt eine wichtige Rolle, damit Unternehmen nachhaltig und wirtschaftlich agieren können, sondern auch Transparenz und Effizienz .
Individuelle Lösungen für jede Herausforderung
Aber nicht nur Resilienz spielt eine wichtige Rolle, damit Unternehmen nachhaltig und wir tschaftlich agieren können, sondern auch Transparenz und Effizienz. Das SCMKonzept von Gebrüder Weiss ist gezielt auf diese drei Säulen ausgerichtet und bietet umfangreiche Services, die sich flexibel nach dem Baukastenprinzip kombinieren lassen.
Ob Beratung, Datenanalyse, digitale Services, die Rolle des Lead-Logistics-Providers oder operative Transport- und Logistikaufgaben –alles ist möglich. Dabei bleibt das Ziel stets dasselbe: die besten Supply-Chain-Lösungen zu entwickeln und so den langfristigen Erfolg der Kunden zu sichern. »Individuelle Anforderungen erfordern maßgeschneiderte Lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir belastbare und effiziente Lieferketten, die auch zukünftigen Herausforderungen standhalten«, so Harry Stiastny.
Mehr über das Supply-Chain-Management von Gebrüder Weiss erfahren:
Opitz Consulting • Brandreport
scheitern – und wie KI den
Unternehmen investieren Millionen in Digitalisierung und treten dennoch oft auf der Stelle. Besonders in der Automotive-Branche zeigt sich: Ohne klaren Plan bleibt die Smart Factory eine Vision. Christoph Pfinder, Branchenexperte bei Opitz Consulting, erklärt, warum viele Projekte scheitern und wie Digital Twins und künstliche Intelligenz den Durchbruch bringen können.

Christoph Pfinder Branchenexperte
Herr Pfinder, die Smart Factory ist in aller Munde. Warum der Hype?
Weil wir uns mitten in einem digitalen Dilemma befinden: Unternehmen investieren hohe Budgets und scheitern trotzdem. Der Grund? Es fehlt der Plan. Technologien für digital-Twin-basierte und KI-gestützte Produktion sind marktreif. Doch ohne strategischen Fokus verpufft ihr Potenzial. Wer klug handelt, schafft sofort echten Mehrwert.
Was heißt »strategischer Fokus« konkret?
Nicht gleich das ganze Werk digitalisieren, sondern gezielt einen Engpass lösen, etwa schwankende Prozesse oder Ausfälle. Digital Twins und KI sind hier Gamechanger: Sie simulieren Szenarien, erkennen Abweichungen und ermöglichen datenbasierte Entscheidungen.
Haben Sie ein Beispiel?
Nehmen wir eine Fertigungslinie: Ein digitaler Zwilling bildet den Prozess virtuell ab. KI
Technologien für digital-Twinbasierte und KI-gestützte Produktion sind marktreif.
– Christoph Pfinder, Branchenexperte
erkennt Schwachstellen und testet Optimierungen ohne Eingriff in die reale Produktion. Das Ergebnis: weniger Ausschuss, stabilere Abläufe, kürzere Rüstzeiten. Oder die vorausschauende Qualitätskontrolle: KI entdeckt Abweichungen, bevor fehlerhafte Teile entstehen.
Also lieber punktuell statt flächendeckend?
Genau. Wer zehn Use-Cases startet, verliert den Überblick. Wer dagegen einen gezielten Digital-Twin- oder KI-Case auswählt, sieht
schnell messbare Ergebnisse. Das schafft Vertrauen und ebnet den Weg zur nächsten Stufe.
Wie findet man den richtigen Startpunkt?
Drei Fragen sind entscheidend:
1. Relevanz: Wo liegt der größte Hebel?
2. Machbarkeit: Sind Prozesse stabil und Daten verfügbar?
3 Wertbeitrag: Lassen sich Kosten oder Qualität messbar verbessern?
Wenn alle drei erfüllt sind, hat man den idealen Einstieg.
Warum bleiben viele Projekte im Pilotstatus stecken?
Weil Skalierung fehlt. Ein Digital Twin muss so konzipiert sein, dass er auf andere Linien übertragbar ist. Und: Die Mitarbeitenden sind der Schlüssel. Wer versteht, dass KI unterstützt statt ersetzt, akzeptiert sie auch.
Was raten Sie Unternehmen?
Erst eine Standortanalyse: Wo sind kritische Prozesse, wo hohe Ausschussraten? Dann prüfen, ob Daten vorliegen – ohne Daten kein sinnvoller KIEinsatz. Anschließend einen Use-Case wählen, der wirklich schmerzt, und ihn sauber umsetzen. Sobald Ergebnisse sichtbar sind, wächst das Vertrauen. So entsteht Schritt für Schritt eine Smart Factory, die nicht nur digital ist, sondern wirtschaftlich sinnvoll.
Die Smart Factory ist kein ferner Traum. Wer jetzt den richtigen UseCase wählt, kann schon morgen spürbare Effizienzgewinne erzielen.
Weitere Informationen unter: opitz-consulting.com/automotive

Christoph Pfinder ist Solutions Manager für Industry & Automotive bei Opitz Consulting. Mit über 20 Jahren IT-Erfahrung unterstützt er Unternehmen dabei, digitale Transformation und Smart-Factory-Projekte erfolgreich umzusetzen – praxisnah, strategisch und zukunftsorientiert.
christoph.pfinder@opitz-consulting.com
Als jüngste Business Unit der Bowe Group bietet Bowe Move autonome mobile Roboterlösungen (AMR) für die Intralogistik. Wolfgang Wagner, Director Business Unit Mobile Robotic, erklärt, wie die AMR-Flotte von Bowe Move den innerbetrieblichen Transport automatisiert und optimiert.

Wolfgang Wagner Director Business Unit Mobile Robotic
Herr Wagner, die Idee der fahrerlosen Transportsysteme ist nicht neu und ist mit den spurgeführten Geräten bereits seit Jahrzehnten im Feld. Wie schätzen Sie den aktuellen Markt ein? Wir sprechen mit vielen Unternehmen über ihre Intralogistik und wir sehen, dass vor allem die Automobilindustrie sehr weit vorangeschritten ist. Gleichzeitig nehmen andere Branchen jetzt Fahrt auf. Insbesondere die Logistikbranche, aber auch die Lebensmittelproduktion oder produzierende Unternehmen. Wo man auch hinschaut, überall müssen Transportwagen manuell geschoben oder gezogen werden –personalintensiv und ergonomisch herausfordernd. Daher suchen alle händeringend nach Automatisierungslösungen für diese massiv manuell geprägten Materialflüsse. Vieles wird heute schon mit autonomen
Brandreport • Inverto GmbH
Unterfahr-AMRs oder Staplern transportiert, aber wenn es um Transportwagen geht, gibt es wenige Lösungen am Markt. Warum gibt es so wenige Lösungen? Wir sehen drei große Herausforderungen für Automatisierungslösungen in diesem Bereich. Zum einen sind Transportwagen innerhalb eines Betriebs häufig in großer Stückzahl im Einsatz und werden auch werksübergreifend eingesetzt. Jedoch gibt es in Summe eine sehr große Variation an Wagenbauformen und viele unternehmensspezifische Lösungen, die mit Blick auf manuelle Prozesse optimiert wurden. Zum anderen sind Wagen häufig in sehr dynamischen, sich verändernden Umgebungen im Einsatz. Stellen Sie sich beispielsweise den Wareneingang eines Logistikzentrums vor, in dem viele Lkw ankommen und Wagen ein- und ausgelagert werden. Solche Bedingungen stellen viele AMR vor die Herausforderung, dass zu wenige gleichbleibende Referenzpunkte für eine zuverlässige Navigation verfügbar sind. Gleichzeitig ist die Arbeit rund um den Transport der Wagen, zum Beispiel beim Beladen, noch sehr manuell. Die Wagen lassen sich auf ihren Rollen nur schwer genau positionieren. Das führt dazu, dass die Positionierung an den Übergabestellen zum automatisierten Transport für viele Systeme fehleranfällig sind. Und genau hier setzen wir an.

Sie haben dennoch zwei TuggerAMR, den TugBot und den FlexxBot, für den Transport von Wagen im Einsatz. Wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen um? Dieser anspruchsvollen Aufgabe stellen wir uns, weil wir damit echte Kundenprobleme lösen können. Wir haben unsere AMR auf die speziellen Anforderungen mit Fokus auf Vielfalt und Dynamik des Brownfields ausgelegt. So nutzen wir z. B. 3D-LiDAR-Sensoren, um im Gegensatz zur 2D-LiDAR-Navigation dreidimensionale Daten für die Lokalisierung im Raum heranzuziehen. Auf diese Weise können sich unsere AMR sogar in Umgebungen mit bis zu 85 Prozent geändertem Layout zuverlässig orientieren. Des Weiteren erkennen unsere AMR die 3D-Position von Ladungsträgern und können zuverlässig auch ungenau abgestellte Wagen aufnehmen. Mit Blick auf die Bauformen haben wir verschiedene Greifmodule, die mit kleinen
Anpassungen an den Kundenwagen angepasst werden können. Und wenn das mal nicht passt, entwickeln wir für den Kunden auch spezifische Greiflösungen. Unser Ziel ist es, Kunden eine Komplettlösung für den eigenen Prozess bereitzustellen, ein cleveres Zusammenspiel aus passenden smarten AMR, dynamischem Flottenmanagement sowie einer Steuerung über den gesamten Materialfluss inklusive WMS und AssetManagement. Im Brownfield existieren oft schon viele Teillösungen, wo wir mit unseren Produkten im Bereich AMR und Software gerne, auch mit Ergänzungen, Mehrwert schaffen wollen.
Weitere Informationen unter: bowe.com/move

Patrick Lepperhoff Managing Director und Co-Lead Center of Excellence Supply Chain Management & Resilience
In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kommt es darauf an, Kundenbedürfnisse zu erfüllen und jederzeit Liquiditätsreserven zu haben. Das gelingt durch die Verzahnung von Sales & Operations mit dem Einkauf, erläutert Patrick Lepperhoff, Managing Director und Co-Lead des Centers of Excellence Supply Chain Management & Resilience bei Inverto. Herr Lepperhoff, warum werden bessere Arbeitsabläufe und kürzere Lagerzeiten für Unternehmen immer wichtiger? Überdimensionierte Lagerbestände kann sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten niemand leisten. Egal ob es um den Handel, Halbfertigerzeugnisse oder Ersatzteile geht. Es gibt oft nur eine ungenaue Planung und ein unpräzises Forecasting, häufig auch unabgestimmt zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Früher sah man den Bestand als Lösung, um auch in schlechten Zeiten gut agieren zu können. Doch bei steigenden Zinsen und schwacher Konjunktur ist das riskant, weil dadurch viel Kapital gebunden ist.
Unternehmen, die crossfunktional denken und planen, haben bessere Prozesse und ein ganz anderes Verständnis von Dynamik .
– Patrick Lepperhoff, Managing Director und Co-Lead Center of Excellence Supply Chain Management & Resilience
Darüber hinaus werden die zugrunde liegenden Schwachstellen häufig nicht strukturiert erfasst und konsequent angegangen. Viele Unternehmen fokussieren ihr Tagesgeschäft und schieben die strategischen Themen im Alltagsstress beiseite. Dazu gehört auch die bereichsübergreifende Bestands- und Bedarfsplanung. Welche Bereiche bezieht »Sales & Operations Planning« (S&OP) in die Optimierungsplanung ein? S&OP fokussiert alle Bereiche, von Marketing und Vertrieb über die Produktion bis zum Einkauf. Es geht darum, aus den gegebenen Faktoren, wie etwa Produktionskapazität, verfügbaren Input-Materialien, Lagerbeständen und dem Marktbedarf, das optimale Betriebsergebnis zu generieren. Dabei müssen verschiedene Parameter berücksichtigt werden, um die richtigen Produkte zu priorisieren, eine hohe Produktionsauslastung und angemessene Lagerbestände zu realisieren. So können auch bewusste
Entscheidungen hinsichtlich des benötigten Working-Capitals getroffen werden. Unternehmen sollten dazu ihre strategischen Ziele mit den Produktionskapazitäten und den Kundenwünschen abgleichen. Ziel ist ein abgestimmter Plan, der in die Aktivitäten der einzelnen Bereiche des Unternehmens herunterkaskadiert wird.
Sie haben einen monatlichen, fünfstufigen Prozess entwickelt, der mehrere Quartale im Voraus plant. Wie sieht der aus?
Das ist ein Prozess für eine effektive Nachfrage- und Angebotsplanung. Er beginnt bei der Bedarfsplanung aus Vertriebssicht, scannt den Beschaffungsbedarf, inklusive strategischem Einkauf und zu verhandelnden Volumina, und tariert dann die eventuellen Lücken aus. Was kann ich über die eigene Fertigung regeln, welche Vorprodukte brauche ich, was muss ich über andere Quellen besorgen? Schließlich gibt es die »Executive S&OP«, um die finale
Entscheidung zu fällen, wie viel und welche Waren produziert werden sollen und wie der Einkauf angepasst werden muss. Auch für mittelfristige Investitionsentscheidungen, etwa zusätzliche Produktionskapazitäten, bietet der S&OP-Prozess eine der relevanten Grundlagen.
Mittelfristig führt diese optimierte Bestands und Lagerverwaltung nicht nur zu einer höheren Lieferfähigkeit, sondern auch zu mehr Resilienz? Absolut. Unternehmen, die crossfunktional denken und planen, haben bessere Prozesse und ein ganz anderes Verständnis von Dynamik. Wenn die vorhandenen Daten vernetzt und zusätzlich mit künstlicher Intelligenz analysiert werden, wird die Entscheidungsbasis immer besser, beispielsweise auf Basis von historischen Mustern, die in zukünftige Planungen einfließen. Darüber hinaus sind der Abgleich der Planung mit dem tatsächlichen Ergebnis, aber auch die Analyse der Abweichungen wichtige Bestandteile, um die Forecast-Genauigkeit zu erhöhen.
Weitere Informationen unter: inverto.com
Strategien für das Zeitalter der Intelligenz: Intelligenz effizient einsetzen und sie zur treibenden Kraft für die Umgestaltung des Unternehmens machen.

Sebastian Diers Managing Director DACH
Für die derzeitige starke Zunahme von Komplexität, Dynamik und Heterogenität sind sechs große Trends verantwortlich: Erstens die »Auflösung« globaler Frameworks, durch die viele Faktoren nicht als stabil betrachtet, sondern strategisch aktiv berücksichtigt werden müssen. Zweitens die Parallelisierung von Trends, die somit nicht hintereinander bearbeitet werden können. Drittens eine Verkürzung der Zeiträume, die für Entscheidungen zur Verfügung stehen – bei gleichzeitig niedriger Prognosequalität und hohem Innovationsbedarf. Viertens die Notwendigkeit, in schwer vorhersagbaren Zeiten mit Herausforderungen von großer zeitlicher und inhaltlicher Dimension umzugehen: Dies umfasst Themen wie geopolitische Veränderungen, Klima, Demografie, Deglobalisierung, den Umbau der Energieversorgung oder die industrielle Transformation. Fünftens die Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung sowie sechstens der Verlust des Common Sense auf unterschiedlichen Ebenen.
»Wir beobachten, dass diese Veränderungen die Unternehmen vielfach unvorbereitet treffen. Die vorhandenen Prozesse, Werkzeuge und Fähigkeiten sind einfach nicht gut genug, um schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Wenn Komplexität und Dynamik in einem solchen Ausmaß zunehmen, wird Intelligenz zur kritischen und knappen Ressource. Das ist durchaus ein Paradigmenwechsel«, erklärt Sebastian Diers, Managing Director der Efeso Management Consultants in der DACH-Region.
Efeso zählt mit rund 1000 Mitarbeitenden an über 35 Standorten zu den führenden Operations-Beratungen mit Fokus auf integrierte Optimierung und Weiterentwicklung von Technologien, Prozessen, Produktkosten, Systemen und Supply-Chains. »In Zukunft wird Intelligenz den Unterschied machen. Deshalb müssen sich Unternehmen intensiv mit dem Konzept der Intelligenz beschäftigen und nach Wegen suchen, um ihre Entscheidungsprozesse, Produktionsstrukturen und Wertschöpfungsnetzwerke smart, adaptiv und kreativ zu gestalten. Und natürlich geht es auch um die Frage, wie datenbasierte Technologien, insbesondere die künstliche Intelligenz, diese Entwicklung unterstützen und beschleunigen können. ROI bedeutet künftig Return on Intelligence – wenn es uns gelingt, die Intelligenz zur treibenden Kraft für die Transformation und Weiterentwicklung in der Industrie zu machen. Genau dabei unterstützen wir unsere Kunden«, so Diers.
Das Zeitalter der Intelligenz: Wie man in einer Welt im Chaos handlungsfähig bleibt.
Um den Return on Intelligence zu steigern, ist es nötig, Systeme und Maschinen intelligent zu machen. Denn die veraltete Ausrüstung vieler produzierender Unternehmen ist nicht mehr auf die schnellen Technologiezyklen und disruptiven Marktumbrüche adaptierbar und wird zu einem zunehmend kritischen Engpassfaktor. Ohne smarte Produktionskonzepte und digitale Initiativen ist die Gestaltung eines Footprints der

Anstatt von einem vorbestimmten Endzustand aus zu planen, sollte der Schwerpunkt auf dem nächsten relevanten Schritt liegen. Dies erfordert den Wechsel von einer statischen Strategie der Positionierung zu einer Strategie der Bewegung.
Zukunft nicht möglich. Flexibilität wird zum Schlüssel. Schnellere technologische Veränderungen erfordern eine höhere Geschwindigkeit und Effizienz in Bezug auf CapEx. Dazu muss der Zeitaufwand für Analysen deutlich reduziert und selbst langfristige Investitionen und risikoreiche Entscheidungsprozesse beschleunigt werden. Digitale Exzellenz befähigt Unternehmen, hochwertige Produkte zu entwickeln und kosteneffizient zu vertreiben. Damit einher geht die Konzentration auf hochintelligente Talente. Denn digitale Exzellenz hängt nicht
vom technologischen Instrumentarium allein ab. Zusätzlich gilt es, die Mitarbeitenden zu befähigen, diese Technologien effektiv und effizient einzusetzen, um die Leistungsfähigkeit der Organisation zu stärken und kontinuierlich weiterentwickeln zu können und die gemeinsame Crowd-Intelligenz im Unternehmen zu fördern.
»In der heutigen dynamischen Welt sind selbst langfristige Ziele fließend. Anstatt von einem vorbestimmten Endzustand aus zu planen, sollte der Schwerpunkt auf dem nächsten
In Zukunft wird Intelligenz den Unterschied machen. Deshalb müssen sich Unternehmen intensiv mit dem Konzept der Intelligenz beschäftigen und nach Wegen suchen, um ihre Entscheidungsprozesse, Produktionsstrukturen und Wertschöpfungsnetzwerke smart, adaptiv und kreativ zu gestalten.
relevanten Schritt liegen. Dies erfordert den Wechsel von einer statischen Strategie der Positionierung zu einer Strategie der Bewegung: einer Strategie, die kontinuierliches L ernen, schnelle Anpassung und Widerstandsfähigkeit in den Vordergrund stellt«, betont Sebastian Diers, »um Veränderungsprojekte erfolgreich zu gestalten und – vom Shopfloor bis zum Management – individuelle Potenziale zu heben, die Ziele im Change-Management zu bestimmen und erfolgreich umzusetzen«.
Von der Analyse bestehender Strukturen über die Definition der Zielorganisation und der Zielprozesse bis hin zur wirksamen Umsetzung und Roll-out: Efeso unterstützt alle Phasen der Transformation, um Veränderung erfolgreich und dauerhaft im Unternehmen zu verankern.
Real Results, Together Efeso Management Consultants ist die führende internationale Unternehmensberatung mit Fokus auf Operations und Performanceverbesserung. Sie helfen globalen Konzernen, mittelständischen Unternehmen und Private-Equity-Investoren, Beiträge zu einer lebenswerten und zukunftssicheren Welt zu leisten und ihre Produktivität und Kosteneffizienz langfristig zu sichern. Gemeinsam mit ihren Kunden verbessern sie die operative Exzellenz, gestalten adaptive Supply-Chains, digitalisieren industrielle Prozesse, beschleunigen die Produktentwicklung und setzen Transformationsvorhaben erfolgreich um.
Weitere Informationen unter: efeso.com/de

Eine Smart Factory entsteht nicht allein durch Technik. Ob beim Neubau oder der Nachrüstung bestehender Werke –entscheidend sind durchdachte Planung und qualifizierte Fachkräfte, die den digitalen Wandel tragen.

Typische Szenerie in einer Produktionshalle: Während die ersten Maschinen anlaufen, flackern Monitore mit Produktionsdaten, Sensoren melden Temperatur und Auslastung, Geräte messen laufend den Materialfluss. Teile der Anlage sind neu, andere Maschinen bereits älter und laufend nachgerüstet. Für die Belegschaft bedeutet das, mit Tablets Wartungsdaten abzurufen, während gleichzeitig das vertraute Geräusch der alten Pressen im Hintergrund zu hören ist. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Alt und Neu entscheidet sich, ob eine Fabrik zukunftsfähig ist – und ob Menschen und Maschinen als Team funktionieren.
Fabrikplanung von Grund auf: Smart Factory im Neubau Wird ein Werk von Grund auf errichtet, eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten. Ein Neubau erlaubt es, Prozesse konsequent auf Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit auszurichten. Layout und Materialfluss können optimal gestaltet, Energieeffizienz von Beginn an integriert und Dateninfrastrukturen auf Wachstum ausgelegt werden. So lassen sich Produktionslinien modular planen, damit sie bei wechselnden Produktanforderungen rasch umgebaut werden können.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Datenarchitektur. Von Anfang an müssen S chnittstellen geschaffen werden, damit Maschinen, Logistik und Qualitätssicherung in einem durchgängigen IT-System kommunizieren. Ebenso wichtig ist das Energiekonzept: Photovoltaikanlagen, Wärmerückgewinnung oder die Nutzung von Industrieabwärme senken langfristig Kosten und den ökologischen Fußabdruck. Der Vorteil eines Neubaus: maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit. Erweiterungen können mitgedacht und die Fabrik skalierbar konzipiert werden. Doch solche Greenfield-Projekte sind kosten- und zeitintensiv. Grundstück, Bau und modernste Ausstattung erfordern hohe Anfangsinvestitionen. Wer sich für einen Neubau entscheidet, braucht also langen Atem – und klare Investitionspläne.
Wird ein Werk von Grund auf errichtet, eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten. Ein Neubau erlaubt es, Prozesse konsequent auf Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit auszurichten.
Retrofit: Alte Anlagen intelligent nachrüsten Für viele Unternehmen ist der Umbau im laufenden Betrieb realistischer. Retrofit bedeutet, bestehende Maschinen mit moderner Steuerungs- und Sensortechnik auszustatten. Beispiele sind der Einbau energieeffizienter Motoren, die Nachrüstung von CNCMaschinen mit IoT-Schnittstellen oder die Integration mobiler Roboter in Materialflüsse. So lassen sich Anlagen vernetzen, Produktionsdaten erfassen und Prozesse automatisieren – ohne eine komplette Neuinvestition.
Die Vorteile liegen auf der Hand: geringere Investitionskosten, schnellere Umsetzung und weniger Unterbrechungen. Zudem verlängert sich die Lebensdauer bestehender Maschinen, und Bediener:innen können weiter mit vertrauten Systemen arbeiten. Vernetzte
Altanlagen liefern wertvolle Daten für Predictive Maintenance oder Energieoptimierung.
Doch Retrofit hat Grenzen. Unterschiedliche Maschinengenerationen müssen über Schnittstellen verbunden werden, Platzmangel in alten Hallen erschwert Umbauten und unerwartete technische Probleme erhöhen den Aufwand. Hinzu kommt: Manche Systeme sind schlicht zu alt, um sinnvoll integriert zu werden. Wichtig ist daher eine klare Analyse: Welche Anlagen lassen sich modernisieren, wo ist ein Ersatz unvermeidlich?
Der Faktor Mensch ist entscheidend So hoch der Automatisierungsgrad auch ist, ohne qualifizierte Fachkräfte läuft keine Smart Factory. Mit der Digitalisierung verschieben sich die Anforderungen: Neben klassischem Maschinenverständnis sind digitale Skills gefragt. Mitarbeitende müssen Daten interpretieren,
Der Weg zur Smart Factory ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess.
mit vernetzten Systemen umgehen und in interdisziplinären Teams arbeiten können.
Aufgrund des technischen Wandels ergeben sich neue Berufsbilder wie Datenanalyst:innen, KI-Spezialist:innen oder Automatisierungstechniker:innen. Aber auch bestehende Stellenprofile verändern sich. Fachmitarbeitende benötigen zusätzliche Kenntnisse in Software-Bedienung, auch Cybersecurity-Aspekte werden immer relevanter.
Unternehmen reagieren darauf mit Weiterbildungsprogrammen, Lernplattformen und enger Kooperation mit Hochschulen. Praxisnahe Schulungen direkt an den neuen Systemen sind besonders effektiv. Entscheidend ist, Mitarbeitende frühzeitig einzubinden und ihnen eine aktive Rolle im Wandel zu geben. Nur so entsteht Akzeptanz für neue Technologien – und Motivation, diese mitzugestalten.
Technik und Qualifikation zusammengedacht planen
Der Weg zur Smart Factory ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Neubauten bieten maximale Gestaltungsfreiheit, doch hohe Investitionen und lange Realisierungszeiten sind Hürden. Retrofit ermöglicht einen schrittweisen Einstieg und schont Budgets, erfordert aber sorgfältige Planung und technisches Know-how. Beide Wege haben ihre Berechtigung – wichtig ist, Technik und Qualifikation zusammengedacht zu planen.
Zurück in die eingangs erwähnte Produktionshalle. Die neuen Maschinen laufen inzwischen synchron mit den nachgerüsteten Anlagen, der Datenfluss funktioniert störungsfrei, die Mitarbeitenden überwachen den Betrieb über Dashboards. Der Erfolg zeigt sich nicht nur in konkret messbaren Kennzahlen, sondern auch im Vertrauen der Belegschaft: Sie sieht, dass sie Teil der Transformation ist. So wird die Smart Factory nicht zu einem Ort der Verdrängung, sondern zu einem Raum gemeinsamer Weiterentwicklung. Und damit zu einem Modell für die Zukunft der industriellen Produktion.
• Brandreport

Matthias Göke
Geschäftsführender Gesellschafter
Herr Göke, welche Rolle spielt die E2E-Perspektive für den Aufbau einer Smart Factory aus Ihrer Sicht?
Die E2E-Perspektive ist der zentrale Erfolgsfaktor, um das Potenzial einer Smart Factory auszuschöpfen. Punktuelle Insellösungen greifen zu kurz. Von der transparenten Steuerung der Lieferkette über den vernetzten Betrieb von Produktion und Logistik bis hin zur vollständigen Traceability muss eine digitale Stringenz über den gesamten Auftragsabwicklungsprozess hergestellt werden. Nur so entstehen geschlossene Datenketten, belastbare Entscheidungen in Echtzeit und skalierbare Verbesserungen.
Welche Rollen nehmen Sie als Fabrikplaner bei dieser komplexen Aufgabe ein?
Wir sind weit mehr als klassische Planer – wir sind Initiator, Integrator und Realisierer. Wir definieren das Zielbild, übersetzen das Produktionsprogramm in effiziente Layouts und verknüpfen Fabrik- und Objektplanung mit IT-Systemen. Mit BIM schaffen wir ein digitales
Koordinationsmodell als Single Point of Truth und schlagen die Brücke in den Betrieb – inklusive ERP/MES-Anbindung, S&OP-Design und Simulation. So stellen wir sicher, dass die Smart Factory nicht nur geplant, sondern auch erfolgreich umgesetzt und im Betrieb verankert wird.
Sie sprechen die digitalen Methoden und Tools in der Fabrikplanung an – wo liegt aus Ihrer Sicht das größte Potenzial?
Das größte Potenzial liegt im Einsatz von BIM als zentralem Koordinationsmodell. Gebäude-, Technik- und Produktionsdaten werden in einem konsistenten Datenmodell zusammengeführt und stehen allen Beteiligten einheitlich zur Verfügung. Dadurch können Abstimmungen beschleunigt, Fehler vermieden und Entscheidungen auf einer belastbaren Basis getroffen werden.
Die Weiterentwicklung besteht in der Kopplung dieser Modelle mit ERP-, MES- und IoT-Systemen, sodass Planungs- und Betriebsdaten miteinander verknüpft werden. Simulationen ermöglichen es, Szenarien frühzeitig zu bewerten und Optimierungen abzusichern – von der Flächennutzung bis zur Produktionslogistik.
Gleichzeitig gilt es, aktuelle Grenzen im Blick zu behalten: Große Datenmengen, notwendige Rechen- und Grafikleistung sowie unterschiedliche Systemlandschaften stellen noch immer spürbare Herausforderungen dar. Dennoch eröffnet die konsequente Nutzung digitaler Modelle einen
Die E2EPerspektive ist der zentrale Erfolgsfaktor, um das Potenzial einer Smart Factory auszuschöpfen.
– Matthias Göke, Geschäftsführender Gesellschafter
klaren Weg zu mehr Transparenz, Planungssicherheit und Effizienz in der Fabrikplanung.
Abschließende Frage: Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für den Aufbau einer Smart Factory?
Erstens: Digitale Stringenz end-to-end. Ohne durchgängige Datenketten über die gesamte Auftragsabwicklung – von Vertrieb/S&OP bis Auslieferung – entstehen Brüche, die
Tempo, Qualität und Skalierung kosten. Unser Anspruch ist: eine saubere E2E-Verzahnung von Prozessen, Daten und Entscheidungen.
Zweitens: Der Dreiklang Standardisierung × Digitalisierung × Automatisierung – in genau dieser Reihenfolge. Standards schaffen Stabilität und Vergleichbarkeit, Digitalisierung macht Abläufe transparent und steuerbar (BIM/Digitaler Zwilling als Koordinationsmodell), Automatisierung hebt Effizienz und Robustheit – im Layout, Materialfluss und in den IT-Systemen.
Drittens: Der Faktor Mensch. Technologie liefert Möglichkeiten – Wirkung entsteht erst durch Erfahrung, Verantwortung und gelebte Routinen am Shopfloor. Deshalb verankern wir Rollen, KPIs und Meeting-Takte im Betrieb, damit die Smart Factory nicht nur geplant, sondern nachhaltig gelebt wird.
Vielen Dank, Herr Göke!
Weitere Informationen unter: metroplan.de

Rothbaum Consulting Engineers GmbH • Brandreport
Viele produzierende Unternehmen investieren in neue Systeme, dabei verhindern Datensilos, fehlende Integration und unklare Prozesse oft einen nachhaltigen Erfolg. Philipp Kappus, Partner bei Rothbaum, erklärt, wie die Smart Factory mit Fokus auf den Business-Value und einem ganzheitlichen Ansatz Realität wird.

Partner & Geschäftsfeldleiter Produktion
Woran scheitern produzierende Unternehmen auf dem Weg zur Smart Factory häufig?
Ein typischer Stolperstein besteht darin, dass Investitionen in Automatisierung und neue IT-Systeme zu punktuell erfolgen. Wer nur auf technische Lösungen setzt, ohne die Verzahnung von Prozessen, Systemen und Datenflüssen zu berücksichtigen, geht ein großes Risiko ein. Dem Management ist oft nicht bekannt, welchen konkreten Nutzen die Smart Factory tatsächlich bringt, entsprechend ist der Aufwand ohne klaren Business-Value schwer zu rechtfertigen. Es ist entscheidend, die Fabrik als Gesamtsystem zu begreifen, Mitarbeitende einzubinden und Schnittstellen klar zu definieren. Andernfalls bleibt die Digitalisierung Stückwerk.
Welche Rolle spielen MES und ERP–Systeme für eine erfolgreiche Smart Factory?
ERP und MES bilden die zentrale Brücke
Die größte Herausforderung liegt nicht in der Technologie, sondern darin, wie Unternehmen ihre Prozesse und Mitarbeiter auf den Wandel einstellen.
zwischen Shopfloor und Geschäftsprozessen. Ergänzt werden diese durch weitere Systeme wie Maschinendatenerfassung, Lagerverwaltungssysteme und IIoT-Plattformen. Gewachsene Strukturen und Insellösungen mit großen Mengen an Daten haben in den letzten Jahren die Komplexität immer weiter erhöht. Der große Mehrwert entsteht durch die reibungslose Integration aller Datenquellen: Sie erzeugt durchgängige Transparenz, höhere Effizienz und geringere Kosten. Somit wird der Business-Value auch greifbar. Wir begleiten Unternehmen auf ihrem Weg zu fundierten Steuerungsentscheidungen und nachhaltiger Wettbewerbsfähigkeit.
– Philipp Kappus, Partner und Geschäftsfeldleiter Produktion
Was ist wichtiger: Technologie oder Prozesse – und wie sieht das in der Praxis aus?
Beides spielt eine zentrale Rolle: Technologie funktioniert nur dann, wenn Prozesse Ende-zu-Ende durchdacht, klar definiert und digital abbildbar sind. Die Grundlage bilden stabile und harmonisierte Abläuf e, ergänzt durch die passende IT-Landschaft. Eine Lean-Philosophie als Basis hilft, unnötige Komplexität zu vermeiden, sollte aber immer zur jeweiligen Organisation passen. Die Smart Factory ist dabei ein Mittel zum Zweck, um Kosten zu senken und Qualität sowie
Flexibilität zu steigern – also einen realen Geschäftswert zu schaffen.
Welche Partner und Ökosysteme sind für den Erfolg entscheidend? Erfolgreiche Smart-Factory-Projekte leben von partnerschaftlicher Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sowohl intern als auch extern. Durch den gezielten Einsatz von Experten sowie ein starkes Netzwerk technologischer und methodischer Partner lassen sich individuelle Lösungen passgenau umsetzen und dauerhaft verankern. Auf diese Weise entwickelt sich die Smart Factory zu einem strategischen Hebel für messbaren und nachhaltigen Geschäftserfolg. Kontaktieren Sie Rothbaum für maßgeschneiderte Lösungen und nachhaltigen Erfolg. Weitere Informationen unter: rothbaum-consulting.com



WE LOVE SPOTS - JUST NOT ON ALUMINIUM! METALWORKING FLUIDS FOR ALUMINIUM MACHINING
rhenus metAlworking fluid technology prevents staining. Thanks to pH-stable formulations, optimum lubrication performance, controlled evaporation and aluminium-compatible additives. Results that speak for themselves. Approved for semiconductor industry.

Contact our experts: +49 2161 5869 0 sales@rhenusweb.de rhenuslub.com
Rhenus Lub GmbH & Co KG Hamburgring 45 41179 Mönchengladbach
Die Prozessindustrie steckt mitten im Stresstest: Energiepreise explodieren, Auflagen steigen, Märkte schwanken. Wie in dieser Lage aus Messwerten ein Wettbewerbsvorteil wird und warum das Industrial Internet of Things (IIoT) zur Überlebensfrage wird, erklärt Daniel Trommer, Executive Vice President IIoT & Systems bei Wika, dem weltweit führenden Hersteller in der Druck- und Temperaturmesstechnik sowie der Kalibriertechnik.

Daniel Trommer Executive Vice President IIoT & Systems
In der Prozessindustrie laufen die Anlagen rund um die Uhr, in Chemieparks, Raffinerien oder Lebensmittelbetrieben. Jeder Ausfall bedeutet Verluste, jeder Effizienzgewinn einen unmittelbaren Vorteil. Und der Druck wächst durch steigende Energiepreise, schärfere Nachhaltigkeits- und Sicherheitsauflagen, volatile Märkte und geopolitische Unsicherheit.
Der kluge Umgang mit Daten entscheidet, wer in diesem Umfeld wettbewerbsfähig bleibt. »Die Daten, die Anlagen schon heute in riesigen Mengen erzeugen, sind das oft ungehobene Kapital der Branche«, sagt Daniel Trommer. »Wer diese systematisch auswertet und in Handlungen übersetzt, stellt ein völlig neues Niveau an Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit her.«
Zu diesen Daten zählen etwa Messwerte der Anlagen in der Prozessindustrie, die von Druck und Temperatur über Füllstände
bis hin zu Vibrationen und Ressourcenströmen reichen. Richtig genutzt sind sie der Schlüssel für eine transparentere und effizientere Zukunft. IIoT macht diese Vorteile nutzbar: Sensoren, Konnektivität und Analytik verwandeln Messwerte in verwertbare Informationen. Die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) verhindert Ausfälle, digitale Zwillinge simulieren Szenarien und Ressourcen lassen sich gezielt einsetzen.
Daniel Trommer beobachtet, dass viele Unternehmen jedoch die Sorge bremst, IIoT sei zu komplex oder zu kostenintensiv. Er betont: »Richtig ist: Die ganzheitliche Veränderung über Nacht ist weder realistisch noch sinnvoll. Aber man kann klein anfangen, mit klar umrissenen Projekten, die schnell Wirkung zeigen.«
Schon mit der Überwachung von rotierenden Maschinen, der digitalen Verwaltung von Gaszylindern oder der Zustandskontrolle abgelegener Öl- und Gasquellen lassen sich bedeutende Fortschritte erzielen. »Diese Quick Wins schaffen Vertrauen und ebnen den Weg für größere Transformationen«, so Trommer.
Wichtig ist, die gesamte Wertschöpfungskette im Blick zu behalten, vom Sensor über die sichere Datenübertragung bis hin zur Analyse in der Cloud und zurück in die Entscheidung. »Nur wenn alle Glieder dieser

Kette reibungslos zusammenspielen, entsteht messbarer Mehrwert«, erklärt Trommer.
Beispielhaft zeigt sich das an Messlösungen wie denen von Wika: Sensoren liefern kontinuierlich Daten, die über moderne Netze übertragen, verschlüsselt verarbeitet und in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Ergebnis sind weniger Stillstände, mehr Transparenz und eine nachhaltigere Ressourcennutzung. Dies spiegelt sich auch in der rasant steigenden Anzahl eingesetzter IIoTGeräte wider: Ende 2023 waren es noch rund 16 Milliarden, 2025 werden es bereits 27 Milliarden sein, bis 2030 könnten es 40 Milliarden werden.
Das macht klar: IIoT ist kein Zukunftsversprechen, sondern eine Gegenwartsaufgabe. Unternehmen, die ihre Daten klug einsetzen,
verschaffen sich sofort einen entscheidenden Vorsprung – in einer Branche, die keine Auszeiten kennt und in der Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit den Takt vorgeben.
Weitere Informationen unter: wika.de

25. – 27.11.2025 NÜRNBERG
34. internationale Fachmesse der industriellen Automation
Automatisierung
fasziniert. Mit jeder neuen Facette.
Seit 1990 ist die SPS – Smart Production Solutions der Treffpunkt für alle, die industrielle Entwicklung vorantreiben. Vom Start-up bis zum Global Player.
Hier verdichten sich Technologien, Netzwerke wachsen und Ideen werden beflügelt. Insbesondere Industrial AI rückt in den Fokus und eröffnet neue Chancen für Produktivität und Effizienz.
Erleben Sie Fortschritt in seiner ganzen Vielfalt!
