HERRMANN
Ein Kinderlied
(Dämonen)
Vier Strophen für Orchester und Schallplatte
Partitur
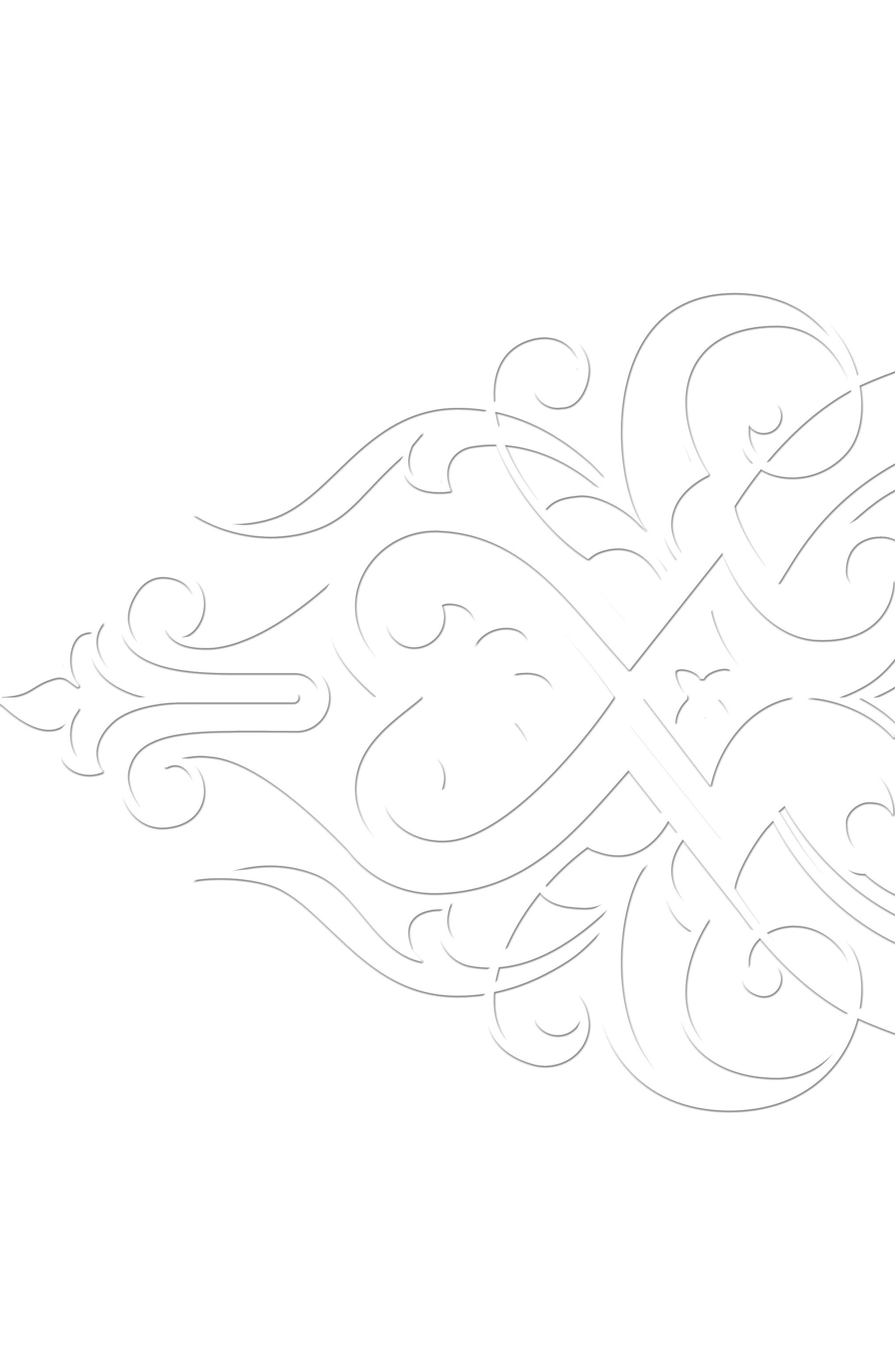

Ein Kinderlied
(Dämonen)
Vier Strophen für Orchester und Schallplatte
Partitur
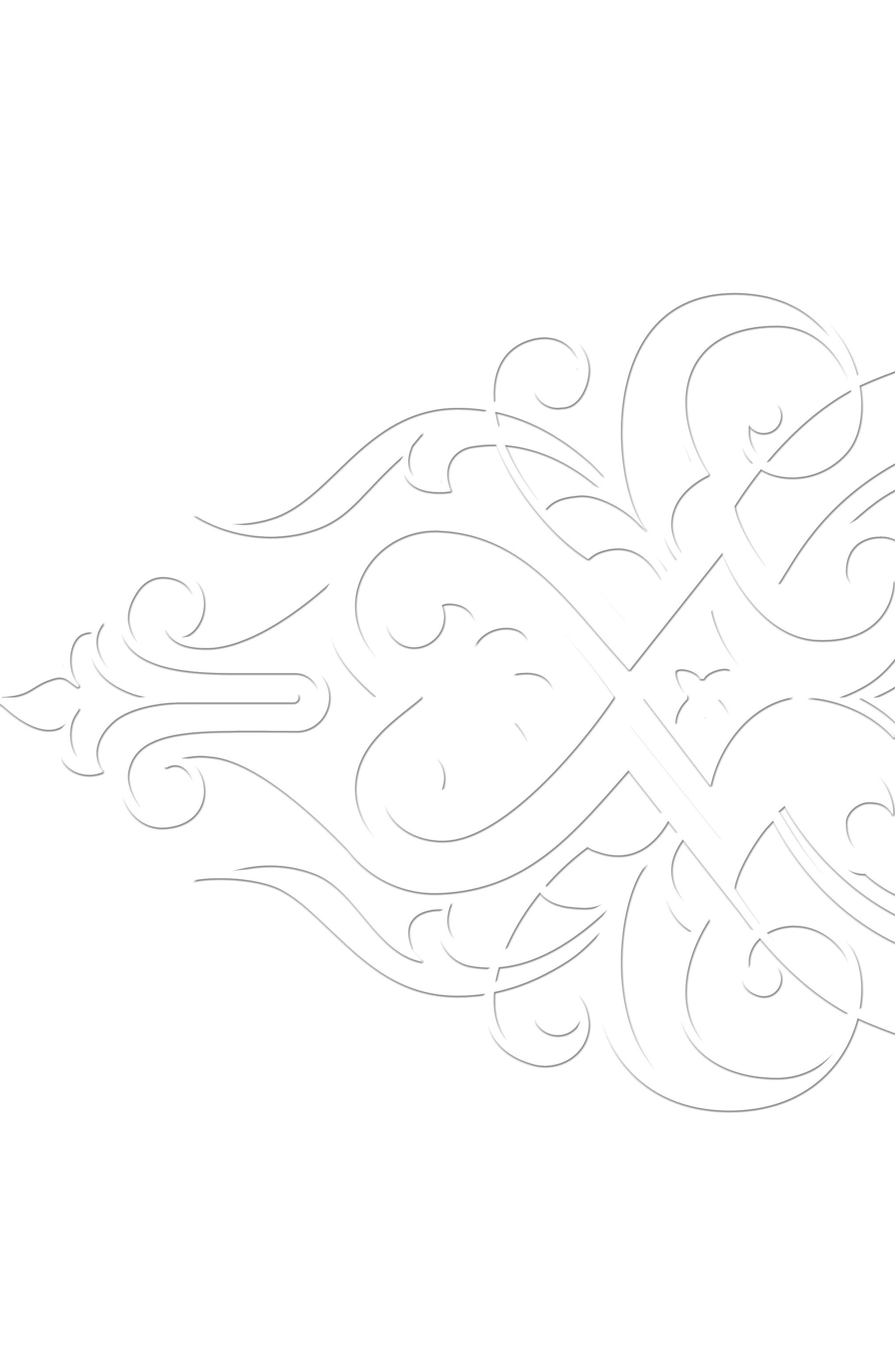
Vier Strophen für Orchester und Schallplatte
(2021)
POD PETERS on demand
Sandmännchen („Die Blümelein sie schlafen“)
Melodie: Anonym
Komposition: Johannes Brahms
Text: Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio
Unter Verwendung von Fragmenten einer Aufnahme von 1943, gesungen von Annemay und Heinrich Schlusnus Sebastian Peschko, Klavier
Notiz zum Stück:
Eine schwankende Kammer der Erinnerung
Ein Kinderlied, eine alte Schallplatte, Stimmen: Es ist eine – nicht nur für Kinder – einschläfernde und hypnotische Wirkung, die von Wiegenliedern ausgeht. In den Klängen bewahren sich Erinnerungen, Bilder, aber auch Halbdunkles, Verschüttetes, unscharf, verformt und umgeschrieben. Denn es gibt eine Kehrseite jenseits der Geborgenheit. So ist der Sandmann - als vermeintlich harmloses Sandmännchen im Lied besungen - zugleich die Figur, die den Kindern bei E.T.A. Hoffmann die Augen stiehlt. Verniedlichung und Abgrund, Geborgenheit und Trauma stehen ganz unvermittelt nebeneinander.
Musikalisches Zentrum ist das tranceartige Schlafe des Kinderliedes. Es soll beruhigen und ist doch auch dringende Aufforderung endlich einzuschlafen. Im Verlauf des Stückes verselbstständigt es sich zunehmend, bis es schließlich manisch seine Runden dreht: Schlafe, schlafe, schlaf’ du, mein Kindelein...; der Verstand beginnt zu dämmern, und die Dämonen schälen sich aus dem Halbdunkel.
Die berühmte Liedmelodie hat sich im Laufe ihrer Geschichte vielfach gehäutet und verwandelt: Vom ursprünglich frivolerotischen französischen Chanson Une petite feste des 16. Jahrhunderts, über die Umdichtung und „Entgiftung“ der sehr populären Melodie durch den Jesuitenpater Friedrich von Spee ins Weihnachtslied Zu Bethlehem geboren im 17. Jahrhundert, bis hin zu Zuccalmaglios fiktivem Volks- und Wiegenlied Die Blümelein sie schlafen im 19. Jahrhundert. Aber ungeachtet aller Verwandlung: Es bleiben Sedimente und Ablagerungen der Geschichte als Reste, die – wenn auch nicht mehr an der Oberfläche – im Lied aufgehoben und gespeichert sind.
Als Speicher fungiert auch die den Rahmen gebende Schallplatte. Auf ihr sind weißes Rauschen und historische Liedfragmente eingeschrieben. Die Schallplatte ist verwoben mit dem Orchester, das die Musik in den Raum projiziert, begleitet von sich langsam drehenden Lautsprechern. Nicht zuletzt liefert sie auch den zeitlichen Rahmen durch die Beschränkung auf die Dauer einer einzelnen Schallplattenseite. Doch das Ende ist nur technisch: Die Nadel hebt sich, das Lied aber ist nicht vorbei.
Kompositionsauftrag des SWR zu den Donaueschinger Musiktagen 2022 UA am 16.10.2022
SWR Symphonieorchester Ltg. Bas Wiegers
Anmerkungen zur Szene und Technik:
Ort, Beleuchtung sowie die Inszenierung des unten beschriebenen Ablaufs können je nach den Gegebenheiten variieren. Wichtig ist, dass der Schallplattenspieler sehr deutlich mit Position und Licht inszeniert wird. Die Lichtstimmung im Orchester ist dagegen möglichst dunkel zu halten (Pultleuchten).
Auf der Bühne soll gut sichtbar (z.B. mittig oder ungefähr in der Position eines Solisten, links vom Dirigenten) ein Schallplattenspieler stehen. Dieser Schallplattenspieler wird z.B. zentral mit einem Scheinwerfer von oben angeleuchtet.
Schallplatte/Plattenspieler:
Die Platte liegt bereits auf dem Plattenteller. Am Beginn des Stückes wird die Schallplatte im Idealfall automatisch bzw. ferngesteuert gestartet. Am Ende des Stückes hebt sich der Tonarm ferngesteuert von alleine. Das Licht auf dem Schallplattenspieler wird erst danach langsam gelöscht. Das Stück ist mit ca. 18 Minuten kürzer als eine gewöhnliche LPSeite, so dass dieser Ablauf sich zeitlich immer ausgeht (bei der Auswahl der Schallplatte auf die Spieldauer achten!). Die verwendeten Soundfiles werden vom Computer aus zugespielt. Die Schallplatte ist also nur eine Requisite.
Lautsprecheraufbau/allgemeine Hinweise vor der UA:
Zu Beginn einer Strophe bzw. in den jeweiligen Übergängen soll das Knistern der Schallplatte etwas deutlicher zu hören sein. Das ist jeweils in der Partitur vermerkt. Während der Strophen wird das Knistern hingegen zurückgenommen. Eine Ausnahme bildet die dritte Strophe, hier hat die Schallplatte die zentrale Rolle. Dennoch soll immer ein Gesamt- bzw. Mischklang mit dem Orchester entstehen. Das Orchester gibt gewissermaßen die Musik auf der Schallplatte wieder, es ist eins mit der Schallplatte. Diesen Eindruck soll sowohl die akustische als auch die optische Inszenierung der Schallplatte unterstützen.
[Die genaue Verwendung der Lautsprecher und ihre Positionierung in der UA kann beim Verlag erfragt werden. Jedoch können auch hier alternative Konzepte – je nach Saal und vorhandenen Möglichkeiten – entwickelt werden. Die beiden hängenden, drehenden Lautsprecher, die bei der Uraufführung zum Einsatz kamen, sind wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.]
Zuspiel:
Die Auslösung der Soundfiles erfolgt vom Mischpult aus.
Es gibt elf Soundfiles: Sf1-3 , +A , +B und M1-6 . Die Startpunkte sind in der Partitur angegeben. Ein Klicktrack ist in der dritten Strophe optional verfügbar.
Die einzelnen Soundfiles mit dem Schallplattengeräuschen Sf sind stets deutlich länger als im Ablauf nötig.
In dem Augenblick, in ein neues Soundfile zugeschaltet wird, schaltet sich das vorhergehende Soundfile aus. Die Soundfiles mit Musik M überlagern dagegen die Schallplattengeräusche und werden gleichzeitig mit diesen abgespielt (s.u.).
Ebene 1: Soundfiles Schallplattengeräusche Sf
Sf1 = Vorlauf Strophe 1, Strophe 1 (Ende während 1. „Schlafe“ in Strophe 1)
Sf2 = Schaltet sich in erstes „Schlafe“ von Strophe 1 ein
Sf3 =Schaltet sich am Ende von Strophe 3 ein (gleichzeitig mit Ende von Sf2 und dem Ende von M2) Anm. evtl. wird Sf3 nach dem fünften Knacken ganz ausgeblendet und erst am Ende (T.320) wieder eingeblendet.
+A = Einzelnes Knacksen. Aufsetzen des Tonarms. Wird zumeist am Anfang der Strophen ZUSÄTZLICH zum durchgehenden Schallplattengeräusch ausgelöst.
+B = Einzelnes Knacksen am Schluß = Heben des Tonarms. Es beendet Sf3 und damit auch das gesamte Stück.
Ebene 2: Musik auf der Schallplatte M
M1 = Eiernder Klaviertriller auf der Schallplatte, Beginn: letztes Schlafe von Strophe 2 (Fade in)/Ende: Beginn Scherzo (Fade out) [Sf2 mit Schallplattengeräuschen läuft während M1 weiter]
M2 = Beginn: Klicktrack (Übernahme des real gespielten Beckens, dann Stimmen der Schallplatte), Ende T.193, Ende Strophe 3 [Sf2 mit Schallplattengeräuschen läuft während M2 weiter und wird gleichzeitig mit M2 und dem Klicktrack beendet.]
M3-6 = Takt 325 bis ca. Takt 363: Einspielung von vier kurzen Klavier/Gesang Soundfiles [Sf3 mit Schallplattengeräuschen läuft während M3-6 weiter]
Besetzung:
3 Flöten (Fl.3 auch Piccolo)
3 Oboen (Ob.3 auch Englisch Horn)
4 Klarinetten in Bb (Klar. 3 und 4 auch Baßklarinette)
3 Fagotte (Fg.3 auch Kontrafagott)
6 Hörner
3 Trompeten in Bb [vorzugsweise Amerikanische Trompeten] (Trp.1: Straight-, Bucket-, Harmon-Mute/Trp.2: Straight-, Bucket-, Cup-, Plunger-Mute/ Trp.3: Straight-, Bucket-, Cup-, Plunger-Mute)
3 Posaunen (Posaune 1-3: Straight-, Bucket-Mute) Tuba (mit Dpf.)
1 Pauke
3 Schlagzeuger
14 Vln. 1
12 Vln. 2
10 Va.
8 Vcl.
8 Kb. (5-saitig)
Anm. Streicher: sordino = Holzdämpfer. Alternativ, falls der Holzdämpfer zu viel Geräusch beim Aufsetzen erzeugt: Gummidämpfer. Bögen sind immer Phrasierungsbögen. „Auf einen Bogen“ muss extra vermerkt sein.
Schlaginstrumente: Oktavangaben sind immer Helmholtz-Notation (d.h. deutsche Bezeichnung, c1 = Mittel-c (MIDI 60))
I. (Perc. 1 Links)
Baßmarimba C-c4, Vibraphon, Gr. Tr., Triangel
II. (Perc. 2 Mitte):
Gr.Tr. (das Instrument von Spieler 1 oder 2 benutzen), Triangel, Kurbelratsche fein/fest montiert, Splash-Becken (20 Zoll)/hängend, Autofeder/groß und möglichst tieffrequent, Beckenpaar
III. (Perc. 3 rechts)
Gr.Tr., Beckenpaar, Crash-Becken/hängend, Triangel, Xylorimba c-d4 (c5)
Anmerkungen zur Orchesteraufstellung:
Pk. : möglichst zentral
Perc. I-III: hinten möglichst links/zentral/rechts.
Verwendete Zeichen:
Ø = das jeweils maximal mögliche Diminuendo bzw. aus dem Nichts kommend
fi = abdämpfen/Ton unmittelbar beenden
[ ] = optionale Varianten, zumeist aus Gründen der Klangbalance. Wenn nicht anders vermerkt, sollen die Passagen in Klammern nur auf besondere Aufforderung gespielt werden.
E = Streicher mit Dämpfer (jeweils vor dem System platziert)
Mikrointervalle:
Viertelton erhöht
Viertelton erniedrigt
Dreiviertelton erhöht
Bb
Dreiviertelton erniedrigt
X Wichtiger bzw. einziger Mikroton im Akkord
Vierteltöne: Es gibt nur sehr wenige und wenn dann auch nur kleinschrittig erzeugte Vierteltöne in den Stimmen. Grundsätzlich wichtig ist, dass die verwendeten Vierteltöne immer genau ausgegriffen werden. D.h. sie dürfen in den Holzbläsern nicht über den Ansatz, sondern müssen über gesonderte Griffe erzeugt werden. In den Strei chern darf auf keinen Fall ein portamentoartiges Hineingleiten den Viertelton erzeugen. Es ist immer wichtig, daß die Rhythmik präzise wahrnehmbar ist.
Vorzeichen gelten ausschließlich vor der Note (Ausnahme sind durchgehende Tonrepetitionen). Meistens wurden zusätzlich noch Auflösungszeichen notiert.
Die Entscheidung, ob z.B. ein vierteltönig vertieftes c oder stattdessen ein vierteltönig erhöhtes h gewählt wird, bleibt dem Spieler überlassen. Da Vierteltöne immer auch mit einer Veränderung der Klangfarbe einhergehen gilt generell: Die Schönheit der Klangfarbe entscheidet und nicht die exaktere Intonation.
Vibrato: natürliches Vibrato ist in den Streichern gewünscht. Starre, vibratolose Tonerzeugung wird extra notiert. Das Gleiche gilt für extreme Vibratoformen.
Doppelstriche sind Gliederungen und meinen niemals (!) eine zeitliche Verzögerung oder Zäsur.
Die im Stück mehrfach auftretende Pendelfigur (Halbton mit vierteltöniger Nebennote) muss unbedingt immer genau ausgespielt werden und zwar mit einer Intonation, die deutlich kein Unisono und deutlich kein Halbton ist, sondern dazwischen liegt. Die Klanglichkeit hat auch hier eindeutig Vorrang vor einer centgenauen Intonation.
Die Partitur ist in C notiert. Die Piccoloflöte klingt 8va, Kontrabässe+Kontrafagott klingen 8vb.
25″ (nach dem Aufsetzen der Nadel viermal das Knacksen abwarten, dann einsetzen)
Aufsetzen der Schallplattennadel
Schallplattengeräusche der leer drehenden Schallplatte (durchgehend).
Beginn von Sf2: Wieder Knackser
= 88 Die Vierteltöne immer genau ausgreifen. Kein Portamento.
mit schwarzem Scherzo
Die Paukenglissandi evtl. größer als eine kleine Sekunde spielen (nicht länger), da der Klang ohnehin sehr schnell verschwindet.
(Das Knacksen endet nach kurzer Zeit; das Rauschen der Platte geht weiter.)
f p f p f p f p f p f p f p f p f p
a2
ß sempre ben marcato
ß sempre ben marcato
ß sempre ben marcato
ß sempre ben marcato
ß sempre ben marcato
ß sempre ben marcato
ß sempre ben marcato
ß sempre ben marcato
(Splash)
(π) (Rauschen) sempre
Tutti divisi (sempre arco) fi fi (p)
f cantabile f cantabile
Tutti divisi (sempre arco)
f cantabile f cantabile
Alle arco-Streicher: Die Glissandi immer erst sehr spät spielen, die Zielnote dabei rhythmisch genau erreichen. Wienerisch, tänzerisch, ohne Hektik, wie extrem weite Seufzer. Die Zielnote der Zweierbindungen soll dabei immer etwas verkürzt werden.
n œ b œ n œ b œ b Œ Œ œ b œ n œ n Œ Œ œ n œ n œ b Œ Œ œ n ‰ Œ Œ œ n ‰ Œ Œ œ n ‰ Œ Œ œ n ‰ Œ Œ œ n ‰ Œ Œ œ n ‰ Œ Œ œ b ‰ Œ Œ œ n ‰ Œ . Œ . Œ j ¿ Œ j ¿ Œ Œ œ n œ n Œ œ n œ m Œ œ m œ n Œ œ m œ m Œ œ n œ n œ n Œ Œ œ n Œ Œ œ
langsamer als zuvor)
Flöte 1+2: das cis2 unmerklich übergeben.
Einsatz Clicktrack (durchgehend bis zum Ende der 3. Strophe)
Vibraphon
(Clicktrack geht durch bis Takt 183/Zzt.1)
sehr leise Fortsetzung der Beckenschläge auf der Schallplatte. (Sie blenden sich ab T.162 allmählich ein.)
Sandm‰nnchen kommt geschlichen
Dritte Strophe aus: Die Bl¸melein sie schlafen (Brahms/Zuccalmaglio) Verarbeitung einer Aufnahme von 1943: Gesungen von Annemay und Heinrich Schlusnus/ Sebastian Peschko, Klavier
Sehr leise Fortsetzung der Beckenschläge von P2 auf der Schallplatte. (Sie blenden sich ab T.162 allmählich ein.)
in der Tonhöhe schwankender Klaviertriller
(Rauschen)
Ihr Einsatz erfolgt meist kurz nach dem Orchesterschlag
Oboe3: Englisch Horn nehmen
Zartes Knacken und Rauschen auf der Schallplatte.
ein mein - mein
Am Übergang von Strophe
zu
Das Rauschen der Schallplatte wird wieder deutlicher hörbar. Sf3 wird gestartet und beendet Sf2 + M2. Das Rauschen der Schallplatte geht bis zum Ende des Stückes durch.
œ n n Œ œ n Œ œ n Œ œ œ b n Œ œ œ n n Œ œ n Œ œ n Œ J ¿ ‰ Œ J ¿ ‰ Œ j ¿ ‰ Œ j ¿ ‰ Œ j œ n ‰ Œ j œ n ‰ Œ „ Œ „ Œ ˙ ˙ b n ˙ ˙ n n œœ œ œ b n b b Œ œœ œ œ n n n n Œ ˙ ˙ b b ˙ ˙ n n œ œœ œ b Œ œœ œœ m b m Œ ˙ ˙ b n ˙ ˙ n
Come prima: Paukenschlägel Etwas hohler Klang, der immer sogleich abgedämpft wird. Wie ein fernes Pochen.
Splash-Becken, hängend
Bassmarimba Schlägel (mittelhart) Schlägel (mittelhart) Xylomarimba (klingt
Die Mikrotöne in den Streichern genau ausgreifen. Die Liegeklänge
Zusätzlich zum Rauschen im Hintergrund: 1) Klavieroktaven: 9x 2) Gesang: "Die Blümelein" 3) Klavieroktaven: 3x Start M3: Zzt.1
Zusätzlich zum Rauschen im Hintergrund: 1) Klavieroktaven: 15x 2) Gesang: "Blümelein" 3) Klavieroktaven: 3x Start M4: Zzt.1
Zusätzlich zum Rauschen im Hintergrund: 1) Gesangsloop "Schlafe": 3x Start M5: Zzt.1

For more than 200 years, Edition Peters has been synonymous with excellence in classical music publishing. Established in 1800 with the keyboard works of J. S. Bach, by 1802 the company had acquired Beethoven’s First Symphony. In the years following, an active publishing policy enabled the company to expand its catalogue with new works by composers such as Brahms, Grieg and Liszt, followed in the 20th century by Richard Strauss, Arnold Schoenberg and John Cage.
Today, with its offices in Leipzig, London and New York publishing the work of living composers from around the world, Edition Peters maintains its role as a champion of new music. At the same time, the company’s historic and educational catalogues continue to be developed with awardwinning critical and pedagogical editions.
Seit über 200 Jahren steht die Edition Peters für höchste Qualität im Bereich klassischer Notenausgaben. Gegründet im Jahr 1800, begann der Verlag seine Tätigkeit mit der Herausgabe von Bachs Musik für Tasteninstrumente. Schon 1802 kamen die Rechte an Beethovens erster Sinfonie hinzu. In der Folgezeit wuchs der Katalog um neue Werke von Komponisten wie Brahms, Grieg und Liszt sowie – im 20. Jahrhundert – Richard Strauss, Arnold Schönberg und John Cage.
Als Verleger zahlreicher zeitgenössischer Komponisten aus aller Welt ist die Edition Peters mit ihren Standorten Leipzig, London und New York auch weiterhin Anwalt neuer Musik. Zugleich wird das Verlagsprogramm im klassischen wie im pädagogischen Bereich kontinuierlich durch vielfach preisgekrönte Ausgaben erweitert.