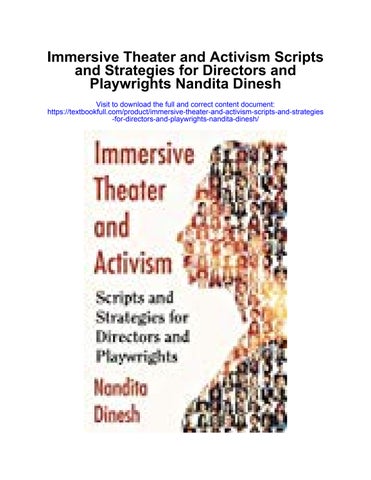Introduction
You walk into a space. You have been told, or maybe you’ve intentionally not been told, that this theatrical experience will require your participation.
You walk into this space and as soon as you do, you are told that you must become someone else. You, the audience member, are given a character and asked to stay true to that character for the duration of your time in the theatrical experience.
You, the audience-member-character, enter this space and over the course of the following minutes/hours/days, you embody an Other. And through this vicarious embodiment, it is hoped that you will encounter a glimpse into someone else’s experience of the world.
You, the audience member, become a character.
You, the audience member, become an Other.
You, the audience member, become a participant.
You, the audience member, become an actor.
You, the audience member, become to borrow from Augusto Boal (1985) a “spect-actor.”1
You become a spect-actor and, in so doing, experience what many of us call immersive theater.
Immersive theater is far from being an uncontested term. What is “immersive theater” to me, is “role-playing” to someone else; the “spect-actor” to me, is a “participant” to someone else. But my fascination with the aesthetic choices described above is not semantic in nature. Rather, my explorations around immersive aesthetics stem from a position of practice. What does this aesthetic “do” differently than another? How can this form of vicarious, theatrical experience of an Other become more ethical? How might writers and directors
for the theatre have to re-conceptualize our approaches in the creation of immersive theater? It is this last question that inspired this book.
Although recent years have seen a number of academic and theoretical analyses about immersive environments that place audience members in multi-sensorial settings and invite spectators to co-execute a performance/performance-like event (Machon, 2013; White, 2013; Hill & Paris, 2014; Magelssen, 2014; Alston, 2016; Frieze, 2016; Harpin & Nicholson, 2016), dramatic scripts that utilize participatory aesthetics are difficult to find possibly because the process of scripting for a form that is hinged on audience immersion and/or participation requires different tools; tools that await some definition in the burgeoning field of immersive theater. What elements of “traditional”2 playwriting have to shift so as to accommodate the spirit of improvisation that lies at the heart of such immersive forms? How can this book address the current lack of immersive theater scripts by generating texts and theories specifically for playwriting, and direction that might be utilized by a range of researchers and practitioners?
While the abovementioned questions frame one part of this writing project, another dimension to this book is brought in through a meditation on the concept of “gray zones”; a term that I borrow from Primo Levi (1988) in its being used to speak to narratives and lived experiences that exist between the more easily identifiable voices of the “victim” and the “perpetrator” in a context of conflict. I highlight this concept of the gray zones since applied theatre interventions that ask spect-actors to become an Other seem to be predicated on the creation of binaries. Spect-actors either step into the shoes of an “oppressor,” as can be seen in the immersive aesthetics that are used by social psychologists like Stanley Milgram (1963) and Philip Zimbardo (1971) in their obedience and prison experiments, respectively. Or, when spect-actors are not characterized as “oppressors,” they are generally asked to step into the shoes of the “oppressed” as in Un Voyage pas comme les autres sur les chemins de l’exil (Chemins)3 the piece that initially catalyzed my interest in this form.
Perhaps unsurprisingly then, the creation of these binaries catalyzes important questions that have to do with voyeurism and ethics: don’t we stand the risk of essentializing complex social situations when we perpetuate problematic binaries between “oppressor” and “oppressed,” or “victim” and “perpetrator”? Don’t we over-simplify the prison and the process of immigration when we do not present the multiple positions that inhabit the spaces between prisoner and guard; between asylum seeker and immigration official? As Jill Bennet (in
Shaughnessy, 2012:6–7) says, the empathy that is derived through immersive experiences might ultimately manifest in a crude empathy in which “another’s experience” is seen as being “assimilated to the self in the most simplistic and sentimental way.” Furthermore, such a “conjunction of affect and critical awareness may be understood to constitute the basis of an empathy grounded not in affinity (feeling for another insofar as we can imagine being that other) but on a feeling for another that entails an encounter with something irreducible and different, often inaccessible” (Shaughnessy, 2012:6–7).
So, how might participatory texts be crafted so as to invite spect-actors to step in the shoes of an Other in the gray zones, i.e., where they do not become the prisoner or the guard; where they do not become the asylum seeker or the immigration official; they become, instead, an Other who occupies a space between the positions of “most” and “least” power within a particular conflicted context? Could the writing of the spect-actors into these gray zones assuage some of the ethical risks that come with embodying an “oppressed” or “oppressor” Other within a theatrical scenario? With these questions in mind, the chapters in this book are not only framed around addressing a lack of immersive theater scripts. Rather, they also seek to explore if such works might be less ethically fraught by inviting spect-actors to embody voices from the gray zones of a particular conflict.
Before moving on to a discussion about existing attempts to give written form to participatory environments though, I would like to clarify my approach to audience immersion in this book as being composed of two important characteristics. First, my work is inspired by the principles of applied theater and as such, hinges on “some component of pedagogy or social change whether or not they bear witness in some manner to past experiences and/or injustices, or as Augusto Boal puts it, ‘rehearse’ their participants for ‘real life’” (Magelssen, 2014:5). Second, in my approach to participation/immersion there are many ways in which the term is understood the spect-actor is invited to physically embody an Other, akin to the realm of social psychology experiments of the past: the spect-actor becomes the asylum seeker in Chemins just as she becomes the prisoner in Zimbardo’s (1971; 2007) Stanford Prison Experiment and the torturer-teacher in Milgram’s (1971; Perry, 2012) obedience experiments. With this framework in mind, therefore, the first step in writing this book involved looking at what material does exist, that I could draw on to develop scripts for such a participatory theatrical aesthetic; a process of investigation that led to the study of a range of examples4: from tabletop role playing games in war studies
to drills from language learning; from simulations in nursing education to training in outdoor education; from refugee simulations designed by the Red Cross to, ultimately, the Live Action Role Plays5 (LARPs) that became most pertinent for the scripts in this book.
This is both a book of plays and a book about writing plays for an immersive theater. Having clarified my approach to immersive theater early on, I do not seek to enter into further discussions about terminology, and use terms like “participatory” and “immersive” freely. Additionally, I do not seek for this book to present “formulas,” which present one way to write and direct an immersive theater text. Instead, I see this writing project as inhabiting a space between theory and practice and as speaking to some of the complex mechanics of composing/executing a participatory/immersive theatrical experience. Therefore, although the scripts in this book have not been “tested” on stage like most published play scripts are required to be the strategies that surround the texts’ creation and implementation have been explored often in my own practice. My experiments with immersive aesthetics are ongoing and I see this writing project as one more step in a long-term effort to understand a form that both amazes and terrifies me for its potential to theatrically unlock the experience of an Other; for its risks of oversimplifying the experiences of that Other.
From Tabletop Role-Playing Games to In Exile for a While
I began my process of investigation by looking at role-playing games that take place around a table (Bowman, 2010; Cover, 2010; Tresca, 2011) and in so doing, encountered Philip Sabin’s (2012) work that shares his “scripting” process for tabletop role-playing games about historical wars. While Sabin sometimes uses different section names in different games, for elements that essentially have the same function, combing through his various “scripts” suggests that his game scripts include the following:
• Introduction: An overview of the events that are set to take place in a particular game and the objectives of what is to be studied through it
• Map: A physical map of the real-life terrain on which the conflict took place
• Scenario Overview: A description of the particular events that are included within the scope of the game
• Actions That Are Possible: A list that describes the potential actions that participants can utilize within the world of the game
• Sequence of Play: A timeline of events that occur in the game
• Example of Play: A detailed description of how one scenario in the game might play out, with regards to player turns and possibilities
• Notes for Facilitators: Guidance for the individuals conducting such tabletop role-playing war games
There is, immediately, a clear difference between such an approach that works around a table, and the simulation of multi-sensorial environments like those I seek to craft in my own immersive theatrical aesthetics. And yet, the similarity of intention behind Sabin’s work and my own of using particular kinds of immersive environments to better understand conflict warranted a consideration of the potential applicability of the framework above.
While a majority of the elements that Sabin uses might be adapted quite easily to an immersive theater script, there are two elements that would need reframing: the “map” and the “sequence of play.” Now, the former (the map) is more easily adaptable to a theatrical context: the concept being useful to give readers/directors/performers a pictorial representation of the spatial dynamics of the piece in question. The sequence of play, however, is not as visibly applicable. Although the potential utility of a sequence of play in a dramatic script is evident, the primary difference between the sequence, as described by Sabin, and the needs of a theatrical effort that works with actors and spect-actors (as compared to every participant being more similarly positioned in tabletop role-playing games) is the absence of dialogue: how does the structure of the “game” guide characters/participants in how to speak to each other? Since looking at tabletop simulations of conflict did not address this question of dialogue, I then turned to the use of simulation drills in language learning, nursing education, and outdoor leadership to understand the ways in which dialogue might be crafted in a participatory environment.
Drills and dialogues are among the most traditional materials used by language teachers and these requisites have been put forth for the execution meaningful
drills:
• that they should “look like real language”
• that the interchanges “should not be totally predictable”
• that they should be centered on topics that are relevant to the students that there should be some element of control so that the teacher can evaluate the degree of learning that is taking place (Epstein & Ormiston, 2007:1–3)
Language-learning drills take a variety of forms:
• repetitions that are used to familiarize students “with a specific structure or formulaic expression” (Epstein & Ormiston, 2007:3)
• substitution drills that more improvisational and give students the chance to change words/phrases when responding within the context of the drill
• transformational drills that allows students more freedom in the responses that they craft.
With the particular intentions of language learning, therefore, and their repetitive/substitution/transformational styles, a combination of the following strategies are used to craft drills (Epstein & Ormiston, 2007:20–23):
• Introduction: An identification of the aims and objectives for the drill
• The Context: An articulation of the physical/spatial environment of the drill
• Scenario Overview: An outline of the event
• Preparation: A list of the necessary linguistic tools that students will need to navigate the context/scenario
• Role Information: A description of participants’ characters for the duration of the drill
• Modeling the Role-Play: A familiarization process where students are informed about possible activities they might have to undertake. For
example, “You can do this using a sequence of pictures and audio recordings, or model a scripted role-play with another student”
• Doing the Role-play: A strategy/strategies for dialogue creation among participants. Options include:
◉ controlled dialogue with fill in the blanks
◉ open dialogue where students have handouts only with their character’s dialogue
◉ choice from a list of available expressions
◉ free practice that goes beyond the script and allows students to go outside the confines of a pre-determined text
◉ cue card dialogues with cues given to each student, including information that could be used to generate dialogue
◉ situation cards with explicit instructions for how the scene should unfold (describing actions, not dialogue)
◉ discourse chains, where diagrammatic representations of how the conversation might unfold are handed out to participants
• Processing the Role-play: A follow-up activity in which the participants are debriefed about their experience in the drill by asking them to, for homework, “write-up their role play as a narrative or a script,” and/or fill in a worksheet “based on the role play”
I initially looked at literature surrounding second language learning drills to think about how dialogue might be crafted for performers in an immersive theatrical experience. However, what I came away thinking about was the potential of creating dialogue “hints” for spect-actors and thus addressing some of the vulnerability that immersive theater environments are likely to cause for those who are new to it. If the goal of an immersive theatrical environment is pedagogical in nature, as is the case with my work, would it behoove spectactors to have “cues” that indicate to them how they might engage with the piece? Is it the presence of such “cues” that leads to the general success of Augusto Boal’s (1985) Forum Theater in that the Joker (facilitator) walks
audiences through exactly how spect-actors should interact with the performance in question? While immersive pieces that do not seek a pedagogical outcome might well desire the vulnerability that is caused when spect-actors are not given any rules of engagement, can the risks of the immersive form in an applied theater context (dealing with “real” people and “real” issues) be mitigated through the use of cue cards/dialogue cards/discourse chains/situation cards as in the examples above, which would serve as a “crutch” for spect-actors during their immersive journeys?
With these questions in mind, in looking for other pedagogical, immersive environments that share language learning drills’ focus on skills acquisition, I encountered the use of simulations in nursing education. By consulting an array of nursing simulation “scripts” that seem to be more widely available than texts for other types of immersive/participatory/simulated environments, I discovered that these events like their language learning counterparts almost always involve a pre-simulation briefing that then feeds in to a similarly structured simulation that focuses on the transference of particular skills to the nursing student (Montgomery College Simulation Library, 2016):
• Briefing: A session that includes a welcome and introduction in which the purpose of the simulation is shared in the context of a safe learning environment. Participants are informed about the preparatory work that they need to undertake before the simulation. Furthermore, they are asked to ensure confidentiality through a “fiction contract” in which the participants agree to maintain the reality of the simulated world through the fictional content. Finally, the participants are oriented to the space and equipment, introduced to their roles, and informed about the logistics surrounding time, place, and before/after sessions
• Cognitive/Psychomotor Skills Required Prior to Simulation: An outline of skills that are required by participants before their participation in the simulation
• Scenario/Simulation Focused Objectives: A list of information that is provided to the participants and facilitators vis-à-vis the expected outcomes of the training simulations
• Requirements of Actor/Mannequins: A section of the “script” that includes information about the context of the patient within the framework
of the scenario (the human or mannequin on whom the student-participants will be learning specific nursing skills)
• Fidelity of the Simulation: An outline that includes descriptions of,
◉ Setting/Environment
◉ Props needed
◉ Documentation forms/information required from participants in the simulation
• Scenario Progression Outline: A timeline for the scenario that includes,
◉ details about the actions performed by a mannequin or human patient/actor
◉ descriptions of the interventions to be performed by the participant/nursing student
◉ cues for the scenario’s progression
This information is represented in a table, through the use of a flowchart, or in the form of more “conventional” script with dialogue
• Debriefing/Guided Questions for Reflections: A final section that includes questions that are designed to help students discover the thinking behind their doing
In addition to the simulations/drills that are used in language learning and in nursing education, another example skill-building oriented immersive structures can be found in the simulations used by the National Outdoor Leadership School (NOLS). These documented structures seem to include:
• a description of desired outcomes
• a summary of what is to be expected within the simulation scenario in question
• ground rules that frame the simulation (similar to the “fiction contract”
that was mentioned in the nursing education material above) preparation that the simulation leader will need to undertake prior to its execution, and the script itself.
In these NOLS scripts, within each documented stage of the simulation, the leader is required to have a checklist of events that should happen during that stage; a checklist that is based on each specific training location’s Emergency Response Plan. This checklist is used by the simulation leader in conjunction with a detailed, time-based breakdown of events as below (Vermeal, n.d.):
9:00 a.m.: Incident simulation begins
9:15 a.m.: Event #1
9:25 a.m.: Event #2
9:35 a.m.: Event #3
9:50 a.m.: Event #4
| | | and so on
12:45 p.m.: End of simulation
1 p.m.: Debrief led by the simulation leader
In comparison with the structure provided for a less “embodied” simulation, the three structures that follow a consideration of Sabin’s work from language learning drills, nursing simulations, and NOLS provide noteworthy distinctions. The first distinction lies in the pre-role-play preparatory sessions that are required, that seem to be more extensive than the simpler introductions that occur in tabletop role-playing games. Such pre-session briefings are also complemented, in nursing education and in NOLS, by a post-role-play debrief during which the students/participants are asked to reflect upon the learning that has occurred for them. That said, while Sabin’s tabletop war simulations do not overtly require a debrief as part of the written structure of the game, given the simulations’ pedagogic goals, it would not surprise me if post-session debriefs are indeed an unscripted part of tabletop role-playing games as well.
In addition to the distinctions between preparatory/debrief mechanisms, differences are evident in how dialogue is scripted (or not) in the abovementioned scenarios as compared to the simulations of war that are
constructed by Sabin:
• variations that are more structured in the case of language learning drills
• the scenario progression outline/flowchart/script structure options that are put forward by the simulations for training nurses
• a more detailed timeline that is provided by NOLS, which when accompanied by constant references back to a “central text” (the Emergency Response Plan of the location in which the simulation is being conducted) functions as a tool to control the quality and content of improvisation-heavy scenarios.
Now, the simplicity behind the variations of dialogue structure in the language learning drills is, of course, attributable to the fact that the participants are second-language learners, making improvisation more difficult for this particular target audience. Similarly, the particular structures that govern the execution of the nursing simulations and the NOLS example are geared toward the particular, very focused, training objectives of those particular curricula.
With these context specific reasons in mind, however, can we extrapolate from language learning drills, to make an argument that the form of theater itself might function as a “second language” for spect-actors especially when they are invited to participate in a fashion that they might not be accustomed to?
Furthermore, could the use of progression outlines, flowcharts, and timelines in an immersive script, inspired by the nursing education simulations, allow for an easier transference and replication of the text amongst its performers and directors? Could the potential reference back to a “central text” like the use of the Emergency Response Plan in the NOLS simulation allow for performers in immersive aesthetics to improvise more cohesively when met with unpredictable responses from spect-actors? And finally, what might be said about the pedagogical potential that arises through the creation of pre/post-performance spaces? While I hope to more rigorously explore preparatory and debrief spaces in my theater practice in the near future, the ubiquitous presence of these two elements within the examples showcased in this Introduction does seem to point toward an already acknowledged benefit vis-à-vis the inclusion of such processes in immersive environments.
Ultimately, although the language learning drills, nursing education, and outdoor
leadership drills provided me with many interesting elements to consider adding to the theatrical, immersive scripts in this book, I was still left with questions surrounding nuance and complexity in these texts. Since the drills and simulations described above are designed with a certain simplicity of narrative/plot because of their particular intentions and target audiences, how could I craft a structure that might allow for more complexity? This is to say, how could I write a participatory script that could be about more than one transactional scenario (as in the case of the language learning drills), or that could interweave more than one kind of setting (as in the case of nursing education), or that could be focused on more than one particular type of situation (as in the outdoor leadership example)? It is in looking for ways of scripting complexity that I came across one particular use of role-plays in a social science classroom.
David Sherrin (2016) proposes the following elements as being necessary when creating complex, dynamic, simulations that are based on a historical event:
• Selecting and researching the story
• Creating (or determining) the characters: Students are asked to choose characters, choose three skills (from a pre-provided list), and two possessions (also from a predetermined list)
• Determining the scenes
• Writing the background narratives
• Deciding on conflicts and choice moments: Choice moments are when one or more individuals in the role-play make a key decision, often ethical, that will drive the subsequent acting and action
• Creating action and speaking cards: Action and speaking cards that seek to help strike the balance between providing students freedom of choice, and guiding them toward specific conflicts and actions that are historically accurate
• Gathering props
• Determining homework assignments
• Pivotal decision debates (PDD): These are moments in which members of the participating community gather to discuss a question whose resolution will have great bearing on their future. This is distinct from “choice moments” which are often individual in nature and usually require coming to a quick decision. These PDDs add additional skill-building elements to the role-playing toolbox by incorporating students’ growing knowledge, their perspective of their roles, and their use of evidence from homework texts into a debate
• Creating an assessment: Similar in function to a debrief, this assessment seeks to test knowledge gained by students during these simulations
The dynamism allowed by the Choice Moments, PDDs, and Options in Sherrin’s work is an element that I find particularly interesting in thinking about how immersive, theatrical scripts with more complex narratives might be framed. The challenge, of course, lies in the strong presence of the teacher within the execution of such simulations in the classroom: the individual educator performs many tasks within the context of a role-play like the one above, unlike a theatrical environment in which multiple performers facilitate a single immersive event. And with this significant difference in play, would Sherrin’s ideas work within an immersive theater script?
In light of this emergent query, I began to seek examples for simulations/immersive environments/role-playing games that would allow for multiplicity and complexity, i.e., texts that could be layered beyond the simplicity of language learning drills, but that could still function without the central presence of one teacher/facilitator. It is in thinking about this question that I decided to revisit the well-known Red Cross simulation (n.d.), In Exile for a While, that uses complex immersive environments toward a very specific pedagogic objective: the spect-actor’s acquisition of an affective, embodied awareness about the experiences of refugees and asylum seekers:
• Introduction: An outline of objectives and goals of the simulation
• The Event: An itinerary that has a detailed time-based breakdown of how the events are to unfold during the course of the event. A detailed timeline is provided for the entire time frame of the event and organizers are encouraged to use a duration that works best for their particular context
• Debriefing: A description of the general themes that might guide an articulation of what participants can do after the simulation i.e., “in real life,” to engage with programs promoting the rights of refugees and asylum seekers
• Actors’ Roles: A list of characters in the simulation
• Logistics: A list of necessary personnel and infrastructure. For instance: describing the responsibilities of an individual who takes on a managerial role, specifying the specific spatial requirements as being a farm or a site in a provincial park, creating lists of food needed by participants; detailing information vis-à-vis sponsorship for the event
• Forms: An extensive array of documentation including registration forms for participants, consent forms, and information/fact sheets about themes that are central to the event (i.e. data about existing refugee camps, globally and locally; the intersection between gender and refugee status; health issues being faced in refugee camps). These information/fact sheets are intended both for organizers to inform themselves, and to better facilitate the debriefing sessions. Given the pedagogic objectives of this particular simulation, these are also documents that can be shared with the participants as handouts during the debriefing at the end of the simulation
Given the heightened relevance of an initiative like In Exile for a While for the kind of immersive work that frames this book, I then undertook more investigation into large-scale immersive environments that were not tied to a particular discipline like language learning, nursing education, outdoor education, or social science. Intentionally deciding not to reinvent the wheel, encountering different structural possibilities forced me to dig deeper; to see if there was “something” that came closer to my approach to immersive theater; “something” that had a practical repertoire of scripted materials that would allow me to make more informed choices about points of departure for the scripts in this book. After much scavenging then, after meandering through the worlds of tabletop role-playing games, language learning drills, nursing education simulations, outdoor education training, social science role-plays, and initiatives like In Exile for a While, I came across the genre of Live Action Role Plays a form whose practice and research came to most influence my decisions vis-à-vis the scripting process in this book.
Live Action Role Plays (LARPs)
Not only is it complex to track “a” history of LARP but also, the terminology that is used for these events seems to change based on the setting of their execution: “from Knutepunkt (Norway) to Knutpunk (Sweden), Knudepunkt (Denmark) and Solmukohta (Finland)” (Stenros & Montola, 2010:10). “The established Nordic larp cultures trace their roots back to the 1980s” and the combined influences of activities like “Dungeons & Dragons,” “tabletop roleplaying games,” “the anti-role-playing film Mazes and Monsters (1982),” “Tolkien societies, historical re-enactment[s], scouting, assassination games, community theater et cetera” are all said to be integral in understanding how LARPs exist today in the Nordic countries and beyond (Stenros & Montola, 2010:15).
LARPs are created for “a first person audience, for players relating to the fictional world from the first person perspective of a fictional character” (Stenros & Montola, 2010:20). It has been called “a medium, an art form, a social art form, a new performance art that creates a social body, and a subjective form of art” (Stenros & Montola, 2010: 305) and has been particularly compared to diverse theatrical forms:
Commedia dell’Arte (usually without obvious masks), a particularly obscure Theater Game, untherapeutic psychodrama, a sort of Invisible Theater, or amateur improvisational theater. Indeed, from a spectator’s point of view the closest relative to larp might very well be a long, uninterrupted impro rehearsal. But this is the key distinction: Larp is not designed to have an audience [Stenros & Montola, 2010:301].
Despite the concept of “audience” being one that is used to differentiate LARPs from theater, LARP literature does seem to acknowledge that such a distinction might not be entirely sufficient either. The role of the audience in the theater is constantly being reinvented: from the use of Viola Spolin’s (1999) Theater Games for the Classroom, in which the difference between actor and audience vanishes; to experimental genres like performance art (or “happenings” or “actions” as they are sometimes called) where a piece does not need to have any spectators; from ritualistic forms of theater making in which the performers themselves form a first-person audience (akin to the work of Jerzy Grotwoski,
2002), to the “spect-actor” in Augusto Boal’s (1985) “Theater of the Oppressed” who intervenes directly within the action on stage. For instance, in particular immersive theater projects that I have undertaken (see Dinesh, 2015a) the experience is constructed around individual spect-actors’ engagement in selfcontained spaces, in intimate in terms of actor-audience ratios interactions with performers. This individual spect-actor then, is both audience and actor; there is no non-performer in the mix, who would fit the traditional understanding of an audience member that watches and listens to a staged work.
LARPs and particular forms of theater making have long been recognized as containing resonances with each other, requiring a more careful articulation of how these particular genres/aesthetics might be differentiated at least superficially from each other. Brian David Phillips (in Stenros & Montola, 2006:301), for example, considers LARP “to be a part of a wider group of playful forms of pretence,” like “Interactive Drama” (Back, 2014:108), where more conventional theatrical strategies are done away with and where traditional boundaries between performers and spectators are challenged. While embarking on such a comparative analysis is fascinating, I must clarify that I do not seek to find a prescriptive answer to what makes immersive theater different from LARP in this book. Rather I hope to encounter some points of departure from which I might better understand how lessons from the world of LARP could be put to use in the immersive, theatrical arena.
In order to develop such points of departure, I draw (in Table 1, below) from ideas put forth by Jamie MacDonald (2012), where she delineates the differences between a staged aesthetic a term that she uses to refer to a theatrical experience in which the audience watches and listens to performers on a stage and what MacDonald refers to as an immersed aesthetic that is put to use in LARPs. As such, Table 1 summarizes the differences that MacDonald, a self proclaimed theater artist turned LARPer, articulates. However, I also add a third (middle) column, which considers the very same aspects as Macdonald does, but in reference to the immersive aesthetic that underpins the scripts in this book.
Table 1: Aesthetic Comparisons
There is one more difference that LARP literature espouses, although Macdonald does not explicitly refer to this, and that is the place for out-ofcharacter knowledge. In more conventional, staged performances, audience members do not have a character and as such, out-of-character knowledge as a concept is not relevant. In LARPs, however, this concept is especially important and is centered on participants not bringing out-of-character knowledge into the personas that they take on for the duration of the LARP experience. This is to say that I will not rely on my lived experience in the “real world” in the portrayal of my character in a LARP. Rather, that LARP character will know only what s/he can know within the bounds of that experience.
Inhabiting a space between irrelevance and relevance though, the concept of out of character knowledge is more complex within the scripts in this book. Since, unlike LARP participants, spect-actors in immersive theater do not always
Another random document with no related content on Scribd:
nehmen würden. Somit war mit einer erheblichen feindlichen Tätigkeit erst nach der Regenzeit zu rechnen, deren Schluß ich auf Ende Februar annahm. Ungefähr um diese Zeit gedachte ich unsere Streitkräfte in der Gegend von Nanungu enger zu versammeln. Bis dahin mußten wir die Verpflegungsbestände dieses Gebietes also schonen und so viel wie möglich von den Beständen leben, die aus dem äußeren Umkreise unserer gesamten jetzigen Unterbringung bezogen werden konnten. Die Jagdergebnisse waren bei Chirumba anfangs nicht erheblich, steigerten sich aber, als auf dem östlichen Ufer des Lujendaflusses und besonders weiter stromaufwärts stärkere Bestände an Antilopen vorgefunden wurden. Der Verkehr über den Fluß vollzog sich jetzt, bei dem niedrigen Wasserstande der Trockenzeit, für die Trägerkarawanen, die ihre Lasten nach Magazinen auf das Ostufer des Flusses schafften, durch mehrere Furten. Außerdem waren zum Übersetzen einige große Einbäume vorhanden. Zur weiteren Erkundung und zum Ansammeln von Verpflegung wurden wochenlang Patrouillen entsandt. Die auf Monate entsandte Patrouille des Leutnants von Scherbening marschierte von Chirumba über Mtende, Mahua und schließlich weiter nach Süden über den Luriofluß, dann den Malemafluß aufwärts und überrumpelte die portugiesische Boma Malema. Ein Italiener, der am Lujendaflusse Elefanten gejagt und sich gänzlich abgerissen und verhungert bei uns eingefunden hatte, begleitete die Patrouille des Leutnants von Scherbening. Durch verschleppte Malaria war aber die Gesundheit des Mannes derartig untergraben und seine Milz so riesenhaft angeschwollen, daß er aus der Gegend von Mahua schließlich auf seine bei Malacotera gelegene Pflanzung getragen werden mußte.
Anfang Januar 1918 begannen die Engländer, sich zu regen. Von der Südostecke des Nyassasees her nahten sich zwei feindliche Bataillone — das 1. und 2. der I. Kings African Rifles — der Abteilung des Hauptmanns Goering, der herangekommen war und dann ein festes Lager in dem spitzen Winkel zwischen Luambalaund Lujendafluß bezogen hatte. Er sicherte die weiter oberhalb am Lujendafluß gelegenen Verpflegungsmagazine. Am 9. Januar wurde vormittags ein Teil des Feindes, der hier vereinzelt angriff, geschlagen. Als der Gegner nachmittags nach Eintreffen seiner
Verstärkungen erneut vorging und zugleich feindliche Truppen auf das Ostufer des Lujendaflusses nach Norden in Richtung auf die Verpflegungsmagazine vordrangen, ging Hauptmann Goering mit dem Hauptteil seiner Truppe auf das Ostufer. Im bisherigen Lager, auf dem Westufer, blieb nur eine stärkere Patrouille, die den Feind zurückhielt. Zu gleicher Zeit gingen feindliche Truppen — festgestellt wurde das aus südafrikanischen Mischlingen bestehende II. CapeCorps — von Mtangula aus auf Mwembe vor.
Es kam nun zu einer Unzahl von kleineren Unternehmungen und Patrouillengefechten, die uns bei der Schwierigkeit, unsere Träger, die Verpflegung herantrugen, ausreichend zu decken, oft in eine unangenehme Lage brachten. Die Engländer benutzten diese für uns unangenehme Zeit geschickt zu Versuchen, die Anhänglichkeit unserer Askari und Träger zu untergraben. Natürlich waren viele derselben kriegsmüde. Die Strapazen waren auch wirklich recht groß gewesen. Dazu kam bei vielen das unsichere Gefühl, wohin die Reise nun weiter führen sollte. Die überwiegende Mehrzahl der Schwarzen hängt an den Verwandten und an der Heimat. Sie sagten sich: wenn wir nun weiter marschieren, dann kennen wir das Land und die Wege nicht mehr. Von da, wo wir jetzt sind, finden wir uns noch zurück, aber später nicht mehr. Die englischen Einflüsterungen und Flugblätter, die Colonel Baxter in unsere Reihen tragen ließ, fielen deshalb bei manchen auf fruchtbaren Boden, und so sind damals eine Reihe guter Askari und selbst ältere Chargen desertiert. Kleine Unannehmlichkeiten, wie sie immer vorkommen, Weiberangelegenheiten und dergleichen, trugen das ihrige dazu bei, den Leuten ihren Entschluß zum Fortlaufen zu erleichtern. Es kam vor, daß ein alter Sol (schwarzer Feldwebel), der eine glänzende, selbständige Patrouille geführt und eine starke Trägerabteilung mit Lasten geschickt mitten durch die feindlichen Reihen zurückgebracht hatte, und der wegen seiner guten Leistungen zum „Effendi“ (schwarzen Offizier) vorgeschlagen war, plötzlich verschwunden war. Auch er war desertiert. Die Impulsivität des Schwarzen macht auch für schlechte Einflüsterungen leicht empfänglich. Aber wenn sich der feindliche Colonel rühmen kann, durch seine Tätigkeit in unseren Reihen bei einigen Elementen eine moralische Krankhaftigkeit erzeugt zu haben, so war dieser Zustand doch nur von
vorübergehender Dauer Bald kehrten die alte Unternehmungslust und das alte Vertrauen zurück, auch bei denen, die den Kopf hatten hängen lassen. Das Beispiel der guten Askari, die einfach lachten über die goldenen Berge, die ihnen der Feind versprach, wenn sie desertierten, gewann die Oberhand. In einem so langen und aufreibenden Kriege war eben die Stimmung gelegentlich auch niedergedrückt. Es kam weniger darauf an, sich hierüber zu erstaunen und zu entrüsten, als vielmehr, dem kräftig entgegenzuwirken, und dazu waren die guten Elemente fest entschlossen, die zahlreich unter unseren Europäern, Askari und Trägern vorhanden waren.
Zweiter Abschnitt Östlich des Lujendaflusses
Die Patrouille des Hauptmanns Otto, die vom Hauptmann Tafel vor dessen Waffenstreckung zu mir abgesandt war und die Einzelheiten über die dortigen Vorgänge meldete, war in Chirumba eingetroffen. Hauptmann Otto rückte jetzt mit zwei weiteren Kompagnien nach Luambala und übernahm dort den gemeinsamen Befehl auch über die Abteilung Goering (3 Kompagnien). Richtigerweise erfolgte der Hauptdruck des Feindes dort bei Luambala, und zwar auf dem östlichen Ufer des Lujenda. Es war ja klar, daß, wenn der Feind dort flußabwärts vordrang, meine Lage bei Chirumba, auf dem Westufer des Flusses, in einem Gebiet, dessen Verpflegungsbestände nach und nach erschöpft wurden, und mit dem durch die inzwischen gefallenen Regen stark angeschwollenen Fluß in meinem Rücken äußerst ungünstig wurde.
Es war nötig, mich dieser Lage zu entziehen und meine Kräfte rechtzeitig auf das östliche Lujendaufer zu verschieben. Leider waren die Furten infolge Hochwassers nicht mehr passierbar, der gesamte Uferwechsel auf die drei vorhandenen Einbäume angewiesen.
Die Kompagnien wurden nach und nach ohne irgendwelche Störungen auf das Ostufer hinübergesetzt. Die Ernährung fing an, recht schwierig zu werden. Erfreulicherweise meldete Hauptmann Koehl, der in der Gegend von M e d o und N a m u n u die sehr verständigen Eingeborenen zum Anbau schnell reifender Feldfrüchte angehalten hatte, daß dort schon von Mitte Februar ab auf die Erträgnisse der neuen Ernte zu rechnen sei. Aber bis dahin war noch ein Monat; so mußten wir mit allen Mitteln versuchen, noch längere Zeit in der Gegend von Chirumba zu bleiben. Erfreulicherweise halfen uns da, wie früher das Manna den Kindern Israel, die in enormen Mengen um diese Jahreszeit hervorschießenden Pilze aus der gröbsten Verlegenheit. Ich hatte
mich schon in Deutschland für Pilzkunde interessiert und fand bald nahe Verwandte unserer deutschen Sorten, der Pfifferlinge, Champignons, Steinpilze und anderer im afrikanischen Walde vor. Ich habe sie oft in kürzester Zeit körbeweise gesammelt, und wenn auch eine allzu einseitige Pilznahrung schwer verdaulich und nicht allzu kräftig ist, so waren uns die Pilze doch eine wesentliche Beihilfe.
Askarifrau
Bei strömendem Regen zogen wir dann weiter nach Osten. Die sonst trockenen Bergschluchten waren zu reißenden Flüssen
geworden. Durch gefällte Uferbäume, die quer über den Fluß fielen, wurden Übergänge geschaffen, ein Geländer schnell durch Stangen oder zusammengeschlagene Baumrinde improvisiert. Mein Maultier, das ich wegen eines Fiebers ritt, das mich befallen hatte — ich war anscheinend besonders empfänglich für Malaria und litt häufig darunter — sowie die wenigen anderen Reittiere, die bisher nicht in den Kochtopf gewandert waren, schwammen hinüber. Am Lagerplatz angekommen, bauten mir meine Leute wegen der Feuchtigkeit des Erdbodens schnell aus Zweigen eine erhöhte Lagerstelle, über die meine beiden Mannschaftszeltbahnen als Dach gespannt wurden. Oberveterinär d. Res. Huber, der für das materielle Wohl der Mitglieder des Kommandos sorgte, und unter ihm unser tüchtiger schwarzer Koch, der bärtige alte „Baba“, waren sogleich am Werk, und trotz regennassem Holze konnten wir uns stets in kurzer Zeit am Feuer zu gemeinsamem Mahle einfinden. Oft hatte es Dr. Huber fertig gebracht, hierzu in der Eile ein schützendes Grasdach herstellen zu lassen.
An sonnigen Tagen wurde eifrig Tabak fermentiert und geschnitten. Der tüchtige Feldintendant, Leutnant z. S. a. D. Besch, der stets von neuem erfinderisch war, wenn es das leibliche Wohl der Truppe galt, hatte auch hieran gedacht und den bei den Eingeborenen vorgefundenen recht guten Tabak gesammelt. Trotz alledem waren die Entbehrungen aber recht groß, und die Einflüsterungen des Feindes, daß jeder Schwarze, der zu ihm überliefe, frei in seine Heimat ziehen und dort auf eigenem Boden behaglich leben sollte, trafen auch jetzt nicht immer auf taube Ohren. Auch der jahrelang treu dienende Boy eines Offiziers war eines Morgens verschwunden; wahrscheinlich hatte seine „Bibi“ (Frau) das Kriegsleben satt bekommen.
Die Abteilung des Hauptmanns Otto rückte von Luambala aus direkt nach Osten nach Mahua und fand dann am Luriofluß ein reiches Gebiet mit Verpflegung vor. Abteilung Goering, die von Luambala aus quer durch die Landschaft auf Mtende rückte, fand unterwegs größere Verpflegungsmengen. Die Ernte war in dieser Gegend sehr viel früher als in Deutsch-Ostafrika; der Mais fing an zu reifen und konnte zum großen Teil schon verzehrt werden.
Das Kommando zog zunächst von Chirumba nach Mtende und dann nach einigen Tagen weiter nach N a n u n g u ; Abteilung Wahle, die von Chirumba aus nach Mtende gefolgt war, wurde hier von mehreren feindlichen Kompagnien umgangen, die überraschend auf einer Höhe im Rücken der Abteilung auftauchten und den Botendienst und die Transporte unterbrachen. General Wahle entzog sich durch einen Umweg dieser unbequemen Lage und rückte in Richtung auf Nanungu näher an das Kommando heran.
Bei Nanungu fanden wir reichliche Verpflegung, und es lohnte sich, in dem Raume von N a n u n g u , N a m u n u und weiter südlich am Lurio wieder, wie in früherer Zeit, Aufkaufposten und Magazine anzulegen. Die Wildbestände lieferten gute Beute, und die Eingeborenen brachten gern Gartenfrüchte und Honig herbei, um diese gegen Fleisch, lieber aber noch gegen Bekleidungsstücke einzutauschen. Recht willkommen war eine wohlschmeckende, süße, kirschartige Porifrucht, die zu Millionen in der Gegend von Nanungu heranreifte. Ich ließ sie mit Vorliebe zu Jam verarbeiten. Auch andere Leckereien, besonders Erdnüsse, bekamen wir gelegentlich, und weit und breit verrieten die krähenden Hähne, daß es in den Lagern und bei den Eingeborenen Hühner und Eier gab.
Das Einsetzen der Regenzeit stimmte nicht genau mit dem Vorhersagen der Eingeborenen überein; es gab zwar tüchtige Güsse, aber das Wasser lief in dem hügeligen Gelände schnell ab und sammelte sich in der Hauptader jener Gegend, dem Msalufluß, der zu einem starken Hindernis anschwoll. Über den Msalufluß hatte der als Vizefeldwebel zur Truppe eingezogene Feldpostsekretär Hartmann eine Pontonbrücke gebaut, die uns mit der Abteilung des Generals Wahle verband. Diese war noch auf dem westlichen Ufer des Flusses geblieben. Als schwimmende Unterstützungen der Brücke dienten Rindenboote. Die Notwendigkeit, in dem wasserreichen Gebiete die angeschwollenen Flüsse glatt überwinden zu müssen, lenkte meine Aufmerksamkeit auf diese Frage. Bisher hatten wir für alle Fälle einige Einbäume mitgetragen. Der Transport war aber auf die Dauer zu schwierig und dieses Mittel zu wenig leistungsfähig. Der Kriegsfreiwillige Gerth, ein Pflanzer vom unteren Rufiji, interessierte sich besonders für diese Frage und ließ
sich von den Eingeborenen der Landschaft, die hierin besonders sachkundig waren, im Bau von Rindenbooten unterweisen. Nachdem die Versuche schnell zu einem Resultat geführt hatten, wurde bei allen Kompagnien der Bau solcher Boote, für deren Herstellung nach einiger Übung knapp zwei Stunden erforderlich waren, mit Eifer betrieben. Diese Boote sind in größerem Maßstabe von uns nicht benutzt worden, aber sie gaben uns das sichere Gefühl, daß im Notfalle auch ein starkes Stromhindernis für unsere recht unhandlichen Karawanen und Lasten nicht unüberwindlich sei.
Nach einiger Bekanntschaft mit der Gegend fanden wir im Msaluflusse Furten, die auch bei hohem Wasserstand einen Uferwechsel gestatteten. Unsere Kampfpatrouillen unter Sergeant Valett und anderen gingen von unseren gesicherten Lagern bei Nanungu aus, durchschritten den Fluß, der unser Unterkunftsgebiet nach Westen zu als Hindernis begrenzte, und suchten den Feind in seinen Lagern bei Mtende auf. Einer dieser Patrouillen, die besonders stark gemacht und mit 2 Maschinengewehren ausgerüstet war, gelang es, westlich von Mtende eine feindliche Verpflegungskarawane zu überfallen. Die Unsrigen haben sich dann aber nicht schnell genug den feindlichen Bedeckungstruppen entzogen und kamen, von mehreren Seiten angegriffen, in eine schwierige Lage. Beide Maschinengewehre gingen verloren und die sie bedienenden Europäer fielen. Nach und nach trafen die Askari zwar wieder vollzählig in Nanungu ein, aber der Patrouillenführer, Feldwebel Müßlin, der sich während des Marsches allein entfernt hatte, war in Feindeshand gefallen. Eine andere Patrouille, mit der Hauptmann Müller nach Norden zu den Msalu überschritt, vertrieb schnell eine englische Postierung bei Lusinje. In der Gegend von Lusinje war auch das Lager des englischen Leutnant Wienholt erbeutet worden, der, wie früher erwähnt, aus unserer Gefangenschaft entlaufen und einer der besten englischen Patrouillenführer geworden war. Die Eingeborenen wurden durch die englischen Patrouillen gründlich bearbeitet und leisteten dem Feinde gegen Belohnung durch Kleidungsstücke Spionagedienst. Auch der anläßlich des Bootsbaues erwähnte Kriegsfreiwillige Gerth wurde am Msalufluß, am Hause eines Jumben, von einer englischen Patrouille überfallen und fand hierbei seinen Tod.
Mächtig erhoben uns damals in der zweiten Hälfte des März 1918 die Nachrichten von der gewaltigen deutschen Märzoffensive an der Westfront, die unsere Funkenstation auffing. Ich wettete mit dem Sanitätsoffizier beim Stabe, Stabsarzt Taute, daß Amiens bald fallen würde. Die Zeit mehrwöchentlicher Ruhe, die jetzt beim Stillstand unserer Operationen eintrat, benutzte ich, um meinen rechten Fuß, der mir infolge eines Sandflohes seit einem halben Jahr Unbequemlichkeiten machte, in Ordnung bringen zu lassen. Die in manchen Lagern in Unmenge vorkommenden Sandflöhe bohren sich mit Vorliebe an den Rändern der Fußnägel in das Fleisch und verursachen dort schmerzhafte Entzündungen. Wird nicht aufgepaßt, so greifen diese weiter um sich und nach ärztlicher Ansicht ist die Verstümmelung vieler Füße der Eingeborenen und der Verlust der Zehen häufig auf solche Sandflöhe zurückzuführen.
Auch ich litt unter dieser Unbequemlichkeit, und beim Gehen bildeten sich immer wieder Entzündungen. Stabsarzt Taute konnte mir glücklicherweise den Zeh unempfindlich machen, um dann den Nagel herauszureißen.
Auch in anderer Weise war ich einmal etwas gehindert. Auf einem Erkundungsgange hatte mir ein Halm des übermannshohen Grases in mein rechtes Auge geschnitten, und bei der nachfolgenden Behandlung war infolge von Atropin die Anpassungsfähigkeit der Linse beeinträchtigt; ich konnte deshalb mit dem rechten Auge nicht ordentlich sehen und keine Schrift oder Kartenskizzen erkennen. Dieser Zustand war lästig, weil mein linkes Auge durch eine im Jahre 1906 beim Hottentottenaufstand in Südwestafrika erhaltene Schußverletzung so stark beschädigt worden ist, daß ich mit diesem nur vermittelst Starbrille lesen kann. Eine solche war aber nicht verfügbar, und so war ich gezwungen, an verschiedene Unternehmungen heranzugehen, ohne richtig sehen zu können.
Die Patrouillen der Abteilung Koehl waren aus der Gegend Medo-Namunu inzwischen bis an die Küste vorgestreift, hatten am unteren Luriofluß und weit südlich desselben portugiesische Befestigungen erobert, einige Kanonen, vor allem aber Gewehre und Munition, meist von altem Modell, und erhebliche Mengen an
Verpflegung erbeutet. Die Eingeborenen erwiesen sich hierbei freundlich gegen unsere Leute und sahen in ihnen auch hier die Befreier von der portugiesischen Bedrückung. Auch Patrouillen der Abteilung Otto waren von Mahua her in das Gebiet südlich des Lurioflusses gestreift, und der in Eingeborenenangelegenheiten so erfahrene Oberleutnant d. Ldw. Methner, erster Referent unseres Gouvernements, rühmte die Tüchtigkeit und Klugheit der portugiesischen Eingeborenen und den verständigen und weiten Blick ihrer Ortsoberhäupter.
Leutnant von Scherbening, der mit seiner Patrouille die Boma Malema genommen hatte, berichtete von dem großen Reichtum dieser Gegend. Um auch uns hiervon etwas zukommen zu lassen, schickte er ein erbeutetes Schwein nach Nanungu. Da es nicht laufen wollte, wurde es 500 km weit getragen. Bei seiner Ankunft stellte sich leider heraus, daß es gar kein europäisches Schwein war, sondern ein Porischwein, wie wir es selbst im Walde häufig erlegten.
Wieder war eine Zeit gekommen, wo es schwer war, Nachrichten über den Feind zu erhalten. Aber aus den unvollkommenen Karten, die uns zur Verfügung standen, war doch manches herauszulesen. Ich konnte nicht zweifeln, daß die sicher bevorstehenden feindlichen Operationen mit ihren Hauptkräften von der Küste, aus der Gegend von P o r t o A m e l i a , ansetzen würden. Das Auftreten stärkerer feindlicher Kräfte bei M t e n d e sowie die allerdings sehr unsichere Nachricht, daß auch feindliche Truppen von Südwesten her auf M a h u a im Anmarsch waren, zeigten mir, daß zugleich mit dem bevorstehenden Vorrücken der feindlichen Hauptkräfte andere Truppen von Westen her operieren wollten. Es schien eine Lage heranzureifen, in der es möglich war, die innere Linie, auf der ich stand, auszunutzen und den einen oder den anderen Teil des Feindes vereinzelt zu fassen. Die Nachschubverhältnisse des Gegners bedingten es, daß diejenigen seiner Kolonnen, die von Westen kamen, nicht allzu stark sein konnten. Hier also bot sich auch voraussichtlich die von mir gesuchte günstige Chance. Mit dem Hauptteil meiner Truppen blieb ich deshalb in der Gegend von Nanungu und zog nach hier auch die Abteilung des Hauptmanns
Otto vom Lurio heran. Mit diesen Kräften wollte ich angriffsweise verfahren und zwar nach Westen zu. Dem Hauptmann Koehl, der seine Abteilung bei M e d o sammelte, fiel die Aufgabe zu, die von Porto Amelia heranrückenden Hauptstreitkräfte des Feindes hinzuhalten und allmählich schrittweise auf mich zurückzugehen.
Hauptmann Müller, der nach jahrelanger Tätigkeit beim Kommando eine selbständige Abteilung von 2 Kompagnien übernommen hatte, wurde aus der Gegend von Nanungu auf Mahua vorgesandt, um dort dem Feinde nach Möglichkeit Abbruch zu tun. Er umging Mahua und überraschte südwestlich dieses Ortes die befestigte Verpflegungsstation Kanene. Die verteidigenden englischen Europäer sahen ein, daß die angesammelten Bestände verloren waren. Um dies wenigstens teilweise zu verhindern, machten sie sich über die Alkoholbestände des Lagers her und fielen recht angeheitert in unsere Hände.
Ich selbst rückte Mitte April gleichfalls in Richtung auf Mahua vor und hörte beim Anmarsch schon aus weiter Entfernung von dort her heftige Detonationen. Hauptmann Müller war nordöstlich Mahua bei Koriwa auf ein feindliches Bataillon unter Colonel Barton gestoßen, das einen Streifzug unternommen hatte und nun von den Unsrigen während des Marsches sogleich angegriffen wurde. Trotzdem auf unserer Seite kaum 70 Gewehre im Gefecht waren, gelang es doch, den Feind auf seinem rechten Flügel zu umfassen und ihn von dort aus von einem Termitenhügel (großen Ameisenhügel) so energisch unter wirksames Maschinengewehrfeuer zu nehmen, daß er in wilder Flucht davonlief. Er verlor dabei über 40 Mann. Oberleutnant z. S. Wunderlich, der einen schweren Schuß durch den Unterleib erhalten hatte, mußte zu dem 2 Tagemärsche entfernten Lazarett von Nanungu geschafft werden und starb nach kurzer Zeit.
Der Schlag, zu dem ich das Gros angesetzt hatte, war durch die schwache Abteilung Müller bereits erfolgreich ausgeführt worden. Ich wandte mich deshalb mit meinen Hauptkräften wieder in die Gegend dicht westlich Nanungu. Dort war inzwischen ein stärkerer Feind am Msaluflusse eingetroffen und hatte diesen mit stärkeren Patrouillen überschritten. Meine Berechnung, einen stärkeren feindlichen Körper unmittelbar nach Überschreiten des Flusses überraschend fassen zu
können, traf nicht zu; die erhaltenen Meldungen waren irrtümlich gewesen. Aber in einer ganzen Reihe kleinerer Zusammenstöße am Msalufluß und westlich desselben wurden dem Gegner durch unsere Kampfpatrouillen doch nach und nach erhebliche Verluste zugefügt, und seine Streifabteilungen räumten bald das östliche Msalu-Ufer. Unsere Verpflegungspatrouillen, deren Aufgabe es war, in der Richtung auf Mahua weiter Verpflegung zu beschaffen, stießen am 3. Mai überraschend auf stärkere feindliche Abteilungen in der Gegend von S a i d i , die unser Feldlazarett und unsere Verpflegungsmagazine bei M a k o t i stark gefährdeten.
Nach Makoti war zur Vorbereitung der zukünftigen, mehr nach westlicher Richtung geplanten Operationen ein Teil unserer Bestände gebracht worden. Unsere sofort entsandten Kampfpatrouillen hatten am Kirekaberge bei Makoti mehrere Zusammenstöße mit dem Feinde. Ich glaubte zunächst nur an Patrouillen des Gegners, entsandte deshalb den Hauptmann Schulz mit einer starken Patrouille dorthin zur Verstärkung und rückte selbst am 4. Mai mit dem Gros an die Straße Nanungu-Mahua. Von hier aus glaubte ich, schnell gegen irgendwo überraschend auftretende feindliche Kräfte eingreifen zu können. Die allgemeine Lage klärte sich dadurch, daß unsere Patrouillen im Laufe des Tages am Kirekaberge auf einen neuen Gegner gestoßen waren. Eine feindliche Abteilung war zurückgeworfen worden, und es war wahrscheinlich, daß stärkere Kräfte in verschanzten Lagern dahinter standen. Am 5. Mai morgens marschierte ich aus meinem Lager ab, auf Makoti zu. Während des Anmarsches wünschte ich sehnlichst, daß der Feind uns den Angriff auf seine befestigte Stellung ersparen möchte, und hoffte, was ja auch nach der ganzen Lage gar nicht unwahrscheinlich war, daß er aus seinen Schanzen herauskommen und sich so ein Kampf im freien Felde entwickeln würde. Gelang es uns bei dieser Gelegenheit, mit unseren Hauptkräften einzugreifen, ohne daß der Feind von unserem Anmarsch eine Ahnung hatte, so war ein erheblicher Erfolg nicht unwahrscheinlich.
Um 11 Uhr vormittags langte ich am Kirekaberge an und begab mich nach vorn zum Hauptmann Schulz, der mit seinen Patrouillen einige in dem Stangenholz befindliche Felsengrotten besetzt hatte.
Als ich gerade angekommen war, erhielt ich von einem Sol (schwarzen Feldwebel), der von einem Patrouillengang zurückkehrte, die Meldung, daß der Feind in großer Stärke ausgeschwärmt vorrücke und sofort auf nahe Entfernung auftauchen müsse. Ich benachrichtigte hiervon den Oberleutnant Boell, der mit seiner Kompagnie soeben hinter der Abteilung Schulz eingetroffen war, und beauftragte ihn, im Falle eines feindlichen Angriffes sogleich einzugreifen. Dann ging ich zurück und ordnete den Aufmarsch unserer weiteren, nach und nach eintreffenden Kompagnien. Inzwischen ging vorn das Gefecht los. Der Feind hatte in dichten Schützenlinien vorgehend unsere Patrouillen schnell aus ihren Steingrotten zurückgeworfen, war dann aber zu seiner größten Überraschung in das wirksame Maschinengewehrfeuer der Kompagnie Boell geraten und teilweise zurückgegangen. Die demnächst eintreffende Abteilung Goering wurde sogleich zum rechts umfassenden Angriff angesetzt, der Feind dadurch völlig überrascht und mit recht schweren Verlusten in großer Eile zurückgeworfen.
So langten wir nach mehreren Kilometern heftigen Nachdrängens vor den feindlichen Verschanzungen an. Auf unserem linken Flügel, wo zwei weitere Kompagnien eingesetzt wurden, ging das Gefecht mehrfach hin und her, und es war mir im Busch schwer, Freund und Feind zu unterscheiden. Es dauerte dadurch einige Zeit, bis ich mir von den Verhältnissen auf dem linken Flügel ein klares Bild machen konnte, und erst die Meldung des Majors Kraut, der von mir zur Erkundung dorthin gesandt war, ließ mich erkennen, daß das Vorgehen unseres linken Flügels auf einer Waldlichtung in recht wirksames feindliches Feuer geraten und dadurch zum Stocken gekommen war. Ein Gegenangriff, den der Feind unternahm und der schon ziemlich dicht an den Standplatz des Kommandos gekommen war, hätte uns recht unangenehm werden können. Zu unserem großen Glück traf aber gerade in diesem Augenblick Oberleutnant Buechsel, der mit seiner Kompagnie detachiert gewesen war und deshalb verspätet ankam, auf dem Gefechtsfelde ein und konnte der Gefahr begegnen.
Auf dem rechten Flügel hatte inzwischen Hauptmann Goering erkannt, daß ein frontales Anstürmen auf die feindlichen Verschanzungen keine Aussicht auf Erfolg bot. Er hatte deshalb Oberleutnant Meier mit einer starken Patrouille die Stellung des Gegners umgehen lassen, um von rückwärts her einen dort befindlichen feindlichen Minenwerfer zu beschießen und womöglich fortzunehmen. Diese Wegnahme gelang nicht, da der Feind unerwarteterweise noch über Reserven verfügte, die die Patrouille Meier fernzuhalten imstande waren. So kam das Gefecht zum Stillstand. Bei Einbruch völliger Dunkelheit lagen wir dem Feinde dicht gegenüber. Beiderseits fielen nur noch ab und zu Schüsse.
Während des Gefechts wurden die büromäßigen Arbeiten — es wurde auch in Afrika geschrieben, wenn auch nicht so viel als sonst üblich — erledigt. Eine Anzahl Eingänge, wie Beschwerden und sonstige Unannehmlichkeiten lagen vor. Mit den Kompagnieführern konnte ich mich von Zeit zu Zeit mündlich besprechen und ließ sie zu diesem Zweck zu mir kommen. Ich selbst wechselte meinen Standplatz so wenig wie möglich, um bei der Übermittlung der eingehenden Meldungen Schwierigkeiten und unliebsame Verzögerungen zu vermeiden. Abgekocht wurde weiter rückwärts, wo auch der Verbandplatz eingerichtet worden war. Auch wir, die Angehörigen des Kommandos, erhielten durch unsere schwarzen Diener wie gewöhnlich die zubereitete Verpflegung in die Gefechtslinie vorgebracht.
Um die Truppe zu weiterer Verwendung wieder in die Hand zu bekommen, wurden Teile derselben aus der vorderen Gefechtslinie zurückgezogen und gesammelt. Ich überlegte, daß es zweckmäßig sei, die Nacht über so liegen zu bleiben, um am nächsten Tage das Gefecht wieder aufnehmen zu können und vor allem, um zu versuchen, den Feind von seinem Wasser abzuschneiden, das irgendwo außerhalb seines Lagers liegen mußte.
Da traf gegen Mitternacht die Meldung ein, daß eine unserer Patrouillen an der Straße N a n u n g u - M a h u a auf einen stärkeren Feind gestoßen sei. Ich mußte befürchten, daß dieser Gegner, den ich der Selbständigkeit seines Auftretens wegen für stark hielt, weiter auf Nanungu vordringen und sich so in den Besitz unserer an dieser
Straße gelagerten Kompagnielasten (Munition, Verbandzeug, Verpflegung, Kranke usw.) sowie der Magazine von Nanungu setzen würde. Ich rückte deshalb noch in der Nacht mit dem Hauptteil meiner Kräfte über Makoti wieder an die Straße Nanungu-Mahua ab. Dicht am Feinde blieben nur starke Patrouillen, die aber nicht bemerkten, daß der Gegner ebenfalls noch während der Nacht seine Stellung räumte und in Richtung auf Mahua abzog. Am 6. Mai stellte sich heraus, daß die Meldung von den starken feindlichen Kräften an der Straße Nanungu-Mahua, die meinen Abmarsch veranlaßt hatte, verkehrt gewesen war; es befand sich dort überhaupt kein Feind. Hauptmann Müller, der das Schießen der englischen Minenwerfer gehört hatte, war in vortrefflicher Initiative aus seinem nordöstlich Mahua gelegenen Lager im Eilmarsch sofort auf den Gefechtslärm losmarschiert und anscheinend für Feind gehalten worden.
Als er auf dem Gefechtsfeld ankam, stellte er fest, daß der Gegner abgerückt war. Der Feind, der aus 4 Kompagnien und einer Maschinengewehrkompagnie bestand, und, nach seinen Befestigungsanlagen zu urteilen, 1000 Mann stark war, war durch unsere wenig mehr als 300 Gewehre — wir waren 62 Europäer und 342 Askari gewesen — vollständig geschlagen worden. Auf seiner Seite waren 14 Europäer und 91 Askari gefallen, 3 Europäer und 3 Askari hatte er an Gefangenen verloren. Außerdem war sein Hospital mit etwa 100 Verwundeten in unsere Hand gefallen; andere Verwundete hat er nach Aussage von Eingeborenen noch mitgenommen. Unsere Verluste betrugen: 6 Europäer, 24 Askari, 5 andere Farbige gefallen, 10 Europäer, 67 Askari und 28 andere Farbige verwundet.
Während diese für uns so erfreulichen Erfolge gegen die westlichen feindlichen Kolonnen erzielt wurden, hatte Abteilung Koehl gegen die feindliche Division, die von Porto Amelia auf Nanungu vordrang, andauernd Gefechte, manchmal von erheblichem Umfange, zu bestehen. Bei Medo hatte der Feind nach seiner eigenen Angabe recht schwere Verluste; in einem Gefecht, das westlich von Medo stattgefunden hatte, war es dem Hauptmann Spangenberg mit seinen 2 Kompagnien gelungen, den Feind sehr gewandt zu umgehen, von rückwärts her an seine leichte
Feldhaubitzbatterie heranzukommen und diese im Sturm zu nehmen. Fast die gesamte Bedienung und Bespannung fiel. Leider war es nicht möglich, die Geschütze und die Munition mitzunehmen. Sie wurden unbrauchbar gemacht. Aber trotz solcher Einzelerfolge mußte Abteilung Koehl weiter zurückweichen. Es nahte der Augenblick, wo sich vielleicht durch rechtzeitiges Eingreifen meiner Hauptkräfte bei der Abteilung Koehl ein durchschlagender Erfolg gegen General Edwards erzielen lassen würde.
Wieder einmal war aber die Verpflegungsfrage ein Bleigewicht für die Bewegungen. Die Feldfrüchte der Landschaft waren im wesentlichen aufgezehrt bis auf den Mtama, der in dieser Gegend früher heranreift als in Deutsch-Ostafrika. Aber er war noch nicht reif. Um nicht rein aus Verpflegungsgründen abrücken zu müssen, halfen wir uns dadurch, daß wir den Mtama durch Trocknen notreif machten. Die Frucht war auch auf diese Weise gut verwertbar, und da in der Gegend sehr viel wuchs, so konnte im allgemeinen jeder so viel bekommen, wie er haben wollte, und keiner litt Not.
Der Bestand der Felder veranlaßte mich, mit den Hauptkräften der Truppe mehr nach Südwesten, in der Richtung auf Mahua, zu marschieren und in der Gegend des Timbaniberges, am Koromaberg, Lager zu beziehen. Von hier aus wollte ich im Notfall nach Süden weiterziehen, um in den fruchtbaren Gegenden der Vereinigung des Malema- und Lurioflusses die dortigen reichen Verpflegungsgebiete auszunutzen. Westlich des Timbaniberges war das Gelände günstig, um ein entscheidendes Gefecht gegen General Edwards aufzunehmen, der der Abteilung des Hauptmann Koehl von Nanungu weiter in südwestlicher Richtung folgte. Das außerordentlich felsige und zerrissene Gelände am Timbaniberg und 6 km nordöstlich davon bis zu der Stelle, auf die die Abteilung Koehl zurückgewichen war, war nicht günstig für ein von mir beabsichtigtes entscheidendes Gefecht. Am 21. Mai verrieten sich neue feindliche Lager westlich der Stellung der Abteilung Koehl durch ihren Rauch. Ich vermutete, daß dieser neue Gegner am 22. Mai der Abteilung Koehl von Westen her in den Rücken marschieren würde. Da habe ich leider versäumt, der Abteilung Koehl den ganz bestimmten Befehl zu geben, sogleich mit ihren Hauptkräften aus dem
ungünstigen Gelände heraus bis südwestlich des Timbaniberges zu rücken. Statt des unzweideutigen Befehls gab ich eine Anweisung, die zu viel Freiheit des Handelns ließ.
So kam es, daß die Abteilung Koehl ihre Träger mit den Munitions- und Bagagelasten erst am 22. Mai vormittags in Marsch setzte. Auch das wäre noch gut gegangen, wenn nicht unglücklicherweise an ihrem Anfange der Gouverneur marschiert wäre, der sich bis dahin bei der Abteilung Koehl aufgehalten hatte. In Verkennung des Ernstes der Lage machte der Gouverneur mitten in dem ungünstigen Gelände, wo er jeden Augenblick der Überraschung durch den Feind ausgesetzt war, ohne sich wirkungsvoll verteidigen zu können, einen längeren Halt. Hierdurch ließen sich die Bagagen der Abteilung Koehl trotz dem ihnen vom Hauptmann Koehl erteilten ausdrücklichen Befehle verleiten, ebenfalls zu halten. Ich selbst erkundete an diesem Tage vormittags noch einmal das südwestlich des Timbaniberges gelegene, recht günstige Gelände und traf hierbei unter anderem den Leutnant Kempner, der tags vorher bei Abteilung Koehl verwundet worden war und zurückgetragen wurde. Bei der Abteilung Koehl selbst, wo seit dem Morgen mehrere Angriffe des Feindes abgeschlagen waren, war Gefechtslärm in weiter Ferne zu hören. Mit Hauptmann Koehl bestand telephonische Verbindung, und ich kehrte, ohne eine Ahnung von den Verhältnissen seiner Bagage zu haben, gegen 11 Uhr vormittags in das Koromalager zurück.
Um 12 Uhr mittags war ich gerade im Lager eingetroffen, als plötzlich Minenwerferfeuer in großer Nähe erscholl, zweifellos zwischen uns und der Abteilung Koehl. Unmittelbar darauf war die Fernsprechverbindung dorthin unterbrochen. Jetzt blieb keine Wahl, als sofort vom Koromalager her mit allen Kräften auf diesen neuen Gegner vorzumarschieren, wobei ich die stille Hoffnung hatte, daß es trotz der Ungunst des Geländes vielleicht gelingen würde, ihn zu überraschen und entscheidend zu schlagen. Nach einer knappen Stunde trafen wir am Timbaniberge ein und warfen vorgeschobene feindliche Abteilungen schnell zurück. Einige versprengte Leute von uns meldeten, daß der Gouverneur und die Bagage des Hauptmann Koehl vom Feinde überraschend angegriffen und alle Lasten
verloren seien. Der Gouverneur selbst sei mit genauer Not entkommen, andere sagten, er sei gefangen genommen worden. Der Feind schoß ziemlich lebhaft mit mehreren Minenwerfern und wurde durch unsere Kompagnien von mehreren Seiten angegriffen. Er hatte aber eine gute Stellung eingenommen, in der er sich verschanzt und einen Teil der erbeuteten Lasten geborgen hatte. Leider nahmen wir ihm nur wenige wieder ab. Aber die feindliche Stellung wurde doch umstellt und unter konzentrisches, für den Feind recht verlustreiches Feuer genommen. Nach einer später erbeuteten Nachricht haben die I. King’s African Rifles allein hierbei etwa 200 Mann verloren.
Bei dieser Einschließung des Feindes unterstützten uns mehrere Kompagnien und Patrouillen des Hauptmanns Koehl. Auch dieser hatte sich mit seinen Hauptkräften gegen den neuen in seinem Rücken auftretenden Feind gewandt und hoffte, denselben schlagen zu können, während eine starke Patrouille, mit der Front nach Nordosten, seinen bisherigen Gegner hinhielt. Diese Patrouille war aber viel zu schwach. Sie wurde zurückgedrängt und mußte von neuem durch Truppen der Abteilung Koehl verstärkt werden. Wenn der Feind auch zweifellos im ganzen erhebliche Verluste erlitten hatte, so war ein durchschlagender Erfolg für uns doch nicht erreichbar. Das Gefecht wurde bei Eintritt der Dunkelheit abgebrochen, und wir rückten in das von mir erkundete günstige Gelände zwischen Timbani- und Koromaberg ab.
Im Lager am Koromaberg hatte sich inzwischen der Gouverneur eingefunden. Er hatte bei dem Abenteuer sämtliche Lasten verloren und wurde durch Unteroffizier Reder, dem bewährten und umsichtigen Führer einer Kolonne, verpflegt. Auch ich steuerte dazu bei, dem Gouverneur aus seiner Verlegenheit zu helfen und verehrte ihm ein paar blaue Strümpfe, die seine Gattin mir im Anfang des Krieges angefertigt hatte, die aber leider abfärbten.
Außer dem sehr fühlbaren Verlust von etwa 70000 Patronen hatten wir auch den Verlust eines größeren Bestandes von Papiernoten — ich glaube, es waren 30000 Rupien — zu beklagen. Meinem Wunsche, statt mit Papiernoten zu bezahlen, lieber Requisitionsscheine auszugeben und dadurch eine Menge
Sicherheitstransporte zu ersparen und unnötige Verluste zu vermeiden, war früher nicht stattgegeben worden. Es waren Millionen Rupien Papiernoten gedruckt worden. Das Mitschleppen derselben war in dem jetzigen Stadium des Krieges eine besondere Last. Um in der Zukunft wenigstens weitere Verluste zu vermeiden, hat auf meine Anregung dann der Intendant einen großen Teil der früher mühsam hergestellten Noten wieder vernichtet.
Dritter Abschnitt
Im Gebiet des Lurio- und Likungoflusses
Am 23. Mai wurden vom Koromalager auf einem quer durch den Busch nach Koriwa abgesteckten Wege der Rest unserer Lasten und der Hauptteil der Truppe in Bewegung gesetzt. Der Hauptteil unserer Trägerkolonnen und die Kranken waren vorangegangen. Die Nachhut unter Hauptmann Otto blieb noch einige Tage am Koromaberge und wies dort mehrere Angriffe des Feindes erfolgreich ab. Es schien, als ob der Gegner wieder einmal nach der Beendigung einer konzentrischen Operation dort bei Timbani den Hauptteil seiner Truppen vereinigt hätte und vor Antritt des Weitermarsches einiger Zeit zur Regelung seines Nachschubs bedurfte. Zurückkehrende Patrouillen meldeten starken Autoverkehr auf der Straße Nanungu-Timbaniberg. Andere Patrouillen berichteten von dem Vormarsch feindlicher Kräfte von Osten her auf dem nördlichen Lurioufer.
Vom Feinde unbelästigt marschierte ich zunächst in die reiche Gegend von Kwiri, südlich Mahua, und dann von dort aus weiter zum Luriofluß. Dabei stellte es sich aber heraus, daß ein Teil unserer Schwerverwundeten und Kranken diese mehrtägigen Märsche in ihren „Maschillen“ (Tragbahren) nicht würde durchhalten können. Da war es nicht leicht, für ärztliche Pflege zu sorgen. Es waren zu wenig Pfleger da, um die Kranken einzeln von Fall zu Fall zurücklassen zu können. So blieb nichts anderes übrig, als die Kranken von Zeit zu Zeit zu sammeln und dann gemeinsam unter einem Arzt als vollständiges Lazarett zu etablieren und sich endgültig von ihnen zu trennen. Auch der Chefarzt der Schutztruppe, Generaloberarzt Dr. Meixner war bei Kwiri mit einem solchen Lazarett liegen geblieben. Von Leutnant d. Res. Schaefer, der uns bei den Vorbereitungen zum Gefecht von Jassini so ausgezeichnete Dienste geleistet hatte, und der jetzt an Schwarzwasserfieber schwer erkrankt war, nahm ich bei dieser Gelegenheit Abschied. Der erfahrene Afrikaner war sich über