
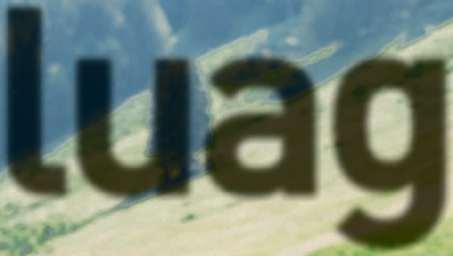

L ä n d l e Al p s ch
w e i n e a u f d e r W e i ß e n b a c h a l p e
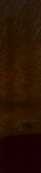
K r a m e r s Fe l d L ä n d l e G e m ü s e

D e r E d e l b r e n n e r -
G e r h a r d Po l z h o f e r
L ä n d l e O b s t v e r e d e l u n g



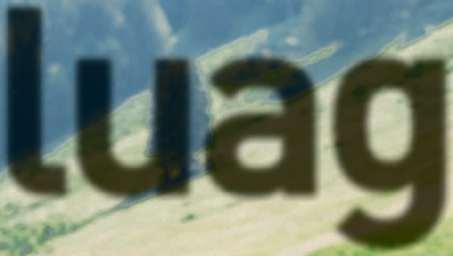

L ä n d l e Al p s ch
w e i n e a u f d e r W e i ß e n b a c h a l p e
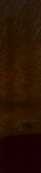
K r a m e r s Fe l d L ä n d l e G e m ü s e

D e r E d e l b r e n n e r -
G e r h a r d Po l z h o f e r
L ä n d l e O b s t v e r e d e l u n g

Wenn die besten Bio-Produkte aus der Region kommen!
Weitere b’sundrige Spezi de BIO UND REGIONAL


Gut für dich. Gut für die Natur. Gut fürs Ländle.

Die heurige Alpsaison war und ist für Älplerinnen und Älpler, das Alpvieh, die Tierbesitzer:innen und die Alpverantwortlichen eine Zeit des Bangens. Wie schon in den vergangenen Jahren hat der Wolf mehrfach zugeschlagen und wahllos Schafe, Ziegen, Rinder und Kälber grausam gerissen. Ein Szenario, vor dem wir immer wieder warnen und welches sich selbst mit Herdeschutzmaßnahmen nicht verhindern lässt. Diese Angriffe treffen unsere Alpwirtschaft ins Mark und stellen auch eine latente Gefahr für Freizeit- und Erholungssuchende dar Ohne Pflege der Alpen fehlt auch dem Sommer- und Wintertourismus die wichtigste Grundlage. Zudem ist jeder Tierverlust eine Tragödie und eine enorme psychische Belastung für unsere Älplerinnen und Älpler. Vermehrt häufen sich auch Meldungen von Hirten, dass ihre Tiere aufgrund der Wolfspräsenz zunehmend nervöser und weniger zutraulich sind und aggressiv auf Hunde reagieren. Ganz zu schweigen von den Bäurinnen und Bauern, die ihre Tiere künftig nicht mehr alpen wollen.
Diese Entwicklung ist nicht tragbar Für Schadwölfe, die Nutztiere reißen, gibt es in Vorarlberg keinen Platz Da hilft nur deren Entnahme, für die auch die bestehende EU-Richtlinie vorgesehen ist. Und trotzdem fühlen sich in der Thematik immer wieder selbst ernannte „Wolfsversteher“ und Organisationen bemüßigt, die Wolfsansiedelung durch bürokratische Verhinderung von Abschüssen zu forcieren. Man muss sich fragen, ob es hier tatsächlich noch um den Wolf geht, der in Europa in keiner Weise vom Aussterben bedroht ist, oder einfach nur um pure Ideologie. Es geht nicht um die Ausrottung der Wölfe, aber das Thema dient zunehmend als Spielplatz für profilierungssüchtige Theoretiker:innen und vermeintliche Tierschützer:innen. Vermeintlich deshalb, weil der Tierschutz für Raubtiere, aber in dem Fall nicht für Nutztiere oder gar Menschen gilt. Dass diese Einstellung die gesamte Alpwirtschaft gefährdet und die Bauernfamilien verbittert, kümmert nicht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was noch passieren muss, bis die Diskussion endlich versachlicht wird und die daraus notwendigen Folgerungen und Entscheidungen umgesetzt werden. In einem beliebten Naturpark in Utrecht/Holland wurden laut Medienberichten im Juli zwei Kinder von einem Wolf angegriffen, eines davon wurde verletzt und seither wird vor Ausflügen ins Naherholungsgebiet gewarnt. Soweit darf es nicht kommen!

Josef Moosbrugger Präsident der Landwirtschaftskammer


08/2024
Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH und Landwirtschaftskammer Vorarlberg Montfortstraße 11/7, 6900 Bregenz
T 05574/400-700, laendle@lk-vbg at www laendle at, vbg lko at
Redaktion: Martin Wagner, Christiane Fiegl, Dietmar Hofer, Bernhard Ammann, Harald Rammel
Layout: Christiane Fiegl
Bildnachweis: Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH, LK Vorarlberg, Land Vorarlberg, Christoph Pallinger, manuelpaul.com, Michael Kreyer, Weißengruber & Partner, Alexandra Serra, Harald Rammel, KäseStrasse Bregenzerwald, Prof. Dr Wilhelm Windisch, Udo Mittelberger, Casino Bregenz, Krammers Feld, Saskia Bauer, Vorarlberg Tourismus, gettyimages, AdobeStock
MIT UNTERSTÜTZUNG VON

Sonntag, 1. September, 9.30 bis 16.00 Uhr, Schorenareal Dornbirn
BRÜCKENGASSE 10

Wir laden Sie herzlich ein, die bäuerliche Welt etwas näher kennenzulernen Kommen Sie zu unserem ländlichen Marktplatz in das Schorenareal. Lernen Sie unsere Bäuerinnen und Bauern kennen, tauchen Sie in die bäuerliche Tierwelt ein und genießen Sie die vielen köstlichen Spezialitäten
unserer heimischen Landwirtschaft. Das spannende Programm bietet Information, Unterhaltung und Kulinarik für die ganze Familie.
Marktplatz • Regionale Spezialitäten • Bäuerinnen-Café • Bauernhoftiere im Stall und im Showprogramm (11 und 14 Uhr in der Arena) • Musik • Oldtimer Traktoren Ausstellung • Kinderprogramm • Heuhüpfburg • Gewinnspiel • Eintritt frei
Nur bei trockener Witterung. Wir bitten um eine umweltfreundliche Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad Es gibt keine Parkplätze am Festgelände. Brückengasse wegen Bauarbeiten gesperrt.
Auf dieser Veranstaltung werden Fotos /Videoaufnahmen angefertigt und für eigene Werbe- und Informationsmaßnahmen in verschiedensten (sozialen) Medien, Publikationen sowie Internetseiten aus berechtigtem Interesse des Veranstalters veröffentlicht


Regionale Produzent:innen
06 Älpler seit Kindheitstagen
Bereits die sechste Saison abseits des Tales verbringt die Jungfamilie Ennemoser auf der Weißenbachalpe oberhalb von Schnepfau.
12 Ein Freigeist mit dem Spirit für alte Obstsorten
Gerhard Polzhofer macht aus Streuobst edle Brände und ist Partner des neuen Gütesiegel Programmes Ländle Obstveredelung.
16 Ohne Miteinander würde es nicht funktionieren
Der Thüringer Ländle Kartoffel Produzent Michael Tschann hat die Landwirtschaft zu seinem Hauptberuf gemacht.
22 Wie Kramers-Läden für frischen Wind sorgen
Klaus Kramer baut seit dem letzten Jahr Gemüse in Doren an und verkauft dieses auch frisch in seinen Läden.
25 Kein Sommer ohne Kräuter
Egal ob herb, süß, sauer, mit oder ohne Alkohol – es gibt zwei Zutaten, die niemals in einem Erfrischungsgetränk fehlen dürfen – Eis und Kräuter!
26 Warum ein Pensionist bei Bäumen auf die Jugend setzt
Mit Manfred Nägele verabschiedet sich ein Urgestein der Ländle Apfel Produzenten in die wohlverdiente Pension.
„nochgfrogt“
18 Professor Dr Windisch erklärt, warum Nutztiere für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion wichtig sind.
Gemüse neu entdeckt
32 Würzige Wunderpflanze – Knollenfenchel. Infos über Verwendung und Anbau.


08 Klimawandel Fakten
Spannende Infos und Zahlen rund um das Thema Klimawandel.
33 Mehrwert beim Gemüsekauf Der Gemüsekauf bei den Vorarlberger Gärtnern und Floristen lohnt sich, auch besonders für das Klima.
28 „Vorarlberg am Teller“ setzt neue Maßstäbe für Regionalität Mit 42 ausgezeichneten Küchen bei der „Vorarlberg am Teller“-Verleihung im Juni war 2023 das erfolgreichste Jahr seit Bestehen der Initiative.
30 Mit Blick über den Tellerrand
In der „Kantine.L“ heißt es seit dem letzten Jahr „Vorarlberg am Teller“. Gemeinsam mit der Lebenshilfe wird an acht Standorten im Land frisch gekocht.
04 Tag der Landwirtschaft
Am 1. September ist Tag der Landwirtschaft. Dabei wird den Besucher:innen einiges geboten!
14 Dornbirner Herbstmesse Zum 76. Mal findet heuer die Dornbirner Herbstmesse statt und auch dieses Jahr warten wieder viele regionale Produzent:innen und Köstlichkeiten auf Sie!
34 Mountainbiketipp Panorama-E-Mountainbike-Tour in Lech Zürs am Arlberg.



selbst, das der Pietrain-Schweine, deren Fleisch als sehr mager und bekömmlich gilt, ist ab Ende August im Handel erhältlich und wird in Paketen verkauft. Bei unserem Besuch suhlen die DurocSchweine genüsslich herum, während es sich ihre buntbefleckten Artgenossen im geräumigen Stall mit viel Einstreu gemütlich gemacht haben und schnarchend vor sich hindösen. Sie genießen den warmen, aber nicht heißen Nachmittag unter ihresgleichen Stress kennen die Schweine hier oben nicht. „Ich will, dass es den Tieren gut geht. Den Schweinen ebenso wie den Kühen und dem Jungvieh“, sagt der ausgebildete Landwirtschaftsmeister, der trotz seines noch relativ jungen Alters bereits über viel Alperfahrung verfügt. „Ich war neun, als ich das erste Mal auf einer Alpe war Das zog sich dann über die gesamte Schulzeit hindurch. Wenn man das einmal kennt, will man es immer wieder“, spricht die Begeisterung aus dem gelernten Zimmerer, der seit 2016 hauptberuflich als Landwirt tätig ist Damals pachtete er einen Hof in Buch, den die Familie bewohnt und bewirtschaftet, wenn sie nicht auf der Alp ist.
Der einzige Mann auf der Alp Platz ist oberhalb von Schnepfau mehr als genug. Zwischen den beiden Felsen erstreckt sich das Wirkungsgebiet der Familie Ennemoser Rund 42 Hektar gilt es instand zu halten. Die Weidepflege zählt da ebenso dazu wie Stall ausmisten oder die Kühe zweimal täglich melken und sie dann wieder ins Freie treiben. Als einziger Mann ist Richard für diese Arbeiten verantwortlich. Seine Frau kümmert sich um den Haushalt, die Wäsche – bis zu drei Waschmaschinen täglich fallen an – um die Kinder und um die Vermarktung der Produkte, die unter dem Label „Wertvoll“ in Eigenregie erfolgt. „Einzig beim Käse nimmt uns die Firma Rupp die Hälfte ab.“ Rund 250 Laibe werden pro Saison hergestellt. Mit der 21-jährigen Andrea ist dafür eine junge Sennerin verantwortlich.

anand und schaffat zämm“, wie es auf gut Vorarlbergisch heißt. Auch wenn die Sennerin – ebenso wie die Praktikantinnen – aus Süddeutschland kommen. Abends setzt sich die Alp-Crew zusammen, spielt Activity oder jasst. Ein bisschen Zeit für Geselligkeit muss bleiben, spätestens um 23 Uhr geht es ins Bett, um für den nächsten Tag gerüstet zu sein.
Keine leichten Wetterbedingungen
Die Sommer sind nicht leicht und das Wetter wird immer unberechenbarer Dieses Jahr war es der viele Regen, der einige Probleme bereitete. An manchen Tagen war die Temperatur sogar nahe am Gefrierpunkt. „Da mussten wir den Ofen in Betrieb nehmen, damit es die Kinder nicht zu kalt haben.“ Viel schlimmer empfindet Richard Ennemoser allerdings Trockenheit oder gar Dürre. „Das macht uns weit mehr zu schaffen.“ Man trotzt jedoch allem Unbill. Wenn es im Frühherbst wieder ins Tal geht und alle Siebensachen gepackt sind, blicken alle stolz auf den Sommer zurück, um im nächsten Frühling schon wieder sehnsüchtig Richtung Alp zu blicken.
Weißenbachalpe
Familie Ennemoser
Weißenbachalpe 6882 Schnepfau T 0664 23 805 84 E richard.ennemoser@vol.at
Produkte mit Ländle Gütesiegel: Ländle Alpschwein (Duroc Freilandschweine Pakete nur in Direktvermarktung auf Vorbestellung)
Weitere Produkte: Kalbfleisch, Wurst, Alpkäse, Alpbutter, Ziegenfrischkäse
Direktvermarktung ab Hof
ALPZEIT: Anfang Juni – Anfang September
BEWIRTUNG: findet nur im Außenbereich statt (Bretteljause, Getränke usw.)
SENNEREIBESICHTIGUNGEN bei Voranmeldungen
www.laendle.at/alpschwein
Die globale Land- und Forstwirtschaft inkl. sonstiger Landnutzung ist für ca 22% der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich Diese Emissionen lassen sich in zwei Bereiche unterteilen:
Jene aus der Landnutzung und Landnutzungsänderung (z B Abholzung von Regenwäldern) und jene direkt aus der Landwirtschaft (Bewirtschaftung der Felder und Äcker, Tierhaltung). In industrialisierten Ländern wie Österreich arbeitet die Landwirtschaft effizienter und zumeist klimaschonender als im globalen Durchschnitt. Trotzdem hat auch die heimische und EU-Landwirtschaft Auswirkungen auf Umwelt und Klima Dabei ist allerdings
TREIBHAUSGASVERURSACHER AUFGETEILT IN SEKTIONEN:*
Quelle: Zahlen von 2019, IPCC, 2022, 6 Sachstandsbericht Workinggroup III, eigene Darstellung auf Basis gerundeter Werte
GLOBAL:


wichtig, zwischen lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln und nicht lebensnotwendigen Gütern zu unterscheiden Die Produktion von Lebensmitteln wird immer mit Emissionen verbunden sein, ist aber eine Grundvoraussetzung für das Leben Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass die Landwirtschaft nicht nur Emissionen verursacht, sondern auch als Kohlenstoffspeicher fungiert und eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Artenvielfalt und der Gestaltung von Lebensräumen spielt Daher bleibt es weiterhin entscheidend, die Effizienz zu steigern und umweltfreundlichere Praktiken zu fördern
Quelle: Zahlen von 2020, Umweltbundesamt 2022, Klimaschutzbericht 2022, S. 78, eigene Darstellung auf Basis gerundeter Werte

Eisen- und Stahlproduktion, Strom- und Wärmeproduktion, Raffinerien, chemische Industrie, fluorierte Gase, Nahrungs- und Genussmittelindustrie
GEBÄUDE LANDWIRTSCHAFT inkl. Landnutzung Raumwärme, Warmwasser & Abfallwirtschaft
GRÜNDE FÜR EINE HÖHERE EFFIZIENZ IN ÖSTERREICH: 28% 47% 11% 14% ENERGIE & INDUSTRIE VERKEHR
• Modernere Produktionsmethoden:
Die Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln erfolgt fast ausschließlich maschinell, oft mit präzisen Systemen. Das reduziert die Verschwendung und somit negative Klimaauswirkungen.
• Stickstoffnutzungseffizienz:
Die Stickstoffnutzungseffizienz liegt in Österreich bei 86%, während sie in China und Indien nur 32–34% beträgt. Somit wird in Österreich ein größerer Anteil des ausgebrachten Düngers tatsächlich von den Pflanzen aufgenommen, während in anderen Ländern ein großer Teil in die Umwelt gelangt.
Straßen-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr
• Milch- und Rindfleischproduktion: In Österreich herrscht eine hohe Selbstversorgung mit Futter sowie eine hohe Milchleistung pro Kuh. Dies führt zu geringen Emissionen aus Landnutzungsänderungen, da kaum Importfuttermittel aus Regenwaldgebieten benötigt werden. Der hohe Anteil an Gras in der Futterversorgung trägt ebenfalls zur Effizienz bei. Ländle Gütesiegel Produkte sind durchgehend gentechnikfrei.
• Landnutzungsänderung: Die Abholzung von Regenwald ist für die Futtermittelproduktion in Österreich kaum relevant. Emissionen entstehen hier vielmehr durch die Umwandlung von Wiesen in Ackerflächen oder aus dem früheren Trockenlegen von Mooren. Obwohl diese Maßnahmen weniger intensiv sind als die Abholzung des Regenwaldes, setzen sie dennoch CO2 frei.
Quelle: Land schafft Leben, Der Klimawandel in Zahlen 2023
Die Landwirtschaft und der Landnutzungssektor werden oft als QUELLEN von Treibhausgasen betrachtet. Kulturpflanzen nehmen während ihres Wachstums zwar CO2 aus der Luft auf, was jedoch meist nur kurzfristig ist. Nach der Ernte und dem Verzehr gelangt das CO2 wieder in die Atmosphäre.
SENKE durch langfristige Kohlenstoffbindung Langfristig kann CO2 durch die Umwandlung von Ackerland in Grünland oder Wald gebunden werden – dies bezeichnet man als eine KOHLENSTOFFSENKE Grünland und Wälder speichern Kohlenstoff in ihrer Biomasse und im Boden, da diese Flächen nicht umgepflügt werden. Laut einer FAO-Studie aus dem Jahr 2023 ist die jährliche Kohlenstoffbilanz der meisten Grünlandböden weltweit positiv Das bedeutet, sie lagern zusätzlichen Kohlenstoff ein oder können den vorhandenen Kohlenstoffgehalt zumindest halten. In Österreich bleibt der Boden auf Wiesen und Weiden ungestört, wodurch Humus aufgebaut und Kohlenstoff gespeichert werden kann.

ALPEN BIETET EINE VIELZAHL VON VORTEILEN:
Landfläche:
Die Alpwirtschaft hat eine jahrhundertealte Tradition und prägt die Kulturlandschaft der Alpen. Kühe auf den Alpen gehören zur Identität vieler Regionen und sind ein wichtiger Bestandteil des alpinen Lebens.
Tourismus & Landschaftspflege:
Der Tourismus profitiert von den gepflegten Weiden, der Landschaftspflege durch die Älpler:innen und den Kühen auf der Weide. Die Alpwirtschaft trägt zur Attraktivität der Regionen bei und schafft eine Win-win-Situation für Landwirt:innen, Tourist:innen und die Umwelt.
ALS KOHLENSTOFFSENKEN
Sie speichern CO2 in Bäumen und anderen Pflanzen sowie im Waldboden. Wälder, die nachhaltig bewirtschaftet oder aufgeforstet werden, können langfristig CO2 binden und so zur Reduktion der Treibhausgase beitragen
MOORE
ALS KOHLENSTOFFSENKEN
Sie speichern große Mengen an Kohlenstoff in ihrem Torf Bei der Wiedervernässung entwässerter Moore kann die Freisetzung von gespeichertem CO2 verhindert und zusätzliches CO2 gebunden werden. In Vorarlberg liegt übrigens 1/4 aller Moore Österreichs.
ACKER
ALS SENKE UND QUELLE
Auch Ackerland kann sowohl CO2 speichern als auch freisetzen. Humusaufbauende Maßnahmen dienen als Senke.
GRÖSSTE QUELLE
Die größte Emissionsquelle im Bereich Landnutzung in Österreich ist die Umwandlung von Land in Siedlungsund Verkehrsflächen. Diese Umwandlungen führen zu erheblichen CO2-Emissionen.

Erhalt der Biodiversität:
Die Beweidung durch Kühe auf den Alpen trägt zur Erhaltung der Biodiversität bei. Durch die extensive Bewirtschaftung werden artenreiche Wiesen geschaffen, die vielen Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum bieten.
Futterqualität & Standortpflege: Die Beweidung mit Kühen verbessert die Futterqualität auf den Alpenflächen und beugt dem Verfall der Standorte vor, was zur langfristigen Erhaltung der Alpenlandschaft beiträgt.
Effiziente Nutzung der Landfläche: Die Beweidung von marginalen Alpenflächen mit Kühen ermöglicht eine sinnvolle Nutzung dieser Flächen, die aufgrund ihrer Topografie und klimatischen Bedingungen nicht für Siedlungen oder den Anbau von Nutzpflanzen geeignet sind. Dies trägt zur Landschaftspflege, Erhaltung der Biodiversität und nachhaltigen Landnutzung bei, was insgesamt zum Klimaschutz beiträgt.
Quelle: www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/schweizer-alpwirtschaft_-der-tourismus-profitiert-von-kuehen-auf-der-alp/4333754 (Abfrage 27.02.2024)
Vortrag „Die Alpenregion (besser) ohne Nutztiere“, Michael Kreuzer, Emeritus ETH

Carbon Farming umfasst Maßnahmen zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre und zur dauerhaften Speicherung in landwirtschaftlich genutzten Flächen. Dies kann durch Aufforstung, die Umwandlung von Ackerland in Grünland oder die Wiederherstellung von Mooren und Feuchtgebieten geschehen. Auch auf bestehenden Ackerflächen lässt sich der Humusgehalt erhöhen, z. B. durch den Anbau von Zwischenfrüchten oder konservierende Bodenbearbeitung, bei der der Boden nicht mehr gepflügt, sondern nur minimal bearbeitet wird. Agroforstwirtschaft, die Integration von Gehölzen in landwirtschaftliche Flächen, trägt ebenfalls zur Kohlenstoffbindung bei. Die Richtlinien des Ländle Gütesiegels schreiben solche Kriterien je nach Produkt ebenfalls vor (z. B. Begrünung der Fahrgassen im Ländle Apfel Programm)
Das Agrar-Umweltprogramm ÖPUL unterstützt seit 1995 finanziell Maßnahmen zur Steigerung und Stabilisierung des Humusgehalts von Ackerböden. Untersuchungen zeigen, dass diese Maßnahmen den Humusgehalt in den ersten Jahren nach Einführung der Programme deutlich erhöht haben und auf hohem Niveau stabil halten. Weitere Erhöhungen des Humusgehalts sind durch umfassendere Veränderungen in der Bewirtschaftung erreichbar, wie z. B. die Direktsaat oder der vermehrte Anbau von Kleegras oder Luzerne, die Stickstoff aus der Luft sammeln und den Boden anreichern.
Durchschnittliche Größe der landwirtschaftlichen Betriebe (nur landwirtschaftlich genutzte Fläche betrachtet)
ha WAS IST EIGENTLICH CARBON FARMING?

Quellen: STATISTIK AUSTRIA, Agrarstrukturerhebung Erstellt am 12.07.2022 –Rundungsdifferenzen technisch bedingt; BMEL-Statistik: Tabellen zur Landwirtschaft, 2020 List of Reports and Publications | 2022 Census of Agriculture | USDA/NASS
Der CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln wird standardmäßig per 1 Kilogramm Lebensmittel gerechnet. Wenn man sich aber den CO2-Fußabdruck pro Nährwert anschaut und nicht nur das Gewicht zählt, sehen die Zahlen für tierische Lebensmittel schon etwas anders aus.
PRO 1 Kilogramm Lebensmittel / Standard
0,9 kg



PRO 100 g EIWEISS


PRO 1.000 KILOKALORIEN


PRO 100 g FETT
2-Äquivalente
2,64 kg
2,25 kg


Der CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln ändert sich deutlich, wenn man ihn nach Nährstoffen statt nach Gewicht betrachtet. Das zeigt, wie wichtig es ist, solche Werte differenzierter zu betrachten, um seine Entscheidungen bewusst treffen zu können.




» erntedank « den Herbst genießen mit qualitativ hochwertigem Bio-Fleisch aus Vorarlberg



VORARLBERGER OBERLAND
Bestellschluss 1Woche vor Auslieferung


In der Schweiz, wo Gerhard Polzhofer den Firmensitz seines kleinen Familienunternehmens hat, gilt er offiziell als Erfinder So steht es im Gewerbeschein eingetragen. Der 63-jährige Lustenauer hat Behandlungsgeräte entwickelt, die im medizinischen, therapeutischen und kosmetischen Bereich zum Einsatz kommen. Ein Freigeist ist er allemal und von seiner Umtriebigkeit hat Polzhofer auch in einem Alter nichts verloren, in dem andere schon längst an den Ruhestand denken. „Ich könnte mir das Nichtstun gar nicht vorstellen“, sagt er und holt aus einem Aktenordner einen Plan heraus. Dort aufgezeichnet ist ein 20.000 Quadratmeter großes Areal von der Wolfurter Bahnhofstraße Richtung Kreiennest, das er mit 100 Hochstammbäumen bestücken will. Noch fehlen die letzten Details, aber das Projekt, das von der Gemeinde befürwortet wird, steht kurz vor der Umsetzung. „Es geht mir vor allem um den Erhalt oder die Wiederbelebung von alten Sorten.“
Gerhard Polzhofer macht aus Streuobst edle Brände. Eine Besonderheit ist sein Most, den er zu Cider und Crémant verarbeitet. Hochstammbäume haben es dem 63-jährigen Lustenauer besonders angetan. In Wolfurt will er 100 solche setzen.
Obmann der VAKÖ
Hoch hinauf wollte der gebürtige Hohenemser eigentlich schon immer Weniger des Geldes und Ruhmes wegen, sondern vielmehr um seine Ideen verwirklichen zu können. Deshalb fand er in der Selbständigkeit auch seine Berufung. Dass er aber einmal zum erfolgreichen Schnapsbrenner und Obmann der Vereinigung der Abfindungs- & Kleinbrenner Österreichs (VAKÖ) wird, hätte der Tüftler in jungen Jahren nie gedacht. Erst mit Anfang 40 brannte er seinen ersten Hochprozentigen, als er einem seiner Kunden eine Himbeerplantage abkaufte. Fortan faszinierte den Freigeist die Arbeit mit dem Weingeist, die ihn zu immer mehr Kreationen inspirierte. Der Spirit, stets etwas Neues zu schaffen oder zu verbessern, ließ ihn nicht mehr los. Seine Brände tragen seit heuer das Ländle Gütesiegel im neu geschaffenen Ländle Obstveredelungs Programm. Aber besonders die Streuobstwiesen und Hochstammbäume haben es Polzhofer

angetan. „Da geht es um ein Kulturgut, das unbedingt erhalten bleiben muss. Denn in den letzten hundert Jahren ging rund die Hälfte davon verloren.“ Der Grund liegt in der schwierigen Bewirtschaftung der Obstbäume, die zum Teil über 12 Meter hoch werden können. Die Bäume benötigen auch regelmäßige Pflege. „Bei vielen kommt zudem noch die Erinnerung an die eigene Kindheit hoch. Da hieß es nach der Schule, mühsam das heruntergefallene Obst vom Boden aufzulesen, anstatt zu spielen.“
Obst fällt ins Netz
werden in einem Rüttelbrett speziell gelagert und müssen in regelmäßigen Abständen leicht gedreht werden. Wichtig ist, dass sich dabei die Maske aus den Hefepilzen langsam Richtung Flaschenhals bewegt und sich dort festsetzt. Zum Schluss kommen sie kopfüber in ein Kältebad mit 28 Minusgraden. Der eingefrorene Hefepropf kann somit entfernt werden – „degorgieren” wird dieser Vorgang in der Fachsprache genannt. Der entstandene Volumenverlust wird mit einer Dosage aufgefüllt und wieder verschlossen. Verkauft werden die Produkte unter den Namen „Cider” und „Crémant.” Das Wort leitet sich vom französischen „crémeux” ab, was so viel wie „cremig oder weich” bedeutet. Exakt 1.000 Flaschen pro Jahr füllt Polzhofer auf diese Art ab. Vertrieben werden sie ausschließlich in Selbstvermarktung. „Bevor ich eine Flasche weitergebe, habe ich sie sicher 50 bis 60 Mal in der Hand gehabt. Praktisch bleibt die ganze Wertschöpfung von der Frucht bis zum Endprodukt in meinen Händen. Für mich ist es ein Hobby, da steckt meine ganze Liebe drin.“

Polzhofer, der 24 Hochbaumstämme in Sulz bewirtschaftet, arbeitet jedoch mit modernen Methoden. Er spannt ein Netz um den Baum, in welches die Birnen oder Äpfel hineinfallen, wenn sie reif sind. Gemeinsam mit seinem sehr guten Freund Meinhard Kronberger wird die Ernte dann täglich abgeholt. Nur mit dessen Hilfe kann die Erntequalität auch gewährleistet werden. „Es ist wichtig, dass das Obst keinen Bodenkontakt hat. Dann lässt es sich viel leichter verarbeiten, weil es nicht anfault oder matschig wird“, erklärt der angehende Obstbau-Landwirt, der sich viel Detailwissen angeeignet hat. So besucht er auch regelmäßig die Höhere Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg und viele weitere Kurse zum Thema Obstverarbeitung in Vorarlberg und dem grenznahen Umland. Im Keller seines Wohnhauses in Lustenau hat er seine kleine Brennerei eingerichtet. Neben den klassischen Bränden hat sich der 63-Jährige auf die Verarbeitung von Most konzentriert. Die Besonderheit: Er arbeitet dabei als Einziger in Vorarlberg nach der traditionellen Champagner-Methode Die Flaschen
Alles was Gerhard Polzhofer in seinem Leben anpackt, macht er mit voller Überzeugung. Auch die geplanten hundert Hochstammbäume in Wolfurt sollen zum Vorzeigeobjekt werden, das andere Gemeinden zum Nachahmen animieren soll. Schließlich handelt es sich dabei um ein sehr nachhaltiges und langlebiges Projekt und damit um einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Die Apfelbäume haben eine Lebensdauer von gut 80 Jahren, Birnenbäume können sogar weit über 100 Jahre werden. „Ich bewirtschafte einen 130 Jahre alten Birnenbaum, der im Vorjahr 700 Kilogramm Ernte abgeworfen hat.“ In Wolfurt rechnet der Projektinitiator mit bis zu 50.000 Kilo Streuobst pro Jahr Bewirtschaftet sollen sie von interessierten Personen werden. Anfragen dafür hat er schon. Und eines hat sich Polzhofer in den Kopf gesetzt. Die Subira, die einst als Landesfrucht Vorarlbergs galt, und jetzt kaum mehr zu finden ist, soll eine Renaissance erleben. „Sie ist prädestiniert für Wolfurt, weil sie ursprünglich von dort stammt.“ Denn auch ein Tüftler und Freigeist muss nicht immer das Rad neu erfinden, sondern auf das Altbewährte auf neuem Untergrund setzen.
Testen Sie ihr Ländle Wissen! Beantworten Sie Fragen zu heimischen Lebensmitteln und gewinnen Sie Sofortpreise wie Kochlöffel, Stofftaschen oder Gutscheine für die Käsestraße oder auch Broger Whiskey



Köstlichkeiten zum Probieren
Sigrid Gasser (laendlekitchen.at) und Christoph Ott zaubern vor Ort mit Ländle Produkten kleine Köstlichkeiten zum Probieren. Überzeugen Sie sich von der hervorragenden Qualität und Vielfalt unserer heimischen Lebensmittel.

Partner:innen.
Mi, 4.9. Familie Witzemann, Ländle Apfel
Do, 5.9. Gerhard Polzhofer, Ländle Obstveredelung
Fr, 6.9. Dornerhof, Ländle Bio Rind
Sa, 7.9. Schroffalamm, Ländle Lamm und Ländle Ziegenkitz
So, 8.9. Stadlerhof, Ländle Schwein


Slow Food Preisträger Dr Richard Dietrich bietet regionale Kulinarik aus Überzeugung: Ob Riebel Chips, das neue Knusper Müsli mit wertvollem Dörrobst aus dem Sortengarten oder Birnenessige, wie der aromatische ZWADL. Regionale Spezialitäten für Gastronomie und Haushalt.
www.dietrich-kostbarkeiten.at
AUSSTELLER: 7 2

Die Kinderstation widmet sich dem Thema „regionale sowie saisonale Ernährung“ und der Fragestellung: Welchen Einfluss hat die Herkunft von Lebensmitteln auf unser Klima? Als Belohnung gibt`s einen Ländle Apfel.




Für hungrige Besucher:innen zaubert die Ländle Gastronomie Köstlichkeiten aus besten regionalen Lebensmitteln. Machen Sie eine Pause vom Messetrubel und verweilen Sie z. B. bei würzigen Kässpätzle oder der berühmten Ländle Kalbsbratwurst vom Grill.
www.laendlegastronomie.at
Regionales Gemüse, erntefrisch nach Hause geliefert –ganz einfach mit der Ländle Gemüsekiste! Lassen Sie sich von Michael beraten, welche Kiste am besten zu Ihnen passt und erhalten Sie schon bald Ihre regionalen Vitamine regelmäßig und bequem nach Hause.
www.laendle.gemuesekiste.at


Ländle Kartoffeln sind eine besondere Spezialität, denn die Anbauflächen sind rar und die Bodenbedingungen nicht einfach. Einer der wenigen im Land, der auf die tollen Knollen setzt, ist Michael Tschann. Der Thüringer arbeitet dabei mit einem wahren Kartoffel-Experten zusammen.
Vierzig Ar ist die Fläche groß, auf der Michael Tschann Kartoffeln anbaut. Dieses in der Landwirtschaft verwendete Maß entspricht rund 4.000 Quadratmetern. Ein Minifeld im Vergleich zu den großen Kartoffelanbaugebieten. „Ich bräuchte allein das Zehnfache an Fläche, nur um ganz Thüringen mit Kartoffeln versorgen zu können“, hat der 53-jährige hauptberufliche Landwirt errechnet. Dabei zählt die Gemeinde am Eingang des Großen Walsertals gerade mal 2.300 Einwohner, also ca. 0,5 Prozent der Gesamtbevölkerungszahl Vorarlbergs. Umso mehr zählt das Engagement, wenn es darum geht, die heimischen Äcker mit den so vielseitigen Feldfrüchten zu bestücken. „Bei uns am Hof hat das schon eine lange Tradition. Meine Eltern haben damit bereits in den 1960er-


Jahren begonnen“, berichtet Michael, der das Anwesen vor 18 Jahren übernommen hat. Der vierfache Vater führt den Lärchenhof mit seiner Frau Edith in zweiter Generation weiter
Seit sechs Jahren hauptberuflich Landwirt
Der gelernte Tischler hat es geschafft, dass die Landwirtschaft zu seinem Hauptberuf geworden ist. „Vor sechs Jahren habe ich mich dazu entschieden“, sieht er – trotz des oft betonten Bauernsterbens – durchaus Zukunft für die Branche. Der Schlüssel dazu liegt in der Zusammenarbeit. Was den Kartoffelanbau betrifft, kooperiert er mit Thomas Bischof, der als wahrer Fachmann in Sachen Erdäpfel gilt. Bischof – Besitzer des Gravishofes in Ludesch –baut sie nicht nur selbst auf vier Hektar an, sondern betreut auch noch die Kartoffelfelder von zehn weiteren Betrieben in der Region. Darunter auch jenes von Michael Tschann. „Wir suchen im Herbst die Sorten aus und Thomas bestellt die Saatkartoffeln. Im Frühling
bereite ich dann den Acker für die Saat vor.“ Aktuell sind die mehlige Karelia, die festkochende Belana und die rotschalige Laura seine Hauptsorten. Hinzu kommen noch die Frühkartoffeln, die vom Partnerbetrieb Thomas Bischof stammen. Verkauft wird direkt ab Hof.
Der Kartoffelanbau im Walgau, welcher rund ein Siebtel der Vorarlberger Gesamtproduktion ausmacht, ist trotz alter Tradition kein leichtes Unterfangen. Die Böden sind im Gegensatz zum Vorarlberger Unterland sehr steinig und damit schwer zu bewirtschaften. Denn „Grumbira“ lieben einen lockeren, leichten und nährstoffreichen Untergrund. Das ist im Walgau nicht der Fall. Da braucht es schon viel Wissen, um eine entsprechende Ernte einfahren zu können. Tschann ist überzeugt, dass es ohne ein Miteinander nicht funktionieren würde. Sein Kooperationskollege kann im Gegenzug beispielsweise Landmaschinen vom Lärchenhof benützen. „Es kann nicht jeder alles haben oder selber machen. Ich konzentriere mich auf andere Dinge“, ist der Thüringer auch noch Herr über rund 60 Kühe und noch weitere Dutzend Stück Jungvieh. Schließlich ist die Milchwirtschaft das größte Arbeitsfeld am Hof. Zudem baut er Dinkel für den Martinshof in Buch an. Sein Prinzip, dass man im Leben immer auf zwei Füßen stehen soll, hat er auch seinen vier Kindern Leonie, Simon, Livia und Noah, die mittlerweile zwischen 17 und 24 Jahre alt sind, weitervermittelt. „Für mich war es wichtig, dass sie neben der Landwirtschaft unbedingt einen anderen Beruf erlernen.“
„Bist dein eigener Chef“
Dennoch schätzt der 53-Jährige das Leben inmitten seines Hofes in Thüringen. „Die Landwirtschaft hat jeden Tag etwas Neues zu bieten. Außerdem bist du dein eigener Boss“, liebt er die Eigenständigkeit. Nur bei einem ist er nicht der Chef, fügt er zwinkernd hinzu. „Wenn es um das Verlesen und Verpacken der Kartoffeln geht, hat ganz klar meine Frau Edith das Sagen.“ Teamwork wird auch innerhalb der Familie großgeschrieben
Die Konsument:innen sind in den letzten Jahren sehr wählerisch geworden. Nicht nur was den Geschmack, sondern auch die Optik der Ware betrifft. So wird auf die äußere Form der tollen Knollen großer Wert gelegt. „Deshalb bleiben von den 14 bis 16 Tonnen Rohware am Ende auch nur sieben bis neun Tonnen übrig, die verkaufsfähig sind“, bedauert der Lärchenhof-Besitzer Dabei wäre es ein einfacher Beitrag für den Klima- und Umweltschutz, wenn auch jene Ware in den Kochtöpfen und Pfannen landen würde, die optische Makel aufweist, aber von der Qualität um nichts schlechter ist Schließlich steht die Natur für Vielfalt und Diversität. Das gilt aber nicht nur für die Kartoffeln, sondern auch für viele andere Gemüse- und Obstsorten. Selbst wenn sie zu einem vergünstigten Preis angeboten werden, greifen die meisten doch zur vermeintlichen Makellosigkeit. Auch Michael Tschann hat diese Erfahrung gemacht. Sogar Kartoffeln in Herzform erfreuen meist nur Kinder. Dabei stehen sie symbolhaft für Landwirtinnen und Landwirte, die mit Herz bei der Sache sind, wie die Ländle Kartoffelproduzent:innen, die sich gemeinsam unterstützen, um ihre besonderen Spezialitäten anzubauen.


Wir haben für diese Ausgabe bei Prof. Dr. Wilhelm Windisch, ehemaliger Ordinarius für Tierernährung an der Technischen Universität München, „nochgfrogt“ . Der Mittelpunkt seiner Arbeit umfasst die Ernährung von Nutztieren zum Zwecke der Gewinnung von Lebensmitteln tierischer Herkunft. Unter anderem ist auch die Umweltwirkung der Nutztierfütterung einer seiner Schwerpunkte. In unserem Interview erklärt der Professor, warum Nutztiere für eine klimaschonende Lebensmittelproduktion wichtig sind.
Guten Tag, Prof. Dr. Windisch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Interview. Können Sie uns kurz erklären, warum die Landwirtschaft mit Nutztierhaltung so wichtig für unsere Ernährung ist?
Prof. Dr. Windisch: Landwirtschaft und Nutztierhaltung sind die Basis unserer Ernährung. Sie liefern uns nicht nur Grundnahrungsmittel wie Getreide und Gemüse, sondern auch wichtige tierische Produkte wie Milch, Fleisch und Eier Nutztiere spielen eine wichtige Rolle, weil sie Pflanzenreste, die wir nicht essen können, in wertvolle Nahrungsmittel umwandeln. So wird aus Gras und Stroh zum Beispiel Milch und Fleisch.

Sie haben kürzlich über die Vereinbarkeit von Klimaneutralität und Wiederkäuerhaltung gesprochen. Können Sie uns kurz erklären, warum diese beiden Konzepte kein Widerspruch sind?
Prof. Dr Windisch: Der Schlüssel liegt darin, wie wir die landwirtschaftlichen Ressourcen nutzen. Wiederkäuer wie Kühe und Schafe haben die einzigartige Fähigkeit, nicht essbare Pflanzenbiomasse in wertvolle Lebensmittel wie Milch und Fleisch umzuwandeln. Diese Fähigkeit ist besonders wichtig, da ein erheblicher Teil der globalen landwirtschaftlichen Fläche nicht für den Anbau von menschlicher Nahrung geeignet ist. Stattdessen wächst dort Grasland, das von Wiederkäuern genutzt werden kann, ohne in direkte Nahrungskonkurrenz zu treten.
Können Sie uns mehr über die Rolle der nicht essbaren Biomasse in diesem Kreislauf erzählen?
Prof. Dr Windisch: Bei der Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln entsteht eine große Menge an nicht essbarer Biomasse, wie zum Beispiel Stroh oder Reste aus der Verarbeitung von Getreide und Ölsaaten. Diese Biomasse enthält wichtige Nährstoffe, die wieder in den Boden zurückgeführt werden müssen. Eine Möglichkeit ist die direkte Zurückführung über Kompostierung oder indirekt über die Vergärung zu Biogas. Eine andere, effizientere Methode ist die Verfütterung an Wiederkäuer Diese Tiere wandeln die nicht essbare Biomasse in hochwertige Lebensmittel um und produzieren gleichzeitig natürlichen Dünger, der wiederum die Bodenfruchtbarkeit verbessert.
Sie sprechen immer wieder von einem „Zero-Waste“-Ansatz in der Landwirtschaft. Wie funktioniert dieser?
Prof. Dr Windisch: Der „Zero-Waste“-Ansatz basiert genau darauf, dass alles in der Landwirtschaft auf Biomasse beruht und nichts verschwendet wird. Das bedeutet, dass alle Teile der Pflanze, die nicht direkt als menschliche Nahrung genutzt werden können, bestmöglich anderweitig genutzt und danach in den Kreislauf zurückgeführt werden. Zum Beispiel wird bei der Produktion von Haferdrinks nur ein Bruchteil, genauer gesagt etwa ein Sechstel der Biomasse einschließlich des Strohs tatsächlich in das Endprodukt umgewandelt, während der Großteil als Nebenprodukt übrig bleibt. Dieses Nebenprodukt kann hervorragend als Futtermittel für Wiederkäuer verwendet werden. Ein weiteres Beispiel ist die Glutenextraktion aus Mehl. In diesem Verfahren wird Seitan produziert, das in vielen veganen Ersatzprodukten Verwendung findet. Aus einem Korn gewinnt man etwa 10% Gluten, während 90% als abgereichertes Produkt übrig bleibt, das nur mehr als Futtermittel für Wiederkäuer verwendet werden kann. Wenn man das ganze Korn nutzt und zu Brot verarbeitet, kann man damit direkt Menschen ernähren, ohne diese vielen Nebenprodukte zu erhalten
Sie sprechen da ein spannendes Thema an: den Vergleich von veganer und tierischer Ernährung. Können Sie uns hierzu noch mehr erzählen?
Prof. Dr Windisch: Die Produktion von veganen Lebensmitteln steht immer am Beginn des Kreislaufes, ist aber oft mit der Erzeugung großer Mengen an nicht essbarer Biomasse verbunden. Die Beispiele habe ich Ihnen bereits genannt. In diesem Zusammenhang ist die Haltung von Wiederkäuern besonders
effizient, da sie diese Restbiomasse in Nahrungsmittel umwandeln können. Diese Form der Verwertung schließt den Kreislauf und sorgt dafür, dass weniger Abfall entsteht. Auch im Vergleich zu Geflügel und Schweinen, die ebenfalls zur Fleischproduktion genutzt werden, sind Wiederkäuer vorteilhaft, da sie weniger in direkte Nahrungskonkurrenz mit Menschen treten. Berechnungen zeigen sehr deutlich, dass dieser Kreislauf für die Ernährung der Weltbevölkerung enorm wichtig ist: Durch die Verwertung der Restbiomasse werden sowohl zusätzliche Lebensmittel wie Fleisch und Milch als auch wirksamer Dünger in Form von Mist produziert. Das wiederum führt zu höherem Ertrag bei veganen Lebensmitteln. Somit werden 50% mehr Nahrungsmittel produziert, als bei reiner Umwandlung der Biomasse in Biogas und Gärrest als Dünger
Wird die Frage der Nahrungskonkurrenz in Zukunft noch an Relevanz gewinnen?
Prof. Dr Windisch: Absolut. Die Weltbevölkerung wächst stetig, und die verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen werden knapper. Daher müssen wir sicherstellen, dass wir die vorhandene Biomasse so effizient wie möglich nutzen. Das bedeutet, dass wir essbare Biomasse nicht mehr in dem Ausmaß an Tiere verfüttern sollten, die in direkter Nahrungskonkurrenz zu Menschen stehen, wie es bisher geschehen ist. Stattdessen sollten wir auf Systeme setzen, die die vorhandene Biomasse so effizient wie möglich nutzen.
Wie stehen Sie zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks der Landwirtschaft und ihrer Produkte?
Prof. Dr. Windisch: Der Vergleich des CO2-Fußabdrucks verschiedener Produkte oder Branchen greift aus meiner Sicht zu kurz. Die

derzeit verbreitete Form der Berechnung mit Hilfe des CO2Äquivalents ist aus meiner Sicht nicht ideal. Es simplifiziert die Berechnung und lässt sich im Umkehrschluss auf komplexe Zusammenhänge nicht mehr passend anwenden. Auch der Einfluss von Methan auf das Klima wird in der aktuell gängigen Berechnung sehr hoch bewertet. Es wird jedoch nicht berücksichtigt, dass Methan wesentlich schneller abgebaut wird und sich der Ausstoß des Gases von Wiederkäuern in den letzten 130 Jahren kaum verändert hat – ganz im Gegensatz zu CO2-Emissionen. Eine Abschaffung der Wiederkäuer hätte in diesem Zusammenhang eine geringe Auswirkung auf den Klimawandel. Die Umkehr von der bestehenden Berechnungsform sehe ich jedoch auf Grund der weiten Verbreitung als sehr schwierig an. Ein weiterer Punkt, der mich an der Berechnung oft stört, ist das Verständnis der Zuordnung zu einzelnen Produkten. Ziehen wir wieder das Bespiel des Haferdrinks heran. Der Hafer wird für die Produktion dieses Getränks angebaut, nur ein Sechstel wird jedoch verwendet und entsprechend auch nur dieser Anteil der beim Anbau der Pflanze verursachten Treibhausgase dem CO2-Fußabdruck des Haferdrinks zugeordnet. Werden die restlichen fünf Sechstel Biomasse an Wiederkäuer verfüttert, erhöht sich entsprechend der Fußabdruck von Fleisch oder Milch, obwohl hier ein Abfallprodukt der Haferdrink-Produktion sinnhaft verwendet wird. Oder ganz provokativ gefragt: Wo würden die fünf Sechstel Treibhausgase eingerechnet, wenn wir Biomasse einfach wegwerfen?
Was sind die nächsten Schritte, um eine nachhaltige und klimafreundliche Landwirtschaft zu fördern?
Prof. Dr. Windisch: Wir müssen weiter in die Forschung und Entwicklung investieren, um die Futtereffizienz zu maximieren und die Emissionen zu minimieren. Das bedeutet auch, dass wir standortgerechte Landwirtschaft betreiben müssen, wie es in Österreich mit einem hohen Anteil an Grünlandflächen der Fall ist. In Österreich bestehen etwa 50% der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus Grünland, in Vorarlberg sogar 60–65%. Auf diesen Flächen kann die Haltung von Wiederkäuern weiterhin eine wichtige Rolle spielen, ohne dass wir auf Fleisch verzichten müssen. Grünland bindet zudem CO2 und trägt somit zum Klimaschutz bei. Wichtig ist, dass wir die gesamte landwirtschaftliche Produktion in einen nachhaltigen Kreislauf integrieren und die Nahrungskonkurrenz minimieren.
Vielen Dank, Herr Professor Windisch, für diese aufschlussreichen Erklärungen. Es war sehr interessant zu hören, wie Klimaneutralität und Wiederkäuerhaltung Hand in Hand gehen können.
Prof. Windisch: Danke, es war mir eine Freude.

Prof. Dr. Wilhelm Windisch
• Geboren 1958
• Professor für Tierernährung an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), 2002–2010
• Ordinarius an der Technischen Universität München (TUM), 2010–2022
• Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Nutztierfütterung in der agrarischen Kreislaufwirtschaft, der Stoffwechsel essenzieller Spurenelemente und die Effekte von Futterzusatzstoffen auf den Verdauungstrakt. Der Agrarwissenschaftler war in mehreren wissenschaftlichen Gremien und Gesellsch h and 20 als der für phy emien Gesell aften aktiv, unter erem von 16–2020 Vorsitzender Gesellschaft Ernährungssiologie.



29. August bis 14. Sept. 2024



Im Vorjahr begann Klaus Kramer, Gemüse anzubauen, das er in seinem eigenen Laden verkauft. Der Dorener hat mit seinem Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes einen Lebensmittelpunkt in der Kleingemeinde geschaffen.
Dreißig Jahre lang beschäftigte sich Klaus Kramer als Angestellter einer Bank mit den Finanzen, ehe er von Geldscheinen auf Gemüseblätter umsattelte. Wer nunmehr an seinem Anwesen in Doren vorbeikommt, staunt oft nicht schlecht, wie schön auf dem rund 2.500 Quadratmeter großen Feld alles angeordnet ist und farbenprächtig vor sich hin wächst. „Immer wieder höre ich, dass ich das schönste Gemüsefeld im Land habe.“ Ein Ritterschlag für den selbstständigen Kaufmann, der ein Spätberufener der

Landwirtschaft ist. Doch die Optik ist das eine und das Tun das andere. Der 52-Jährige legt persönlich Hand an, wenn es darum geht, frischen Brokkoli, Kohlrabi, Lollo Rosso, Blumenkohl oder anderes Gemüse zu hegen und zu pflegen. Die Bewässerung erfolgt über eine eigene Quelle. Insgesamt 13 verschiedene Sorten baut er an, die direkt frisch vom Feld in seine beiden KRAMERs-SPAR-Läden in Doren und in Riefensberg landen.
Kleine Schatzkammer
Als sich Klaus Kramer im Jahr 2017 entschied, das Lebensmittelgeschäft in seinem Heimatdorf zu übernehmen, stand für ihn fest, dass es zu einer kleinen Schatzkammer in seiner Gemeinde werden soll. Mit dem Gedanken spielte er bereits früher „Ich war als Gemeindepolitiker dabei, als 2011 ein Entwicklungskonzept für die Zukunft Dorens ausgearbeitet wurde. Ein wichtiges Thema war dabei die Nahversorgung.“ 2015 erwarb die Gemeinde die Liegenschaft und der ehemalige Bankfilialleiter fühlte sich berufen, das Geschäft zu über-
nehmen. Längst ist daraus sein persönlicher „Kramer-Laden“ entstanden, der in der knapp über tausend Einwohner zählenden Kleinkommune zu einem Treffpunkt für das ganze Dorf geworden ist, bei dem auch die soziale Nahversorgung nicht zu kurz kommt. Ganz nach dem Motto „ikoufa – guat leba – gnüssa – im dorf“ verkörpern Kramer und seine 15 Mitarbeiterinnen die Regionalität auf wenigen hundert Quadratmetern Fläche. Kleinen Produzenten aus der Region bietet er ebenso eine Plattform. „Nahversorgung bedeutet Gemeinschaft, Arbeitsplätze im unmittelbaren Lebensumfeld, Treffpunkt und Kommunikation, kurze Wege, Hilfestellung für ältere Mitbürger, Sicherung der Lebensqualität.“ Der Laden-Inhaber sieht sich in erster Linie als Dienstleister Und so ist es auch der Chef, der frühmorgens das frisch geerntete Gemüse anliefert. „Um fünf Uhr ist bei mir Tagwache“, bekennt der Frühaufsteher Vor zwei Jahren übernahm er einen weiteren SPAR-Markt in Riefensberg, weil es der Wunsch der Gemeinde war.
Nicht reden, sondern handeln
Zum Gemüsebauer wurde der Bregenzerwälder hingegen erst vor gut einem Jahr. Dafür hat er extra die Ausbildung zum Gemüsefacharbeiter absolviert. „Mich hat das Wissen interessiert und es hat mich erstaunt, wie umfangreich und vielfältig die Materie ist.“ Im März 2023 wurde das im eigenen Besitz befindliche KRAMERs Feld zum ersten Mal gepflügt. Rund 20.000 Pflanzen sind es, die pro Jahr in mehreren Sätzen ausgebracht werden. Für Kramer ist das Arbeiten auf dem Feld fast wie eine Meditation. Sie erdet ihn im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist es das händische Tun, das ihn – wie er es bezeichnet – zurück in die Welt bringt. „Es geht nicht ums Reden, sondern ums Handeln“, will der versierte Politiker in dieser Hinsicht auch ein Vorbild sein. Wenn er frühmorgens allein auf dem Feld steht, scheint das ganze Leben um sich eins zu sein. Mit genauem Blick betrachtet er dann sein Gemüse, schreitet Reihe für Reihe ab. Die Feldhygiene spielt für ihn eine große Rolle. Sie ist entscheidend, wie das heranwachsende Gemüse gedeiht. Er achtet darauf, dass sich kein Unkraut ausbreitet und bearbeitet den Boden mit der Hacke. „Das Pflügen und elegant gekleidet erschienen. Heute muss man dafür nicht mehr bis in die Bundeshauptstadt schielen. Liegt doch das Gute so nah.

Produkte mit Ländle Gütesiegel Ländle Gemüse
KRAMERs SPAR
Doren, Grötzern 116, T 05516 20647
Riefensberg, Dorf 51, T 05513 51254 E kramers-gmbh@outlook.com
www.laendle.at/Gemüse
Jens Blum, er in Höchst


OB ELST
DEN ERN
BEI SPAR
Absolute F
Jens Blum
Vorarlberg
Kernobst h
SPAR-Obst


Das Thermometer steigt auf Höchstwerte und Grillabende stehen fest auf dem Wochenendplan. Man freut sich über gutgelaunte Gesellschaft, leckeres Essen und kühlende Sommerdrinks. Egal ob herb, süß, sauer, mit oder ohne Alkohol – es gibt zwei Zutaten, die niemals in einem Erfrischungsgetränk fehlen dürfen – Eis und Kräuter!
Nicht nur das Fleisch am Grill braucht die richtigen Kräuter und Gewürze, sondern auch im perfekten Sommerdrink dürfen diese nicht fehlen. Erfrischende Minze, herber Rosmarin, würziges Basilikum –gerade im Sommer haben frische Kräuter ihren großen Auftritt
Egal ob als gesunde Durstlöscher oder die gewisse Note im Sommercocktail, frische Kräuter entführen uns in eine heitere Welt voller Lebensfreude für alle Sinne. Nicht umsonst heißt die Stunde
der Drinks „Happy Hour“. Ein guter Drink wird zelebriert und ist eine kleine, liebevoll angerichtete elegante Köstlichkeit. Die bekannteste Verwendung hat wohl Minze und macht einen Mojito oder Caipirinha erst richtig komplett. Auch wissen Kenner, dass ein Zweig Basilikum oder Rosmarin Gin wunderbar verfeinert und den Wacholdergeschmack unterstreicht.
Auch als Sirup oder in Verbindung mit Zitrusfrüchten und Fruchtsäften sind Gartenkräuter die idealen Begleiter So lässt sich der Sommer auf der Zunge zergehen.
Mit der eigenen Kräutersammlung haben Sie die Zutaten für leckere Drinks stets parat und können damit nicht nur beim Gartenfest für eine besondere Erfrischung sorgen.
Die Ländle Kräutertöpfe sind im SPAR, INTERSPAR, EUROSPAR und in der Gärtnerei Angeloff erhältlich. Cheers!

Rezept: Sigrid Gasser, laendlekitchen.at
Die perfekte Erfrischung für heiße Tage!
• 3–5 große Hand voll Rosmarin*, je nach Intensität, wie man es wünscht
• 2 kg Zucker
• 1,5 Liter Wasser
• 1 Bio Zitrone
• 1 Teelöffel Zitronensäure
Die Rosmarinnadeln grob von den Stielen zupfen und danach etwas durchhacken. Das Wasser mit Zucker aufkochen und wenn der Zucker aufgelöst ist, die Rosmarinnadeln dazugeben. Einmal gut aufkochen lassen. Die Zitrone heiß abwaschen, samt der Schale in Achtel-Schnitze schneiden und anschließend in das Rosmarinwasser geben. Zudecken und bis zu einer Woche kühl stellen.
Je nachdem, wie lange man es mit den Rosmarinnadeln drinnen stehen lässt, ist die Intensivität.
Nach maximal 1 – 2 Woche(n) abseihen und in einem Topf nochmals bis zum Siedepunkt erhitzen (nicht mehr kochen, nur noch stark erhitzen). Danach heiß in sterile Flaschen einfüllen und sofort verschließen.
Fertig ist der Sirup. Auch ideal zum Spritzen mit Sekt oder Wein.
Gärtnerei Angeloff Rüggelen 3, 6830 Rankweil T 05522 423 51 E info@gaertnerei-angeloff.at www.gaertnerei-angeloff.at
www.laendle.at/kräuter
Verkauf bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR


Manfred Nägele beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit dem Anbau von Obst. Auch mit 82 Jahren will der langjährige Ländle Gütesiegel Partner seine Apfelbäume nicht missen. Sie verleihen ihm sogar eine jugendliche Frische, auch wenn die Apfelernte mittlerweile nur mehr ein „Hobby“ ist.
Wenn Manfred Nägele mitten unter seinen Apfelbäumen steht, offenbart sich darin sein ganzes Lebenswerk. Seit seiner Kindheit hat es dem nunmehr 82-Jährigen die süße Frucht angetan. Auf den 22 Ar (das entspricht 2.200 Quadratmetern), die er mittlerweile noch bewirtschaftet, trifft das Alter auf die Jugend. „Fast alle Bäume, die hier stehen, sind sehr jung und erst in der Anfangsphase ihres Lebens“, drückt es der Pensionist etwas philosophisch aus. Es hat den Anschein, dass ihn gerade sein sehr zeitaufwändiges Hobby, wie er es nennt, jung hält. „Ich fühle mich fit und möchte dies machen, solange es mir irgendwie möglich ist“, ergänzt er. Dass er baumtechnisch auf die Jugend setzt, hat aber einen ganz bestimmten Grund. „Junge Bäume geben weniger Arbeit. Der Schnitt ist weniger zeitintensiv und sie tragen auch noch nicht so viele Früchte.“ Langweilig wird ihm aber auch so nicht.
Rund 3.000 Kilo Äpfel
Stolze 24 Jahre war Nägele Apfellieferant für die Handelskette Spar. „Ein sehr guter Partner“, schwärmt der Gaißauer von der langjährigen Zusammenarbeit. Nachdem er seine Kulturen reduziert hat, setzt er nur noch auf dem Ab-Hof-Verkauf. Was nicht direkt verkauft wird, wird zu Apfelsaft gepresst oder zu Most vergoren. Rund 3.000 Kilogramm Äpfel beträgt seine jährliche Ernte, in Spitzenzeiten waren es zehnmal so viel. „Leben hätte ich dennoch nicht davon können. Hätte ich das hauptberuflich gemacht, wäre ich schon lange verhungert und nicht so alt geworden“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. Der zweifache Vater und Opa war hauptberuflich Mechaniker bei der Firma Leica in Heerbrugg. Oft hieß es, um fünf Uhr früh die frischen Früchte zu liefern und im Anschluss gleich zur Arbeit zu fahren. Nach dem Feierabend ging es gleich wieder zu den Obstbäumen. Auch am Wochenende war nichts mit Ausruhen. Selbst die Bäume
züchtete er von eigener Hand. „Wenn ich manchmal an diese Zeit zurückdenke, frage ich mich schon, wie ich das alles geschafft habe. Ein großer Rückhalt war die Familie, die mich unterstützt und mitgeholfen hat. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen.“
Auch der Landwirtschaftskammer spricht er seinen Dank aus, die ihm über die Jahre mit Rat und Tat zur Seite stand. Der einzige Luxus während seines Berufslebens war ein einwöchiger Urlaub, den sich die Familie pro Jahr gönnte. „Und den verbrachten wir in Österreich.“ Ohne die Leidenschaft, die ihm sein Vater in die Gene gepflanzt hatte, wäre solch ein Einsatz sicher nicht möglich gewesen. So zieht sich der Lebensbaum der Familie durch eine jahrzehntelange Obstgeschichte. Der Vater war es, der die ersten Meterbäume einpflanzte. Manfred war damals noch Schüler. Der Apfel fiel jedoch nicht weit vom Stamm. Später übernahm er selbst die Anlagen, stellte die Plantagen auf Spindelbüsche um. Diese lassen sich gut zum Spalierobst ziehen und wegen ihrer geringen Wuchshöhe sind die Früchte gut zu pflücken.
Apfelsorten ändern sich
Auch die Apfelsorten haben sich im Laufe der Jahre gewandelt Damit das Tafelobst in den Handel gelangt und gekauft wird, muss es nicht nur gut schmecken, sondern auch optisch den Ansprüchen gerecht werden. Gefragt sind „perfekte Typen“. Ganz dem Motto entsprechend: „Das Auge isst mit“ Typische gängige Sorten sind derzeit Gala, Elstar, Boskoop, Jonagold und Topaz. Bis eine neue Apfelsorte im Handel akzeptiert wird, vergehen im Schnitt fünf Jahre. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Business auch immer schnelllebiger. Die Anbauzeiten wurden kürzer, die Ernte einfacher, das Arbeiten wirtschaftlicher „Man muss das gerne tun oder sein lassen“, weiß der lebenserfahrene Mann, worauf es trotz aller Wandelbarkeit ankommt. Die Unwägbarkeiten der Witterung sind ohnehin ein ständiger Begleiter Hagel und Frost sind die zwei größten Feinde für Blüten oder Früchte. Hinzu kommen Schädlinge wie Pilze oder der Apfelwickler Die Klimaveränderungen machen zudem alles noch unberechenbarer Doch irgendwie gleicht sich immer alles aus, spricht die Erfahrung
aus ihm. Nägele appelliert in dieser Hinsicht an den Hausverstand und an das Gespür, das die Menschen früher an den Tag legten.
Ein bewegtes Obstleben
Heute blickt Nägele auf ein bewegtes Obstleben zurück. Mit vielen schönen Sachen, die er dabei erlebt hat. Besondere Highlights waren die Kurse und Fortbildungen, die ihn nach Deutschland, Südtirol oder in die Steiermark geführt haben. „Da habe ich viel kennengelernt. Vor allem andere Obstbauern.“ Immer an seiner Seite war ein guter Kollege, der mittlerweile verstorben ist. „Wir waren eine ganze Truppe, die mit zwei Bussen unterwegs war.“ Heute ist er der einzige in Gaißau, der Äpfel anbaut. Mittlerweile ist es tatsächlich mehr zu einer Beschäftigung geworden, die der 82-Jährige sic d einem s die Sollte s g in T gibt w n diese t der Mit Ur in b
Garten,



42 Gemeinschaftsküchen ausgezeichnet
– Vier Millionen regionale Mahlzeiten kamen im Jahr 2023 auf die Tische.

Mit 42 ausgezeichneten Küchen ist das letzte Jahr das erfolgreichste seit Bestehen von „Vorarlberg am Teller“. Die 2017 gestartete Initiative setzt sich zum Ziel, vermehrt regionale Lebensmittel in Gemeinschaftsküchen einzusetzen. 250 geladene Gäste feierten am Mittwoch, den 19. Juni in der Otten Gravour in Hohenems im Zuge eines „Festabends der Regionalität“ die erfolgreiche Entwicklung der Landesinitiative. Die teilnehmenden Küchen setzen ein klares Zeichen für mehr Regionalität, für Klimaschutz, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und, was ebenso wichtig ist, sie geben den heimischen Bauernfamilien und Lebensmittelproduzent:innen Planungs- und Abnahmesicherheit, betonten Landeshauptmann Markus Wallner und Landwirtschaftslandesrat Christian Gantner: „Unser Dank gilt allen, die zur erfolgreichen Umsetzung unserer Initiative beitragen – vom Feld und Stall bis in die Küche.“
Im Jahr 2023 wurden in Vorarlbergs Spitälern, Sozialzentren, Kindergärten, Schulen und Kantinen insgesamt rund vier Millionen hochwertige regionale Mahlzeiten serviert. Im Vergleich zum letzten Jahr sind 14 neue Betriebe und 500.000 zusätzliche regionale Mahlzeiten dazugekommen.
Die teilnehmenden Küchen gaben in Summe 7,1 Millionen Euro für regionale Lebensmittel aus.
Landeshauptmann Wallner verwies auf die Entschließungen des Vorarlberger Landtags für den Ausbau des Anteils von regionalen Produkten in der Gemeinschaftsverpflegung: „Mit den ausgezeichneten „Vorarlberg am Teller“-Betrieben setzen wir ein starkes Zeichen dafür Das Land Vorarlberg hat eine besondere Vorbildfunktion.“
Besonders erfreulich ist für Landeshauptmann Wallner und Landesrat Gantner, dass bereits rund 400 Schulen und Kindergärten von ausgezeichneten „Vorarlberg am Teller“-Betrieben beliefert werden. „Wir wollen, dass alle Kinder Zugang zu hochwertigen Mahlzeiten haben, die nicht nur satt machen und schmecken, sondern zugleich aus Vorarlberg kommen und auch leistbar sind. Zu diesem Zweck wurde das Fördermodell „Kinder.Essen.Körig“ gestartet“, so Wallner „Die Förderung des Einsatzes hochwertiger regionaler Produkte in der Gemeinschaftsverpflegung, insbesondere in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, ist ein zentrales Anliegen, das auch in unserer Landwirtschaftsstrategie „Landwirt. schafft.Leben“ verankert ist“, bestätigte Gantner
„Vorarlberg am Teller“ startete 2017 mit vier teilnehmenden Betrieben, dieses Jahr wurden 42 Betriebe ausgezeichnet, darunter zehn mit Bronze, acht mit Silber, 20 mit Gold und vier mit der höchsten Auszeichnung Platin.

„Vorarlberg am Teller“ – sei dabei! Einrichtungen, die die „Vorarlberg am Teller"-Auszeichnung anstreben, und landwirtschaftliche Betriebe, die an einer Partnerschaft interessiert sind, können sich gerne beim Land oder beim Ländle Marketing melden:
• Land Vorarlberg, Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum: Vera Kasparek-Koschatko, E vera.kasparek@vorarlberg.at, T 05574 511 25115
• Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH: Benjamin Hehle, E benjamin.hehle@lk-vbg.at, T 05574 400 705
Auszeichnungen in Platin (4):
• Landesbauhof Felsenau
• Ländle Gastronomie GmbH – FH Mensa
• Mittagsbetreuung Schwarzenberg
• Straßenmeisterei Arlberg/Montafon – Stützpunkt Rauz
Auszeichnungen in Gold (20):
• 3 L Gastronomie GmbH – Landhausrestaurant
• Benevit Sozialzentrum Alberschwende
• BSBZ – Landwirtschaftsschulen Vorarlberg
• Häuser der Generationen Götzis & Koblach
• illwerke vkw AG – Rodundwerk
• illwerke vkw AG – Bregenz
• Kindercampus Höchst
• Landesbauhof Lauterach
• Landesberufsschule Lochau
• Ländle Gastronomie GmbH – Hohe Brücke
• Miteinander füreinander Andelsbuch
• SeneCura Sozialzentrum Laurentius-Park Bludenz
• SeneCura Sozialzentrum Dornbirn
• SeneCura Sozialzentrum Hohenems
• Seniorenbetreuung Feldkirch GmbH
• Sozialdienste Wolfurt gGmbH
• Sozialzentrum Altach
• Sozialzentrum Frastanz
• Sozialzentrum Rankweil Haus Klosterreben
• Vorderlandhus Röthis
Auszeichnungen in Silber (8):
• Antoniushaus der Kreuzschwestern
• AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH
• Lebenshilfe Kantine.L – Schule am See Hard
• Pflegeheim St. Josef Schruns
• SeneCura Sozialzentrum Hard
• SeneCura Sozialzentrum Lauterach
• Sozialzentrum Josefsheim Betriebs-GmbH
• Vorarlberger Schulsport-Zentrum Tschagguns
Auszeichnungen in Bronze (10):
• Bildungscampus Vandans
• Krankenhaus der Stadt Dornbirn
• Lebenshilfe Kantine.L – Bundesgymnasium Blumenstraße Bregenz
• Lebenshilfe Kantine.L – Gastronomie Batschuns
• Lebenshilfe Kantine.L – HTL Dornbirn
• Lebenshilfe Kantine.L – HTL Rankweil
• Lebenshilfe Kantine.L – PH Feldkirch

• Schloss Hofen – Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.
• Sozialzentrum Egg
• Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft m.b.H.
Regionalität is(s)t vielseitig
Nach den positiven Rückmeldungen im letzten Jahr wurden auch dieses Jahr wieder Sonderauszeichnungen vergeben und von Projektkoordinatorin Vera Kasparek und Ländle Marketing-Geschäftsführer Marcel Strauß überreicht.
• Die Auszeichnung „Aufsteiger des Jahres“ ging an die Straßenmeisterei Arlberg/Montafon – Stützpunkt Rauz.
• Gerald Fleisch, Direktor des Landeskrankenhauses Feldkirch, holte sich die Sonderauszeichnung „Stärkster Ländle Gütesiegelpartner“ ab.
• Die dritte Sonderauszeichnung ging an das Stadtkrankenhaus Dornbirn. Küchenchef Torsten Kappei bekam die Auszeichnung „Spitzenreiter bei Essen auf Rädern“ verliehen.



In der „Kantine.L“ heißt es seit dem letzten Jahr „Vorarlberg am Teller“. Gemeinsam mit der Lebenshilfe wird an acht Standorten im Land frisch gekocht. Mit möglichst vielen heimischen Produkten. Welchen Spagat es dabei zu bewältigen gilt, wissen Leiter Georg Eberharter und Koordinator Ralf Langner ganz genau.

Auch wenn in ihrer Küche viel Vorarlberg am Teller drin ist, blicken Gastronomieleiter Georg Eberharter und Gastronomie-Koordinator Ralf Langner über den Tellerrand hinaus. „Das müssen wir auch, um unsere Strukturen aufrecht halten zu können“, erklären die beiden. Nicht nur das Essen muss passen, sondern auch das ganze Drumherum. Denn in der Kantine.L, einem österreichweit einzigartiges Projekt, wird gleich an acht verschiedenen Standorten in Vorarlberg frisch gekocht. Eine Besonderheit dabei ist, dass Küchenfachkräfte gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen der Lebenshilfe für die Verpflegung sorgen. Und das sogar im ziemlich üppigen Ausmaß. „Zusammengerechnet bereiten wir pro Jahr rund 250.000 Mahlzeiten zu“, nennt Langner die beeindruckende Zahl.
Eine Challenge entstand
Trotz dieser Menge steht die Regionalität beim Kochen im Vordergrund. Wo immer es möglich ist, wird auf heimische Ware zurückgegriffen. „Daher haben wir uns im Vorjahr entschlossen, bei „Vorarlberg am Teller“ mitzumachen. Seitdem ist die Motivation, den regionalen Anteil an Produkten weiter zu erhöhen, bei den einzelnen Köchinnen uns Köchen zusätzlich gestiegen. Das Gefühl, einen Beitrag zur Förderung der Regionalität zu leisten, spornt an. Es gibt allen einen Push und es ist eine richtige Challenge daraus entstanden. Wir werden im nächsten Jahr sicher eine Steigerung haben. In Hard haben wir Silber geholt, an den anderen Standorten Bronze“, ist Koordinator Ralf Langner stolz auf das Team, das aus rund 50 Mitarbeitenden besteht. Hinzu kommen noch rund 40 betreute Personen, die in den
Küchen die unterschiedlichsten Aufgaben erfüllen. Die Menschen mit Behinderungen der Lebenshilfe betrachten alle als eine Bereicherung. „Es entschleunigt einen einfach. Die Arbeit bekommt eine andere Wertigkeit und sie wird durch eine hohe Sozialkompetenz garniert“, hat der 35-jährige Wahl-Altacher Langner, der ursprünglich aus Deutschland kommt, nur positive Erfahrungen gemacht. Das Umfeld ist familiär, der Umgang miteinander herzlich. „Wir versuchen, ihnen Aufgaben zu geben, die ihren Fähigkeiten entsprechen. Mitunter zahlen sie es mit einer spontanen Umarmung oder anderen Herzlichkeiten zurück.“
Eigenständige Kantinen
Jede der einzelnen acht Kantinen arbeitet eigenständig und entscheidet selbst, was auf dem Speiseplan steht. Geschöpft wird unter anderem aus einem Pool an Vorarlberger Produzent:innen, wobei es durchaus regionale Unterschiede gibt. „Im Bregenzerwald muss es beispielsweise ein Wälderschinken sein“, nennt Eberharter ein Beispiel. Weitere Lieferanten sind etwa Puten Flatz, Hühnergut, die Metzgerei Klopfer oder Vorarlberg Milch. Die Preisverhandlungen werden zentral geführt, das Produzentennetz von Eberharter und Langner koordiniert. Nur dadurch ist es möglich, die Kosten einzuhalten. Die einzelnen Standorte können sich so auf ihre zentrale Aufgabe nämlich das Kochen, konzentrieren. Der Vorteil an diesem System ist, dass dadurch bedarfsgerecht produziert wird und es kaum Schwund gibt. Das ist für die Kalkulation enorm wichtig. „Wir sind ein Non-Profit-Unternehmen, bei dem am Ende des Jahres eine schwarze Null stehen muss. Und das ohne jegliche Förderungen in der Produktion“, erklärt Eberharter. Für den 41-jährigen Wahl-Harder, der ursprünglich aus dem Zillertal stammt, geht es beim Rechnen oftmals um Cent-Beträge. Zur Auswahl stehen von Montag bis Freitag zwei Menüs – eines davon ist vegetarisch. „Wir bieten Tagesteller für 6,00 Euro an und halbe Tagesteller für 4,80 Euro.“ Viel Spielraum bleibt nicht. „Wenn wir 10 oder 20 Cent mehr verlangen, ist das für viele Eltern schon schwierig.“
Eine Küche mit Niveau
Dennoch ist es oberster Anspruch, eine gesunde Ernährung mit frischen heimischen Produkten zu bieten. Eine Küche mit Niveau, nennt es der Gastronomieleiter „Das gelingt, indem wir das verkochen, was die Gastronomie nicht gerne nimmt.“ In der kommerziellen à la carte-Küche sind vor allem Edelteile gefragt. Das soll jedoch nicht heißen, dass es sich bei den anderen Teilen um eine minderwertige Qualität handelt. „Bei uns gibt es durchaus auch Hühnerkeulen, Faschiertes, Ragout oder Gulasch. Wobei wir schauen, dass wir das Fleisch generell reduzieren.“ Da unter anderem für Kindergärten und Schulen gekocht wird, haben auch Ernährungsberater:innen, Schulärztinnen und -ärzte oder Lehrer:innen Einfluss auf den Speiseplan. Nicht alles jedoch ist immer in ausreichender Menge aus Vorarlberg beziehbar. Gewisse Obstsorten beispielsweise sind Mangelware, weil es kaum jemanden im Land gibt, der sie produziert. Versucht wird, auch die Kinder in die Küche miteinzubeziehen. Dadurch bekommen sie einen Bezug zu Nahrungsmitteln und lernen, was dahintersteckt, ein gutes Essen zuzubereiten. In der Schule am See
in Hard wird beispielsweise das Mehl für die Pizza selbst gemahlen. Einiges stammt sogar aus dem eigenen Schulgarten. Manches Menü besteht sogar zu hundert Prozent aus Vorarlberg Etwa die Kässpätzle in der Kantine.L in Batschuns. Damit Speisen mitunter besser angenommen werden, bekommen sie auch jugendgerechte Namen. Das Kantine.L-Konzept „Jeder is(s)t anders und mitanand schmeckt's besser!“ kommt an allen acht Standorten gut an. „Wir hätten auch genügend Anfragen, um zu erweitern und zusätzliche Kantinen zu eröffnen“, betont Georg Eberharter Aber das sei gar nicht das Ziel. „Uns ist wichtig, dass wir die bestehenden Betriebe gut führen und die betreuten Menschen voll integrieren.“ Das alles mit dem regionalen Touch als Sahnehäubchen.

Lebenshilfe Vorarlberg
Gartenstraße 2, 6840 Götzis
T 05523 506-0
Leiter Gastronomie: Georg Eberharter
E gastronomie@lhv or.at www.lebenshilfe-vorarlberg.at
Standorte:
Schule am See Hard, Bundesgymnasium
Blumenstraße Bregenz, Gastronomie Batschuns, HTL Dornbirn, HTL Rankweil und PH Feldkirch
Silber bei „Vorarlberg am Teller"
Der Gesamtregionalanteil aller Lebensmittel beträgt mindestens 40%. Wobei mindestens 20% aller Lebensmittel nach dem 3G-Prinzip hergestellt wurden.
Bronze bei „Vorarlberg am Teller"
Der Gesamtregionalanteil aller Lebensmittel beträgt mindestens 20% bzw. 30%. Wobei mindestens 10% bzw. 15% aller Lebensmittel nach dem 3G-Prinzip hergestellt wurden.


Rezept: Brigitte Schwarz
350 g Ländle Dinkel Mehl*
200 ml Wasser
0,5 würfelfrische Hefe
20 g Olivenöl
1 TL Salz
250 g Sauerrahm*
100 g Crème fraîche* (mit Kräutern)
200 g Fetakäse 1 Stk Fenchelknolle* 2 Stk rote Zwiebel* Kleine Tomaten* Pfeffer Salz
• Mehl, Wasser, Hefe, Öl und Salz zu einem Teig kneten und 20 Minuten gehen lassen
• Sauerrahm mit Kräuter-Crème fraîche vermengen
• Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden
• Fenchel waschen und fein hobeln
• Rispentomaten waschen und trocken tupfen
• Teig auf einem mit Backpapier belegten Blech dünn ausrollen
• Sauerrahmmix auf dem Teig verteilen
• Mit Salz und Pfeffer würzen
• Mit Fenchel, Zwiebeln und Tomaten belegen
• Den Fetakäse darüber bröseln
Im vorgeheizten Backofen bei 200° C ca. 20–25 Minuten backen
*Produkte mit Ländle Gütesiegel erhältlich


Die Vorarlberger Gemüsegärtner sind eine kleine, aber sehr schlagkräftige Gruppe innerhalb der heimischen Landwirtschaft. Auf ihren Feldern und in den Gewächshäusern wachsen über 50 verschiedene Gemüsearten, von der Artischocke bis zur Zwiebel. Von vielen Gemüsearten werden für jede Jahreszeit angepasste Sorten kultiviert. Diese saisonal entsprechenden Früchte tragen maßgeblich zu einer gesunden Ernährung bei.

Was ist der Vorteil für die Vorarlberg Konsumentinnen und Konsumenten?
Gemüse findet man schließlich ganzjährig in den Regalen der Lebensmittelversorger Das Hauptargument für den Griff zum Vorarlberger Gemüse ist eindeutig dessen Frische. Volle Vitamine gibt es nur bei kurzen Transportwegen. Je kürzer die Zeitspanne zwischen Ernte und Genuss,
desto höher ist der Gesundheitswert des Erntegutes. In der Regel wird unser Gemüse morgens geerntet und wenige Stunden später bereits verzehrt.
Zusätzlich sieht man genau, wo und wie unser Gemüse wächst. Österreichs Landwirtschaft zählt zu den sichersten Lebensmittelproduzenten in Europa. Gute Ausbildung, stringente Gesetze, umfängliche Kontrollen, hohe Sozialstandards für unsere Mitarbeitenden und ein strenges Dünge- und Pflanzenschutz-Reglement führen zur Produktion hochwertigster Lebensmittel. In der Regel kennen Sie zudem Ihre Gärtnerinnen und Gärtner persönlich und können sich direkt über Qualität und Angebot informieren. So nimmt man vom


Einkauf nicht nur Gemüse mit, sondern immer auch Tipps für die Verwendung der Köstlichkeiten. Gemüseeinkauf ist Vertrauenssache! Wer auf Nummer Sicher gehen will, kauft beim Vorarlberger Gärtner
Ein starkes Argument für den Griff zu heimischem Gemüse ist dessen klimatischer Fußabdruck. Das Gemüse aus Vorarlberger Produktion wächst in der Regel mit geringstem CO2-Ausstoss am Feld oder in unbeheizten Gewächshäusern. Vieles davon wird saisonal und in Handarbeit produziert. Größere Schläge werden mit leistungsfähigen Maschinen bearbeitet. Auch die vom Transport stammenden CO2-Emissionen entfallen beim Anbau im Land. Will man bei seinem Einkauf aufs Klima schauen, sollte man zu regionalen und saisonalen Produkten greifen.

Will man Gemüse oder Obst nicht nur kaufen, sondern auch selbst im professionellen Maßstab kultivieren, kann man sich berufsbegleitend zum Gemüse- oder Obstbauspezialisten ausbilden lassen. Die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der Landwirtschaftskammer Vorarlberg bietet ab Herbst 2024 Vorbereitungskurse über zwei Wintersemester zur Facharbeiterprüfung in diesen Berufssparten an. Hier wird umfassend Wissen zu Anbau und Vermarktung dieser Spezialkulturen vermittelt. Info und Kursanmeldung: LFI Vorarlberg, T 05574



Kinder und Jugendliche entdecken landwirtschaftliche Betriebe & heimische Lebensmittel - Erlebnisse zum Angreifen für Schulklassen und Kindergärten!
Mehr Infos zu den Angeboten beim Ländlichen Fortbildungsinstitut Vorarlberg 05574/400-192 I lfi@lk-vbg at I schuleambauernhof at
Fr 13. Sep
ZLG Kräuterpädagogik
2 0 2 4 Fr 5
Fr 13. Sep
Mo 16. Sep
Do 19. Sep Mi 16. Okt
Fr 08. Nov
Fr 08. Nov
Fr 08. Nov
Do
14. Nov
Do 12. Dez
Intensivlehrgang Obstbrand
Perspektivenwechsel im eigenen
Sensorik von Destillaten
ZLG Edelbrandsommelier
Lehrgang Textiles Handw
Dämmerung im Wald
Liköre selbst gemacht
Essig selbst gemacht
Kindernotfallkurs

05574 / 400 -
lfi@lk-vbg.at




