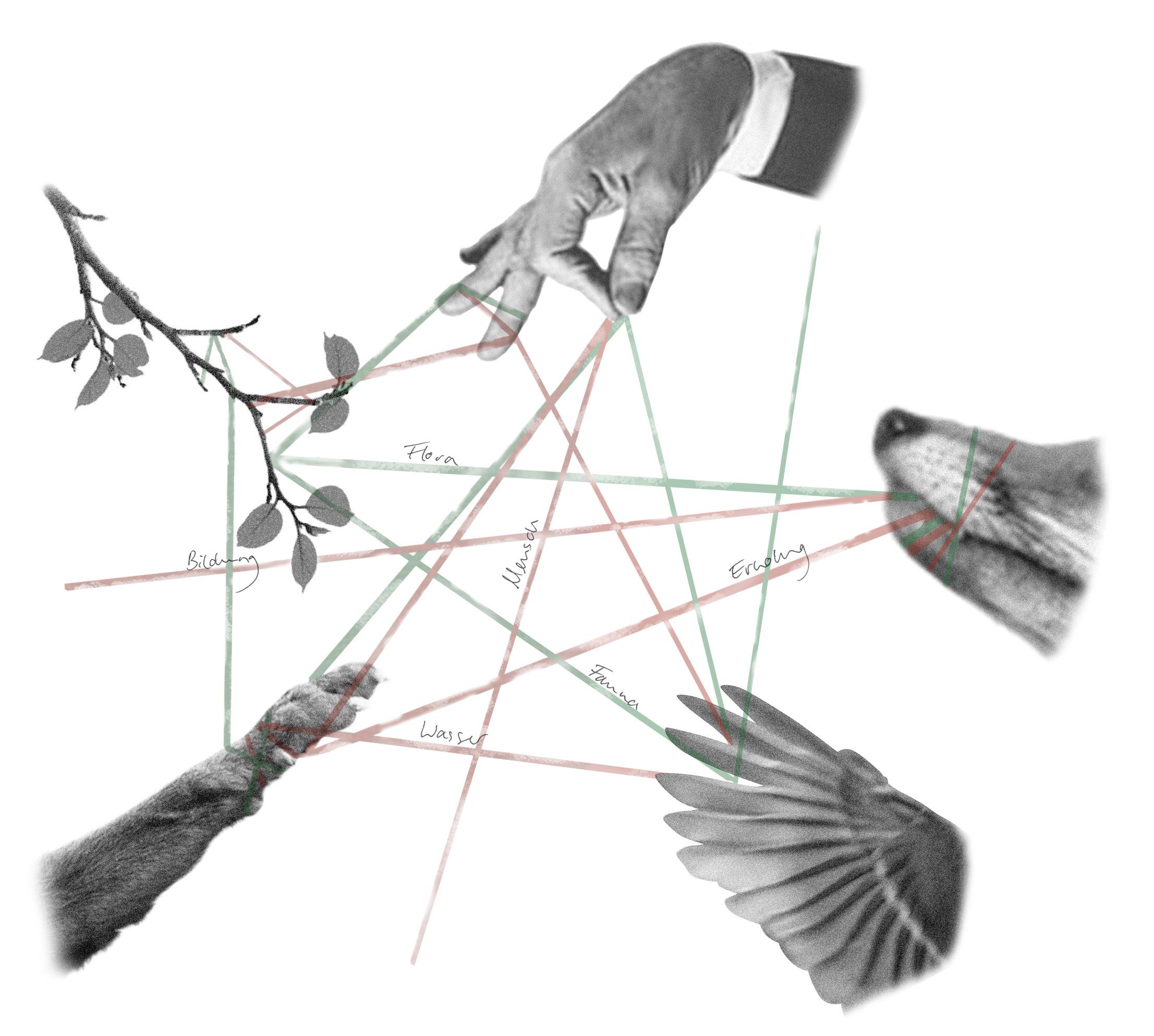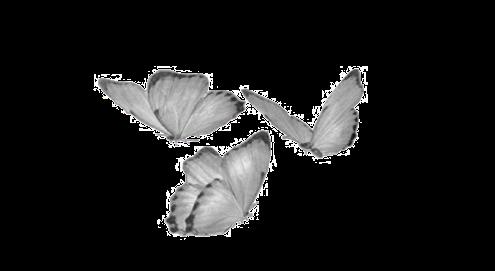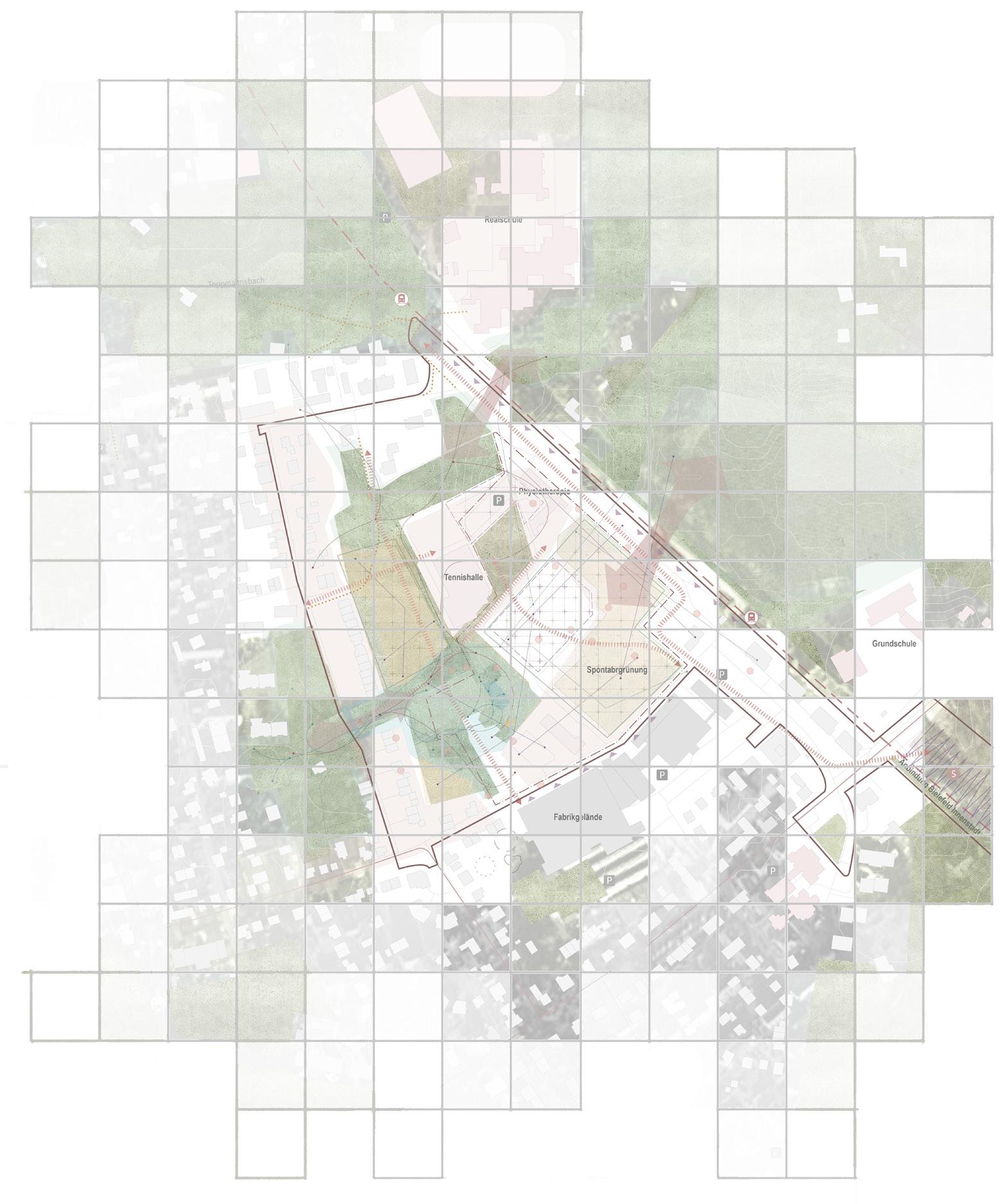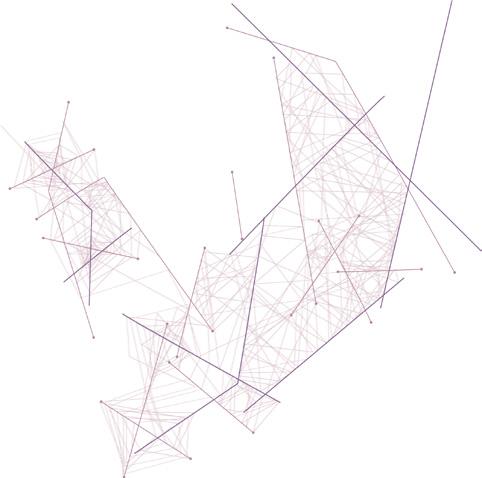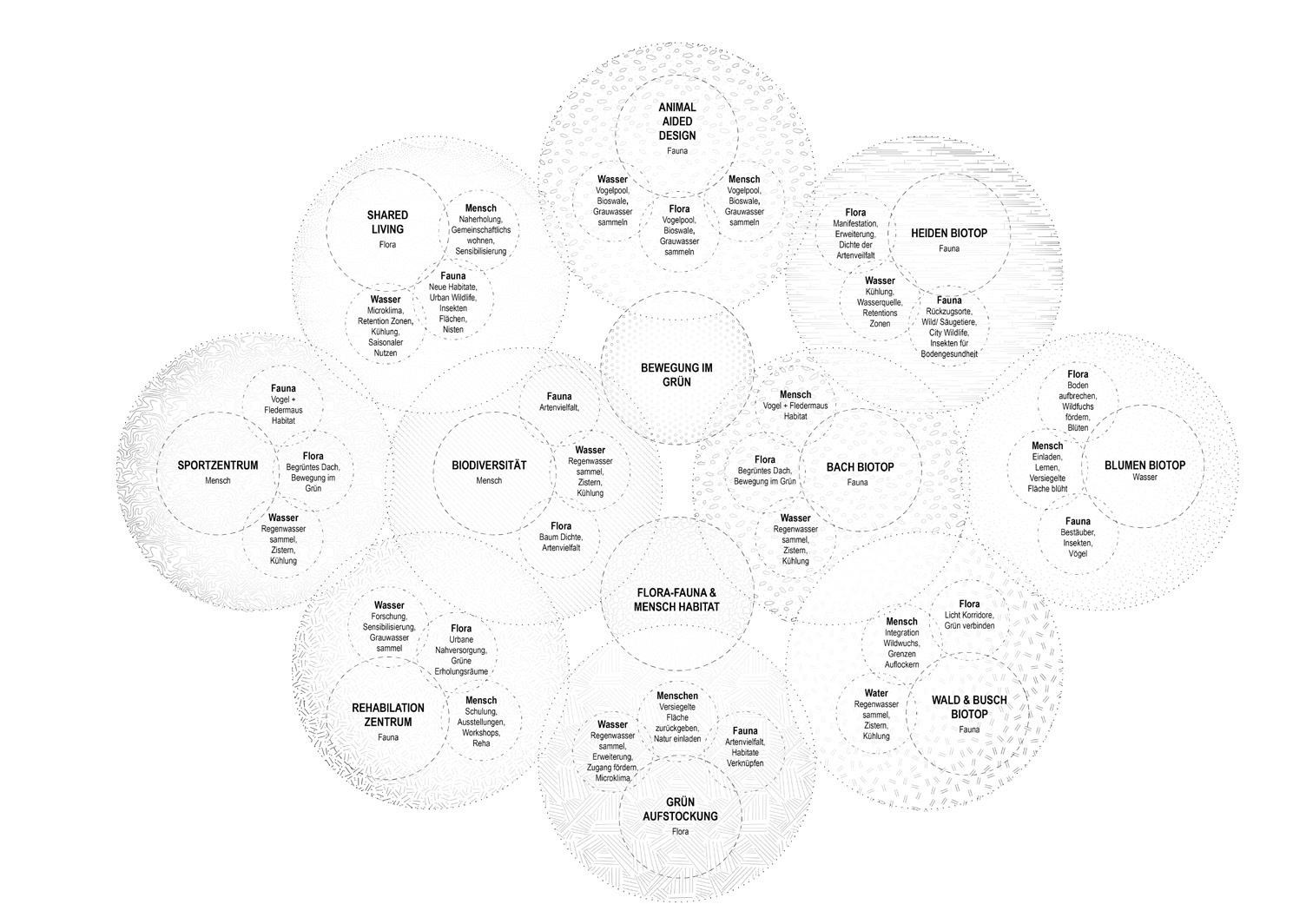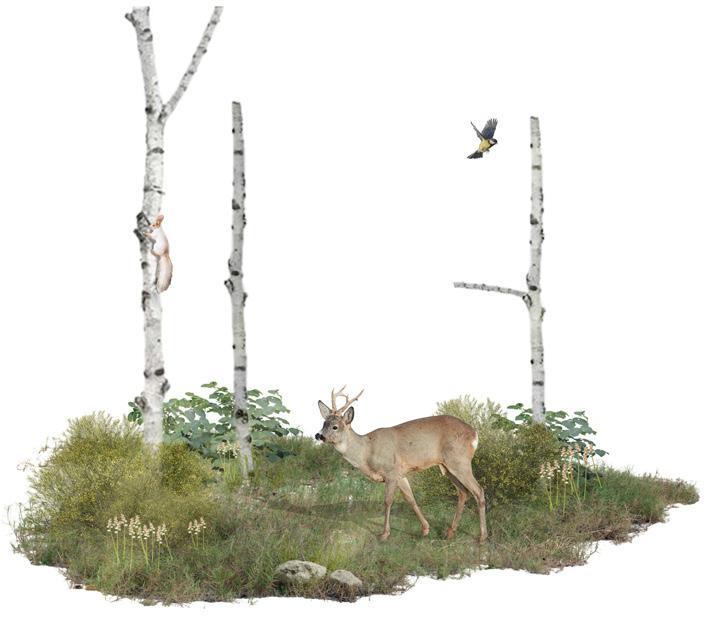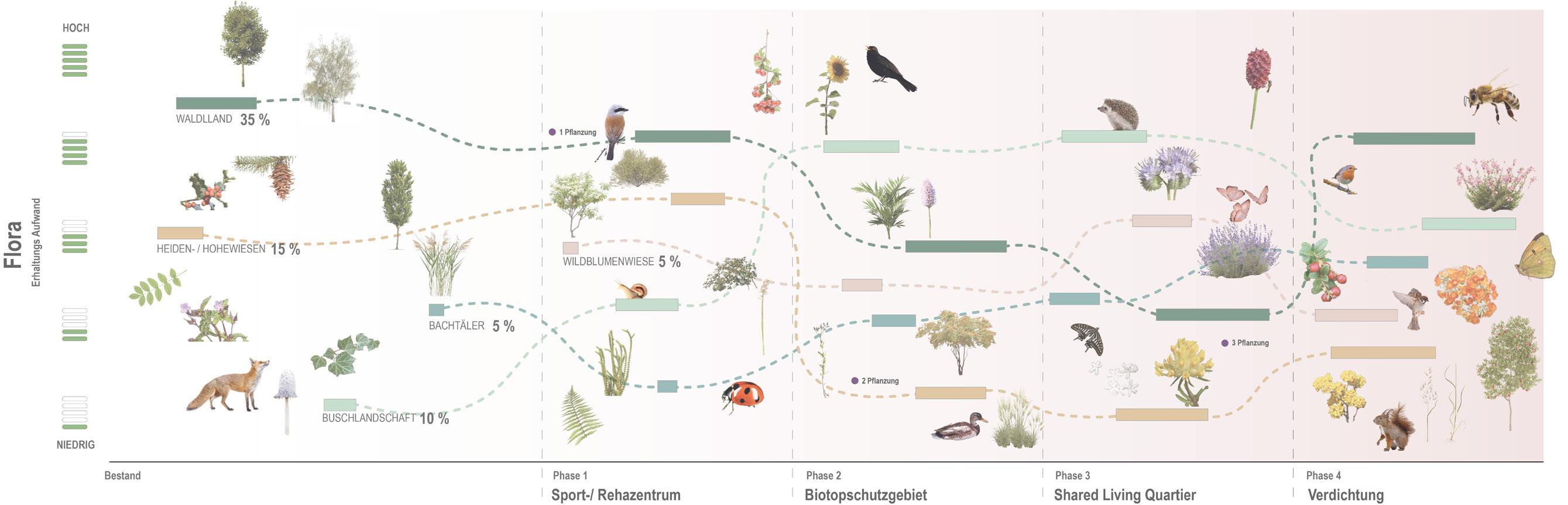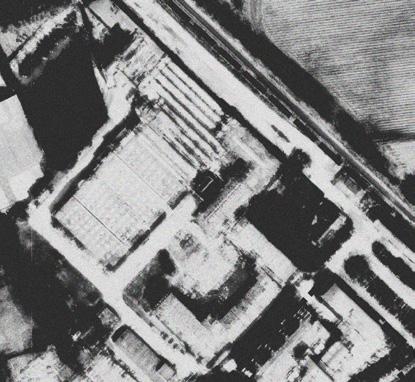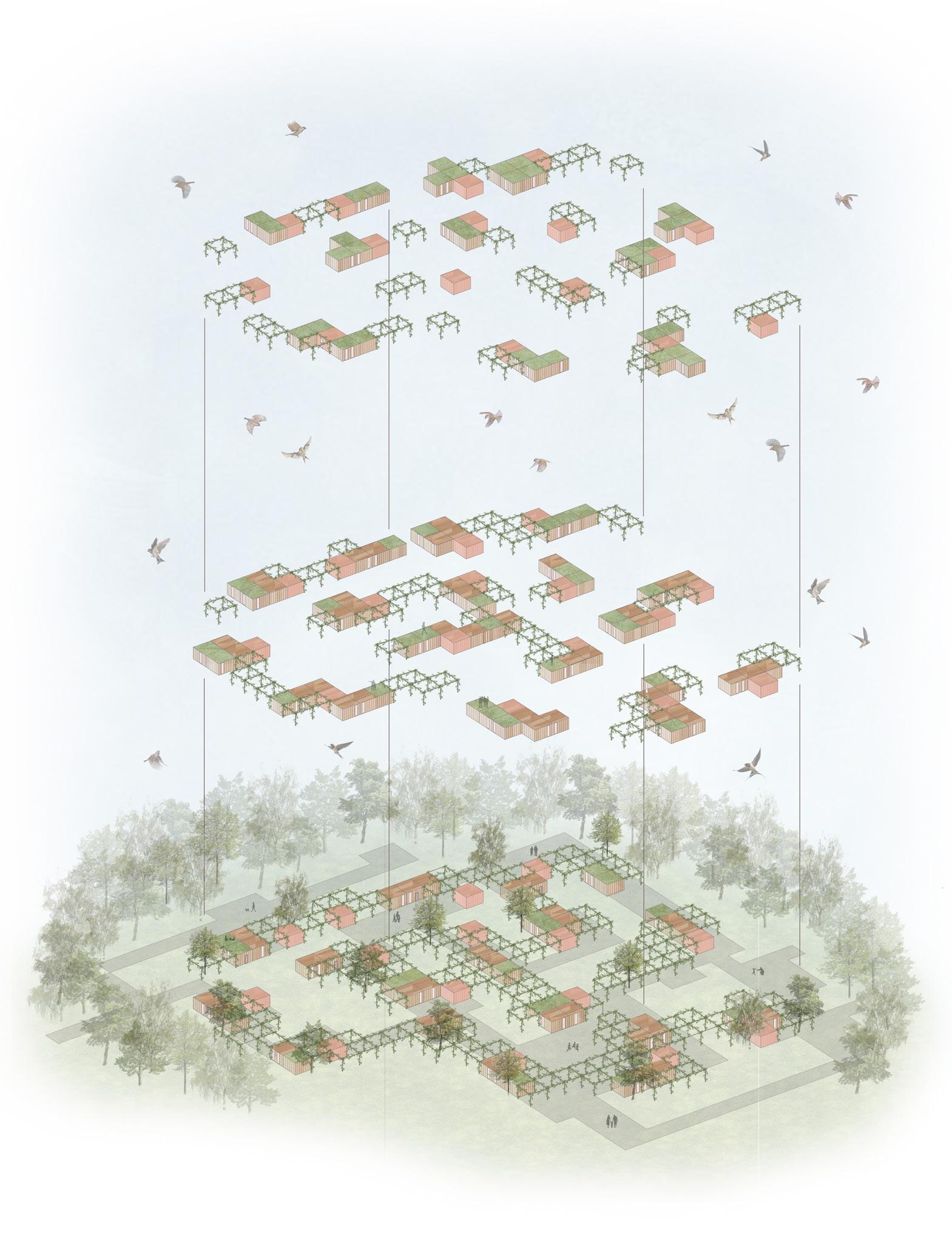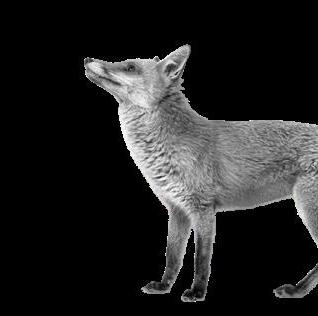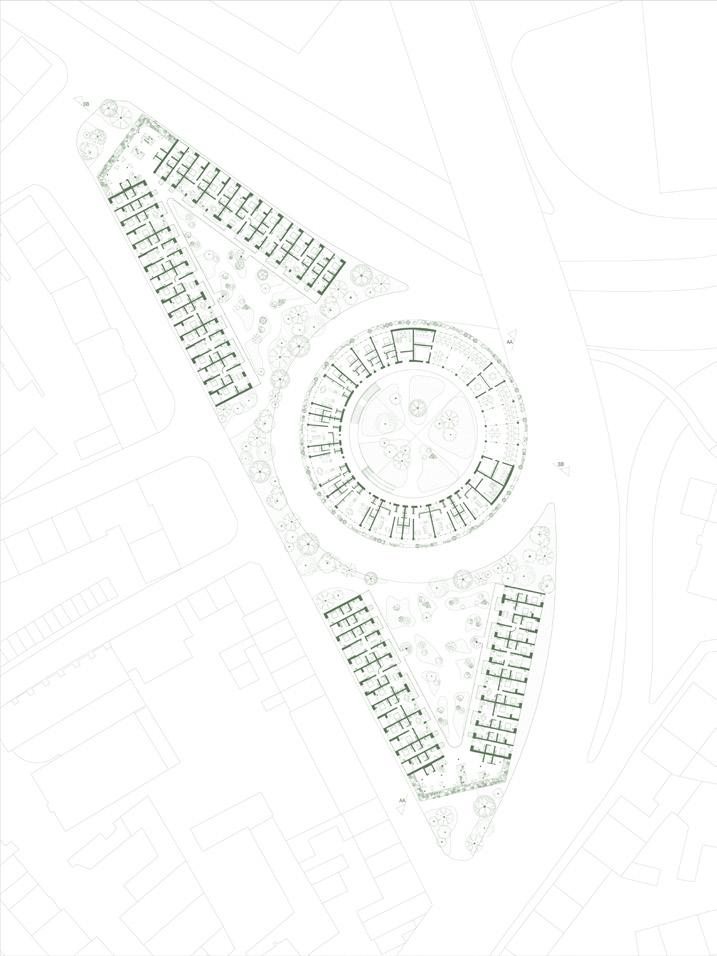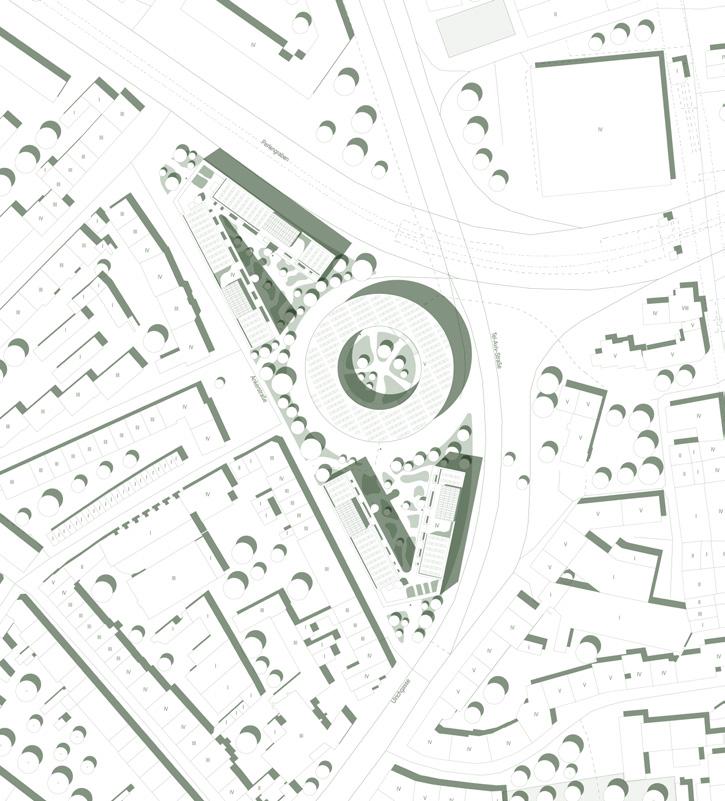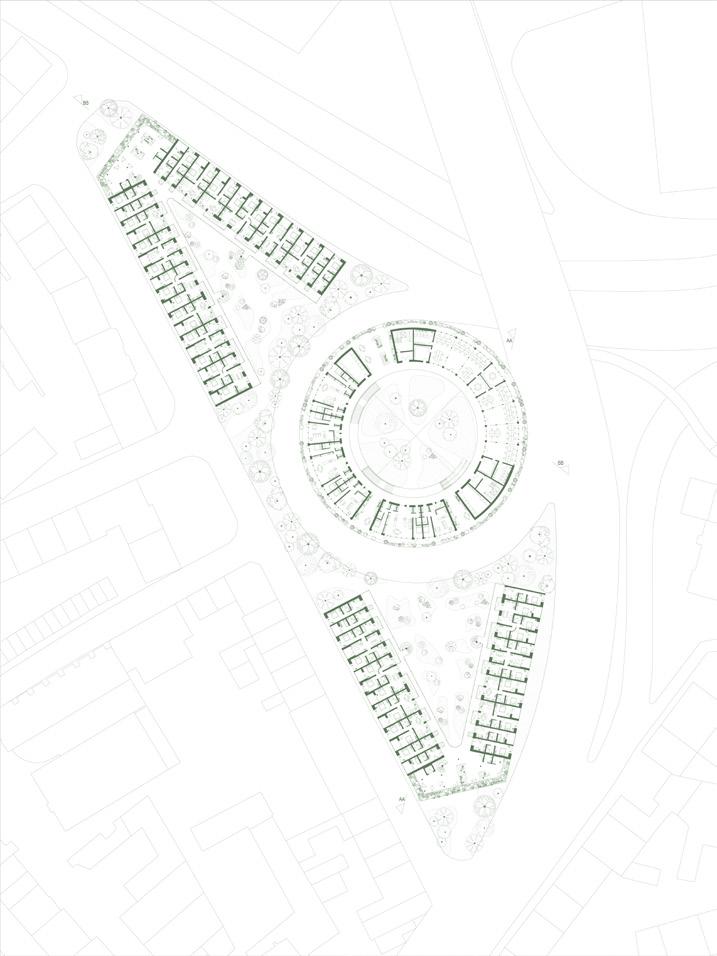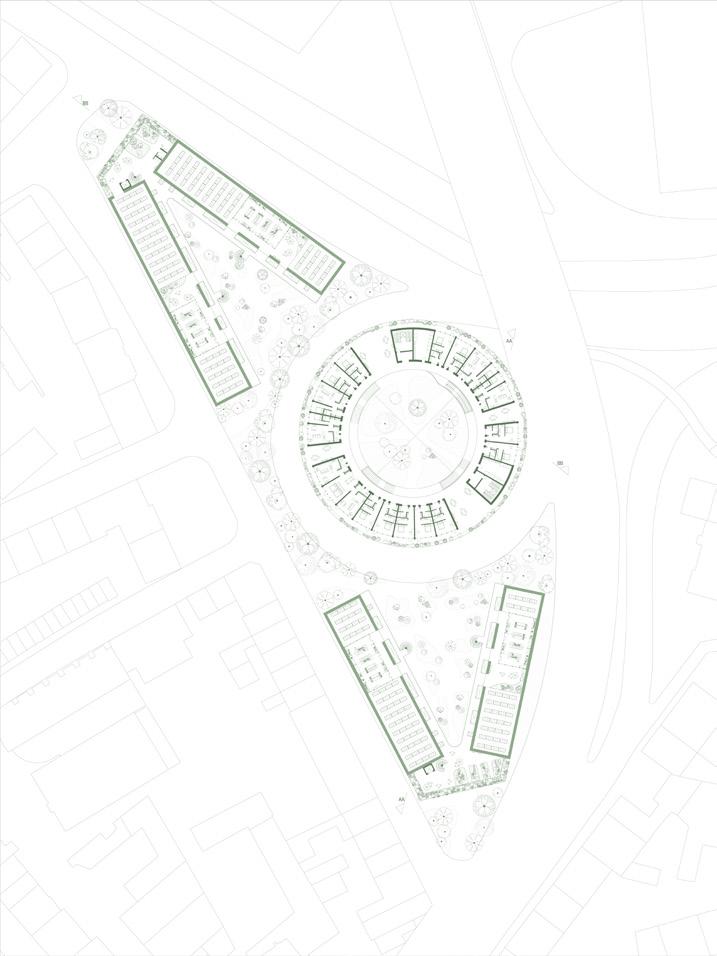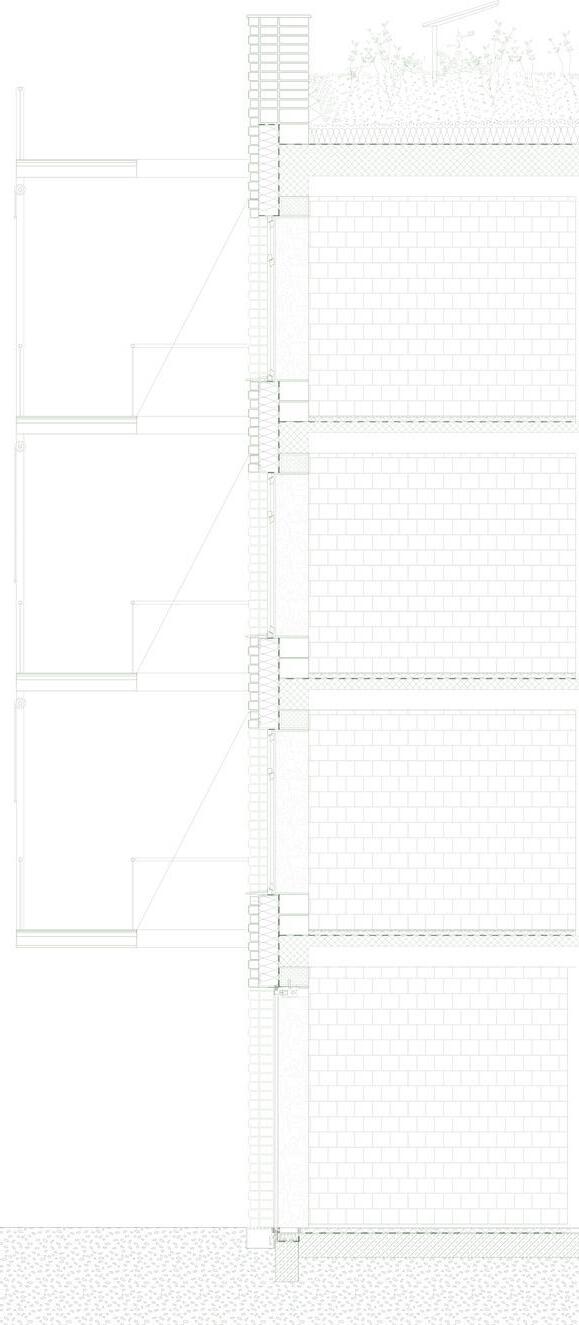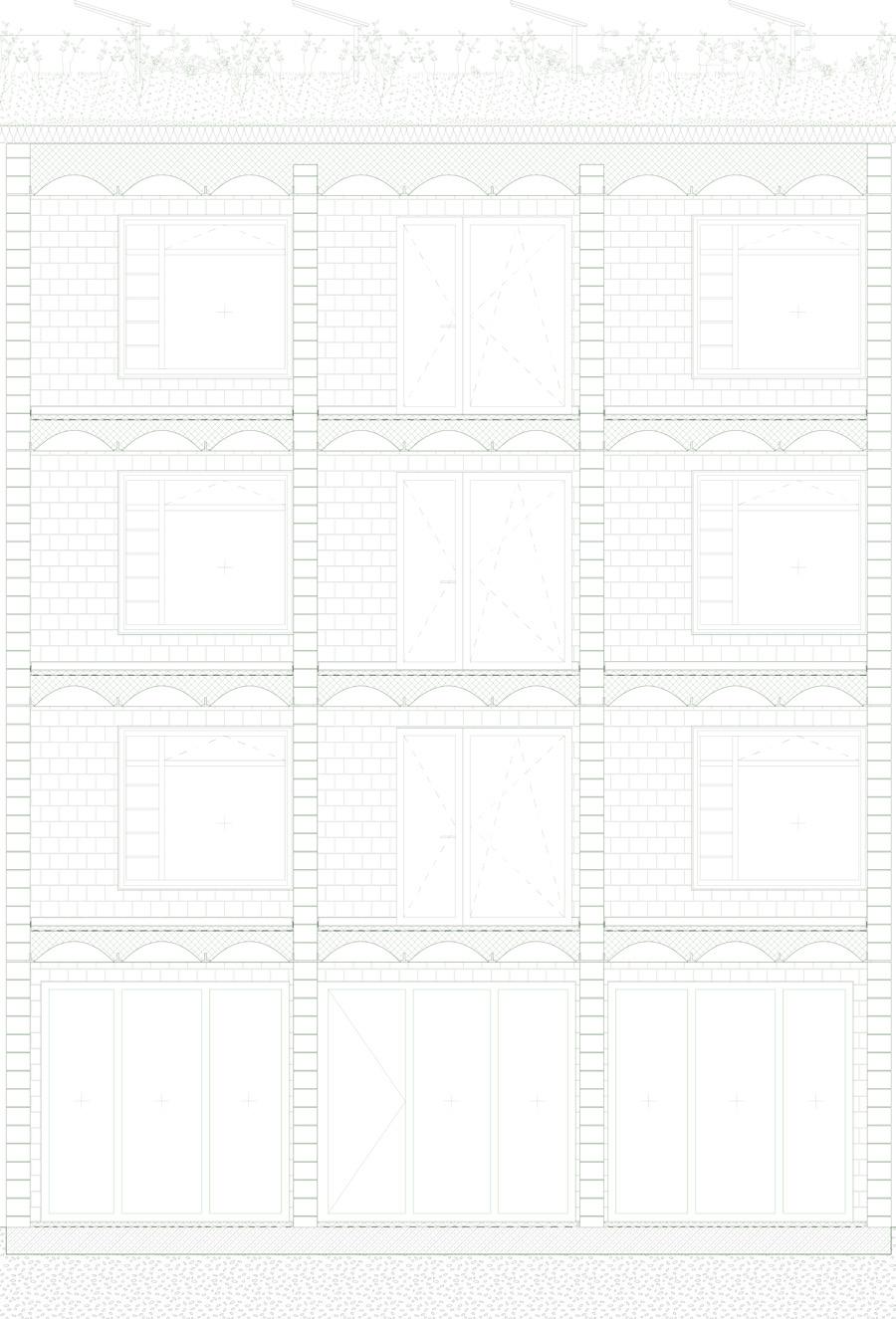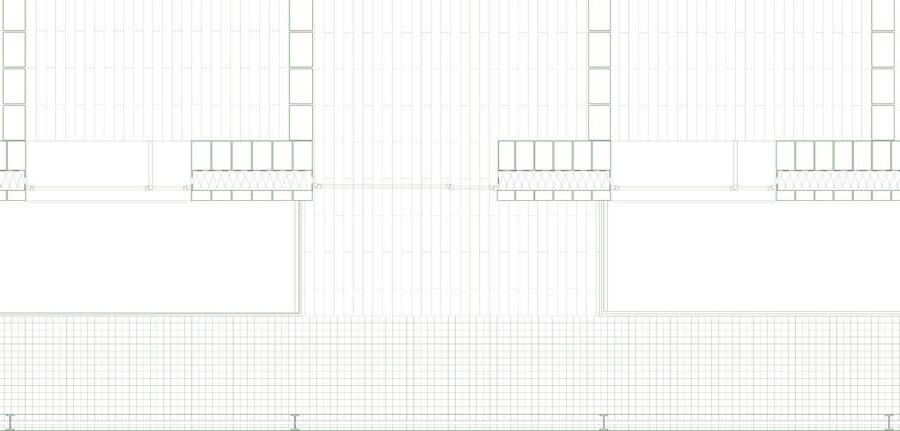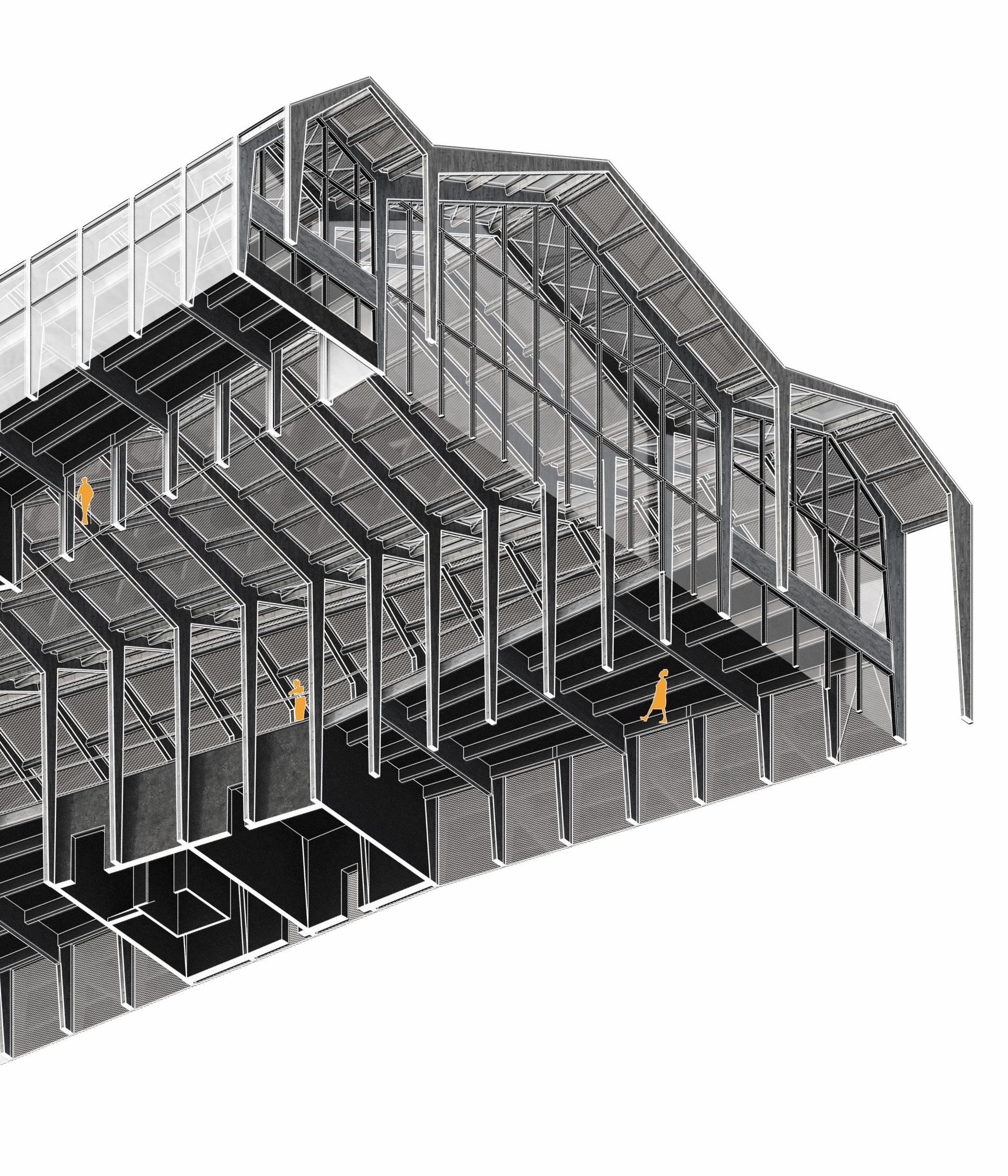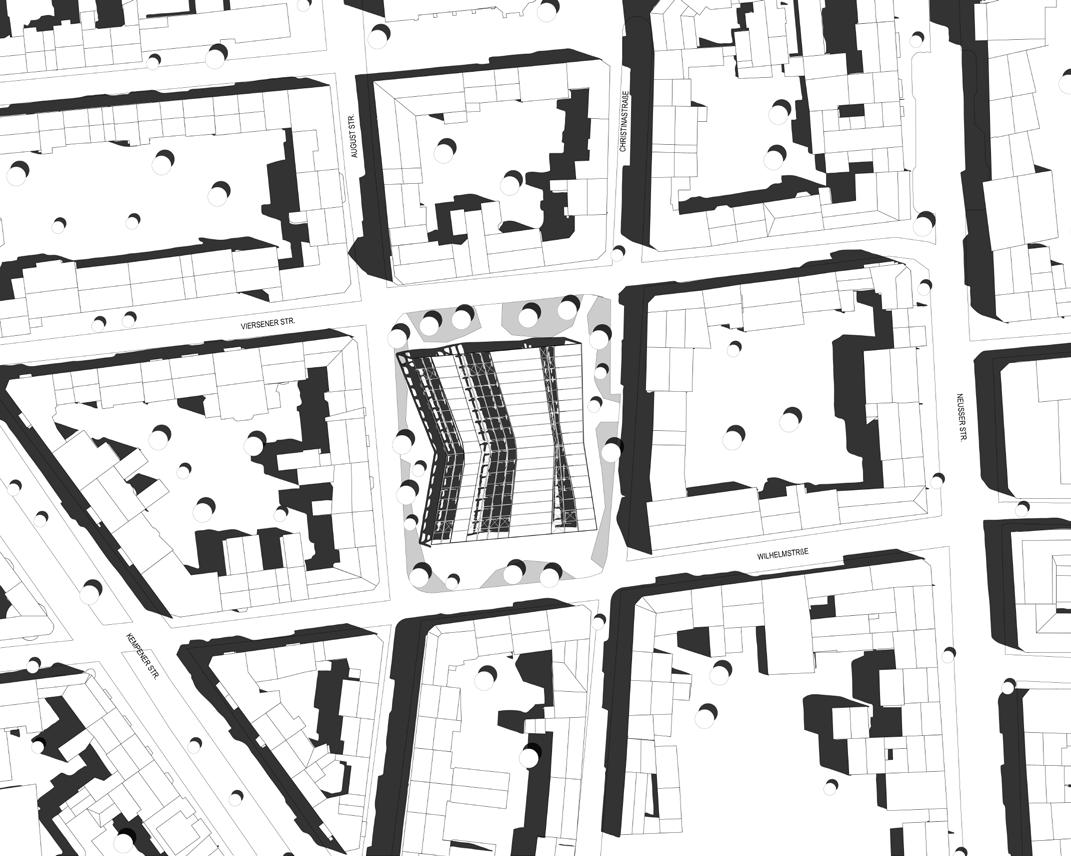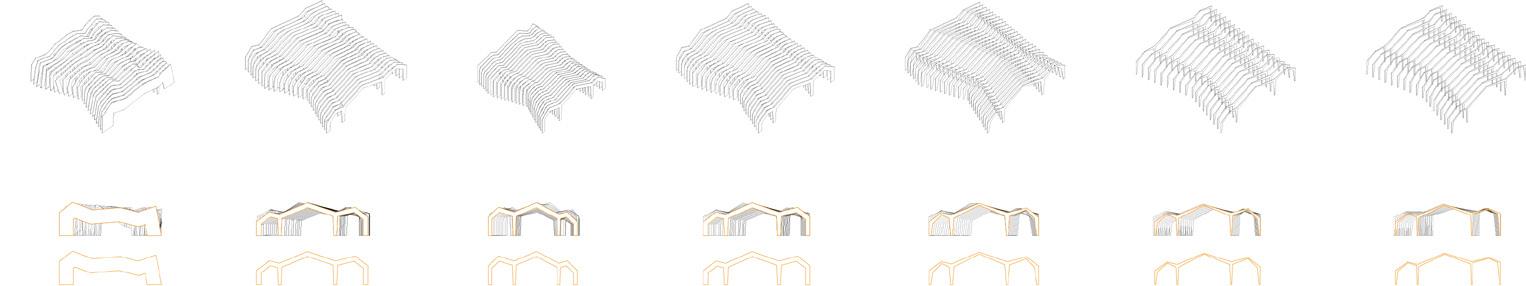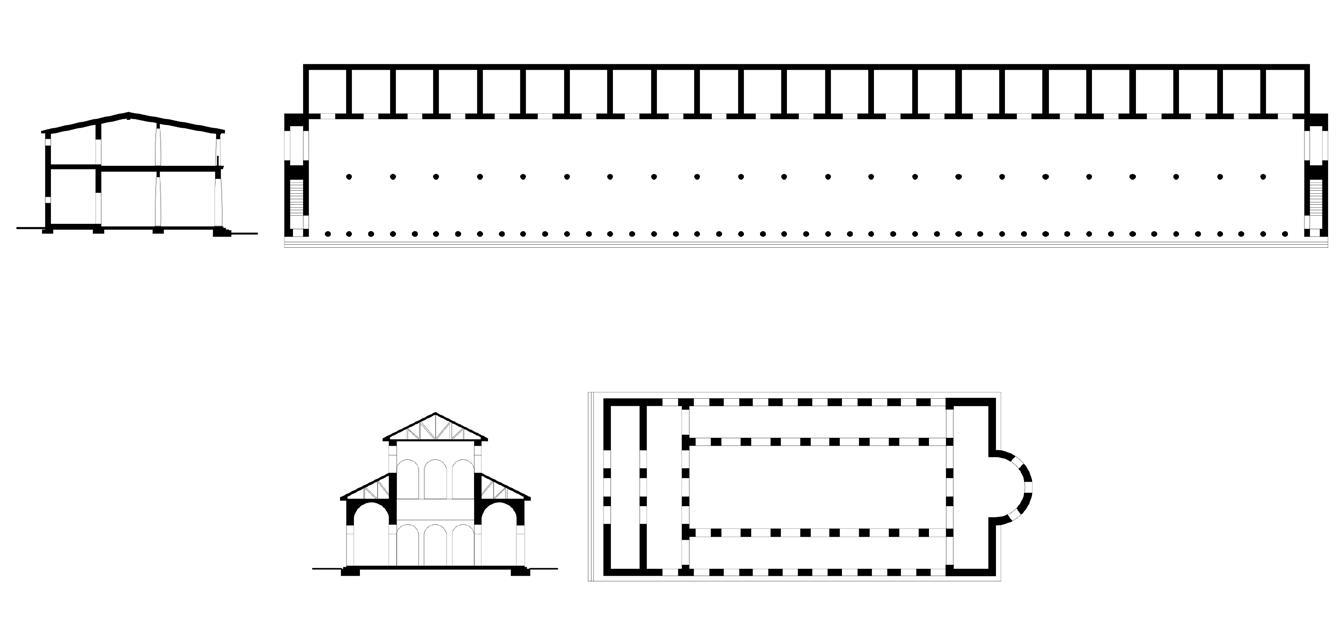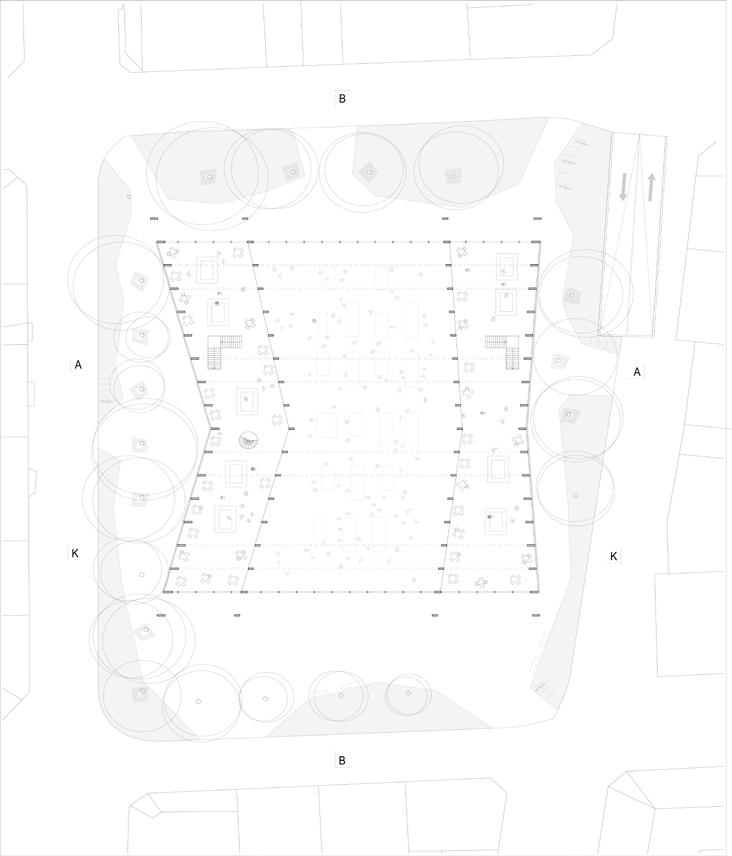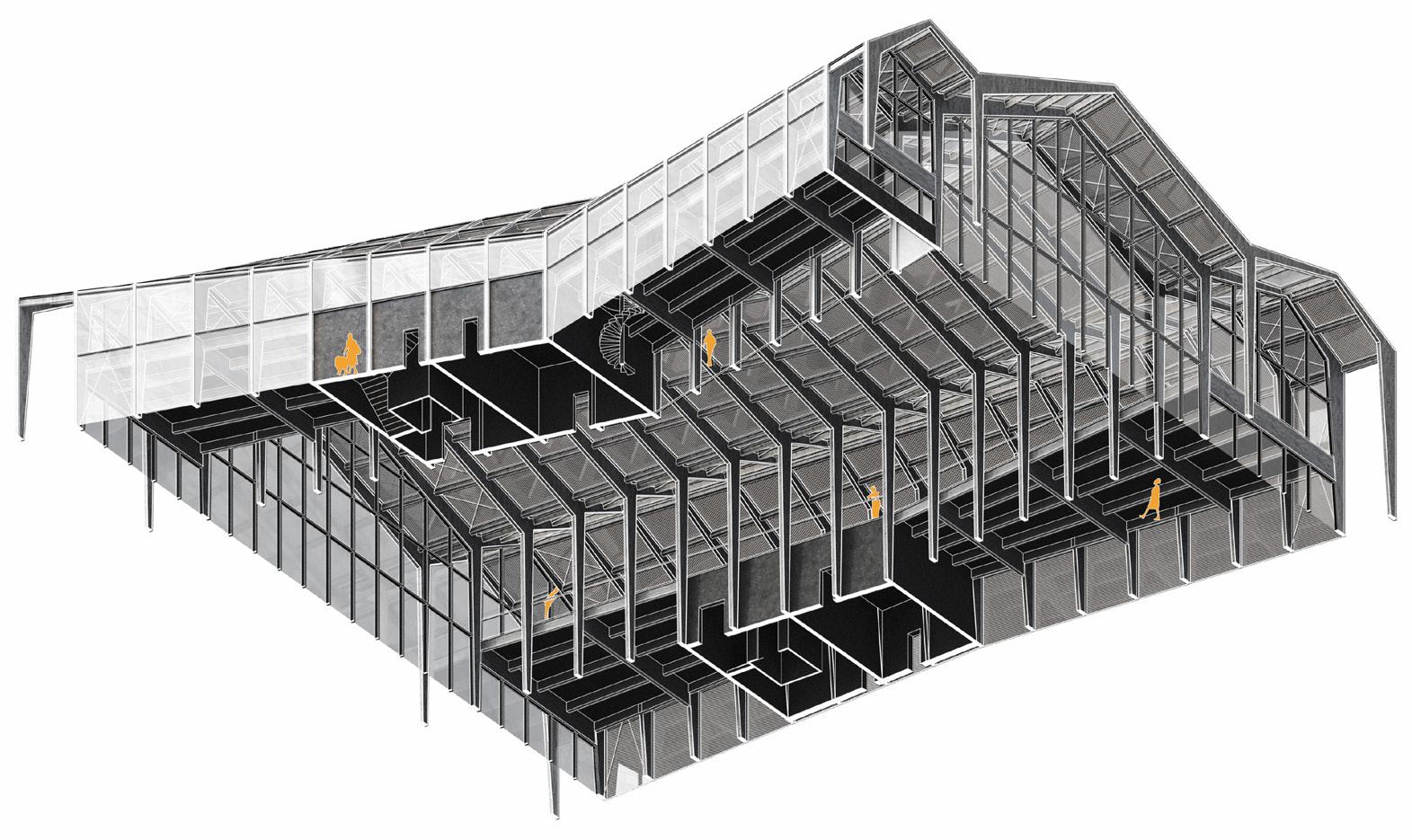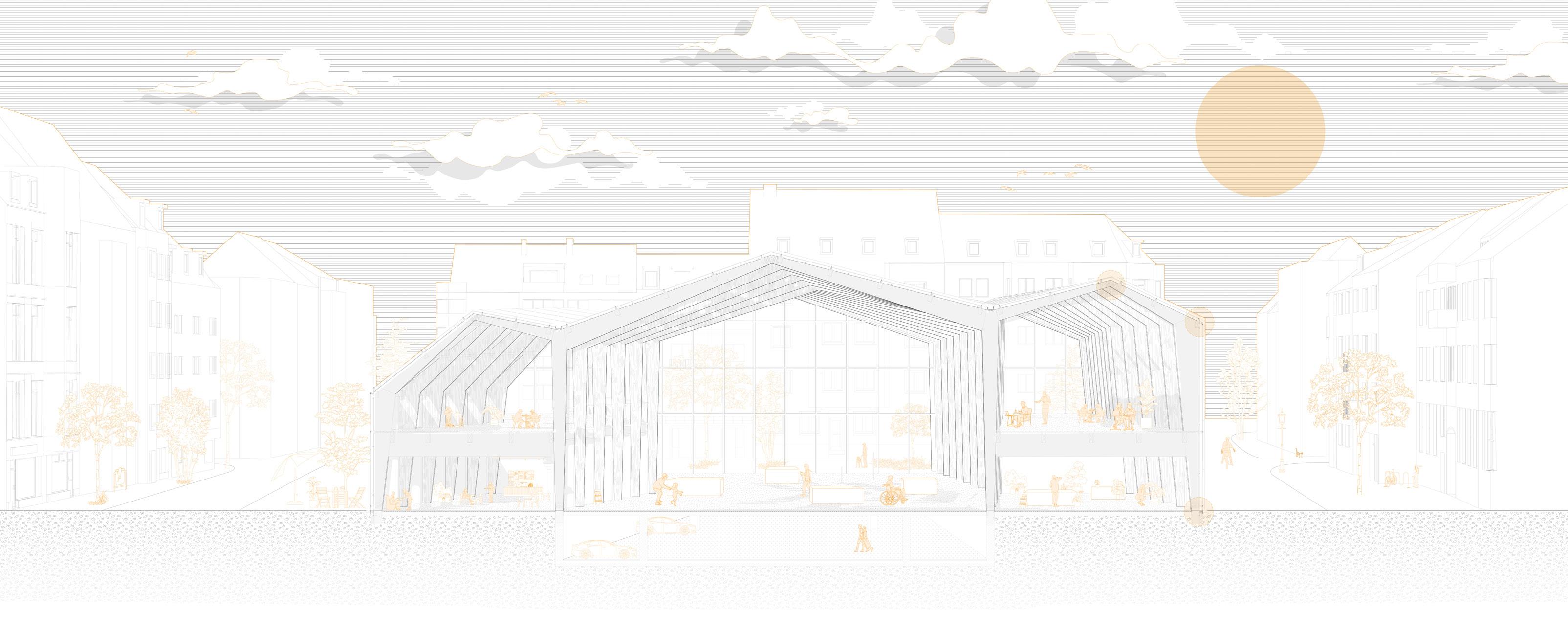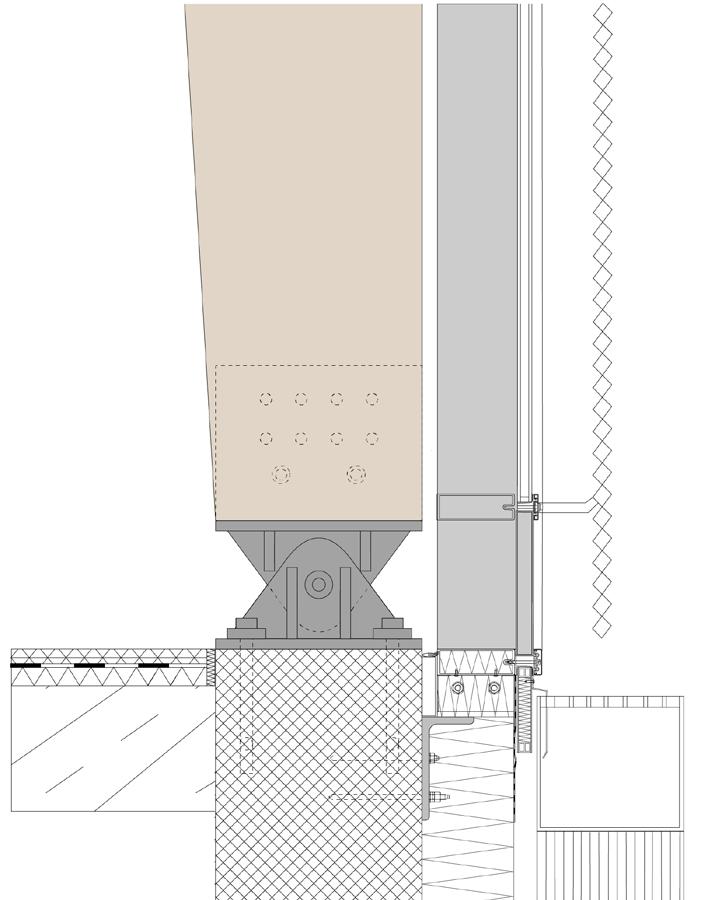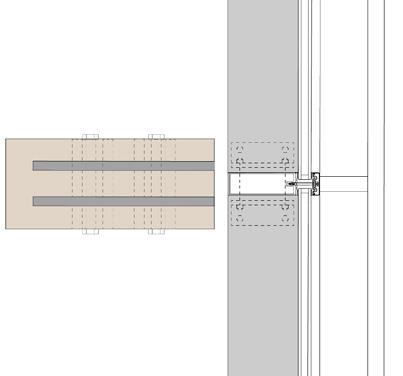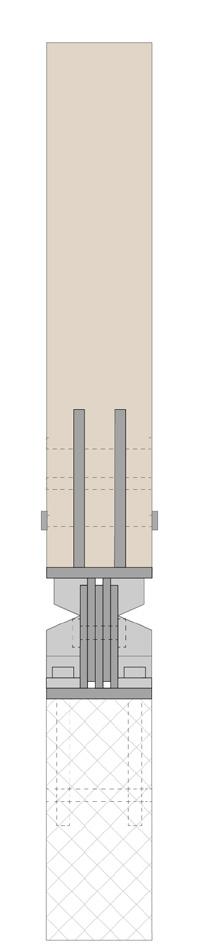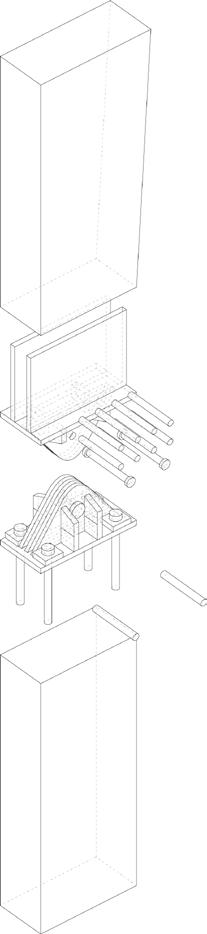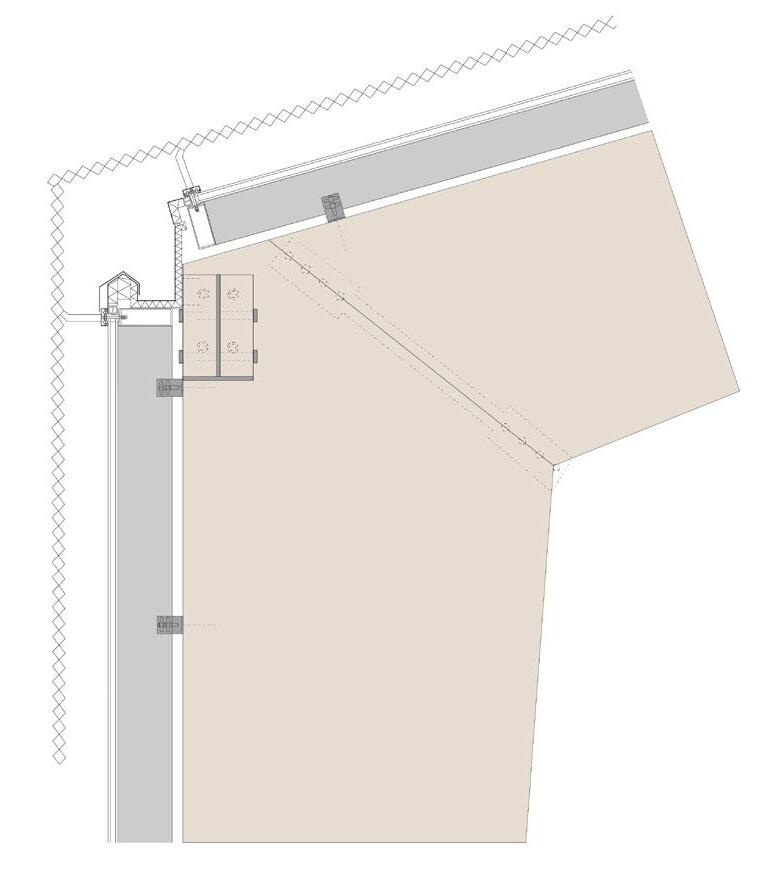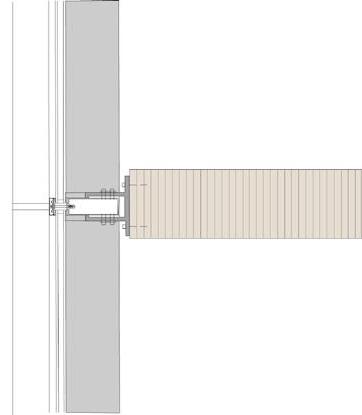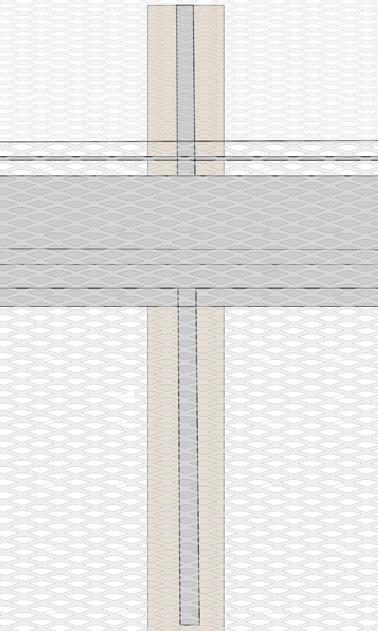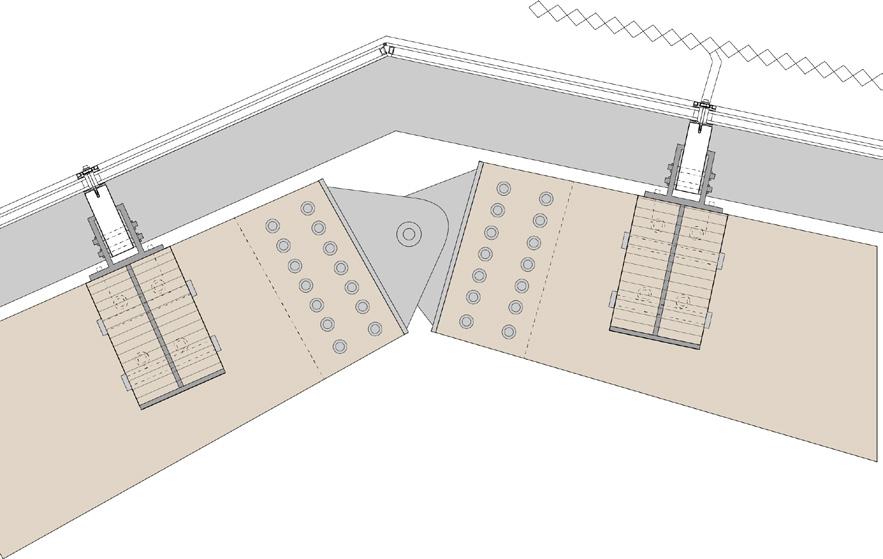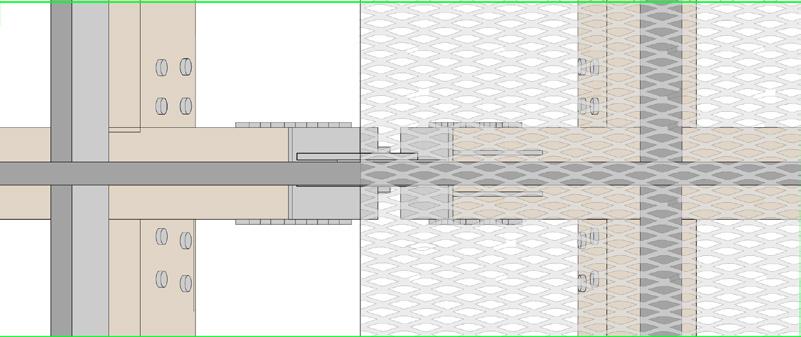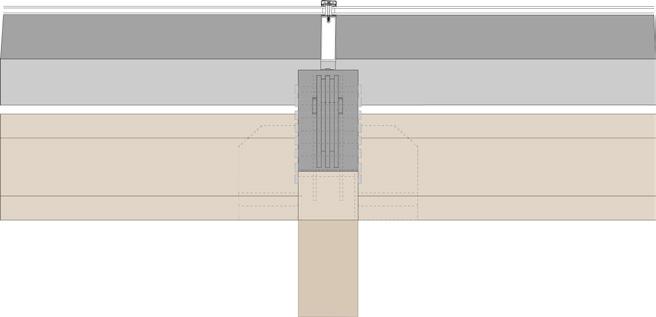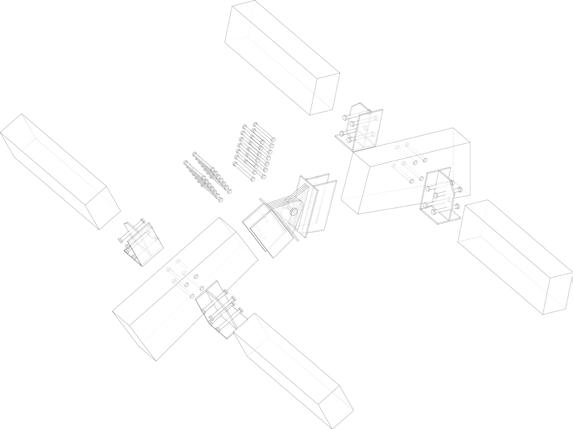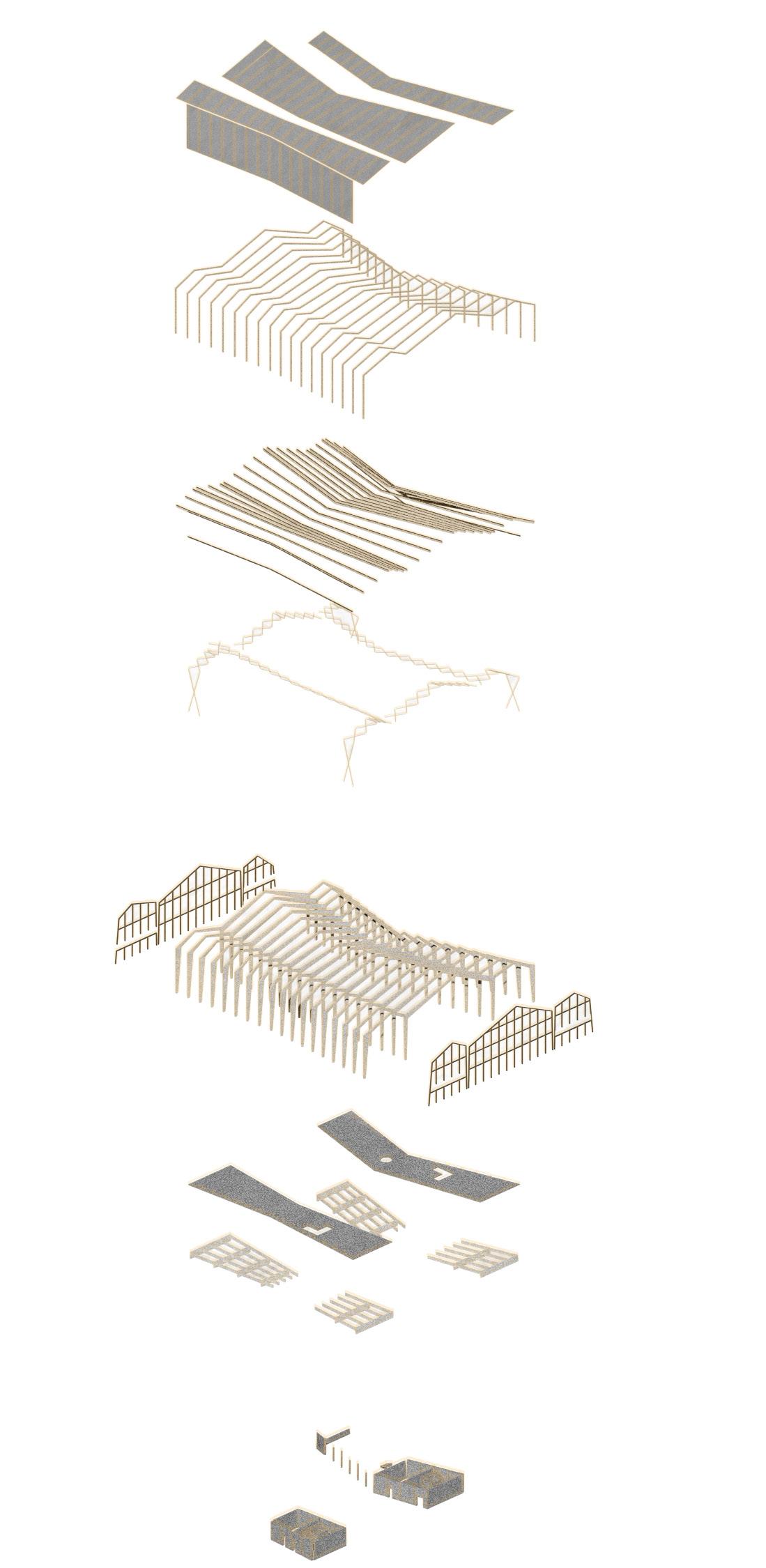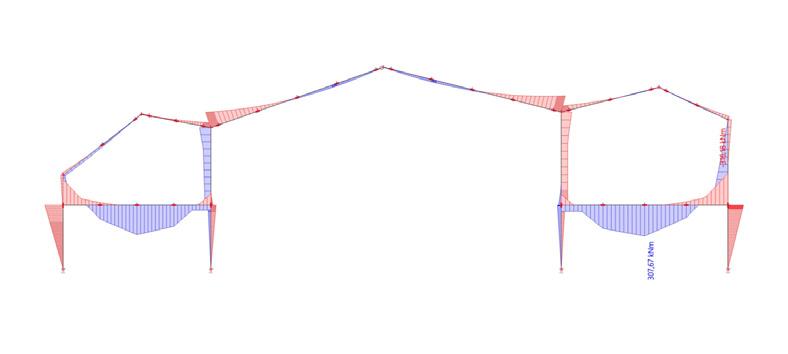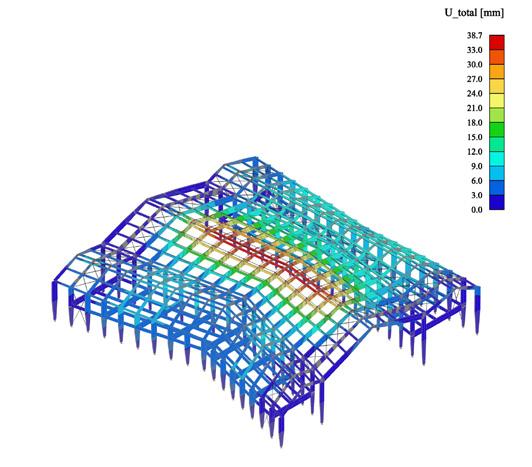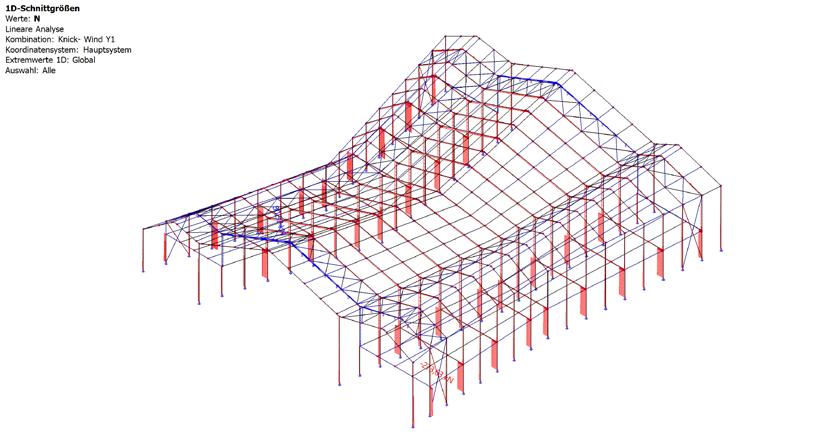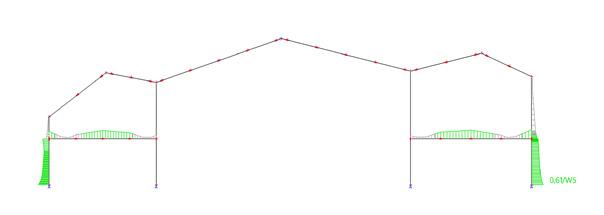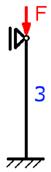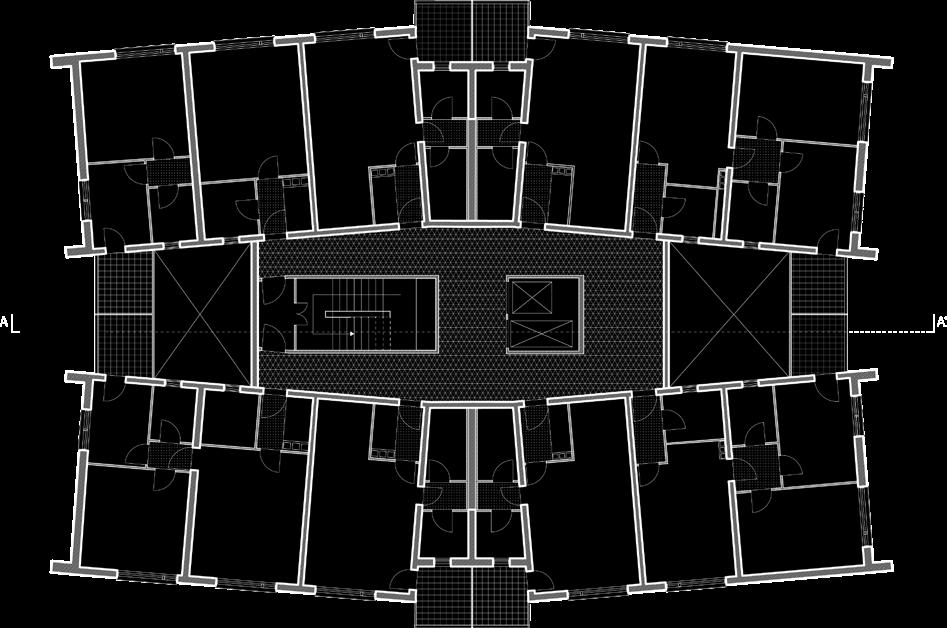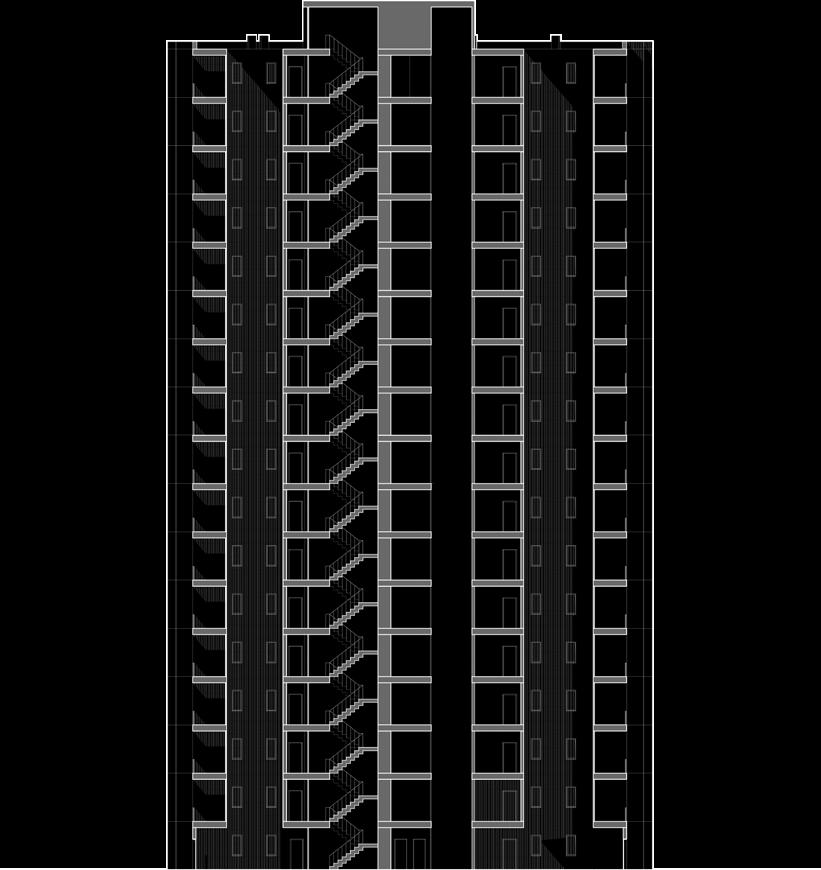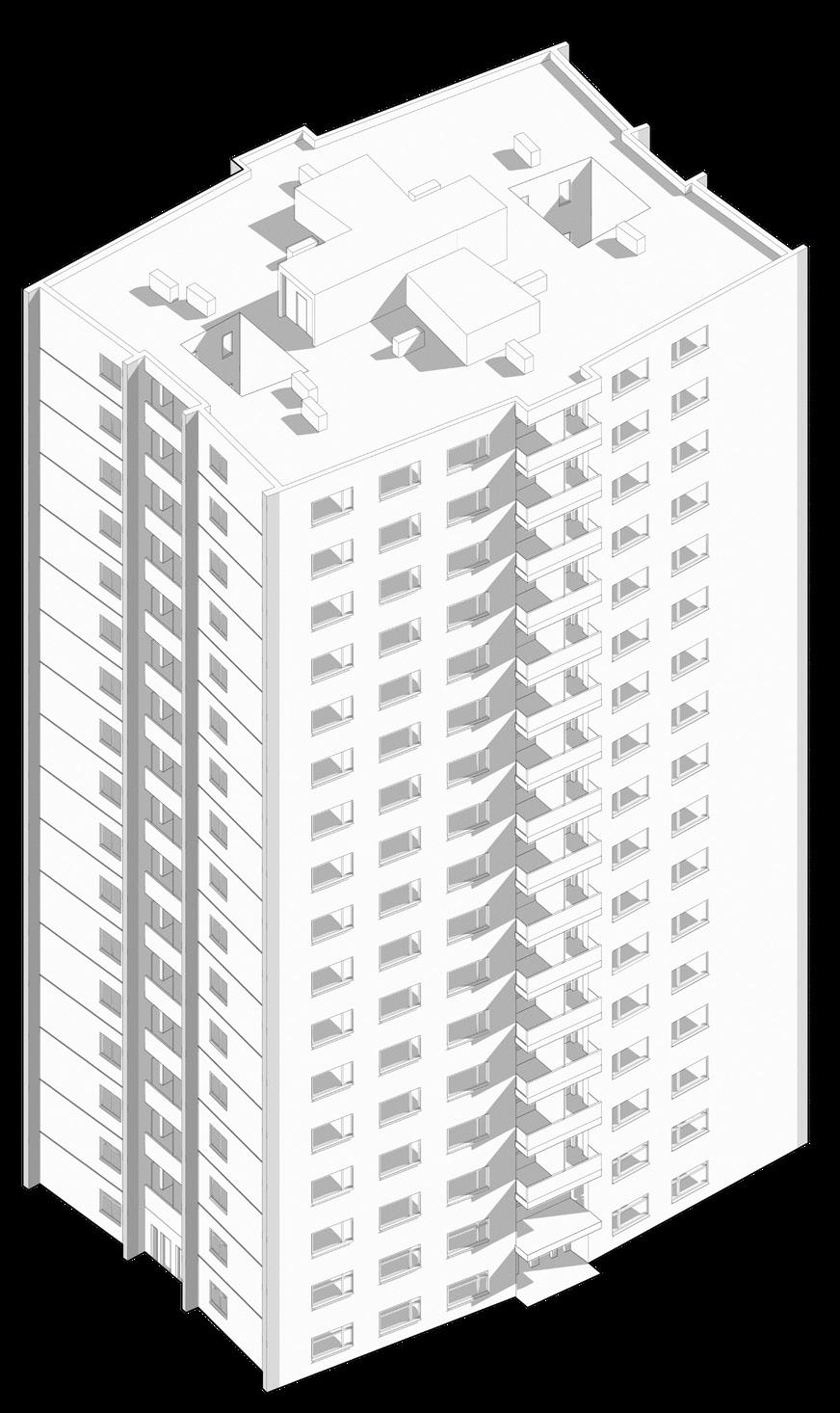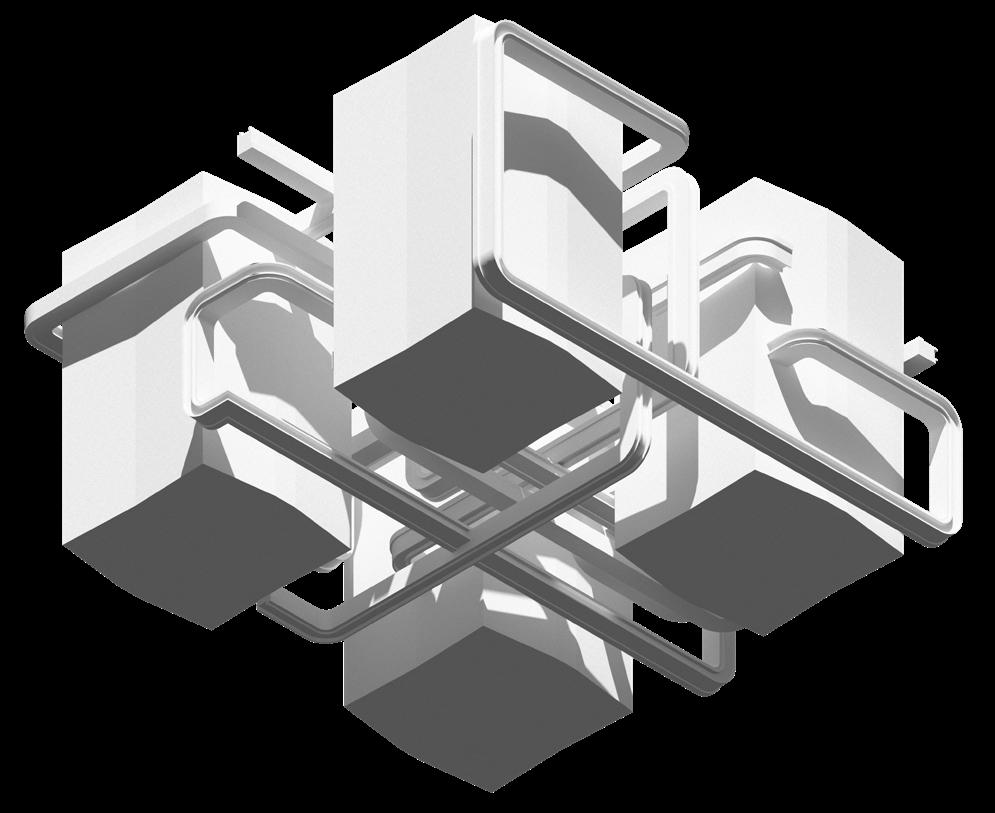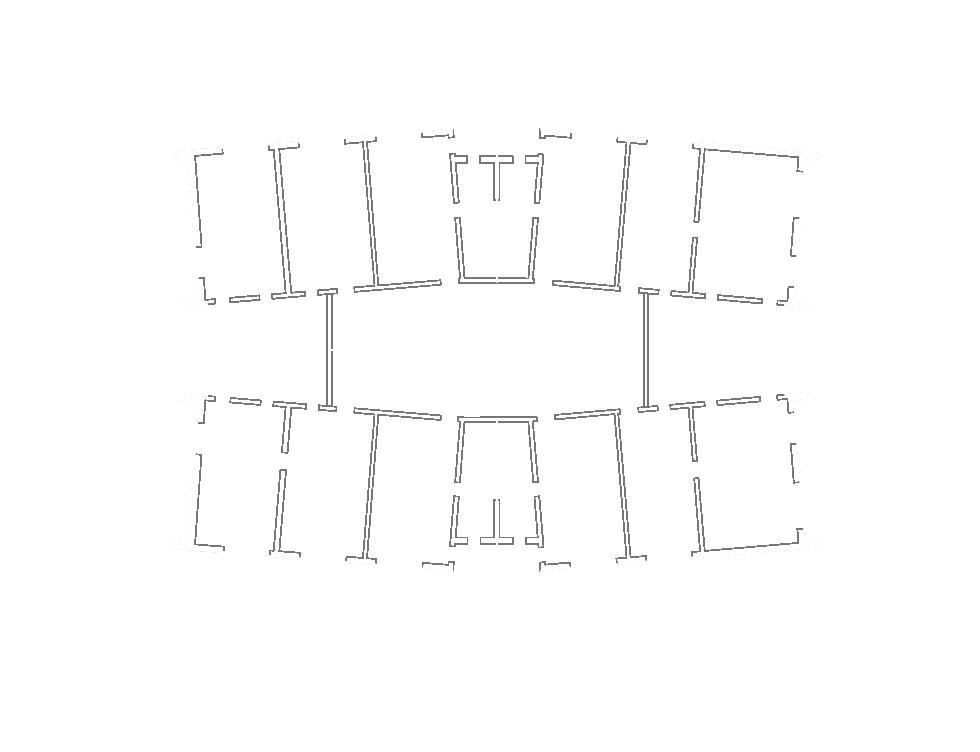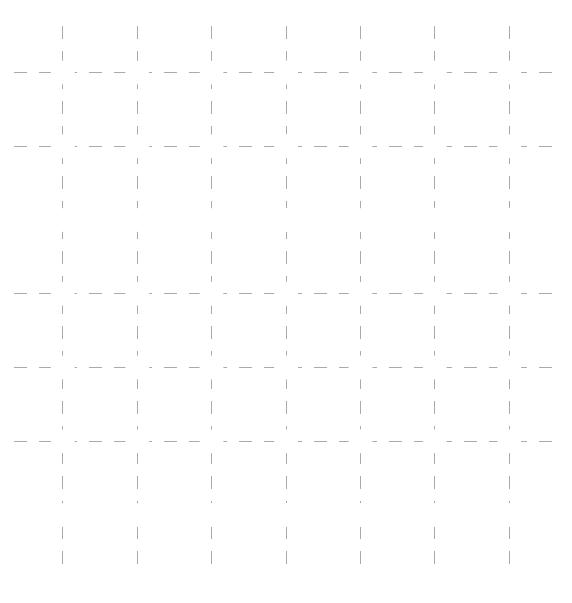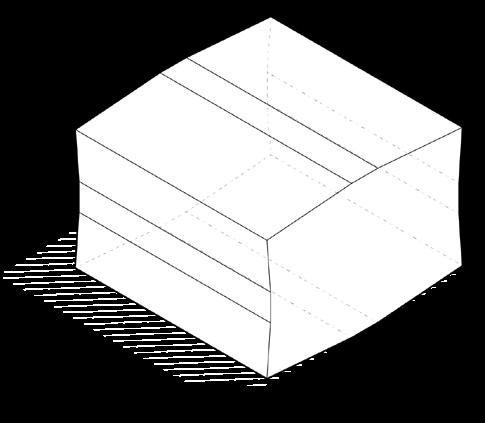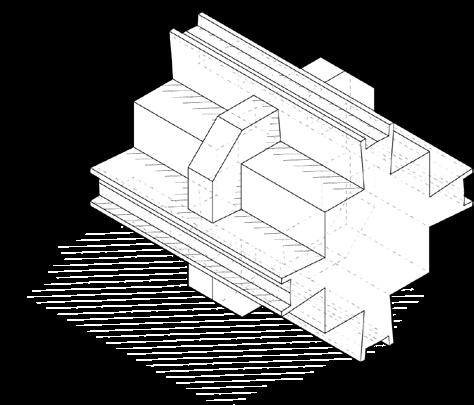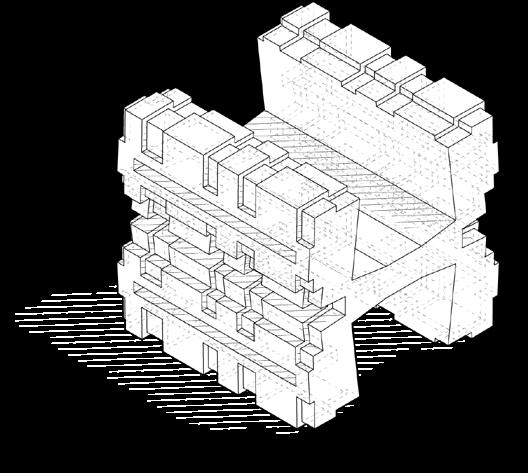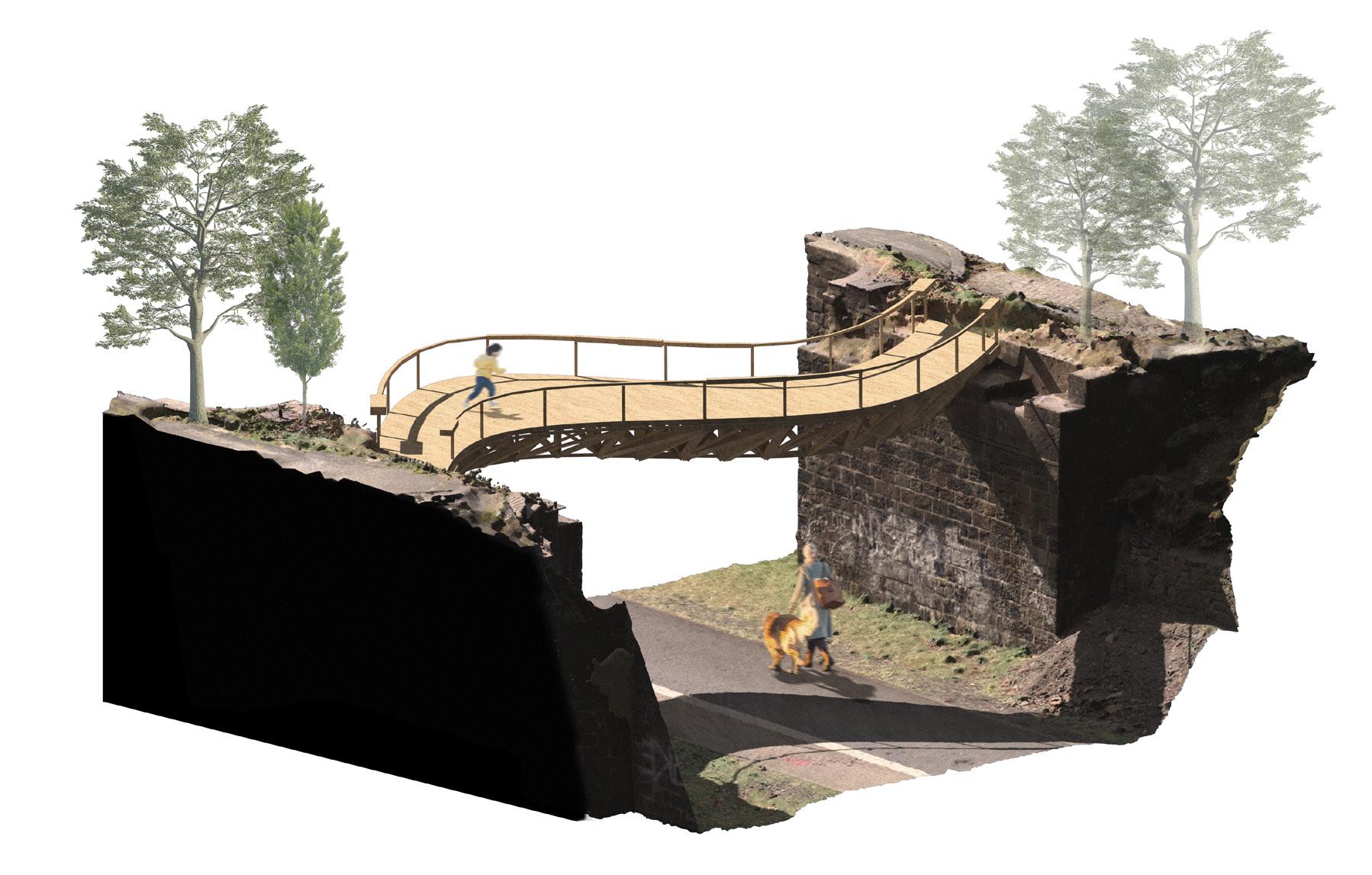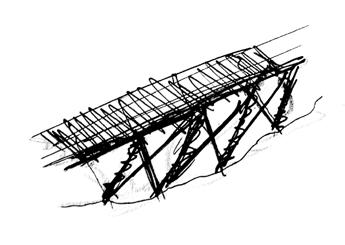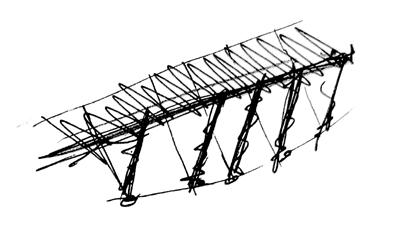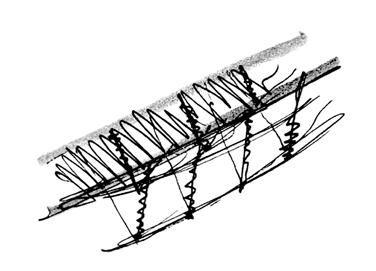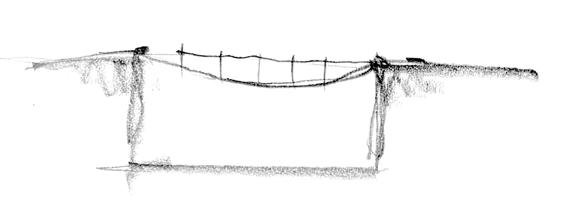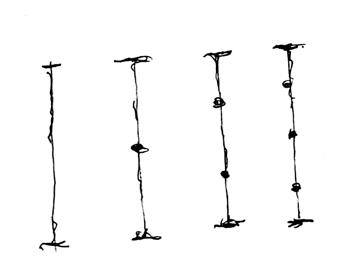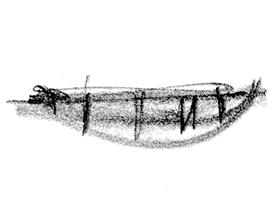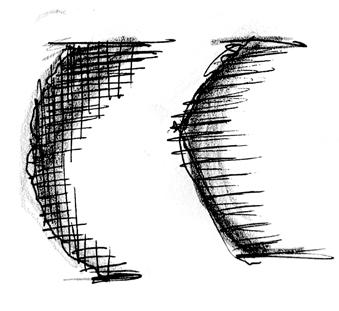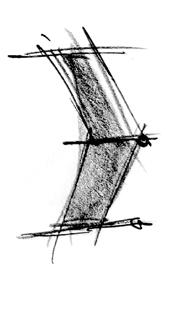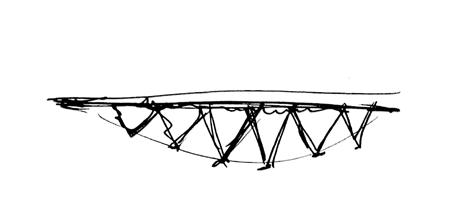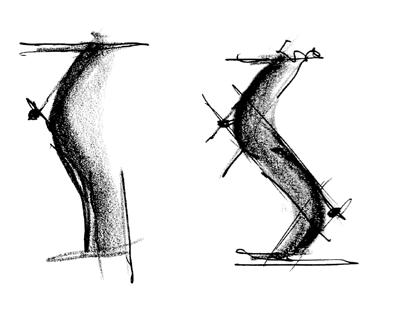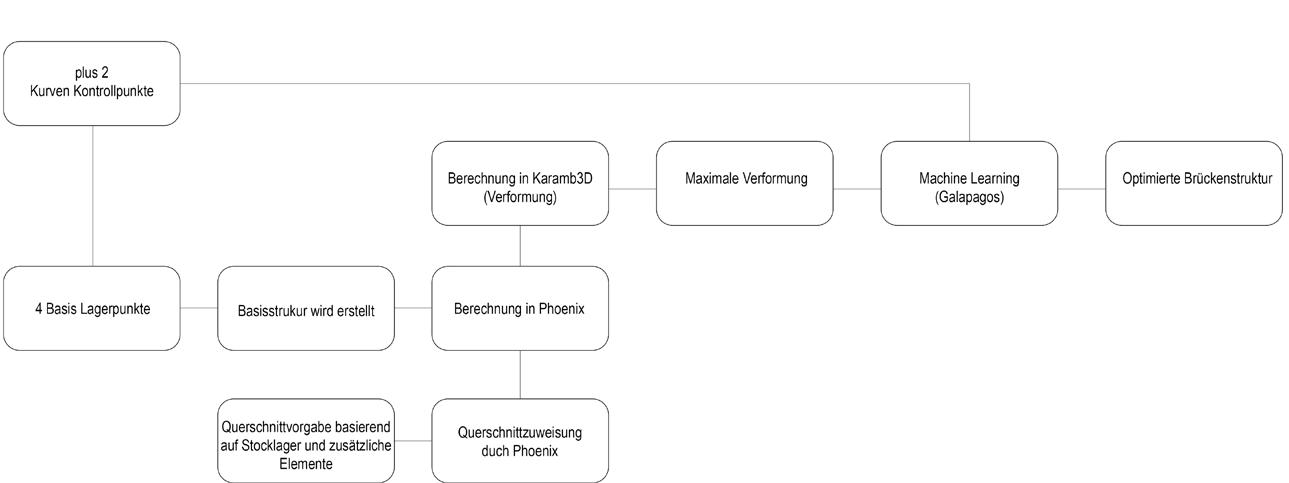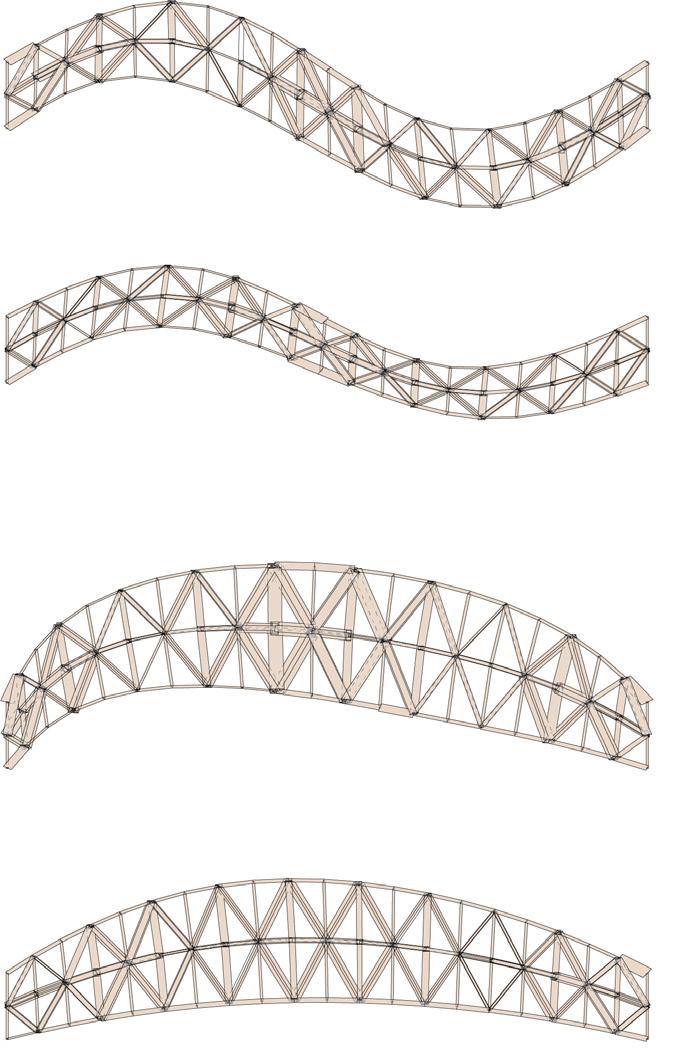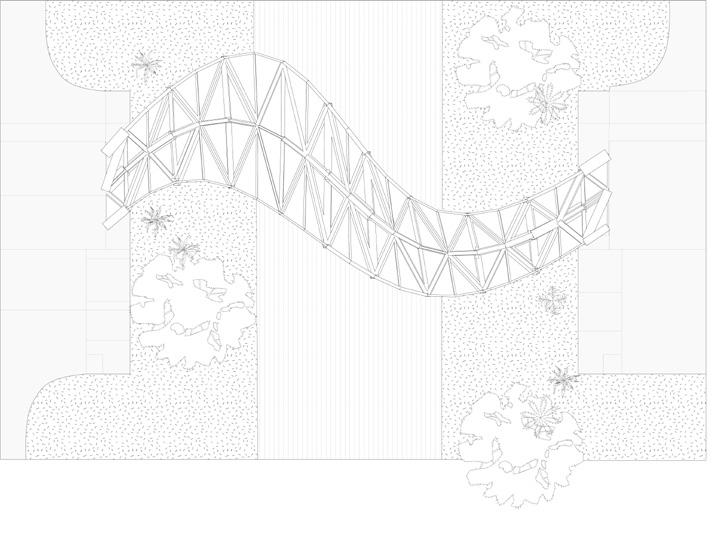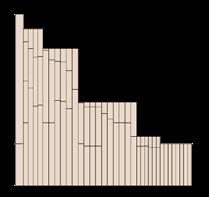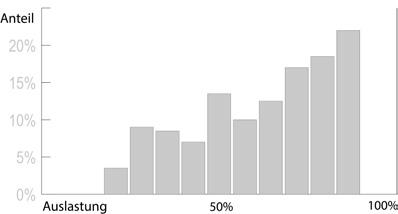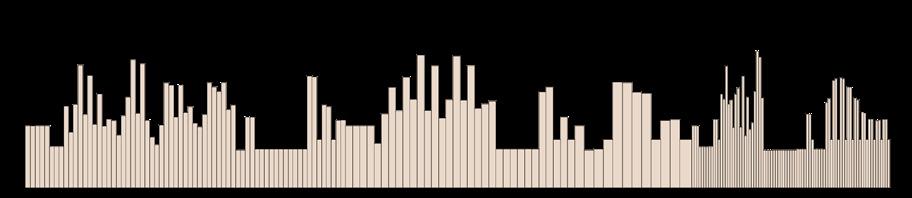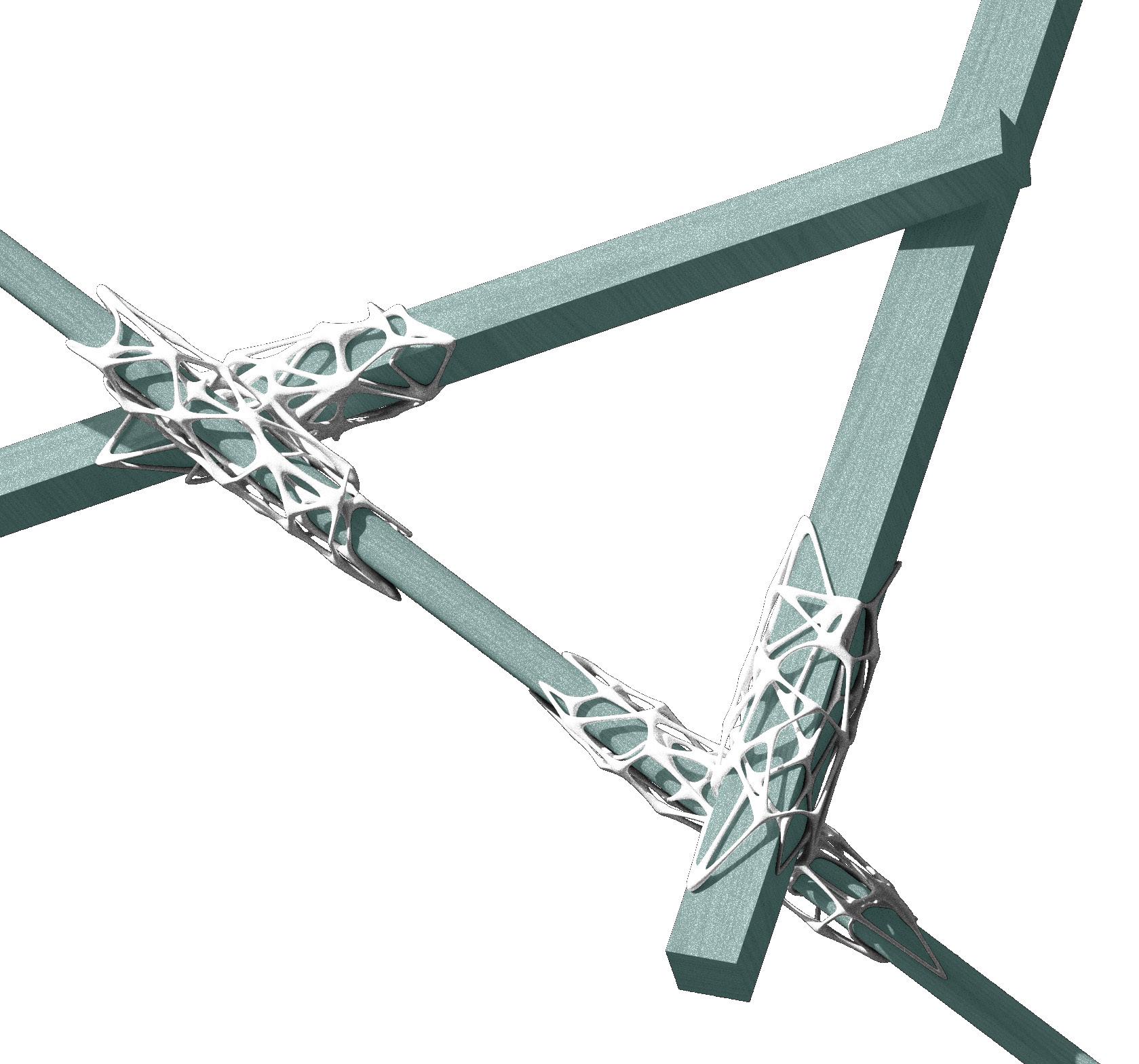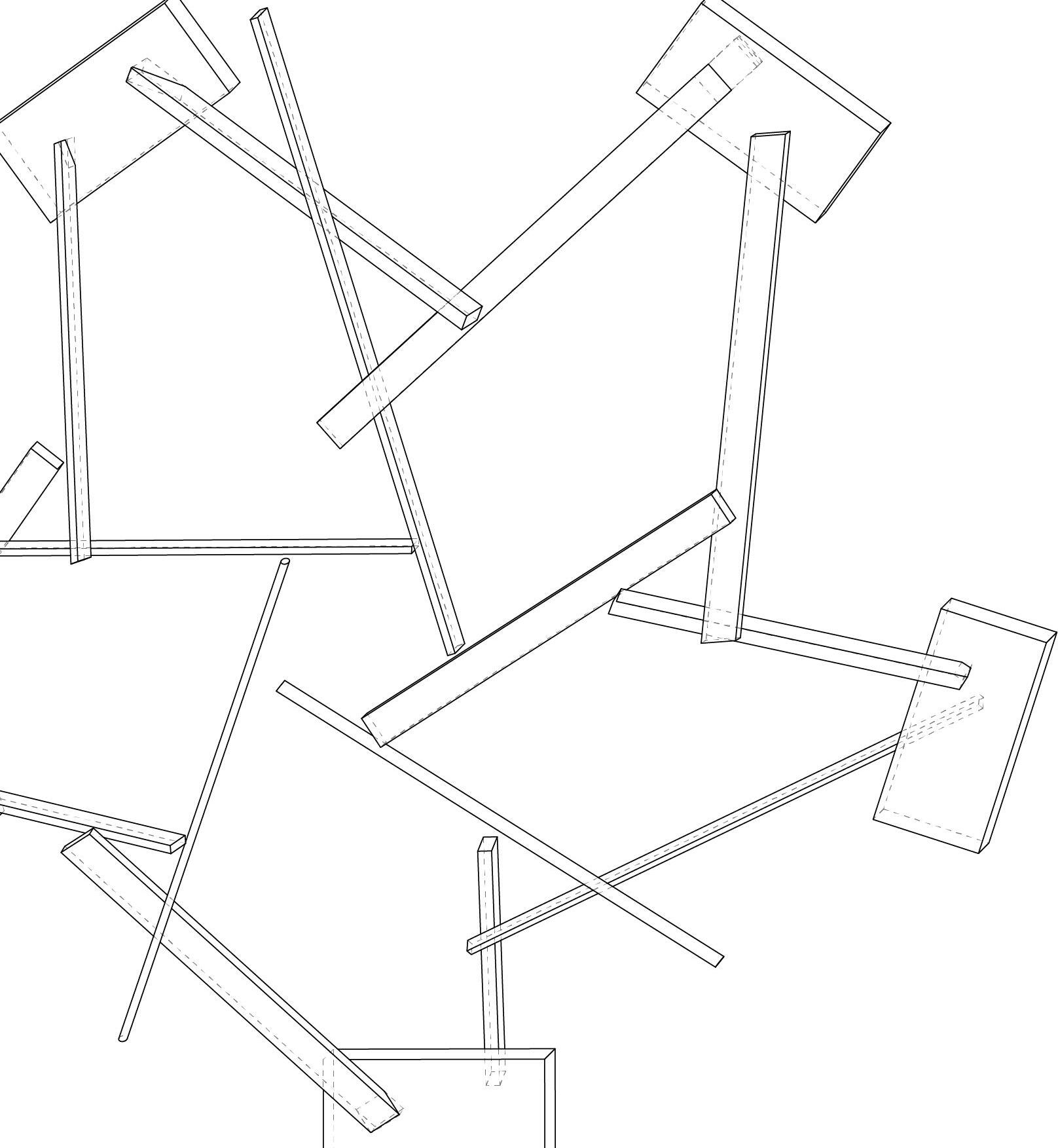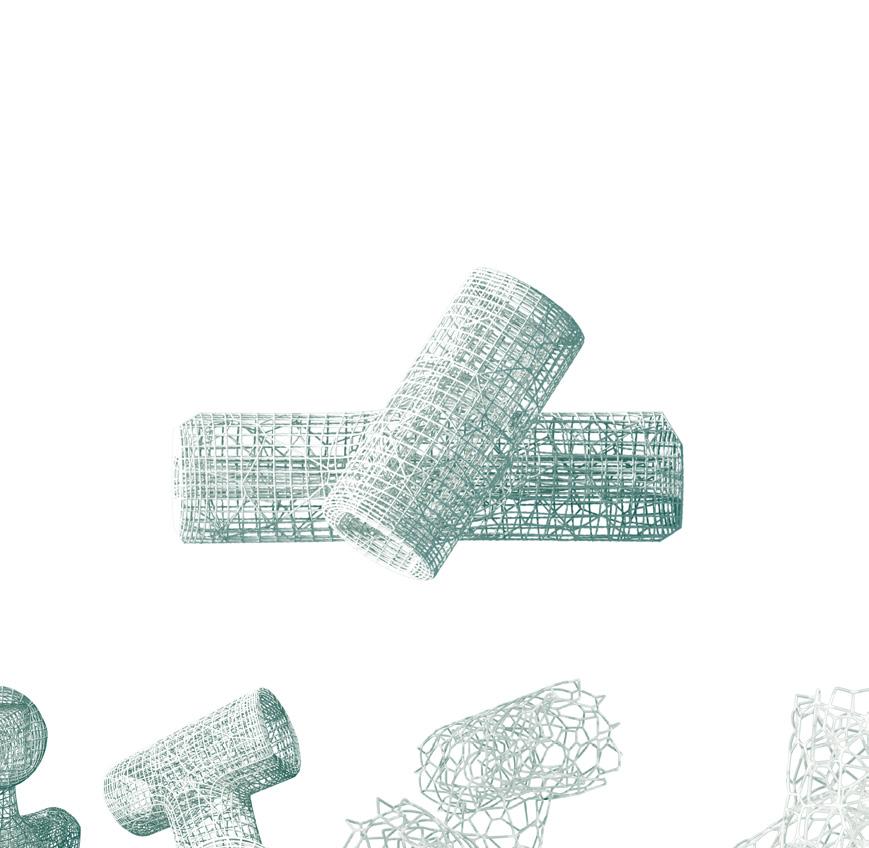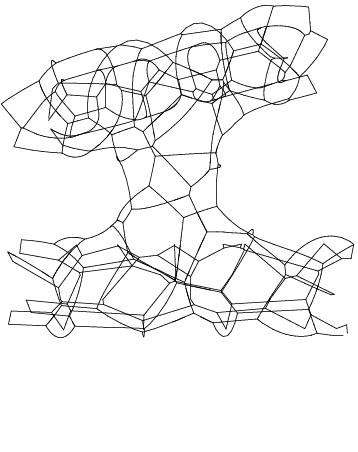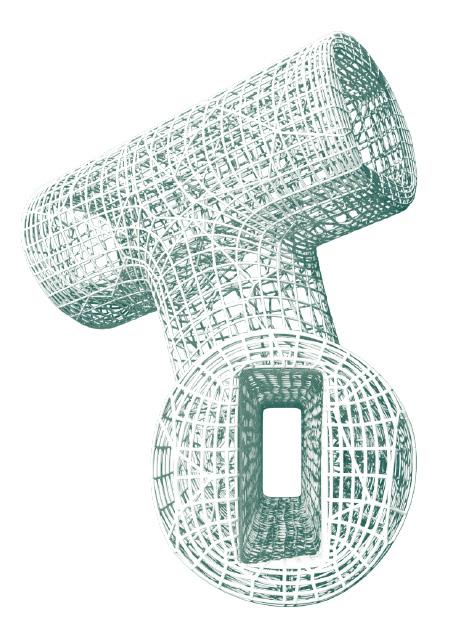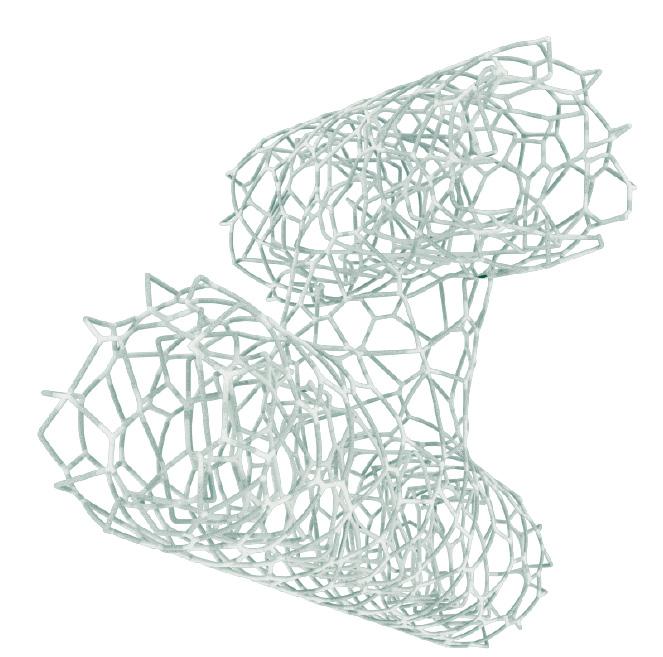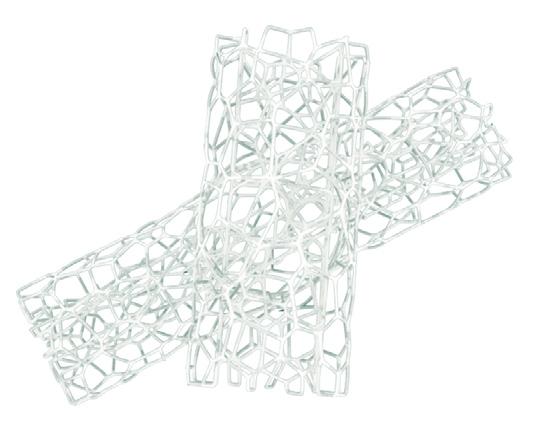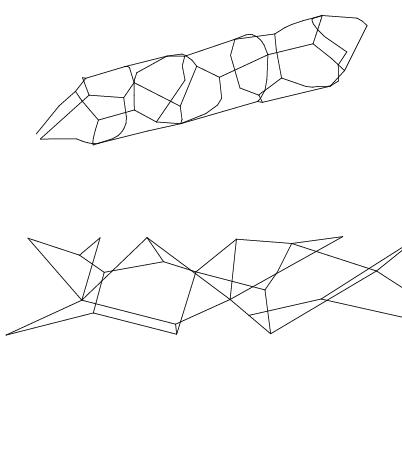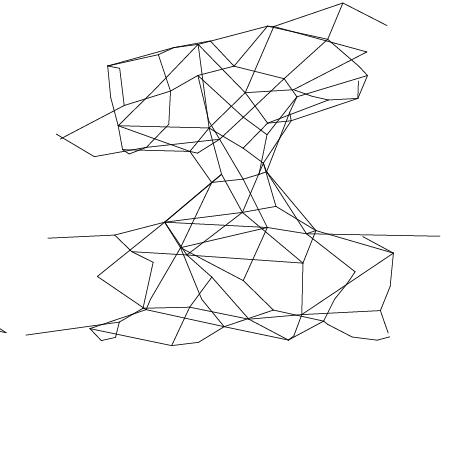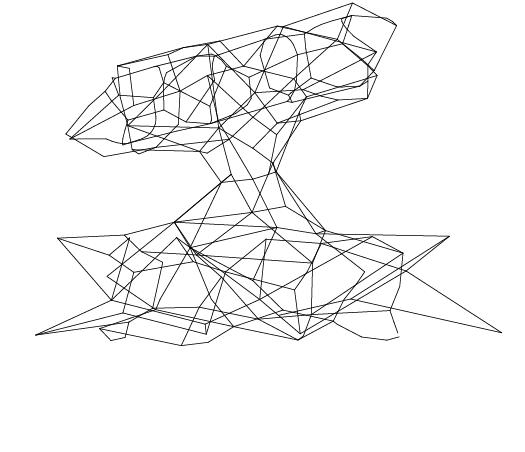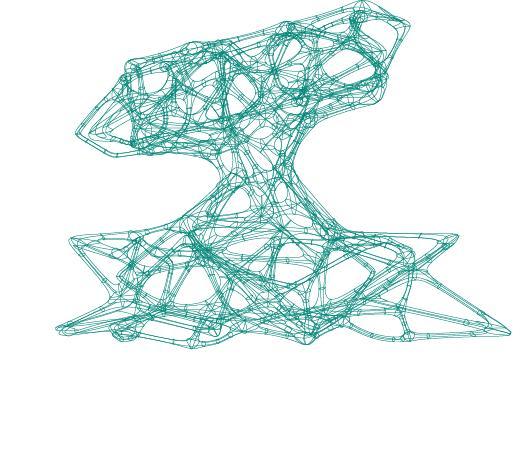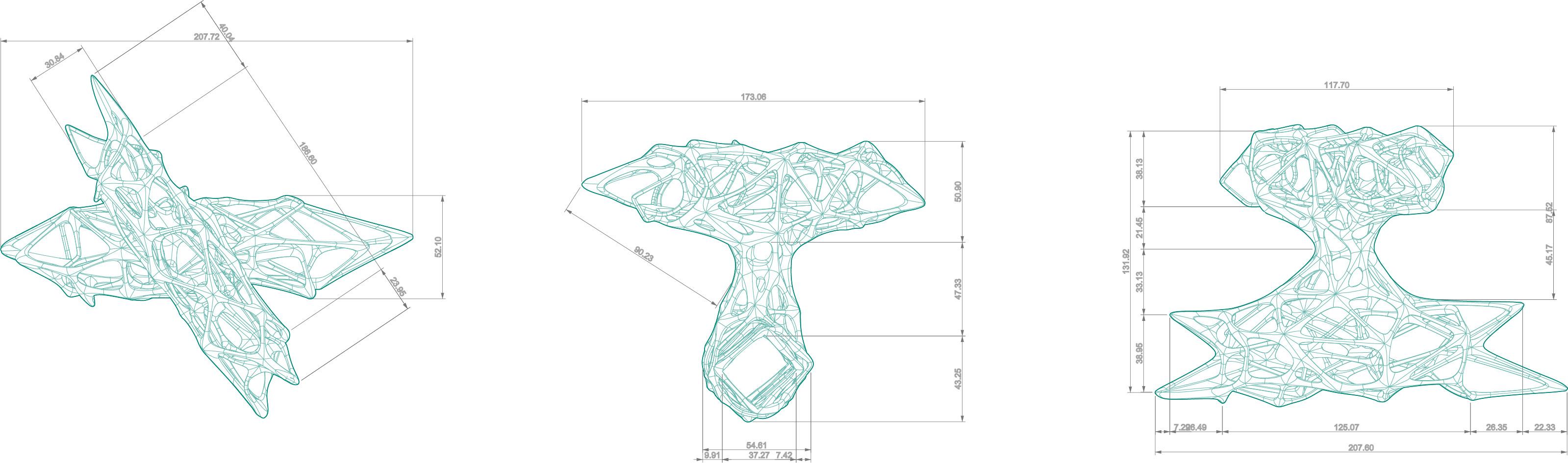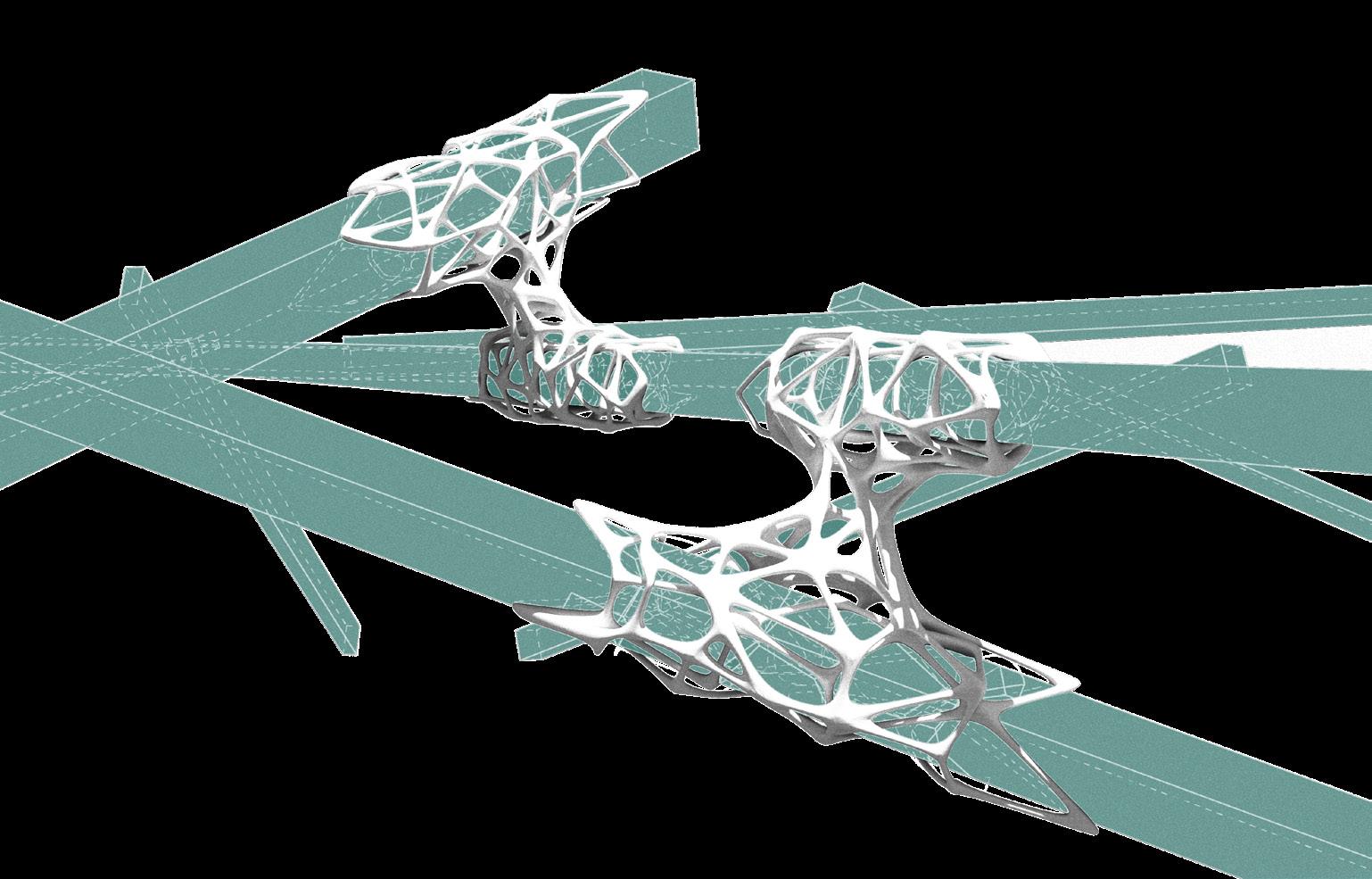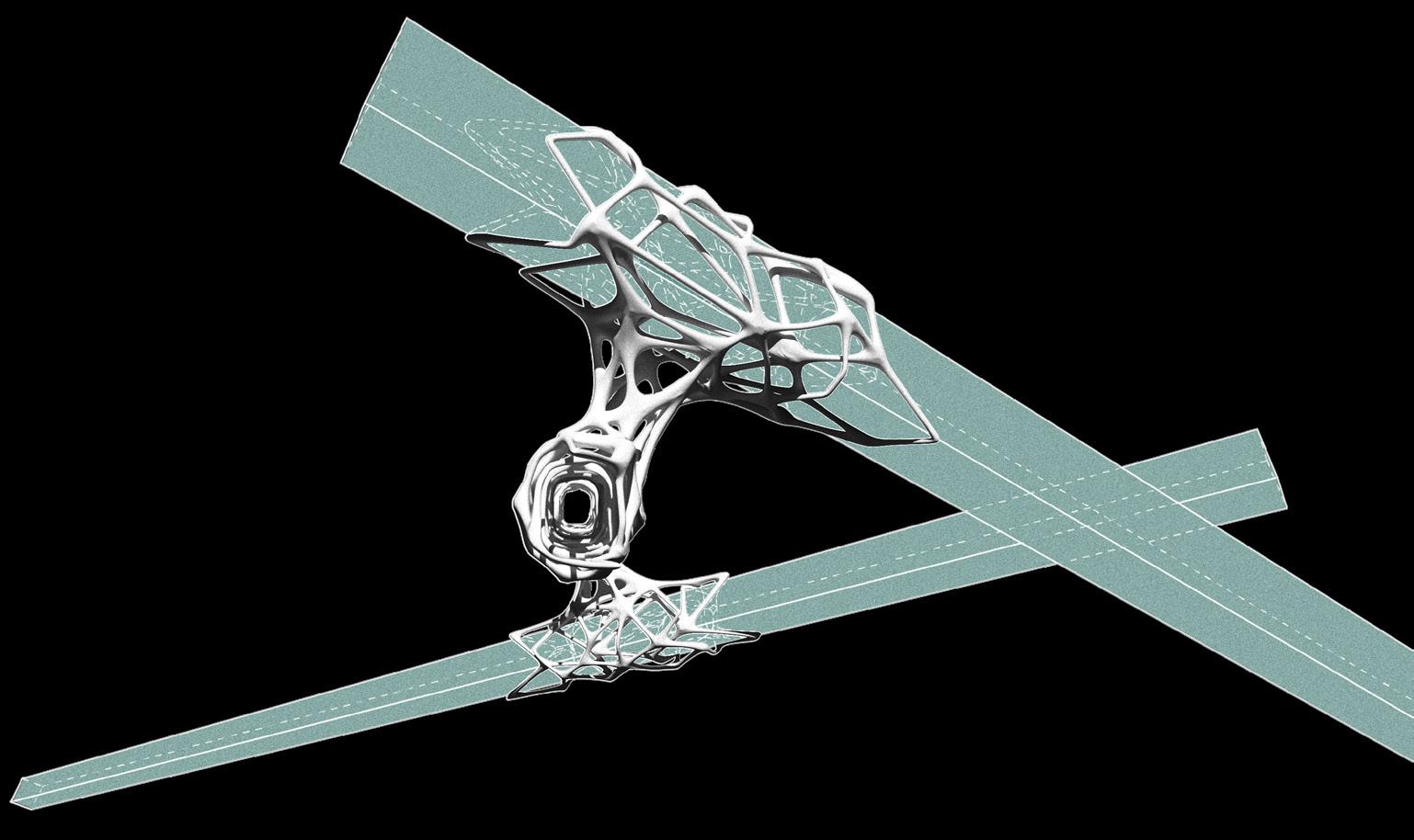Bachelors 2022 - 2025 ARCHITEKTUR PORTFOLIO
LUDWIG SCHOFER
LUDWIG SCHOFER
Gartenstraße 30 ludwig.schofer@gmail.com
Wuppertal,42107 +49 01573 3250648
NRW, Germany
ZITAT
Architektur gleicht einer Bibliothek, in der jedes Gebäude ein Buch und jede Sekunde ein neu aufgeschlagenes Kapitel ist, auf das jeder Leser anders antwortet.
2022 - 2025
BILDUNG
Bergische Universität Wuppertal
Architekture Bachelor of Science in Gange
ESL - Kaplan International Sprachschule Vancouver
Einmonatiger C1 Englisch Sprachkurs; mit Zertifikat
2006 - 2021
Gymnasium Am Kothen
Abschluss Abitur mit gutem Erfolg; Leitungsfächer Mathe, Kunst
BERUFSERFAHRUNG/ PRAKTIKA
2023 - 2026
Finanzbeauftragter der Fachschaft Architektur
Verwaltung und Dokumentation des Kontos der Studentenvertretung, Kommunikation mit der Finanzabteilung des AStA (Allgemeiner Studentenausschuss)
Trockenbau Praktikum Alan Toromanovic, zwei Monate
Unterstützung bei der Montage und Vermessung von Trockenbauwänden, dem Einbau von Decken sowie der Durchführung von Spachtel- und Malerarbeiten an Wand- und Deckenflächen.
Creme-Eis Wuppertal
Verkauf und Bedienung
WETTBEWERBE
2025
2024 - 2025
2020
The last nuclear bomb memorial edition #6
Fabrication
Rendering 2023 2021 2020
Design/ Modeling
Adobe CC
13. Schlaun-Wettbewerb 2024|2025 „Am Metallwerk – Konversion step by step“
Fortlaufend Teilnahme
Planspiel Deutscher Gründerpreis
2 Platz in der Stadt Wuppertal mit Projekt CLOBETA
KENNTNISSE
CNC, 3D Printing, Grasshopper, Hand drafting/modeling
V-Ray, D5
Rhinoceros, Archicad, MS office
Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom
SPRACHE
Deutsch
Muttersprache
Englisch
C1
Französisch
Grundkenntnisse; B1
KAPITELÜBERSICHT
Biophilia
Ein Quartier als Biotop; urbanes Leben inmitten der Natur
Kappengarten
Ein Quartier als grüne Lunge, nachhaltiges Wohnen in Köln
Arkadenhalle
Die Markthalle als sozialer Knotenpunkt im urbanen Gefüge
Dekonstruktion
Interbau 1957 in einer neuen Form
Ingrunnen Horizontale
CircularLink aus wiederverwendeten Bauelementen mithilfe von Machine Learning
R3: connect
Entwicklung einer adaptiven Knotenverbindung
BIOPHILIA
Ein Quartier als Biotop; urbanes Leben inmitten der Natur
Im Fokus des Projektes steht die Idee, ein Quartier zu gestalten, dass Lebensraum von Mensch, Flora und Fauna dient und dessen Koexistenz fördert. Ein signifikanter Teil des kontaminierten Geländes wird in naturnahe Ausgleichsflächen umgewandelt, aufgeforstet und als vielfältige Biotope entwickelt. Es werden gezielt Rückzugsorte und Lebensräume für heimische Tier- und Pflazneartengeschaffen. Unterstützung werden diese Tierarten durch Animal-Aided-Dersigns in der Architektur.
Das Quartier ist darauf ausgelegt, eine harmonische Verbindung zwischen menschlicher Nutzung und natürlichem Umfeld zu schaffen, ohne die Integrität der Umwelt zu beeinträchtigen.
Das Konzept sieht zudem die Einrichtung eines Ko-Rehabilitationszentrums, einer Tierschule sowie grün integrierter Sportflächen vor. Die daraus resultierende Konsequenz manifestiert sich in der Entstehung eines lebendigen Ökosystems, in dem eine gleichberechtigte Koexistenz von Mensch, Tier und Pflanze evident wird. Das Konzept der „Biophilia“ kann als Gestaltungsprinzip für eine biodiversitätsfördernde und klimaresiliente Stadtentwicklung dienen. Das Ziel dieser Entwicklung ist die Schaffung eines Lebensraums für alle.
Standort: Am Metallwerk, Senne, Bielefeld
13. Schlaun Wettbewerb | Oktober 2024 - Februar 2025 | 5 Semester Gruppenarbeit mit Ilayda Öztürk, Nika Magas und Evalotte Balsam
50% Darstellung, 30% Konzept
Tutor : Prof. Dr.-Ing. Tanja Siems siems@uni-wuppertal.de
Faunahabitate Bestand Faunabewegung
Faunahabitate Erweiterung
Der Fokus der Analyse lag auf den natürlichen Gegebenheiten der Flora und Fauna. Die bestehende Vegetation wurde hinsichtlich ihrer ökologischen Funktionen sowie ihres Potenzials zur Förderung der Biodiversität bewertet. Zudem erfolgte eine Untersuchung der Habitatansprüche und Bewegungsmuster der lokalen Tierarten. Hierbei wurden Wechselwirkungen zwischen den bestehenden Grünstrukturen und den Wanderkorridoren der Fauna ermittelt. Die Daten dienten der Planung, die die ökologische Durchlässigkeit des Quartiers verbessert und eine nachhaltige Integration naturnaher Räume ermöglicht.
Collage räumliche Beziehungen
Ökosystem Ideation
Bildungs & Erholungs Habitat
Wohn Habitat
Sport Habitat
Wildblumenwiesen Habitat
Buschlandschafts Habitat
Waldbach Habitat
Wald Habitat
Phasen des Flora-Wachstums
Heiden Habitat
Animal-Aided Design ist ein Planungsansatz, der darauf abzielt, Tiere als integralen Bestandteil urbaner Räume zu berücksichtigen. Dabei werden gezielt Strukturen geschaffen, die die Lebensbedingungen für bestimmte Tierarten verbessern und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität für den Menschen zu erhöhen. Ziel ist es, nicht nur bestehende ökologische Gegebenheiten zu schützen, sondern aktiv neue Lebensräume für Tiere in städtischen Gebieten zu schaffen.
Im Kontext des beschriebenen Wohnquartiers wird Animal-Aided Design durch gezielt begrünte Gebäudeblöcke und Freiräume umgesetzt, die sowohl Aufenthaltsmöglichkeiten ür Menschen als auch Nistplätze wie auch Lebens- und Schutzräume für verschiedene Tierarten bieten. Diese Maßnahmen fördern die Kohabitation von Mensch, Flora und Fauna, indem sie urbane Strukturen mit ökologischen Funktionen verbinden. Dadurch entsteht ein nachhaltiges Quartier, das sowohl ökologischen als auch städtebaulichen Anforderungen gerecht wird.
Erweiterungsmöglichkeit Phase 1
Erweiterungsmöglichkeit Phase 2
Erweiterungsmöglichkeit Phase 3
Boxel Module des Quartiers
Grundriss EG
Das neu geschaffene Habitat des Menschen dient nicht nur als Wohnquartier, sondern auch als Bindeglied zwischen Mensch und Natur. Statt sich gegenseitig zu verdrängen, ergänzen sich die Lebensräume und fördern die Ausbreitung der, ohne dabei mit dem menschlichen Lebensraum in Konkurrenz zu treten.
Durch die entstehenden Biotope gewinnt das Wohnumfeld an hoher Lebensqualität und wird zu einem Naherholungsraum mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in den Bereichen Sport und Kultur. Ein modernes Sportzentrum, ein Co-Rehabilitationszentrum sowie eine Naturschule bieten sowohl den Quartiersbewohnern als auch Menschen aus anderen Regionen wertvolle Bildungs- und Erholungsangebote.
Biophilia schafft eine harmonische Verbindung zwischen Natur und urbanem Leben, in der Mensch und Umwelt gleichermaßen profitieren.
Steg mit Aussichtsplatform
Steg Axonometrie
Vogelperspektive
Schnitt Sportzentrum & Reha
Schnitt Wohnquartier
Kappengarten
Ein Quartier als grüne Lunge, nachhaltiges Wohnen in Köln
Das Wohnungsbauprojekt an der Tel-Aviv-Straße in Köln reagiert auf die besondere städtebauliche Lage an stark befahrenen Hauptstraßen mit hohen Lärm- und Emissionseinträgen. Ziel ist es, ein Wohnquartier zu entwickeln, das trotz dieser Belastungen eine hohe Aufenthalts- und Lebensqualität bietet. Kleine, intensiv begrünte Innenhöfe fungieren als geschützte Rückzugsräume, die sowohl atmosphärisch aufwerten als auch funktional die Luftqualität verbessern und Emissionen abmildern. Die nachhaltige Nutzung von Dachflächen durch Photovoltaikanlagen und gemeinschaftlich nutzbare Gärten stärkt die ökologische Qualität und fördert soziale Vernetzung.
Laubengänge und gemeinschaftliche Bereiche schaffen Treffpunkte und unterstützen nachbarschaftliche Interaktion. Die Fassadengestaltung greift traditionelle Kölner Bauformen auf, insbesondere die Verwendung von Kappendecken, die als historische Referenz und statisches Element dienen. Durch die Verbindung von historischer Anlehnung, ökologischen Maßnahmen und sozialen Konzepten entsteht ein städtisches Wohnprojekt, das städtebaulich sensibel, nachhaltig und architektonisch anspruchsvoll ist.
Standort: Ankerstraße, Pantaleons-Viertel, Köln
Akademisch | Juli 2024 - September 2024 4 Semester Gruppenarbeit mit Nick Schaller
80% Darstellung, 70% Konzept
Tutor : Prof. Dipl.-Ing. Ulrich Königs, M.Sc Timo Hornemann hornemann@uni-wuppertal.de
Foto von der Bundesstraße
Render von Umgebungsmodel
Schnittperspektive
Render von dem Innenraum
Render von dem Laubengang
Außenwandaufbau
Zwischendeckenaufbau
Ansicht Dreitafel
Horizontal Schnitt Dreitafel
Render von dem Innenhof
Arkadenhalle
Die Markthalle als sozialer Knotenpunkt im urbanen Gefüge
Die Markthalle am Wilhelmplatz in Köln ist als sozialer Knotenpunkt und multifunktionaler Raum konzipiert, der alltägliche Nutzungen wie Märkte und Gastronomie ebenso aufnimmt wie städtische Ereignisse oder Feste. Damit wird sie zu einem identitätsstiftenden Ort, der die Nachbarschaft aktiviert und als Bühne für das urbane Leben fungiert.
Architektonisch orientiert sich das Projekt an der Typologie der Stoa und Basilika. Ein Mittelschiff, flankiert von zwei Seitenschiffen und gegliedert durch Säulenarkaden, schafft eine klare, offene Struktur, die Tradition zitiert und zugleich in eine zeitgemäße Form transformiert. Diese archetypische Raumordnung verbindet Orientierung mit Flexibilität und verleiht dem Gebäude Großzügigkeit.
Das optimierte Holztragwerk bildet dabei nicht nur eine nachhaltige, ressourcenschonende Konstruktion, sondern zugleich das ordnende und gestalterische Prinzip der Architektur. In seiner Offenheit und Lesbarkeit erzeugt es eine räumliche Klarheit, die den Charakter der Halle prägt und ihre Nutzungsvielfalt unterstützt
Standort: Wilhelmsplatz, Nippes, Köln
Akademisch | Oktober 2023 - Februar 2024 | 3 Semester Gruppenarbeit mit Nick Schaller
70% Darstellung, 50% Konzept, Scia 30%
Tutor : Prof. Dipl.-Ing. Ulrich Königs, M.Sc. Nitsche, Frauke nitsche@uni-wuppertal.de
Lageplan
Feste Marktfläche
Offene Fläche
Foto von dem Wilhelmsplatz
Entwicklung des Tragwerks
Zweigeschossig
Zweigeschossige Seitenschiffe
Attalos Stoa, Agora Athen, ca. 200 v. Chr. römische Basilika
Säulenarkaden
geöffnete Säulenreihe
erhöhtes Mittelschiff Seitenschiff
Die Markthalle basiert auf der Typologie von Stoa und Basilika, mit einem Mittelschiff und zwei Seitenschiffen, getrennt durch Säulenarkaden. Diese Dreischiffigkeit schafft klare Orientierung, Offenheit und Flexibilität für multifunktionale Nutzungen. Ein Seitenschiff weist bewusst einen Knick auf, der einen öffentlichen Platz herstellt und die Halle in den städtischen Außenraum integriert.
Die statische Analyse bildete die Grundlage für eine Optimierung der Holztragstruktur. Das Tragwerk wurde in einem konstruktiven Raster optimiert, die Querschnitte hinsichtlich Lastabtragung und Materialeinsparung angepasst. Durch diese Vorgehensweise entsteht eine ressourcenschonende Konstruktion, die die historische Typologie in eine zeitgemäße Form überträgt und zugleich die räumliche Offenheit und Verbindung zum urbanen Kontext betont.
Wandelhalle
Grundriss EG
Marktfläche 1 2 WC- Anlagen 3 Feste Marktstände 4 Cafe & Bäckerei
Grundriss Empore
Render der Markthalle
Kollage des Cafe-Außenbereich
Collage des Wochenmarkts
1. Fassadenaufbau
Streckmetall 50 mm Maschen, Thermische Hülle
Edelstahlrahmen 50/ 40 mm
Hinterlüftung 30mm
Edelstahlklammern
Pressleistenverglasung
2-fache Verglasung
Trägerlage 20/ 30
Träger 160/ 20; 80/ 20
2. Markthallenbodenaufbau
Gusasphaltestrich 40 mm Trennlage Graupappe 1 mm
Trittschaldämmung 50 mm Stahlbeton 240 mm
3. Emporenaufbau
Holzbeplankung 25 mm
Trittschalldämmung 25 mm Balkenlage 20/ 30 Schalung Holzbeplankung
4. Tiefgaragenbodenaufbau
Gusasphaltestrich 50mm Estrich 50mm Stahlbeton 500mm
Konstruktionsschnitt
1 BSH Voute Stütze außen 1100mm(400mm)/ 200mm
2 BSH Voute Stütze innen 80mm(400mm)/ 200mm
3 BSH Voute Seitenschiff 600mm(300mm)/ 200mm
4 BSH Voute Mittelschiff 1100mm(400mm)/ 200mm
5 Vollholzträger Sekundärtragwerk 200mm/ 400mm
6 Vollständiges Kreisprofil (Auskreuzung) 10mm
7 BSH Tertiärtragwerk (Empore quer) 200mm/ 1200mm
8 BSH Tertiärtragwerk (Empore längs) 200mm/ 500mm
3m Trägerraster
2,7m Trägerraster der Empore
Schnittgrößen Charakteristischer Träger (Träger 4)
Aussteifung Y Richtung: 2 Auskreuzungsrigel im Seitenschiff
Aussteifung X Richtung: Selbstaussteifen/zusätzliche Auskreuzungen
Plausibilitätsanalyse
δ zul(min)= 6,7cm/ δmax 3,87cm δmax < δzul - Gebrauchstauglich
Knickuntersuchung
Max. Druck
Außenstützen/Empore knickgefährdet Nmax = 273,63 kN
Knicknachweis Träger 4
Auslastung: 61%
Tragwerksanalyse
04
DEKONSTRUKTION
Interbau 1957 in einer neuen Form
Das Projekt Dekonstruktion widmet sich der Neuinterpretation der Architektursprache der Bartningallee 5 von Luciano Baldessari
In der vorliegenden Untersuchung wird die Architektursprache in Bezug auf ihre grundlegenden Konzepte und räumlichen Anordnungen neu interpretiert und in einem dreidimensionalen Würfelmodell dargestellt.
Das Gebäude wird einer dreigliedrigen Klassifikation unterzogen. Die vorliegenden Schleifen repräsentieren explizite architektonische Prinzipien, welche das Gebäude definieren. Angeordnet sind die Schleifen in einem 7 mal 7 3D-Würfelraster. Die vorliegende Schleifenstruktur weist drei Durchbrüche auf, die die Entstehung von drei Schächten bedingen.
Eine der Schleifen stellt die vereinfachte Form der Außenkontur des Gebäudes dar und verläuft in einem strikten vertikalen und horizontalen gekreuzten Kurs. Die zweite Schleife greift das Konzept des Grundrisses auf, ballt sich in dessen Mitte und tritt in den Ecken nach außen hervor. Die dritte Schleife widmet sich der Analyse der Strukturen und Wiederholungen in der Anordnung der Fenster und Lodgien. Die vorliegende Struktur definiert den Großteil der Randstruktur des Würfels.
Standort: Bartningallee 5, Hansaviertel, Berlin
Akademisch | Mai 2023 - September 2023 | 2 Semester
Individuelle Arbeit
Tutor Prof. Holger Hoffmann, M.Sc. Heiner Verhaeg verhaeg@uni-wuppertal.de
Schnitt AA
Grundriss OG
Rekonstruktion der Bartningallee 5
Dekonstruktion Formstudie
Schleifen Fragmente
Schleifen Pfad
Verbindung der Kanäle
7 x7 Raster
Spiegelung des Grudnriss
Finale Dekonstruktion der Bartningallee 5
INGRUNNEN HORIZONTALE
CircularLink aus wiederverwendeten Bauelementen mithilfe von Machine Learning
Der Entwurf dieser Fußgängerbrücke entstand durch die experimentelle Anwendung von Machine Learning in Verbindung mit einer ressourcenschonenden Bauweise. Das Ziel war vorhandene stabförmige Bauteile wiederzuverwenden und in einem strukturell effizienten Brückensystem einzusetzen. Diese Elemente bildeten die Grundlage eines parametrisch modellierten Fachwerks, das mithilfe eines Grasshopper-Skripts entworfen und optimiert wurde.
Die Besonderheit des Projektes lag darin, dass vorhandene Stäbe gezielt in die Struktur- und Formfindung integriert wurden. Die Materialverteilung erfolgte mittels Machine-Learning-Algorithmen in Galapagos. Dabei wurde die Ressourceneffizienz zum leitenden Kriterium. Das System suchte iterativ nach Lösungen mit minimalem Materialeinsatz, maximaler Tragfähigkeit und gleichzeitig minimaler Verformung.
Durch die Kombination aus statischer Analyse (Phoenix 3D, Karamba3D) und intelligent gesteuerter Materialzuweisung gelang es, eine nachhaltige, funktionale Struktur zu entwickeln, in die jedes wiederverwendete Bauteil konstruktiv sinnvoll eingebunden wurde. So wurde nicht nur die Tragstruktur datenbasiert optimiert, sondern auch ein zukunftsweisender Umgang mit vorhandenen Ressourcen im Bauwesen demonstriert.
Standort: Norbahntrasse- Heubruch, Barmen, Wuppertal Akademisch | Dezember 2024 - März 2025 | 5 Semester Gruppenarbeit mit Nick Schaller
60% Darstellung, 50% Konzept, Script 20%
Tutor : Dr.-Ing. Alec Singh asingh@uni-wuppertal.de
Untergurt + Fachwerk Varianten
Leitkurven Konzeption
Die Grundstruktur der Brücke basiert auf zwei Fixpunkten mit einem Abstand von 14 Metern, die durch eine Linie verbunden wurden. Das Tragwerkskonzept folgt einem dreiecksförmigen Fachwerksystem, das mithilfe von Grasshopper generiert wurde
Die Hauptstruktur besteht aus zwei Randkurven als Basis, sowie einem Mittel- und einem Untergurt. Diese Elemente bilden das Rückgrat der Brücke und werden durch mehrere zusätzlichen Fachwerke verbunden. Die Konstruktion ist so konzipiert, dass sie sich in Abhängigkeit von den Optimierungsparametern an den Randkurven ausrichtet, um ein möglichst effizientes Tragverhalten zu erzielen.
Hauptachse
Leitkurven - zwei Knotenpunkte
Stabstruktur
Tragwerk
Variantenstudie
2 Kontrollpunkte
1 Kontrollpunkte
Grasshopper Script
Horizontal Schnitt
Draufsicht
Querschnitt Anzahl der Stäbe
R 50x50 Anzahl von R 50x50
R 50x50 Anzahl von R 50x50
R 100x100 67
R 100x100 67
R 120x120 14
R 120x120 14
R 150x150 32
R 150x150 32
R 200x200 11
R 200x200 11
R 240x120 11
R 240x120 11
R 250x250 1
R 250x250 1
R 300x160 1
R 320x100 9 R 50x50 82 R 80x80 14
R 300x160 1 R 320x100 9 R 50x50 82 R 80x80 14
Querschnitte
Auslastung der Träger
Verfügbarer Materialpool Genutzter Materialpool Materialpool
Die statische Berechnung der Brücke erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde die Lastanalyse mithilfe von Phoenix 3D durchgeführt, um die Belastungen auf die Struktur präzise zu ermitteln. Diese Berechnungen wurden genutzt, um eine gezielte Materialzuweisung vorzunehmen. Der vorgegebene Materialbestand wurde in den Code integriert und durch zusätzliche, nicht wiederverwendbare Stäbe mit Querschnitten von 50×50 mm bis 400×400 mm ergänzt.
Um eine möglichst materialeffiziente Konstruktion zu gewährleisten, wurden die Stäbe mit Phoenix 3D so zugeordnet, dass die Brücke eine minimale Masse bei maximaler Tragfähigkeit aufweist. Hierbei spielte die Optimierung der Materialverteilung eine entscheidende Rolle, um eine wirtschaftliche und ressourcenschonende Bauweise zu ermöglichen
Knotendetail Render aus der Perspektive der Nordbahntrasse
R3:connect 06
Entwicklung einer adaptiven Knotenverbindung
R3:connect ist ein experimentelles Leichtbauprojekt, das sich durch die Verbindung von digitaler Parametrik und nachhaltiger Materialnutzung auszeichnet. Im Fokus der Entwicklung steht die Adaption einer 3D-gedruckten Knotenverbindung, welche durch die Kombination wiederverwendeter Holzstäbe eine räumliche Gitterschale generiert.
Die Formfindung orientiert sich an biomimetischen Strukturen und wurde mithilfe algorithmischer Entwurfsmethoden in Grasshopper optimiert. Die Kombination von präziser digitaler Planung und handwerklicher Umsetzung resultierte in der Entwicklung eines konstruktiven Systems, das sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugt. Es handelt sich um einen Knotenpunkt zwischen Naturprinzipien und innovativer Bautechnologie.
Standort: Uni Wuppertal, Haspel Akademisch Juli 2025 - August 2025 | 6 Semester Gruppenarbeit mit Ilayda Öztürk
100% Darstellung, 50% Konzept, Script 50% Tutor : Dr.-Ing. Alec Singh asingh@uni-wuppertal.de
Forminspiration waren integrierter Knotenverbindungen wie Klemmverbinder, modulare Rohrsysteme um ein stabiles, leichtes und formflexibles Tragwerk zu entwickeln
Die Gestaltung folgt biomimetischen Prinzipien und ersetzt starre Geometrien durch organische, netzwerkartige Strukturen nach Vorbildern wie Knochengewebe oder Astverzweigungen. Ziel ist eine hohe Stabilität durch effiziente Materialverteilung und fließende Übergänge, die technische Leistungsfähigkeit mit einer organischen, ästhetischen Formensprache verbindet.
Formfindung und Optimierung
Ansichten in [mm]
Perspektive der Knoten 1
Perspektive der Knoten 2