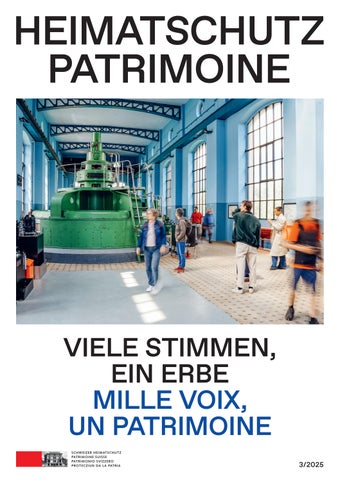VIELE STIMMEN, EIN ERBE MILLE VOIX, UN PATRIMOINE

FOKUS FOCUS

20 GESPRÄCH MIT YUMA SHINOHARA ENTRETIEN AVEC YUMA SHINOHARA
4 Spuren der Saisonniers
Neue Fragen, viele Perspektiven
Ein Blick auf das Denkmalschutzjahr 1975 16 Ihre Lieblingsbauten
18 Weg der Vielfalt 20 «Wir möchten auch weniger sichtbare Themen ansprechen»
Verbandsnachrichten 24 Extrafahrt nach Mühleberg 29 Poschiavo kennenlernen 30 Grosse Feier in Basel 32 Angriffe auf das ISOS
Eine Pionierin des Ortsbildschutzes 35 Ferien in der Villa Elfenau
Begegnungen
38 Ein Spiel mit den Wellen
Heimat ist immer jetzt
Unterwegs in Geuensee 46 Wir empfehlen 48 Schlusspunkt
VERBANDSNACHRICHTEN VIE ASSOCIATIVE

24 EXTRAFAHRT NACH MÜHLEBERG
COURSE SPÉCIALE POUR MÜHLEBERG
BEGEGNUNGEN RENDEZ-VOUS

38 EIN SPIEL MIT DEN WELLEN JEUX D’ONDES
2 En
4 Sur les traces des saisonniers
Nouvelles questions, multiples perspectives 15 Retour sur l’Année du patrimoine architectural 1975
16 Vos lieux de patrimoine préférés
18 Le parcours de la diversité
20 «Nous voulons aussi traiter de sujets moins visibles»
Vie associative
24 Course spéciale pour Mühleberg
29 À la découverte de Poschiavo
30 Une grande fête à Bâle
32 Attaques contre l’ISOS
34 Une pionnière de la protection des sites construits
35 Vacances à la Villa Elfenau
Rendez-vous
38 Jeux d’ondes
42 Le patrimoine est ancré dans le présent
44 Chemin faisant à Geuensee
46 Coups de cœur
48 Point final
Ralph Brühwiler
Natalie Schärer
DAS KULTURERBE GEHÖRT UNS ALLEN LE PATRIMOINE EST UN BIEN COMMUN
1975 rief das Europäische Denkmalschutzjahr dazu auf, unser baukulturelles Erbe zu erkennen und zu schützen. 50 Jahre später stellen sich neue, grundlegende Fragen: Was gilt als Baudenkmal? Wer entscheidet darüber? Und für wen bewahren wir überhaupt? Es zeigt sich: Die Antworten auf diese Fragen sind vielfältig. Nicht überall, wo bauliche Zeugen erhalten werden, fühlen sich alle mitgemeint. Und manches Denkmal schmerzt – gerade weil es zu unserer Geschichte gehört. Heute gilt es, den Impuls des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975 weiterzutragen: mit neuen Stimmen, neuen Perspektiven und einer Erinnerungskultur, die auch Raum für das bislang Unerzählte lässt.
Diese Ausgabe führt zum Bührer-Areal in Biel, zu einem Ort, der selbst vielen Einheimischen lange verborgen blieb, weil die Geschichte und die Lebensrealität der dort einst lebenden Saisonniers gezielt ausgelöscht wurden. In St. Gallen machen bislang übersehene Erinnerungsorte sichtbar, wie vielschichtig unser kollektives Gedächtnis ist. Und auf der Schweizer Karte auf Seite 16 versammeln sich Objekte, die Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, besonders am Herzen liegen – klassische Baudenkmäler ebenso wie überraschende Entdeckungen.
Unser Kulturerbe muss ausgehandelt werden, denn es gehört uns allen: Alten und Jungen, Hiergeborenen und Zugezogenen, Minderheiten und der grossen Mehrheit. Je mehr sich für unsere gemeinsame Vergangenheit einsetzen, desto lebendiger und inklusiver wird unsere Zukunft.
En 1975, l’Année européenne du patrimoine architectural appelait à reconnaître et à préserver notre patrimoine bâti. 50 ans plus tard, de nouvelles questions fondamentales se posent: qu’est-ce qu’un monument? Qui en décide? Et pour qui, dans le fond, préservons-nous? Les réponses à ces questions sont multiples. Tout le monde ne se sent pas forcément concerné par la conservation d’un bâtiment en particulier. Ce n’est pas parce que des témoins du bâti sont conservés que tout le monde s’y reconnaît. Aujourd’hui, il convient de poursuivre l’élan donné par l’Année du patrimoine architectural 1975, avec de nouvelles voix, de nouvelles perspectives et une culture de la mémoire qui fasse également place à ce qui, jusqu’ici, n’a pas été raconté.
Cette édition nous conduit sur le site Bührer, à Bienne – un lieu longtemps resté dans l’ombre, y compris pour de nombreux habitants de la région, parce que l’histoire et les conditions de vie des saisonniers qui y ont vécu ont été délibérément effacées. À Saint-Gall, des lieux de mémoire jusqu’à présent ignorés révèlent la complexité de notre conscience collective. Et la carte de Suisse, en page 16, rassemble des objets qui, chères lectrices et chers lecteurs, vous sont particulièrement chers – des monuments classiques aussi bien que des découvertes surprenantes.
Notre héritage culturel doit être débattu, car il nous appartient à toutes et à tous: jeunes et aînés, autochtones et immigrés, minorités et majorité. Plus nous nous engageons en faveur de notre passé commun, plus notre avenir sera vivant et inclusif.
Natalie Schärer und Peter Egli, Redaktion

FÖRDERPROGRAMM
LEBENSWERTE UND NACHHALTIGE ORTE
Planen Sie die Neugestaltung eines Ortes, um die ökologische, wirtschaftliche oder soziale Nachhaltigkeit zu stärken? Haben Sie Ideen, wie die Nachhaltigkeit bei der Gestaltung und langfristigen Nutzung unseres Lebensraums gefördert werden kann?
Die Ausschreibung des Förderprogramms «Nachhaltige Entwicklung 2025/2026» ist lanciert, in diesem Jahr als Kooperation zwischen dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und dem Bundesamt für Kultur (BAK). Thema: «Lebenswerte und nachhaltige Orte». Gemeinden, Städte, Kantone sowie private Institutionen sind eingeladen, bis am 30. September 2025 Vorschläge für innovative und reproduzierbare Projekte einzureichen.
are.admin.ch/foerderprogramm
«HISTOIRES D’ARCHITECTURES»
À l’occasion du cinquantenaire de l’Année du patrimoine 1975, les Journées européennes du patrimoine 2025 vous invitent à un exceptionnel voyage dans le temps. Les 13 et 14 septembre, plus de 400 lieux culturels ouvrent leurs portes sous le titre «Histoires d’architectures».
decouvrir-le-patrimoine.ch

AUSSTELLUNG
WASSERKRAFT UND WIDERSTAND

Die Nutzung der Wasserkraft in den Alpen ist eine Erfolgsgeschichte der Ingenieurskunst und der erneuerbaren Energie. Die Errichtung von Staudämmen und Wasserkraftwerken ist aber auch eine Geschichte von Vertreibung, Enteignung und Widerstand. In einer Videoinstallation im Landesmuseum Zürich erzählen zehn Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von persönlichen Erfahrungen. Im Rahmen des Ausstellungsformats «Erfahrungen Schweiz» zeigt die Videoinstallation zusammen mit einer interaktiven Vertiefungsstation, dass Wasserkraft nicht nur ein technisches oder ökologisches Thema ist, sondern auch ein soziales und kulturelles. Sie betrifft Menschen, Dörfer, Landschaften – gestern und heute. Bild: Protest gegen die Ilanzer Kraftwerke am 17. Juni 1979.
Landesmuseum Zürich 4.7.2025–2.11.2025 landesmuseum.ch/wasserkraft-widerstand
Schweizerische
Greina-Stiftung

PROJET INTERNET
CORRESPONDANCES
L’association Correspondances a pour centre d’intérêt l’architecture du XXe siècle et sa représentation par la carte postale. Le recul historique confère à la production de masse qu’est la carte postale, une dimension documentaire de premier ordre. Celle-ci, ainsi que la qualité photographique des prises de vues et l’intérêt architectural des bâtiments représentés constituent les critères de sélection de la collection, qui compte à ce jour 30 000 cartes postales. Afin de la rendre accessible au plus grand nombre, elle est en voie de numérisation et d’indexation dans une base de données. Le but de l’association est de toucher un public très large, de l’amateur à l’expert qu’il soit historien, architecte, photographe ou chercheur. Elle reprend également des collections de cartes postales afin d’éviter qu’elles ne disparaissent.
correspondances.ch
TAGUNG
BAUKULTUR UND RENDITE
Wie lassen sich Rendite, Nachhaltigkeit und Baukultur in Einklang bringen? Die Tagung «Baukultur und Rendite» bietet eine Plattform für Diskussionen rund um den Erfolgsfaktor «Baukultur» und fragt, welche Rolle diese Faktoren bei der Bewertung, der Wertsteigerung und der Rentabilität sowie der Anlagestrategie von Immobilienanlagegefässen spielen. Und: Wie lassen sich Quartiere resilient entwickeln bzw. sanieren, und wie trägt das zukünftige Bauen (und die zukünftige Stadtplanung) dem Erhalt einer hohen Baukultur Rechnung?
Die Tagung der Stiftung Baukultur Schweiz, in deren Stiftungsrat auch der Schweizer Heimatschutz vertreten ist, will den Austausch fördern und Handlungsempfehlungen an Entscheidungstragende in Politik und Wirtschaft geben.
12. November 2025, Universität St. Gallen stiftung-baukultur-schweiz.ch/baukultur-und-rendite-2025
MEINUNG
DAS NEUE BLATTEN?
VOM SCHWIERIGEN UMGANG MIT STARARCHITEKTEN UND ORTSFREMDEN EXPERTEN
Der Bergsturz von Blatten hat Hab und Gut einer kleinen, stolzen Lebensgemeinschaft zuhinterst im Lötschental zerstört. Schmerzhaft ist der Verlust von Haus und allen liebgewonnenen Gegenständen, noch schmerzhafter der Verlust von Nachbarschaften, Zusammengehörigkeit und Identität.
Wenige Tage nach dem Ereignis haben Fachkreise bereits öffentlich über Sinn und Unsinn eines neuen Blatten diskutiert. Mit Staunen hat man im Tal zur Kenntnis genommen, wie Wissenschaftler aus weiter Ferne Prognosen über die Zukunft des Tals verkündeten, wie Skeptiker bereits die Machbarkeit des neuen Blatten infrage stellten und wie Stararchitekten medienwirksam ihre Hilfe unentgeltlich anboten. Just jene Architekten, die vor Jahren die «alpine Brache» postulierten und Täler wie das Lötschental entvölkern wollten. Bei nationalen Tragödien ist es Brauch, dass die Fahnen auf halbmast gesetzt werden und der Betroffenen gedacht wird. Die Solidarität im Tal, in der ganzen Schweiz und darüber hinaus ist gewaltig und tröstet die Blattenerinnen und Blattner. Unverständlich und pietätlos ist es aber, wenn Fachleute in der Phase der Schockstarre genau wissen wollen, ob und wie es ein zukünftiges Blatten geben wird.
Müsste sich die Fachwelt angesichts dieser Tragödie nicht etwas demütiger verhalten und zugeben, dass auch sie keine Patentrezepte im Umgang mit den vielen offenen Fragen hat? Was das Tal jetzt braucht, sind keine Heilsverkünder, sondern Fachleute, die mit Empathie mithelfen, einen Prozess über den zukünftigen Lebensraum Lötschental unter Einbezug und Mitwirkung der Bevölkerung in Gang zu bringen. Der Druck von Bevölkerung und Politik auf einen raschen Wiederaufbau ist gross. Entsprechend werden technische Mittel und Geld im grossen Umfang zur Verfügung stehen. Gleichzeitig gilt es die Chance zu nutzen, das Grosse und das Kleine zusammen zu denken. Das ganze Lötschental steht vor der Herausforderung, sich touristisch und gesellschaftlich neu zu positionieren. Ebenso ist das qualitätsvolle Umnutzen und Weiterbauen der bestehenden Siedlungen ein wichtiges Anliegen. All dies in kurzer Zeit unter einen Hut zu bringen, braucht neu gedachte Prozesse und den Willen, diese partizipativ zu gestalten.
Wer die geballte Energie an der Gemeindeversammlung Mitte Juni über einen Zukunftsraum Blatten miterlebt hat, ist sich bewusst geworden, dass mit der Frage des Weiterlebens von Blatten nicht nur das Schicksal eines Bergtals verhandelt worden ist, sondern auch zukünftige Herausforderungen für eine föderalistische, offene und solidarische Schweiz.
Urs Heimberg, Stiftung Blatten
Präsident des Stiftungsrats, Prof. für Raumplanung und Städtebau BFH

SPUREN DER SAISONNIERS SUR LES TRACES DES SAISONNIERS
Florian Eitel, Historiker und Kurator
Die Saisonniers bauten die Schweiz mit –und sollten vergessen werden. Auf dem Bührer-Areal in Biel steht eine der letzten original erhaltenen Saisonnierbaracken. In dieser schlichten Unterkunft kommt ans Licht, was jahrzehntelang vertuscht, verwischt und versteckt worden ist.
Les saisonniers ont contribué à bâtir la Suisse, mais devaient être oubliés. Sur le site Bührer à Bienne se dresse l’une des dernières baraques de saisonniers encore conservées dans leur état d’origine. Dans ce logement rudimentaire, ce qui, pendant des décennies, a été dissimulé, effacé et tenu caché refait surface.
Hinter dem Maschendrahtzaun befindet sich eine der letzten erhaltenen Saisonnierunterkünfte der Schweiz.
Die Baracken auf dem Bührer-Areal zeugen von den prekären Lebensbedingungen der Gastarbeiter.
Derrière la clôture en treillis métallique se trouve l’un des derniers logements de saisonniers existant en Suisse.
Les baraques du site Bührer témoignent des conditions de vie précaires des travailleurs immigrés.
Die Geschichte der Saisonniers ist eine Geschichte der Marginalisierung, des Verdrängens und des Vergessens. Die Schweizer Wirtschaft rief sie als günstige Arbeitskräfte, die Mehrheitsgesellschaft fürchtete sich jedoch vor der «Überfremdung». Der helvetische Ausweg aus diesen beiden eigentlich nicht zu versöhnenden Ansprüchen war das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) von 1931 mit dem Saisonnierstatut. Rotationsprinzip hiess die Patentlösung: Junge Menschen sollten je nach Bedarf für maximal neun Monate in die Schweiz kommen, Arbeit verrichten und wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Die Saisonniers gehörten nicht zur Schweizer Gesellschaft, entsprechend sollten sie wenig sichtbar sein. Spuren hinterliessen sie dennoch, auch wenn diese oft verwischt oder verborgen blieben. Das Bührer-Areal in Biel steht in dieser Hinsicht exemplarisch für die Schweizer Migrations- und Verdrängungsgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Verschwiegen und vergessen
Das Neue Museum Biel (NMB) machte sich im Rahmen der Ausstellung «Wir, die Saisonniers ... 1931–2022» auf die Spurensuche. Früh musste festgestellt werden, dass die Fremdenpolizei des Kantons Bern sämtliche Personendossiers der sich in Biel aufhaltenden Saisonniers vernichtet hatte. Die Behörde setzte damit konsequent den Geist des ANAG um: Die Saisonniers und noch weniger deren illegal sich in der Schweiz aufhaltende Partner und Kinder, die sogenannten «Schrankkinder», sollten nicht Teil der Gesellschaft sein, deren schriftliche Spuren nicht im Archiv landen, ihr Leben nicht Teil der kollektiven Erinnerung werden.
Auch Dutzende von den Saisonniers errichteten Wohn- und Infrastrukturbauten in Biel und Umgebung erinnern nicht an ihre Erbauer. Nirgends ist eine Gedenktafel angebracht für diejenigen, die die Zementsäcke buckelten, Mauern hochzogen und zum Teil sogar ihr Leben auf den Baustellen verloren. Emblematisch dafür steht der Bau des Bieler Kongresshauses, einer Ikone der Betonarchitektur der Schweizer Nachkriegszeit. An den Eröffnungsfeierlichkeiten 1966 nahmen «zahlreiche Ehrengäste, darunter Vertreter der bernischen Regierung und der Gemeindebehörden» teil. Der Bieler Gemeindepräsident Fritz Stähli bedankte sich beim Architekten Max Schlup und bei den Unternehmern, die den Bau geschaffen hatten. Geradezu zynisch für die Abwesenheit der Saisonniers anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten ist die musikalische Begleitung des feierlichen Augenblicks: Der einzige «italienische» Beitrag am Festakt beschränkte sich auf ein in Latein vorgetragenes Werk eines italienischen Komponisten – das Orchestre de la Suisse Romande führte das Gloria von Vivaldi auf, «mit bedeutenden Schweizer Solisten», wie es in der Depeschenmeldung hiess. Die Hunderte von Saisonniers, die den Turm hochgezogen und das Schrägdach betoniert hatten, waren an diesem feierlichen Tag wortwörtlich keiner Rede wert.
Prekäre Wohnverhältnisse
Baracken dienten als Unterkunft für die euphemistisch genannten «Gastarbeiter», insbesondere in der Baubranche. Bezüglich Isolation, Platzverhältnissen, sanitärer Einrichtungen und allgemein hygienischer Zustände lagen diese schlichten Konstruktionen weit unter dem damaligen Schweizer Standard. In der Regel standen die Baracken auf dem Areal der jeweiligen Baufirma, teils jedoch auch in Hinterhöfen, am Rand der Stadt. Schweizer hatten – mit Ausnahme der einheimischen Angestellten der Firma – keinen Zutritt. Das
L’histoire des saisonniers est une histoire de marginalisation, de refoulement et d’oubli. L’économie suisse les appelait comme main-d’œuvre bon marché, mais la majorité de la population craignait une «surpopulation étrangère». Le biais trouvé par la Suisse face à ces attentes inconciliables s’est matérialisé avec la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) de 1931 qui introduisait le statut de saisonnier. La solution s’appelait «principe de rotation»: de jeunes personnes devaient venir en Suisse selon les besoins, pour un maximum de neuf mois, travailler, puis retourner dans leur pays d’origine. Les saisonniers ne faisaient pas partie de la société suisse; ils devaient donc rester aussi peu visibles que possible. Ils ont pourtant laissé des traces, même si celles-ci ont souvent été effacées ou cachées. Dans cette perspective, le site Bührer à Bienne est exemplaire de l’histoire de la migration et du refoulement en Suisse durant la seconde moitié du XXe siècle.
Dissimuler et oublier
Dans le cadre de l’exposition «Nous, saisonniers, saisonnières… 1931–2022», le Nouveau Musée Bienne (NMB) s’est lancé à la recherche des vestiges de leur passage. Il a fallu constater très tôt que la police des étrangers du canton de Berne avait détruit tous les dossiers personnels des saisonniers qui avaient séjourné à Bienne. Les autorités étaient ainsi fidèles à l’esprit de la LSEE: les saisonniers, et a fortiori leurs partenaires et enfants – «les enfants du placard» –séjournant illégalement en Suisse, ne devaient pas faire partie de la société: la trace écrite de leur passage ne devait pas atterrir dans les archives, leur vie ne devait pas faire partie de la mémoire collective.
Même les dizaines de bâtiments et d’infrastructures bâtis par les saisonniers à Bienne et dans la région ne portent ainsi aucune trace de leurs bâtisseurs. Aucune plaque commémorative n’a été posée pour ceux qui ont porté les sacs de ciment, qui ont élevé les murs et qui, dans certains cas, ont même perdu la vie sur les chantiers. À cet égard, le Palais des Congrès de Bienne, une icône de l’architecture en béton de la Suisse de l’après-guerre, est emblématique. Lors de la cérémonie d’inauguration en 1966, «de nombreux invités d’honneur, parmi lesquels des représentants du gouvernement bernois et des autorités communales» étaient présents. Le maire de la ville, Fritz Staehli, remercia l’architecte Max Schlup et les entrepreneurs qui avaient créé le bâtiment. L’accompagnement musical de ce moment solennel fut particulièrement cynique compte tenu de l’absence des saisonniers lors de ces festivités: la seule contribution «italienne» se limita à une œuvre en latin, le Gloria de Vivaldi, interprété par l’Orchestre de la Suisse romande «avec de grands solistes suisses», comme l’écrivait l’Agence télégraphique suisse. Ce jour-là, aucune parole ne fut prononcée pour les centaines de travailleurs étrangers qui avaient érigé cette tour et bétonné son toit suspendu.
Des logements précaires
Des baraques servaient de logements pour ceux que l’on appelait «travailleurs immigrés», en particulier dans le bâtiment. Dans ces constructions sommaires, l’isolation, l’espace, les installations sanitaires et les conditions générales d’hygiène étaient largement en dessous des standards helvétiques de l’époque. En général, ces édifices se situaient sur le site des entreprises de construction, mais parfois aussi dans des arrièrecours, en périphérie des villes. Les Suisses, à l’exception des employés locaux de l’entreprise, n’y avaient pas accès. Mais


Zwei gegensätzliche Lebenswelten: das stattliche Cheminée des Bauunternehmers Bührer und daneben der kleine Kachelofen in der Saisonnierbaracke, der die Kammer kaum zu wärmen vermochte. Deux mondes opposés: la vaste cheminée du patron de l’entreprise de construction Bührer, et à côté, le petit poêle en faïence de la baraque de saisonniers, qui peinait à chauffer la chambre.
Nichtwissen über die erbärmlichen Unterkünfte für diejenigen Leute, die wesentlich zum Wirtschafts- und Bauboom der Schweiz der Nachkriegszeit beitrugen, beruht aber auch auf fehlendem Interesse seitens der Schweizer Bevölkerung.
Eine dieser Saisonnierbaracken stand mitten in der Gleisanlage des Rangierbahnhofs Biel. Für deren Bewohner bedeutete der Aufenthalt in dieser Unterkunft neben Isolation und Entbehrung auch Lebensgefahr: Es gab keinen gesicherten Bahnübergang, die Toilette war draussen, und in der Frühe fuhren Waggons entlang der Baracken. Diese Baracke zwischen den Gleisen wurde mittlerweile abgerissen, wie die meisten anderen auch. Die Mehrzahl dieser baulichen Zeugen der Saisonnierzeit und damit auch der Migrationsgeschichte der Schweiz verschwand nach der Abschaffung des Statuts im Jahre 2002 und machte Platz für Neubauten.
Besetzung und Wiederentdeckung des Bührer-Areals Eine weitere Etappe auf der Spurensuche nach Zeugnissen aus der Saisonnierzeit in Biel erfolgte im Rahmenprogramm der Ausstellung anlässlich eines partizipativen Stadtrundgangs. Das NMB lud in Zusammenarbeit mit dem Verein «Geschichte im Puls» Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein, die Stadt aus ihrem Blickwinkel neu zu betrachten. An verschiedenen Posten in der Stadt erzählten sie von ihren persönlichen Erinnerungen, so zum Beispiel auch der Gewerkschafter Mariano Franzin: Vor dem Gitter des verschlossenen Zugangstors sprach er von seinem Engagement für die Saisonniers auf dem Bührer-
l’ignorance des conditions d’hébergement misérables de ces travailleurs, qui ont largement contribué à la prospérité économique et au boom de la construction dans la Suisse de l’aprèsguerre, est dû aussi au manque d’intérêt de la population. Une de ces baraques de saisonniers se situait au milieu des voies de la gare de triage de Bienne. Pour ses occupants, y vivre signifiait, en plus de l’isolement et du renoncement, une mise en danger de leur vie: il n’existait pas de passage à niveau sécurisé, les toilettes étaient situées à l’extérieur et, dès l’aube, des wagons longeaient le bâtiment. Cette construction entre les voies ferrées a été rasée dans l’intervalle, comme la plupart des autres. La majorité de ces témoins de l’époque des saisonniers et, avec eux, de l’histoire des migrants en Suisse, ont disparu après l’abolition du statut en 2002 et ont été remplacées par de nouvelles constructions.
Investissement et redécouverte du site Bührer Une autre étape dans la recherche des traces des saisonniers à Bienne est intervenue à l’occasion d’un tour de ville participatif organisé dans le cadre de l’exposition. En collaboration avec la société «Geschichte im Puls» (le pouls de l’histoire), le NMB invita des témoins de cette époque à partager leur regard sur la cité. À différents points du parcours, ils partagèrent leurs souvenirs personnels – comme le syndicaliste Mariano Franzin, qui évoqua son engagement en faveur des saisonniers devant les grilles fermées à l’entrée du site Bührer. Au début des années 1990, il s’adressa aux autorités biennoises pour dénoncer
Areal. Anfang der 1990er-Jahre wandte er sich an die Bieler Behörden, um die baulichen Zustände der dortigen Saisonnierunterkünfte zu bemängeln. Zusammen mit der Gewerkschaft Bau und Industrie (GBH) übte er auch medialen Druck aus.
In der Folge überstürzten sich die Ereignisse. Eine Gruppe aus dem Hausbesetzerumfeld kletterte vier Tage nach dem partizipativen Rundgang über den Zaun und besetzte die Gebäude mit der Forderung nach einer Zwischennutzung. Ein über Jahrzehnte im Verborgenen gebliebener und schliesslich in Vergessenheit geratener Ort rückte binnen weniger Tage in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit.
Die Besetzung bot die einmalige Gelegenheit, ins Innere des Areals und der Gebäude zu gehen. Mit Erstaunen konnte man feststellen, dass die Räumlichkeiten einen authentischen Blick in die Vergangenheit gewähren. Das Mobiliar war zwar grossenteils nicht mehr vor Ort, hingegen standen dort noch die sanitären Anlagen (WC, Wasserstelle), die mobilen Gasherde in der Küche sowie die Holzheizungen. Auch einzelne schriftliche Zeugnisse aus der letzten Phase der Nutzung während der 1990er-Jahre fanden sich noch, darunter spanische Kalender von 1992, einzelne damalige Zeitungen, Zahlungsbelege und ein handgeschriebenes Blatt, das auf Spanisch zum Lichterlöschen beim Verlassen der Unterkunft mahnte. Graffitis an den Wänden zeugen von den einstigen Bewohnern. Allen Beteiligten war bewusst, dass man unverhofft auf einen einzigartigen historischen Ort gestossen war. Wir hatten es mit einer der wohl letzten in ihrem ursprünglichen Zustand noch erhaltenen Saisonnierunterkünfte zu tun.
l’état des baraquements qui s’y trouvaient. Avec le Syndicat industrie et bâtiment (SIB), il alerta aussi la presse. Les évènements se sont alors enchaînés. Quatre jours après la visite participative, un groupe issu du milieu des squatteurs escalada la clôture et occupa les bâtiments, réclamant une utilisation transitoire des lieux. En quelques jours, un lieu dissimulé durant des décennies puis tombé dans l’oubli se retrouva au centre de l’attention médiatique.
L’occupation offrit une occasion unique d’accéder à l’intérieur du site et des bâtiments. On constata avec grande surprise que les locaux offraient une plongée authentique dans le passé. Certes, la plupart des meubles avaient disparu mais les sanitaires (WC, éviers), les gazinières mobiles dans la cuisine et les poêles à bois étaient toujours là. Quelques publications datant de la dernière phase d’occupation dans les années 1990 avaient également survécu, comme un calendrier espagnol de 1992, quelques journaux, des justificatifs de paiement et une feuille manuscrite qui invitait, toujours en espagnol, à éteindre la lumière en quittant les lieux. Sur les murs, des graffitis témoignaient du passage des anciens occupants. Tous les participants étaient conscients que l’on venait de découvrir par hasard un lieu historique unique. Il s’agissait vraisemblablement de l’un des derniers logements de saisonniers encore conservés dans leur état d’origine.
Nous avons pu constater à quel point les conditions de logement étaient précaires: en juin, sous le toit sans isolation, la chaleur était étouffante. Lors de visites ultérieures en hiver, on pouvait deviner le froid qui régnait.

Der pensionierte Gewerkschafter Mariano Franzin berichtet von seinem Kampf für bessere Unterkunftsbedingungen für Saisonniers der Baufirma Bührer vor den (noch) verschlossenen Toren des ehemaligen Bührer-Areals.
Syndicaliste à la retraite, Mariano Franzin raconte son combat pour améliorer les conditions de vie des saisonniers devant le portail (encore) fermé de l’ancien site Bührer.
Florian Eitel
Die klimatisch prekäre Wohnsituation konnten wir nachempfinden, war es doch in den Junitagen unter dem nicht isolierten Dach brennend heiss. Spätere Aufenthalte in den Wintermonaten liessen die Kälte in den Räumen erahnen.
Wenige Meter trennen Reichtum und Armut
Weitere Stärke entfaltet das Bührer-Areal als Erinnerungsort an die Zeit der Saisonniers und somit an die Schweizer Migrationsgeschichte durch den Kontrast mit der gegenüberliegenden Villa des Bauunternehmers, die sich ebenfalls noch in einem authentischen historischen Zustand befindet. Die 1954 errichtete Villa zeugt auch heute noch vom damaligen Luxus, der in einem völligen Kontrast zur Wohnsituation der Arbeiter stand: auf der einen Seite der Reichtum und Luxus des Patrons, auf der anderen die prekäre Wohnsituation der ausländischen Arbeiter. Nur wenige Meter sind es, die Reichtum und Armut, Schweizer und Ausländer voneinander trennen. Dies ist geradezu beispielhaft für die Schweiz des 20. Jahrhunderts.
Dass dieser schweizweit einzigartige Erinnerungsort an die Saisonniers noch steht, verdanken wir einem nicht realisierten Infrastrukturprojekt: Nach ursprünglichen Plänen des ASTRA sollten mittlerweile alle Gebäude auf dem Bührer-Areal abgerissen sein und dort die Baustelle für das letzte Teilstück des nationalen Autobahnnetzes stehen. Die Bewegung «WestAst, so nicht» brachte das Autobahnprojekt zum Erliegen. Es ist gewissermassen Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet ein verhindertes Autobahnprojekt einen Erinnerungsort an die Saisonniers ermöglicht, an jene Menschen also, die ja fast alle Autobahnen der Schweiz gebaut haben.
Dieser Artikel ist eine gekürzte Version des Originaltexts, der in der Publikation A future for whose past? zum Denkmalschutzjahr 2025 erschienen ist (vgl. Seite 46 in diesem Heft).


Während die Saisonniers auf Gasherden gekocht haben, zeugt die Küche der Familie Bührer von Wohnkomfort. Tandis que les saisonniers cuisinaient sur de simples réchauds à gaz, la cuisine de la famille Bührer témoignait d’un certain confort de vie.
Wie geht es weiter auf dem Bührer-Areal in Biel? Der Kanton Bern als Besitzer des Areals hat 2024 mit dem Kollektiv «Quai du Bas 30» (quaidubas30.ch) eine Zwischennutzung vereinbart. Angeboten werden nun Aktivitäten und Dienstleistungen, darunter Essensverteilungen oder Reparaturwerkstätten. Die Vermittlung der Geschichte der Saisonniers ist ebenfalls Bestandteil der Zwischennutzung. Auf Vereinbarung können die ehemaligen Saisonnierunterkünfte besucht werden. Auch im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals werden am 13. September Führungen angeboten. Die Patron-Villa wird derzeit im Auftrag des Kantons Bern umgebaut. Dieser will in Zukunft das Gebäude als Unterkunft für Asylsuchende nutzen.
Que va devenir le site Bührer à Bienne? Le canton de Berne, propriétaire du site, a conclu en 2024 un accord d’utilisation transitoire avec le collectif «Quai du Bas 30» (quaidubas30.ch). Celui-ci propose désormais divers services et activités, dont des distributions de repas ou des ateliers de réparation. La transmission de l’histoire des saisonniers fait également partie intégrante de cette utilisation temporaire. Les anciens logements des saisonniers peuvent être visités sur rendez-vous, et des visites guidées seront également proposées le 13 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. L’ancienne villa du patron est actuellement en cours de transformation sur mandat du canton de Berne, qui prévoit d’y héberger à l’avenir des personnes en demande d’asile.
Seuls quelques mètres séparent la richesse et la misère Le site Bührer est un lieu de mémoire privilégié du temps des saisonniers et ainsi de l’histoire de la migration suisse avec, juste en face, la villa de l’entrepreneur qui se trouve également dans son état original. Construite en 1954, cette demeure témoigne encore aujourd’hui du luxe de l’époque, en contraste total avec les conditions de logement des ouvriers: la richesse et le luxe du patron d’un côté, les logements précaires des travailleurs étrangers de l’autre. Seuls quelques mètres séparent la richesse et la misère, le Suisse et l’immigré. Un exemple typique de la Suisse du XXe siècle. Nous devons la survie de ce lieu de mémoire unique à l’abandon d’un projet d’infrastructures. Selon les plans de l’Office fédéral des routes (OFROU), tous les bâtiments du site auraient dû être rasés afin de laisser la place au chantier d’un tronçon autoroutier. Le mouvement «Axe ouest, pas comme ça» mit un terme à cette idée. C’est, d’une certaine manière, une ironie de l’histoire que ce soit l’échec d’un projet d’autoroute qui a contribué à la préservation d’un lieu à la mémoire des saisonniers, alors que ceux-ci ont construit pratiquement toutes les routes nationales du pays.
Cet article est une version raccourcie du texte original paru dans la publication A future for whose past? à l’occasion de l’Année du patrimoine 2025 (cf. page 46 dans ce numéro).
NEUE FRAGEN, VIELE PERSPEKTIVEN NOUVELLES QUESTIONS, MULTIPLES PERSPECTIVES
Peter Egli, Redaktor
Unter dem Motto «Eine Zukunft für unsere Vergangenheit» markierte das Europäische Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 einen Meilenstein in der Geschichte der Denkmalpflege. Die Ortsbilder und die Lebensqualität gewannen an Bedeutung. 50 Jahre später bleibt viel zu tun. Und es stellt sich neu die Frage, wessen Vergangenheit mit «unsere» gemeint ist?
Vor rund 50 Jahren verkündete alt Bundesrat Ludwig von Moos in unserer Zeitschrift den Start ins Denkmalschutzjahr 1975, das sich in Analogie zum 1970 auch in der Schweiz erfolgreich durchgeführten europäischen «Jahr des Naturschutzes» um Probleme der Denkmalpflege aus europäischer Sicht kümmern sollte: «Wenn sich der Bundesrat am 18. Juni 1973 entschlossen hat, den vom Europarat ausgehenden Gedanken eines ‹Europäischen Jahres für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975› aufzunehmen und ihm auch in unserem Schweizerland Gestalt zu geben, so waren dafür wohl zwei Überlegungen massgebend. Die Schweiz […] ist dank ihrer geographischen Situation, ihren kulturellen Strukturen und ihrer geschichtlichen Entwicklung mit den Ländern des europäischen Völkerkreises verbunden. Sie birgt aber zudem selber ein reiches geschichtliches und bauliches Erbe.» (Heimatschutz Nr. 2/1974).
Der Impuls von 1975
In seiner Funktion als Präsident der Eidgenössischen Naturund Heimatschutzkommission (ENHK) sowie des Nationalen Komitees betonte Ludwig von Moos, wie das Europäische Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 dazu beitragen solle, bekannte und weniger bekannte Baudenkmäler «nicht zu vernachlässigen oder sogar zerstören zu lassen, sondern sie zu pflegen, zu erhalten und den kommenden Generationen zu überliefern». Die Hoffnung war, dass in der Bevölkerung und bei den Verantwortlichen auf allen Stufen erkannt wird, dass der durchaus erstrebte technische und wirtschaftliche Fortschritt keineswegs «Missachtung und Zerstörung alter Bauten und Formen» zur Folge haben müsse. Den Verantwortlichen für das Denkmalschutzjahr war die Bewahrung der über Jahrhunderte gelebten Geschichte, die in unserem gebauten Erbe eingeschrieben ist, ein Kernanliegen. Angesichts der stürmischen wirtschaftlichen Entwicklung vor 50 Jahren ging es weniger um die in ihrer Bedeutung unbestrittenen Baudenkmäler als um die bescheideneren Bauwerke, deren künstlerischer und baulicher Wert oft weit geringer ist als deren Situationswert im Ortsbild.
Sous la devise «Un avenir pour notre passé», l’Année européenne du patrimoine architectural 1975 a marqué une étape dans l’histoire de la conservation des monuments et de la protection du patrimoine. L’attention portée aux sites construits et à la qualité de vie s’est accrue. 50 ans plus tard, il reste beaucoup à faire. Et la question se pose à nouveau: quel passé est désigné par ce «notre»?
Il y a 50 ans, l’ancien conseiller fédéral Ludwig von Moos annonçait dans notre revue le début de l’Année européenne du patrimoine architectural 1975. À l’instar de l’Année européenne de la conservation de la nature, menée avec succès en 1970 – y compris en Suisse –, cette initiative visait à aborder les enjeux de la conservation des monuments dans une perspective européenne. «Si le Conseil fédéral a décidé, le 18 juin 1973, d’accueillir favorablement l’idée, lancée par le Conseil de l’Europe, d’une Année européenne du patrimoine architectural et de la mettre en pratique dans notre pays, c’est que deux considérations lui ont paru déterminantes. (…), de par sa situation géographique, sa structure culturelle et son histoire, la Suisse est liée aux autres peuples européens. De plus, elle possède un riche patrimoine historique et architectural.» (Heimatschutz N° 2/1974).
L’élan de 1975
En sa qualité de président de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) ainsi que du Comité national suisse, Ludwig von Moos soulignait que l’Année du patrimoine architectural allait contribuer à ce que les monuments – célèbres ou moins connus – ne soient «ni négligés ou même détruits, mais entretenus, conservés et transmis aux générations futures». L’espoir était que la population et les responsables à tous les niveaux reconnaissent que le progrès technique et économique, aussi souhaitable soit-il, ne doit nullement entraîner «le dédain et la destruction des édifices et des styles anciens».
Pour les responsables de l’Année européenne du patrimoine architectural, la préservation de l’histoire vécue à travers les siècles inscrite dans notre patrimoine bâti était un défi central. Compte tenu du développement économique fulgurant du demi-siècle précédent, il ne s’agissait pas tant des monuments dont l’importance était indiscutable que des édifices plus modestes, dont la valeur artistique et architecturale s’avère souvent bien moindre que leur situation dans le paysage urbain ou villageois.

Schlussveranstaltung zum Europäischen Jahr für Heimatschutz und Denkmalpflege 1975 in Rapperswil.
In der vordersten Reihe, zweiter von rechts alt Bundesrat Ludwig von Moos.
Cérémonie de clôture de l’Année européenne du patrimoine architectural 1975 à Rapperswil. Au premier rang, en deuxième à partir de la droite, l’ancien conseiller fédéral Ludwig von Moos.
Ortsbild im Mittelpunkt
Für das Europäische Denkmalschutzjahr 1975 leitete der Schweizer Heimatschutz das Sekretariat des Nationalen Komitees und nahm eine entsprechend führende Rolle bei der Umsetzung zahlreicher Aktionen und Projekte ein. Ein besonderes Anliegen war der Schutz der stark gefährdeten Ortsbilder. Der damalige Obmann des Schweizer Heimatschutzes, Arist Rollier, hielt die Gefahren fest (Heimatschutz Nr. 2/1974): «Entstellung durch eindringende Fremdkörper wie Glas- und Betonhäuser, aber auch Reklamen, Leitungsdrähte, Fernsehantennen, […] optische und akustische Entwertung durch den Verkehr; Steinfrass durch Abgase von Ölheizungen und Motorfahrzeugen; Herabsinken zur toten Geschäfts- und Bürostadt oder zum blossen Museum durch Bevölkerungsverlust; allmählicher Zerfall mangels Unterhaltung.» Zu den explizit erwähnten Forderungen gehörten verkehrsfreie oder -arme Innenstädte. Damit verbunden war der Aufruf, mithilfe des Denkmalschutzjahres Volk und Behörden wachzurütteln.
Ein wesentlicher Beitrag zum Europäischen Denkmalschutzjahr 1975 war denn auch der Beschluss des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) und des Delegierten für
L’importance des sites construits
La Ligue suisse du patrimoine national (aujourd’hui Patrimoine suisse) a dirigé le secrétariat du comité national de l’Année européenne du patrimoine architectural 1975. L’association a joué ainsi un rôle moteur pour la mise en œuvre de nombreux projets et actions. Une attention particulière a été portée à la protection des sites urbains et villageois gravement menacés. L’ancien président de la Ligue suisse du patrimoine national Ariste Rollier constatait les dangers (Heimatschutz No 2/1974): «Altération par la présence de corps étrangers tels que maisons de verre ou de béton, mais aussi réclames, fils électriques, antennes de télévision, (…) dépréciation visuelle ou acoustique par la circulation; altération de la pierre par l’émission de gaz provenant des huiles de chauffage ou des véhicules à moteur; déclin résultant de la transformation en villes commerçantes ou en bureaux ou simplement en musées, à cause de la diminution de la population; destruction progressive par manque d’entretien.» Parmi les revendications explicites figuraient des zones sans trafic ou à circulation réduite à l’intérieur des centres urbains. S’y ajoutait la volonté de réveiller la population et les autorités grâce à l’Année du patrimoine architectural.
Raumplanung, ein Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) zu erarbeiten. Verantwortlich für das Projekt waren der Architekt J. Peter Aebi von der Sektion Naturund Heimatschutz des EDI (vgl. Heimatschutz/Patrimoine 2/2020) sowie die Architektin Sibylle Heusser (vgl. S. 34). Als Probelauf zur Feininventarisierung wurde das Ortsbild von Beromünster (LU) bearbeitet. Die Deklaration des Kongresses von Amsterdam über das europäische Bauerbe zum Abschluss des Denkmalschutzjahres auf europäischer Ebene hielt ganz im Sinne des ISOS fest: «Die Erhaltung der baulichen Schätze muss zum integralen Bestandteil des Städtebaus und der Raumplanung werden.» Bei Betrachtung der heutigen Angriffe auf das ISOS wünscht man sich das damals so starke wie breite Bewusstsein für die Bedeutung der Ortsbilder zurück.
«Von Leben erfüllt»
Das Jahr 1975 war reich an Aktionen – von Filmserien, Ausstellungen und Schulprojekten bis hin zum europäischen Vorzeigeprogramm der «réalisations exemplaires»: Alle Länder, die sich an der gesamteuropäischen Aktion beteiligten, reichten beim Europarat Projekte ein, mit denen sie in den städtischen oder ländlichen Gemeinden ein mustergültiges Programm von Sanierungen und Revitalisierungen vorantreiben wollten. Für die Schweiz schlug das Nationale Schweizerische Komitee vier Gemeinden vor: Murten (FR), Ardez (GR), Corippo (TI) und Martigny (VS). Die Auswahl sollte die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Schweiz auch international aufzeigen. Im Ganzen konnten im Wettbewerb 40 Städte und Gemeinden ausgezeichnet werden. Die Schweiz schloss mit zwölf prämierten Wettbewerbsarbeiten sehr gut ab. Die Projekte wurden in Ausgabe 1/1976 von Heimatschutz gewürdigt und den Preisträgern im Schloss Rapperswil am 12. Februar 1976 die Urkunden des europäischen Wettbewerbs überreicht.
Une contribution essentielle à cette année européenne 1975 fut aussi la décision du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et du délégué à l’aménagement du territoire de créer un Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). L’architecte J. Peter Aebi, de la section Protection de la nature et du patrimoine au DFI, a été nommé à la tête du projet (voir Heimatschutz/Patrimoine No 2/2020), ainsi que l’architecte Sibylle Heusser (voir page 34). Le site de Beromünster (LU) servit de projet pilote pour le relevé détaillé. La déclaration du Congrès d’Amsterdam sur le patrimoine bâti européen, en clôture de cette année, allait tout à fait dans le sens de l’ISOS: «La planification urbaine et l’aménagement du territoire doivent intégrer les exigences de la conservation du patrimoine architectural (…).» À l’heure où l’ISOS fait l’objet d’attaques répétées, on ne peut que souhaiter le retour de la conscience, autrefois forte et largement partagée, de l’importance des sites construits.
«Respirant la vie»
L’année 1975 fut riche en actions – des séries de films au programme européen des «réalisations exemplaires», en passant par des expositions et des projets dans les écoles: tous les pays qui participaient à la campagne ont envoyé des projets au Conseil de l’Europe. Ils entendaient ainsi promouvoir des assainissements et des rénovations exemplaires dans les communes urbaines ou rurales. En Suisse, le Comité national proposa quatre communes: Morat (FR), Ardez (GR), Corippo (TI) et Martigny (VS). Ce choix devait témoigner, y compris à l’étranger, de la diversité linguistique et culturelle du pays. Au total, 40 villes et communes furent primées lors du concours. Par ailleurs, avec 12 travaux récompensés, la Suisse tira tout particulièrement son épingle du jeu. Ces réalisations furent honorées dans l’édition 1/1976 de la revue Heimatschutz, et les lauréats reçurent leurs

Die Preisträger des europäischen Wettbewerbs in Rapperswil am 12. Februar 1976 mit G. Kahn-Ackermann, Generalsekretär des Europarates (rechts aussen).
Les représentants des communes primées à Rapperswil le 12 février 1976 avec G. Kahn-Ackermann, secrétaire général du Conseil de l’Europe (tout à droite).


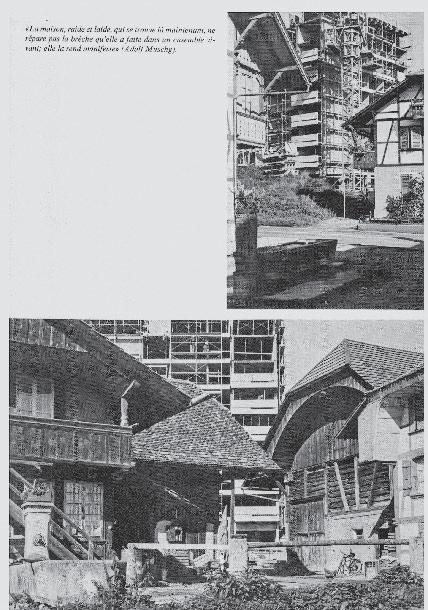
Mit dem Ende des Europäischen Jahres für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 zeigte sich, dass zwar viel bewegt wurde, viele der Probleme aber nicht gelöst werden konnten. Bis heute nicht. Es geht weiter darum, zeitliche und räumliche Zusammenhänge im gebauten Erbe erkennbar zu machen und bei allen Eingriffen an die Bedürfnisse der Menschen zu denken, wie bereits Ludwig von Moos festhielt (Heimatschutz Nr. 1/1976): «Eine Gruppe von Bauten, ein Strassenzug, eine Silhouette, ein Ortsbild, immer aber von Leben erfüllt und auf menschliches Mass zugeschnitten.» Die Erkenntnisse aus dem Denkmalschutzjahr 1975 können durchaus als Weiterentwicklung der Sinngebung des Denkmalschutzes verstanden werden. Sie haben eine neue, ganzheitliche Denkweise eingeläutet, die die Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt. Auch aus Sicht des Schweizer Heimatschutzes zeigte sich der Heimatbegriff nun umfassender, indem er die Lebensqualität miteinbezog: «Anstelle des Nationalen und Patriotischen ist die Umwelt, unser alltäglicher Lebensbereich getreten. Hier müssen wir uns immer wieder fragen: Vermag das Bauen heute Heimat zu schaffen?» (Heimatschutz Nr. 1/1975).
Die Ziele bleiben, die Gesellschaft verändert sich Am 12. Februar 1976 fand das Europäische Jahr für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975 im Schloss Rapperswil seinen Abschluss für die Schweiz. Auf den Fotos der Schlussveranstaltung sind fast ausschliesslich seriöse, ältere Herren im Anzug zu sehen. Wie in Wirtschaft und Politik verkörperten sie vor 50 Jahren auch die Spitze der Schweizer Denkmalpflege –anerkannt, erfahren, bestens vernetzt und mit hehren Zielen. Diese Ziele haben sich nur wenig geändert. Nach wie vor gilt es, dem sinnlosen Abriss wertvoller Bausubstanz entgegenzuwirken, sich für eine gute Lebensqualität in Stadt und Land einzusetzen und eine bessere Baukultur einzufordern.
Verändert haben sich jedoch die Menschen, die für diese Ziele kämpfen: Sie sind bunter und vielfältiger, jünger, weiblicher, anders – ein Spiegel der sich wandelnden Gesellschaft. Je mehr und unterschiedlichere Stimmen sich für unser Kulturerbe einsetzen, desto besser. Unser Kulturerbe schliesst uns alle ein, Alt und Jung, Hiergeborene und Zugezogene, Arme und Reiche und auch die Minderheiten, die Randgruppen und die Menschen ohne Lobby. Viele Stimmen – ein Erbe. Eine Frage stellt sich dabei immer wieder neu: Für welches Erbe stehen wir ein? Sind es die klassischen, seit Jahrzehnten gut gepflegten Baudenkmäler, die von den Blütezeiten und Höhepunkten der Schweizer Geschichte erzählen? Die mit ihrer Schönheit heimelig anrühren und uns von einst besseren Zei-
Mehr erfahren: Die im Artikel zitierten Textstellen und zahlreiche lesenswerte Artikel zum Denkmalschutzjahr aus den Jahren 1974, 1975 und 1976 finden sich in unserem Zeitschriftenarchiv unter heimatschutz.ch/e-periodica
Pour en savoir plus: Les passages cités dans l’article et de nombreux articles publiés en 1974, 1975 et 1976 à propos de l’année du patrimoine peuvent être consultés dans nos archives de revues à l’adresse patrimoinesuisse.ch/e-periodica
diplômes européens le 12 février 1976 au château de Rapperswil. Avec la fin de l’Année européenne du patrimoine architectural, il s’avéra que si beaucoup de choses avaient bougé, de nombreux problèmes n’ont pas pu être résolus – et ce jusqu’à aujourd’hui. Il convient toujours de mettre en évidence les relations temporelles et spatiales dans le patrimoine bâti et de réfléchir aux besoins des habitants lors de toutes les interventions, comme Ludwig von Moos l’exprimait déjà (Heimatschutz No 1/1976): «Un groupe de maisons, la perspective d’une rue, la silhouette d’un site mais faits à la taille de l’homme et respirant la vie.» Les enseignements de cette année peuvent être certainement considérés comme une évolution du sens donné à la conservation des monuments. Ils annonçaient un nouveau mode de pensée global qui met l’accent sur la qualité de vie. Pour Patrimoine suisse également, la notion de «Heimat» s’est élargie dès lors qu’elle englobait la qualité de vie: «La notion de patrie, de patrimoine national (Heimat) a pris une signification nouvelle. L’environnement, le cadre de notre vie quotidienne, est passé au premier plan. Et nous nous demandons une fois de plus: l’architecture d’aujourd’hui est-elle capable d’enrichir le patrimoine (Heimat schaffen)?» (Heimatschutz N° 1/1975).
Les objectifs restent, la société évolue Le 12 février 1976, l’Année européenne du patrimoine architectural 1975 trouva sa conclusion pour la Suisse au château de Rapperswil. Sur les photos de la cérémonie, on distingue presque exclusivement des hommes âgés sérieux, en costume. Comme dans les sphères économique et politique, ils représentaient alors les figures de proue de la conservation des monuments suisses – reconnus, expérimentés, disposant d’un large réseau et animés de nobles objectifs. Les objectifs n’ont guère changé. Il s’agit toujours de s’opposer à la vaine démolition d’une substance bâtie précieuse, de s’engager en faveur d’une qualité de vie élevée, en ville et dans les campagnes, et de promouvoir une meilleure culture du bâti.
Mais les personnes qui se battent pour ces idéaux ont changé: plus diverses, plus jeunes, plus féminines, plus hétérogènes – elles sont à l’image d’une société en mutation. Plus les voix qui s’engagent en faveur de notre patrimoine bâti sont variées et multiples, mieux c’est. Car ce patrimoine nous concerne toutes et tous: jeunes et aînés, immigrés et autochtones, classes aisées et modestes mais aussi les minorités, les groupes marginalisés et les personnes sans lobby. Mille voix, un patrimoine. Une question ne cesse de se poser: pour quel héritage voulons-nous nous battre? Les monuments classiques, choyés depuis des décennies qui racontent l’apogée et les grands moments

ten träumen lassen? Unbedingt, ja, denn sie sind ein wichtiger Teil der Identität und (touristischen) Attraktivität unseres Landes. Und auch unscheinbare Zeugnisse wie Industriebauten, Arbeitersiedlungen, Ställe in Bergregionen oder Bauten des 20. Jahrhunderts verdienen Schutz.
Ein breiteres Erbe
Nun folgt ein weiterer Schritt. Die Arbeitsgruppe Denkmalschutzjahr 2025 des ICOMOS Suisse stellt zum Jubiläum fest: «50 Jahre später stehen wir angesichts der Folgen von Krieg, Klimawandel, Migration und Vertreibung vor der Frage, wessen Vergangenheit mit ‹unsere› gemeint ist und ob wir überhaupt noch von einer gemeinsamen Vergangenheit sprechen können.» Die aktuelle Frage lautet, ob die durch Denkmal- und Heimatschutzgesetze geschützten Objekte tatsächlich die Geschichte repräsentieren. Welches Erbe ist für Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby bedeutend, und welche Massnahmen sind zu ergreifen, damit der Denkmalbestand der Zukunft die gesellschaftlichen Entwicklungen der Vergangenheit abbildet? Benötigen wir neue Inventare, Praktiken und Zugänge – und eine diversere Erinnerungskultur?
Das Resultat unserer Frage nach Ihren persönlichen Lieblingsbauten spiegelt dieses neue Denken. In der Auswahl der eingesandten Beiträge befindet sich auch ein Wohnwagen der Fahrenden oder ein einst als Provisorium gedachter Bau (vgl. S. 16/17). Die Arbeit der Denkmalpflege und des Heimatschutzes wird vielfältiger und komplexer. Und die Aufgabe bleibt, eine Zukunft für unser aller Vergangenheit zu sichern – gern mit möglichst vielen Heimatschutzmitgliedern an unserer Seite!
de l’histoire suisse? Ceux qui nous touchent au plus profond par leur beauté et réveillent en nous la nostalgie des temps meilleurs? Oui, sans aucun doute, car ils constituent une part essentielle de l’identité et de l’attractivité (touristique) de notre pays. Les témoins plus discrets comme des bâtiments industriels, des cités ouvrières, des étables en montagne ou encore l’architecture du XXe siècle méritent aussi d’être protégés.
Un vaste héritage
Une nouvelle étape s’annonce aujourd’hui. Le groupe de travail Année du patrimoine 2025 d’ICOMOS revient sur le thème de 1975 «Un avenir pour notre passé»: «50 ans plus tard, face aux conséquences des guerres, des dérèglements climatiques, des migrations et des déplacements forcés, se pose la question de savoir de quel ‹notre› passé il est question, et s’il est encore possible de parler d’un passé commun.» Autrement dit, les objets protégés par les lois sur la préservation des monuments et du patrimoine représentent-ils vraiment l’histoire? Quel patrimoine est porteur de sens pour les minorités, les groupes marginalisés et les personnes sans voix politique? Et quelles mesures faut-il prendre pour que les monuments de demain reflètent et représentent les évolutions sociales d’hier? Devonsnous revoir nos inventaires, nos pratiques et nos accès – avonsnous besoin d’une culture de la mémoire plus diversifiée?
Les résultats de notre appel à partager son bien patrimonial préféré reflètent cette nouvelle façon de penser. Parmi les contributions reçues figurent une caravane yéniche ou un bâtiment autrefois conçu comme une solution provisoire (voir pages 16/17). Le travail de la conservation des monuments et de la protection du patrimoine devient toujours plus diversifié et complexe. Mais la mission demeure d’assurer un avenir à notre passé commun avec, espérons-le, un grand nombre de membres de Patrimoine suisse à nos côtés!
Viele Stimmen, ein Erbe: Besuch des Bauernhofs Mollards-des-Aubert im Vallée de Joux im Rahmen des Clou rouge 2024 mit dem Waadtländer Heimatschutz Mille voix, un patrimoine: visite de la ferme des Mollards-des-Aubert sur les hauts de la Vallée de Joux dans le cadre du Clou rouge 2024 avec la section vaudoise de Patrimoine suisse
Liubov
Krivenkowa
EIN BLICK AUF DAS
DENKMALSCHUTZJAHR 1975
RETOUR SUR L’ANNÉE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 1975
Unter den Dokumentationen zum Denkmalschutzjahr 1975 sind in den Archiven der SRG einzelne Folgen einer extra produzierten Filmserie zu finden, die Herausforderungen von Denkmalpflege und Heimatschutz aus verschiedensten Gesichtspunkten beleuchtet. Parmi les documents consacrés à l’Année du patrimoine architectural 1975, on retrouve, dans les archives de la SSR, quelques épisodes d’une série produite pour l’occasion. Ces émissions illustrent sous des angles variés les défis de la conservation des monuments et de la protection du patrimoine.

Betonfluss
Auswirkungen des Baus der Expressstrasse in Zürich für Mensch und Umwelt: Der Film setzt ein grosses Fragezeichen hinter den grenzenlosen Strassenausbau. (SRF)

Morcote, un gioiello in pericolo
La modernità rischia di mettere a rischio il patrimonio architettonico e culturale. È il caso di Morcote e Vico Morcote, dove l’urbanizzazione selvaggia sta sottraendo terreno agricolo, deturpando il paesaggio e mettendo a rischio il settore turistico. (RSI)

Provisorisch geschützt
Aufruf zur Erhaltung der Bausubstanz aus der Zeit der Jahrhundertwende am Beispiel einzelner Bauwerke in der Stadt St. Gallen. (SRF)

Rivitalizzare Corippo
Il piccolo villaggio verzaschese di Corippo, raro esempio di architettura rurale rimasto intatto sul versante sudalpino, è stato scelto nell’ambito dell’anno europeo del patrimonio architettonico 1975 quale località da salvaguardare e rivitalizzare. (RSI)

Romainmôtier et Katharina von Arx L’écrivaine Katharina von Arx a redonné vie à la Maison du Prieur. Interview de 1966 (en français) et retour sur son expérience neuf ans plus tard dans le cadre de l’année du patrimoine (en allemand). (RTS/SRF)
Eine starke Frau und ihr Engagement für ein Baudenkmal: Erfahrungen der Schriftstellerin Katharina von Arx bei der Restaurierung und dem Unterhalt von Schloss Romainmôtier (VD) im Jahr 1966 und neun Jahre später. (RTS/SRF)
Videos anschauen: Eine Zusammenstellung finden Sie unter heimatschutz.ch/ videoarchiv.
Regarder les vidéos: vous trouverez les extraits sous patrimoinesuisse.ch/ archives-video.
zVg
IHRE LIEBLINGSBAUTEN VOS LIEUX DE PATRIMOINE PRÉFÉRÉS
In unserem Newsletter haben wir gefragt: Welches ist Ihr liebstes Baudenkmal, und was macht es für Sie besonders? Die Favoriten reichen vom prunkvollen Schloss bis zum historischen Wohnwagen.
Dans notre infolettre, nous vous avons demandé quel était votre bien patrimonial préféré et ce qui le rendait si spécial à vos yeux.
Vos choix vont du somptueux château aux caravanes historiques.
MONUMENT NATIONAL, GENÈVE
Nadia Braendle Retraitée
«Quel exemple pour l’avenir de la Suisse et pour l’importance des femmes hier et aujourd’hui! Je connais ce monument depuis mon enfance, lors de promenades sur les quais de la rade de Genève.»
MANOIR HAUTEROCHE, LE PONT (VD)
Philipp Maurer Raumplaner und ehemaliger Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz
«Die Konstruktionsweise, eine frühe Betonkonstruktion von François Hennebique, kombiniert mit der wunderbaren Lage über dem Lac de Joux macht dieses Bauwerk besonders.»
Alle Stimmen und alle Lieblingsbauten sind unter heimatschutz.ch/ihr-baudenkmal aufgeführt und können in den kommenden Wochen auf unseren Social-Media-Kanälen entdeckt werden.
TEMPLE DE CHÊNE-PÂQUIER, CHÊNE-PÂQUIER (VD)
Denis Berdoz
«D’abord, ses qualités esthétiques: une forme harmonieuse qui dégage de la sérénité. Puis son architecture rare: une église de plan elliptique. Enfin, son caractère historique: il témoigne de la construction spécifique d’un bâtiment destiné au culte réformé.»
Toutes les contributions et tous les lieux de patrimoine préférés sont à découvrir sur patrimoinesuisse.ch/ votre-patrimoine, et seront présentés dans les semaines à venir sur nos réseaux sociaux.
CHÂTEAU DE CHILLON (VD)

Evelyn Riedener Guide du patrimoine culturel
«Le château montre une partie importante de l’histoire de la Suisse romande. Il est malheureusement devenu trop touristique.»
WASSERHÜS, ALBINEN (VS)
Gian Battista Castellani Architekt
«Das Projekt zeigt das Thema Wasser im Kontext mit dem Ort und dessen Bedeutung regional und national.»
SPYCHER NR.2, SCHWARZENBURG (BE)

Nicole Dahinden Geografin
«Ein wilder Zwilling mit viel Geschichte: Der Speicher mag ramponiert wirken, doch genau dieser Zustand hat über 20 Menschen inspiriert, seine Rettung in die Hand zu nehmen.»
die Hannover-Messe. Im Anschluss stand er bis 1983 auf dem Werkgelände der USM in Bühl (D). Nach einer Überarbeitung und Ergänzung der USM-Bauteile erstellte ich damit 1986 das Wohnhaus Bill in Grenchen.»
KÜHLTURM KERNKRAFTWERK LEIBSTADT (AG)
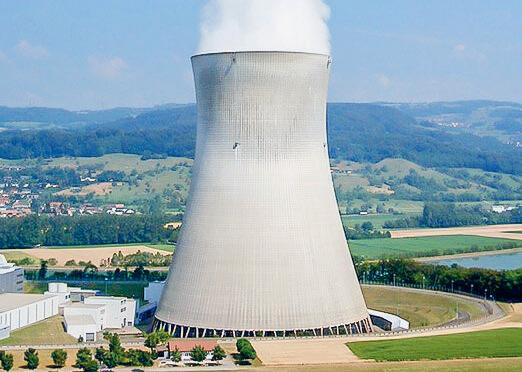
Hugo Schumacher
«Es gibt nur zwei erhaltene Kühltürme in der Schweiz als Zeitzeugen einer wichtigen energietechnischen Epoche. Dennoch bleibt dieser leider nicht erhalten.»
GLOBUS-PROVISORIUM, ZÜRICH
Stefan Hilbrand Architekt und Berater
«Ein ‹Mississippi-Dampfer› am Quai, filigran und leicht, scheinbar vorübergehend und doch widerstandsfähig, beständig und fest verankert. Beim Blick vom «Central» erschliesst sich die Seefahrerromantik.»
CULINARIUM ALPINUM, STANS (NW)

WOHNHAUS BILL, GRENCHEN (SO)
Remo Bill Architekt
«Die Produktion des Pavillons erfolgte 1974 als Demonstrationsobjekt der Firma USM für
Kornelia Schultze Pensioniert
«Hier ist es gelungen, die Atmosphäre eines Klosters in die heutige Zeit zu retten und nebenbei ein ganz ausserordentliches Hotel und Restaurant zu schaffen.»
HÄNKITURM, DIESSENHOFEN (TG)
Lucia Angela Cavegn
Kunsthistorikerin
«Mit seiner Geschichte, seiner Lage und seiner Erscheinung ist der Hänkiturm Diessenhofen Teil der Identität des Ortes. Als ehemaliger, umgenutzter Wehrturm weist er eine auffällig schlanke Form auf und ist in seiner Art einmalig.»
SALGINATOBELBRÜCKE, SCHIERS (GR)
Aaron Merlin Müller Physiker
«Das Baudenkmal ist eines der grossartigsten Bauwerke von Robert Maillart und vielleicht die schönste Brücke der Welt.»
HISTORISCHER WOHNWAGEN VON JENISCHEN, ZILLIS-REISCHEN (GR)

Willi Wottreng Schriftsteller und Geschäftsführer der «Radgenossenschaft»
«Ein solcher Wagen wird jenisch ‹Scharotl› genannt. Ein materielles Relikt einer oralen Kultur, die kulturarchäologisch kaum zu dokumentieren ist. Generell sollte ein derartiges Objekt – dieses hier ist unverkäuflich –auf dem Ballenberg einen Platz finden.»
Peter König Rechtsanwalt
«Gerade ihre scheinbare Unscheinbarkeit macht die Funicolare degli Angioli besonders – und der Umstand, dass die Anlage noch besteht und mit vergleichsweise wenig Aufwand wiederbelebt werden könnte.»

1944 wurden mit dem «Kasztner-Transport» 1368 jüdische Gefangene aus dem KZ Bergen-Belsen befreit und in die Schweiz gebracht, wo sie zuerst u.a. in der Turnhalle Kreuzbleiche in St. Gallen Aufnahme fanden. En 1944, le «train Kastner» transporta 1368 juifs libérés du camp de concentration de Bergen-Belsen vers la Suisse, où ils furent d’abord hébergés dans la salle de gymnastique Kreuzbleiche, à Saint-Gall, notamment.
WEG DER VIELFALT
LE PARCOURS DE LA DIVERSITÉ
Rassismus, Kolonialismus, Ausgrenzung –viele Orte im Stadtraum erzählen davon, oft ungesehen. Der Weg der Vielfalt in St. Gallen macht diese Geschichten sichtbar und setzt ein Zeichen für eine inklusive Erinnerungskultur. Doch was folgt daraus für die Denkmalpflege?
Den Anstoss für den Weg der Vielfalt lieferte ein Postulat im Stadtparlament. Die weltweit geführten Debatten rund um die Black Lives Matter-Proteste forderten eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe sowie dessen Vermittlung. Vor dem Hintergrund einer diversen Gesellschaft mit einer Vielfalt kultureller Herkünfte, Religionen, Identitäten und der kolonialen Vergangenheit stellt sich die Frage, wie wir mit belastetem kulturellem Erbe umgehen. Anstatt Zeichen der Vergangenheit aus dem öffentlichen Raum zu entfernen, soll die Stadt über sie informieren, aufklären und sie somit kontextualisieren.
Eine Fachgruppe übernahm die Projektleitung. In dieser waren verschiedene städtische Dienststellen und Archive vertreten, aber auch Expertinnen und Experten für Kolonialge-
Racisme, colonialisme, exclusion – de nombreux sites, souvent ignorés, en témoignent dans l’espace urbain. À Saint-Gall, le Weg der Vielfalt (parcours de la diversité) rend visible ces histoires et pose un jalon en faveur d’une culture inclusive de la mémoire. Avec quel impact sur les services des monuments historiques?
L’impulsion pour ce parcours de la diversité est née d’un postulat déposé devant le parlement de la ville. Les débats menés à l’échelle mondiale dans le sillage des manifestations Black Lives Matter ont appelé à une réflexion approfondie sur l’héritage culturel et sa transmission. Dans une société diverse, marquée par la pluralité des origines culturelles, des religions, des identités, et par un passé colonial, la question se pose: comment traiter un héritage culturel chargé? Plutôt que de faire disparaître les traces du passé de l’espace public, la ville entend informer, les expliquer et les contextualiser. Un groupe de travail a pris la direction du projet. Il réunissait des représentants de plusieurs services de la ville, dont les archives, mais aussi des experts de l’histoire coloniale, de
Matthias Fischer, Denkmalpfleger Stadt St. Gallen
schichte, für Frauen- und Geschlechtergeschichte, für Diversität und Inklusion sowie für Sozialanthropologie. Die Bevölkerung wurde eingeladen, auf einer Onlineplattform Erinnerungsorte vorzuschlagen, die in den Weg der Vielfalt aufgenommen werden sollten. Gesucht waren Orte, an denen sich die Geschichte der Diskriminierung von Minderheiten zeigt oder die positiv für einen erfolgreichen Kampf um Anerkennung stehen. An einem öffentlichen Workshop diskutierte die Fachgruppe die eingereichten und von ihr ergänzend eingebrachten Vorschläge mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Interessengruppen.
Aus 150 Vorschlägen wählte die Fachgruppe rund 90 Orte für den Weg der Vielfalt aus. Dabei achtete sie darauf, Themen wie Frauengeschichte, Queerness, Kolonialismus oder jüdische Geschichte möglichst ausgewogen zu berücksichtigen –was aufgrund des unterschiedlichen Stands der Aufarbeitung jedoch nicht überall gelang. Die Fachgruppe und weitere beigezogene Autorinnen und Autoren verfassten Beiträge zu den einzelnen Stationen, die seit März 2025 auf der öffentlich zugänglichen Webseite wegdervielfalt.ch zu finden sind.
Den Denkmalwert neu denken
Anschliessend widmete sich die städtische Denkmalpflege der weiterführenden Informationsvermittlung im Kontext des Denkmalschutzjahres 2025, insbesondere mit der Jahresausstellung «Denkmal anders». Die im Weg der Vielfalt erhaltenen Erinnerungsorte unterscheiden sich stark hinsichtlich ihrer denkmalpflegerischen Kategorisierung. Zahlreiche Bauten stehen zwar unter Schutz, aber nur wenige sind wegen ihrer sozialgeschichtlichen, historischen oder kulturellen Bedeutung inventarisiert. Orte der Diskriminierung fehlen in den Inventaren (noch) ganz.
Im Inventarisierungsprozess gewichten Fachpersonen die denkmalpflegerische Bedeutung noch immer zu einseitig nach architektonischen oder baukünstlerischen Kriterien. Dabei kann auch eine historische Bedeutung, die nicht unmittelbar zu sehen ist, für sich allein schon einen Denkmalwert begründen. Bei der nächsten Aktualisierung des Inventars der schützenswerten Bauten sollte die Bevölkerung im Allgemeinen stärker miteinbezogen werden – insbesondere Bevölkerungsgruppen, deren Geschichte bisher im Inventar unterrepräsentiert ist. Wie beim Workshop zum Weg der Vielfalt können die Beteiligten gefragt werden, welche Gebäude für sie identitätsstiftend sind und deshalb als kulturhistorische Zeugnisse erhalten bleiben sollen. Neben der Erweiterung bestehender Inventare soll auch bereits geschützten Objekten ein erweiterter Denkmalwert zugeschrieben werden. So ist etwa die Turnhalle Kreuzbleiche (Abbildung links) nicht bloss ein Zeugnis für den aufkommenden Sportunterricht im frühen 20. Jahrhundert, sondern auch ein Erinnerungsort für die Flüchtlingsgeschichte im Zweiten Weltkrieg. Oder das «Haus zur Waage», das zwar für die Jugendstilarchitektur und Stickereiblüte in der Stadt St. Gallen steht, aber mit den stereotypen Porträtköpfen der Kontinente ebenso Ausdruck einer kolonialrassistischen Haltung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist.
Baudenkmäler erzählen Geschichten – und es ist die Aufgabe der Denkmalpflege, diese Geschichten ganzheitlicher zu erzählen als bisher. Nur so kann sie der gesellschaftlichen Vielfalt und dem Erbe von Minderheiten gerechter werden.
l’histoire des femmes et du genre, de la diversité et de l’inclusion ainsi que de l’anthropologie sociale. La population a été aussi invitée à proposer, sur une plateforme en ligne, des lieux de mémoire susceptibles d’être intégrés au parcours de la diversité. On recherchait des lieux témoignant de l’histoire des discriminations subies par les minorités ou symbolisant un combat positif pour leur reconnaissance. Lors d’un atelier public, le groupe a discuté, avec des représentants de différents groupes d’intérêts, des propositions reçues et de celles rassemblées durant son activité.
Parmi quelque 150 propositions, le groupe a sélectionné 90 sites pour le parcours de la diversité. Il a veillé à prendre en compte de manière aussi équilibrée que possible des thèmes tels que l’histoire des femmes, les identités queer, le colonialisme ou l’histoire juive – ce qui n’a pas été toujours possible vu l’état d’avancement différent des recherches. Le groupe de travail et des auteurs associés ont rédigé des contributions pour chacune des étapes du parcours que l’on peut désormais trouver sur la page web wegdervielfalt.ch mise en ligne en mars 2025.
Réévaluer la valeur patrimoniale
À l’issue du processus, le Service des monuments historiques de la ville s’est attelé à approfondir la transmission des connaissances dans le contexte de l’Année du patrimoine 2025 avec, en particulier, l’exposition «Denkmal anders» (le patrimoine autrement). Les lieux de mémoire du parcours de la diversité se distinguent fortement par leur typologie patrimoniale. De nombreux bâtiments sont certes protégés, mais rares sont ceux qui sont inscrits à l’inventaire en raison de leur importance sociale, historique ou culturelle. Ainsi, les sites témoins des discriminations n’y sont pas (encore) présents. Lors des procédures de recensement, les spécialistes évaluent l’importance pour le patrimoine selon des critères qui sont encore trop orientés sur l’architecture ou l’esthétique. Pourtant, une signification historique, qui n’est pas forcément perceptible au premier coup d’œil, peut justifier à elle seule une valeur patrimoniale. Lors de la prochaine actualisation de l’inventaire des bâtiments dignes de protection, il conviendrait d’associer davantage la population en général – et en particulier les groupes dont l’histoire est sous-représentée jusqu’à présent. Comme lors de l’atelier dédié au parcours de la diversité, il serait pertinent de leur demander quels bâtiments participent à leur sentiment d’identité et devraient donc être préservés en tant que témoins de l’histoire culturelle. Outre l’extension des inventaires existants, il convient aussi d’attribuer une valeur plus large à des constructions déjà protégées. Ainsi, la salle de gymnastique Kreuzbleiche (photo à gauche) n’est pas seulement un témoin de l’essor de l’éducation physique au début du XXe siècle. Elle constitue également un lieu de mémoire de l’histoire des réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale. Ou encore la «Haus zur Waage» (maison à la balance), exemple remarquable d’architecture Jugendstil et symbole de l’âge d’or de la broderie à Saint-Gall, mais également l’expression du racisme colonial du début du XXe siècle avec ses bustes stéréotypés représentant les cinq continents.
Les monuments racontent des histoires, et il incombe au Service des monuments historiques d’en restituer une vision plus globale qu’auparavant. C’est ainsi seulement qu’il pourra rendre justice à la diversité de la société et à l’héritage des minorités.
wegdervielfalt.ch
wegdervielfalt.ch

Yuma Shinohara, Kurator im S AM Schweizerischen Architekturmuseum, in der «Denk Mal Bar» der aktuellen Ausstellung «Was War Werden Könnte» Yuma Shinohara, commissaire au S AM Musée suisse d’architecture, dans le «Denk Mal Bar» de l’exposition actuelle «Ce qui était pourrait devenir»
GESPRÄCH MIT YUMA SHINOHARA ENTRETIEN AVEC YUMA SHINOHARA
«WIR MÖCHTEN AUCH WENIGER SICHTBARE THEMEN ANSPRECHEN»
«NOUS VOULONS AUSSI TRAITER DE SUJETS MOINS VISIBLES»
Marco Guetg, Journalist
Marion Nitsch, Fotografin
Zum 50. Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahrs 1975 beleuchtet das S AM Schweizerische Architekturmuseum in der aktuellen Ausstellung das Zusammenspiel von Architektur und Denkmalpflege. Kurator Yuma Shinohara gibt ein paar Einblicke.
In der aktuellen Ausstellung «Was War Werden Könnte: Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur» sind zehn Projekte zu sehen, die alle die Renovation, die Sanierung oder den Umbau bestehender Gebäude thematisieren. Nach welchen Kriterien wurden sie ausgewählt? Wir haben vor allem nach Projekten mit unterschiedlichen Lösungsansätzen gesucht. Ausgangspunkt war ein Kurs mit 20 Studierenden der Denkmalpflege an der ETH, den wir als Kuratoren mitbetreut haben. Unser Anliegen war, thematisch möglichst breit zu fahren und dabei kleine wie grosse Interventionen vorzustellen.
Die Tatsache, dass die Denkmalpflege im S AM temporär eine Heimat gefunden hat, kann als programmatisches Zeichen gedeutet werden, oder?
Auf jeden Fall. Die Anfrage kam vor Jahren von Silke Langenberg vom ETH-Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege. Sie hat vorgeschlagen, etwas zum 50. Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahrs zu machen. Wir haben die Idee aufgenom-
Pour le Jubilé de l’Année européenne du patrimoine architectural 1975, le S AM Musée suisse d’architecture consacre une exposition aux interactions entre architecture et conservation. Le commissaire Yuma Shinohara nous en livre quelques clés de lecture.
men und uns überlegt, wie wir als Architekturmuseum das Thema in einen grösseren Kontext stellen könnten, und haben schliesslich den Fokus auf das Verhältnis zwischen Architektur und Denkmalpflege gelegt. Was nun zu sehen ist, ist eine Bestandesaufnahme.
Wann wird ein Gebäude ein Denkmal?
Schwierige Frage! Ich rette mich mit einer eher klassischen Definition. Ein Denkmal ist ein Objekt, das generell auch nach einer Generation – 30 oder 40 Jahre – noch als baukulturell wichtig eingestuft wird. Es ist ein Zeuge einer bestimmten Zeit und zeigt, wie damals gebaut und gelebt wurde. Je
L’exposition «Ce qui était pourrait devenir: expérimentations entre conservation et architecture» présente dix projets qui portent sur la rénovation, l’assainissement ou la transformation de bâtiments. Comment avez-vous orienté vos choix? Nous avons avant tout cherché des projets portés par des approches différentes. Nous sommes partis d’un cours réunissant 20 étudiants en conservation du patrimoine bâti à l’ETH Zurich. Ces étudiants ont fonctionné en tant que commissaires sous notre supervision. Nous voulions aborder les thèmes les plus variés possible et présenter aussi bien des interventions modestes que de grande ampleur.
Die Ausstellung «Was War Werden Könnte – Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur» (bis 14. September 2025) ist in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Konstruktionserbe und Denkmalpflege (Prof. Dr. Silke Langenberg) der ETH Zürich entstanden: sam-basel.org
L’exposition «Ce qui était pourrait devenir: expérimentations entre conservation et architecture» (jusqu’au 14 septembre 2025) a été réalisée en collaboration avec la chaire de patrimoine bâti et de conservation des monuments (prof. Dr Silke Langenberg) à l’ETH Zurich: sam-basel.org
nach Aussagekraft kann auch ein jüngeres Objekt zum Denkmal erklärt werden, aber oft werden die Qualitäten erst durch den zeitlichen Abstand sichtbar. Die Schwierigkeit bei dieser klassischen Sicht ist das Tempo unserer Zeit. Gut möglich, dass ein Gebäude, das in 40 bis 50 Jahren als Denkmal gelten könnte, bis dahin längst verschwunden ist. Eine weitere definitorische Schwierigkeit liegt darin, dass ein Denkmal für viele Menschen etwas Unterschiedliches bedeuten kann. Es gibt durchaus Bauten, die nicht wegen ihres baukulturellen Wertes schützenswert sind, sondern für eine bestimmte Gruppe einen emotionellen Wert besitzen. Gelegentlich ist es schlicht auch eine Frage der Gesellschaft, ob sie ein Objekt zum Denkmal adeln will oder nicht.
Wir führen dieses Gespräch im vierten Raum der Ausstellung, in der sogenannten «Denk Mal Bar». Besuchende haben hier die Möglichkeit, via QR-Code Ideen zu lancieren. Tun sie es auch?
Eher wenig. Ich vermute, da liegt die Hemmschwelle etwas höher. Die restlichen Angebote hingegen werden stark genutzt und übertreffen unsere Erwartungen. Die drei bisherigen Debatten fanden bei vollem Haus statt. Auch bin ich immer wieder überrascht, wer den Weg in die Bar findet. Jeder Gast bringt sein eigenes Netzwerk mit und damit auch ein An -
gebot zum thematisch breiten Gespräch. Neugierde und Offenheit sind gross. Wir stellen fest, dass die Denkmalpflege oft plakative Bilder evoziert, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Hier wird das dann verhandelt. Es sind auch schon Besitzer alter Häuser erschienen, die sich bei uns erkundigt haben, was sie damit tun könnten. Das informelle Setting einer solchen Bar trägt natürlich auch dazu bei, dass man sich in lockerem Ambiente treffen und offen reden kann.
Die Themen, die in der Ausstellung gezeigt oder in der «Denk Mal Bar» diskutiert werden, sind auch Themen des Schweizer Heimatschutzes. In welcher Form war der Heimatschutz involviert?
Das Interesse am Thema ist seitens des Schweizer Heimatschutzes sehr gross. Wären wir etwas früher ins Gespräch gekommen, wäre der Heimatschutz in der Ausstellung mit Sicherheit präsenter. Inzwischen ist eine Medienpartnerschaft entstanden, und es besteht der gegenseitige Wille, die hier formulierte Botschaft hinauszutragen. In der Ausstellung selbst werden die Funktion des Heimatschutzes und seine Haltung zum Verbandsbeschwerderecht thematisiert.
Wie stehen Sie persönlich dazu?
Ich finde es grossartig, dass die Schweiz die Möglichkeit bietet, sich auf diese Art politisch einzubringen. Klar, dieses Rechtsmittel verzögert die
Le fait que la conservation du patrimoine ait temporairement trouvé un foyer au S AM peut-il être interprété comme un geste programmatique?
Assurément. L’idée de faire quelque chose pour le Jubilé de l’Année européenne du patrimoine a été proposée il y a plusieurs années déjà par Silke Langenberg, qui occupe la chaire de patrimoine bâti et de conservation des monuments à l’ETH Zurich. Nous l’avons suivie et nous sommes demandé comment, en tant que musée d’architecture, nous pourrions replacer ce thème dans un contexte plus large. Nous avons finalement opté pour la relation entre architecture et conservation des monuments. La présente exposition dresse un inventaire.
Quand un bâtiment devient-il un monument?
Vaste question! Je m’en tiens à une réponse classique pour m’en sortir. Un monument est un objet qui, après une génération (30 ou 40 ans), reste jugé important en termes de culture du bâti. C’est un témoin d’une époque qui montre comment on construisait et vivait en ce temps-là. Selon sa force d’expression, un objet plus récent peut déjà être considéré comme un monument, mais souvent les qualités ne deviennent perceptibles que plus tard. La difficulté de cette vision classique, c’est le rythme d’aujourd’hui. II est bien possible qu’un bâtiment qui pourrait être considéré dans 40 ou 50 ans
«Gut möglich, dass ein Gebäude, das in 40 oder 50 Jahren als Denkmal gelten könnte, bis dahin längst verschwunden ist.»
«II est bien possible qu’un bâtiment qui pourrait être considéré dans 40 ou 50 ans comme un monument historique ait disparu bien avant.»
Abläufe und fordert etwas Geduld. Darauf zu verzichten, fände ich aus demokratiepolitischen Gründen als nicht angebracht.
In Basel lebten und kämpften in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zwei Persönlichkeiten, die sich fürs Bauen im Bestand und für die Stadtentwicklung engagiert haben: Lucius und Annemarie Burckhardt. Sie nehmen in der Ausstellung mit ihrem verlorenen Kampf gegen den Abriss des Stadttheaters Basel sowie mit der Tagung «Denkmalpflege ist Sozialpolitik» im Denkmalschutzjahr nur einen kleinen Raum ein. Aber ihr Denken war beim Konzipieren stets präsent. Burckhardts Schriften werden nach wie vor sehr stark rezipiert und haben dadurch auch entsprechend ihre Wirkung. Er war ein Vordenker, der vor 50 Jahren Themen angesprochen hat, die heute noch relevant sind.
Sie haben japanische Wurzeln, sind in den USA geboren und haben dort studiert. Sie haben dann in Berlin gelebt und gearbeitet. Seit 2018 sind Sie Kurator im S AM. Was wollen Sie hier bewegen und bewirken? Wenn ich Ziele und Absichten formuliere, dann spreche ich auch ein wenig über die Intentionen dieses Museums. Mit unseren Ausstellungen und Publikationen wollen wir auf die Relevanz von Architektur aufmerksam machen und Diskussionen auslösen, nicht nur unter Fachleuten, sondern in der breiten Gesellschaft. Denn was gebaut wird, beeinflusst unser Leben! Andererseits möchten wir Ausstellungen machen, die nicht nur die grossen Namen feiern, sondern auch weniger sichtbare oder diskutierte Themen ansprechen und experimentellen oder jüngeren Positionen eine Plattform geben.
comme un monument historique ait disparu bien avant. Une autre difficulté de cette définition vient du fait que, pour nombre de personnes, un monument peut signifier autre chose. Il y a des constructions qui ne sont pas dignes de protection en raison de leur valeur architecturale, mais parce qu’elles ont une valeur émotionnelle pour un groupe particulier. Et parfois, déterminer si un objet mérite d’être adoubé comme monument dépend tout simplement de la société.
Nous menons cet entretien dans la quatrième salle de l’exposition, rebaptisée «Denk Mal Bar». Les visiteurs ont la possibilité de lancer des idées via un code QR. Le font-ils? Assez modestement. Je suppose que cela suscite des inhibitions un peu plus fortes que les autres propositions, davantage utilisées par les visiteurs, même au-delà de nos attentes. Les trois débats déjà organisés ont fait le plein de participants. Je suis toujours surpris de voir qui vient au Bar. Chaque hôte amène son propre réseau, ce qui contribue à élargir les thématiques abordées. La curiosité et l’ouverture sont grandes. Nous constatons que la conservation du patrimoine bâti inspire souvent des images simplificatrices qui n’ont rien à voir avec la réalité. Nous en discutons ici. Des propriétaires d’anciennes maisons se sont déjà adressés à nous pour savoir ce qu’ils pourraient faire. Le cadre informel du Bar est à l’évidence propice à la détente et à la liberté de parole.
Les thèmes présentés dans l’exposition ou débattus dans le «Denk Mal Bar», sont aussi ceux de Patrimoine suisse. Sous quelle forme l’association a-t-elle été impliquée?
L’intérêt de Patrimoine suisse à ce sujet est très grand. Si nous étions entrés en
Mehr erfahren: Unter heimatschutz.ch/interview findet sich eine ausführliche Version des Gesprächs. Darin erzählt Yuma Shinohara unter anderem, wie Architektinnen und Denkmalpfleger auf die Ausstellung reagiert haben und wie die Diskussion über die Museumswände hinaus weitergeht.
Pour en savoir plus: la version complète de l’entretien est publiée sous patrimoinesuisse.ch/interview. Yuma Shinohara y explique entre autres comment les architectes et les conservatrices et conservateurs ont réagi à l’exposition et sous quelle forme le débat engagé se prolongera hors les murs.
contact plus tôt, l’association serait davantage présente dans l’exposition. Entre-temps, nous avons convenu d’une collaboration médiatique et il y a une volonté réciproque de donner un écho aux messages formulés ici. L’exposition elle-même aborde le rôle de Patrimoine suisse et sa position sur le droit de recours des organisations.
À titre personnel, que pensez-vous de ce droit?
Je trouve formidable que la Suisse offre une telle possibilité de participation politique. Il est clair que cet outil juridique retarde les procédures et exige un peu de patience. Mais je trouve que, sur le plan démocratique, il serait inapproprié d’y renoncer.
Durant la seconde moitié du XXe siècle, deux personnalités ayant vécu et milité à Bâle, Lucius et Annemarie Burckhardt, se sont engagées pour la construction dans le bâti existant et pour l’aménagement urbain. Un espace assez modeste leur est accordé dans le cadre de l’exposition – au sujet de leur combat perdu contre la démolition du Stadttheater de Bâle et du colloque «Denkmalpflege ist Sozialpolitik» (la conservation du patrimoine bâti est politique) lors de l’Année européenne du patrimoine architectural 1975. Mais leur pensée a été constamment présente dans la conception de l’exposition. Les écrits de Lucius Burckhardt sont toujours très repris et ont encore de l’impact. Il était un précurseur. Les sujets qu’il traitait restent pertinents aujourd’hui.
Vous avez des racines japonaises, êtes né aux États-Unis et avez étudié là-bas. Vous avez par la suite vécu et travaillé à Berlin. Depuis 2018, vous êtes commissaire au S AM. Que souhaitez-vous changer et accomplir ici? Formuler des intentions, c’est aussi parler un peu de celles du musée. Avec nos expositions et nos publications, nous voulons mettre en valeur l’importance de l’architecture et susciter le débat, pas seulement entre spécialistes, mais également dans le grand public. Car ce qui se construit influence nos vies! Nous voulons aussi faire des expositions qui ne mettent pas seulement à l’honneur des grands noms, mais qui traitent également de sujets moins visibles ou débattus – et offrir une plateforme pour des positions expérimentales ou plus récentes.

EXTRAFAHRT NACH MÜHLEBERG COURSE SPÉCIALE POUR MÜHLEBERG
Natalie Schärer, Redaktorin
Eine «ArchitekTour» ist keine Stadtführung im klassischen Sinn. Das Angebot unserer Regionalgruppe Bern Mittelland führt Kulturinteressierte und Fans von historischen Fahrzeugen zusammen. Die neue Route nach Mühleberg lädt ein zu einer Zeitreise in die Infrastrukturgeschichte – und zurück in die Seventies.
Un «ArchitekTour» n’est pas un tour de ville classique. L’offre de notre groupe régional Berne Mittelland réunit les personnes intéressées par la culture et celles passionnées par les véhicules historiques. Le nouvel itinéraire à destination de Mühleberg invite à un voyage dans l’histoire des infrastructures – et à un retour aux seventies.
Auf Zeitreise im Postauto von 1979: Die «ArchitekTour» nach Mühleberg führt durch die hügelige Landschaft westlich von Bern und spannt dabei einen Bogen zwischen den Themen Brückenbau, Infrastrukturgeschichte und Verkehr. Un voyage dans le passé dans un car postal de 1979: l’«ArchitekTour» mène à travers les paysages vallonnés à l’ouest de Berne jusqu’à Mühleberg, à la découverte de différents thèmes, de la construction des ponts à l’histoire des infrastructures sans oublier les transports. Foto: Natalie Schärer
Die einflügligen Türen schliessen, der Gang rastet ein, und schon setzt sich das historische Postauto mit einem Knattern in Bewegung. Statt eines Linienziels steht auf der Plakette an der Seite des Wagens «Extrafahrt»: Heute fährt es mit rund 20 Personen nach Mühleberg, in die westliche Nachbargemeinde Berns.
Seit 2019 bietet die Regionalgruppe Bern Mittelland des Berner Heimatschutzes gemeinsam mit der Stiftung BERNMOBIL historique und dem Trägerverein Historische Postautolinie sogenannte «ArchitekTouren» an. Mit historischen Bussen geht es in die Berner Vororte Bümpliz und Köniz, wo unterwegs immer wieder halt gemacht wird, um in die Geschichte dieser Stadtteile einzutauchen. Neu seit diesem Jahr führen die Touren auch weiter in den Westen: Mit einem Postauto von 1979 geht es auf den Spuren von Verkehrsund Energieinfrastrukturen nach Allenlüften, Gümmenen und Mühleberg.
Noch vor dem ersten Halt zieht das Fahrzeug selbst den Fokus auf sich. Der Hochflur-Reisewagen Saurer RH 525-23 wurde in Arbon am Bodensee gefertigt. Er zählt zu einer Serie von knapp 340 Fahrzeugen, die Ende der Siebzigerjahre an die Post ausgeliefert worden sind. Dabei handelte es sich um die grösste Fahrzeugbeschaffung in der Geschichte der Post. «Dieser ‹Rolls-Royce der Alpenpost› war hauptsächlich auf der Strecke Flums–Flumserberg im Einsatz», erzählt Chauffeur Mario Gächter durch das Reiseleitermikrofon, «fuhr aber auch eine Schulklasse bis nach Hamburg.» Der Motor hat eine Leistung von 320 PS – relativ viel für die damalige Zeit – und drei unabhängige Bremssysteme, um auf Alpenpässen sicher eingesetzt werden zu können.
Drei Brücken aus drei Zeiten
Die Fahrt führt nach Gümmenen, einem Verkehrsknotenpunkt seit dem frühen Mittelalter. Die hölzerne Gümmenenbrücke über die Saane aus dem Jahr 1739 zählt zu den ältesten erhaltenen Holzbrücken im Kanton Bern. Schanzen und Dämme erinnern bis heute an die strategische Bedeutung dieses Übergangs, der streng überwacht war. Fuhrleute mussten Zollabgaben entrichten, um die Brücke passieren zu dürfen. «Für Vielfahrende gab es ein Abonnementsystem, wie wir es heute aus dem ÖV kennen», erklärt Anne-Catherine Schröter, Co-Präsidentin der Regionalgruppe Bern Mittelland, und zeigt auf das Zollhaus am Brückenende. Mit dem zunehmenden Autoverkehr entstand 1959 eine neue Parallelbrücke. Ein Glücksfall, meint Schröter, denn so blieb die alte Brücke für Fussgänger und Velofahrerinnen erhalten.
Nur einen Steinwurf entfernt spannt sich das Saaneviadukt von 1901, Teil der Eisenbahnverbindung zwischen Bern und Neuenburg, über das Saanetal. Der Ingenieur Albin Beyeler zeichnete die Streckenpläne für dieses imposante Bauwerk auf eigene Kosten und hat sogar eine Tagung im Historischen Museum Bern organisiert, um Geldgeber zu gewinnen. Seine Konstruktion ist so solide, dass sie auch mit heutigen Anforderungen Schritt halten kann.
Nicht weniger beeindruckend ist das Viadukt Marfeldingen, eine Autobahnbrücke der A1, die zwischen 1974 und 1976 entstanden ist. Man entschied sich für eine Hohlkastenbrücke in Vorschubtechnik, eine für die damalige Zeit revolutionäre Bauweise. Gebaut wurde die Brücke Abschnitt für Abschnitt, indem sie über ihre eigenen Pfeiler vorgeschoben wurde – ganz ohne Gerüst im Gelände. Trotz ihrer Grösse wirkt die Brücke erstaunlich leicht: Die schlanke Fahrbahn-
Le chauffeur ferme les portes à un battant et passe la première vitesse. Le car postal s’ébranle avec un frémissement. En guise de destination, le panneau sur le côté affiche «Extrafahrt»: aujourd’hui, le car emmène une vingtaine de passagers à Mühleberg, une commune voisine à l’ouest de Berne.
Depuis 2019, le groupe régional Berne Mittelland de Patrimoine suisse Berne propose des «ArchitekTouren», en collaboration avec la fondation BERNMOBIL historique et l’association Historische Postautolinie. À bord de bus historiques, les parcours conduisent vers les faubourgs bernois de Bümpliz et Köniz, avec de nombreux arrêts permettant de plonger dans l’histoire de ces quartiers. Depuis cette année, les tours gagnent l’ouest de l’agglomération: un car postal de 1979 invite à découvrir les témoins des infrastructures de transport et d’énergie à Allenlüften, Gümmenen et Mühleberg. Avant le premier arrêt, c’est le car qui retient l’attention. Ce Saurer RH 525-23, à plancher surélevé, a été construit à Arbon, au bord du lac de Constance. Il fait partie d’une série de 340 unités qui ont été livrées à la fin des années 1970 à La Poste. Il s’agissait de la plus grosse commande dans l’histoire de la régie. «Cette ‹Rolls-Royce de la poste alpine› circulait principalement sur la ligne Flums-Flumserberg, précise le chauffeur Mario Gächer au micro, mais elle a aussi transporté une classe jusqu’à Hambourg.» Le car est équipé d’un moteur de 320 chevaux, une puissance respectable à l’époque, et de trois circuits de frein indépendants afin de circuler en toute sécurité sur les routes des cols alpins.
Trois ponts d’époques différentes
Le trajet mène à Gümmenen, nœud de communication depuis le haut Moyen Âge. Le pont en bois sur la Sarine date de 1739 et compte parmi les plus anciens préservés dans le canton de Berne. Les fortifications et les remblais témoignent aujourd’hui encore de l’importance stratégique de ce passage qui était étroitement surveillé. Les cochers devaient s’acquitter d’un droit de péage avant de franchir le pont. «Pour les habitués, il y avait un système d’abonnement, analogue à ce que nous connaissons dans les transports publics», explique Anne-Catherine Schröter,

Das Saaneviadukt spannt sich in schwindelerregender Höhe über die Ebene und endet in einem aufgeschütteten Damm. Le viaduc ferroviaire de la Sarine domine la plaine à une hauteur vertigineuse et se prolonge par des talus élevés.
Natalie
Schärer

Im Vordergrund das Wasserkraftwerk Mühleberg am aufgestauten Wohlensee, im Hintergrund das Atomkraftwerk
Au premier plan, l’usine hydroélectrique de Mühleberg ferme le Wohlensee, à l’arrière-plan la centrale nucléaire.
platte und die weiten Stützenabstände von 60 Metern verleihen ihr eine filigrane Eleganz. Im Schatten dieser Konstruktion fährt das Postauto weiter – vorbei an alten Panzersperren aus dem Kalten Krieg und Richtung Aare, wo Energieinfrastrukturen warten.
Von der Energiekrise zum Atomausstieg
Das Wasserkraftwerk Mühleberg steht exemplarisch für eine Epoche, in der Energie zur strategischen Ressource geworden ist. Die Strommangellage während des Ersten Weltkriegs beschleunigte den Bau, und der Wohlensee wurde ab 1920 gestaut. Die Bernische Kraftwerke AG beauftragte den in ihrem Verwaltungsrat sitzenden Architekten Walter Bösiger für die architektonische Hülle des Kraftwerks.
Unweit davon steht das 1972 in Betrieb genommene Atomkraftwerk Mühleberg, das erste und einzige im Kanton Bern. Die Nähe zu bereits vorhandenen Infrastrukturen des Wasserkraftwerks, zur Stadt Bern als Stromverbraucherin und zur Aare sprachen für den Standort. «Was sofort auffällt: Der Kühlturm fehlt!», betont Architekt Simon Teutsch, Vorstandsmitglied der Regionalgruppe. «Beznau und Mühleberg sind die einzigen Kraftwerke der Schweiz mit direkter Flusskühlung», ergänzt er. Diese erwies sich wegen der Erwärmung der Flüsse jedoch bald als ökologisch problematisch, sodass alle neuen Werke mit Kühltürmen ausgestattet werden mussten. Der wachsende Widerstand gegen die Kernenergie und der Reaktorunfall von Fukushima 2011 mündeten im politischen Entscheid zum schrittweisen Atomausstieg, und 2019 wurde das Atomkraftwerk Mühleberg als erstes in der Schweiz vom Netz genommen. Seither ist offen, ob die Anlagen künftig auf die grüne Wiese rückgebaut, ob sie industriell weitergenutzt oder als Erinnerung an das Atomzeitalter erhalten werden.
coprésidente du groupe régional Berne Mittelland, en montrant la guérite du péage. Avec l’augmentation du trafic, un pont routier a été construit à côté en 1959, une chance pour l’ouvrage en bois qui a été préservé pour les cyclistes et les piétons.
Datant de 1901, le viaduc ferroviaire s’élève à un jet de pierre. Ce pont enjambant la vallée de la Sarine fait partie de la ligne Berne-Neuchâtel. L’ingénieur Albin Beyeler en traça les plans à ses propres frais et organisa même un séminaire au Musée d’Histoire de Berne afin de trouver des soutiens financiers. Sa construction est si robuste qu’elle répond encore aujourd’hui aux exigences actuelles.
Le viaduc autoroutier de Marfeldingen n’est pas moins impressionnant. Il a été construit pour l’A1 entre 1974 et 1976. Les ingénieurs ont recouru à une technique révolutionnaire pour l’époque, celle du pont à poutre-caisson. L’ouvrage a été bâti tronçon par tronçon, lesquels étaient poussés sur leurs piliers – en se passant presque d’échafaudages. En dépit de sa taille, le pont paraît étonnamment léger: il doit son élégance aérienne à la minceur du tablier et à la portée de 60 mètres entre les piles. Le car postal poursuit sa route à l’ombre de ce géant, le long d’anciens ouvrages antichar datant de la Guerre froide et en direction de l’Aar, à la découverte d’autres infrastructures, énergétiques cette fois.
De la crise énergétique à l’essor du nucléaire
La centrale hydroélectrique de Mühleberg témoigne de l’époque où l’énergie est devenue une ressource stratégique. La pénurie d’électricité durant la Première Guerre mondiale accéléra sa construction, et le Wohlensee fut endigué dès 1920. Les Forces motrices bernoises chargèrent l’architecte Walter Bösiger, membre de son conseil d’administration, de dessiner l’enveloppe de la centrale.
Mit dieser Frage steigen alle wieder ins Postauto, jenes Fahrzeug, das einst die Kraftwerksarbeiter zu ihrem Arbeitsort transportiert hat. Heute chauffiert es die Mitreisenden zurück nach Bern und verabschiedet sich mit einem Ton, den alle kennen: dem ikonischen Dreiklanghorn. Streng genommen darf dieses «Dü-Da-Do» nur auf Bergpoststrassen erklingen –doch bei dieser besonderen Fahrt macht der Wagenlenker eine Ausnahme.
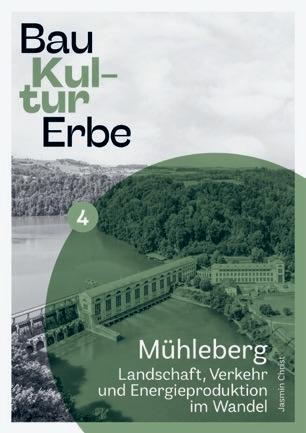
Mühleberg – Landschaft, Verkehr und Energieproduktion im Wandel
Jasmin Christ, 168 Seiten, Verkaufspreis: CHF 20.–Bestellen unter bau-kultur-erbe.ch
Heimat verbindet
Ihr Vermächtnis – eine Erbschaft oder ein Legat – legt den Grundstein für die Zukunft.
Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, diese für kommende Generationen zu bewahren.
Bestellen Sie unsere Unterlagen oder kontaktieren Sie unseren Geschäftsführer David Vuillaume. Er berät Sie gerne persönlich: T 044 254 57 00.

Non loin de là s’élève la centrale nucléaire de Mühleberg. Mise en service en 1972, elle est la première et la seule installation de ce type dans le canton de Berne. La proximité des infrastructures de l’usine hydroélectrique, de la ville de Berne et de ses besoins en électricité plaidèrent en faveur de ce site. «Ce qui frappe immédiatement, c’est qu’il n’y a pas de tour de refroidissement!», souligne l’architecte Simon Teutsch, membre du comité du groupe régional. «Beznau et Mühleberg sont les seules centrales nucléaires de Suisse qui sont refroidies directement par un cours d’eau», précise-t-il. Cette solution s’avéra rapidement problématique d’un point de vue écologique en raison du réchauffement de la rivière. Par conséquent, toutes les nouvelles installations furent équipées de tours de refroidissement. La résistance croissante au nucléaire et l’accident de la centrale de Fukushima en 2011 poussèrent à la décision de sortie progressive du nucléaire. En 2019, la centrale de Mühleberg a été la première à être mise hors service en Suisse. Depuis, la question reste ouverte: les installations seront-elles démantelées et rendues à la verdure, converties en zone industrielle ou préservées comme témoins de l’ère nucléaire?
Avec cette question en tête, tous les participants remontent dans le car, dans le véhicule qui, autrefois, amenait le personnel de la centrale sur son lieu de travail. Aujourd’hui, l’engin les ramène à Berne et prend congé sur une note bien connue: l’iconique klaxon à trois tons. En principe, ce «Tu-Ta-Tut» ne doit retentir que sur les lignes de montagne mais le chauffeur a fait une exception pour cette course spéciale.


heimatschutz.ch/nachlass



Die Publikation zum Wakkerpreis ist der Gemeinde Poschiavo und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern gewidmet, unter anderem Giacomo Paravicini, Pierluigi Crameri und Elisa-Bontognali (v.l.n.r).
La publication du Prix Wakker est dédiée à Poschiavo ainsi qu’à celles et ceux qui font vivre cette localité, notamment Giacomo Paravicini, Pierluigi Crameri et Elisa Bontognali (de gauche à droite).
POSCHIAVO KENNENLERNEN À LA DÉCOUVERTE DE POSCHIAVO
Die Gemeinde Poschiavo erhält den Wakkerpreis 2025. In einer Begleitpublikation beleuchtet der Schweizer Heimatschutz die Gründe für die Auszeichnung, die Entwicklung der Region und porträtiert einige der vielen in der Gemeinde engagierten Personen.
Die periphere Berggemeinde entwickelt ihren historischen Baubestand und die Kulturlandschaft nachhaltig weiter. Durch die infrastrukturelle Unabhängigkeit und das vielfältige Kulturangebot setzt sich Poschiavo für eine hohe Lebensqualität ein und wirkt so der Abwanderung entgegen. Dieses proaktive und umsichtige Vorgehen ist bemerkenswert und vorbildlich für Schweizer Bergregionen. Die neue Publikation des Schweizer Heimatschutzes beleuchtet planerische, historische und gesellschaftliche Themen und porträtiert einige der vielen in der Gemeinde engagierten Personen. Das beigelegte Faltblatt lädt zu einem Spaziergang ein, auf dem an neun Stationen wichtige Merkpunkte in Poschiavo erlebt werden können. Dieser ist auf heimatschutz.ch/ rundgaenge auch digital verfügbar.
Das Faltblatt sowie die handliche Begleitpublikation sind bestellbar im Shop des Heimatschutzes.
heimatschutz.ch/shop
Poschiavo reçoit le Prix Wakker 2025. Dans une publication accompagnant cette distinction, on découvre les motifs de l’attribution du prix, les grands axes du développement de la région ainsi que les portraits de quelques-unes des nombreuses personnes qui s’investissent dans la commune.
Poschiavo développe son patrimoine bâti et son paysage culturel de manière durable. Grâce à son indépendance en matière d’infrastructures et à une offre culturelle diversifiée, cette commune de montagne périphérique œuvre pour une qualité de vie élevée et lutte ainsi contre l’exode de la population. Sa démarche proactive et réfléchie est remarquable, faisant d’elle un modèle pour les régions de montagne en Suisse. La nouvelle publication de Patrimoine suisse met en lumière des thèmes urbanistiques, historiques et sociétaux, et dresse le portrait de quelques-unes des nombreuses personnes qui s’investissent dans la commune. Le dépliant joint invite en outre à une promenade, permettant de découvrir Poschiavo en neuf étapes marquantes. Ce parcours peut également être consulté en ligne sous patrimoinesuisse.ch/promenades.
Le dépliant et la publication consacrée à la lauréate peuvent être commandés dans la boutique de Patrimoine suisse.
patrimoinesuisse.ch/boutique
Maria Svitlychna



Sabrina Németh (links) und Muriel Thalmann sind neu im Vorstand des Schweizer Heimatschutzes. Mit grossem Dank verabschiedet wurde das langjährige Vorstandsmitglied Benedetto Antonini.
Sabrina Németh (à gauche) et Muriel Thalmann ont été élues au comité de Patrimoine suisse. De chaleureux remerciements ont été adressés à Benedetto Antonini, membre de longue date, à l’occasion de son départ du comité.
GROSSE FEIER IN BASEL UNE GRANDE FÊTE À BÂLE
Wahlen und Verabschiedungen standen bei der Delegiertenversammlung des Schweizer
Heimatschutzes am 28. Juni 2025 in Basel im Vordergrund. Am Nachmittag folgte die feierliche Verleihung des Schulthess Gartenpreises im Kannenfeldpark.
Dieses Jahr fand die Delegiertenversammlung des Schweizer Heimatschutzes in Basel statt. Es wurden zwei neue Mitglieder in den Vorstand des Schweizer Heimatschutzes gewählt: die Tessiner Architektin Sabrina Németh und Muriel Thalmann, die Präsidentin der Waadtländer Sektion. Die Delegiertenversammlung verabschiedete zudem Benedetto Antonini und sprach ihm ihre ganze Dankbarkeit für sein langjähriges engagiertes Wirken im Vorstand aus. Ausserdem wurde Rahel Marti, Co-Leiterin der Stiftung Landschaftsschutz, und Benedikt Wechsler, UNESCO-Botschafter in Paris, als neue Fachvertreterin bzw. neuer -vertreter gewählt und Raimund Rodewald zum Abschied ganz herzlich für sein wertvolles und langjähriges Engagement als Fachvertreter des Schweizer Heimatschutzes gedankt.
Am Nachmittag folgte die offizielle Verleihung des Schulthess Gartenpreises 2025 an die Stadt Basel für die Qualität der Pflege, des Unterhalts und der Weiterentwicklung des Kannenfeldparks. Die behutsame Weiterentwicklung des Parks, der ursprünglich als Friedhof angelegt und ab 1951 umgestaltet worden ist, zeigt exemplarisch, wie sich gartenkulturelles Erbe mit den heutigen Bedürfnissen eines dichten Stadtquartiers in Einklang bringen lässt.
Élections et départs ont marqué l’assemblée des délégués de Patrimoine suisse, qui s’est tenue le 28 juin 2025 à Bâle.
L’après-midi, la cérémonie officielle de remise du Prix Schulthess des jardins s’est déroulée dans le Kannenfeldpark.
Cette année, l’assemblée des délégués de Patrimoine suisse s’est tenue à Bâle. À cette occasion, deux nouvelles membres ont été élues au comité de Patrimoine suisse: Sabrina Németh, architecte tessinoise, et Muriel Thalmann, présidente de la section vaudoise de Patrimoine suisse. L’assemblée a également salué le départ de Benedetto Antonini, en lui exprimant toute sa reconnaissance pour son engagement de longue date au sein du comité. Par ailleurs, Rahel Marti, codirectrice de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, et Benedikt Wechsler, ambassadeur de la Suisse auprès de l’UNESCO à Paris, ont été élus comme nouveaux représentants des milieux spécialisés. Un chaleureux hommage a été rendu à Raimund Rodewald pour son précieux engagement et ses nombreuses années de service comme représentant des milieux spécialisés au sein de Patrimoine suisse.
L’après-midi a été marqué par la remise officielle du Prix Schulthess des jardins 2025 à la ville de Bâle pour la qualité de la conservation, de l’entretien et du développement du Kannenfeldpark. L’évolution consciencieuse de ce parc, anciennement un cimetière transformé dès 1951, démontre comment concilier préservation du patrimoine et besoins contemporains d’un quartier urbain dense.
Tanja Schätti, Schweizer Heimatschutz


Bei schönstem Wetter fanden gut besuchte Führungen und der Festakt zur Verleihung des Schulthess Gartenpreises an die Stadt Basel statt. Par un temps radieux, des visites guidées très suivies et la cérémonie de remise du Prix Schulthess des jardins à la ville de Bâle ont rencontré un franc succès.

Esther Keller, Regierungsrätin Kanton Basel-Stadt, Marc Keller, Präsident Basler Heimatschutz, Susanne Winkler, Leiterin Fachstelle Gartendenkmalpflege Stadtgärtnerei Basel, Emanuel Trueb, Leiter Stadtgärtnerei Basel, Claudia Moll, Präsidentin der Kommission für den Schulthess Gartenpreis, Beat Schwabe, Vizepräsident Schweizer Heimatschutz, und David Vuillaume, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz (v.l.n.r.)
Tanja
Schätti, Schweizer
Heimatschutz
Tanja Schätti, Schweizer Heimatschutz

DES ATTAQUES POLITIQUES COURTCIRCUITENT L’AMÉLIORATION DE L’ISOS
POLITISCHE ANGRIFFE TORPEDIEREN VERBESSERUNG DES ISOS
La protection des sites construits subit des pressions politiques. Les problèmes d’application directe de l’ISOS peuvent être résolus. Malgré cela, les attaques contre cet instrument unique se poursuivent.
Depuis sa fondation en 1905, Patrimoine suisse s’engage pour le maintien et le soin des sites exceptionnels dans leur ensemble. L’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) est un instrument unique en son genre. Il permet aux autorités en charge de la construction et de l’aménagement du territoire de reconnaître et de sauvegarder les valeurs culturelles du bâti en les prenant en compte suffisamment tôt.
Table ronde sur l’ISOS L’ISOS est sous pression, raison pour laquelle l’Office fédéral de la culture a invité Patrimoine suisse ainsi que des représentants de services publics spécialisés et d’associations de la société civile à une table ronde sur l’ISOS. La critique selon laquelle l’ISOS serait un instrument d’obstruction ne nous semble
Der Ortsbildschutz steht unter politischem Druck. Probleme der Direktanwendung des ISOS lassen sich lösen. Trotzdem halten die Angriffe auf dieses einmalige Planungsinstrument an.
Der Schweizer Heimatschutz setzt sich seit seiner Gründung 1905 dafür ein, dass den einmaligen Ortsbildern in ihrer Gesamtheit Sorge getragen wird. Ein einzigartiges Instrument hierfür ist das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS). Bei frühzeitiger Berücksichtigung dient es den Behörden des Bauund Planungswesens zur Erkennung und Sicherung baukultureller Werte.
Runder Tisch ISOS
Das ISOS steht unter Druck, weshalb das Bundesamt für Kultur den Schweizer Heimatschutz zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern öffentlicher Fachstellen sowie weiterer zivilgesellschaftlicher Verbände zu einem runden Tisch ISOS eingeladen hat. Der Schweizer Heimatschutz hat sich der Kri-
Neunkirch (SH): un ensemble médiéval harmonieux et un site d’importance nationale Neunkirch (SH): eine mittelalterliche Anlage aus einem Guss und ein Ortsbild von nationaler Bedeutung
Gataric Fotografie
pas pertinente. Nous estimons que des corrections sont certes nécessaires dans certains cas, d’autant plus que l’application directe de l’ISOS est parfois difficilement compréhensible. De manière générale, l’application directe remplit cependant parfaitement son rôle. Sans l’application directe de l’ISOS, des sites et des paysages très importants et d’une grande beauté auraient été perdus à jamais dans de nombreux cas.
Cela dit, pour résoudre les problèmes d’application, la table ronde a formulé des propositions adaptées. Depuis mai 2025, elle s’est réunie plusieurs fois pour élaborer des mesures susceptibles d’améliorer l’application pratique de l’ISOS. Ces mesures comprennent notamment la limitation de l’application directe de l’ISOS, la clarification des dispositions relatives aux tâches cantonales et communales et le renforcement des processus et des procédures visant à une application efficace de l’ISOS. Le rapport de la table ronde sur l’ISOS sera soumis à la cheffe du DFI et au chef du DETEC. Ceux-ci décideront de la suite du processus.
Avec les représentants des services fédéraux, des cantons, des villes et des communes, ainsi que des organisations engagées pour la culture du bâti, nous réaffirmons ainsi le caractère unique et l’importance de la protection des sites construits, et nous soutenons les solutions viables, durables et rapides proposées par la table ronde. Alors que ce processus de dialogue constructif visant à améliorer la mise en œuvre de l’ISOS est en cours, des attaques politiques extrêmes tentent cependant de le court-circuiter.
L’ISOS comme bouc émissaire
Le fait qu’une motion parlementaire soit déposée durant ce processus pour augmenter la pression politique n’est certes pas très élégant, mais c’est le jeu politique. Mais cette motion (Würth) va plus loin: elle est une attaque frontale, violente, sans concession, avec pour objectif d’abolir purement et simplement la protection des sites au niveau national. Au lieu de préciser les tâches de la Confédération et de simplifier les modalités de collaboration, elle veut changer la Constitution, elle contredit les principes éprouvés de l’aménagement du territoire et surtout elle veut abandonner la vision nationale qui a permis à la Suisse de conserver ses sites exceptionnels et ses paysages de grande beauté. En plus de supprimer les prérogatives de la Confédération dans le domaine de la protection des sites d’importance nationale, la motion amènerait des années d’insécurité juridique.
La motion Würth a été adoptée par le Conseil des États. Nous sommes déconcertés par cette décision. Nous espérons ainsi que les membres du Conseil national choisiront de ne pas donner suite à une motion qui ne résout aucun problème mais en crée de nouveaux.
Il est exaspérant de voir les politiques utiliser l’ISOS comme un bouc émissaire pour tous les problèmes de construction. L’ISOS n’est pas un problème mais bien une solution. L’ISOS protège les plus beaux sites de Suisse, ceux qui font l’identité de notre pays et sa qualité de vie.
Et «protéger» ne signifie pas mettre sous cloche. Il y a une définition dynamique de la protection du patrimoine: faire vivre et faire évoluer, tout en veillant à ce que l’histoire reste lisible pour les générations futures et que la qualité des espaces publics reste élevée. C’est pour cela que nous nous engageons, dans l’intérêt de nos membres et donateurs, mais aussi au service de toute la population.
David Vuillaume, secrétaire général de Patrimoine suisse
tik, das ISOS sei ein Instrument der Verhinderung, nicht verschlossen. In Einzelfällen besteht Korrekturbedarf, zumal die Direktanwendung des ISOS manchmal schwer nachvollziehbar ist. Generell ist die Direktanwendung jedoch nicht deplatziert. Ohne die ISOS-Direktanwendung wären in vielen Fällen sehr wichtige und wunderschöne Orts- und Landschaftsbilder für immer verloren gegangen.
Dennoch hat der runde Tisch geeignete Vorschläge für die Lösung von Anwendungsproblemen. Er hat seit Mai 2025 in mehreren Sitzungen mögliche Massnahmen erarbeitet, die eine Verbesserung der praktischen Anwendung des ISOS bezwecken. Zu diesen Massnahmen zählen die Beschränkung der Direktanwendung des ISOS, die Klärung der Bestimmungen bei kantonalen und kommunalen Aufgaben und die Stärkung von Prozessen und Verfahren zur effizienten Anwendung des ISOS. Der Bericht zum runden Tisch ISOS wird nun den Departementsvorstehenden des EDI und des UVEK vorgelegt. Diese werden das weitere Vorgehen beschliessen. Mit den Vertreterinnen und Vertretern der Bundesstellen, der Kantone, Städte und Gemeinden sowie der Organisationen, die sich mit Baukultur beschäftigen, bekräftigen wir so die Einzigartigkeit und Wichtigkeit des Ortsbildschutzes, und vor allem unterstützen wir die praktikablen, nachhaltigen und schnellen Lösungen, die der runde Tisch vorschlägt. Während dieser konstruktive Dialog zur Verbesserung der Anwendung des ISOS im Gange ist, versuchen jedoch kompromisslose politische Kräfte, diesen zu unterlaufen.
Das ISOS als Sündenbock Dass während des Prozesses um den runden Tisch eine parlamentarische Motion eingereicht worden ist, um den politischen Druck auf das ISOS zu erhöhen, ist nicht sehr elegant; aber so funktioniert das politische Spiel. Diese Motion (Würth) geht jedoch sehr weit: Sie ist ein frontaler, heftiger Angriff mit dem Ziel, den Ortsbildschutz auf nationaler Ebene schlicht und einfach abzuschaffen. Anstatt die Aufgaben des Bundes zu präzisieren und die Modalitäten der Zusammenarbeit zu vereinfachen, will sie die Verfassung ändern. Die Motion widerspricht den bewährten Grundsätzen der Raumplanung, und vor allem will sie die nationale Vision aufgeben, die es der Schweiz ermöglicht hat, ihre aussergewöhnlichen Orte und ihre schönen Landschaften zu erhalten. Abgesehen davon, dass die Motion die Kompetenz des Bundes im Ortsbildschutz von nationaler Bedeutung aufheben würde, würde sie jahrelange Rechtsunsicherheit mit sich bringen.
Der Ständerat hat die Motion bereits angenommen. Diese Entscheidung ist befremdlich. Wir hoffen, dass die Mitglieder des Nationalrats diesen Antrag, der keine Probleme löst, sondern neue schafft, nicht weiterverfolgen.
Es ist irritierend, dass in der Politik das ISOS als Sündenbock für alle Probleme im Bauwesen herhalten muss. Das ISOS ist grundsätzlich kein Problem, sondern eine Lösung. Das ISOS schützt die schönsten Orte der Schweiz, die die Identität unseres Landes und seine Lebensqualität ausmachen. Und «schützen» bedeutet nicht, unter eine Glasglocke zu stellen. Es gibt eine dynamische Definition von Denkmalschutz: mit Leben füllen und weiterentwickeln – aber die Geschichte muss für künftige Generationen lesbar und die Qualität des öffentlichen Raums hoch bleiben. Dafür setzen wir uns ein, im Interesse unserer Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner – und im Dienst der ganzen Bevölkerung.
David Vuillaume, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz
SIBYLLE HEUSSER (24. 4. 1942–1. 7. 2025)
EINE PIONIERIN DES ORTSBILDSCHUTZES UNE PIONNIÈRE DE LA
PROTECTION DES SITES CONSTRUITS
Nach langer Krankheit ist Sibylle Heusser am 1. Juli von uns gegangen. Wir trauern um einen Menschen, eine Architektin, eine Künstlerin und eine Architekturhistorikerin, die eine grosse Lücke hinterlässt. Sie hinterlässt jedoch ein enormes Vermächtnis, von dem die ganze Schweiz profitiert hat und hoffentlich auch weiterhin profitieren wird: das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung – ISOS.
Über 20 Jahre lang ist Sibylle unermüdlich durch unser Land gereist, um alle schützenswerten historischen Siedlungen zu finden, gegebenenfalls zu inventarisieren und für jede einzelne davon die beste Möglichkeit zu empfehlen, sie an künftige Generationen weiterzugeben.
Um diese gigantische wissenschaftliche Arbeit zu bewältigen, die vom Bundesrat in Auftrag gegeben und vom Bundesamt für Kultur geleitet worden ist (vgl. Seite 12 in diesem Heft), hat die Autorin zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Autorität und Menschlichkeit zum zentralen Ziel geführt, nämlich alle Siedlungen trotz ihrer extrem unterschiedlichen historischen Ursprünge, ihrer Grösse und ihrer Lage mit einer einheitlichen Methode zu erfassen und zu bewerten.
Après une longue maladie, Sibylle Heusser nous a quittés le 1er juillet dernier. Nous pleurons la perte d’une personne, d’une architecte, d’une artiste et d’une historienne de l’architecture, dont l’absence laissera un grand vide. Elle nous laisse toutefois un héritage considérable dont toute la Suisse a bénéficié et continuera, espérons-le, de bénéficier: l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
Pendant plus de 20 ans, Sibylle a parcouru sans relâche notre pays à la recherche de tous les sites historiques dignes de protection, afin de les recenser lorsque cela s’avérait nécessaire et de recommander pour chacun la meilleure manière de le transmettre aux générations futures.

Pour mener à bien ce travail scientifique monumental, commandé par le Conseil fédéral et placé sous la direction de l’Office fédéral de la culture (voir page 12), l’autrice a su guider de nombreux collaborateurs, avec autorité et humanité, vers un objectif commun: documenter et évaluer tous les types de localités, malgré la diversité de leurs origines historiques, de leur taille et de leur situation géographique, selon une méthode unifiée.
Ein trauriger Zufall will es, dass gerade in diesen Tagen im Parlament darüber diskutiert wird, ob die Rechtswirksamkeit des ISOS aufgehoben werden soll oder nicht. Wir sind der Meinung, dass es eines der nützlichsten und wirksamsten Instrumente zum Schutz der Geschichte und der Kulturlandschaft der Schweiz darstellt.
Sibylle Heusser war jedoch nicht nur eine Architektin, die sich für den Schutz und die Aufwertung der Baukultur engagierte, sondern die auch in vielen eidgenössischen Gremien und Architekturwettbewerben tätig war. Als Mitglied der Kommission für den Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes trug Sibylle Heusser von 1999 bis 2014 wesentlich zum Renommee dieser seit 1972 jährlich vergebenen Auszeichnung bei.
Sie war auch Malerin – dieser Tätigkeit widmete sie einen Grossteil ihrer Freizeit. Sie stellte ihre Werke regelmässig in Zürich und gelegentlich auch im Tessin aus. Die letzte Ausstellung (2024) im Gemeindehaus von Bioggio verschaffte ihr grossen Trost, als sie bereits sehr krank war.
Ich hatte das Privileg, seit den Diskussionen über die Bewertung der Tessiner ISOS-Siedlungen in den 1980er-Jahren mit ihr befreundet zu sein. Diese Verbindung war stets sehr bereichernd und intensivierte sich, nachdem sie sich in Tremona niedergelassen hatte. Ihrem Ehemann Peter Rüedi sprechen wir unser tiefes, freundschaftliches Beileid aus.
Benedetto Antonini, für den Vorstand des Schweizer Heimatschutzes
Un triste hasard veut que le Parlement débatte actuellement de la validité juridique de l’ISOS, dont la suppression est envisagée. Nous sommes d’avis qu’il s’agit de l’un des instruments les plus utiles et les plus efficaces pour protéger l’histoire et le paysage culturel de la Suisse.
Sibylle Heusser n’était pas seulement une architecte engagée dans la protection et la valorisation de la culture du bâti, elle a aussi siégé dans de nombreuses instances fédérales et concours d’architecture. En tant que membre de la Commission du Prix Wakker de Patrimoine suisse, elle a largement contribué, de 1999 à 2014, à la renommée de cette distinction décernée chaque année depuis 1972.
Elle était également peintre, une activité à laquelle elle consacrait une grande partie de son temps libre. Elle exposait régulièrement ses œuvres à Zurich et parfois aussi au Tessin. Sa dernière exposition (2024), dans les locaux de la mairie de Bioggio, lui avait apporté un grand réconfort moral, alors qu’elle était déjà très malade.
J’ai eu le privilège d’être son ami depuis les discussions sur l’évaluation des localités tessinoises inscrites à l’ISOS, dans les années 1980. Ces liens ont toujours été très enrichissants et se sont encore intensifiés après son installation à Tremona, hélas, jamais autant que je l’aurais souhaité. À son époux Peter Rüedi, nous adressons nos condoléances les plus sincères et amicales.
Benedetto Antonini, pour le comité de Patrimoine suisse
Rolf Siegenthaler

FERIEN IN DER VILLA ELFENAU VACANCES À LA VILLA ELFENAU
Die 1862 erbaute Villa Elfenau liegt mitten in der Stadt Biel, umgeben vom wildromantischen Elfenau-Park. Sie ist eines von vier neuen Angeboten unserer Stiftung Ferien im Baudenkmal.
Die Villa Elfenau im ehemaligen Industriequartier Pasquart am Schüsskanal blieb über Generationen in Familienbesitz, bis sie 1994 der bekannte Bieler Kunstsammler und Immobilienunternehmer Francis Meyer erwarb. Er bewohnte die Villa mit seiner Familie, später fanden auch seine Kunstsammlungen – Gemälde, Skulpturen und Jugendstil-Glaskunst – in der Villa ihren Platz. Nach seinem Tod im Jahr 2022 wollten seine Erben das imposante Haus der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Ferien im Baudenkmal ermöglicht es, das Haus in seinem historischen Zustand zu erhalten und mit neuem Leben zu füllen.
Neu im Angebot sind seit wenigen Wochen auch das Château d’Anchettes im gleichnamigen Weiler nahe des Dorfs Venthône (VS), die Casa Fontauna aus dem 18. Jahrhundert in Lumbrein (GR) sowie die Hofstätte Hintergasse im Dorfkern von Vaduz, das älteste datierte Bauernhaus des Fürstentums Liechtenstein. Mehr dazu ist auf der Website der Stiftung Ferien im Baudenkmal zu erfahren. Dort gibt es auch einen Einblick in die vielfältigen Aktionen rund um das 20-Jahr-Jubiläum der vom Schweizer Heimatschutz gegründeten Stiftung.
ferienimbaudenkmal.ch
Construite en 1861/62, la Villa Elfenau est située dans le romantique parc Elfenau, au cœur de la ville de Bienne. Elle est l’une des quatre nouvelles offres de notre fondation Vacances au cœur du Patrimoine.
Située dans l’ancien quartier industriel du Pasquart, la Villa Elfenau est restée dans une même famille pendant plusieurs générations, jusqu’à son acquisition en 1994 par le collectionneur d’art et entrepreneur biennois Francis Meyer. Il y vécut avec sa famille, et sa collection d’art – peintures, sculptures, art verrier de style Art nouveau – y trouva aussi sa place. À son décès en mai 2022, la villa revient à sa famille qui, soucieuse de rendre ce lieu d’envergure accessible au public, cherche une solution adaptée. La collaboration avec la fondation Vacances au cœur du Patrimoine permet alors de préserver la maison dans son état historique tout en lui insufflant une nouvelle vie. Depuis quelques semaines, le château d’Anchettes, situé dans le hameau du même nom près du village de Venthône (VS), la Casa Fontauna du XVIIIe siècle à Lumbrein (GR) et la Hofstätte Hintergasse, la plus ancienne ferme datée de la Principauté du Liechtenstein, au cœur de Vaduz, ont également rejoint l’offre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de la fondation Vacances au cœur du Patrimoine. Vous y trouverez également un aperçu des nombreuses activités organisées autour du 20e anniversaire de la fondation.
vacancesaucoeurdupatrimoine.ch
Entschleunigung zwischen Parkidylle und Altstadtflair: die Villa Elfenau in Biel (BE)
Une parenthèse ressourçante entre parc idyllique et charme citadin: la Villa Elfenau à Bienne (BE)

Basel: Passagen – Orte urbaner Qualität heimatschutz-bs.ch und heimatschutz.ch/shop
BASEL
PASSAGEN – ORTE URBANER QUALITÄT
Der Basler Heimatschutz präsentiert in der Reihe «Baukultur entdecken» die neuste Ausgabe Passagen – Orte urbaner Qualität. Die Passagen wurden vornehmlich aus praktischen Gründen errichtet – als Abkürzung durch einen grossen Bau und als zusätzliche Verbindung in der oft lückenlosen Bebauung der Innenstadt, mit dem willkommenen Nebeneffekt zusätzlicher Verkaufsfläche. Es ist höchste Zeit, den historischen Passagen in der Innenstadt mehr Beachtung zu schenken. Sie bieten zahlreiche Chancen, urbanen Raum und urbane Qualitäten wiederzugewinnen, die in Vergessenheit geraten sind. Wenn wieder mehr Leben in die Passagen zurückkehrt, erhöht sich die Lebensqualität der Stadt.
SOLOTHURN
TRIBÜNENKUNST UND FUSSBALLFIEBER

Erleben Sie die ikonische Stadiontribüne Brühl des FC Grenchen 15 aus den 1960erJahren. An verschiedenen Posten mit Vertretungen des Solothurner Heimatschutzes, der Stadt Grenchen, mit Fachleuten aus dem Ingenieurwesen und Funktionären des Fussballvereins können Sie viele Themen selbst erkunden. Sie erhalten Einblick in die statischen Finessen und die architektonischen Feinheiten, in die Baugeschichte, in die jüngst abgeschlossene Sanierung sowie in die Fussballgeschichte des FC Grenchen. Und Sie sind herzlich zum «Doppelpassspiel» und zum Apéro eingeladen.
Tage des Denkmals: «Architekturgeschichten» Sonntag, 14.9.2025, ab 13.30 bis 16.30 Uhr heimatschutz-so.ch
THURGAU
GESCHÄFTSLEITER/IN GESUCHT
Der Thurgauer Heimatschutz setzt sich seit über 100 Jahren für bessere Baukultur und den Erhalt von Ortsbildern und Landschaften ein. Infolge Pensionierung sucht die Sektion per 1. November 2025 oder nach Vereinbarung eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter im Teilpensum von 30 Prozent.
Sie sind Anlaufstelle für Gemeinden, Planer und Private, bearbeiten Baugesuche, machen Objektbegehungen mit den zuständigen Behörden und organisieren Anlässe.
Informationen und Kontakt: heimatschutz.ch/thurgau
PATRIMOINE SUISSE (1905–2025), 120 ANS AU SERVICE DU PATRIMOINE
Le 17 mars 1905 paraissait dans la Gazette de Lausanne un article polémique intitulé «Les Cancers», dénonçant le fort développement industriel et touristique dans la région lémanique et déplorant l’enlaidissement progressif du paysage, alpin en particulier. Ce pamphlet est suivi, la semaine suivante, d’un vibrant appel à la création d’une Ligue pour la beauté. Les deux textes sont de la plume de l’artiste franco-suisse Marguerite Burnat-Provins, alors domiciliée à La Tour-de-Peilz. La démarche de la Vaudoise suscite des réactions enthousiastes. L’initiative est aussitôt soutenue par plusieurs personnalités politiques, artistiques et intellectuelles: Gonzague de Reynold, Émile Bonjour, Ernest Biéler, Adrien Bovy, Daniel BaudBovy, Philippe Godet, Édouard Vallet, Paul Ganz ou encore Ernest Bovet. Sa proposition de constituer une Ligue pour la beauté. Conservation de la Suisse pittoresque aboutit, trois mois plus tard, à la création du Schweizer Heimatschutz. Le président de la Confédération, le Vaudois Marc-Émile Ruchet, s’empresse en effet de constituer à Berne, le 1er juillet 1905, un comité central dont Marguerite Burnat-Provins devient membre fondateur. C’est le début d’un combat sans relâche au service de la défense du patrimoine, un combat qui évoluera au fil des décennies. Berceau de ce mouvement, le canton de Vaud abritera sa section cinq ans plus tard.
La section vaudoise de Patrimoine suisse souhaite commémorer cet acte fondateur et rendre hommage à la pionnière de la défense du patrimoine bâti et paysager en Suisse. Les festivités auront lieu à l’occasion des Journées européennes du pa-
GRAUBÜNDEN
SPLÜGEN, PREISGEKRÖNT
1995 zeichnete der Schweizer Heimatschutz Splügen mit dem Wakkerpreis aus. Zum 30-Jahr-Jubiläum haben der Bündner Heimatschutz und die Gemeinde Rheinwald eine Ausstellung realisiert, die in acht Stationen den Weg Splügens zum Wakkerpreis nachzeichnet und die engen Beziehungen zwischen der Gemeinde und dem Heimatschutz rekonstruiert. Die mit zahlreichen Bild- und Textdokumenten unterlegte Schau führt zurück in die Anfänge der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung der Schweiz und gibt Einblick in die Herausforderungen der Gegenwart.
Ausstellung «Splügen, preisgekrönt» STALL 13, Oberdorf Splügen, bis Sommer 2026: viamala.ch und heimatschutz-gr.ch
trimoine 2025, qui se tiendront les 13 et 14 septembre. Lors de ce week-end, le domaine de La Doges ouvrira ses portes et proposera une trentaine de visites guidées aux thématiques suivantes: «patrimoine bâti», «patrimoine paysager» et «savoirfaire». Ces visites seront menées par des historiennes de l’art, historiens, architectes, architectes paysagistes et restauratrices, entre 10 h et 17 h.

ZÜRICH
SCHUTZWÜRDIGKEIT
DER MAAG-HALLEN KLÄREN
Zu Unrecht hat die Stadt Zürich darauf verzichtet, vor Erteilung einer Baubewilligung die Schutzwürdigkeit der Maag-Hallen zu prüfen, welche seit 2002 als Theaterraum und multifunktionelle Veranstaltungsstätte dienen, so unter anderem als Ausweichspielort für die Tonhalle (heute Lichthalle) von 2017 bis 2021. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat die Beschwerde der Swiss Prime Site Immobilien AG gegen den Entscheid des Baurekursgerichts abgewiesen. Dieses hatte im Mai 2024 dem Zürcher Heimatschutz (ZVH) unter Führung des Stadtzürcher Heimatschutzes (SZH) und der Hamasil Stiftung sowie weiterer Rekurrenten recht gegeben, die eine Schutzabklärung gefordert hatten. Die beiden grossen Eventhallen an der Zahnradstrasse 24 von 1969/70 sowie der Büroturm von 1971 sollten dem Abbruch preisgegeben werden und dem geplanten Grossprojekt der Swiss Prime Site Immobilien AG weichen.
Medienmitteilung vom 16. Juli 2025 heimatschutz-zh.ch
VAUD
Visites au domaine de La Doges Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025 decouvrir-le-patrimoine.ch

EIN SPIEL MIT DEN WELLEN JEUX D’ONDES
Danielle Fischer, Architektin und Fachjournalistin
Wie mag es sich anfühlen, im Inneren einer Geige zu sitzen, wenn der Bogen ansetzt und mit den Saiten der ganze Korpus zu schwingen beginnt? Mit dem neuen Klanghaus am Schwendisee in Wildhaus (SG) ist ein einzigartiger Resonanzraum entstanden, ein begehbares Instrument, das mit seiner besonderen Akustik zu Konzerten und musikalischen Experimenten einlädt. Der sorgfältig gefügte Holzbau schwingt in freier Form – architektonisch wie akustisch.
Quelles seraient nos sensations si nous pouvions nous asseoir à l’intérieur d’un violon, lorsque l’archet effleure les cordes, qu’elles frémissent et que tout le corps de l’instrument se met à résonner? Au bord du Schwendisee, à Wildhaus (SG), la toute nouvelle Klanghaus est une caisse de résonance unique, un instrument à parcourir, dont l’acoustique particulière invite à des concerts et à des expériences musicales. La construction en bois, soigneusement assemblée, vibre en toute liberté, tant sur le plan architectural qu’acoustique.
Eine Architektur, die der Akustik folgt: der Hauptraum des Klanghauses Toggenburg mit geöffneten Toren Une architecture au service de l’acoustique: la salle principale de la Klanghaus du Toggenbourg, portes grandes ouvertes Foto: Roland Bernath
Ein feines Schuppenkleid aus 110 000 handgespaltenen Fichtenschindeln überspannt die Fassade des neuen Zentrums für Naturtonmusik und Klangexperimente in Wildhaus-Alt St.Johann. Hell und regelmässig reihen sich die Holzplättchen aneinander und erinnern an einen riesigen Fisch, der sich am Ufer des Schwendisees in die Höhe schwingt. Doch das einfache Bild täuscht. Die Fassade ist nur die äusserste Konsequenz der aufwendigen inneren Logik des hölzernen Freiformbaus. So mussten zum Beispiel auf den konvex gebogenen Fassadenseiten pro Reihe mehr Schindeln verlegt werden als auf den konkaven. Die Lösung für das regelmässige Bild ist eine Kombination aus mathematischem Knobelspiel und ästhetischem Augenmass. Zusätzlich verlaufen Bänder wellenförmig über die Fassade, in denen die Schindeln leicht versetzt sind. So entsteht ein feines Muster – wie flirrende Klangwellen. Die gewölbten Aussenwände des Baus funktionieren wie ein Amphitheater und fangen die Akustik der Umgebung ein: das Gurgeln des nahen Baches, das Glockengebimmel der Kühe oder die Schritte eines Wanderers. Zwei dieser Aussenbereiche können für das Musizieren vor der alpinen Kulisse mit dem Schafberg, den Churfirsten und dem Gamser Rugg genutzt werden. Die aufwendig gefügten Dachbalken, die horizontal und vertikal unterschiedlich gewölbt sind, sind unter 4200 m2 Dachschalung verdeckt. Daraus ragen kaminartige Zylinder hervor, durch die Tageslicht in den Zentralraum fällt und die für die natürliche Belüftung des Hauses sorgen.
Vom Gedanken zur Gestalt
Die Realisierung des Klanghauses dauerte lange und erfolgte auf Umwegen. 2010 riefen der Architekt Marcel Meili und der Klangkünstler Andres Bosshard das Haus in zehn Thesen im Wettbewerbsverfahren ins Leben. Zuerst überdauerte die Idee einige politische Hindernisse und schliesslich sogar Marcel Meilis Tod im Jahre 2019. Dass das Klanghaus diesen Frühling eröffnet wurde, ist auch Staufer & Hasler Architekten zu verdanken, die nach Meilis Erkrankung ab 2012 in die Planung einstiegen und das Projekt weiterführten. Ursprünglich war geplant, die Räume als Resonanzkörper zu gestalten –mit Schallöffnungen in Form von Musikinstrumenten, inspi-

Une fine robe en écailles faite de 110 000 tavillons en épicéa façonnés à la main recouvre la façade du nouveau centre dédié à la musique harmonique naturelle et aux expérimentations sonores, à Wildhaus-Alt St. Johann. Les petits bardeaux clairs régulièrement alignés font penser à un poisson géant qui s’élève sur la rive du Schwendisee. Mais cette image simple est trompeuse. La façade n’est que la conséquence visible de la logique interne complexe d’une construction en bois de forme libre. Sur les faces aux courbes convexes, il a fallu poser davantage de bardeaux par rangée que sur les courbes concaves. L’image régulière est le fruit de la combinaison d’un casse-tête mathématique et d’une vision esthétique. De plus, des bandes ondulées parcourent la façade, dans lesquelles les tavillons sont légèrement décalés. Il en résulte un motif délicat qui rappelle les ondes sonores. Les parois extérieures incurvées du bâtiment fonctionnent comme un amphithéâtre. Elles capturent l’acoustique de l’environnement: les gargouillis du ruisseau voisin, le tintement des cloches de vache ou les pas des randonneurs. Deux de ces espaces peuvent être utilisés par les musiciens, sur fond de paysage alpin – le Schafberg, les Churfirsten et le Gamser Rugg. La charpente complexe, dont les poutres présentent des courbures différentes à l’horizontale et à la verticale, est couverte sur 4200 m2. En émergent des cylindres qui rappellent les conduits de cheminée: puits de lumière de la pièce principale, ils contribuent également à la ventilation naturelle du bâtiment.
De l’idée à la conception
La réalisation de la Klanghaus a pris du temps et a connu quelques détours. L’architecte Marcel Meili et l’artiste sonore Andres Bosshard lui ont donné naissance à travers dix thèses à la faveur d’un concours. L’idée a dû survivre à quelques obstacles politiques, puis même au décès de Marcel Meili en 2019. Si la Klanghaus a pu ouvrir ses portes au printemps dernier, on le doit aussi au bureau d’architectes Staufer & Hasler, qui a rejoint le processus de planification en 2012 après la maladie de Marcel Meili, et a poursuivi le projet. À l’origine, les espaces devaient être conçus comme des caisses de résonance, avec des ouvertures acoustiques inspirées d’instruments de musique, un concept inspiré du palais Ali Qapu d’Ispahan en Iran. En collaboration avec Meili, Staufer & Hasler ont ensuite transposé cette idée dans leur propre langage formel, en s’appuyant sur des rosaces rappelant celles des ouïes traditionnelles du hackbrett du Toggenbourg ou la broderie ajourée typique de la Suisse orientale.
Le silence de Zwingli et les rosaces
Pour la construction, la priorité a été donnée aux matériaux et aux artisans locaux. Quant à l’architecture, elle suit les principes de l’économie circulaire. Le bois était donc prédestiné à cet effet, comme en témoignent les bâtiments du Toggenbourg vieux de plusieurs siècles. Un exemple historique en témoigne, de l’autre côté du village de Wildhaus. C’est dans une simple et vénérable maison en madriers empilés, dont la forme se distingue radicalement de celle de la Klanghaus, que naquit le réformateur Huldrych Zwingli il y a plus d’un demi-millénaire. Le réformateur, qui lui-même jouait de plusieurs instruments, faisait régner le silence lors des services religieux pour que le chant ne détourne pas l’attention du sermon. On peut se demander ce qu’il penserait des concerts organisés dans la Klanghaus. Mais aussi différentes soient-elles, la maison natale de Zwingli, par ailleurs sans fioritures, et la Klanghaus ont en commun les petites rosaces qui ornent le plafond de la première et celles, géantes, des salles de concert de la seconde.
Die Holzschindeln der Fassade fügen sich zu einem rhythmischen Spiel aus Linien und Licht. Les bardeaux de bois de la façade composent un jeu rythmique de lignes et de lumière.
riert vom Ali-Qapu-Palast in Isfahan, Iran. Noch zusammen mit Meili überführten Staufer & Hasler diese Idee in eine eigene Formensprache und griffen dabei auf Rosetten zurück, wie man sie von traditionellen Toggenburger Hackbrettöffnungen oder der typischen Ostschweizer Lochstickerei kennt.
Zwinglis Schweigen und die Rosetten Beim Bau hat man lokalen Materialien und Handwerkern den Vorzug gegeben, und die Architektur ist kreislaufwirtschaftlich ausgerichtet. Dafür ist Holz als Baumaterial prädestiniert, das zeigen Jahrhunderte alte Bauten im Toggenburg. Ein historisches Beispiel steht auf der anderen Seite des Dorfes Wildhaus. In dem einfachen und altehrwürdigen Blockbau, der sich in seiner formalen Ausprägung diametral vom Klanghaus unterscheidet, wurde vor über einem halben Jahrtausend der Reformator Huldrych Zwingli geboren. Zwingli, der selbst zahlreiche Instrumente spielte, liess im Gottesdienst dennoch völlige Stille walten, um nicht durch Gesang von der Predigt abzulenken. Was würde er wohl von den Konzerten im Klanghaus halten? Trotz der Gegensätzlichkeit dieser Bauten gibt es eine Verwandtschaft: die grossen Rosetten in den Aufführungsräumen und die zierlichen Schnitzereien an den Deckenbalken von Zwinglis sonst eher schmucklosem Geburtshaus.
Tanz der Töne
Wie an der Fassade bestimmt auch im Inneren die Akustik die Form des Baus. Im Zentralraum entfaltet sich der Ton auf unterschiedliche Weise. Mal tanzt das Echo Pirouetten, mal hallt es in der Ferne wider. Für den Klang ist entscheidend, wie die metallenen Klangspiegel in den Echokammern hinter den geschwungenen Wänden eingestellt sind und ob die riesigen Tore zur Fassade am Schwendisee geöffnet oder geschlossen sind. Unter dem Parkett befinden sich drei «Hohlräume», die beim Tanzen für Akzente sorgen, ähnlich wie der klopfende Golpe auf einer Flamencogitarre. Auch im «Hallraum», einer Ausstülpung des Zentralraums, kann mit Klang experimentiert werden. Je nach Position oder Entfernung zur Wand entstehen ein eigentümlicher Widerhall oder gedämpfte Geräusche. Nicht nur in der Architektur zeigt sich ein spannungsreicher Bogen zwischen Tradition und Moderne, sondern auch in der Auswahl der Musik. Direktion, Musikerinnen und Kuratoren schaffen im Programm eine feine Balance zwischen Stilen und Epochen: Auf traditionellen Schellenschlag und Bödele folgen Afro Fusion und Obertongesang. Das Klanghaus steht gleichermassen für regionales Brauchtum wie für die Offenheit gegenüber fernen Kulturen. Es wirkt einladend und ist geprägt von vielschichtigen akustischen wie architektonischen Wellen. Im Laufe der Zeit werden Wind, Sonne und Regen die Schindeln mit einer silbrigen Patina überziehen. Auf den geschwungenen Wänden unter dem schützenden Vordach wird somit eine zusätzliche Wellenlinie entstehen, die dem Ausdruck des Klanghauses eine weitere, subtile Dimension verleihen wird.
PUBLIKATION: KLANGHAUS TOGGENBURG
Die umfangreiche und vielstimmige Publikation «Resonanzen: Klanghaus Toggenburg» aus dem Verlag Lars Müller Publishers beleuchtet Hintergründe und überraschende Zusammenhänge.

Zwischen Volkslied und Beatboxing, Saxofon und Klangexperiment: Das Klanghaus eröffnete mit einem eindrucksvollen Spektrum an Ausdrucksformen. Entre chants folkloriques et beatboxing, saxophone et expérimentations sonores, l’ouverture de la Klanghaus a accueilli un éventail impressionnant d’expressions musicales différentes.
Danse des sons
Comme pour la façade, l’acoustique régit la forme du bâtiment à l’intérieur. Dans l’espace central, le son se propage de différentes manières. Parfois l’écho tourbillonne, parfois il résonne au loin. Pour la sonorité, l’élément décisif est le réglage des panneaux métalliques dans les chambres d’écho, derrière les parois incurvées, tout comme peut l’être l’ouverture ou la fermeture des grandes portes du côté du Schwendisee. Sous le parquet, se trouvent trois cavités qui, lorsque l’on danse, donnent des accents rappelant la frappe golpe de la guitare flamenco. La «Hallraum», une sorte de salle de résonance attenante à l’espace central, permet aussi d’expérimenter la perception sonore. Selon où l’on se situe et l’éloignement avec la paroi, on entend un écho particulier ou des bruits étouffés.
klangwelt.ch/orte/klanghaus
Le contraste entre tradition et modernité n’est pas seulement saisissant sur le plan architectural, il caractérise aussi la programmation musicale. Un équilibre raffiné entre les styles et les époques est assuré par la direction, les musiciens et les curateurs: aux traditionnels Schellenschlag (percussion sur des cloches) et Bödele (danse folklorique) succèdent de l’afro fusion et du chant diphonique. La Klanghaus est ouverte aussi bien aux coutumes régionales qu’aux cultures du monde. L’édifice est accueillant et marqué par la diversité des ondes acoustiques et architecturales qui le traversent. Au fil du temps, le vent, le soleil et la pluie conféreront une patine argentée aux bardeaux. Sur les parois incurvées protégées par l’avant-toit apparaîtra ainsi une bande ondulée de plus, qui subtilement ajoutera une dimension à l’expression de la Klanghaus.
Anna-Tina Eberhard / Klangwelt Toggenburg
HEIMAT IST IMMER JETZT LE PATRIMOINE EST ANCRÉ DANS LE PRÉSENT
Marco Guetg, Journalist

Lucius und Annemarie Burckhardt auf einer Reise nach Sizilien 1977
Lucius et Annemarie Burckhardt lors d’un voyage en Sicile en 1977
Er dachte über Stadtentwicklung nach, sie spitzte mit. Lucius und Annemarie Burckhardt prägten als intellektuelles Tandem die Stadt Basel und den Basler Heimatschutz. Eine Annäherung an dieses kreative Duo anlässlich des 100. Geburtstags von Lucius Burckhardt.
Wo beginnen? Einen Einstieg böten die Schriften. Nur: In den rund 50 aktiven Jahren des Ehepaares Burckhardt hat sich ein gewaltiger Materialberg angehäuft: Leserbriefe, Fachartikel, Glossen, Bücher, selbst Theaterstücke und Filme. Diese Fülle verweigert sich dem schnellen Blick. Aus dieser akademischen Welt lösen wir mithilfe von Markus Ritter ein paar biografische Splitter. Der Biologe und grüne Politiker war mit Lucius Burckhardt befreundet und hat einige seiner Schriften herausgegeben.
Lucius (1925–2003) und Annemarie Burckhardt (1930–2012) bildeten ein intellektuelles Tandem, das sich mit Fragen des Alltags, der Wahrnehmung von Landschaft und der Stadt wie auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung beschäftigte. Er war Professor, Autor und Redner, sie die wirkungsvolle Kraft im Hintergrund, indem sie ihren Mann nicht nur organisatorisch unterstützte, sondern auch mitredete und kritisier-
Il réfléchissait à l’aménagement urbain, elle aiguisait ses idées. Lucius et Annemarie Burckhardt ont marqué la ville de Bâle et la section bâloise de Patrimoine suisse en tant que tandem intellectuel. Le centenaire de la naissance de Lucius Burckhardt offre l’occasion de faire la connaissance de ce duo créatif.
Par où commencer? Les textes offrent certes une porte d’entrée mais, durant un demi-siècle d’activité, le couple Burckhardt a laissé derrière lui une vraie montagne de documents: lettres de lecteurs, articles spécialisés, commentaires, livres et même pièces de théâtre et films. Un contenu d’une telle richesse ne se lit pas à la va-vite. Nous avons pu compter sur Markus Ritter pour nous aider à dégager quelques éléments biographiques de cet univers académique. Ce biologiste et politicien écologiste était un ami de Lucius Burckhardt. Il a publié certains de ses écrits. Lucius (1925–2003) et Annemarie Burckhardt (1930–2012) ont formé un duo intellectuel qui s’est engagé dans des réflexions sur le quotidien, la perception du paysage et de la ville, ainsi que sur l’évolution de la société. Il était professeur, auteur et conférencier. Elle était l’élément dynamique qui agissait en coulisse, avec son sens de l’organisation mais aussi par ses réflexions et ses
te. Ausdruck ihres gemeinsamen Wirkens ist die Entwicklung der «Spaziergangswissenschaft», einer Art methodischen Spazierens, das Burckhardt nach verständnislosem Nachfragen aus dem Rektorat augenzwinkernd akademisch adelte und zur «Promenadologie» umtaufte.
Engagiert für den Basler Heimatschutz
Früh schon geisselte Lucius Burckhardt in Basel städteplanerische Sündenfälle. Als Student bekämpfte er zum Beispiel die geplante Talentlastungsstrasse, die eine Schneise in die Altstadt geschlagen hätte. Er engagierte sich auch institutionell: 1950 wurde Lucius Burckhardt Sekretär des Basler Heimatschutzes. Ritter meint, Burckhardt sei kein sturer Bewahrer gewesen und durchaus «zum Neuen gestanden», hätte dabei aber stets eine «respektvolle Referenz auf das Alte» eingefordert. Mit der «kompromisslosen Moderne, die das Bestehende rücksichtslos abreissen wollte», konnte er nichts anfangen.
1955 hielt der Dreissigjährige die Festrede zu 50 Jahre Heimatschutz Basel. Markus Ritter klappt ein Büchlein auf und zitiert daraus programmatische Sätze: «Heimatschutz ist ein Ja zur Heimat und Heimat ist immer in der eigenen Zeit. Nur indem man es im Gegenwärtigen beheimatet, erhält man dem heimatlichen Erbe seinen Platz.» Der Blick auf die moderne Stadt sei dem Heimatschutz nicht in die Wiege gelegt worden, doch «nur indem er sich über die Zukunft Gedanken macht, kann er ihre Vergangenheit retten».
Burckhardt habe, so Ritter, in den 1950er-Jahren mit seinem «Einsatz für die Altstadt einen wichtigen Beitrag geleistet». Die Grenzen der Stadt verschoben sich ab dann zunehmend – Stichwort Grossagglomeration. Burckhardt fragte, «wie sich die Altstadt in diesem sich verändernden Umfeld verhält». Seine Sicht auf die Stadt als Lebensraum und als Bühne gesellschaftlicher Entwicklung wirkt bis heute weiter – bei allen, die sich mit Stadtplanung, Architektur und urbaner Kultur beschäftigen.
Kritik mit Schalk und Schere
Auch Annemarie Burckhardt war Heimatschützerin. 1966 wurde sie als erste Frau in den Vorstand des Basler Heimatschutzes gewählt, von 1972 bis 1983 zeichnete sie für die Broschüre «Heimatschutz Basel liest für Sie» verantwortlich. Was ihr in einer Zeitung mit Blick auf die gebaute Umwelt wichtig schien, collagierte sie und kommentierte damit die Seiten der Broschüre stets mit Originalität und ernsthaftem Schalk. Und sie entdeckte die Stickerei als ihre Kunstform, indem sie die Bedeutung von Alltagsgegenständen mit humorvollen wie vieldeutigen Kreuzstichen weitete.
Die Studentinnen und Studenten Lucius Burckhardts schätzten den unkonventionellen Intellektuellen, der sein Wissen bildhaft vermittelte und die Öffentlichkeit mit Aktionen auf ein städteplanerisches Manko aufmerksam machte. Legendär war sein «mobiler Zebrastreifen» in Kassel, bei dem Fussgänger selbst bestimmten, wo sie die Strasse überqueren wollten. Von 1962 bis 1972 leitete er die Zeitschrift Werk, wo er mit lockerer Ernsthaftigkeit und Ironie Probleme darstellte oder seine Visionen skizzierte.
Das Denken der Burckhardts hinterlässt bis heute viele Spuren. Das neu aufgelegte Buch Der kleinstmögliche Eingriff (Martin Schmitz Verlag, 2013), in dem Lucius Burckhardt über Stadtentwicklung, Design oder Gartengestaltung nachdenkt, ist hochaktuell und laut Ritter «ein absoluter Renner».
critiques. L’expression de leur action commune est l’invention de la «science de la promenade» (Spaziergangswissenschaft), une sorte de promenade méthodique que Lucius Burckhardt, après des réactions perplexes du rectorat, anoblit avec humour en lui donnant un nom académique: la «promenadologie».
Engagés au sein de la section bâloise de Patrimoine suisse Lucius Burckhardt fustigea très tôt les hérésies urbanistiques à Bâle. Alors qu’il était encore étudiant, il combattit le projet de route de décharge (Talentlastungsstrasse) qui aurait découpé la vieille ville. Lucius Burckhardt s’engagea aussi au niveau institutionnel: en 1950, il devint secrétaire de la section bâloise de Patrimoine suisse. Selon Markus Ritter, Lucius Burckhardt n’était pas un conservateur borné: «ouvert à la nouveauté», il était partisan d’une «référence respectueuse à l’ancien». Il ne se reconnaissait pas dans une «modernité intransigeante, qui veut démolir l’existant sans ménagement». En 1955, à l’âge de 30 ans, Lucius Burckhardt prononça le discours du 50e anniversaire de la section bâloise. Markus Ritter ouvre un livret et cite quelques phrases programmatiques: «La protection du patrimoine, c’est dire oui à notre ancrage identitaire, et cet ancrage ne peut vivre qu’inscrit dans son temps. Ce n’est qu’en vivant dans le présent que le patrimoine trouve sa juste place.» Le regard sur la ville moderne n’est pas forcément inhérent à la protection du patrimoine, mais «c’est seulement en réfléchissant à l’avenir que l’on peut préserver son passé».
Selon Markus Ritter, Lucius Burckhardt «a fourni une contribution essentielle par son engagement en faveur de la vieille ville» dans les années 1950. Depuis lors, les limites de la ville n’ont cessé de s’étendre – d’où la notion de grande agglomération. Lucius Burckhardt se posait la question «de la place de la vieille ville dans cet environnement en mutation». Sa vision de la ville en tant qu’espace de vie et scène de l’évolution de la société est toujours d’actualité pour tous ceux qui s’intéressent à l’urbanisme, à l’architecture et à la culture urbaine.
La critique par l’humour et les ciseaux
Annemarie Burckhardt était également engagée dans la protection du patrimoine – en 1966, elle a été la première femme élue au comité de la section bâloise et a dirigé la brochure «Heimatschutz Basel liest für Sie» de 1972 à 1983. Lorsqu’elle trouvait un article de journal en rapport avec l’environnement construit qui lui semblait important, elle le découpait, le collait et le commentait dans les pages de la brochure, toujours avec originalité et un sérieux teinté d’ironie espiègle. Et elle a découvert la broderie dont elle a fait son expression artistique en détournant la signification des objets quotidiens avec des points de croix humoristiques et à double sens.
Les étudiantes et les étudiants de Lucius Burckhardt appréciaient cet intellectuel non conventionnel, qui transmettait son savoir de manière imagée et qui, par des actions, savait attirer l’attention du public sur des erreurs urbanistiques. Son passage piétons mobile, à Cassel, était devenu légendaire: il permettait aux intéressés de décider eux-mêmes où ils souhaitaient traverser les rues. De 1962 à 1972, Lucius Burckhardt a dirigé la revue «Werk» où il présentait des problèmes non sans décontraction et ironie, et esquissait ses visions.
La pensée des Burckhardt exerce aujourd’hui encore son influence. Réédité récemment, le livre Der kleinstmögliche Eingriff (la plus petite intervention) est toujours d’actualité et un «vrai succès» selon Markus Ritter. Le professeur y livre ses réflexions sur le développement urbain, le design ou l’aménagement paysager.
UNTERWEGS IN GEUENSEE CHEMIN FAISANT À GEUENSEE
Rebekka Ray, Baukulturelle Bildung, Schweizer Heimatschutz

Der Weg durch Geuensee (LU) folgt zu einem grossen Teil dem Dorfbach, der von zwei Strassen flankiert wird. Le chemin traversant Geuensee (LU) suit en grande partie le cours du ruisseau, flanqué de deux rues de part et d’autre.


Markus Muri, Ueli Meyer, Greta Fischer und Egon Albisser (v.l.n.r.) setzen sich für die historischen Bauten in ihrem Wohnort ein.
Markus Muri, Ueli Meyer, Greta Fischer et Egon Albisser (de g. à dr.) se mobilisent pour la préservation des bâtiments historiques dans leur commune.


Zwei Bewohnerinnen und drei Bewohner der Innerschweizer Gemeinde Geuensee schliessen sich zu einer Interessengemeinschaft zusammen und zeigen auf, wie man sich trotz Verkehr und Wachstum mit Dialogbereitschaft für den historischen Bestand einsetzen kann.
In Geuensee geht was – dies zumindest ist mein erster Eindruck, als ich an der Hauptstrasse aus dem Postauto steige 1 Autos und Schwerverkehr rasen im Sekundentakt vorbei – täglich etwa 16 000 Fahrzeuge, wie ich später erfahre –, und auf der nahen Baustelle entsteht neuer Wohn- und Gewerberaum. Hier empfangen mich Egon, Greta, Ueli und Markus (Ines ist verhindert), die sich vor einigen Jahren zusammengetan haben und als Kerngruppe Oberdorfstrasse das Baugeschehen in der Gemeinde aufmerksam verfolgen. Trotz Lärm verweilen wir einen Moment an der Hauptstrasse und blicken zur
KERNGRUPPE OBERDORFSTRASSE
Um sich gemeinsam für einen sorgsamen Umgang mit dem historischen Bestand einzusetzen, schlossen sich Egon Albisser, Greta Fischer, Ueli Meyer, Ines und Markus Muri, alle wohnhaft in Geuensee, 2023 zur Kerngruppe Oberdorfstrasse zusammen.
Deux habitantes et trois habitants de la commune de Geuensee, en Suisse centrale, forment une communauté d’intérêt et montrent comment il est possible, malgré le trafic et la croissance, de s’engager en faveur du bâti historique en privilégiant le dialogue.
Ça bouge à Geuensee – c’est du moins ma première impression lorsque je sors du car postal sur la route principale 1 . Voitures et poids lourds se succèdent sans interruption – j’apprendrai plus tard que pas moins de 16 000 véhicules traversent la localité chaque jour. Et le chantier voisin donnera naissance à un nouvel ensemble résidentiel et commercial.
Egon, Greta, Ueli et Markus (Ines étant absente) viennent m’accueillir. Il y a quelques années, ils ont formé le groupe local de l’Oberdorfstrasse, afin de suivre attentivement les projets de construction dans la commune. En dépit du bruit, nous restons un moment sur la Hauptstrasse et admirons la chapelle et son élégante flèche 2 , qui disparaît presque entre les nouveaux immeubles, mais reste au cœur de l’attention dans le cadre du développement de la localité. Le plan d’affectation prévoyait en effet que cet édifice du Moyen Âge reste visible dès l’entrée dans le village. Aujourd’hui, la chapelle se dresse fièrement sur la route principale reliant Aarau à Lucerne. Dans les années 1960, elle avait déjà dû être déplacée en rai-
Rebekka Ray
Kapelle mit dem eleganten, spitzen Turm 2 . Sie verschwindet fast zwischen den Neubauten und markiert zugleich einen Brennpunkt der künftigen Ortsentwicklung. Der Gestaltungsplan für die Neubauten sah tatsächlich vor, dass das mittelalterliche Bauwerk bei der Einfahrt ins Dorf sichtbar bleiben müsse. Nun ragt die Kapelle trotzig in die Hauptstrasse zwischen Aarau und Luzern. Bereits in den 1960er-Jahren musste sie dem wachsenden Verkehrsaufkommen weichen und versetzt werden, erzählt Egon. Wir nähern uns der Kapelle, die St. Nikolaus gewidmet und im späten 16. Jahrhundert erbaut worden ist. Als pensionierter Restaurator weiss Egon einiges zu berichten über die Geschichte und die Ausstattung dieses Bauwerks.
Dem Bach entlang, dem wir nun folgen, war früher das Gewerbe angesiedelt. Der historische Bestand, etwa das repräsentative Storenhaus (1888) oder der Speicher (1743), ist von zahlreichen Neubauten umgeben, die für die stark wachsende Gemeinde mehr Wohnraum bieten sollen.
Wir wechseln auf die andere Seite des Dorfbachs und kommen zur Oberdorfstrasse 3 , wo das Engagement meiner Gastgeber seinen Anfang nahm. Als die Bäume, die den Bach säumen und die Strasse fast wie eine Allee aussehen lassen, gefällt werden sollten, setzten sich die fünf erfolgreich für deren Erhalt ein. Etwas weiter oben steht ein weiterer historischer Speicher und zwei stattliche, bald 300-jährige Luzerner Bauernhäuser. Die drei sorgfältig restaurierten Bauten sind in Besitz von Greta, die vor 50 Jahren eine Bleibe für sich und ihr Pferd suchte, in Geuensee fündig und damit zur engagierten Schützerin historischer Baukultur geworden ist. «Der Spekulation entzogen» habe sie die Bauten, um sie langfristig zu erhalten. Sie werden später in die Stiftung überführt werden, die Greta zum Erhalt der Mühle 4 gegründet hat. Mit Egon, Greta, Ueli und Markus lerne ich nicht nur eine neue Gemeinde kennen, ich erfahre darüber hinaus, was zu einem erfolgreichen Engagement für Baukultur gehört: ein Bewusstsein für die Geschichte, ein Verständnis für aktuelle Herausforderungen, Kreativität und Dialogbereitschaft. Und wenn nötig, lädt Greta den Gemeinderat auch mal zum Apéro zu sich nach Hause ein. In Geuensee geht tatsächlich was.
Wo leben Sie? Welchen speziellen Ort in Ihrem Umfeld möchten Sie uns zeigen? Schreiben Sie eine E-Mail an redaktion@heimatschutz.ch, und begleiten Sie Rebekka Ray auf einer Tour durch Ihre Umgebung.
GROUPE LOCAL DE L’OBERDORFSTRASSE
Pour s’engager en faveur d’un traitement attentif des bâtiments historiques, Egon Albisser, Greta Fischer, Ueli Meyer, Ines et Markus Muri, qui résident à Geuensee, ont créé en 2023 le groupe local de l’Oberdorfstrasse.
son du trafic automobile, explique Egon. Nous nous approchons de cette chapelle consacrée à Saint-Nicolas. En tant que restaurateur à la retraite, Egon a beaucoup à dire sur l’histoire et l’aménagement de cet édifice du XVIe siècle.
Autrefois, les activités artisanales étaient installées au bord du ruisseau que nous longeons. Les monuments historiques, tels que l’imposante Storenhaus (1888) ou encore le grenier (1743), sont cernés par de nouveaux immeubles qui offrent davantage de logements dans cette commune en plein boom.
Nous traversons la rivière et empruntons l’Oberdorfstrasse 3 , à l’origine de la mobilisation de mes hôtes. Les arbres qui bordent ce cours d’eau et confèrent à la rue le style d’une allée étaient promis à l’abattage: le groupe s’est investi avec succès pour les sauver.
Un autre grenier historique s’élève un peu plus loin, avec deux imposantes fermes lucernoises, vieilles de bientôt 300 ans. Greta est la propriétaire de ces trois bâtiments soigneusement restaurés. Il y a un demi-siècle, elle cherchait un logement qui pouvait également accueillir son cheval. Elle l’a trouvé à Geuensee, où elle est devenue une ardente protectrice du patrimoine construit. Greta a mis ces bâtiments historiques à l’abri de la spéculation pour les préserver à long terme. Ils seront plus tard transférés à la fondation qu’elle a créée pour la sauvegarde du moulin du village 4 .
Aux côtés d’Egon, de Greta, d’Ueli et de Markus, je ne découvre pas seulement une commune, j’apprends aussi quels sont les ingrédients du succès de l’engagement pour la culture du bâti: une conscience de l’histoire, une compréhension des défis du moment, de la créativité et une certaine aptitude au dialogue. Et si nécessaire, Greta n’hésite pas à inviter l’exécutif local pour un apéritif chez elle. À Geuensee, ça bouge bel et bien.
Où habitez-vous? Voulez-vous nous présenter un lieu particulier près de chez vous? Envoyez un e-mail à redaktion@heimatschutz.ch et accompagnez Rebekka Ray dans votre univers.

Die Bäume, die auf der rechten Seite in die Strasse ragen, bleiben dank des Engagements der Kerngruppe Oberdorfstrasse erhalten. Sur la droite de la rue, les arbres sont préservés grâce à l’engagement du groupe local de l’Oberdorfstrasse.
Rebekka Ray
EINE ZUKUNFT FÜR WESSEN VERGANGENHEIT?
Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Europäischen Denkmalschutzjahres widmet sich dieses Buch der Frage, inwiefern das geschützte Kulturerbe die Vielfalt unserer Gesellschaft widerspiegelt und welche Rolle die Erfahrungen von Minderheiten als Teil der Erinnerungskultur der Mehrheit spielen. Diejenigen, die oft übersehen werden, erhalten eine Stimme: Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind, sowie marginalisierte Gruppen. Auf über 500 Seiten teilen sie ihre Erfahrungen, Geschichten und Wünsche und weisen so auf das bisher unterrepräsentierte materielle und immaterielle Erbe hin. Eines von zahlreichen Beispielen ist der Beitrag über die Saisonnierbaracken auf dem Bührer-Areal in Biel (vgl. S. 4 in diesem Heft).
So schön gestaltet, dass der wichtige Inhalt manchmal etwas in den Hintergrund zu rücken droht, ist diese Publikation ein wegweisender Beitrag zu kommenden Herausforderungen für die Denkmalpflege, und es sind ihr möglichst viele aufgeschlossene Leserinnen und Leser zu wünschen. Peter Egli
Denkmalschutzjahr 2025
Eine Zukunft für wessen Vergangenheit? denkmalschutzjahr2025.ethz.ch
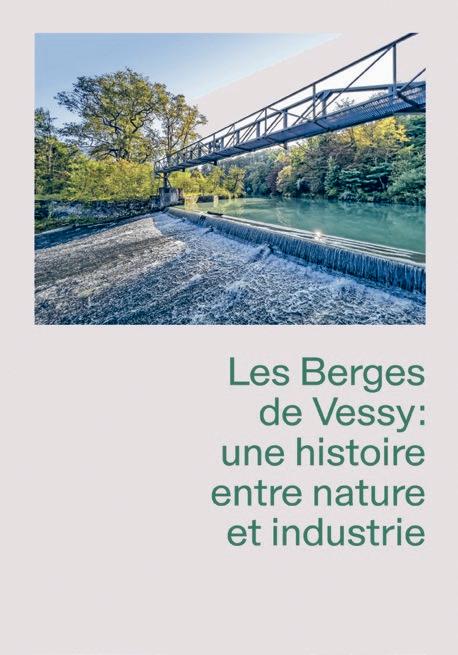
Patrimoine suisse Genève (éd.), Pauline Nerfin (dir.): Les Berges de Vessy: une histoire entre nature et industrie. 2025, 258 pages, CHF 50.–

AG Denkmalschutzjahr 2025, ICOMOS Suisse, Denkmalpflege der ETH Zürich (Hg.): A future for whose past?
Das Erbe von Minderheiten, Randgruppen und Menschen ohne Lobby. Hier und Jetzt 2025, 516 Seiten, CHF 39.–
LES BERGES DE VESSY
Au cœur d’un méandre de l’Arve, un lieu unique: les Berges de Vessy. En 1865, un jeune serrurier-mécanicien y installe une usine de pompage d’eau, posée entre la rive et deux îles naturelles. De là naît la Société des Eaux de l’Arve, une entreprise privée de distribution d’eau qui fonctionna 123 ans avant son rachat par les Services industriels genevois en 1988. Ce livre retrace la transformation d’un site industriel singulier, où nature et machines ont étroitement cohabité: barrage, turbines, moteurs et pompes dialoguent avec la forêt et la rivière. Depuis sa réhabilitation, Vessy est devenu un site patrimonial vivant, ouvert au public, où s’expérimentent de nouvelles formes de transmission autour de l’eau, de l’énergie et de l’environnement. Dirigée par Pauline Nerfin, la publication accueille des contributions d’Allison Huetz (historienne-géographe), de Marcellin Barthassat (architecte), Bénédict Frommel (spécialiste en patrimoine industriel), Lucas Lazzarotto (historien), Panos Mantziaras (architecte), Paul Marti (historien) et Fiore Suter (géologue), ainsi qu’une préface de Robert Cramer (président du Conseil d’administration des SIG) et une postface de Roberto Multari (président de l’association Les Berges de Vessy). Ce livre, richement illustré, relié et imprimé à Genève, vous propose un voyage entre nature, patrimoine et énergie au cœur d’un site genevois unique, où machines, rivière et forêt cohabitent depuis plus d’un siècle. À commander sur le site patrimoinegeneve.ch, prix pour les membres de Patrimoine suisse Genève: CHF 40.–
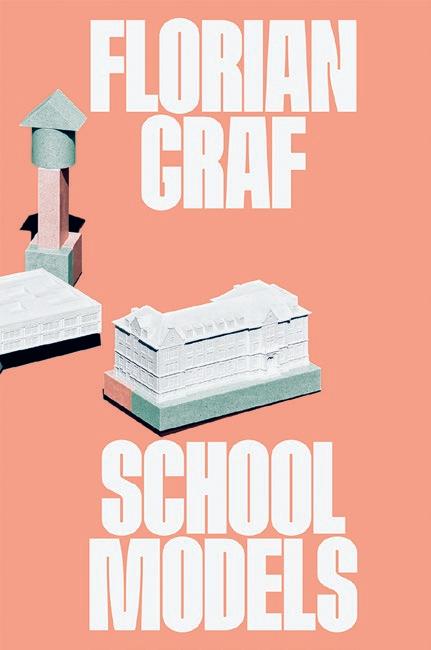
Florian Graf: School Models.
Scheidegger & Spiess 2025, Deutsch/ Englisch, 132 Seiten, CHF 29.–
SCHOOL MODELS
Auf der Schulanlage Hofacker in Zürich Hirslanden gesellte sich 2022 zu den zwei denkmalgeschützten Bauten von Friedrich Wehrli (1898) und Hermann Herter (1938) ein Neubau von E2A Architekten. Der Künstler und Architekt Florian Graf stellte diesen drei Bauten in einem Kunstprojekt 2023 verkleinerte Ebenbilder aus Stein gegenüber, die den Schülerinnen und Schülern als Sitzgelegenheiten, Kletterturm oder Spielgerät dienen. Die im Verhältnis 1:20 verkleinerten Modelle stehen auf überdimensionierten farbigen Spielklötzen, wie sie die meisten aus ihrer vordigitalen Kindheit kennen.
Texte von Teresa Fankhänel, Yasmin Afschar und Dominique Laleg gehen diesem Spiel mit architektonischen Dimensionen nach. Sie untersuchen das Skulpturenensemble in Bezug zu dessen Modellhaftigkeit, dessen Wirkung als Resonanzverstärker oder dessen Verbindung zum Original. Zahlreiche Fotografien und Zeichnungen geben einen Einblick in das aussergewöhnliche Projekt. Rebekka Ray
SIEDLUNG RIETHOLZ
Die Reihe swissmonographies stellt bemerkenswerte Schweizer Bauwerke der Nachkriegszeit vor, die bislang wenig Aufmerksamkeit erhalten haben. Nach Luigi Snozzis Casa Kalman in Brione und dem Ensemble Chauderon in Lausanne vom Atelier des Architectes Associés beschäftigt sich Band 3 mit einem frühen Beispiel der Betonvorfabrikation: der Wohnsiedlung Rietholz im Zollikerberg von Hans und Annemarie Hubacher von 1962. Das strenge äussere Erscheinungsbild zeigt nur andeutungsweise die grosse Vielfalt an Wohnungstypologien, die sich im Innern der Blöcke offenbart: Nicht weniger als 15 verschiedene Grundrisse decken die Bedürfnisse einer sozial breit durchmischten Bewohnerschaft ab, von Geschosswohnungen bis zu Maisonetten mit «Rue intérieure», inspiriert von Le Corbusier. Sie alle werden mit Archivplänen sowie bauzeitlichen und aktuellen Fotos illustriert. Das Buch würdigt zudem Annemarie Hubacher, die als eine der ersten Frauen in der Architektur zusammen mit ihrem Mann in Zürich ein Büro geführt hat. Die ausserordentlichen Qualitäten der Wohnungen schätzen die heutigen Bewohner und Bewohnerinnen noch immer: «Wenn man das Glück hat, hier zu wohnen, dann bleibt man.» Regula Steinmann

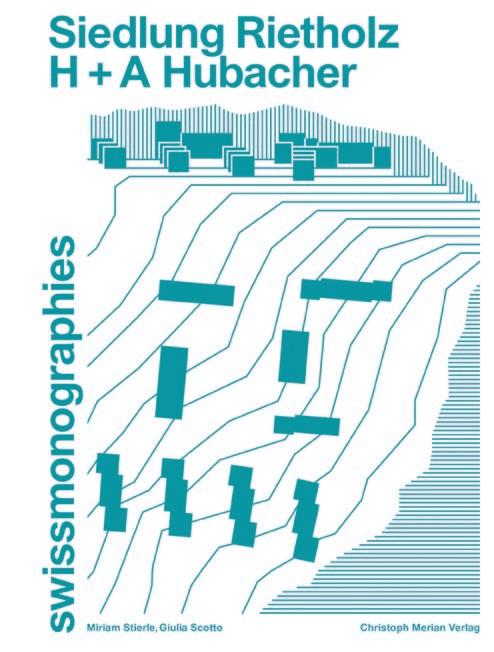
Harald R. Stühlinger (Hg.), Miriam Stierle, Giulia Scotto: Siedlung Rietholz – H + A Hubacher. swissmonographies, Band 3, Christoph Merian Verlag 2024, Deutsch/Englisch, 188 Seiten, CHF 39.–
FASZINATION KLEINSEILBAHNEN
Der erstmals 2019 publizierte (Wander-)Führer zu rund 200 Kleinseilbahnen in der Schweiz ist kürzlich in einer dritten, vollständig überarbeiteten Auflage erschienen. Anhand von einladenden Texten, Fotos, Plänen und kurzen Steckbriefen werden die vielfältigen Facetten der kleinen Luftseilbahnen präsentiert. Das Buch gibt zudem Einblick in technische Besonderheiten, Geschichte und gesetzliche Vorgaben. 40 der 198 aufgeführten Kleinseilbahnen mit kantonaler Betriebsbewilligung werden in ausführlichen Porträts vorgestellt. Die typisch schweizerischen Bähnli sind ein nationales Kulturgut, das faszinierende Erlebnisse bietet. Die Publikation würdigt auch das Engagement der Menschen, die sich für deren Erhalt und Betrieb einsetzen. Peter Egli
Roland Baumgartner, Reto Canale: 200 Kleinseilbahnen Schweiz Weber Verlag 2024, 356 Seiten, CHF 49.–
HÉRITER DE L’ABSENCE? WAS ERBEN, WENN NICHTS BLEIBT?
En couverture du dernier numéro de Heimatschutz/Patrimoine, un homme regarde son village alpin. Oui, il veut le léguer à la prochaine génération, encore plus beau et plus vivant qu’aujourd’hui. C’est en tous cas cette fierté et cette dynamique que nous voulions illustrer. Mais nous ne voyons pas le visage de ce villageois. Peut-être est-il préoccupé par l’avenir de sa commune de montagne? Quoi qu’il en soit, quelques jours après la publication de notre revue, un autre village, celui de Blatten (VS), est détruit, en quelques secondes, par l’effondrement du glacier du Birch.

Une telle destruction est un choc qui nous touche profondément. Patrimoine suisse se bat pour la protection de sites (Blatten était inscrit à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse ISOS), pour que leur développement soit harmonieux et qu’ils passent de génération en génération. Mais ce que nous ressentons comme défenseurs du patrimoine n’est rien en comparaison de l’immense perte à laquelle sont confrontés les habitantes et les habitants. Comment vivre quand tout a disparu? Comment s’organiser à moyen terme? Et que donner en héritage quand tout est détruit?
Il reste bien sûr le patrimoine immatériel, ce lien invisible qui renforce une communauté et qui peut avoir un effet curatif dans les moments de crise. Mais la question de la reconstruction devient de plus en plus prégnante. C’est en effet l’endroit où l’on vit, les bâtiments et les lieux publics qui sont les mieux à même de porter le patrimoine d’une communauté. Le président de la Fondation Blatten a raison de rappeler que tout doit partir de là, à savoir des besoins et des aspirations des habitantes et des habitants. Il fait l’éloge de l’écoute et de la participation (voir page 3).
À Patrimoine suisse, nous croyons fermement au travail commun. Pour nous, tout le territoire doit être pensé dans une perspective fédéraliste. À chacun son rôle: la politique et l’administration au niveau des communes, des cantons et de la Confédération, les droits politiques des citoyens, le ressenti de chaque habitant, les intérêts des entreprises, ceux des milieux de la recherche, du secteur créatif et des organisations qui s’engagent pour le bien commun, comme Patrimoine suisse – toutes et tous ont une mission à accomplir. Le résultat est bien souvent plus compliqué que prévu mais s’il est porté par chacune et chacun, il pourra non seulement faire sens aujourd’hui mais accompagner les prochaines générations.
Auf dem Cover der letzten Ausgabe von Heimatschutz/Patrimoine schaut ein Mann auf sein Bergdorf. Ja, er will es der nächsten Generation noch schöner und lebendiger hinterlassen, als es heute ist. Genau diesen Stolz und diese Dynamik wollten wir zeigen. Aber wir sehen das Gesicht dieses Dorfbewohners nicht. Vielleicht macht er sich Sorgen um die Zukunft seiner Berggemeinde? Wie dem auch sei, wenige Tage nach Erscheinen unserer Zeitschrift wurde ein anderes Dorf, Blatten (VS), innerhalb weniger Sekunden durch den Abbruch des Birch-Gletschers zerstört.
Eine solche Zerstörung ist ein Schock, der uns tief bewegt. Der Schweizer Heimatschutz setzt sich für den Schutz von Ortsbildern ein (Blatten war im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS aufgeführt), damit sie sich harmonisch entwickeln und von Generation zu Generation weitergegeben werden können. Aber was wir als Verfechter des Kulturerbes empfinden, ist nichts im Vergleich zu dem immensen Verlust, den die Bewohnerinnen und Bewohner erlitten haben. Wie soll man weiterleben, wenn alles verschwunden ist? Wie soll man sich mittelfristig organisieren? Und was soll man als Erbe hinterlassen, wenn alles zerstört ist?
Natürlich bleibt das immaterielle Kulturerbe, diese unsichtbare Verbindung, die eine Gemeinschaft stärkt und in Krisenzeiten eine heilende Wirkung haben kann. Aber die Frage des Wiederaufbaus wird immer wichtiger. Denn es sind die Orte, an denen wir leben, die Gebäude und öffentlichen Plätze, die das gemeinschaftliche Erbe am besten verkörpern. Der Präsident der Stiftung Blatten hat recht, wenn er daran erinnert, dass alles von den Bedürfnissen und Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner ausgehen muss. Er betont die Bedeutung des Zuhörens und der Teilhabe (siehe Seite 3).
Wir vom Schweizer Heimatschutz glauben fest an die gemeinsame Arbeit. Für uns muss das gesamte Gebiet föderalistisch gedacht werden. Alle haben ihre Rolle: Die Politik und Verwaltung in den Gemeinden, Kantonen und beim Bund, die politischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger, die Gefühle der einzelnen Einwohner, die Interessen der Unternehmen, der Forschung, der Kreativwirtschaft und der Organisationen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, wie der Schweizer Heimatschutz – alle haben ihre Aufgaben. Das Ergebnis ist oft komplizierter als erwartet, aber wenn es von allen mitgetragen wird, ergibt es nicht nur heute Sinn, sondern begleitet auch die nächsten Generationen.
David Vuillaume
Secrétaire général de Patrimoine suisse
Sophie Stieger
GESCHÄFTSSTELLE/SECRÉTARIAT
Schweizer Heimatschutz/Patrimoine suisse
Villa Patumbah
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich T 044 254 57 00, info@heimatschutz.ch, heimatschutz.ch info@patrimoinesuisse.ch, patrimoinesuisse.ch
Geschäftsführer/Secrétaire général: David Vuillaume
VORSTAND/COMITÉ
Präsident/Président:
Prof. Dr. Martin Killias
Vizepräsident/Vice-président: Beat Schwabe
Übrige Mitglieder/Autres membres: Christof Tscharland-Brunner, Claire Delaloye Morgado, Monika Imhof-Dorn, Sabrina Németh, Muriel Thalmann, Caroline Zumsteg
SEKTIONEN/SECTIONS
Aargauer Heimatschutz
Präsident: Christoph Brun Gehrig
Geschäftsstelle: Lucienne A. Köpfli heimatschutz-ag.ch
Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden
Präsidentin: Irene Hochreutener heimatschutz-ar.ch
Baselbieter Heimatschutz
Präsident: Angelo Tomaselli
Geschäftsstelle: Nadine Caflisch heimatschutz-bl.ch
Heimatschutz Basel
Präsident: Marc Keller
Geschäftsstelle: Andreas Häner heimatschutz-bs.ch
Berner Heimatschutz
Präsident: Luc Mentha
Geschäftsstelle: Andrea Schommer-Keller bernerheimatschutz.ch
Pro Fribourg
Présidence: vacante
Secrétariat général: Sylvie Genoud Jungo pro-fribourg.ch
Patrimoine Gruyère-Veveyse
Président ad interim: Serge Castella monpatrimoine.ch
Patrimoine suisse Genève
Coprésidence: Pauline Nerfin, Lionel Spicher
Secrétariat: Sara Hesse patrimoinegeneve.ch
Glarner Heimatschutz
Präsident ad interim: Marc Schneiter
Geschäftsstelle: Sarah Maria Lechner glarnerheimatschutz.ch
Bündner Heimatschutz
Präsident: Patrick Gartmann
Geschäftsstelle: Ludmila Seifert heimatschutz-gr.ch
Protecziun da la patria Grischun dal Süd
Präsidentin: Patrizia Guggenheim heimatschutz-engadin.ch
Innerschweizer Heimatschutz
Präsident: Dr. Remo Reginold
Geschäftsstelle: Marco Füchslin innerschweizer-heimatschutz.ch
Patrimoine suisse, section Jura
Président ad interim: Toufiq Ismail-Meyer
Secrétariat: Gabriel Jeannerat patrimoinesuisse.ch/jura
Patrimoine suisse, section neuchâteloise
Président: Denis Clerc patrimoinesuisse.ch/neuchatel
Heimatschutz St. Gallen / Appenzell I.-Rh.
Präsident: Jakob Ruckstuhl
Geschäftsstelle: Annina Sproll heimatschutz-sgai.ch
Schaffhauser Heimatschutz
Präsidentin: Katharina E. Müller
heimatschutz-sh.ch
Schwyzer Heimatschutz
Präsidentin: Isabelle Schwander heimatschutz-sz.ch
Solothurner Heimatschutz
Präsident: Daniele Grambone
Geschäftsstelle: Michael Rothen heimatschutz-so.ch
Thurgauer Heimatschutz
Präsident: Kurt Egger
Geschäftsstelle: Gianni Christen heimatschutz.ch/thurgau
Società ticinese per l’arte e la natura (STAN)
Presidente: Tiziano Fontana stan-ticino.ch
Patrimoine suisse Vaud
Présidente: Muriel Thalmann
Secrétariat: Sophie Cramatte patrimoinesuisse-vd.ch
Oberwalliser Heimatschutz
Präsidentin: Valeria Triulzi oberwalliserheimatschutz.ch
Patrimoine suisse, section Valais romand
Président: Léonard Bender patrimoinesuisse.ch/valais
Zuger Heimatschutz
Co-Präsidium: Paul Baumgartner, Thomas Christmann
Geschäftsstelle: Regula Waller zugerheimatschutz.ch
Zürcher Heimatschutz
Präsident: Prof. Dr. Martin Killias
Geschäftsstelle: Bianca Theus, Christine Daucourt heimatschutz-zh.ch
FACHVERTRETER/INNEN/REPRÉSENTANT-E-S DES MILIEUX SPÉCIALISÉS
Ursula Boos, Lucie Hubleur, Damian Jerjen, Rahel Marti, Dr. phil. Friederike Mehlau Wiebking, Christoph Schläppi, Benedikt Wechsler
STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL/ FONDATION VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE
Geschäftsführerin/Directrice: Christine Matthey ferienimbaudenkmal.ch vacancesaucoeurdupatrimoine.ch
SCHOGGITALER/ÉCU D’OR
Geschäftsleiterin/Direction: Loredana Ventre schoggitaler.ch, ecudor.ch
EHRENMITGLIEDER/MEMBRES D’HONNEUR
Marco Badilatti, Philippe Biéler, Denis Buchs, Dr. Caspar Hürlimann, Dr. Andrea Schuler
WERDEN SIE TEIL UNSERER GEMEINSCHAFT/REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ: heimatschutz.ch/newsletter patrimoinesuisse.ch/infolettre



IMPRESSUM/IMPRESSUM 3/2025
120. Jahrgang/120e année
Herausgebe/Éditeur:
Schweizer Heimatschutz/Patrimoine suisse
Redaktion/Rédaction: Natalie Schärer, Peter Egli (Leitung) Marlyse et Laurent Aubert (traductions) Irene Bisang (Übersetzungen)
Redaktionskommission/Commission de rédaction: Lucia Gratz (Vorsitz), Architektin TU / MAS ETH
Hans-Ruedi Beck, MSE Raumentwicklung/ Landschaftsarchitektur
Christian Bischoff, architecte EPFZ Karoline Wirth, Journalistin, Videobiografin David Vuillaume, Geschäftsführer Peter Egli, Architekt FH/MAS Denkmalpflege und Umnutzung
Druck/Impression: Stämpfli Kommunikation, Bern
Gestaltungskonzept/Maquette: Stillhart Konzept und Gestaltung, Zürich
Erscheint/Parution: vierteljährlich/trimestrielle
Auflage/Tirage: 18 000 Ex.
Adresse:
Redaktion Heimatschutz/Patrimoine, Villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich, T 044 254 57 00, redaktion@heimatschutz.ch, redaction@patrimoinesuisse.ch ISSN 0017-9817
Die Zeitschrift als Online-Ausgabe: heimatschutz.ch/zeitschrift Revue disponible en ligne: patrimoinesuisse.ch/revue
Ausgabe 4/2025 erscheint am 24. November 2025 Le numéro 4/2025 paraîtra le 24 novembre 2025
Adressänderungen: heimatschutz.ch/adressaenderung Changement d’adresse: patrimoinesuisse.ch/changement-d-adresse
Datenschutz: heimatschutz.ch/datenschutz Protection des données: patrimoinesuisse.ch/protection-des-donnees








Ich bestelle / Je commande Die schönsten Aussichten Les plus beaux points de vue Die schönsten Bauten 1975–2000 Les plus beaux bâtiments 1975–2000 Die schönsten Hotels der Schweiz Les plus beaux hôtels de Suisse CHF 18.–(CHF 10.–für Heimatschutzmitglieder, exkl. Porto) CHF 1 8.–(CHF 1 0.–pour les membres de Patrimoine suisse, port exclu)

Name, Vorname / Nom, prénom
Strasse, Nr. / Rue, n o PLZ, Ort / NPA, lieu Telefon, E-Mail / Téléphone, e-mail Datum, Unterschrift / Date, signature
Ich werde Freundin oder Freund der Villa Patumbah. Bitte schicken Sie mir mehr Informationen zum Heimatschutzzentrum.
I ch bin bereits Mitglied beim Schweizer Heimatschutz.
Je suis déjà membre de Patrimoine suisse. Ich werde Mitglied beim Schweizer Heimatschutz (CHF 70.–pro Jahr)* und profitiere von Sonderkonditionen.
Je deviens membre de Patrimoine suisse (CHF 70.–par an*) et je profite de conditions préférentielles.
* Kantonale Abweichungen möglich: heimatschutz.ch/mitglied * Les tarifs peuvent différer selon la section: patrimoinesuisse.ch/membre heimatschutz.ch/datenschutz patrimoinesuisse.ch/protection-des-donnees
Name, Vorname Strasse, Nr. PLZ, Ort Telefon, E-Mail Beruf, Geburtsjahr Datum, Unterschrift

GUTE BAUKULTUR BRAUCHT BILDUNG UND VERMITTLUNG
Unser Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah in Zürich schärft den Blick für die Baukultur und spricht mit Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen ein breites Publikum an. Als Freundin oder Freund der Villa Patumbah helfen Sie, den Betrieb des Heimatschutzzentrums langfristig zu sichern, und unterstützen dabei unser vielfältiges Engagement in der Vermittlung von Baukultur. Herzlichen Dank! Unterstützen Sie uns! We rden Sie Freundin oder Freund der Villa Patumbah ab CHF 1000.–pro Jahr. Ihre Vorteile
Freier Eintritt ins Heimatschutzzentrum
Gratismitgliedschaft beim Schweizer Heimatschutz
Persönliche Einladung zu unseren Ausstellungen und Veranstaltungen, Spezialführungen u.v.m.
heimatschutzzentrum.ch/unterstützen
Jede Spende zählt! I BA N: CH69 0483 5169 8616 9100 0 Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich heimatschutz.ch/datenschutz



Schweizer Heimatschutz
Villa Patumbah Zollikerstrasse 128 8008 Zürich
Schoggitaler Écu d’or








Die schönsten Aussichten



Werden Sie Freundin oder Freund der Villa Patumbah!
Schweizer Heimatschutz
Villa Patumbah Zollikerstrasse 128 8008 Zürich


Schoggitaler für Natur und Heimat

Mit dem Kauf des Schoggitalers 2025 helfen Sie mit, lebendige Böden zu erhalten.
Verkauf durch Schülerinnen und Schüler und Poststellen ab September 2025.
www.schoggitaler.ch
En achetant l’Écu d’or 2025 vous nous aidez à conserver des sols vivants.
Vente par des élèves et les offices de poste dès septembre 2025.
www.ecudor.ch

© Gabi Kopp
© Schoggitaler, Meret
Fischli