



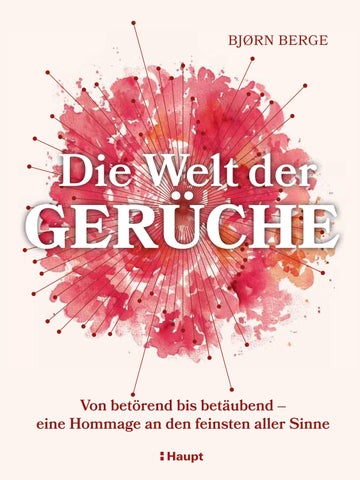
















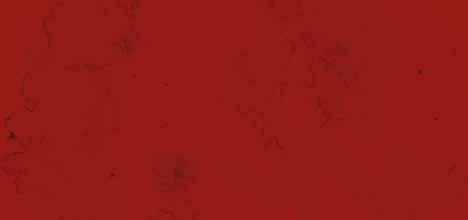









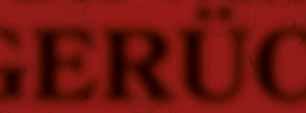











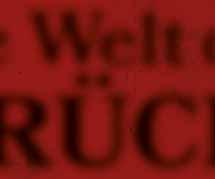











Von betörend bis betäubend –eine Hommage an den feinsten aller Sinne

Bjørn Berge
Von betörend bis betäubend –eine Hommage an den feinsten aller Sinne
Aus dem Norwegischen von Frank Zuber Illustrationen von Anette Rosenberg
Haupt Verlag
An einem sonnigen Sommertag vor wenigen Jahren machte ich eine Spritztour über die Küstenberge im Südwesten. Ich musste Wasser lassen und hielt bei einem geeigneten Birkengebüsch zwischen den runden Felsen an.
In diesem Moment strömte er mir entgegen: der unverkennbare Geruch feuchterNatur. Süßlich, würzig und erdig, mit einem Hauch von Kalk und Rost. Und mit einem Mal fühlte ich mich mehr als ein halbes Jahrhundert zurückversetzt, in deine Hütte am Fjord in Ryfylke. Es war ein grauer Tag. Wir saßen dicht nebeneinander, ich und du, mein lieber Opa, im Unterhemd, mit glänzender Halbglatze, dicker Hornbrille und großen, behaarten Händen, und ließen Rindenboote mit Papiersegeln über eine Pfütze schwimmen. Spanische Galeassen, brummtest du.
Berauscht von Glück ging ich tiefer in das Gebüsch, um die Quelle des Geruchs zu finden, vielleicht Weidenkätzchen oder Moor und Pilze, irgendetwas Moderiges. Doch plötzlich war der Duft weg, genauso schnell, wie er gekommen war. Ich gab nicht auf, steckte die Nase zwischen Blaubeersträucher, riss Hände von Torf und Moos aus der Erde zwischen den Felsen, doch vergeblich. Der Geruch war verschwunden.
An den folgenden Tagen kehrte ich immer wieder zurück, als hätte ich Entzugserscheinungen, in der Morgen- und Abenddämmerung, bei Sonne und Regen, und durchkämmte die Gegend. Nichts. Der Geruch ließ sich nicht mehr rekonstruieren, er war für immer verschwunden – und mit ihm die Sommer meiner Kindheit. Es war, als wärst du zum zweiten Mal gestorben.
Ich räume mein Werkzeug zusammen:
Gehör, Gesicht, Geruch, Geschmack, Gehirn. Es ist nun Abend geworden. Nikos Kazantzakis1
Beobachten Sie einmal Menschen, die einander mit Händedruck begrüßen. Im nächsten Augenblick fassen sie sich rasch an die Nase, als wollten sie den letzten Rest des Händedrucks inhalieren. Diese etwas unkultivierte Geste wiederholt sich mit wenigen Ausnahmen immer wieder, sogar unter Staatsoberhäuptern und Ministern. Nachdem der Händedruck auf dem roten Teppich vor der Flugzeugtreppe ausgetauscht ist, kann man fast die Sekunden zählen – selten mehr als fünfzehn –, bis die Hände so diskret wie möglich in die Höhe gehen.
Der Geruch einer Hand kommuniziert.2 Er trägt chemische Signale, die von Stimmung, Stress und gegebenenfalls auch Krankheiten einer Person zeugen. Von Dingen, die man verbirgt, um keine Schwäche zu zeigen und seine Verhandlungsposition nicht zu verschlechtern. Doch diese Art der Kenntnisübertragung ist unbewusst und folgt weder strategischen Überlegungen noch rationalen Analysen. Stattdessen beeinflusst sie unser Bauchgefühl. Manchmal braucht es nicht mehr, um zwischen Freund und Feind zu unterscheiden, zwischen Krieg und Frieden.
Machtmenschen ziehen es vor, sich mit energischem Blick, kreideweißen Zähnen, raffinierten Krawatten und breitschultrigen Anzügen vorzustellen – gerne auch mit einer Rolex am Arm, besonders, wenn sie ein Land repräsentieren, das sonst nicht viel zu bieten hat. Denn der Sehsinn beherrscht die Welt. Zumindest bilden wir uns das ein.
Bald ist alles nur noch Bilder – und nichts anderes. Wir leben im Zeitalter des Okularzentrismus, in dem der westliche Mensch in erster Linie von der visuellen Welt beeinflusst wird.3 Es ist wichtiger, dass etwas gut aussieht, als dass es funktioniert, seien es Häuser, Backwerk, Kampfflugzeuge oder Menschen. Für die heranwachsende Generation erscheint das Leben wie ein ewiger Catwalk.4
Auf dem zweiten Platz der Hierarchie der Sinne folgt der Gehörsinn, der noch immer eine gewisse Bedeutung hat, während Geschmacks-, Tast- und Geruchssinn die unteren Ränge einnehmen. Letzterer steht mit Abstand an letzter Stelle.5 Eine weltweite Umfrage im Jahr 2011 hat ergeben, dass Jugendliche lieber auf ihren Geruchssinn verzichten würden als auf ihren Computer oder ihr Smartphone.6
Das Zusammenspiel unserer Sinne verleiht uns einen direkten Zugang zur Welt und bildet die Grundlage für Entscheidungen, die lebenswichtig sein können. Obwohl sie ständig vom Informationsstrom der Medien herausgefordert werden, können wir uns im Grunde nur auf unsere unmittelbaren Sinneserfahrungen verlassen. Alles andere kann Suade, Bluff oder Propaganda sein.
Wenn die Sinne aus dem Gleichgewicht geraten und einzelne Sinne so sehr unterdrückt oder übertönt werden, dass sie keine Informationen mehr an uns liefern, riskieren wir, dass Halluzinationen überhandnehmen. Das Gehirn beginnt, sich das Leben zu erdichten. Dem finnischen Architekten und Philosophen Juhani Pallasmaa zufolge befinden wir uns auf dem Weg in eine Fantasiewelt.7
In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz immer größere Lebensbereiche übernimmt, geschieht es sogar, dass auch der Sehsinn kapituliert. Am schlechtesten steht es jedoch um den Geruchssinn. Dass er sich nicht digitalisieren lässt, hilft ihm erst recht nicht weiter.
Die Menschen haben seit Langem ein ambivalentes Verhältnis zu ihrem Geruchssinn. Lange Zeit galt er als der oberste und informativste Sinn von allen. Zu anderen Zeiten wurde er in Tabus gehüllt und zur Stigmatisierung von Randgruppen wie Bauern, Arbeitern oder Immigranten missbraucht.
Sein endgültiger Niedergang begann mit der Aufklärung Ende des 18. Jahrhunderts. Im Gegensatz zu anderen Sinneseindrücken ließen sich die Gerüche nicht organisieren, sortieren und quantifizieren. Für die fortschreitenden Naturwissenschaften war dies ein Problem, aber es ging auch um Macht, Dominanz und Kontrolle.8 Dieser Aspekt ist bis heute immer wichtiger geworden, sowohl
in autoritären Regimes mit besonderem Interesse für Reinheit, Hygiene und Struktur als auch in demokratischen Gesellschaften. Geruch wird mit Unregierbarkeit, Erotik, Asozialem und Primitivität assoziiert, er gilt geradezu als Gegenstück zu Modernität und Fortschritt. In den letzten Jahrhunderten hat die Menschheit sich große Mühe gemacht, die vielfältigen Ursachen aller möglichen Gerüche zu bekämpfen. Die vollständige Abwesenheit von Gerüchen gilt heute als Ideal. Die wenigen Ausnahmen, die weiterhin toleriert werden, beschränken sich auf das Kochen, Parfümieren und Deodorieren – alles unter Kontrolle und meist mit kommerziellen Absichten.
Dieses Buch ist ein Plädoyer für den freien Geruchssinn in allen Nuancen von Schönheit bis Ekel. Es beginnt mit einer Einführung in die Wirkungsweise des Geruchssinns und die grundlegenden Bedingungen von Gerüchen, dann begibt es sich auf eine geruchshistorische Entdeckungsreise von den ersten Stadtgründungen des Altertums über die Pestepidemien des Mittelalters und die industrielle Revolution bis in unsere Gegenwart.
Die Perspektive ist in erster Linie auf die europäische Kultur gerichtet, denn in unserem Kulturkreis hat der Geruchssinn den größten Widerstand erfahren. Unsere Häuser und Städte sind zu Geruchswüsten geworden, und wir entwickeln uns immer mehr zu sensorischen Analphabeten. Doch gerade dies könnte uns zum Verhängnis werden in einer Welt, in der etablierte Routinen und Gesellschaftsstrukturen wackeln, weshalb Intuition, Improvisation sowie die Entlarvung falscher Information wichtiger als je zuvor werden.
Unser Geruchssinn muss erhalten bleiben, sonst verkümmern wir, und er entwickelt sich nur durch Erfahrung.9 Glücklicherweise lernen wir in dieser Hinsicht schnell. Während andere Sinnes-
eindrücke mehrere Wiederholungen brauchen, um sich festzusetzen, wird selbst ein kurzes Schnuppern selten vergessen.10 In jedem der zwanzig Kapitel dieses Buches wird ein besonderer Geruch vorgestellt, der für die meisten von uns eine wichtige Rolle im Leben spielt – eine Art Kanon des Geruchssinns. Dabei gehe ich auf den Ursprung und die chemischen Eigenschaften der jeweiligen Gerüche ein. Um den Wiedererkennungseffekt zu triggern, beschreibe ich ihre Eigenschaften und Besonderheiten. Ich möchte dazu beitragen, dass wir auch weiterhin die Witterung aufnehmen können.
Das Buch beruht größtenteils auf zeitgenössischen Quellen, meist aus der Belletristik und vor allem Komödien und Satiren, in denen Gerüche wichtiger als in anderen Genres sind. Moderne Geschichtswerke ziehe ich selten heran, denn sie übersehen oft, dass es früher nicht nur anders gerochen hat, sondern auch der Geruchssinn selbst einen anderen Status genossen hat. Eine Ausnahme bildet die kleine Gruppe Soziologen, Sozialanthropologen und Kulturhistoriker, die sich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ernsthaft mit dem Verhältnis der Menschen zum Geruch befasst haben, darunter die Kanadierin Constance Classen, der Norweger Trygg Engen und die Franzosen Alain Corbin und Robert Muchembled.
Viele haben zur Entstehung dieses Buches beigetragen, nicht nur durch fachliche Expertise, sondern auch durch Teilnahme an der In-situ-Erforschung und Beschreibung der Gerüche. Besonderer Dank gilt Anders Eik Pilskog, Andrea Bergh Pettersen, Anna Fara Berge, Dag Roalkvam, Jan Gunnar Skjeldsøy, Marie Rosenberg, Nina Castracane Selvik, Simon Holmen, Sofía Lersol Lund, Stian Tveiten, Svanhild Naterstad und Trond Berge.
Vor allem aber danke ich der Künstlerin Annette Rosenberg für die Illustrationen des Buches. Die Farben, Formen und Texturen ihrer Kunstwerke entstanden auf der Grundlage intensiver –und bisweilen äußerst anstrengender – Untersuchungen von Gerüchen.
Ein Buch über Gerüche zu illustrieren, ist zweifelsohne ein Paradox. Doch wir müssen es einsehen: Begeisterung funktioniert heutzutage vor allem über das Auge. Im Idealfall wird dies auch den Geruchssinn der Leser:innen wecken.
Bjørn Berge Lista, Sommer 2024
Hier draußen an der Küste können selbst im Sommer ohne Vorwarnung Stürme aufkommen. Dann erwacht der Sinnesapparat durch das Brausen gewaltiger Wellen, das Klackern der Rollsteine, plötzliche Temperaturstürze in salziger Gischt, weißen Schaum, der aufgewirbelt wird und wie große Möwen durch die Luft fliegt –und vor allem durch den Geruch.
Es ist der Geruch des Meeres. Nicht des trüben Brackwassers eines Hafens oder eines durch Lachszucht verunreinigten Fjordes. Es ist der Urgeruch, der seit Millionen Jahren gleich ist, unendlich frisch und stark, mit einem deutlichen Einschlag von faulen Eiern, medizinischem Jod und einem leichten Beigeschmack von gekochtem Kohl, der jedoch nicht stört.
Als der junge Archäologe Rodolfo Lanciani in den 1870er-Jahren ein riesiges, 2000 Jahre altes Massengrab – ein sogenanntes puticuli – östlich des Esquilin-Hügels in Rom entdeckte, wurde er über Nacht berühmt. Er berichtete von einer «zusammenhängenden, schwarzen Masse, zäh, pestilent und ölartig», die offenbar Wind und Wetter ausgesetzt war:
Der Leser wird mir kaum glauben, wenn ich sage, dass Menschen, Tiere, Körper, Kadaver und aller möglicher Abfall in diesen offenen Gruben aufeinandergehäuft wurden. Stellen Sie sich die Verhältnisse an diesem vermaledeiten Ort zu Zeiten der Pest vor, wenn all dies den lieben, langen Tag offen herumlag!53
Der Legende zufolge wurde Rom 750 Jahre vor unserer Zeitrechnung gegründet. Über 5000 Jahre nach den steinzeitlichen Höhlenbewohnern von Jæren sind wir in einer urbanen Gesellschaft angekommen. Was früher ein Bündnis einzelner Stämme war, ist inzwischen von komplexen Strukturen mit Ordnung, Disziplin und Arbeitsteilung abgelöst worden. Meist wird das römische Stadtwesen auch mit ausgeprägter Reinlichkeit und Hygiene verbunden.54 In der Schule lernen wir von Aquädukten, die kristallklares Wasser in öffentliche Bäder und Springbrunnen leiteten, sowie von groß angelegten Abwassersystemen. Mit ihren mächtigen Gewölben aus massiven Steinblöcken gilt Roms Cloaca Maxima – die «Hauptkloake» – bis in unsere Zeit als Vorbild der Abwasserkanalisation in Europas Großstädten.55 In Wirklichkeit hatte sie nicht viel mit echter Kloake zu tun. Bis auf eine Handvoll verzierter Statuslatrinen im Forum war kaum eine Toilette an das System angeschlossen. Der Hauptzweck der Cloaca Maxima war es, eine Überschwemmung des tief gelegenen Stadtzentrums bei Sturzregen im Herbst und Winter zu verhindern. Nebenbei landete dies und das in der Kanalisation, zum Beispiel Leichen während der Pestepidemien oder der ein oder andere liquidierte Senator, dem auch das letzte bisschen Ehre geraubt werden sollte.56
Um das Jahr 0 produzierten die 450 000 Einwohner Roms mehr als 30 Millionen Liter Urin und 65 000 Tonnen Exkremente pro Jahr.57 Diese flossen in einfache Gruben in den Hinterhöfen. Meist war die Toilette Wand an Wand mit der Küche, weil derselbe Abfluss für Küchenabfälle genutzt wurde. Alles lief durch offene Rinnen nach draußen ab und versickerte mehr oder weniger im Erdboden. Das funktionierte halbwegs und erinnert an heutige Klär- oder Sickergruben. Der große Unterschied war jedoch, dass es keinen Geruchsverschluss gab. Zwar wurde der Abfluss ab und zu mit einem Eimer Wasser ausgespült, doch besonders in der Küche muss es stark gerochen haben. Der Geruch verteilte sich weiter in die Straßen und gehörte somit zu den permanenten Aromen der Stadt.
Draußen gab es noch mehr zu holen, unter anderem durch die allgegenwärtige Tierhaltung: Pferde, Maultiere, Hunde, Hühner, Enten, Gänse und mehr. Hinzu kamen die Abfälle der Schlachtereien, die Müllhaufen der Fischmärkte und die Ausdünstungen vieler Werkstätten und der Kleinindustrie, darunter die Wäschereien, die alten Urin zum Reinigen und Bleichen benutzten. Und mittendrin verbreiteten unzählige mobile Straßenküchen den Duft von Garum, einer fermentierten Fischsoße, deren übler Geruch fast schon legendarisch ist. Sie erfreute sich nicht nur wegen ihrer Würze großer Beliebtheit, sondern auch, weil sie so stark war, dass sie den Geschmack von verdorbenem Fleisch übertönte. Obwohl moderne asiatische Fischsoßen einen ähnlichen Umami-Geschmack haben, gehörte der Geruch von Garum vermutlich einer anderen Liga an.

Geruchsstoff
Trans-4,5epoxy-(E)-2decenal
Wahrnehmungsschwelle [ppb]
Wenn körperwarmes Blut aus einer kleinen Wunde rinnt, riecht man kaum etwas. Mit einem guten Geruchssinn und viel Aufmerksamkeit vernimmt man vielleicht ein leicht säuerliches und metallisches Aroma, das an rostiges Eisen oder Kupfer erinnert. Dies ist der Geruch frischen, sauberen Blutes, bei dem die Aldehyd-Verbindung Trans-4,5epoxy-(E)-2-decenal die Hauptrolle spielt. Der Siedepunkt des Stoffs ist hoch, aber weil die Wahrnehmungsschwelle sehr niedrig ist, erkennen Raubtiere auf der Jagd – Insekten, Haie, Vielfraße und viele mehr – selbst mikroskopische Mengen davon. Vielleicht gilt dies auch für die Werwölfe unter uns. Doch erst, wenn das Blut in großen Mengen strömt, wie in römischen Amphitheatern oder Feldhospitälern, ist die Dosis hoch genug, um von den meisten wahrgenommen zu werden. Dann verbreitet sich Unruhe.
Im Grunde ist die Nase des Menschen ein seltsames Organ. Sie sticht mitten im Gesicht hervor und ist manchmal lustig anzusehen. Im Fall Sigmund Freuds handelte es sich um ein ungewöhnlich umfangreiches Körperteil, und weil die Nase im Alter größer werden kann, erinnerte sie am Ende gar an ein Wurzelgemüse. Außerdem machte sie ihm ständig Probleme, sie lief oder war aufgrund geschwollener Schleimhäute verstopft.307
Freuds Freund, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Wilhelm Fliess, führte mehrere chirurgische Eingriffe in den Nasenhöhlen des
Psychoanalytikers durch, aber es half nichts. Im Gegenteil – vielleicht, weil er Freud Kokain als Medizin und Schmerzmittel verschrieb. Bedenkt man, dass Freud Kettenraucher war, darf man sich fragen, ob sein Geruchssinn überhaupt funktionierte.
Er muss seine Nase gehasst haben, denn auch in seinen Werken schreibt er dem Organ keinen anderen Sinn zu, als dass es die Brille trägt.
Nachdem die Miasma-Theorie widerlegt war, machten sich die Menschen deutlich weniger Gedanken über ihr Verhältnis zur Umwelt. Der Geruchssinn galt nicht mehr als lebenswichtig. Die Naturwissenschaft wandte sich erneut den Idealen der Aufklärung zu und stellte sich einstimmig auf die Seite Charles Darwins. Dieser hatte in seinem berühmtesten Werk, Über die Entstehung der Arten, behauptet, die Nase des Menschen liege evolutionär betrachtet ebenso weit entfernt wie dessen kleiner Zeh.308
Sigmund Freud bekräftigte diese Aussage mit einer psychologischen Erklärung: Der Geruchssinn sei kaum mehr als eine unnütze Reminiszenz aus der Zeit, als wir noch auf allen vieren liefen.309 Damals habe die Nase sich dichter an den Geschlechtsorganen befunden, deren Säfte den Geruchssinn stimulierten und ihn direkt mit der Fortpflanzung verbanden. Beim aufrechten Menschen sei der Abstand größer, und gleichzeitig habe der Sehsinn sich weiterentwickelt und den Geruchssinn überflüssig gemacht. Beim modernen Menschen, so Freud, könne sich übertriebenes Interesse an Gerüchen sogar zu Neurosen entwickeln.310 Im Fall eines verschärften Geruchssinns bestehe sogar die Gefahr einer Hysterie – ein Leiden, das vorwiegend Frauen betreffe.
Der britische Psychiater und Sexualforscher Henry Havelock Ellis vertrat denselben Standpunkt311: Der Geruchssinn sei symptomatisch für Patienten mit Perversionen.312 Jedoch müsse ein durchschnittlicher Europäer oder Amerikaner nicht verzweifeln, wenn er dem Einfluss der Gerüche einmal erliege, fügte er tröstend hinzu, denn es gehöre mehr dazu, um als Abweichler zu gelten.313 Der deutsche Psychiater Richard von Krafft-Ebing, der auch die Homosexualität als Krankheit betrachtete, erfand die Diagnose Olfactophilie oder Geruchsfetischismus, die sich bis heute in den Lehrbüchern hält.
Der Utilitarismus war eine Moralphilosophie, die im 19. Jahrhundert viele Anhänger fand. Seine Botschaft lautet kurz gesagt, dass man richtig handelt, wenn möglichst viele Menschen davon Nutzen haben. Um dies zu erreichen, muss sich das Individuum in allen gesellschaftlichen Belangen dem Kollektiv unterordnen. Anpassungsfähigkeit war gefragt, während die individuellen Sinneserlebnisse in Zaum gehalten und sogar verdrängt wurden, um den Prozess der Zivilisation voranzutreiben. Unter diesen Umständen war jegliche Verherrlichung des Geruchs ein Ausdruck der Regression zu früheren, primitiven Stadien.314
Wie wir gesehen haben, verweigerten die gesellschaftskritischen «Dekadenten» diese Anpassung und behaupteten stattdessen, Glück sei ein fragwürdiges und ganz und gar persönliches Konzept. Doch nach der Jahrhundertwende verlor ihre sinnesorientierte Strategie für viele den Reiz, sogar unter dem städtischen Bürgertum. Materialistisch orientierte Systeme wie der Kapitalismus, die Sozialdemokratie und der Kommunismus verstärkten
diesen Trend. Für die neuen Weltbilder waren rückhaltlose, individuelle Sinneserlebnisse schlichtweg irrelevant.315 Man verwies sie voll und ganz in den Bereich der Kunst.
Eine Welle des Optimismus und Zukunftsglaubens überspülte Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mithilfe enormer Mengen Beton wurden die Großstädte noch größer, und die Menschen zogen in Massen vom Land in die Städte.
In den nun entvölkerten Dörfern hatten die Menschen sich per Handschlag begrüßt, einander also – mit der zugehörigen Andeutung von Geruch – berührt, und auf der Straße miteinander geschwatzt. In den Städten waren alle Fremde. Fast jeder Kontakt war allein auf den Sehsinn beschränkt, der in überfüllten Straßen und Verkehrsmitteln pausenlos überreizt wurde.316 An menschlichem Geruch blieb nur der kleinste gemeinsame Nenner der Massen übrig.
Dafür betraten die neuen Stadtbürger eine nie dagewesene Geruchswelt. Elektrische Straßenbahnen ratterten Funken sprühend über geölte Schienenstränge, und immer mehr Fahrzeuge wurden von Verbrennungsmotoren angetrieben. Die Straßen, auf denen früher der Pferdemist gedampft hatte, wurden nun in blaugraue Abgase gehüllt, die bald in allen Städten Europas den Grundgeruch bildeten. Er war beißend und streng und brannte in den Augen, aber die Menschen akzeptierten ihn ohne Weiteres als notwendiges Übel für die Funktionalität des Stadtlebens.317
Geruchsstoff
[°C]
nehmungsschwelle [ppb]
Stickstoffdioxid
Eine Tankstelle ist eine Geruchswelt für sich. Unter den Kohlenwasserstoffen, welche die Hauptbestandteile von Benzin und Diesel ausmachen, war Benzol (auch Benzen genannt) lange Zeit der dominierende Geruchsstoff. Sein einfaches, scharfes und süßes Aroma – fast wie von sauren Drops – gehört für viele zu den guten Kindheitserinnerungen, weil wir es mit Ausflügen und Ferien verbinden. Aber Benzol greift auch das Nervensystem an, ist krebserregend und schädigt das Erbgut. Im Treibstoff ist es deshalb heute durch den weniger gesundheitsschädlichen Stoff Toluol ersetzt worden. Dieser hat einen etwas höheren Siedepunkt, riecht aber ebenso scharf und süßlich. Er kann die gleichen Nerven- und Erbgutschäden wie Benzol verursachen, braucht jedoch eine höhere Dosis dazu. Außerdem kann der Dampf allergische Reaktionen auslösen.
Bjørn Berge ist ein norwegischer Sachbuch-Autor und Architekt. Er veröffentlichte bereits zahlreiche Artikel und Bücher über Geschichte, Architektur und Bauökologie.
1. Auflage: 2025
ISBN 978-3-258-08436-7
Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © 2025 für die deutschsprachige Ausgabe: Haupt Verlag, Bern Jede Art der Vervielfältigung ohne Genehmigung des Verlages ist unzulässig.
Aus dem Englischen übersetzt von Frank Zuber, D-Wiesbaden
Satz der deutschsprachigen Ausgabe: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, D-Göttingen Umschlagabbildungen: vorne: Vera Makeeva/iStock Illustrationen: Anette Rosenberg
Das Werk wurde aus dem Norwegischen ins Deutsche übersetzt mit der finanziellen Unterstützung von NORLA.
Die norwegischsprachige Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel LUKT – Fortellingen om en falmet sans bei Spartacus publishing in Zusammenarbeit mit Northern Stories, Norwegen.
Copyright © Bjørn Berge, Spartacus publishing 2024. Veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Northern Stories.
Gedruckt in Bosnien und Herzegowina
Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Weise für das Training von Technologien oder Systemen der künstlichen Intelligenz verwendet oder vervielfältigt werden. Die Verwendung der Inhalte für das Text- und Data-Mining ist untersagt.
Wir drucken mit mineralölfreien Farben und verwenden FSC®-zertifiziertes Papier. FSC® sichert die Nutzung der Wälder gemäß sozialen, ökonomischen und ökologischen Kriterien.
Diese Publikation ist in der Deutschen Nationalbibliografie verzeichnet. Mehr Informationen dazu finden Sie unter http://dnb.dnb.de.
Der Haupt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
Wir verlegen mit Freude und großem Engagement unsere Bücher. Daher freuen wir uns immer über Anregungen zum Programm und schätzen Hinweise auf Fehler im Buch, sollten uns welche unterlaufen sein.
Haupt Verlag AG Verantwortlich in der EU (GPSR): Falkenplatz 14 Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH CH-3012 Bern Kreidlerstr. 9 herstellung@haupt.ch DE-70806 Kornwestheim www.haupt.chhaupt@brocom.de
Die Welt ist voller Gerüche, manche sind leicht und angenehm, andere fürchterlich penetrant. Sie lösen Angst oder Freude, Genuss oder Ekel, Sympathie oder Abneigung, Erinnerungen oder längst vergessene Sehnsüchte in uns aus. Gerüche beeinflussen unsere Stimmungen ebenso wie unsere Entscheidungen und prägen unser soziales Verhalten weit mehr, als es uns bewusst ist.
Dieses Buch ist eine Hommage an den Geruchssinn in all seinen Facetten. Es nimmt Sie mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Geschichte der Gerüche, von den ersten Stadtgründungen des Altertums über die Pestepidemien des Mittelalters und die industrielle Revolution bis in unsere Gegenwart. Dabei zeigt es nicht nur auf, wie vielfältig die Welt der Gerüche ist, sondern auch, wie sehr Gerüche uns und unsere Kultur beeinflusst haben und dies bis heute tun.
ISBN 978-3-258-08436-7