Biografische bergänge innovativ gestalten
Übergänge des Arbeitsmarktes:
Orte der Sozialpolitik, Sozialer Arbeit und sozialer
Innovationen
Carlo Knöpfel
11
«Jetzt oder nie» – Übergänge im Lebenslauf. Gespräche mit Betroffenen
Marcel Krebs und Christoph Mattes
27
Auf allen Ebenen aktiv für ehemalige
Heim- und Pflegekinder
Susanne Bachmann
45
Unterstützung von Menschen mit Behinderung beim Übergang ins Rentenalter
Ruth Treyer und Anselmo Portale
59
Kunst im Heft: zwischenfeldern
Janice Beck
69 Compassionate Communities: Übergänge am Lebensende gemeinschaftlich gestalten
Claudia Michel, Sibylle Felber und Marina Richter 85 Übergang in die Selbstbestimmung : Soziale Innovation in der inklusiven Gesellschaft
Tobias Studer 97 Impressum
108
Soziale Inn ovati o n ’25
Editorial
Susanne Bachmann
Simone Girard
Christoph Mattes
Marcel
Krebs
Die diesjährige Tagung Soziale Innovation am 26. Februar 2025 befasste sich mit dem Thema «Übergänge gestalten: Erfolgsfaktoren und Risiken sozialer Innovationen». Der Begriff «Übergänge» bezog sich dabei sowohl auf individuelle Lebensverläufe wie auf Transitionen in Organisationen als auch auf gesellschaftlichen Wandel. Die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift «Soziale Innovation» knüpft hier an und setzt sich mit einem dieser drei Aspekte auseinander: soziale Innovationen in Bezug auf Übergänge im Lebenslauf.
Uns interessiert, welche Bedürfnisse im Zuge von biografischen Übergängen entstehen oder sich verändern. Wie antworten Institutionen der sozialen Hilfe darauf? Und inwiefern ist dies innovativ? Diesen Fragen gehen wir anhand von Erfahrungsberichten aus der Praxis, mit Forschungsbefunden und theoretischen Kommentaren nach.
Die Beiträge dieser Ausgabe werfen einen Blick auf verschiedene biografische Lebensphasen und diskutieren, was diese Übergänge kennzeichnet und wie soziale Organisationen und Projekte die entsprechenden Bedarfe und Merkmale dieser Übergänge im
Lebensverlauf angehen. Vor welchen Herausforderungen steht die Soziale Arbeit hierbei?
Mit der Tagungsreihe «Soziale Innovation» bietet die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW ein Forum, um soziale Innovation als Konzept und soziale Praxis in ihrer Breite sichtbar und für die Soziale Arbeit fruchtbar zu machen. Schon mal vormerken: Am 24. Februar 2027 findet die nächste Tagung «Soziale Innovation» in Olten statt.
Ein Rückblick auf die diesjährige Tagung findet sich hier: soziale-innovation-fhnw.ch. Unter diesem Link sind ebenfalls alle Ausgaben der Zeitschrift zu finden und die Zeitschrift kann kostenlos abonniert werden.
Übergänge des Arbeitsmarktes:
Orte der Sozialpolitik, Sozialer Arbeit und sozialer Innovationen
Carlo Knöpfel
Die Schweiz ist eine Arbeitsgesellschaft, in der der Arbeitsmarkt die primäre Quelle für soziale Sicherheit bildet. Der gesellschaftliche Wandel beeinflusst diesen Arbeitsmarkt kontinuierlich. Dies prägt auch die Partizipation der Erwerbstätigen in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Die Übergänge des Arbeitsmarktes sind zentrale Orte der Steuerung des Arbeitsangebots. Sie müssen sich ebenfalls immer wieder den neuen Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels anpassen. Die Soziale Arbeit findet in diesen Übergängen eine wichtiges, aber heterogenes und föderal geprägtes Arbeitsfeld. Für die wirkungsvolle Gestaltung dieser Übergänge braucht es soziale Innovationen. Manche sind in den letzten Jahren etabliert worden, manche stehen noch an.
Knöpfel, Carlo (2025): Übergänge des Arbeitsmarktes: Orte der Sozialpolitik, Sozialer Arbeit und sozialer Innovationen. In: Soziale Innovation 2025. S. 11–24.
Der Arbeitsmarkt ist in der Schweiz Quelle der Identität, der Existenzsicherung und der sozialen Absicherung. Wer erwerbstätig ist, erhält Wertschätzung, ein Einkommen und Anrechte auf Sozialversicherungsleistungen. Sich um eine Anstellung zu kümmern, ist Ausdruck von Eigenverantwortung und zu eigen gemachter Schadenminderungspflicht (Lessenich 2008). Die Integration in den Arbeitsmarkt ist denn auch zentrales Element sozialstaatlichen Handelns und sozialarbeiterischer Bemühungen. Das Narrativ des aktivierenden Sozialstaats gibt dieser sozialpolitischen Strategie Ausdruck. Es bestätigt damit die Selbstzuschreibung als eine Arbeitsgesellschaft.
Der schweizerische Arbeitsmarkt erweist sich dabei im internationalen Vergleich als äusserst robust. Der Wirtschaft, dem Staat und dem «dritten Sektor» der organisierten Zivilgesellschaft gelingt es seit langer Zeit, sehr vielen Personen eine Anstellung zu vermitteln. Entsprechend hoch sind die Quoten der Erwerbsbeteiligung über alle Alterskategorien, Geschlechter und Nationalitäten hinweg. In den verschiedensten Statistiken findet sich die Schweiz immer auf den vordersten Rängen, und dies seit Jahren (BFS 2024). Trotzdem kennt auch die Schweiz prekäre Arbeitsverhältnisse und einen Niedriglohnsektor, gibt es (strukturelle) Arbeitslosigkeit und findet eine kontinuierliche Aussteuerung von Langzeitarbeitslosen statt. Zudem finden nicht alle, die auf Stellensuche sind, sofort den Zugang zum Arbeitsmarkt.
Der hiesige Arbeitsmarkt ist alles andere als ein statisches Gebilde. Er ist vielmehr durch ein kontinuierliches Wachstum und steten Strukturwandel geprägt. Die Zahl der Arbeitsplätze wächst seit Jahren, die Anteile der verschiedenen Branchen an diesem Stellenwachstum verändern sich aber im Laufe der Zeit deutlich. Der landwirtschaftliche Sektor ist beschäftigungsmässig nur noch eine Randerscheinung. Der industrielle, gewerbliche und bauliche Sektor kann die Zahl der Arbeitsplätze gerade so halten. Der Dienstleistungssektor hat sich hingegen sehr dynamisch entwickelt und dominiert heute in vielfältiger Weise das Bild des schweizerischen Arbeitsmarktes (BFS 2025a). Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass nicht primär die privatwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen für zusätzliche
Arbeitsplätze sorgen, auch nicht die zivilgesellschaftlich ausgerichteten Nonprofit-Organisationen, sondern die staatlichen und staatsnahen Branchen aus dem Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen.
Der gesellschaftliche Wandel verändert den Arbeitsmarkt
Die verschiedenen Facetten des gesellschaftlichen Wandels nehmen in sehr unterschiedlicher Weise Einfluss auf die fortlaufende Gestaltung und Umformung des Arbeitsmarktes (Knöpfel 2011). Der demografische Wandel ist in der Schweiz vor allem durch ein anhaltendes Bevölkerungswachstum und eine Verschiebung der Gewichte zwischen den verschiedenen Altersgruppen geprägt (BFS 2025b). Bald haben alle Jahrgänge der Babyboomer (1946 –1964) den Arbeitsmarkt verlassen. Sie tragen zu einer deutlichen Zunahme der Rentnerinnen und Rentner bei und werden bald auch die Zahl der Hochbetagten markant ansteigen lassen. In drei Dekaden wird jede zehnte Person über 80 Jahre alt sein. Demgegenüber nehmen die jungen Erwachsenen in immer geringerer Anzahl ihre Erwerbsarbeit auf. In den nächsten Jahren wird diese Lücke immer grösser werden. Manche zweifeln, ob sie durch eine noch höhere Migration gedeckt werden kann – und soll. Dies ist allerdings nicht nur eine Frage der Quantität, sondern auch der Qualität. Werden genügend ausländische Arbeitskräfte mit den «richtigen» Qualifikationen zuwandern? Oder wird man die Lücke mit einer noch besseren Nutzung des inländischen Arbeitskräftepotenzials schliessen können?
Der wirtschaftliche Wandel ist gerade in der Schweiz und trotz aller Turbulenzen von einer weiter fortschreitenden Globalisierung und einem sich intensivierenden Standortwettbewerb geprägt. Die Schweiz will und kann nicht für alle unternehmerischen Aktivitäten attraktiv sein. Die Firmenlandschaft ist kein zufälliges Ergebnis, sondern Ausdruck einer breit angelegten Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft auf allen föderalen Ebenen des Staates. Dabei sind fast alle Politikbereiche involviert. Die schweizerische Standortpolitik reicht vom Berufsbildungswesen bis zur
Wissenschaftsförderung, vom Steuer- bis zum Sozialstaat, von der Bauzonenplanung bis zum Service public, von der Sicherheit im öffentlichen Raum bis zur Freizeitgestaltung. Herausgekommen ist ein Standort, der vor allem für kapital-, wissens- und wertschöpfungsintensive unternehmerische Tätigkeiten attraktiv ist. Ein solches Profil muss durch den Arbeitsmarkt «bedient» werden. Die Zahl der jungen Erwachsenen mit einem Tertiärabschluss ist entsprechend angestiegen. Insbesondere haben die Frauen in ihrem Streben nach höheren Bildungsabschlüssen massiv aufgeholt und finden sich anteilsmässig auf dem gleichen Niveau wie die Männer (BFS 2025c). Bei der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt lässt sich eine ähnliche Entwicklung beobachten. Auch hier hat der Anteil der Arbeitsmigrantinnen und -migranten mit einem Tertiärabschluss markant zugenommen (Wanner/Steiner 2018). Dabei ist zu beobachten, dass sich der Wettbewerb um die Talente insbesondere in Europa verschärft. Hat die Schweiz genügend gute Argumente, um in dieser Situation immer die «richtigen» Personen in ausreichender Zahl im Ausland zu bekommen?
Der technologische Wandel ist durch eine fortschreitende Automatisation, Digitalisierung und Verwendung von KI-Tools geprägt. Die Automatisation ist in erster Linie im industriellen Sektor erkennbar, und dies seit vielen Jahren. Sie ist eine Alternative zur Produktionsverlagerung in sogenannte Billiglohnländer. Inzwischen durchdringt die Automatisation die Herstellung von Gütern so weit, dass Rückverlagerungen, zum Beispiel in der Textil- oder Uhrenbranche, in die Schweiz zu beobachten sind. Ein Transfer von Arbeitsplätzen ist damit allerdings kaum verbunden. Die Digitalisierung und die Verwendung von KI zeigen sich in besonderem Masse im Bereich der Dienstleistungen (McKinsey 2019). Immer mehr Dienste werden nicht mehr analog angeboten, sondern nur noch über entsprechende Internetangebote. Damit verschmelzen die Rollen der Konsumentinnen und Konsumenten mit jenen der Produzentinnen und Produzenten von Dienstleistungen. Das sogenannte Prosumer-Phänomen wird immer häufiger und stärker sichtbar. Inzwischen können zum Beispiel Hotels und Flüge selbst gebucht werden, Ausbildungen
und Zertifikate selbständig online erworben werden, Bestellungen on demand erledigt werden und vieles Weiteres mehr. Das bedeutet nicht, dass die reale Erbringung von Dienstleistungen obsolet wird – geflogen wird trotzdem mit einer Maschine, bestellte Kleider werden trotzdem genäht und nach Hause geliefert –, aber mehr und mehr beratende und organisierende Aufgaben und damit auch entsprechende Arbeitsplätze fallen weg. Dies sind nicht nur Arbeitsplätze mit geringen Qualifikationsansprüchen, sondern zunehmend trifft es auch solche, für die eine berufliche Ausbildung Voraussetzung ist. Diese Entwicklung bedroht den Status der Mittelschicht. Werden Menschen mit mittleren Qualifikationen auch in Zukunft Stellen finden, die ihren Einkommenserwartungen entsprechen? Oder wird hier der Staat mit umfangreichen Umschulungs- und Weiterbildungsangeboten den Strukturwandel, etwa hin zu einer CO2 -armen und auf Care-Arbeit fokussierten Arbeitsgesellschaft unterstützen müssen (Travail.Suisse 2021)? Allein diese knappe Skizze lässt erahnen, welche Ansprüche der Arbeitsmarkt an die hiesigen Beschäftigten stellt, welche Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen gesucht sind und wo unter Umständen in berechtigter Weise von einem Fachkräftemangel die Rede sein kann. Deutlich wird auch, dass in einer solchen Konstellation gleichzeitig Arbeitskräfte gesucht sind und eine nicht geringe Zahl von Erwerbslosen beobachtet werden kann. Dies wird als mismatching bezeichnet und beschreibt die Differenz zwischen dem Anforderungsprofil der offenen Stellen und dem Fähigkeitsprofil der Stellensuchenden. Damit klingt auch an, wo sich die Herausforderungen finden lassen, die Personen im erwerbsfähigen Alter zu meistern haben, wenn sie in den Schweizer Arbeitsmarkt eintreten und dort verbleiben möchten. Und es deutet sich an, was – im Rahmen der Sozialen Arbeit – getan werden muss, um die anhaltende Integration in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten und für die Stellensuchenden gelingende Übergänge zu organisieren.
Die Akteure, welche die Übergänge des Arbeitsmarktes gesetzlich rahmen und inhaltlich gestalten, sind allesamt darüber hinaus einer gesellschaftspolitischen Aufgabe verpflichtet: Sie haben dafür zu sorgen, dass
sich im hiesigen Arbeitsmarkt stets genügend Erwerbstätige in passender Qualifikation finden, um den Bedarf der Wirtschaft, des Staates und des Nonprofit-Sektors an geeigneten Arbeitskräften zu befriedigen.
Damit wird auch deutlich, dass die Übergänge des Arbeitsmarktes entscheidende arbeitsmarktpolitische Orte darstellen, um die individuellen Erwartungen von Stellensuchenden und die gesellschaftspolitischen Herausforderungen zu erfüllen. An diesen Schlüsselstellen ist die Soziale Arbeit in hohem Ausmass präsent und aus professioneller Sicht gefordert. Arbeitsintegration ist nicht nur Dreh- und Angelpunkt der Arbeitsmarktpolitik, sondern auch einer der wichtigsten Orte sozialer Innovationen.
1. Der primäre Eintritt in den Arbeitsmarkt
Die angesprochenen Orte dieser Bemühungen, die arbeitsmarktlichen Übergänge in der beschriebenen Weise auszurichten und zu gestalten, lassen sich typologisch in drei Kategorien fassen. Da ist zunächst die Kategorie des primären Eintritts in den hiesigen Arbeitsmarkt. Dabei darf nicht nur an all die jungen Erwachsenen gedacht werden, die nach einer immer häufiger längeren beruflichen und wissenschaftlichen Ausbildung eine feste Anstellung suchen. Noch immer gibt es auch Personen, in der Regel Frauen, die zwar eine Ausbildung absolvieren, dann aber erst nach der Familienphase eine feste Anstellung anstreben.
Zu jenen, die in ihrer Erwerbsbiografie ebenfalls zum ersten Mal im Arbeitsmarkt Fuss fassen wollen, gehören auch alle, die unter dem Titel der arbeitsmarktlichen Migration in die Schweiz kommen, sei dies im Rahmen der Personenfreizügigkeit aus den EU- und EFTA-Ländern, sei dies über Kontingente aus Drittstaaten. Zudem gehören auch alle Personen dazu, die über das Asylwesen als vorläufig Aufgenommene oder anerkannte Flüchtlinge aufgefordert werden, sich ihre Existenz in Zukunft durch die Aufnahme einer Erwerbsarbeit selber zu finanzieren, und schliesslich auch die Gruppe der Sans-Papiers, von denen die meisten ohne Erwerbsarbeit in der Schweiz nicht bleiben könnten,
weil sie keine Ansprüche auf sozialstaatliche Leistungen zur Existenzsicherung geltend machen können. Ausser bei Letzteren ist der Sozialstaat bei den aufgezählten Gruppen gefordert, Unterstützung zu leisten und eine rasche arbeitsmarktliche Integration für jene Personen herbeizuführen, denen es nicht gelingt, selbständig eine Arbeitsstelle zu finden. Dazu sind in den letzten Jahren eine grosse Zahl von sozialen Innovationen auf der rechtlichen, organisatorischen und individuellen Ebene angestossen und realisiert worden. Dies kann hier nur mit ein paar exemplarischen Hinweisen illustriert werden.
So hat sich die Schweiz beispielsweise schon vor geraumer Zeit ein berufsbildungspolitisches Ziel gesetzt: 95 Prozent eines jeden Jahrgangs sollen mindestens einen Abschluss auf Sekundarstufe II erreichen und damit die entscheidenden Voraussetzungen für eine gelingende Erwerbsbiografie mitbringen. Dieses Ziel konnte bis heute nicht vollständig erreicht werden. Inzwischen liegt der Wert bei knapp über 90 Prozent. Insbesondere junge Erwachsene, die erst mit dem Familiennachzug in die Schweiz gekommen sind, scheitern in höherem Ausmass an dieser Hürde (SKBF 2023).
Eine weitere soziale Innovation ist das Programm zur Anerkennung von Berufszertifikaten, die im Ausland erworben wurden. In festgelegten Verfahren findet eine Validierung des erreichten Bildungsniveaus und der damit erworbenen Berufserfahrung statt. Die Kantone bieten dann in Zusammenarbeit mit den Hochschulen Möglichkeiten zur Erreichung von spezifischen Berufszertifikaten an, insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen (SBFI 2025).
Zur Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials hat der Bund ein breit gefächertes Massnahmenpaket zusammengestellt. Hier geht es unter anderem darum, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, damit mehr Frauen mit höheren Beschäftigungsgraden erwerbstätig sein können, den Übergang in die Pensionierung zu flexibilisieren und mit besonderen Integrationsmassnahmen die arbeitsmarktliche Integration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen zu verstärken (Bundesrat 2024).
Weiter wird in der Sozialhilfe jungen Erwachsenen ohne Ausbildung ein besonderes Augenmerk geschenkt. Diese Gruppe, der es nicht gelingt, die Regelstrukturen zu durchlaufen, wird immer grösser. Hier sind Angebote notwendig, die sehr individuell ausgestaltet werden und bei denen es zunächst darum geht, überhaupt Voraussetzungen zu schaffen, die eine berufliche Ausbildung möglich machen. Im Vordergrund stehen in diesen Programmen zumeist die soziale Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Hier entstehen neue Angebote und Programme, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden und intensiv evaluiert werden (Bochsler 2024).
Eine besondere Herausforderung stellt die wachsende Zahl von jungen Erwachsenen dar, die psychisch erkranken. Im Moment erhält diese Gruppe vergleichsweise rasch eine Rente der Invalidenversicherung zugesprochen. Fachkreise kritisieren diese Entscheide und fordern soziale Innovationen, mit denen auch diesen Betroffenen eine Chance zu einer arbeitsmarktlichen Integration gewährt werden könnte (Baer et al. 2015).
2. Der zirkuläre Aus- und Eintritt in den Arbeitsmarkt
Die zweite Kategorie kann als zirkulärer Aus- und Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt beschrieben werden. Auch hier liegt der Gedanke nahe, sich auf die erwerbslosen Personen zu konzentrieren. Dazu gehören all jene, die aus saisonalen, konjunkturellen oder strukturellen Gründen ihre Stelle verloren haben, über eine kürzere oder auch längere Zeit arbeitslos waren, dann aber von alleine, mit zivilgesellschaftlicher oder aber auch mit staatlicher Unterstützung wieder einen Job gefunden haben. Doch dieser Blick ist zu eng.
Zirkuläre Aus- und Wiedereintritte erleben auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen eine gewisse Zeit nicht erwerbstätig sein können. Dabei ist nicht nur an Krankheit und Unfall zu denken, sondern auch an das Risiko der Invalidität. Auch in dieser Kategorie lassen sich zahlreiche soziale Innovationen finden, die in den letzten Jahren entwickelt wurden und sich inzwischen in entsprechenden gesetzgeberischen Festschreibungen und organisatorischen Ausformungen manifestieren.
Ferner gibt es eine dritte Gruppe mit zirkulären Aus- und Eintritten in den Arbeitsmarkt. Das sind jene, die in der Familienphase die Erwerbsarbeit ruhen lassen, sich auf die Care-Arbeit konzentrieren und später, wenn die Kinder selbständig(er) sind, wieder in den Arbeitsmarkt eintreten. Dieses Modell hat in den letzten Jahren vor allem unter jungen Frauen an Bedeutung gewonnen.
Auch in dieser Kategorie finden sich zahlreiche soziale Innovationen, manche sind schon älteren Datums, andere wurden erst vor wenigen Jahren realisiert. Auch hier kann nur eine kursorische Auswahl genannt werden:
In der Arbeitslosenversicherung wurde der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit mehr Gewicht gegeben. Zum einen werden die Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen RAV für Bemühungen zur Vermeidung der Aussteuerung belohnt, zum anderen wurde das Ziel, die Langzeitarbeitslosigkeit möglichst tief zu halten, auch in die neue Strategie der ALV aufgenommen (Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung 2023).
Für die Integration von arbeitslosen Personen finden sich mehr und mehr Organisationen, die über die klassischen Angebote wie Sprach- und Bewerbungskurse hinausgehen und auf ein verstärktes Coaching der Betroffenen und der potenziellen Arbeitgebenden setzen (vgl. Arbeitsintegration Schweiz 2025).
Mit den Reformen der letzten zwei Dekaden in der Invalidenversicherung wurde die Vorgabe «Integration vor Rente» weiter betont. Neu wurde die Früherkennung von drohender Invalidität als weiteres Instrument etabliert. Zudem setzen sich im Bereich der Reintegration Ansätze durch, die dem supported employment verpflichtet sind. Hier geht es darum, Menschen mit Beeinträchtigungen rasch wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen und dann erst die nötigen Massnahmen in die Wege zu leiten, die diesem Schritt Nachhaltigkeit verleihen können. Dieser Approach ist personenzentriert und basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit dem Betrieb, in dem diese Integrationsmassnahme greifen soll (vgl. Supported Employment Schweiz 2019).
Nochmals einen anderen Weg gehen erste Sozialdienste, die in ihren Bemühungen um eine soziale und
arbeitsmarktliche Reintegration von Sozialhilfebeziehenden auf Gruppenangebote setzen (z. B. das Pilotprojekt «FokusArbeit» in Biel, vgl. Soziale Innovation 2024, S. 89 ff.).
In Peer-to-Peer-Konstellationen werden eine gegenseitige Unterstützung und eine bessere Stabilisierung der prekären Lebenssituation angestrebt (Seebeck 2023).
3. Der finale Austritt aus dem Arbeitsmarkt
Schliesslich gelangen wir zur dritten Kategorie der Übergänge, dem finalen Austritt aus dem Arbeitsmarkt. Natürlich geht es hier zuallererst um die Pensionierung von Erwerbspersonen, die das Referenzalter erreicht haben. Aber es geht auch um all jene, die aus verschiedenen Gründen – seien diese der fehlenden Arbeitsmarktfähigkeit, dem Wunsch, sich unbezahlten Aufgaben zu widmen, oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen geschuldet –für immer den Arbeitsmarkt verlassen (müssen), obwohl sie das Rentenalter noch nicht erreicht haben. Schliesslich gehören in diese Kategorie auch Personen, seien es Schweizerinnen und Schweizer oder Ausländerinnen und Ausländer, die das Land auf Dauer verlassen.
Die Politik lässt diese Erwerbstätigen nur ungern den Arbeitsmarkt verlassen. Auch hier finden sich soziale Innovationen, die darauf angelegt sind, den finalen Austritt zu verzögern. Dies kann mit ein paar Beispielen illustriert werden: Die naheliegendste Massnahme stellt die allgemeine Erhöhung des Rentenalters da. Dafür gab es bis heute keine Mehrheiten an der Urne. Doch kam es zu einer Anpassung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer. Zugleich wurde in dieser Vorlage auch eine Flexibilisierung der Pensionierung eingeführt. Neu spricht man darum auch nicht mehr vom Rentenalter, sondern vom Referenzalter, an dem sich die Berechnungen der Altersvorsorgeeinrichtungen (AHV und BV) ausrichten (BSV 2025).
Auch wenn das Risiko der Arbeitslosigkeit bei älteren Erwerbstätigen nicht höher ist als in der ganzen Erwerbsbevölkerung, so ist doch ein deutlich höheres Risiko für diese Altersgruppe gegeben, in eine Langzeitarbeitslosigkeit mit Aussteuerung zu rutschen. Diesen Menschen blieb bisher oftmals nur noch der Weg zum
Sozialamt. 2021 wurden aber für die Zeit zwischen der Aussteuerung und dem Bezug einer Altersrente die Überbrückungsleistungen eingeführt. Deren Bezug ist an zahlreiche Bedingungen geknüpft, was die Zahl der Bezügerinnen und Bezüger tief hält: Wer in den Genuss von Überbrückungsleistungen kommt, muss Gegenleistungen erbringen. In der Liste der möglichen Gegenleistungen sticht eine soziale Innovation heraus. So können sich ÜL-Beziehende auch sozial engagieren, als Freiwillige oder als betreuende Angehörige, um weiterhin Anspruch auf diese Sozialversicherungsleistungen zu haben. Damit wird erstmals der sozialen Integration Beachtung geschenkt (Knöpfel 2024).
Diese Entwicklung findet sich nun auch in der Sozialhilfe. Neu wird die soziale Integration als eigenständige Gegenleistung gewürdigt. Die Bemühungen um soziale Teilhabe werden stärker beachtet und höher gewichtet. Wie dies genau auszusehen hat, ist Gegenstand von Fachdiskussionen, an denen sich die Soziale Arbeit noch stärker beteiligen könnte.
Ausblick
Gibt es Gemeinsames, wenn man auf die geschilderten sozialen Innovationen blickt? Deutlich zeigt sich zunächst der grosse Aufwand, den die Schweiz betreibt, um Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen und darin zu halten. Auffallend ist auch, dass sich die Massnahmen immer stärker auf eine individuelle Ausgestaltung der Unterstützung ausrichten. Klar wird zudem, dass diese in der Logik des aktivierenden Sozialstaates nicht nur mit einer Belohnung, sondern immer wieder auch mit impliziten oder expliziten Sanktionierungsdrohungen einhergehen. Was auch deutlich wird: Noch immer wird der direkte Weg in den Arbeitsmarkt favorisiert und der Qualität der Arbeitskräfte zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das Motto «Bildung vor Integration» wird kaum zur Geltung gebracht (SKOS 2023), obwohl sich solche «Umweginvestitionen» rasch lohnen würden. Dies zeigt sich exemplarisch, wenn es darum geht, Menschen mit geringen Bildungsressourcen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Sie sollen keine besseren Aussichten auf eine gelingende Erwerbsbiografie erhalten,
sondern sich um jene Arbeiten bewerben, die sonst niemand machen möchte. Diese Haltung findet sich nicht nur bei den staatlichen Behörden, sondern auch bei den Betrieben selber, die ihre Weiterbildung lieber auf jene fokussieren, die schon einen üppig gefüllten Bildungsrucksack tragen, als auf jene, die in besonderem Masse von solchen Möglichkeiten profitieren könnten. Ihre Arbeitsmarktfähigkeit oder employability ist kein Thema (Knöpfel/Leitner 2017).
Trotz all dieser kritischen Bemerkungen muss auch festgehalten werden, dass die Arbeitsgesellschaft der Schweiz eine Jobmaschine ist, die nicht nur mehr und mehr Arbeitsplätze schafft, sondern der es auch gelingt, diese mit inländischen und ausländischen Erwerbstätigen meist adäquat zu besetzen. Sorge bereitet aber das weiter bestehende mismatching, also die Gleichzeitigkeit von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung auf der einen Seite und Mangel an qualifizierten Arbeitskräften auf der anderen Seite.
Wird das heutige Design der Übergänge des Arbeitsmarktes angesichts des gesellschaftlichen Wandels genügen? Die Schweiz wird ihre Standortpolitik fortschreiben und die Unternehmen werden als schnelle Adapterinnen neuer Technologien weiterhin Furore machen (Freiburghaus et al. 1991). Weniger positiv ist der Blick auf den demografischen Wandel. Die neuen Bevölkerungsszenarien des Bundesamtes für Statistik für die Jahre 2025 bis 2055 zeigen deutlich, dass sich auch in der Schweiz ein Ende des Bevölkerungswachstums abzeichnet (BFS 2025b). Im Referenzszenario wird um das Jahr 2035 die Zahl der Geburten unter jener der Sterbefälle liegen. Damit öffnet sich eine Schere, die nur noch mit einer grösser werdenden Zahl von Migrantinnen und Migranten geschlossen werden kann. Wird das zu realisieren sein? Die Frage reicht weit über den Arbeitsmarkt hinaus und markiert eine gesellschaftliche Herausforderung: Nicht die Beschäftigung dieser Menschen bereitet dabei Sorge, sondern die Bereitschaft der Hiesigen zu weiteren Integrationsleistungen, sei dies auf der persönlichen, der organisatorischen, der infrastrukturellen oder der gesellschaftlichen Ebene.
Damit gelangen wir an einen überraschenden Ort unserer Reflexion. Erneut geht es in gewisser Weise um
einen Übergang, nämlich den Zugang zur Schweiz über die Aussengrenzen hinweg. Dabei stehen nicht primär Fragen einer nachhaltigen arbeitsmarktlichen Integration ausländischer Arbeitskräfte im Vordergrund. Die Schweiz hat hier eine lange Geschichte und grosse Erfahrung gesammelt. Vielmehr geht es um die soziale Integration einer wachsenden Zahl von Arbeitsmigrantinnen und -migranten. Damit verbunden sind Fragen des Service public, also des Ausbaus der Infrastruktur in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Verkehr und Wohnen. Hier ist der Ort, der sich am stärksten durch einen Mangel an sozialer Innovation im Zusammenhang mit der Beteiligung am Arbeitsmarkt bemerkbar macht. Dabei darf eines nicht vergessen gehen: Die Bevölkerung wächst in der Schweiz, solange die Wirtschaft erfolgreich ist und der Staat dazu mit einem Ausbau des Service public beiträgt. Dieser Beitrag wäre auch dann nötig, wenn dieses Wachstum ausschliesslich durch eine Zunahme der inländischen Bevölkerung zustande käme.
Carlo Knöpfel, Prof. Dr. rer. pol., Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. carlo.knoepfel@fhnw.ch
Literatur
Arbeitsintegration Schweiz (2025): Jahresbericht 2024. https:// arbeitsintegrationschweiz.ch/de/ jahresbericht-2024/ (Zugriff 13.5.2025).
Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung 2023): Strategie öffentliche Arbeitsvermittlung 2030. https:// www.arbeit.swiss/secoalv/de/ home/menue/institutionen-medien/ projekte-massnahmen/strategiearbeitsvermittlung.html (Zugriff 13.5.2025).
Baer, N./Juvalta, S./AltwickerHàmori, S./Frick, U./Rüesch, P. (2015): Profile von jungen IV-Neurentenbeziehenden mit psychischen Krankheiten. Beiträge zur sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 16/15.
BFS (2025a): Beschäftigungsstatistik. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/ home/statistiken/industriedienstleistungen/unternehmenbeschaeftigte/beschaeftigungsstatistik.html (Zugriff 13.05.2025).
BFS (2025b): Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone 2025 –2055. Neuchâtel.
BFS (2025c): Bildungsniveau. https://www.bfs.admin.ch/bfs/ de/home/statistiken/arbeit-erwerb/ erwerbstaetigkeit-arbeitszeit/ merkmale-arbeitskraefte/ bildungsniveau.html (Zugriff 13.5.2025).
BFS (Bundesamt für Statistik) (2024): Arbeitsmarktindikatoren 2024. Neuchâtel.
BSV (2025): Stabilisierung der AHV (AHV 21). https://www.bsv.admin.ch/ bsv/de/home/sozialversicherungen/ ahv/grundlagen-gesetze/ahv-21.html (Zugriff 13.5.2025).
Bochsler, Y. (2024): Governing the Young Poor in Switzerland. How the Moral Foundations of Work Ethics Guide Social Assistance Discourse. Zürich: Seismo Verlag.
Bundesrat (2024): Gesamtschau zur Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials (Umsetzung Art. 121a BV). Bericht des Bundesrates. https://www.newsd.admin.ch/newsd/ message/attachments/86663.pdf (Zugriff 13.5.2025).
Freiburghaus, D./Balthasar, A./ Zimmermann, W./Knöpfel, C. (1991): Technik-Standort Schweiz. Von der Forschungs- zur Technologiepolitik. Bern: Haupt Verlag.
Knöpfel, C. (2024): Überbrückungsleistungen – wenige erfüllen die Kriterien. In: Zeitschrift für Sozialhilfe, 4, S. 18/19.
Knöpfel, C./Leitner, J. (2017): Trendund Umfeldanalyse für die Wirtschaftliche Hilfe der Sozialen Dienste Zürich. Soziale Dienste, Zürich.
Knöpfel, C. (2011): Soziale Sicherheit im Zeitalter der Globalisierung. In: Stadt Zürich, Beauftragte in Beschwerdesachen, Ombudsfrau (Hg): Ombudsarbeit mit Zukunft. Ausrichtung und Ansprüche. Zürich, S. 69–82.
Lessenich, S. (2008): Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus. Bielefeld: transkript Verlag.
McKinsey & Company Switzerland (2019): Switzerland Wake Up. Reinforcing Switzerland’s Attractiveness to Multinationals. Zürich.
SBFI (2025): Validierung von Bildungsleistungen. https://www.sbfi. admin.ch/sbfi/de/home/bildung/ berufsbildungssteuerung-und--politik/ projekte-und-initiativen/ berufsabschluss-fuer-erwachsene/ handbuch-berufliche-grundbildungfuer-erwachsene/validierung-vonbildungsleistungen.html (Zugriff 13.5.2025).
Seebeck, B. (2023) Biel will Perspektiven für viele. In: Zeitschrift für Sozialhilfe, 1, S. 18/19.
SKBF (2023). Bildungsbericht Schweiz 2023. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
SKOS (2023): Fokus Soziale Integration. Der Integrationsauftrag der Sozialhilfe. Grundlagenpapier. https://skos.ch/fileadmin/user_ upload/skos_main/public/pdf/ Publikationen/Grundlagenpapiere/ 2023_10_SKOS_Grundlagenpapier_ Soziale-Integration.pdf (Zugriff 13.5.2025).
Supported Employment Schweiz (2019): Was ist Supported Employment/ Supported Education? https:// supportedemployment.ch/wpcontent/uploads/SES_Standortpapier_ 09.19_final.pdf (Zugriff 13.5.2025).
Travail.Suisse (2021): Aktionsplan für eine auf dem gerechten Übergang basierende Klimapolitik. Ein neuer ökologischer und sozialer Arbeitsmarkt für die Schweiz. Bern.
Wanner, P./Steiner, I. (2018): Ein spektakulärer Anstieg der hochqualifizierten Zuwanderung in die Schweiz. Social Change in Switzerland, N° 16. doi: 10.22019/SC-2018-00008.
«Jetzt oder nie» –Übergänge im Lebenslauf. Gespräche mit Betroffenen
Marcel Krebs und Christoph Mattes
Während biografischer Übergänge verändert sich vielfach die Notwendigkeit der Betroffenen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Einerseits ist der Alltag, den Menschen bewältigen müssen, anders als zuvor. Aber auch die eigenen Ressourcen und Verwirklichungschancen werden verändert wahrgenommen, schaffen neue Möglichkeiten der Teilhabe oder beenden bislang gekannte Verwirklichungschancen.
Um darüber mehr zu erfahren, haben wir mit zwei Menschen gesprochen, die aufgrund eigener Suchtbetroffenheit langjährige Erfahrungen mit dem Hilfesystem haben und sich nach biografischen Übergängen immer wieder neu orientieren mussten. Von ihnen wollten wir wissen, wie sie die Veränderungen wahrgenommen haben, wie sich ihrer Ansicht nach die Inanspruchnahme von Hilfe verändert hat, was dabei gelungen oder auch nicht gelungen ist.
Krebs, Marcel/Mattes, Christoph (2025): «Jetzt oder nie» – Übergänge im Lebenslauf. Gespräche mit Betroffenen. In: Soziale Innovation 2025. S. 27–42.
Zwei Menschen berichten von tiefgreifenden Wendepunkten in ihrem Leben – vom Einstieg in eine Sucht, dem Verlust von Beziehungen, Obdachlosigkeit und dem oft mühsamen Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Biografische Übergänge erscheinen dabei als ambivalente Phasen zwischen Krise und Neubeginn, geprägt von Brüchen, Isolation und Hilflosigkeit, aber auch von Sinnsuche, Selbsthilfe und Unterstützung durch Peers.
Deutlich wird dabei, wie entscheidend es für Fachpersonen ist, das kurze Zeitfenster in Momenten der Veränderungsbereitschaft zu erkennen und durch passgenaue, niedrigschwellige Unterstützung zu nutzen. Die Erfahrungen der Betroffenen geben wertvolle Hinweise darauf, wo das Hilfesystem ansetzen muss und welche sozialen Innovationen notwendig sind, um Menschen in solchen Übergängen wirksam zu unterstützen.
Martin
Martin (Name geändert) ist 73 Jahre alt, lebt in der Region Solothurn und war als Elektroingenieur und Verkaufsleiter tätig. Mit 40 begann seine Alkoholabhängigkeit, die ihn zunehmend aus dem aktiven Leben drängte. Er ist seit fünfzehn Jahren trocken und engagiert sich heute in der Selbsthilfe.
Kindheit, Familie und erste Erfahrungen mit Sucht
Martin, wie hat dein Bezug zu Alkohol angefangen?
Martin Also, ich bin eigentlich in geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Mein Vater hat kaum getrunken, vielleicht mal ein Glas Wein zum Essen. Aber meine beiden Grossväter waren schwer alkoholkrank. Den einen kannte ich gar nicht; er ist gestorben, als ich ein Jahr alt war. Ich denke manchmal, das hat sich durchgezogen, vielleicht habe ich da ein Alkohol-Gen in mir. Trotzdem habe ich lange keinen Alkohol getrunken. Ich war sehr
sportlich, fuhr Velorennen, lebte gesund. Vielleicht im Winter mal ein Bier, aber wirklich nichts Ernstes.
Wann hat sich das geändert?
Martin Mit 40. Da fing ich an zu jagen. Ich war in einer Jagdgesellschaft am Jura, und dort wurde ziemlich viel getrunken. Und ich machte halt einfach mit. Es wurde dann langsam immer mehr. Aber ich war nie ein Beizenhocker. Ich war im Aussendienst tätig, trank tagsüber nichts, aber abends zu Hause, da gab ich Gas. Und dann, wenn ich Büroarbeit hatte, habe ich einfach immer wieder einen Schluck genommen. So ab dem Mittag. Das hat sich dann aufgebaut. Und bis am Abend war dann eine halbe Flasche weg. Portwein, Sherry, Campari –einfach was grad da war. Ich merkte nicht mehr, wie sehr sich das einschlich. Und ich redete mir immer ein: Ich habe es im Griff.
Gab es Warnzeichen, die du ignoriert hast?
Martin Ja, sicher. Die Leberwerte zum Beispiel. Der Hausarzt hat immer wieder gesagt: «Trinken Sie vielleicht ein bisschen viel?» Und ich: «Ach, nur ein Glas abends.» Oder in der Familie. Meine Schwestern haben manchmal etwas angedeutet. Aber man will es nicht hören. Man rechtfertigt sich.
Beziehung, Alkohol und erste Hilfesuche
Wie war die Rolle von Alkohol in deinen Beziehungen?
Martin In der Ehe war es anfänglich eher beiläufig. Wir tranken beide, aber nie extrem. Später änderte sich dies aber. Wenn wir tranken, waren wir wie Hund und Katze. Es brauchte wenig – ein schiefes Wort, und schon war ein Krach da. Das war sicher ein Grund für die Scheidung. Ich habe damals auch einmal einen Termin beim Psychologen gemacht. Ich wollte eigentlich die Beziehung reflektieren.
Wie war das Erlebnis beim Psychologen?
Martin Ich war nur einmal da. Am Schluss sagte er, wir machen einen neuen Termin, und er werde mir ein Rezept für Antabus geben. Ich kannte das nicht. Als er sagte, es sei gegen Alkohol, dachte ich: Was? Ich bin doch kein Alkoholiker! Ich wollte eigentlich über die Beziehung reden. Und so ging ich dann nicht mehr hin. Ich fühlte mich abgestempelt. Wenn er vielleicht gesagt hätte, er wolle mit meiner Frau zusammen arbeiten, vielleicht eine Paartherapie, dann wäre ich wohl länger geblieben. Aber so dachte ich einfach: Nein, das ist nicht mein Weg. Ich fühlte mich nicht gesehen. Und das ist genau das, was bei den AA anders ist.
Neue Beziehung und Eskalation
Und dann kam es zur Scheidung?
Martin Ja. Nach der Scheidung war ich lange allein. Dann hatte ich eine Partnerin. Wir wohnten aber nicht zusammen, das wollte sie nicht. Ich hätte gerne mit ihr gewohnt. Ich war viel allein. Und dann kam das Selbstmitleid. Ich ging dann zum Kästli, holte einen Whisky oder Grappa. Oder im Keller eine Flasche Wein. Das wurde dann viel. Zwei Flaschen Wein am Abend waren keine Seltenheit. Ich war auch Präsident der Jagdgesellschaft, dort gab es Konflikte. Abendelang telefonieren und dazu trinken. Es war zu viel. Und wenn ich getrunken hatte, war ich unerträglich. Ungepflegt, unpünktlich, aggressiv. Das hat meine Partnerin nicht mehr mitgemacht. Nach drei Jahren sagte sie: Jetzt ist fertig.
War das der Wendepunkt?
Martin Ja, das war für mich ein Tiefschlag. Nicht einmal die Scheidung war so schlimm. Aber dass sie gegangen ist – das hat mich getroffen. Ich habe gemerkt: Jetzt musst du etwas machen. Ich rief meinen Hausarzt an. Er hatte mich früher schon mal gewarnt, wegen meiner Leberwerte. Aber ich hatte das immer abgewiegelt.
Jetzt war es anders. Jetzt wollte ich wirklich Hilfe. Ich wusste, ich konnte so nicht weitermachen. Ich war am Punkt, wo ich bereit war, alles zu tun. Und das war neu für mich.
Hilfe holen
Wie lief das genau ab?
Martin Ich rief ihn an und sagte: Ich habe ein Alkoholproblem. Und er: «Merkst du es jetzt endlich?» Das hat mich getroffen. Er hatte ja schon bei den jährlichen Blutkontrollen gesagt, die Leberwerte seien nicht gut. Aber ich sagte immer: Nur mal ein Glas, oder einen Whisky. Nie zu viel. Typisch Alkoholiker. Er sagte, ich solle es mir überlegen bis Freitag. Wenn ich wolle, würden wir am Montag anfangen. Und ich solle auch einen Psychologen anrufen. Das habe ich gemacht. Montagmorgen war ich beim Hausarzt, bekam Antabus. Dann beim Psychologen. Und am Abend war ich schon beim ersten AA-Meeting.
Alles an einem Tag?
Martin Ja, das war so eine geballte Ladung. Und ich glaube, das war entscheidend. Wenn eines davon nicht sofort geklappt hätte, hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Dieses Zeitfenster war klein. Es war wie eine Energie, die da war – ich wusste: Jetzt oder nie. Und das hat mir unheimlich geholfen, dass alles so schnell ging. Ich hatte keine Zeit, es mir anders zu überlegen. Und ich sah es als Chance. Zum ersten Mal.
Wie war die Beziehung zum Hausarzt?
Martin Wichtig. Wir kannten uns auch ein wenig privat. Er war mal in einer Schnitzelbankgruppe, da habe ich ihn kennengelernt. Ich konnte offen mit ihm reden. Das half. Ich musste anfangs dreimal die Woche zu ihm, das Antabus nehmen. In der Praxis. Später durfte ich es zu Hause nehmen. Aber dieser Anfang war entscheidend. Es gab mir Struktur. Und ich hatte das Gefühl: Da schaut jemand. Ich bin nicht allein. Auch das half mir, durchzuhalten.
Erste Erfahrungen bei den AA
Wie war das erste Meeting bei den Anonymen Alkoholiker:innen (AA)?
Martin Ich kam rein, zwei Leute waren da. Mein erster Gedanke war: So will ich nie aussehen. Aber dann haben sie erklärt, wie das Meeting abläuft. Und ich habe gemerkt: Wir haben alle das gleiche Problem. Ich wurde herzlich aufgenommen. Ich fühlte mich verstanden. Ich durfte einfach da sein, zuhören, erzählen. Es hat mir Mut gemacht. Ich bin dann regelmässig zweimal pro Woche hingegangen. Das war wie ein Fixpunkt in der Woche. Ich habe dort wirklich viel gelernt. Mehr über mich selbst als in der Therapie. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich komme aus einem Gottesdienst, so gut hat mir das getan. Als hätte ich einen Heiligenschein. So stark war das Gefühl, angenommen zu sein.
Was meinst du damit: «Mehr gelernt als in der Therapie»?
Martin Beim Psychologen wirst du gefragt. Du gibst Antworten, aber du bleibst in deinem Muster. Bei den AA erzählen die Leute von sich. Und dann merkst du plötzlich: «Hey, das kenne ich. Genau so geht’s mir auch.» Und dann beginnt etwas in dir zu arbeiten. Du reflektierst anders. Du hörst dich selbst sprechen. Und da passiert Veränderung. Ich habe mich besser kennengelernt durch diese Gespräche. Es war wie ein Spiegel. Nicht belehrend, sondern begleitend.
Rückkehr zur Partnerin und Rückfall
Du hast erzählt, dass du wieder Kontakt mit deiner Partnerin hattest. Wie ist es dazu gekommen?
Martin Ich hatte sie nicht vergessen. Und ich dachte: Wenn ich aufhöre zu trinken, ergibt sich vielleicht wieder etwas. Nach etwa neun Monaten gingen wir wieder ins Kino.
Ich rief sie an, wir haben geredet. Sie war vorsichtig, aber offen. Und nach einem Jahr kamen wir tatsächlich wieder zusammen. Ich war überglücklich. Aber ich hatte auch Angst, dass ich es nicht würde halten können.
Und dann kam der Rückfall?
Martin Ja. Es war so ein schleichender Moment. Ein alkoholfreier Silvester, alle trinken alkoholfrei – ausser meine Partnerin und ihre Tochter. Die hatten noch richtigen Sekt im Keller. Und da war noch eine angebrochene Flasche. Ich habe zuerst nur den alkoholfreien getrunken. Dann kam der Gedanke: «Ein kleiner Schluck.» Und dann noch einer. Und dann war alles wieder da. Es war wie ein Sog. Ich hatte noch 300 Flaschen Wein im Keller. Der Rückfall dauerte drei Monate. Ich trank heimlich, morgens im Auto, vor der Arbeit. Ich lag wieder im Keller, weinend. Dachte: Du bist gescheitert. Komplett.
Bist du in dieser Zeit wieder zu den AA gegangen?
Martin Nein. Ich schämte mich. Ich wusste, ich müsste. Ich wusste auch, dass sie mich aufnehmen würden. Aber ich konnte nicht. Ich dachte: Du hast es verkackt. Du warst doch das gute Beispiel. Jetzt bist du zurück am Anfang. Das war hart. Ich fühlte mich wie ein Versager. Und irgendwann habe ich gesagt: Ich muss. Und dann ging ich wieder ins Meeting. Ich kam rein mit hängendem Kopf. Und dann sagen sie: «Schön, dass du wieder da bist.» Kein Vorwurf. Kein Druck. Einfach: Willkommen. Und das hat mir so viel bedeutet.
Was wirkt in der Selbsthilfe?
Was ist es, was bei den AA anders ist? Was hilft dir dort konkret?
Martin Es ist die Haltung. Man hört zu. Man unterbricht nicht. Man bewertet nicht. Jeder redet nur von sich. Es gibt keine Ratschläge, ausser man bittet darum. Es ist wie ein Selbstbedienungsladen. Du nimmst mit, was du brauchst. Manche kommen nur zum Zuhören.
Andere reden viel. Jeder auf seine Weise. Und man merkt: Man ist nicht allein. Das ist das Wichtigste. Und dieses Gefühl, dass andere auch kämpfen, auch fallen, auch aufstehen – das trägt.
Und was war deine Motivation, regelmässig weiter hinzugehen?
Martin Zuerst war es der Wunsch, wieder mit meiner Partnerin zusammenzukommen. Dann merkte ich, dass ich es für mich machen muss. Und inzwischen gehe ich auch, weil ich anderen helfen will. Ich bin in der Öffentlichkeitsarbeit, ich informiere Kliniken, halte Vorträge, besuche neue Gruppen. Das gibt mir Sinn. Und es schützt mich selbst. Es erinnert mich an meine eigene Geschichte.
Ein notwendiges Zusammenspiel
Was sollte sich aus deiner Sicht im Hilfesystem verbessern?
Martin Erstens: Selbsthilfe sollte fixer Bestandteil jeder Nachsorge sein. Viele kommen aus der Klinik und wissen nicht, wohin. Die AA oder andere Gruppen können das auffangen. Aber man muss es den Leuten sagen. Man muss ihnen erklären, was das ist.
Zweitens: Fachpersonen sollten offener sein. Ich hörte einmal von einem Psychologen: «Wenn ich jemanden zu den AA schicke, verliere ich einen Kunden.» Das ist doch traurig. Es geht doch um die Menschen, nicht ums Geschäft.
Drittens: Selbsthilfe spart Kosten. Wir kosten nichts. Und trotzdem bewirken wir viel. Das sollte man sehen.
Blick zurück –und nach vorn
Wenn du auf deine Geschichte zurückblickst –was war der entscheidende Moment?
Martin Der Moment, als meine Partnerin ging. Da habe ich gemerkt: Jetzt oder nie. Und dass dann alles gleichzeitig geklappt hat – Hausarzt, Psychologe, AA –, das war wie ein Wunder. Dieses kleine Fenster. Wenn da etwas verzögert worden wäre, hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Das hat mir gezeigt, wie wichtig Timing ist. Und wie wichtig Beziehungen sind. Vertrauen. Dass jemand sagt: «Ich bin da.» Das reicht manchmal.
Und heute?
Martin Heute bin ich trocken. Ich gehe regelmässig in Meetings. Ich engagiere mich. Und ich mache es für mich. Nicht mehr, um jemand anderen zu halten oder zu überzeugen. Ich mache es, weil ich weiss: Es tut mir gut. Und wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Umfeld besser. Das ist das Schönste daran.
Paul (Name geändert) ist 53 Jahre alt, lebt in der Region Bern und war früher drogenabhängig und zeitweise obdachlos. Nach einem schweren Arbeitsunfall und persönlichen Traumata fand er über die Heroinabgabe zurück in die Stabilität. Heute arbeitet er als Peer bei «Walk & Talk» und setzt sich für andere Betroffene ein.
Einstieg in die Peerarbeit
von « Walk & Talk »
Paul, was ist deine Aufgabe als Peer bei der Beratungsstelle Contact in Bern?
Paul Ich arbeite im Programm «Walk & Talk». Wir sind ehemalige Süchtige, die für Süchtige da sind. Wir verteilen Spritzen, Kondome und reden mit den Menschen. Wenn jemand Hilfe braucht, sind wir so ein bisschen ein Sprachrohr zwischen den Behörden, der Polizei und den Betroffenen. Alle sechs Wochen haben wir Weiterbildungen oder Sitzungen. Dort diskutieren wir, was in dieser Zeit gelaufen ist, ob es auf der Strasse Zulauf von Süchtigen gegeben hat oder ob es weniger geworden sind.
Wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen?
Paul Vor sechs Jahren war ich obdachlos. Zu dieser Zeit wurde das Angebot «Walk & Talk» hier in Bern ins Leben gerufen. Ich wollte mich dafür bewerben, aber es hiess, dass obdachlose Menschen nicht genommen werden, und ich liess es bleiben.
Später habe ich mal einen Freund angesprochen, der genommen wurde: «Wie läuft es so bei euch auf der Gasse? » Und er hat dann gesagt: «Ja, es ist gut und sie suchen für ein solches Angebot in Thun noch Leute.» Ich habe nicht gross darauf reagiert, aber zwei, drei Tage später sagt mein Freund, dass er mich dort vorgeschlagen hat. Ich habe mir das lange gut überlegt und dachte dann, das ist eigentlich eine gute Sache, denn ich bin selber auch betroffen.
Seid ihr ein Team von Peers?
Paul Genau, ja ! Hier in Thun sind wir etwa drei Teams. Es macht Spass, gerade auch mit den Weiterbildungen und den vielen Gesprächen. Wir sind schon gerne auf dem neuesten Stand. Unser Motto lautet: Wenn wir nur einem Menschen helfen können, so hat sich unser Job schon gelohnt. Das wird auch von den Behörden so akzeptiert und hoch angerechnet! Wir gehen zum Beispiel auch zu den Sexarbeiterinnen und sprechen mit ihnen.
Wie oft seid ihr auf der Gasse unterwegs?
Paul Einmal in der Woche zwei Stunden, manchmal, je nachdem, wie es Leute hat, auch nur eine Stunde. Dafür gehen wir einen oder zwei Tage später noch mal eine Stunde. Wenn wir Probleme auf der Gasse sehen, so «verpfeifen» wir niemanden. Auch nicht, wenn die Polizei kommt. Wir sind nicht zum Spitzeln unterwegs, das machen wir nicht. Wenn die Polizei etwas herausfinden will, dann müssen sie das selber machen. Wenn wir mit unserer Arbeit auf der Gasse Probleme haben, reden wir mit dem Stellenleiter.
Wie nehmen die Betroffenen auf der Strasse das Angebot an?
Paul Ganz gut, und wir hatten bisher eigentlich noch nie Probleme. Wenn sie untereinander Probleme haben, dann gehen wir auch schlichten oder nehmen sie räumlich auseinander. Aber im Grossen und Ganzen sind wir akzeptiert, weil wir eben auch von der Gasse kommen. Darum wissen wir eigentlich am besten, worum es geht, und sind glaubwürdig.
Missbrauch und Verdrängung
Aus welchem Grund bist du bei «Walk & Talk» eingestiegen?
Paul Ich hatte einen Bruder, der jetzt gerade vor einem Monat verstorben ist, leider ! Der hatte mich sexuell missbraucht. Ich habe das irgendwann meinen Eltern
und auch dem Pfarrer erzählt. Und dann hiess es: «Der macht das nicht.»
Mit den Drogen habe ich bewusst angefangen, weil ich gemerkt habe, dass es mir damit besser geht und ich alles besser verdrängen kann. Aber ich habe mich nie ganz fallen lassen. Ich habe immer geschaut, dass ich gepflegt herumlaufe und nicht stinke. Ich ging auch immer arbeiten und habe auch eine Lehre gemacht. Das funktionierte eigentlich alles relativ gut, bis ich 2004 einen schweren Bauunfall hatte. Ich lag fast neun Monate im Krankenhaus.
Substitution, Alltag und Biken
Was für einen Unfall hattest du?
Paul Ich bin zwölf Meter in den Beton hinuntergeknallt. Der Kranführer hatte das Gerüst umgerissen. Deshalb flog ich hinunter und verletzte mich schwer. Es dauerte ein Dreivierteljahr, bis das alles einigermassen verheilt war.
In dieser Zeit bekam ich nicht mit, welche Zahlungen von meinem Konto abgingen. Als ich dann nach Hause kam, passte der Hausschlüssel nicht mehr. Ich habe nie eine Kündigung bekommen. Dabei wusste der Vermieter, wo ich war. Ich hatte nur noch den Trainingsanzug vom Spital. Der ganze Haushalt wurde einfach in die Mulde geschmissen. Danach war ich fast zwei Jahre obdachlos und ohne Wohnung. Und: Ohne Wohnung kein Job. Und dann bin ich wirklich sehr tief abgestürzt. Dazu stehe ich.
Nach x Jahren hier in der Anlaufstelle hatte ich die Nase voll und sagte mir: « Schlussstrich drunter!», und meldete mich für die Heroinabgabe an. Anfänglich hatte ich noch Beikonsum und meinen Alltag auf der Gasse. Vor gut drei Jahren habe ich mir dann gesagt: «Fertig, nur noch Substitution, keinen Beikonsum!» Aber ich wusste nicht, wie ich das machen sollte. Ein Kollege hat mich dann zum Biken mitgenommen. Das Biken hat sich dann nach und nach entwickelt.
Therapie keine Option
Hast du in dieser ganzen schwierigen Zeit Unterstützung oder Hilfe aufgesucht und bekommen?
Paul Das war eigentlich alles ohne Hilfe. Ich habe nie ärztliche Hilfe angenommen oder irgendwo eine Therapie gemacht.
Warum nicht?
Paul Weil eine Therapie ein geschütztes Umfeld ist. Da ist es kein Problem, sauber zu werden. Aber der springende Punkt bei mir war: Was machst du nach einer Therapie? Da gibt es nur wenige Angebote. Nach einer Therapie stehst du mehr oder weniger allein da. Das betrifft auch die Gefühlswelt, die dann wieder erwacht. Das ist ein grosses Problem. Viele Süchtige wissen nicht, wie sie mit ihrer Gefühlswelt umgehen sollen. Und dafür gibt es nach meinem Wissen eigentlich kein Angebot; darum habe ich nie eine Therapie gemacht.
Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist: Wenn du etwas verändern willst, musst du einfach mal den Freundeskreis ändern. Also die sogenannten Freunde. Seither habe ich eigentlich mit den Dröglern nur noch zu tun, wenn ich für «Walk & Talk» unterwegs bin.
Was für eine Hilfe hättest du dir denn konkret gewünscht?
Paul Dass ich besser verstanden worden wäre, zum Beispiel, als das mit dem Bruder passiert ist. Und da wäre sicher sehr vieles anders rausgekommen. Das war in der Zeit, in der man das eigentlich zu Tode geschwiegen hat. Mit so einem Thema ist man in den achtziger Jahren nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Ich hätte mir hier von meinen Eltern und den Vertrauenslehrer:innen mehr erhofft.
Behörden und das Sozialamt
Und hattest du in dieser Zeit auch mal Kontakt zu Sozialarbeiter:innen?
Paul Ja, ich hatte sogar einen sehr guten Sozialarbeiter beim Sozialdienst. Aber der hat dann aufgehört und zu den anderen dort hatte ich eigentlich nie das Vertrauen.
Was war für dich da so gut?
Paul Mit dem Sozialarbeiter konnte ich sehr offen sprechen und fühlte mich verstanden. Bei der Heroinabgabe hatte ich auch meine Ärzte. Aber mit denen habe ich weniger geredet. Da gab es vielleicht alle drei Monate mal ein Gespräch. Und ich wusste eigentlich nach zwanzig Jahren Substitution genau gleich viel wie am Anfang, weil ich mit denen nicht über meine Probleme rede. Ich bin eigentlich eher einer, der es selber machen muss und selber auch den Grind anschlagen muss. Und dann daraus lernen kann.
Was müsste sich verändern, damit du mit Sozialarbeitern über deine Probleme reden würdest?
Paul Flexiblere Zeiten. Also nicht gerade mitten in der Nacht, aber wenn ich anrufe, dass ich vielleicht innerhalb von 24 Stunden oder vielleicht noch am selben Tag einen Termin bekomme. Einfach weniger Wartezeiten. Wenn du in eine Therapie gehst, dann hast du Wartezeiten zwischen zwei und vier Monaten. Wenn ich aber eine Therapie machen will, dann möchte ich sie jetzt machen. Weil jetzt habe ich im Kopf den Entschluss gefasst. Aber in drei Monaten sieht es bei mir vielleicht wieder anders aus und ich bin nicht mehr für eine Therapie bereit. Darum habe ich eigentlich nie eine Therapie gemacht. Und mir bringt es auch nichts, wenn ich alle drei bis vier Monate anrufen und fragen muss, ob es einen freien Platz gibt.
Hast du auch schon mal schlechte Erfahrungen mit sozialen Institutionen gemacht?
Paul Ja, vor fünf Jahren, bei einer Arbeitsintegration, die für Drogensüchtige Recyclingarbeiten angeboten hat und später auch Zügelarbeiten und Gartenbau. Ursprünglich hatten wir für die Arbeit jeden Monat 300 Franken Integrationszulage bekommen. Das wurde dann leider auf 100 Franken gekürzt. Damit bin ich einfach nicht einverstanden. Wer viel arbeitet, soll auch einen guten Lohn dafür bekommen. Im Gartenbau haben wir Arbeiten erledigt, die eine normale Gartenbaubude auch macht. Und da fühlte ich mich mit der Zeit etwas ausgenutzt. Später, als Corona kam, ging ich da dann nicht mehr hin. Irgendwann habe ich mich dann bei der IV angemeldet.
Wechsel zur IV –
Unsicherheit
und Neuanfang
Wie ging das dann mit der IV-Anmeldung vor sich?
Paul Ich habe das über einen Hausarzt gemacht. Der riet mir eines Tages dazu, es mit der IV mal zu probieren. Lange Zeit konnten sich drogenkranke Menschen nicht anmelden. Sie wurden abgelehnt. Das hat sich unterdessen geändert. Das Sozialamt hatte mich schon viele Jahre mehr oder weniger geplagt, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Die haben Kürzungen gemacht, die eigentlich kontraproduktiv sind. Ich hatte so schon wenig und dann wird es noch weniger. Man wird schon fast dazu getrieben, illegale Dinge zu treiben. Und dann habe ich gesagt: «Fertig, jetzt probiere ich es mal mit der IV. Wenn es klappt, okay. Wenn es nicht klappt, ist es halt so.» Ich hatte etwas Glück und gute Sachbearbeiter:innen, die mich unterstützt haben. Anfänglich musste ich einen Monat lang für die Abklärungen viel machen.
Was hat sich durch die IV sonst noch alles bei dir verändert?
Paul Der Wechsel vom Sozialamt auf die IV war mit mehr Unsicherheiten für mich verbunden, als ich anfänglich
dachte. Ich wusste nicht, was auf mich zukommen würde. Plötzlich musste ich wieder alles selber machen: Miete, Strom, Rechnungen bezahlen. Mittlerweile schaue ich das alles als normal an. Aber wenn ich das Geld für etwas anderes brauche, habe ich einen Monat später mehr Kosten und das kann einen Rattenschwanz auslösen. Darum zahle ich lieber alle Rechnungen von Anfang an und weiss, was ich noch zur Verfügung habe. Ich muss gestehen: Anfänglich hatte ich mich riesig gefreut, dass ich das Geld für Blödsinn ausgeben konnte. Aber unterdessen kann ich sagen: Es funktioniert. Ich kann das mit den Finanzen wieder, also pünktlich die Rechnungen zahlen, das Geld nicht für anderes Zeug brauchen. Da bin ich dann einfach auch stolz. Das mir hat dann auch das Gefühl gegeben, wieder ein Mensch zu sein.
Wünsche an die Soziale Arbeit
Du hast in deinem Leben sicherlich viele Ratschläge bekommen. Hast du auch Ratschläge für die Soziale Arbeit?
Paul Es gibt leider nur wenige gute Sozialarbeitende. Wobei, die jüngere Generation hat schon ein ganz anderes Denken, was Sucht anbelangt. Wenn ich die Sozialarbeitenden bei uns auf der Gemeinde anschaue, die sind zwischen 50 Jahre und kurz vor der Pensionierung. Dann haben die, was Drogen und Sucht anbelangt, keine Erfahrung.
Marcel Krebs, Dr., Soziologe und Sozialarbeiter, Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. marcel.krebs@fhnw.ch
Christoph Mattes, Dr., Sozialarbeiter, Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. christoph.mattes@fhnw.ch
Auf allen Ebenen aktiv für ehemalige
Heim- und Pflegekinder
Susanne Bachmann
Das Kompetenzzentrum Leaving Care (KLC) engagiert sich für bessere Bedingungen für ehemalige Heim- und Pflegekinder, sogenannte Care-Leaver:innen, die im Übergang ins selbständige Erwachsenenleben stehen. Dabei agiert die Fachorganisation auf mehreren Ebenen: mit Öffentlichkeitsarbeit, Advocacy und Wissensaufbau ebenso wie mit Fall- und Fachsupport und Informationsangeboten. Wie gelingt ihnen diese anspruchsvolle Arbeit, damit junge Menschen auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit besser unterstützt werden? Wo liegen Fallstricke und was sind Gelingensbedingungen?
Bachmann, Susanne (2025): Auf allen Ebenen aktiv für ehemalige Heimund Pflegekinder. In: Zeitschrift Soziale Innovation 2025. S. 45–56.
Der Übergang ins Erwachsenenleben ist für alle jungen Menschen eine Herausforderung. Besonders in der heutigen Zeit: Die Ausbildungswege sind länger und die Übergänge in den Bereichen Wohnen, Beziehungen/Familie, Arbeit etc. sind komplizierter geworden. Für junge Menschen, die ihre Kindheit und Jugend in einem Heim oder einer Pflegefamilie verbracht haben –sogenannte Care-Leaver:innen – ist diese Phase des Übergangs in die Eigenständigkeit noch einmal deutlich herausfordernder als für junge Erwachsene, die in ihren Herkunftsfamilien aufgewachsen sind. Denn Care-Leaver und Care-Leaverinnen stehen vor zusätzlichen Hürden (vgl. Hofer / Knecht Krüger / Marty 2020): So müssen sie etwa die Übergänge in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit/Ausbildung und soziale Beziehungen gleichzeitig und nicht selten von einem Tag auf den anderen und ausserdem meist viel früher als Gleichaltrige bewältigen, oft bereits mit 18 Jahren oder spägtestens mit dem Ende der Erstausbildung. In Krisensituationen gibt es kaum Rückkehrmöglichkeiten in ein Heim oder in die Pflegefamilie. In ihrer Bildungslaufbahn müssen diese jungen Menschen aufgrund ihrer Erlebnisse und ihrer Lebenssituationen meist längere Wege und Umwege gehen und können so ihr Potenzial oft nicht ausschöpfen. Gleichzeitig können sie weniger auf materiellen und emotionalen Support von Familien und weiteren Bezugspersonen zurückgreifen.
Aktuelle Forschungserkenntnisse (Schaffner et al. 2022) zeigen, dass viele bestehende Unterstützungsangebote im Übergang ins junge Erwachsenenalter nicht ausreichend bedarfsorientiert sind, besonders für diejenigen jungen Menschen, die sogenannte Mehrfachproblematiken bewältigen müssen. Insbesondere die Übergangsforschung zeigt auf, dass die Übergänge in die Erwerbsarbeit und Eigenständigkeit Risiken beinhalten. Vor allem komplexe Lebenslagen – wie eben bei Care-Leaver:innen – erfordern individuell ausgerichtete Hilfsangebote, die niederschwellig zugänglich sind. Das Kompetenzzentrum Leaving Care (KLC) setzt hier an. Es stellt als nationale Fachorganisation Informationen über Unterstützungsangebote, rechtliche Grundlagen und Vernetzungsmöglichkeiten zur Verfügung, organisiert Weiterbildungen und
bietet Beratungen für Fachpersonen, Organisationen und Verwaltungen an. Zudem leistet das KLC Sensibilisierungs- sowie Lobbyarbeit und setzt sich auf verschiedenen Ebenen für die Interessen und Rechte von ehemaligen Heim- und Pflegekindern ein. Das Ziel ist, in der Schweiz die Bedingungen für Care-Leaver:innen beim Übergang in ein selbständiges Erwachsenenleben zu verbessern. Oder, wie es auf der KLC-Website heisst: « Chancen- und Rechtsgleichheit für Care-Leaver:innen beim Übergang aus dem Heim oder der Pflegefamilie in die Selbständigkeit». Mit seiner Arbeit adressiert das KLC Fachpersonen, Institutionen und Organisationen im Pflegekinderbereich, Anlauf- und Fachstellen sowie kantonale und nationale Behörden und darüber hinaus auf der übergeordneten Ebene Politiker:innen und die breite Öffentlichkeit.
Wie kam es dazu, dass das KLC gegründet wurde? Welche Erfahrungen machte das Team während der Aufbauarbeit?
Das Projekt Nachbetreuung
Alles begann mit dem Projekt « Nachbetreuung » (2013 –2018) der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime (vgl. Drosos Stiftung o. J.). Das war ein Praxisprojekt, in welchem 16 Institutionen den jungen Menschen nach Austritt aus dem Heim Nachbetreuung anboten. Während der fünfjährigen Laufzeit des Projekts wurde schnell klar, dass es ein solches Angebot in der ganzen Schweiz braucht. Die Evaluationen zeigten deutlich, wie erfolgreich der Ansatz ist, weshalb das Projekt inzwischen als Modell für zahlreiche andere Nachbetreuungsprojekte dient. Das Zürcher Projekt einfach auf nationaler Ebene auszurollen, funktionierte aber nicht: In der föderalen Schweiz sind kontextangepasste Angebote notwendig. Das heisst, die Angebote für Care-Leaver:innen müssen entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen, der vorhandenen sozialen Infrastruktur und der entsprechenden Verwaltungspraxis ausgestaltet werden. Beziehungsweise: Die Rahmenbedingungen müssen mancherorts erst geschaffen oder zumindest verbessert werden. So, dass etwa Fachpersonen im sozialen Bereich
den Bedarf an Angeboten für Care-Leaver:innen überhaupt erkennen, dass die jeweiligen Akteur:innen vernetzt agieren und dass der gesetzliche Rahmen adäquate Angebote zulässt. Zudem ist es wichtig, den ganzen Prozess der ausserfamiliären Unterbringung aus der Perspektive der Leaving Care zu betrachten und allenfalls zu optimieren und nicht nur den Moment rund um den Austritt der jungen Menschen zu fokussieren. Oder, wie es Natascha Marty, Fachmitarbeiterin des KLC, auf den Punkt bringt: «Der Austritt beginnt mit dem Eintritt. »
Zusammenspiel der Ebenen
Diese Anfangszeit war wesentlich für die Ausgestaltung des heutigen Kompetenzzentrums, wie Beatrice Knecht Krüger, die Leiterin des KLC, ausführt: « Wir haben in dieser Zeit gelernt: Wir müssen kein neues Angebot implementieren, sondern das ganze Feld voranbringen. Es braucht etwas, das über die Praxisangebote hinausgeht: Es braucht mehr Wissen. Und wir müssen schauen, dass dieses Wissen unter die Leute kommt. Es braucht Beratungsangebote für Fachpersonen und Betroffene. Ausserdem ist es wichtig, die Öffentlichkeit zu informieren. Und um die Rahmenbedingungen zu ändern, braucht es auch politische Arbeit.» Daraus sind die vier Aktivitätsfelder des KLC entstanden: Wissensgenerierung, Wissenstransfer, Interessenvertretung und Support. Das KLC versteht sich als Drehscheibe in der Thematik Leaving Care und ist in diesen miteinander zusammenhängenden Aktivitätsfeldern auf unterschiedlichen Zielgruppen-Ebenen tätig.
Konkret heisst das etwa, dass die Website des KLC über die in den Regionen verfügbaren Angebote für Care-Leaver:innen und die jeweiligen rechtlichen Grundlagen informiert – keine triviale Angelegenheit, denn vorher gab es genau solch eine Übersicht nicht. Das KLC bietet Schulungen und Weiterbildungen für Fachleute, Verwaltungen und Praxisorganisationen an. Diese können sich auch an das KLC wenden, um sich zu konkreten Fällen beraten zu lassen oder wenn sie etwa ein Konzept oder ein Angebot für Care-Leaver:innen entwickeln wollen.
Darüber hinaus sensibilisiert das KLC nicht nur Fachleute, sondern auch die breite Öffentlichkeit und Politiker:innen, um dem Anliegen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. So führt das KLC das Sekretariat einer parlamentarischen Gruppe, die sich für bessere Bedingungen für Care-Leaver:innen einsetzt. Weiter bringen die drei Fachmitarbeiterinnen des KLC ihre Expertise im Beirat nationaler Forschungsprojekte ein, organisieren Forschungskolloquien und erarbeiten Stellungnahmen. Mit seinen Publikationen stellt das KLC Handlungsoptionen für spezifische Themen vor, etwa mit der Online-Broschüre «VOJA-Issue » zur Thematik Leaving Care (Hofer/Knecht Krüger / Marty 2025), in welcher konkrete Ansatzpunkte für die Unterstützung von CareLeaver:innen seitens der offenen Kinder- und Jugendarbeit beschrieben werden. Im März 2025 publizierten das KLC, verschiedene Praxisorganisationen und die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW zusammen als Interessengruppe NiPro das Positionspapier und Argumentarium «Zur Notwendigkeit niederschwelliger und bedarfsorientierter Unterstützung für junge Menschen» (Interessengruppe NiPro 2025).
Gemeinsam voranbringen
Um das Unterstützungsangebot zu verbessern, indem es z. B. bedarfsgerechter gestaltet werden kann, sind die Sensibilisierung von Fachpersonen und die Zusammenarbeit und Vernetzung von Akteur:innen zentral. Natascha Marty streicht heraus: «Es reicht nicht aus, wenn man endlich eine gute Gesetzgebung erreicht hat, sondern es braucht viel mehr. Den juristischen Begriff ‹Vollzugsdefizit› habe ich in diesem Zusammenhang kennengelernt. » Und er wird auch mit einer guten Gesetzesgrundlage nicht verschwinden: Ohne eine entsprechende Infrastruktur und sensibilisierte Fachkräfte mangelt es bei der Umsetzung. Umgekehrt, erläutert Marie-Thérèse Hofer, die zweite Fachmitarbeiterin im KLC, gebe es kleine Kantone, wo engagierte Fachpersonen gute Lösungen ermöglichten, obwohl die gesetzlichen Grundlagen nicht ideal seien. «Die Differenzierung ‹Was braucht es
wo für wen und wie genau?› ist anspruchsvoll und nicht einfach zu kommunizieren. Aber zugleich ist es genau das, was das Feld voranbringt.»
Ein zentrales Ziel des KLC ist es daher, die verschiedenen Akteurinnen und Akteure miteinander und mit dem Kompetenzzentrum zu vernetzen, damit sie sich austauschen und voneinander lernen können. So ist das KLC nicht nur mit der Praxis, der Verwaltung und der Politik vernetzt, sondern auch mit der Forschung. Die drei Mitarbeiterinnen des Kompetenzzentrums präsentieren ihre Erkenntnisse an Forschungskolloquien und Tagungen, zuletzt etwa an der Fachtagung «Soziale Innovation», die alle zwei Jahre in Olten an der Hochschule für Soziale Arbeit stattfindet. «Wir versuchen, Forschende zu diesem Thema miteinander ins Gespräch zu bringen und überhaupt mit allen Akteur:innen, die in diesem Feld aktiv sind, zusammenzuarbeiten, um das Anliegen voranzubringen», erklärt Hofer.
Wie gelangt das Kompetenzzentrum an diese Akteur:innen? Als «aktives Klinkenputzen» beschreibt Beatrice Knecht Krüger einen der Wege: «Wir müssen dranbleiben, das ist aufwendig. Aber es lohnt sich, relevante Personen direkt anzuschreiben und Kontakte bei entsprechenden Anlässen zu knüpfen, etwa bei Tagungen.»
Um die Anliegen von Care-Leaver:innen in der Öffentlichkeit besser sichtbar zu machen, initiierte das KLC 2021 ausserdem eine viel beachtete multimediale Kampagne in Kooperation mit ehemaligen Heimund Pflegekindern. Deren Erfahrungen und Anliegen stehen dabei im Mittelpunkt. Über Plakate mit dem Slogan «Deplatziert? – Typisch Heim- und Pflegekind!» gelangt man via QR-Code auf den YoutubeKanal der Kampagne CareLeaverTalk (KLC 2021). Hier berichten Care-Leaver:innen aus verschiedenen Generationen sehr persönlich davon, wie herausfordernd der Übergang ins Erwachsenenleben nach dem Austritt aus einem Heim oder einer Pflegefamilie ist. Im Zuge der Kampagne haben die beteiligten Betroffenen entschieden, den Verein Careleaver Schweiz zu gründen und sich politisch zu engagieren, woraus mehrere Vorstösse im Nationalrat resultierten.
Anspruchsvolle Finanzsuche
Die Finanzsuche ist eine der grossen Herausforderungen für Organisationen wie das KLC. Die grosse Stärke des Kompetenzzentrums Leaving Care – das Agieren auf verschiedenen Ebenen parallel – ist im Hinblick auf die Finanzierung nicht immer einfach zu vermitteln. Es ist schwierig aufzuzeigen, was der Gewinn dieser Arbeitsweise ist, die vor allem aus viel Hintergrundarbeit besteht. Denn deren direkte Wirkung lässt sich nicht immer ableiten und visualisieren. Projekte mit einem eindeutigen Ziel und klar messbaren Effekten – wie etwa Teilnehmendenzahlen an einer Veranstaltung – sind viel leichter zu finanzieren. Wenn das Kompetenzzentrum beispielsweise eine Praxisorganisation berät und diese künftig dafür sorgt, die relevanten Akteur:innen im Prozess des Übergangs zum selbständigen Erwachsenenleben besser einzubeziehen, ist diese Arbeit zwar sehr nachhaltig – aber auch recht unsichtbar. Marie-Thérèse Hofer betont daher: « Der eigentliche Gewinn unserer Arbeit liegt im Weitergeben von Wissen und im Verarbeiten von Wissen durch uns und andere, und im Vernetzen. Es ist schwierig darzustellen, wo da genau die Wirkung liegt.»
Die Entscheidung, dass Fachleute und weniger die Care-Leaver:innen selbst die eigentliche Zielgruppe des Kompetenzzentrum sind, erschwert die Finanzierung der Aktivitäten zusätzlich. «Es gibt keine Kausalität unseres Erfolgs. Was wir dazu beigetragen haben, dass sich auch auf der politischen Bühne etwas ändert, das kann man nicht wirklich abschätzen. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, dass wir viel dazu beitragen, dass sich Dinge ändern», so Beatrice Knecht Krüger.
Allianzen bilden
Um den Herausforderungen der Finanzsuche zu begegnen, ist die Bildung von Allianzen zentral. Eine Aufgabe des KLC ist somit auch, potenziellen Geldgebenden, etwa Förderstiftungen, plausibel zu vermitteln, was der Vorteil dieser vernetzten, differenzierten Arbeitsweise ist. Knecht Krüger erläutert: «Wenn nachher
gesetzliche Anpassungen vorgenommen werden oder sich Haltungen bei Fachleuten verändern, bewirkt das letztlich mehr, als wenn einzelne Personen an einem Praxisprojekt teilnehmen.» Ab 2027 ist die Finanzierung des Kompetenzzentrums Leaving Care noch nicht gesichert und es laufen bereits wieder erste Gespräche mit den Förderstiftungen.
Es brauchte also viel Überzeugungsarbeit und gleichzeitig die Bereitschaft der Menschen in den Stiftungen, sich für die Thematik zu engagieren und den Mehrwert zu erkennen. Erfreulicherweise haben sich innovative Förderstiftungen zusammengetan und finanzieren das Thema «Leaving Care» als Ganzes. Diese Förderstiftungen tragen gemeinsam nicht nur das Kompetenzzentrum, sondern gleichzeitig auch den Verein Careleaver Schweiz (CLCH), der die Selbstorganisation der Betroffenen ins Zentrum stellt und in regionalen Netzwerken organisiert ist. Der Verein CLCH ist im Zuge zweier umfangreicher partizipativer Forschungsprojekte an der FHNW und der ZHAW entstanden. Mit dem Verein CLCH arbeitet das Kompetenzzentrum eng zusammen. So geht die Arbeit des KLC mit der Vernetzung der Care-Leaver:innen Hand in Hand, und die Erfahrungsexpertise, also das Wissen der ehemaligen Heim- und Pflegekinder, kann in die Arbeit des Kompetenzzentrums einfliessen. Marie-Thérèse Hofer hebt hervor, wie zentral die enge Zusammenarbeit mit dem Verein Careleaver Schweiz für die Arbeit des KLC ist: «Das ist wirklich auch ein Faktor, der das Feld enorm voranbringt, weil es ganz andere Perspektiven und auch eine grosse Glaubwürdigkeit und Dringlichkeit in diese Themen einbringt.»
Einmal pro Jahr findet ein Runder Tisch statt, zu dem die beteiligten zwölf Stiftungen (siehe https:// leaving-care.ch/kompetenzzentrum), die das Kompetenzzentrum Leaving Care unterstützen, eingeladen werden, um sich auszutauschen und ihre Förderung aufeinander abzustimmen. So kommen viel mehr Mittel zusammen, als wenn die Stiftungen einzeln fördern, und gleichzeitig kann sich jede der Stiftungen auf ihren spezifischen Stiftungszweck fokussieren. Die Stiftungen wiederum schätzen den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung untereinander. Hilfreich für die
Glaubwürdigkeit des Kompetenzzentrums ist darüber hinaus, dass es an YOUVITA angegliedert ist, dem nationalen Branchenverband der Dienstleister für Kinder und Jugendliche und damit einem breit akzeptierten und gut vernetzten Akteur in der Kinder- und Jugendhilfe.
Geduld und Mut
Die KLC-Leiterin Beatrice Knecht Krüger bringt noch einen Punkt ins Spiel: «Was ganz wichtig ist : Diese Arbeit braucht extrem viel Zeit. Wenn Fachleute das erste Mal von uns hören, bis zu dem Moment, wo sie das umsetzen können, ein Konzept erstellt haben, das dauert zwei, drei, zum Teil vier Jahre, bis sie so weit sind. »
Das gelte insbesondere für die politische Arbeit: « Es geht nicht schneller, wenn wir mehr insistieren. Darum ist es gut, auf verschiedenen Ebenen Hebel zu bewegen.» Das Agieren auf verschiedenen Ebenen bewährt sich hier, zumal diese sich auch gegenseitig beeinflussen. Wenn etwas irgendwo ansteht, kann das Kompetenzzentrum währenddessen an einer anderen Stelle ansetzen. «Wir setzen sozusagen Sämli in die Erde, und es geht halt, bis die Pflanzen wachsen,» meint Knecht Krüger. «Eine Balance zu finden zwischen einerseits Hartnäckigkeit und Dranbleiben und andererseits wieder Zeit lassen und nicht zu fest insistieren – das ist nicht ganz einfach.»
Ein langer Atem und Hartnäckigkeit sind auch deswegen nötig, weil das Wissen enorm schnell wieder verloren geht. Die Fluktuation im Heim- und Pflegekinderbereich ist hoch, und viel Know-how hängt an einzelnen Personen. Beatrice Knecht Krüger erzählt ein Beispiel: «Mit einer Institution haben wir ein Konzept erstellt, aber zwei Jahre später wusste niemand mehr etwas davon. Der Heimleiter hat gewechselt, die zuständige Person ist nicht mehr da – und dann fängt man wieder von vorne an. » Es reiche also nicht, Fachpersonen einmalig zu schulen und davon auszugehen, das Wissen sei nun verankert.
Neben Geduld ist auch Mut nötig. Vielfach ist nicht vorab sichtbar, in welchem Bereich oder bei welchen Akteur:innen sich ein Engagement lohnt. Dass die Kampagne «CareLeaverTalk» derart erfolgreich sein
würde, war nicht vorhersehbar. «Diese Bereitschaft und Offenheit ist wichtig. Manchmal merken wir erst hinterher, was sich gelohnt hat», meint Knecht Krüger.
Gemeinsame Reflexion
Das Team des Kompetenzzentrums hat eine Kultur des Reflektierens entwickelt. Externe Evaluationen der Arbeit sind wichtig, ebenso wie Zeit für gemeinsame Rückschau im Team. Marie-Thérèse Hofer erklärt: «Wir investieren viel Zeit, um aus unseren Erfahrungen lernen zu können: Was hat das jetzt gebracht? Was bedeutet das fürs nächste Mal? Was können wir daraus für andere Kontexte ableiten? Wir erlauben uns hier eine gewisse Langsamkeit, um wirklich in die Tiefe gehen zu können – auch wenn das ein wenig gegen den Zeitgeist läuft, der schnelle Resultate erwartet.» Hilfreich ist dabei der zehnköpfige Fachbeirat – mit Mitgliedern aus den verschiedenen Zielgruppen des KLC –, mit dem das Kompetenzzentrum Ziele und Massnahmen abstimmt. Die Lösungen, die das Kompetenzzentrum Leaving Care zusammen mit den verschiedenen Akteur:innen entwickelt, gehen über die Zielgruppe der ehemaligen Heim- und Pflegekinder hinaus. Sie kommen auch anderen jungen Menschen in der Phase des Übergangs zum Erwachsenwerden zugute, etwa Jugendlichen mit Migrationshintergrund, jungen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden. Dazu kommt, dass den jungen Menschen mit mehrfachen Benachteiligungen im Laufe ihres späteren Lebens weitere Übergänge bevorstehen. Trotzdem hat sich das KLC entschieden, den Fokus bei der Gruppe der Care-Leaver:innen zu lassen, wie Marie-Thérèse Hofer ausführt: «Wir denken, dass der klare Fokus auf eine Zielgruppe sinnvoll ist, weil wir so anschaulicher und plausibler machen können, wie etwa Bedarfe und Lösungen zusammenhängen, als wenn die Zielgruppe sehr breit wäre.» In diesem Sinne setzt sich das KLC weiterhin für die Chancen- und Rechtsgleichheit der Care-Leaver:innen ein. Trotz des klaren Fokus auf eine Zielgruppe ist zu erwarten, dass die Arbeit auch positive Effekte für andere junge Menschen an der Schwelle zum Erwachsenenleben haben kann,
weil so, wie es Hofer beschreibt, «die verschiedenen Zahnräder von Praxisangeboten, politischer Steuerung und gesetzlichen Grundlagen in den Kantonen besser zusammenspielen.»
Susanne Bachmann, Dr., wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Soziale Arbeit, FHNW. susanne.bachmann@fhnw.ch
Das Kompetenzzentrum Leaving Care
Das KLC entstand 2019 als Initiative der drei Verbände YOUVITA (damals der Kinder- und Jugendbereich von CURAVIVA Schweiz), INTEGRAS (Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik) sowie PACH (Pflege- und Adoptivkinder Schweiz). Mit einer Anschubfinanzierung der Drosos Stiftung konnte die Aufbauphase bis 2022 realisiert werden, um das KLC als nationale Drehscheibe zum Thema Leaving Care zu etablieren. Seit 2023 ist das KLC ein Teil der Organisation YOUVITA (Branchenverband der Dienstleister für Kinder und Jugendliche) und wird finanziell im Rahmen des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes (KJFG) vom Bund sowie von verschiedenen Förderstiftungen unterstützt.
www.leaving-care.ch/ kompetenzzentrum
Drosos Stiftung (o. J.): Projektbeschreibung « Nachbetreuung –Nachhaltigkeit von Erziehungsund Bildungsmassnahmen ». https://drosos.org/projekte/ nachbetreuung-nachhaltigkeitvon-erziehungs-undbildungsmassnahmen/
Hofer, M.-T., Knecht Krüger, B., Marty, N. (2020): Argumentarium Leaving Care. Bern: KLC. https:// leaving-care.ch/s/Argumentarium_ KompetenzzentrumLeavingCare_ Marz2020.pdf
Hofer, M-Th., Knecht Krüger, B., Marty, N. (2025): Issue «Leaving Care». Die Phase des Übergangs von der ausserfamiliären Unterbringung in ein eigenständiges Erwachsenenleben In: VOJA – Verband offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern. Veröffentlicht Januar 2025. https://www.voja.ch/Themen/ Leaving-Care.
Interessengruppe NiPro (Niederschwellige Projekte) (2025). Positionspapier – Argumentarium Zur Notwendigkeit niederschwelliger und bedarfsorientierter Unterstützung für junge Menschen. Olten. https:// qualifutura.ch/downloads/ .
KLC (2021): Kampagne CareLeaverTalk – ehemalige Heim- & Pflegekinder. YouTube-Channel: https://www.youtube.com/channel/ UCnOKWJUF_16HMAFWHkp_pSw.
Schaffner, D., Heeg, R., Chamakalayil, L., & Schmid, M. (2022). Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Mehrfachproblematiken an den Nahtstellen I und II. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. https://doi.org/ 10.26041/fhnw-4277.
Unterstützung von Menschen mit Behinderung beim Übergang ins Rentenalter
Ruth Treyer und Anselmo Portale
Immer mehr Menschen mit Behinderung erreichen das Rentenalter und wechseln von der Invalidenversicherung in die AHV sowie von Pro Infirmis zu Pro Senectute. Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Arbeit der beiden Pro-Werke, auf deren Angebot für die Betroffenen und auf die Möglichkeiten, die bei einer Zusammenarbeit entstehen. Denn nicht allen Betroffenen fällt dieser Wechsel zu einer neuen Organisation leicht. Die Rahmenbedingungen, vor allem die finanziellen Möglichkeiten der beiden Organisationen, prägen deren Hilfeangebot und die Intensität der Unterstützung massgeblich. Zudem ändert sich durch den Wechsel auch die Beratungs- bzw. Vertrauensperson. Das Projekt Tandem im Kanton Aargau zeigt, wie ein gemeinsamer Ansatz den Zugang zur Beratung und Unterstützung im Alter erleichtern kann.
Reyer, Ruth/Portale, Anselmo (2025): Unterstützung von Menschen mit Behinderung beim Übergang ins Rentenalter. In: Soziale Innovation 2025. S. 59–66.
Der Übergang ins AHV-Alter ist eine Herausforderung für Menschen mit einer Behinderung. Ein Beispiel zur Veranschaulichung:
Frau H. wird seit drei Jahren bei Pro Infirmis beraten. Sie hat eine IV-Rente aufgrund einer psychischen Erkrankung. Ihre Fragen betreffen nebst Sozialversicherungen auch administrative Angelegenheiten. Sie ist auch in Zukunft auf Unterstützung und Orientierung angewiesen. Da sie in einem halben Jahr das AHV-Alter erreichen wird, empfiehlt ihr die zuständige Sozialarbeiterin, rechtzeitig den Kontakt mit Pro Senectute zu suchen. In den kommenden Monaten wirkt Frau H. angespannter und reizbarer. Aus den Erfahrungen in der Sozialberatung weiss Pro Infirmis, dass Frau H. Mühe mit Wechsel hat. Sie gibt an, kurz vor Erreichen des Rentenalters einen Termin mit der neuen Sozialarbeiterin von Pro Senectute vereinbaren zu wollen, und das Dossier wird bei Pro Infirmis geschlossen. Zwei Monate später teilt Frau H. Pro Infirmis mit, dass sie es nicht geschafft habe, einen Termin mit Pro Senectute zu vereinbaren und dass sie lieber zurück zu Pro Infirmis in die Beratung wolle. Da dies nicht mehr möglich sei, stellt sich die Sozialarbeiterin von Pro Infirmis für ein gemeinsames Gespräch bei Pro Senectute zur Verfügung. Darauf wollte Frau H. jedoch nicht mehr eingehen und brach in der Folge den Kontakt zu beiden Organisationen ab.
Die beiden Pro-Werke bilden Tandems
Im Dezember 2022 trat die Geschäftsleitung der Pro Infirmis Aargau mit einem wichtigen Anliegen auf die Pro Senectute Aargau heran: den Übergang von Menschen mit einer Behinderung ins AHV-Alter zu erleichtern. Die Schwelle in diesem Übergang ist vor allem bei vulnerablen Menschen mit Behinderung anspruchsvoll. Sie müssen sich auf neue Beratungspersonen, Beratungsstellen und Hilfeangebote einlassen. Es wechseln nicht nur Ansprechpersonen, sondern auch Leistungsansprüche und Hilfestrukturen, die erst einmal neu und unvertraut sind.
Aufgrund der demografischen und medizinischen Entwicklung ist nach ARTISET, dem Branchenverband der Dienstleister für Menschen mit Unterstützungsbedarf im Kanton Zürich, zu erwarten, dass die Anzahl der
Personen, die im Alter nicht nur alt, sondern auch körperlich oder psychisch beeinträchtigt sind, zunehmen dürfte (https://artiset-zh.ch/fachwissen/behinderungand-alter/ ). Diese Betroffenengruppe droht zunächst abzutauchen und nimmt gesetzliche Leistungen oft erst einmal nicht in Anspruch. Die Probleme des Alltags werden anfänglich auf eigene Faust gelöst, oft aber unprofessionell und mit finanziellen Nachteilen durch den Nichtbezug von Sozialleistungen. Teilweise nehmen diese Menschen erst einige Jahre später Kontakt zu Pro Senectute auf, allerdings dann mit grösseren finanziellen, administrativen und sozialen Problemen. Diese Erfahrungen aus der Beratungspraxis führten zu einer spannenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen. Auslöser war die Initiative der Geschäftsleitung der Pro Infirmis, auf die Geschäftsleitung der Pro Senectute zuzugehen, um eine Antwort auf diese Übergangsproblematik zu finden. Diese Initiative traf bei der Pro Senectute auf offene Türen und so kam es zur Innovation, dass die beiden Organisationen zur Beratung dieser Betroffenengruppe im Tandem zusammenarbeiten.
Gemeinsame Haltung
In einem Gespräch zwischen den Geschäftsleitenden und der Bereichsleitung der Sozialberatungen wurde schnell deutlich, dass wir uns gemeinsam zur Verbesserung der Zugänglichkeit und der gewinnbringenden Zusammenarbeit für die Menschen, die unsere Beratung und Begleitung brauchen, zusammentun wollen. Wir legten fest, dass wir einen Weg von einem Jahr beschreiten und in diesem Jahr die Herausforderungen der Betroffenen, welche uns im Beratungsalltag geschildert werden, zu reflektieren, zu ordnen und entsprechende Hilfeangebote zu finden oder zu entwickeln. Dabei ging es immer auch darum, voneinander zu lernen, sich gegenseitig Netzwerke zu Verfügung zu stellen oder Beratungsansätze gemeinsam zu erarbeiten. Ziel war es, dass Menschen mit einer Behinderung eine auf Vertrauen, Kontinuität und Fachkompetenz beruhende Beratung von Pro Senectute Aargau und deren
Angeboten erhalten. Zudem soll den Mitarbeitenden der Pro Infirmis eine nachhaltige Übergabe der Beratungsdossiers und der konkreten Beratungsarbeit an die Pro Senectute gelingen sowie eine Vermittlung anderer Angebote wie Kurse, administrative Unterstützung und Hilfen im Haushalt für Menschen im Alter.
Der Weg zum Tandem
In einem ersten Schritt wurde die Beteiligung in einer Arbeitsgruppe bei den Sozialarbeitenden ausgeschrieben. Dabei beachtete man, dass die Arbeitsgruppe nicht zu gross (sieben Personen) und zur Hälfte von Pro Infirmis und Pro Senectute besetzt war. Es war einfach, die Mitarbeitenden für diese Projektgruppe zu gewinnen, da es auch eine Abwechslung im Berufsalltag war. Die zeitlichen Ressourcen wurden dabei mit ihnen abgesprochen. Wichtig war, dass wir kein kompliziertes, sondern ein möglichst einfaches und effizientes Vorgehen wollten. Im März 2023 fand die gemeinsame Kick-offSitzung in der Arbeitsgruppe statt. Dabei ging es im Kern um folgende Fragestellungen:
→ Wer möchte Beratung und Begleitung?
→ Welche sind die Herausforderungen beim Übergang in die Lebensphase Alter?
→ Wo haben wir Wissensbedarf?
→ Welche Erfahrungen bestehen seitens Pro Senectute und Pro Infirmis?
→ Welche Ideen gibt es zur besseren Zusammenarbeit?
Die Sozialarbeitenden merkten schnell, dass ihnen detailliertes Wissen über den Unterschied der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche zwischen dem IVund dem AHV-Alter fehlte. Dieses Wissen ist jedoch erforderlich, um die Menschen so zu beraten, dass diese ihre Sozialleistungsansprüche geltend machen können und ihre Existenz hinreichend sichern können. So fehlte
zum Beispiel das Wissen, dass diverse IV-Ansprüche im AHV-Alter nicht mehr geltend gemacht werden können. Ebenso fehlte detailliertes Wissen zu den Angeboten der beiden Organisationen.
Es wurde vereinbart,
→ wie der Kontakt auf beiden Seiten stattfinden soll,
→ dass die Klient:innen bei Pro Infirmis auf die begleitete Triage angesprochen wurden und man sich bewusst Zeit für dieses Vorhaben nehmen wollte,
→ dass die Klient:innen entscheiden, ob sie das Angebot nutzen wollen oder nicht,
→ dass ein Monitoring eingerichtet wird.
So
startete das Tandem operativ
Potenzielle Ratsuchende wurden sechs Monate vor dem Renteneintritt von der Pro Infirmis angeschrieben. Sie wurden nach ihren Bedürfnissen befragt und zu einer ersten Beratung eingeladen. So konnte der Übergang der Fallführung von der Pro Senectute zu Pro Infirmis und zwischen den beteiligten Beratungspersonen gut koordiniert, mit den Ratsuchenden abgesprochen und mit Rücksicht auf deren Bedürfnisse vollzogen werden. Das neu geschaffene Tandem ermöglichte einen behutsamen Wechsel, der von den Ratsuchenden nicht mehr als Bruch, sondern als behutsame Veränderung wahrgenommen wurde.
Nach einem halben Jahr trafen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe für eine erste Zwischenbilanz und um erste Anpassungen und Korrekturen der Vorgehensweise zu vereinbaren. Die Endauswertung und die definitive Prozessbereinigung fanden nach zwölf Monaten statt.
Eine erste Zwischenbilanz
Nach einem Jahr Pilotphase mit 45 Neurentnern und Neurentnerinnen wurden 15 begleitete Übergaben erfolgreich durchgeführt.
Frau T. ist seit mehreren Jahren bei Pro Infirmis in Beratung. Sie hat eine ganze Rente infolge körperlicher Einschränkungen und einer bleibenden Beeinträchtigung nach einer Krebsbehandlung. Sie wird über den bevorstehenden Abschluss bei Pro Infirmis informiert. Ein Wechsel zu Pro Senectute kommt für sie spontan zunächst nicht infrage. Schlussendlich kann sich Frau T. dank der Begleitung zu einem Termin bei Pro Senectute entscheiden. Herr und Frau T. sind nach der Übergabe sehr zufrieden mit dem Gespräch und wenden sich künftig gerne an Pro Senectute.
Herr F. ist neurologisch beeinträchtigt und nahm nach einer vierzehnjährigen Sozialberatung bei Pro Infirmis das Angebot einer begleiteten Übergabe zu Pro Senectute gern an. Seine Erwartungen und der Auftrag konnten geklärt werden und er ist, wie er kurze Zeit später berichtet, bei Pro Senectute gut angekommen. Die begleitete Übergabe habe ihm geholfen, seine Ängste zu überwinden und sich auf die Veränderung einzulassen.
Wir haben viel voneinander gelernt. Insbesondere haben die Sozialarbeitenden gelernt, über welche Angebote die beiden Organisationen verfügen und welche Ansprüche infolge der Besitzstandswahrung in der Beratung beachtet werden müssen, so zum Beispiel der Anspruch auf Hilflosenentschädigung oder auf Hilfsmittel. Zudem erhielten die Mitarbeitenden der Pro Senectute eine gute Einführung zu Assistenzbeiträgen, so zum Beispiel, dass Menschen, die vormals im IV-Bezug keine Assistenzbeiträge bezogen haben, diese auch in der AHV nicht mehr beantragen können.
Pro Infirmis wendet im Durchschnitt mehr Zeit für die Beratung von Menschen mit Behinderung auf als Pro Senectute mit ihrer Klientel. Deshalb ist es für den Erfolg im Übergang entscheidend, ein besonderes Augenmerk auf die Erwartungen und die Auftragsklärung zu setzen. Die Prozesse im Übergang wurden angepasst. So informiert die Pro Infirmis das gesamte Klientel ein halbes Jahr vor AHV-Beginn zum Übergang und bietet
eine begleitete Triage an. Die Pro Senectute weiss heute, wann Menschen im AHV-Alter spezifische Hilfestellungen immer noch bei Pro Infirmis erhalten.
Was haben wir gelernt?
Gute Innovationen und Kooperationen müssen nicht kompliziert sein. Wichtig ist der Grundsatzentscheid, dass wir uns miteinander auf den Weg machen und gemeinsam lernen. Dabei braucht es ein gemeinsam definiertes Ziel, klare Absprachen, Ressourcenplanung und definierte Kommunikationskanäle. Zuständigkeiten müssen geklärt sein und die Termine geplant.
Um für Nachhaltigkeit zu sorgen, benötigt es ein klares Commitment der Organisationen. Es besteht die Gefahr, dass in der täglichen Arbeit nach einem Pilotprojekt die Aufgabe aus dem Blickfeld gerät. Aus diesem Grunde wurden regelmässige Treffen zur Stärkung der Kooperation innerhalb des Tandems vereinbart.
Ausblick
Eine weitere spannende Entwicklung wäre die Einbeziehung der betroffenen Menschen selbst in die Planung und Auswertung. Interessant für die weitere Projektentwicklung könnte die Zufriedenheit der Ratsuchenden, die erreichte materielle Versorgung und schliesslich auch die Einschätzung der Klient:innen zu ihrer Selbstbestimmung und zum Wohlbefinden im Alltag sein. Diese Klient:innenperspektive wäre eine spannende Herausforderung für eine zweite Projektphase.
Pro Infirmis unterstützt mit ihren Dienstleistungen Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen bei der Lebensgestaltung und der Teilhabe in wichtigen Lebensbereichen wie Wohnen, Arbeit und Freizeit. Die Sozialberatung richtet sich an Erwachsene vor dem AHV-Alter und an Kinder mit einer psychischen, körperlichen oder kognitiven Einschränkung.
Die Sozialberatung von Pro Senectute richtet sich an ältere Menschen im AHV-Alter und deren Bezugspersonen. Sie bietet Unterstützung in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Recht, Lebensgestaltung, Vorsorge, Wohnen, Gesundheit sowie Betreuung
und Pflege. Die Beratung im Kanton Aargau erfolgt auf 11 Beratungsstellen.
Die Finanzierung der Sozialberatung beider Organisationen wird hauptsächlich durch das Bundesamt für Sozialversicherungen, Gelder des Kantons und Spenden getragen.
Ruth Treyer, Bereichsleiterin Soziales bei Pro Senectute Aargau. ruth.treyer@ag.prosenectute.ch
Anselmo Portale, Leiter Beratung Pro Infirmis Aargau und Projektverantwortlicher Sozialberatung Region Mitte. anselmo.portale@proinfirmis.ch
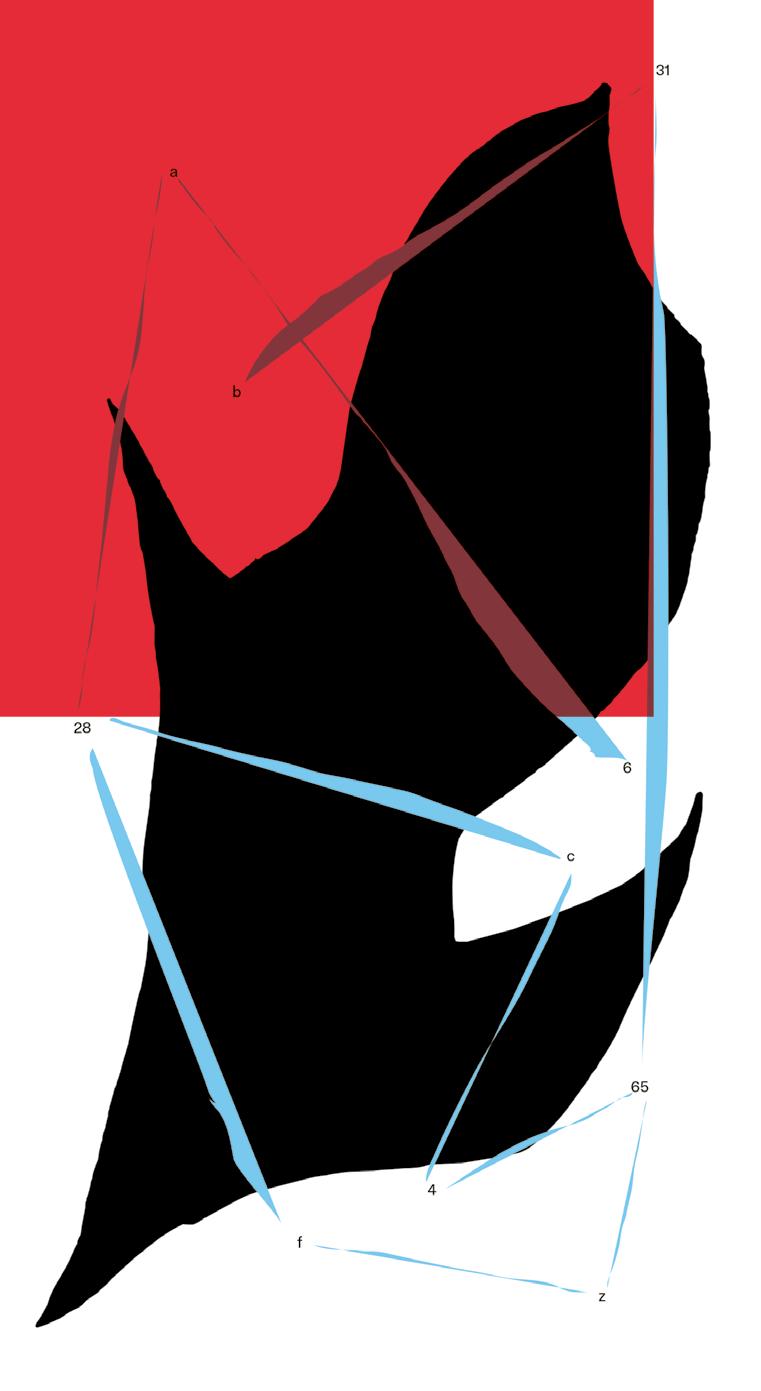


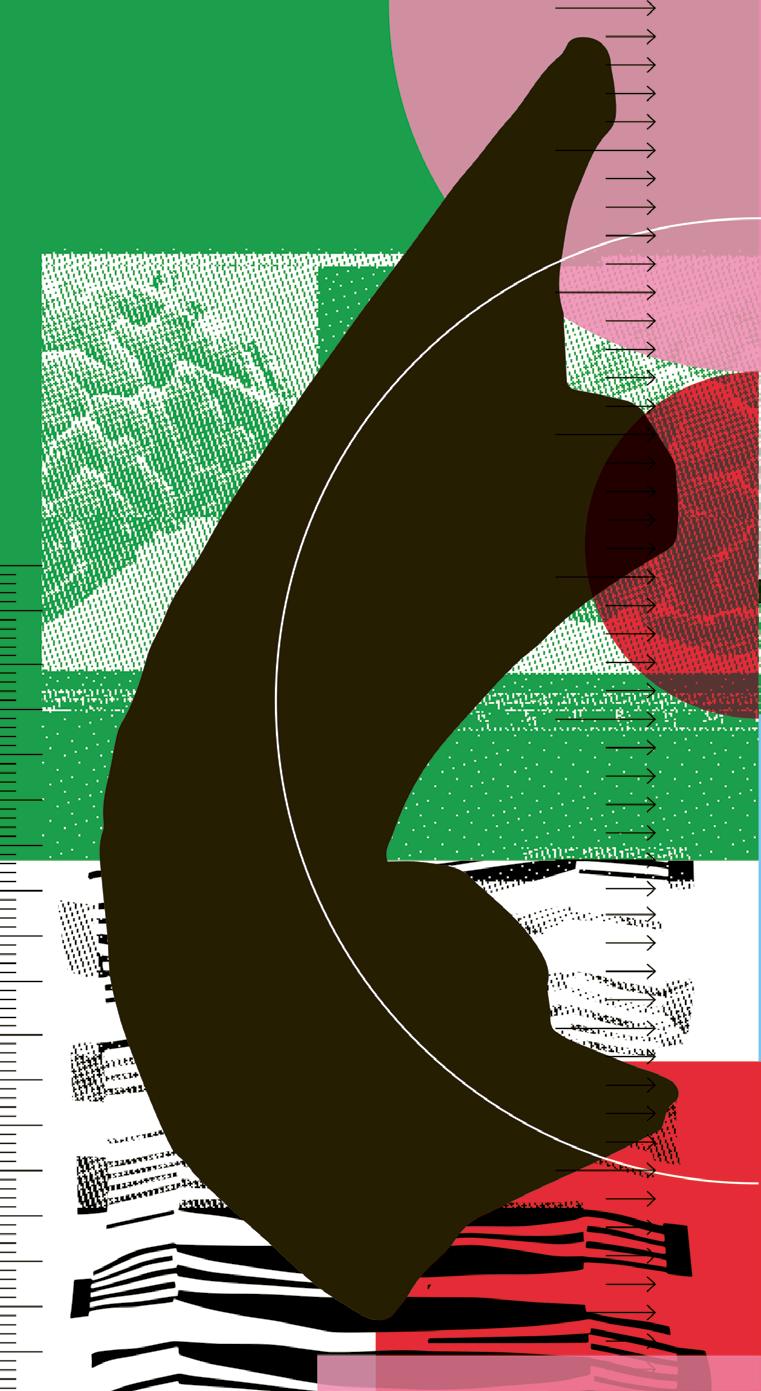
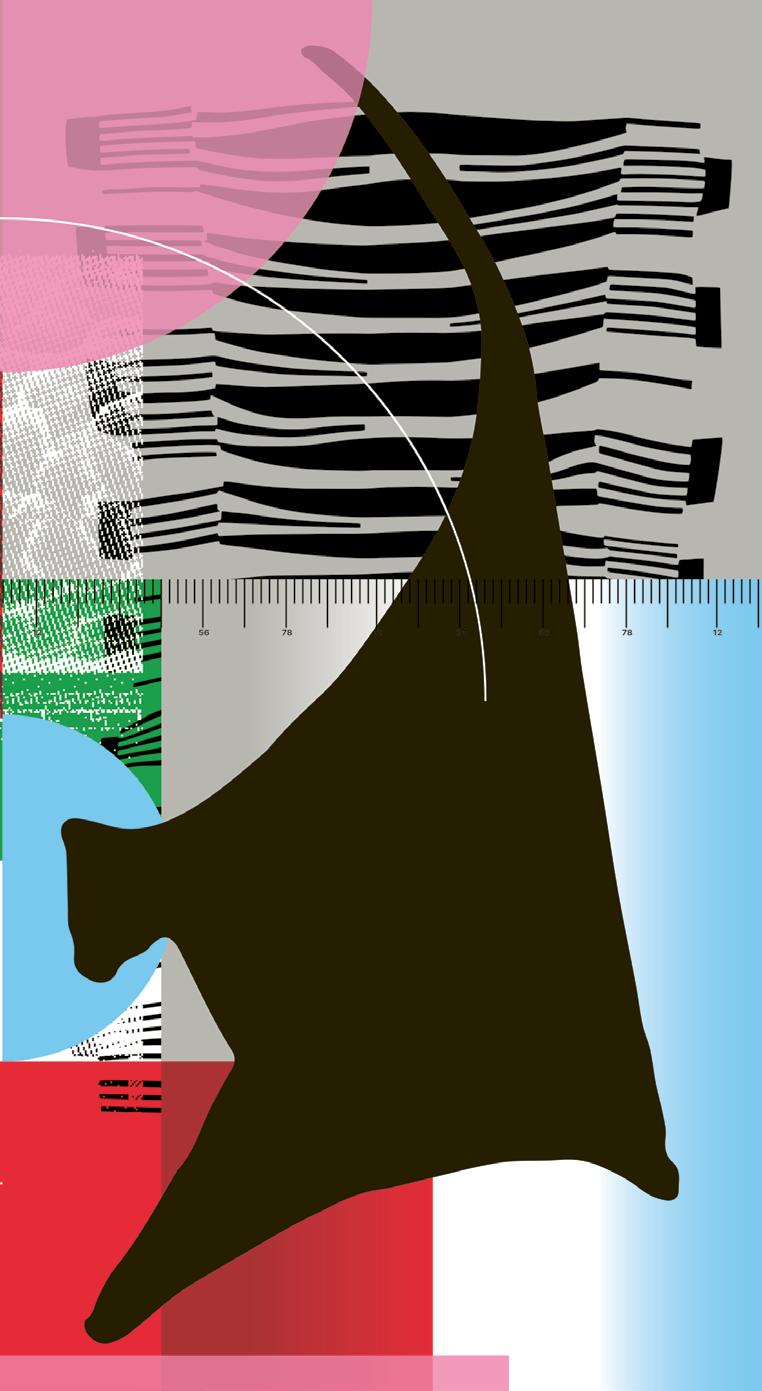







zwischenfeldern
Janice Beck
Fragmente, Texturen, Raster und Zahlen überlagern sich, wiederholen sich, lösen sich auf. Die Bildserie reflektiert unausweichliche Sprünge, abrupte Brüche und leise Verschiebungen. Manche Formen scheinen sich zu ordnen, andere driften ab. Übergänge zeigen sich manchmal nicht als klare Schwellen, sondern als vielschichtige, oft widersprüchliche Zustände: zwischen Struktur und Auflösung, zwischen Kontrolle, Erwartung und Zufall, zwischen dem, was war, und dem, was kommt.
Janice Beck, *1997, arbeitet, experimentiert, studiert als Grafikerin in Basel.
instagram.com/jahahanice janice-beck.github.io/hacking
Compassionate Communities: Übergänge am Lebensende gemeinschaftlich gestalten
Claudia Michel, Sibylle Felber und Marina Richter
Betreuung und Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase sind nicht nur Aufgaben der Gesundheitsversorgung, sondern der gesamten Gesellschaft. Auch Gemeinden kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Sie können sich an der Compassionate Community orientieren, einem kommunalen Modell, in dem Sterben, Tod und Trauer als gemeinschaftliche Ereignisse verstanden werden. Um diesen Wandel anzustossen, wurden Informations- und Bildungsangebote für Gemeinden entwickelt, namentlich eine mobile Ausstellung, die zurzeit in der Schweiz an verschiedenen Orten Halt macht.
Michel, Claudia/Felber, Sibylle/Richter, Marina (2025): Compassionate Communities: Übergänge am Lebensende gemeinschaftlich gestalten. In: Soziale Innovation 2025. S. 85–93.
Dem verbreiteten gesellschaftlichen Verständnis zufolge ist das Lebensende ein primär gesundheitliches Ereignis und daher eine Aufgabe von Gesundheitsfachpersonen mit Fachkompetenzen zur Behandlung von Symptomen. Dies wird kritisch auch als Medikalisierung des Lebensendes bezeichnet (Körtner 2022). Kritisiert wird, dass der Fokus einseitig auf medizinische und pflegerische Aspekte gerichtet ist und die Bedeutung von Gesundheitsfachleuten insgesamt überschätzt wird.
Als Gegenentwurf zur Medikalisierung der letzten Lebensphase ist in der Gesundheitsversorgung ein soziales Modell des Lebensendes entwickelt worden. Studien des Soziologen Alan Kellehear zufolge verbringen Menschen ihre letzten Tage, Wochen und Monate meist mit ihren Angehörigen oder alleine und nur wenig Zeit in Begleitung von Gesundheitspersonal, selbst wenn sie nicht zu Hause, sondern im Pflegeheim oder im Spital sind (Kellehear 2022). Der Public-HealthAnsatz der Compassionate Communities fördert die Einbindung der Gesundheitsversorgung in einen gesellschaftlichen Kontext.
Compassionate Communities
Ausgehend vom sozialen Modell des Lebensendes entstand der Begriff der Compassionate Community (Kellehear 2013). Compassionate Communities oder Compassionate Cities, wie sie auch genannt werden, sind Gemeinden, in denen das Lebensende als Angelegenheit der Gesamtbevölkerung verstanden wird. Es ist keine Aufgabe, die ausschliesslich an die Gesundheits- oder Sozialversorgung delegiert werden kann. In Compassionate Communities verbringen schwerkranke Menschen, sofern sie dies wünschen, ihre letzte Lebensphase im gewohnten sozialen Umfeld. Sie werden in der Bewältigung ihres Alltags von Angehörigen, einem Unterstützungsnetzwerk von Bekannten sowie von professionellen Fachpersonen der Gesundheitsversorgung und des Sozialwesens unterstützt. Sogenannte Sorgekreise, wie sie Julian Abel beschreibt (2018), bilden ein dichtes Unterstützungsnetz, das idealerweise ermöglicht, dass Menschen bis zuletzt in ihrem gewohnten Umfeld
bleiben können, ohne dass die betreuenden Angehörigen durch die Last der Verantwortung selbst erkranken.
Eine etablierte und funktionierende Compassionate Community fördert die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, die in der letzten Lebensphase notwendig ist. Das Konzept, englisch Death Literacy (Noonan et al. 2016), bezeichnet die kontextspezifischen Kompetenzen von Personen und Gemeinschaften, sich Zugang zu Fachwissen in der Versorgung zu verschaffen und dieses Wissen praktisch anzuwenden, damit Entscheidungen am Lebensende getroffen werden können (Leonard et al. 2021). Konkret sind es vier Aspekte, die mit Gesundheitskompetenz am Lebensende assoziiert werden:
→ Fachwissen über die Versorgung am Lebensende,
→ praktische Fähigkeiten zur Unterstützung von betroffenen Menschen,
→ eine akzeptierende Haltung gegenüber Sterben, Tod und Trauer sowie
→ kommunale Unterstützungsstrukturen.
In der Compassionate Community kommt der Gemeindebehörde und -verwaltung eine zentrale Rolle zu: Sie schafft günstige Rahmenbedingungen für das Zusammenspiel von involvierten Organisationen und Freiwilligen zur Unterstützung von vulnerablen Personen. Die Zusammenarbeit unter den Involvierten richtet sich auf die Förderung von Gesundheitskompetenz, etwa indem thematische Anlässe durchgeführt, Dienste von Palliative-Care-Organisationen sichtbar gemacht, Freiwilligeneinsätze für schwerkranke Menschen koordiniert oder Nachbarschaftshilfen in Quartieren gefördert werden. Die Gemeinde ist in der Bewältigung dieser Aufgabe jedoch nicht allein. Sie vernetzt Organisationen und Personen von staatlichen, privatwirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und privaten Bereichen.
Zusammenfassend zielt eine Compassionate Community darauf ab, die Verantwortung für die letzte Lebensphase nicht allein Gesundheitsfachpersonen zu überlassen, sondern sie als soziale Aufgabe zu verstehen
und ins öffentliche Bewusstsein zu tragen. So unterstützen Compassionate Communities Gemeinschaften dabei, die mit dem Lebensende einhergehenden Erfahrungen ins alltägliche Leben zu integrieren.
Impulse für soziale Innovationen
Compassionate Communities stellen eine soziale Innovation im Sinne von Galego und Kolleg:innen dar (Galego et al. 2022). Den Autor:innen zufolge sind soziale Innovationen kollektive Handlungen und soziale Beziehungen, die darauf abzielen, vernachlässigte Bedürfnisse zu befriedigen und soziopolitische Transformationen einzuleiten. Diese Transformationen werden durch neue Formen der Gouvernanz gestützt, die partizipative und kollektive Entscheidungsmechanismen mit konventionellen Formen des Regierens kombinieren (ebd.: 265). Die soziale Innovation von Compassionate Communities liegt einerseits darin, die Bedürfnisse von schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen bei der Bewältigung von Herausforderungen zu adressieren. Andererseits sind Compassionate Communities Ausdruck der Bemühungen, Verlusterfahrungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Gemeinden, die sich als Compassionate Communities bezeichnen, entwickeln ausserdem zusätzlich zu bisherigen Regierungsformen partizipative und kollektive Mechanismen. Sie schaffen günstige Rahmenbedingungen, die es unterschiedlichen Gruppen erlauben, einen Beitrag zur Entstehung von Gesundheitskompetenz am Lebensende zu leisten, indem sie ihre Stimme einbringen, kollektiv handeln, Beziehungen zu anderen Akteurinnen und Entscheidungsträgern festigen und an Entscheidungen teilnehmen. Die daraus resultierenden soziopolitischen Transformationen sind daran erkennbar, dass Menschen über die Versorgung am Lebensende besser informiert sind, mehr praktische Erfahrungen in der Unterstützung von Menschen machen, eine dem Lebensende zugewandte Haltung einnehmen und die lokalen Strukturen nutzen, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen.
Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung verläuft jedoch eher in die gegenteilige Richtung, nämlich
hin zu einer sich immer stärker individualisierenden Gesellschaft. Umso grösser sind die Anforderungen an einen solchen soziopolitischen Wandel. Compassionate Communities könnten einen Anstoss zu mehr Gemeinschaftlichkeit in Krisensituationen leisten. Dabei soll einerseits schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen konkrete Unterstützung zukommen und andererseits das gesellschaftliche Verständnis von Lebensende überdacht werden. In einem idealen Szenario könnten solche Communities sogar einen Rahmen bieten, der sich nicht auf Lebensendsituationen beschränkt, sondern allgemein Verlusterfahrungen von Menschen in den Blick nimmt und deren gemeinschaftliche Bewältigung fördert (Reckwitz 2024).
Informations- und Bildungsangebote
Das Projekt «Compassionate City Lab» befasste sich damit, Impulse für Compassionate Communities zu entwickeln (BFH o. J.). Das Projekt ging aus einer Zusammenarbeit dreier Bildungseinrichtungen (Berner Fachhochschule BFH, Inselspital-Universitätsspital Bern und Fachhochschule Westschweiz HES-SO Valais-Wallis) und zwei Praxispartnern (Verein «Bärn treit» der Stadt Bern und Kommission «Senioren Frutigland» von Frutigen und Anschlussgemeinden) hervor. Diese von der Gesundheitsförderung Schweiz unterstützte Arbeitsgemeinschaft ging der Frage nach, wie betreuende Angehörige den Wunsch von Menschen in der letzten Lebensphase, so lange wie möglich zu Hause zu verbleiben, erfüllen. Die Geschichten der Angehörigenbetreuung wurden nicht nur analysiert (Michel et al. 2021), sondern auch für die Öffentlichkeit aufbereitet, um in Gemeinden Gespräche über das Lebensende anzuregen. Es entstanden Informations- und Bildungsangebote: eine mobile Ausstellung, ein Dokumentarfilm und ein Kurs zur gesundheitlichen Vorausplanung. Die kleine Ausstellung «Zuhause sterben» zeigt Erfahrungen von gemeinschaftlicher Sorge von Menschen in der letzten Lebensphase aus der Sicht betreuender Angehöriger (Michel et al. 2022). Sie ist als mobile Installation mit Stellwänden konzipiert, die drei Räume
schaffen. Ein inszeniertes Schlafzimmer, eine Stube und ein Café verbinden das persönliche und intime Erleben mit der öffentlichen Auseinandersetzung des Lebensendes. Der Dokumentarfilm «Bis zuletzt» porträtiert drei Angehörige und zeigt ihre Belastungen, aber auch ihre Erfolge im Umgang mit dem Wunsch von Sterbenden, das Lebensende zu Hause zu verbringen (Michel/Slappnig 2022). Darüber hinaus vermittelt er die Sichtweisen einer Gemeinderätin und eines Stadtpräsidenten darauf, wie Gemeinden die Gesundheitskompetenz am Lebensende stärken können. Der Kurs zu gesundheitlicher Vorausplanung «Was wäre, wenn…? » befasst sich mit Möglichkeiten und Instrumenten der vorausschauenden Planung für Krankheits- und gesundheitliche Krisensituationen (Felber/Affolter 2022). Mit dem Ziel, frühzeitig für verschiedene Themen rund um die Vorausplanung von medizinischer Behandlung und Betreuung zu sensibilisieren, bietet er Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu klären und sich zu informieren, welche Vorausplanung für welche Situation Sinn ergibt. Inwiefern kann eine Ausstellung einen Anstoss für soziale Innovation darstellen? Uns interessierte im Projekt zu erfahren, ob die Ausstellung einen ersten Impuls für die Entwicklung einer Compassionate Community leistet. Hierzu sind zwei Perspektiven relevant: erstens die der Gemeinde oder der gastgebenden Organisation, welche die Ausstellung bucht, und zweitens die der Bevölkerung bzw. der Personen, welche die Ausstellung besuchen. Diese Perspektiven werden im Rahmen des Projektes «Compassionate City Lab» über Interviews und Fragebögen erhoben. Weiter werden Artefakte, die im Zusammenhang mit der Ausstellung entstehen, systematisch gesammelt und analysiert. Da die Ausstellung bis ins Jahr 2026 an verschiedenen Standorten gastiert, befindet sich das Projekt aktuell in der Phase der Datenerhebung.
Austausch rund um eine Ausstellung
Die Ausstellung ist seit September 2024 an verschiedenen Standorten zu sehen. Bis Frühjahr 2025 machte sie an zehn Standorten Halt: in sieben Kantonen (LU, UR,
SZ, BE, ZH, GR, ZG) und zehn Gemeinden (Sursee, Altdorf, Schwyz, Luzern, Burgdorf, Bülach, Chur, Muri bei Bern, Hünenberg und Büren an der Aare). Sie gastierte in vier kirchlichen Gebäuden, vier Kulturlokalen, einer Bibliothek und einem Gastronomiebetrieb. Gebucht wurde sie von sechs Leistungsträgern der Gesundheitsversorgung (Sektionen der Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Care in Graubünden, Luzern bzw. Zentralschweiz, Zürich/Schaffhausen, und ein Spital), einer kantonalen Behörde (Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion) und drei Gemeinden (drei kommunale Fachstellen für Altersfragen) für einen Zeitraum von zwei bis fünfzehn Tagen. Die gastgebenden Organisationen arbeiteten für die Durchführung der Ausstellung und des Rahmenprogramms mit Organisationen und Personen zusammen, sei es in Form von Kooperationen, Sponsoring oder durch Beiträge zum Rahmenprogramm. Im Minimum waren 3, im Maximum 27 Organisationen oder Gruppen involviert.
Ein Beispiel zur Illustration: Am Ausstellungsstandort Muri bei Bern vom 21. März bis 4. April 2025 war die kommunale Fachstelle für Altersfragen gastgebende Organisation. Als Partnerorganisationen waren im Flyer die Kirchgemeinde Muri-Gümligen und die Spitex-Organisation Home Instead genannt, sowie sieben Kooperationspartner und sechs Sponsoren. Der Gemeindepräsident eröffnete die Ausstellung, das Rahmenprogramm umfasste ein Trauercafé, ein Referat zu betreuenden Angehörigen und eines zu alternativen Bestattungsformen, einen Töpferkurs und einen Workshop zum Schreiben von Trauerkarten. Die Ausstellung machte Sterben, Tod und Trauer in der Öffentlichkeit sichtbar, indem die Ausstellung beworben wurde und Artikel und Social-Media-Posts über die Ausstellung berichteten.
Wege zur Compassionate Community
Vermag die Ausstellung nun einen ersten Impuls für eine Compassionate Community zu geben? Das Gelingen misst sich nicht nur daran, ob die Ausstellung von Gemeinden gebucht und von der Bevölkerung
besucht wird. Es interessiert, ob Gemeinden darüber hinaus günstige Rahmenbedingungen schaffen, damit unterschiedliche Gruppierungen einen Beitrag zur Ausstellung leisten, im Austausch mit anderen Involvierten stehen, in kollektive Handlungen eingebunden sind und auch an Entscheidungen partizipieren, die langfristig dazu führen, dass Gesundheitskompetenz am Lebensende entstehen kann.
In diesem Sinne lässt sich erstens konstatieren, dass jede Ausstellung zu einer breiten Vernetzung von Organisationen führte. Die Ausstellung wurde in den Gemeinden jeweils erfolgreich dazu genutzt, um Organisationen und Freiwillige in einen Austausch zu bringen, sei es für die Finanzierung der Ausstellung, die Mitorganisation der Ausstellung oder die Gestaltung des Rahmenprogramms. Zweitens wurden mittels öffentlicher Veranstaltungen, Zeitungsartikeln und Radiobeiträgen über den lokalen Kontext hinaus die Bedürfnisse von Menschen am Lebensende und deren Betreuungspersonen ins öffentliche Bewusstsein gerückt und Möglichkeiten der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme aufgezeigt.
Für eine abschliessende Betrachtung der Ausstellung ist es aber noch zu früh. Auch über die Gelingensbedingungen kann zum aktuellen Zeitpunkt nur gemutmasst werden. Eine detaillierte Analyse steht mit anderen Worten noch aus, sie ist jedoch bedeutsam. Denn wenn die Ausstellung in einer Gemeinde einen Prozess in Richtung einer Compassionate Community anstösst, hilft eine sorgfältige Analyse, um den Weg zu einem bedeutungsvollen Wandel zu verstehen.
Ausstellungsorte: www.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/compassionate-city-lab/ informationen-fuer-gemeinden/
Claudia Michel, Prof. Dr., Dozentin am Institut Alter, Berner Fachhochschule BFH. claudia.michel@bfh.ch
Sibylle Felber, M.Sc., wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitären Zentrum für Palliative Care, Inselspital, Universitätsspital Bern und Universität Bern. sibylle.felber@extern.insel.ch
Marina Richter, Prof. Dr., Professorin Soziale Arbeit, Fachhochschule Westschweiz HES-SO Valais-Wallis. marina.richter@hevs.ch
Literatur
Abel, J. (2018): Compassionate communities and end-of-life care. In: Clinical Medicine, 18 (1). S. 6–8.
BFH (o. J.): Forschungsprojekt Compassionate City Lab. www.bfh.ch/de/forschung/ referenzprojekte/compassionatecity-lab/ (Zugriff 23.04.2025).
Felber, S./Affolter, B. (2022): Entwicklung & Evaluation eines Kursangebots zur gesundheitlichen Vorausplanung. Schlussbericht (S. 27). Bern: Universitäres Zentrum für Palliative Care UZP.
Galego, D./Moulaert, F./Brans, M./ Santinha, G. (2022): Social innovation & governance: A scoping review. In: Innovation: The European Journal of Social Science Research, 35 (2). S. 265–290.
Kellehear, A. (2013): Compassionate communities: End-of-life care as everyone’s responsibility. In: QJM, 106 (12). S. 1071–1075.
Kellehear, A. (2022): The social nature of dying and the social model of health. In: Abel, J./Kellehear, A. (Hg.): Oxford Textbook of Public Health Palliative Care. Oxford: Oxford University Press. S. 22–29.
Körtner, U. H. J. (2022): Medikalisierung des Lebensanfangs und des Lebensendes. In: Riedel, A./ Lehmeyer, S. (Hg.): Ethik im Gesundheitswesen. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 685–700. Springer.
Leonard, R./Noonan, K./Horsfall, D./ Kelly, M./Rosenberg, J. P./Grindrod, A./ Rumbold, B./Rahn, A. (2021): Developing a death literacy index. In: Death Studies, 46 (9). S. 1–13.
Michel, C./Felber, S. J./Affolter, B./ Greusing, M.-H./Eychmüller, S. (2021): Compassionate Cities: Stärkung der sozialen Ressourcen in den Gemeinden für ein gemeinsam getragenes Lebensende. In: Praxis, 110 (10). S. 866–871.
Michel, C./Slappnig, J./Slappnig, O. (2022): Zuhause sterben: Wie wir als Gemeinschaft Menschen am Lebensende unterstützen. Ausstellung zur gemeinschaftlichen Sorge [Installation]. Bern: Berner Fachhochschule BFH.
Michel, C./Slappnig, O. (2022): Bis zuletzt. Erfahrungen zur gemeinschaftlichen Sorge am Lebensende [Video]. Bern: Berner Fachhochschule BFH. www.bfh.ch/ de/ forschung/referenzprojekte/ compassionate-city-lab/ informationen-fuer-gemeinden/ (Zugriff 12.05.25).
Noonan, K./Horsfall, D./Leonard, R./ Rosenberg, J. (2016): Developing death literacy. In: Progress in Palliative Care, 24 (1). S. 31–35.
Reckwitz, A. (2024): Verlust: Ein Grundproblem der Moderne. Berlin: Suhrkamp.
Übergang in die Selbstbestimmung: Soziale Innovation in der inklusiven Gesellschaft
Tobias Studer
Welche Bedeutung kommt Übergängen zu, insbesondere im Zusammenhang mit der Erhöhung von Selbstbestimmung? Der vorliegende Beitrag setzt sich mit der Frage auseinander, wie im Kontext der Lebenssituationen von Menschen mit Behinderungen Übergänge in ein selbstbestimmtes Leben individuell und gesellschaftlich ermöglicht beziehungsweise erschwert werden. Im Artikel wird die These diskutiert, dass es sich bei sozialer Innovation im Zusammenhang mit Übergängen um nicht realisierte gesellschaftliche Möglichkeiten handelt. Es gilt, die gesellschaftlichen Lernblockaden wie auch die individuellen Widerstände bei Übergängen zu analysieren.
Studer, Tobias (2025): Übergang in die Selbstbestimmung: Soziale Innovation in der inklusiven Gesellschaft. In: Soziale Innovation 2025. S. 97–104.
Selbstbestimmung stellt aufgrund aktueller gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen einen zentralen Orientierungspunkt dar: Mit der UNO-Behindertenrechtskonvention hat die Schweiz 2014 ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert und sich damit verpflichtet, Hindernisse für Menschen mit Behinderungen zu beheben, die Personen gegen Diskriminierungen zu schützen und ihre gesellschaftliche Inklusion zu fördern. Wohnen und damit das Wahrnehmen des Privatlebens stellen zentrale Elemente der bürgerlichen Gesellschaft dar. Für Menschen mit kognitiven Behinderungen ist das selbstbestimmte Wohnen aber noch immer mit etlichen Hürden verbunden. Der vorliegende Beitrag greift auf Erfahrungen in einem mehrjährigen Forschungsprojekt zur Entwicklung einer inklusiven WG zurück (vgl. Van der Kooy/Studer 2019, Studer/Van der Kooy 2024). Betreffend Übergänge wurde dabei deutlich, wie die oben beschriebenen Bestrebungen im Hinblick auf Selbstbestimmung immer wieder gesellschaftlichen, institutionellen und individuellen Begrenzungen ausgesetzt waren. Veränderungen in Form von Übergängen werden verhindert oder als unrealistisch abgewehrt. Es wird immer wieder aufs Neue deutlich, dass die Umsetzung gesellschaftlicher Bedingungen von Selbstbestimmung mit Widerständen konfrontiert ist.
Der vorliegende Beitrag greift erstens die Frage auf, inwiefern soziale Innovation in Momenten von individuellen und gesellschaftlichen Übergängen neben Fortschritten auch Regression impliziert. Hierzu wird eine aktuelle Argumentation der Philosophin Rahel Jaeggi (2023) aufgenommen. Zweitens greife ich Übergänge in die Selbstbestimmung im Kontext des Lebensverlaufs junger Menschen mit Behinderung im Hinblick auf das Wohnen auf. Drittens erfolgt eine Diskussion gesellschaftlicher Übergänge in eine inklusive Gesellschaft und viertens soll anhand der vorherigen Überlegungen die These diskutiert werden, dass es sich bei sozialer Innovation im Zusammenhang mit Übergängen um nicht realisierte gesellschaftliche Möglichkeiten handelt.
«Fortschritt und Regression»
Gesellschaftliche Veränderungen in Form von Übergängen sind wiederkehrenden Widerständen ausgesetzt. Zumindest ist das erkennbar, wenn es Menschen mit Behinderungen und die Erhöhung von Selbstbestimmung betrifft. So finden sich zwar aktuell Bestrebungen wie die Inklusionsinitiative, welche die tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen in allen Lebensbereichen in der Verfassung verankern möchte. Gleichzeitig aber lässt sich feststellen, dass die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes in der Schweiz noch immer starke Mängel aufweist. Und aktuell sind regressive Momente hinsichtlich der integrativen Schule in der Schweiz erkennbar (vgl. bspw. Labhart/Studer 2023). Was Jaeggi (2023) als Zusammenhang von Fortschritt und Regression in der gesellschaftlichen Entwicklung beschreibt, stellt ein zentrales Element der Kritischen Theorie dar, wie sie von Horkheimer und Adorno in der «Dialektik der Aufklärung» argumentativ entwickelt wurde (vgl. Horkheimer/Adorno 1997): Die moderne Gesellschaft hat ihr rückläufiges Element bereits in sich und muss dies betreffend der Forschrittsorientierung notwendigerweise reflektieren, damit der Fortschritt nicht zur Ideologie wird. Zentral ist also nicht die Idealisierung eines anzustrebenden Ziels sozialer Innovation, sondern die systematische Reflexion von Entwicklungsprozessen und Übergängen im Hinblick auf die Rückläufigkeit. Jede Forderung nach Selbstbestimmung sieht sich mit gesellschaftlichen Bedingungen, Einschränkungen und Lernblockaden konfrontiert (siehe bspw. Garcés 2022, Graf 2011). In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob eine Gesellschaft lernen kann. Hierzu braucht es die Auseinandersetzung mit und die Analysen von individuellen und kollektiven Lernblockaden.
Individueller Übergang in die Selbstbestimmung
Übergänge im Lebensverlauf sind vor allem bei jungen Menschen mit einer Behinderung mit Spannungen verbunden. Im Rahmen eines Wohnprojekts, in dem
zusammen mit jungen Erwachsenen mit einer Behinderung eine inklusive WG entwickelt wurde, wurden die Hindernisse deutlich, die sich vor allem an Übergängen zeigten ( Van der Kooy/Studer 2025). Das Projekt orientiert sich an der UNO-Behindertenrechtskonvention, womit die folgende grundsätzliche Haltung einhergeht: «Selbstbestimmt wohnen heisst: Ich sage, wo ich wohne, mit wem ich wohne und wer mir hilft.»1
Der Übergang in selbstbestimmtes Wohnen ist biografisch meistens mit einem Wechsel von familiären in individuellere Wohnformen und damit mit einem Übergang in der Adoleszenz verbunden. Für Menschen mit kognitiver Behinderung ist dieser Übergang aus der Familie heraus aber nicht automatisch gegeben. Vielmehr sieht die Realität in vielen Fällen so aus, dass die jungen Menschen entweder in Heimeinrichtungen wechseln oder möglichst lange zu Hause bei den Eltern wohnen bleiben. Die Schweiz weist hier vergleichsweise wenige Alternativen auf, das Wohnen mit Assistenz ist für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung noch eher schwach umgesetzt.2
Individuell zu leistende Übergänge im Wohnen sind dadurch geprägt, eine Vorstellung von damit verbundenen Erfahrungen zu haben und allfällige Unsicherheiten auszuhalten. So beschrieb ein junger Mann mit Behinderung die Erfahrung, dass er überhaupt erst aufgrund des Auszugs seines Bruders aus dem Elternhaus in eine WG die Vorstellung erhielt, diesen Wunsch auch zu äussern und letztlich nach vielen Jahren auch zu realisieren. Dass es neben den institutionellen Angeboten und dem Elternhaus alternative Wohnformen gibt, fällt vielen Menschen mit Behinderungen schwer zu denken. Es braucht viel Zeit, um sich darüber zu verständigen, wie sich die betroffenen Personen das Zusammenleben vorstellen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten hängen unter anderem auch mit einer individuell erlernten Hilflosigkeit zusammen.
Das Zusammenleben in der inklusiven WG brachte auch deutlich hervor, dass Mitbewohnende ungewollt in eine pädagogische und bisweilen bevormundende Haltung rutschten. Dabei handelt es sich nicht in erster Linie um ein individuelles Problem, sondern es verdeutlicht die Schwierigkeiten des Zusammenlebens, wenn
institutionelle Klarheiten von Betreuung und Pädagogik wegfallen. Ähnlich sieht es auch mit der Rolle der Assistenzen aus, deren Zuständigkeiten und Kompetenzen nicht mehr automatisch über die professionelle Zugehörigkeit gesichert sind. Vielmehr braucht es dazu konkrete Aushandlungen und Klärungen, und die involvierten Fachpersonen können sich nicht mehr auf die «Identifikation mit der Rolle» (vgl. dazu Parin 1978) abstützen .
Übergang als Erhöhung sozialer Integration
Gesellschaftsanalytisch ist mit dem Übergang in ein selbstbestimmtes Wohnen und dem angestrebten Ziel einer inklusiveren Gesellschaft ein Anspruch verbunden, der mit einem dezidiert normativen Verständnis von Sozialpädagogik und Sozialarbeit einhergeht. Die beschriebene inklusive WG lässt sich als Ausdruck einer Erhöhung der gesellschaftlichen Integrationskraft verstehen. Was unter Inklusion gefordert wird, stellt ein gesellschaftliches Bestreben dar, die Inklusion aller von möglichen Entscheidungen betroffenen Personen als gleichberechtigt an der politischen Willens- und Meinungsbildung teilnehmen zu lassen, wie das von Habermas in seiner Demokratietheorie entwickelt wurde (vgl. Habermas 2022: 21). Die von Martin Graf und Christian Vogel entwickelte «Offensive Sozialarbeit» (Graf 2017, Vogel 2017) greift das demokratische Element bei Habermas als normative Grundlage des Handelns Sozialer Arbeit auf: Sozialpädagogik stellt ein Bestreben dar, die individualistische Pädagogik zu überwinden, und liefert gleichsam eine Grundlage, um als «Offensivkraft im Dienst eines Kampfes gegen unhaltbare soziale Verhältnisse» (ebd.: 17) zu agieren. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich der Übergang in eine inklusive Gesellschaft nicht von allein ergibt und dass auch rechtliche Institutionalisierungen keinen Automatismus für Veränderungen mit sich bringen. Vielmehr ist der Übergang in eine inklusivere Gesellschaft Resultat von sozialen und politischen Kämpfen.
Das sozialpädagogische Handeln und die entsprechenden Analysen bewegen sich im Kontext einer
gesellschaftlichen Entwicklung, die in Richtung mehr Solidarität und mehr Gerechtigkeit steuern sollte (Studer 2024: 241). Gesellschaftliche Übergänge lassen sich vor dem Hintergrund dieser normativen Ausrichtung bemessen und darauf hin prüfen, wo spezifische Lernblockaden eine entsprechende Erhöhung sozialer Integration verhindern oder erschweren.
Nicht realisierte gesellschaftliche Möglichkeiten
Die beschriebenen Formen von Übergängen auf individueller, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene können als Bestreben zur Erhöhung sozialer Integrationskraft gedeutet werden: Menschen, die bis anhin tendenziell ausgeschlossen wurden, werden verstärkt in die gemeinsamen gesellschaftlichen Klärungsprozesse einbezogen. Nach der Philosophin Marina Garcés handelt es sich dabei um die zentrale Frage, wie wir zusammenleben wollen und wie wir entsprechend gemeinsam lernen können: «Wir müssen alles lernen, von Geburt an bis zum Tod» (Garcés 2022: 29).
Viele Formen der Institutionalisierung im Bereich der Sozialen Arbeit tendieren dazu, die sehr konkrete Frage, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen, möglichst auszuklammern. Die Erhöhung sozialer Integration wäre grundsätzlich möglich, es fehlt aber des Öfteren an der konkreten Umsetzung. Soziale Innovation im Zusammenhang mit Übergängen lässt sich –so die These – dahingehend diskutieren, inwiefern nicht realisierte gesellschaftliche Möglichkeiten mitgedacht werden. Dies ist die historische Grundlage der Kritischen Theorie, die danach fragte, weshalb sich die demokratischen Gesellschaftsstrukturen nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland nicht durchsetzten und warum die Gesellschaft stattdessen in die Barbarei des Holocaust geriet (Horkheimer/Adorno 1997). Dieses analytische Element ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt erschreckenderweise aktueller denn je. Die Kritische Theorie «möchte Wissen bereitstellen, damit Personen und Gruppen Herrschaftsmechanismen, verborgene Zwänge, Einschränkungen ihrer Freiheit, bewusst und verstehbar werden sowie ihnen in einem zweiten
Schritt helfen, sich von diesen, soweit es möglich ist, zu befreien» (Winter 2007: 31).
Soziale Innovation liesse sich dahingehend diskutieren, inwiefern Herrschaftsmechanismen abgebaut und verborgene Zwänge bewusst gemacht werden. Veränderungen und Fortschritte gelten dann als solche, wenn sie an der Erhöhung von sozialer Integrationskraft arbeiten und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Kritik setzt dann da an, wo gesellschaftliche Unbewusstmachungsprozesse erkennbar sind, wie das Mario Erdheim analysierte (vgl. Erdheim 1982). Es sind nicht nur äussere Widerstände, welche gesellschaftliche Veränderungen erschweren, sondern bisweilen auch innere Widerstände bei den involvierten Personen. Hier setzt eine sich kritisch verstehende Sozialpädagogik an, indem sie die Widerstände und die gesellschaftlichen Bedingungen analysiert und damit einen Beitrag dazu leistet, dass die Gesellschaft eine bessere wird.
Tobias Studer, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. tobias.studer@fhnw.ch
1 Siehe hierzu auch unter http://www.zaeme-wohne.ch/
2 Vgl. das Angebot www.wohnsinn.org, auf deren Homepage beschrieben wird, dass in der Schweiz noch wenige Angebote bestehen. Siehe hierzu auch den Schattenbericht von Inclusion Handicap zur mangelhaften Umsetzung der UNO-BRK (Hess-Klein/Scheibler 2022): Beim Wohnen fokussiere die Schweiz noch immer auf institutionelle Wohnformen, und Unterstützungsleistungen für selbständiges Wohnen seien unzureichend.
Literatur
Erdheim, Mario (1982): Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Eine Einführung in den ethnopsychoanalytischen Prozess. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Garcés, Marina (2022): Mit den Augen der Lernenden. Wien: uria + Kant.
Graf, Erich Otto (2011): Lernen ist Veränderung. Bildungs- und Erziehungsprozesse aus dem Blickwinkel der Institutionsanalyse. Münster: Waxmann.
Graf, Martin Albert (2017): Offensive Sozialarbeit. Beiträge zu einer kritischen Praxis. Band 1: Grundlagen. Norderstedt: Books on Demand.
Habermas, Jürgen (2022): Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik. Berlin: Suhrkamp.
Hess-Klein, Caroline/Scheibler, Eliane (2022): Aktualisierter Schattenbericht. Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UNAusschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Hg. v. Inclusion Handicap – Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz.https://www.inclusionhandicap.ch/admin/data/files/asset/ file_de/699/schattenbericht_de_ mit-barrierefreiheit-(1). pdf?lm=1646212633.
Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1997): Dialektik der Aufklärung. 1969 erstmals publiziert. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Jaeggi, Rahel (2023): Fortschritt und Regression. Berlin: Suhrkamp.
Labhart, David/Studer, Tobias (2023).:Für sozialen Zusammenhalt statt Vereinzelung. In: VPOD –Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft. (232). S. 5–9.
Parin, Paul (1978): Der Widerspruch im Subjekt. Ethnopsychoanalytische Studien. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Studer, Tobias (2024): Demokratisierung der Machtverhältnisse. Zur politischen Rolle der Sozialen Arbeit. In: Krebs, Marcel/Abderhalden, Irene (Hg.). Soziale Arbeit weiterdenken: Festschrift für Peter Sommerfeld. 1. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien. S. 235–254.
Studer, Tobias/Van der Kooy, Nuria (2024): Wohnen partizipativ erforschen. Methodologische Überlegungen im Kontext von inklusivem Wohnen. In: Meuth, Miriam/Mende, Julia von/Krahl, Antonia Josefa/ Althaus, Eveline (Hg.). Wohnen erforschen: qualitative Methoden und forschungspraktische Reflexionen. Bielefeld: transcript. S. 97–108.
Van der Kooy, Nuria/Studer, Tobias (2019): Wie möchte ich wohnen? Einblicke in ein inklusives Praxisprojekt. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. 25. Jg. (8). S. 20–26.
Van der Kooy, Nuria/Studer, Tobias (2025): Selbstbestimmtes Wohnen: Von der Vision zur Realität. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. (Noch nicht publiziert).
Vogel, Christian (2017): Offensive Sozialarbeit. Beiträge zu einer kritischen Praxis. Band 2: Verfahren und Anwendungen. Norderstedt: Books on Demand.
Winter, Rainer (2007): Kritische Theorie jenseits der Frankfurter Schule? Zur aktuellen Diskussion und Bedeutung einer einflussreichen Denktradition. In: Winter, Rainer/ Zima, Peter Václav (Hg.). Kritische Theorie heute. Bielefeld: transcript. S. 23–46.
Fachzeitschrift.
Herausgegeben von der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
Redaktion
Susanne Bachmann
Simone Girard
Marcel Krebs
Christoph Mattes
Korrektorat
Sandra Ryf www.varianten.ch
Gestaltung
Bonbon, Zürich
Druck
Kromer Print AG, Lenzburg
Bindung
Buchbinderei Grollimund, Reinach
Auflage
1200 Exemplare
PDF und Abonnement unter soziale-innovation-fhnw.ch
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Herausgeberin.
ISSN 1661-6871
Soziale Innovation. Zeitschrift der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
Übergänge des Arbeitsmarktes:
Orte der Sozialpolitik, Sozialer Arbeit und sozialer Innovationen
Carlo Knöpfel 11 «Jetzt oder nie» – Übergänge im Lebenslauf.
Gespräche mit Betroffenen
Marcel Krebs und Christoph Mattes
27
Auf allen Ebenen aktiv für ehemalige Heim- und Pflegekinder
Susanne Bachmann 45
Unterstützung von Menschen mit Behinderung beim Übergang ins Rentenalter
Ruth Treyer und Anselmo Portale 59
Kunst im Heft: zwischenfeldern
Janice Beck 69 Compassionate Communities: Übergänge am Lebensende gemeinschaftlich gestalten
Claudia Michel, Sibylle Felber und Marina Richter 85 Übergang in die Selbstbestimmung : Soziale Innovation in der inklusiven Gesellschaft
Tobias Studer 97
