Von göttlicher Macht zum physikalischen Gesetz: Die Geschichte der Astronomie
Eine Ausstellung von Ursula Kampmann und Daniel Baumbach


Eine Ausstellung von Ursula Kampmann und Daniel Baumbach

Eine Ausstellung von Ursula Kampmann und Daniel Baumbach
© 2022 Herausgegeben von: Sunflower Foundation / MoneyMuseum Hadlaubstrasse 106 8006 Zürich www.moneymuseum.com
Text: Ursula Kampmann und Daniel Baumbach Gestaltung und Umsetzung: Claudia Neuenschwander
Vorwort .......................................................................... 4
Von göttlicher Macht zum physikalischen Gesetz: Die Geschichte der Astronomie
Die Kunst der Beobachtung ......................................... 8
Die Deutung der Beobachtungen .............................. 15
Die Kunst der Berechnung ......................................... 20 Geänderte Spielregeln ................................................ 26 Das Phänomen Galileo Galilei ................................... 35 Die Weltmaschine ....................................................... 44
Ist da noch jemand? ................................................... 63 Star Trek oder Star Wars? ........................................... 70
Station 1
Der Blick von der Erde ................................................ 77
Station 2
Die Kirche und die Lehre der Astronomie ................ 89 Station 3
Neue Bedingungen ................................................... 101
Station 4
Galileo Galilei – ein Märtyrer der Wissenschaft? .... 111
Station 5
Newton offenbart den Sterblichen das Universum 123
Station 6
Der Traum von fremden Welten .............................. 137
Ursula Kampmann, Historikerin, Nu mis matikerin und Kuratorin der Bü chersammlung des MoneyMuseums.

Eigentlich fand ich die Geschichte der Astronomie immer todlangweilig. Wen interessiert es schon, wann welcher Stern entdeckt worden ist, und wer welches Modell vom Universum entwickelte? Ich gebe zu, als mich Jürg Conzett beauftragte, einen Essay über die Geschichte der Astronomie anhand der Bücher des MoneyMuseums zu verfassen, habe ich mich erst einmal ein paar Monate lang vor der Arbeit gedrückt. Aber Jürg Conzett beharrte auf seinem Vorhaben, und so kaufte ich mir ein paar gängige und populäre Stan dardwerke zur Geschichte der Astronomie und las sie. Sie bestätigten all meine Vorurteile: todlangweilig! Der Durchbruch kam erst mit einem Buch des Wissenschaftsautoren Thomas de Padova, der anhand des Verhältnisses zwischen Kepler und Galilei auf schlüsselte, in welchem historischen Umfeld die beiden Forscher ihre Entdeckungen machten. Mein Interesse war geweckt, als ich plötzlich begriff, dass auch der
Titelbild: Ein Blick mit Weltraumteleskop Hubble auf den Tarantelnebel: Ob irgendwo da draussen intelligentes Leben existiert? Urheber: NASA, ESA, ESO, D. Lennon and E. Sabbi (ESA/STScI), J. Anderson, S. E. de Mink, R. van der Marel, T. Sohn, and N. Walborn (STScI), N. Bastian (Excellence Cluster, Munich), L. Bedin (INAF, Padua), E. Bressert (ESO), P. Crowther (Sheffield), A. de Koter (Amsterdam), C. Evans (UKATC/STFC, Edinburgh), A. Herrero (IAC, Tenerife), N. Langer (AifA, Bonn), I. Platais (JHU) and H. Sana (Amsterdam).
Fortschritt in der Astronomie nichts anderes ist als das Ergebnis aus dem Zusammenspiel von sozialen, politischen und wirtschaftlichen Zwängen. Und als ich realisierte, dass das in den populären Medien verbre itete Bild vom wissenschaftlichen Fortschritt nicht im Geringsten der historischen Vergangenheit entspricht, begann ich zu hinterfragen, woher wir unsere Bildungs versatzstücke beziehen.
Plötzlich hatte ich ein Déjavu. Ich war wieder in der Vorbereitung zur letzten Ausstellung des Money Museums über die Geschichtsbilder der Schweiz. Genau wie bei Wilhelm Tell gab es auch in der Wissenschaftsgeschichte Interessensgruppen, die ihre eigene Agenda hatten, wenn sie Galileo Galilei oder Isaac Newton zu den großen Heroen der Wissenschaft stilisierten. Die Frage, warum wir uns an manche Namen erinnern und an andere nicht, schien mir noch viel spannender, als das Geschehen selbst.
Ich gebe zu: Es hat mich gepackt. Was ein kleiner Text von ein paar Seiten werden sollte, wuchs sich zu einem längeren Essay aus.
Sie können ihn als Einleitung zur Ausstellungspublikation lesen. Daniel Baumbach hat die darin zusammengefassten Erkenntnisse auf einige Bücher des MoneyMuseum angewandt, die Sie in der Ausstellung des Winterhalbjahres 2022/23 sehen.
Wir beide hoffen, dass Sie uns nach der Lektüre resp. dem Besuch der Ausstellung zustimmen werden: Die Geschichte der Astronomie ist total aufregend.
Ursula Kampmann
Rund 120 Milliarden US Dollar investiert die Mensch heit im nächsten Jahrzehnt in die Raumfahrt, und das obwohl es auf der Erde genug andere Problemfelder gäbe, für die man dieses Geld ausgeben könnte. Warum wollen wir seit mehr als 2500 Jahren wissen, was über den Wolken ist? Und hat dieses Wissen irgendwelche Auswirkungen auf die Gesellschaft, die unter diesen Wolken lebt? Sind gar Gesellschaftsstruktur und das Wissen über den Himmel in irgendeiner Form voneinander abhängig? Das sind die Fragen, denen dieser Essay nachspürt.
von Ursula Kampmann
Es ist ein ewiger Kreislauf: Die Sonne geht auf; die Sonne geht unter. Der Mond nimmt ab; der Mond nimmt zu. Aus Winter wird Frühjahr, aus Frühjahr Sommer, aus Som mer Herbst, und auf den Herbst folgt der Winter. Immer wieder. Und irgendwie, das haben wir Menschen schon in grauer Vor zeit begriffen, hängt dieser stetige Wandel mit Sonne und Mond zusammen. Sie sind die Herrscher der Himmel: die Sonne am Tag, der Mond in der Nacht.
Was interessieren uns die Gestirne?
In einer Zeit, in der wir Brot bei der Backstation und Gemü se im Supermarkt kaufen, können wir uns nicht mehr vor stellen, dass es vor 5000 Jahren von existentieller Bedeutung war, über Sonne, Mond und ihre Verbindung zum Kalender Bescheid zu wissen. Damals war der Mensch den Jahreszei ten ausgeliefert. Für den Ackerbauern war es lebenswichtig nicht nur zu ahnen, sondern zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt für die Aussaat gekommen war und wann der Winter vor der Tür stand. Deshalb suchten diejenigen, die eine Gemeinschaft leiteten, schon früh nach Zeichen, die den Wechsel der Jahreszeiten untrüglich vorhersagten. Sie fanden sie am Himmelszelt. Die Ägypter zum Beispiel verehrten schon um das Jahr 3000 v. Chr. den Hundsstern
Der Sonnenwagen von Trondholm gibt uns einen Einblick in die Vorstellungswelt des Nordens Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. Foto: UK.
Sirius, der durch sein Erscheinen die jährliche Nilschwem me ankündigte.
Sonne und Mond spielten in allen vorgeschichtlichen Religionen eine zentrale Rolle. Die einen stellten sich vor, dass der Sonnenwagen von Pferden über den Himmel gezogen wird. Andere behaupteten, der Sonnengott fahre in der Nacht auf einer Barke den unterirdischen Nil hinab und durchquere so den Leib der Göttin Nut, um am Morgen verjüngt am Himmel wiedergeboren zu werden. Wieder andere opferten ihr Blut, um so die Sonne für ihre tägliche Reise zu nähren.

Stonehenge am Tag der Wintersonn wende: Der Bau dieses vorge schichtlichen Him melsobservatorium wurde Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. begonnen. Foto: Chuta Kooanantkul / Shutterstock.

Bestandteil der astronomischen Uhr von Antikythe ra aus dem 1. Jh. v. Chr. Foto: KW.
 Die Kunst der Beobachtung
Die Kunst der Beobachtung
Jeder kann die Phänomene am Himmelszelt beobachten, wenn er sich dafür genug Zeit nimmt. Um die eigenen Beobachtungen zu objektivieren und für eine Gemeinschaft nutzbar zu machen, entwickelten Astronomen schon sehr früh Messinstrumente wie Stonehenge mit seinen festste henden geraden und waagrechten Linien. Jede gerade Mauer kann als künstlicher Horizont dienen, an dem ein Punkt Aufgang und Untergang eines Gestirns fixiert. Ein anderes Instrument ist der Winkelmesser. Er hilft, den höchsten Punkt eines Gestirns festzulegen.
Je mehr Wissen über die Gestirne existierte, umso komplexer wurden die Instrumente. Um das Jahr 250 v. Chr. soll der griechische Astronom Eratosthenes bereits die erste Armillarsphäre konstruiert haben. Sie bildete den sich wandelnden Himmel ab und machte es möglich, zukünftige Sternpositionen vorauszusagen. Wie kompliziert solche Apparate beschaffen waren, erfahren wir aus den Funden, die aus dem um 70 v. Chr. vor Antikythera gesunkenen Wrack geborgen wurden. Einige von ihnen lassen sich zu einer astronomischen Uhr zusammensetzen, die den Stand der Sonne, des Mondes und der Sterne nachvollzog.
Nun ist es eine Sache, den Himmel zu beobachten und aus wiederkehrenden Erscheinungen allgemeingültige Regeln abzuleiten. Eine ganz andere ist es, aus den eigenen Beobachtungen Hypothesen über die Beschaffenheit des Himmelsgewölbes abzuleiten, mit denen sich alle bekann ten Phänomene erklären lassen. Denn wir dürfen nicht vergessen: Bevor der erste Mensch in einer Raumkapsel die Weiten des Weltraums erkundete, war jedes Modell des Kosmos’ nur eine Hypothese, eine Hypothese, die Mathe matiker mit Hilfe von komplizierten Rechnungen zu be gründen versuchten.
Ägyptischer Obelisk vor der römischen Kirche Trinità dei Monti. Foto: UK.

Fassen wir an dieser Stelle zusammen, dass die klassische Astronomie vor dem Beginn der Raumfahrt nur über zwei Methoden verfügte: die Beobachtung die Mathematik Beide zusammen summierte jeder Astronom zu seiner eigenen Hypothese, wie das Weltall beschaffen sein könnte. Diese Hypothese diente ihm vor allem dazu, zukünftiges Himmelsgeschehen genau vorherzusagen.
Viele dieser Vorhersagen wurden in praktische Anwendun gen des Alltags umgesetzt. Das einfachste und gleichzeitig beste Beispiel dafür ist die Sonnenuhr, die bereits von den Ägyptern des 4. Jahrtausends vor Christus genutzt wurde. Es ist ja auch so leicht zu beobachten, dass ein Stab einen Schatten wirft. Jeder, der diesen Schatten mehrere Tage hintereinander beobachtet, wird feststellen, dass er mit dem Lauf der Sonne fest verbunden ist. Ein nächster Schritt ist es, den Weg, den der Schatten tagsüber zurücklegt, mit Hilfe von permanenten Markierungen in gleiche Teile aufzuteilen. Unsere Stunden beruhen auf diesem Prinzip. Dass eine primitive Sonnenuhr im Winter kürzere Stunden zeigt als im Sommer, störte in der Antike niemanden. Die Zeit und ihr
Titelblatt des Stan dardwerks von Johann Friedrich Penther über die Konstruktion einer Sonnenuhr, nach gedruckt 1768 in Augsburg.

Erleben ist nämlich relativ. Seine Zeit minutengenau ein zuteilen, wird erst dann zum Bedürfnis, sobald es eine Möglichkeit gibt, das Verstreichen der Zeit minutengenau anzuzeigen, und es war erst die weite Verbreitung der Ta schenuhr, die dies möglich machte. Sie veränderte das Zeitempfinden ihrer Nutzer und hatte damit gleichzeitig Rückwirkungen auf die Konstruktion der Sonnenuhren.
Die verschwanden nämlich nicht mit dem Erscheinen der Taschenuhr. Im Gegenteil, sie erlebten in der frühen Neuzeit ihre grösste Blüte und blieben bis weit ins 18. Jahr hundert die dominierende Form der Zeitmessung. So konn te das MoneyMuseum jüngst im Antiquariat Rezek einen Bestseller aus dem Jahr 1768 kaufen, der sich mit der Konst ruktion von Sonnenuhren beschäftigt.
Nun mag man sich fragen, warum trotz der Erfindung der Taschenuhr die Konstruktion von Sonnenuhren immer noch von solch grosser Bedeutung war. Die Antwort ist einfach: Nur die wenigsten Uhrmacher waren so geschickt, dass ihre Erzeugnisse Tag für Tag exakt liefen. Die meisten Uhren gingen jeden Tag mehrere Minuten vor oder nach. Um sie zu justieren, brauchte es die Sonnenuhr, die un bestechlich die Mittagsstunde anzeigte.
Dass sich das Zeitverständnis der Menschen durch die mechanischen Uhren mit ihren Minutenzeigern gewandelt hatte, zeigt die Tatsache, dass die Sonnenuhren des 18. Jahr hunderts wesentlich genauer gehen mussten als ihre rö
mischen Vorbilder. Ein einfacher Stab reichte schon lange nicht mehr aus. Im 18. Jahrhundert waren Sonnenuhren hochkomplexe Messgerät, die Stunden und Minuten messen konnten, wenn man sie passend zum geographi schen Längengrad einstellte und die zur Jahreszeit passende Skala besass.
Die Konstruktion einer Sonnenuhr gemäss dem grundlegenden und weit verbreite ten Werk von Jo hann Friedrich Penther war alles andere als einfach, wie Tafel XI zeigt.

In der Vorrede stellt Autor Johann Friedrich Pen ther fest, dass es sich bei seinem Werk um ein «Mathematisches Tractat» handelt.

Der Autor unseres Buchs über die Sonnenuhren verstand sich nicht als Astronom, sondern als Mathematiker. Johann Friedrich Penther (1693–1749) war das, was wir heute einen Ingenieur nennen würden. Er verdiente sich seinen Lebens unterhalt, indem er verschiedene Aufgaben mit Hilfe ange wandter Mathematik löste. Er vermass für seinen Auftragge ber Grundstücke, berechnete die Flugbahn von Kanonen und legte die Stelle fest, wo der feindliche Festungswall am leichtesten zu durchbrechen sein würde. Ausserdem konst ruierte er eine damals höchst innovative Sonnenuhr, die heute noch vor der Wolfenbütteler Bibliothek zu sehen ist. Sie wurde berühmt und ihr Urheber Penther hielt in seinem grundlegenden Buch fest, was es brauchte, um so eine Sonnenuhr zu konstruieren – und das war eben keine Astro nomie, sondern reine Mathematik.
Halten wir an dieser Stelle fest, dass die Raumfahrt Johann Friedrich Penther bei der Konstruktion seiner Sonnenuhr nicht weitergebracht hätte. Für seine Berechnungen spielte das Weltall nämlich keine Rolle. Um die Gestirne im prakti schen Leben zu nutzen, brauchte und braucht es nämlich keinerlei Wissen um den Aufbau des Weltalls, sondern lediglich ein grosses Mass an Beobachtungsgabe und Erfah rung.
Menschen sind sinnsuchende Wesen. Sie beobachten nicht nur, sondern inter pretieren ihre Beobachtungen. Hatten Jahrtausende lang Mythen zur Interpretation genügt, kon struierten die Griechen mit Hilfe der Mathe matik ein Modell des Kosmos, das auch ohne ein Eingreifen göttlicher Mächte funktio nierte. Manche ihrer Ideen beeinflussten die Astronomie noch fast 2000 Jahre später.
Die griechischen Wurzeln des geozentrischen Weltbilds
Für einen griechischen Philosophen war die Mathematik die Sprache der Götter, in der sich die Weltenharmonie ausdrücken liess. Und so dienten ihnen Geometrie und Logik dazu, ein stimmiges Modell des Kosmos zu erdenken, das all ihre Beobachtungen erklärte. Dabei entwickelte jeder Philosoph seine eigenen Vorstellungen vom Weltall, und ja, es gab auch damals schon Menschen, die behaupteten, dass die Erde sich um die Sonne drehe. Zur communis opinio entwickelte sich diese Idee nicht. Meinungsmacher wurde stattdessen Aristoteles: Er beschrieb die Erde als eine Kugel, um die sich – an transparenten Sphären befestigt – Planeten und Sterne bewegten.
Diese Vorstellung übernahm der wohl einflussreichste Astronom der Antike, der alexandrinische Gelehrte Claudi
1 Die Kunst der Beobachtung
Eine Darstellung des geozentrischen Weltbildes nach Johannes von Sacrobosco.
us Ptolemaios. Er lehrte im 2. Jahrhundert n. Chr. am Mu seion von Alexandria und schrieb ein viel rezipiertes Werk, das ursprünglich den Titel Mathematike Syntaxis trug. Übersetzt bedeutet das Systematische Darstellung der Mathematik. Mathematik wohlgemerkt! Nicht Astronomie! Aber weil zu den Anwendungen der Mathematik eben auch die Astronomie gehörte, fasste Claudius Ptolemaios darin alles zusammen, was die Gelehrten so über den Kosmos zu wissen glaubten. Und das war eben die Tatsache, dass Planeten und Sternbilder an Sphären geheftet waren, auf denen sie um die kugelförmige Erde kreisten. 1025 Sterne in 48 Bildern listete Ptolemaios in seinem epochalen Werk auf und zeigte, wie ihre Bahn vorausberechnet wurde. Übrigens lieferte Claudius Ptolemaios nicht nur die Grundlagen der antiken Astronomie. Er war als Kind seiner Zeit überzeugt, dass die Sterne das Schicksal der Menschen beeinflussen. Seine Ausführungen bildeten die Basis der Astrologie, die viele Jahrhunderte lang als Schwesterwissen schaft der Astronomie existierte. Denn auch wenn die Herren Wissenschaftler gerne aus reinem Erkenntnisdrang in den Himmel starrten, lag ihren Auftraggebern viel mehr an den praktischen Ergebnissen des Starrens. Und wer von

sich behauptete, er könne durch eben dieses Starren die günstigste Stunde für eine Hochzeit, einen Angriff, eine Vertragsunterzeichnung festlegen, musste nicht lange um Forschungsmittel betteln.
Aber zurück zur Mathematike Syntaxis des Claudius Ptolemaios. Sie wurde zu einem Bestseller, den man in byzantinischen und vor allem arabischen Bibliotheken eifrig studierte. Dort erhielt sie auch den Namen, unter dem sie die europäischen Gelehrten des Mittelalters kannten: Almagest, abgeleitet vom arabischen Artikel al, und vom griechischen megistos . Übersetzen könnte man diese Be zeichnung vielleicht am treffendsten mit Das Grösste. Das Kennenlernen erfolgte im 12. Jahrhundert. Damals übersetzten zwei Gelehrte von einander unabhängig den Almagest ins Lateinische: Der eine in Sizilien aus dem Griechischen, der andere in Toledo aus dem Arabischen. Ihre Übersetzungen verbreiteten sich durch handschriftli che Kopien von Universität zu Universität.
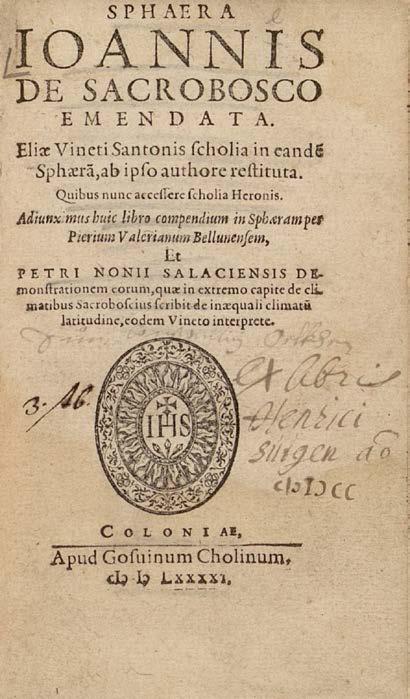
Einer der den Almagest mit Begeisterung las, war Johannes von Sacrobosco. Er wurde zum einflussreichsten Astrono men des Hochmittelalters. Viel wissen wir nicht über sein Leben. Er könnte 1195 in Schottland geboren worden sein und starb sicher in Paris, vielleicht um 1256. Sicher ist auch, dass Johannes von Sacrabosco Geistlicher war und an der Pariser Universität lehrte, und zwar bevor sie als Sorbonne Berühmtheit erlangte.
Damals musste jeder Student, ehe man ihn zum Studium der Theologie, der Medizin oder der Rechtswissenschaften zuliess, die sieben freien Künste gemeistert haben. Dazu gehörten im Grundstudium Grammatik, Rhetorik und Dialektik, im Aufbaustudium Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Für die Astronomie war in Paris Johannes
Titelblatt des Trac tatus de Sphaerae von Johannes von Sacrobosco. Das im MoneyMuseum aufbewahrte Exem plar erschien 1591 in Köln.
1 Die Kunst der Beobachtung
von Sacrobosco zuständig. Er wird so gelehrt haben, wie das damals alle Professoren taten: Er besass sein eigenes Manu skript zum Lehrstoff, das er während der Vorlesung vorlas. (Daher die Bezeichnung Vorlesung. ) Seine Studenten schrieben mit und machten sich anhand seiner Erklärungen Anmerkungen zu schwierigen Passagen.
Der Tractatus de Sphaera des Johannes von Sacrobosco, den wir 2022 im Antiquariat Rezek erwarben, dürfte aus diesem Skript hervorgegangen sein. Jahrhundertelang lasen ihn Professoren ihren Studenten vor. Und immer neue Generationen von Studenten schrieben ihn während der Vorlesungen mit. Deshalb kursierte der Traktat in unzähli gen Handschriften, von denen Hunderte bis heute überlebt haben.
Der Erfolg des Traktats hatte einen guten Grund. Es war nicht nur didaktisch hervorragend aufbereitet, sondern auch auf dem neuesten Stand der Forschung. Sacrobosco benutzte die arabischen Ziffern. Damit war er einer der ersten westlichen Mathematiker, die dies taten. Darüber hinaus verarbeitete er nicht nur den Almagest des Ptole maios, sondern zitierte die arabischen Astronomen, sofern sie in lateinischer Übersetzung vorlagen. Zu ihnen gehörten Thabit ibn Qurra aus Bagdad, der im 9. Jahrhundert das Werk des Ptolemaios überarbeitet hatte, und der um 1015 verstorbene Al-Biruni, der die indische Forschungstradition vertrat.
Basierend auf ihren Erkenntnissen schilderte Sacrobos co den Kosmos wie ihn die Griechen beschrieben hatten: In der Mitte die Weltkugel, umkreist von den sieben Plane ten – Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn, darum das Firmament, die Sphäre der Fixsterne. Die göttli che Sphäre umhüllte und hielt diese Welt.
Mit Hilfe dieses Modells berechnete Sacrobosco die Planetenbahnen. Dabei stellte sich ihm allerdings ein geo metrisches Problem. Von der Erde aus beobachtet, verliefen diese Bahnen nicht linear. Sie glichen vielmehr einer Schlei
fe, was nur damit erklärt werden konnte, dass die Planeten eine Art Purzelbaum vollführten. Eindeutig ein Schönheits fehler des göttlichen Weltenplans. Eine Purzelbaumschla gende Sonne! Aber das störte niemanden – oder sagen wir besser noch niemanden.
1472 wurde Sacroboscos Buch erstmals gedruckt. Es blieb nämlich auch im 16. Jahrhundert das verbindliche Elementarlehrbuch zur Astronomie. Wie gross seine Bedeu tung war, kann man daran ermessen, dass es in alle wichti gen westeuropäischen Volkssprachen übersetzt wurde. Bis zum Jahr 1650 erschienen 240 Drucke dieses Standardwerks. Einen davon erwarb das MoneyMuseum kürzlich in einer Ausgabe des Jahres 1591. Sie überliefert nicht nur den ei gentlichen Text von Sacrobosco, sondern auch die Kom mentare bekannter Astronomen. Eli Vinet (1509–1587) war der bekannteste der drei als Autoren genannten Persönlich keiten. Er lehrte an der Universität von Coimbra im König reich Portugal und war damit ein Zeitgenosse des Pedro Núñez, dessen berühmtester Schüler der Jesuit Christoph Clavius werden sollte.
Die Schleifen, die Planeten nach dem geozentrischen Weltbild auf ihren Bahnen zu ziehen scheinen, brachten Mathematiker ins Grübeln.

Das 16. und 17. Jahrhundert sollte die entscheidende Epoche für die Astronomie werden. Quasi im Monatstakt machten Sterngucker neue Entdeckungen und ver breiteten sie mit Hilfe der noch jungen Druckerpresse. Damit vervielfältigte sich das astronomische Wissen über die Stern bewegungen. Durch das zusätzliche Daten material gewannen die Mathematiker ganz andere Möglichkeiten zur Berechnung der Planetenbahnen. Das war auch drin gend nötig, denn die Zeit war aus dem Takt geraten.
Der bekannteste Astronom des 16. Jahrhunderts: Christopher Clavius
Als Lichtgestalt der Astronomie galt im 16. Jahrhundert weder Kopernikus, noch Kepler oder gar Galilei, sondern der heute im breiten Kreisen vergessene Christopher Cla vius. Er beeinflusste unser tägliches Leben nachhaltig. Ihm verdanken wir den immer noch gültigen Gregorianischen Kalender von 1582, nach dem heute die ganze Welt ihre Termine festlegt.
Clavius wurde 1538 in Bamberg geboren. Er war nicht nur hoch intelligent, sondern auch tief gläubig, eine Kombi nation, die ihn für eine Karriere bei den Jesuiten prädesti
Porträt des Chris toph Clavius im geistlichen Ge wand. Er hält einen Zirkel in der Hand, das wichtigste Hilfsmittel für geometrische Be rechnungen. Im Hintergrund weite re astronomische Messgeräte.
nierte. Kein anderer Orden liess seinen Schützlingen eine vergleichbare Ausbildung angedeihen: Clavius trat 1555 –also mit 17 Jahren – dem Orden bei. Schon ein Jahr später schickte man ihn an die berühmte Universität von Coimbra, wo damals der Mathematiker und Astronom Pedro Núñez lehrte. Núñez revolutionierte die Positionsbestimmung der Gestirne, so dass deren Stand wesentlich akkurater als zuvor dokumentiert werden konnte. Seine Innovationen waren von entscheidender Bedeutung für die Datenerfassung.
Fünf Jahre später wurde Clavius ans Collegio Romano in Rom berufen. Dort ernannte man ihn 1563 zum Professor für Mathematik – Mathematik nicht Astronomie! Aber wie wir bereits mehrfach betont haben, gehörte die Astronomie zu den mathematischen Wissenschaften. Deshalb zeichnete Clavius auch verantwortlich für die Reorganisation der päpstlichen Sternwarte.
Und das führt uns zu einer entscheidenden Frage: War um besass der Papst überhaupt ein astronomisches For schungszentrum? Schliesslich glauben wir doch alle zu

Christi. Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Col mar. Foto: KW.

wissen, dass sich der Vatikan nicht für den astronomischen Fortschritt interessierte.
Tatsächlich gehörte die Kirche zu den wichtigsten Förderern der Astronomie, und zwar aus einem einfachen Grund: Sie hatte ein Sonne-Mond-Kalender-Problem. Während sie den Jahreswechsel nach dem Julianischen – auf der Sonne basierenden – Kalender berechnete, fixierte sie das Datum für das Osterfest nach dem Mondkalender: Es fiel auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühjahrs äquinoktium, also nach dem Tag, an dem die Sonne im Frühjahr genauso lang über wie unter dem Horizont steht. Damit musste im voraus(!) berechnet werden, auf welchen Tag des kommenden Julianischen Jahres das Äquinoktium fallen würde. Dieses Datum musste man in den Mondkalen der umrechnen, um den nächsten Sonntag als Ostertag zu benennen und davon ausgehend einen Teil des Kirchenjah res festzulegen.
Nun hat dummerweise das Sonnenjahr nicht 365, son dern 365,2422 Tage, eine ungerade Zahl, die der Julianische Kalender mit einem Schalttag alle vier Jahre ausgleicht. Trotzdem weicht das Julianische Jahr jedes Jahr um exakt 0,0078 Tage vom Sonnenjahr ab. Das summierte sich. 1235, als Sacrobosco einen Vorschlag für eine Kalenderreform machte, betrug dieser Zeitunterschied bereits ca. 10 Tage!
Das hätte in Rom niemanden kümmern müssen, hätte der Papst nicht als pontifex maximus den Anspruch erho ben, weltweit die Verantwortung für die Zeitrechnung zu tragen. Er hatte dieses Amt von seinen römischen Vorgän gern geerbt, von denen der berühmteste pontifex maximus Julius Caesar die letzte Kalenderreform durchgeführt hatte. Vor allem in einer Zeit, in der überall Kritik am Papsttum laut wurde, war es eine sinnvolle PR-Massnahme, wenig
Seite aus dem Manuskript des Kopernikus, auf dem er ein Weltall konstruiert, bei dem die Erde sich um die Sonne
stens diesen Missstand zu beseitigen. Die Mittel waren vorhanden: Der Papst leistete sich die besten Astronomen der Welt zur Berechnung des Osterdatums. Sie trugen den Ehrentitel Computisten. Christopher Clavius war einer von ihnen.
Und diesen Computisten lieferte Nikolaus Kopernikus mit seinem Buch De revolutionibus orbium coelestium (= Über die Umlaufbahnen der Himmelssphären) im Jahr 1543 eine neue Methode, wie sich die Umlaufbahnen der Planeten wesentlich einfacher vorherberechnen liessen. Wenn man davon ausging, dass die Erde um die Sonne kreiste, fielen auf einen Schlag all die lästigen Purzelbäume der Gestirne weg, die so schwierig vorherzusagen waren. Seine Zahlen und Methoden wurden deshalb sehr schnell

Titelblatt einer der zahlreichen Aufla gen des Lehrbuchs von Christoph Clavius mit dem Titel In sphaeram Ionnis de Sacro Bosco commentari us. Unser Exemplar erschien 1596 in Venedig
akzeptiert. Weltanschauliche Probleme gab es keine, denn der Herausgeber der Schrift hatte vorsichtshalber eine anonyme Einführung vorausgeschickt, in der er festhielt, dass Kopernikus sein Buch als ein Gedankenspiel ver standen habe, als eine Hypothese, mit deren Hilfe sich alle Berechnungen leichter durchführen liessen. Kopernikus konnte dem nicht mehr widersprechen. Er starb am 24. Mai 1543 im heute polnischen Frauenburg. Wahrscheinlich hat er sein in Nürnberg gedrucktes Buch nie in Händen ge halten.
So flossen also auch die Erkenntnisse des Nikolaus Koper nikus ein, als Christoph Clavius im Jahr 1570 sein epochales und grundlegendes Lehrbuch zur Astronomie publizierte. Dieses Lehrbuch, das Clavius bescheiden In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius (= Kommentar zu den Sphaeren des Johannes von Sacrobosco) nannte, löste das Werk des Sacrobosco an allen Universitäten ab. Alle wichtigen Astronomen lernten ihr Handwerk fortan anhand des Buchs von Christopher Clavius. 2022 konnte das MoneyMuseum im Frankfurter Anti quariat Tresor am Römer ein Exemplar dieses neuen Lehr buchs kaufen. Es handelt sich um eine Ausgabe von 1596. Das Buch des Clavius wurde nämlich schon zu seinen

Das neue Lehrbuch von Christoph Clavius war in der Theorie nur ein Kommentar zu Sacrobosco. Aller dings übertrafen die von Clavius verfassten Passa gen die Länge des eigentlichen Textes um ein Viel faches.

Lebzeiten ständig nachgedruckt: allein zwischen der Erst publikation und dem Tod des Clavius sieben(!) Mal. Der Autor erweiterte und ergänzte jede einzelne Ausgabe, um auf dem neuesten Stand der Forschung zu bleiben. Er er wähnt zum Beispiel in einer der späteren Ausgaben die Beobachtungen, die Galilei mit seinem Fernrohr machte.
Wer also auf dem neuesten Stand der Forschung bleiben wollte, musste sich alle sieben Ausgaben des Clavius vom Buchmarkt kommen lassen! Bis 1618, also in den sechs Jahren nach dem Tod des grossen Astronomen, erfuhr das Werk neun weitere Auflagen!
Das stellt uns vor zwei Fragen: Warum explodierte das astronomische Wissen in der Zeit um 1600 derart, dass dieses grundlegende Werk ständig ergänzt werden musste? Und wieso schluckte der Buchmarkt derart viele Ausgaben? Um das zu erklären, müssen wir vier Faktoren in Rechnung stellen:
1. Die grosse Kalenderreform
2. Die Erwerbsmöglichkeiten für Astronomen
3. Die verbesserten Messmethoden
4. Die Erfindung des Fernrohrs
Es gibt eine alte Scherzfrage unter Historikern: Was geschah am 10. Oktober 1582? Die Antwort ist einfach: Nichts. Denn der 10. Oktober 1582 wurde durch die Gregorianische Kalenderreform als einer von 10 Tagen ersatzlos gestrichen. Tatsächlich bewegten diese 10 fehlenden Tage mehr als die meisten Schlachten: Sie veränder ten nicht nur die Zeitrechnung, sondern machten die Astronomie zu einem zen tralen Thema.

Titelblatt der Bulle Inter gravissimas, mit der die Grego rianische Kalen derreform allen Katholiken zur Pflicht gemacht wurde.
Die Idee einer Kalenderreform war nicht neu. Seit Jahrhun derten wurde darüber diskutiert. Aber mit Papst Gregor XIII. und Christoph Clavius waren zwei «Macher» am Drücker. Gregor setzte eine Kommission ein, und Clavius verwandelte die vielen Vorschläge, die Mathematiker aus allen Winkeln der katholischen Christenheit der Kommission vortrugen, in eine 800 Seiten umfassende Handlungsanweisung, die Gregor XIII. mit seiner Kalenderreform in die Tat umsetzte.
Und so verlas der Papst feierlich am 24. Februar 1582 eine Bulle, in der er für alle katholischen Gläubigen ver pflichtend dekretierte, dass das Jahr 1582 10 Tage weniger haben solle. Auf Donnerstag, den 4. Oktober 1582, werde Freitag, der 15. Oktober, folgen. Zukünftig werde man auf
Blick auf den Marktplatz von Augsburg in den Monaten Oktober, November und Dezember. Der Schnee erinnert daran, dass im 16. Jahrhundert die Menschen eine kleine Eiszeit durchlebten.
den Schalttag, der alle vier Jahre zusätzlich fällig wurde, jeweils zur Jahrhundertwende verzichten, um weitere Verschiebungen zwischen den natürlichen und den ka lendarischen Jahreszeiten zu vermeiden.
Während des Augsburger Reichstags im September des Jahres 1582 forderte der päpstliche Legat alle Reichsstände auf, den neuen Kalender einzuführen. Die Gründe dafür waren eigentlich überzeugend. Trotzdem weigerten sich die protestantischen Reichsstände, dies zu tun. Sie hatten dafür religiöse Motive: Mit der Übernahme des Kalenders hätten sie den Papst als pontifex maximus anerkannt. Mit diesem Titel war im alten Rom die Oberhoheit über den Kalender sowie der letzte Entscheid in allen Glaubensfragen verbun den. Und letzteres konnten und wollten die Protestanten dem Papst auf keinen Fall zugestehen. Deshalb verweiger ten sie die Kalenderreform und blieben beim Julianischen Kalender. Eine kuriose Situation!
In der bedeutenden Reichsstadt Augsburg zum Beispiel stellten die Protestanten die Mehrheit der Bevölkerung. Die Lebensmittel der Stadt kamen aber aus dem Umland, das zum strikt katholischen Herzogtum Bayern gehörte. Diese Lebensmittel durften ausschliesslich an den von der Obrig keit festgelegten Markttagen in die Stadt gebracht und gehandelt werden. Entschlossen sich nun die Ratsherren, der Auffassung protestantischer Extremisten zu folgen und

den julianischen Kalender beizubehalten, während im Umland nach dem neuen gregorianischen Kalender gerech net wurde, war das Durcheinander vorprogrammiert: Wie sollten sich die einfachen Bauern mit zwei völlig unter schiedlichen Kalendern zurechtfinden?
Deshalb entschied der Augsburger Stadtrat, den päpstli chen Kalender anzunehmen. Sehr zum Ärger der evangeli schen Geistlichkeit. Die wetterte auf den Kanzeln gegen den Beschluss und löste damit schwere, ja blutige Unruhen aus. Wir müssen uns vorstellen, dass bald an jedem Tisch in den Augsburger Gasthäusern, bei jedem Treffen unter Fremden und Freunden, heftig die Vor- und Nachteile der beiden Kalender diskutiert wurden. Und dies wird nicht nur in Augsburg, sondern im ganzen Reich so gewesen sein, ja, die ganze damals bekannte Welt musste sich mit der päpstlichen Aufforderung auseinandersetzen, den Kalender umzustellen.
Und das bedeutete, dass plötzlich Menschen, die sich noch nie in ihrem Leben mit den Sternen beschäftigt hatten, über die verschiedenen Konjunktionen parlierten. Wer nicht wusste, was das war, konnte nicht mitreden.
Auf welchem Niveau die Bürger im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation damals diskutierten, darüber in formiert uns eine kleine Broschüre, die der Augsburger Druckerei-Besitzer Michael Manger 1582, also im Jahr der Kalenderreform, herausgab. Ihr Verfasser hiess Nikolaus Winkler (1529–1613). Er war seines Zeichens Stadtrat und Astronom der Reichsstadt Schwäbisch-Hall, im 16. Jahrhun dert eines der aktiven Zentren des Luthertums. Der Titel seiner Broschüre lautet in modernes Deutsch gebracht: Erwägungen über die zukünftige Veränderung der weltli chen Ordnung und das Ende der Welt in den Jahren von 1583 bis zu den Jahren 1588 und 1589 anhand der heiligen Schrift, der Schriften der Altvorderen und der Naturgesetze.
Es ist nicht die einzige Schrift, die Winkler zu diesem Thema verfasste. Er hatte sich auf Apokalypsen spezialisiert und war damit nicht der einzige. Apokalyptische Prophe
zeiungen boomten im 16. Jahrhundert und wurden von der protestantischen Geistlichkeit durchaus gefördert. Die Endzeitstimmung verlieh nämlich der Reformation ein Gefühl der Dringlichkeit. Wer mit dem Ende der Welt rech nete, war eher geneigt, überkommene und bequeme Glau bensvorstellungen aufzugeben. Viele Drucker befeuerten diese Bewegung, denn sie war ein gutes Geschäft. Schon damals gaben Menschen Geld aus, um zu lesen, dass es nur noch schlimmer kommen werde.
Für uns ist Winklers Broschüre deshalb so interessant, weil sie zeigt, welches Vorwissen ein populärer Autor bei seiner Zielgruppe, dem Deutsch lesenden, gebildeten Bürgertum voraussetzen konnte. Seine Leser kannten den Begriff der Konjunktion, also der scheinbaren Begegnung zweier Himmelskörper, und wussten, wie die Planeten sowie die wichtigsten Sternzeichen hiessen und mit wel chen Kürzeln sie bezeichnet wurden. Keine Selbstverständ lichkeit! Kurz zuvor war das noch Wissen gewesen, das lediglich in gelehrten Zirkeln existierte.
Spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Tat sache, dass Nikolaus Winkler keinen Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie machte. Für ihn war die Astrolo gie eine naturwissenschaftliche Methode, um das Schicksal von Mensch und Welt vorherzusagen. Auch wenn das im 16. Jahrhundert nicht mehr unumstritten war, gab es viele, die auf die Sterne vertrauten. Noch Kepler beschrieb die
Titelblatt der von Nikolaus Winckler verfassten Bro schüre Bedencken Von Künfftiger verenderung Welt licher Policey vnd Ende der Welt auss heyliger Göttlicher Schrifft vnnd Pat ribus, auch auss dem Lauff der Natur des 83. biss auff das 88. vnd 89. Jars, erschie nen in Augsburg im Jahr 1582.

Winckler erklärt auf dieser Seite seinem Leser die verhängnisvollen Konjunktionen, also welche Plane ten wann zusam men zu sehen sein werden, um so das Schicksal der Menschen zu be einflussen.

Die Weltallschale
Rudolfs II. bezeugt, in welch hohem Masse Astronomie damals Teil der Selbstdarstellung eines Herrschers war. Kunstgewer bemuseum Berlin. Foto: UK.

Astrologie als «das närrische Töchterlein der achtenswerten Mutter Astronomie» und war froh, dass er mit dem Stellen von Horoskopen sein klägliches Einkommen aufbessern konnte.
Halten wir also an dieser Stelle fest, dass die Kalender reform das allgemeine Interesse an der Astronomie enorm förderte.
Nun wissen wir heute, in welch grossem Masse das öffentli che Interesse die Wissenschaft fördert und damit lenkt. Schliesslich müssen auch Wissenschaftler essen, und am liebsten essen sie gut. Das heisst, dass die Wissenschaft dort blüht, wo sie reichlich entlohnt wird. Nun war die Astrono mie seit dem Mittelalter ein universitäres Lehrfach. Sie wurde sowohl an geistlichen als auch an weltlichen Schulen im Rahmen des Lehrbetriebs gepflegt. Die Kirche schätzte gute Astronomen und zeichnete sie als Computisten aus. So fanden also Astronomen seit dem Hochmittelalter ein zufrie denstellendes Auskommen, doch wirklich reich wurden sie erst danach. Und wie reich manche von ihnen wurden!
Denn nach der Kalenderreform wollte jeder gebildete Mann mitreden können, sobald es um Astronomie ging. Man bildete sich dafür entweder selbst weiter oder man hielt sich – wenn man über die Mittel verfügte – einen eige nen Astronomen. Der plauderte an der festlichen Tafel amüsant über astronomische Themen, nachdem die Hof narren ihre Scherze gemacht hatten. Und damit bot sich jedem Mathematiker ein reiches Auskommen an den vielen fürstlichen Höfen, so er willens war, sich auf Astronomie zu spezialisieren. Die bekanntesten Astronomen wurden nämlich mit beeindruckenden Jahresrenten gelockt. Für die Widmung astronomischer Bücher revanchierten sich die so Bedachten mit wertvollen Geschenken. Und selbst im
Die Sternwarte von Uraniborg. Zeitgenössische Darstellung von 1598.

bürgerlichen Haushalt fand der nicht ganz so bekannte Sterngucker im Austausch für sein Wissen zumindest Quartier und Unterhalt.
Kurz: die Kalenderreform schuf einen Markt für astrono misches Wissen. Was vorher eine mathematische Disziplin war, wurde zu einem Luxusprodukt, mit dem sich richtig viel Geld verdienen liess. Und so bestritten immer mehr Wissen schaftler ihren Lebensunterhalt mit der Astronomie, was geradezu zwangsläufig zu einer Beschleunigung der For schung führte: Wer Geld verdienen wollte, musste seine Beobachtungen drucken lassen. Und je mehr Astronomen ihre Himmelsbeobachtungen niederschrieben und als Buch veröffentlichten, umso mehr Zahlenmaterial stand zur Verfügung, um immer genauere Berechnungen der Sternen bahnen anzustellen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann ein kühler Rechner darauf kommen würde, dass nicht nur die Erde um die Sonne kreist, sondern sie dies nicht auf einem Kreis, sondern einer Ellipse tut.
Einen entscheidenden Beitrag zu dieser Erkenntnis leistete ein dänischer Adliger namens Tycho Brahe. Bemerkenswert ist daran schon einmal, dass die Astronomie mittlerweile derart chic war, dass ein Mitglied des höchsten Standes sich dafür entschied, Astronom zu werden, statt in der Verwal
Das Titelbild der 1627 von Johannes Kepler publizierten Rudolfinischen Tafeln, in denen die Stellung der Sterne so exakt wie nie zuvor beschrieben wurde. Man beach te, dass die stabils ten Säulen des Vordergrundes die Namen Kopernikus und Tycho Brahe tragen. An ihnen hängen die astro nomische Messins trumente. Noch Isaac Newton nutz te dieses Buch, um seine Gravitations theorie herzulei ten.

tung oder im Heer Karriere zu machen. Und das obwohl sein Vater über hervorragende Verbindungen zum Königs hof verfügte. So kam es, dass König Friedrich II. von Däne mark und Norwegen ein Vermögen investierte, um zwei grosse Observatorien unter der Leitung von Tycho Brahe zu unterhalten.
Nun war Brahe ein genialer Organisator und die Galli onsfigur des Projekts. Sein Verdienst ist es, die Methoden der Positionsbestimmung von Sternen verfeinert und die Richtlinien vorgegeben zu haben, nach denen die Beobach tungen dokumentiert wurden. Die eigentliche Arbeit aber wurde von Dutzenden schlecht besoldeter Assistenten erledigt, die Nacht für Nacht den Himmel mit dem blossen Auge absuchten, um die sich verändernden Positionen der Sterne festzuhalten. Ihre Erkenntnisse summierten sich zur umfangreichsten Datensammlung, die bis zu diesem Zeit punkt zusammengetragen worden war. Tycho Brahe hielt diese Daten streng geheim. Er wollte sie ausschliesslich für seine eigenen Berechnungen nutzen, nur dumm, dass er selbst alles andere als ein genialer Mathematiker war.
Und damit kommen wir zu Johannes Kepler, seines Zei
Der Mathematiker, der seinen Nutzen aus dieser Entdeckung zog
chens Mathematiker, wie viele seiner Vorgänger. Er war nicht nur Mathematiker, sondern auch Protestant. Seinen Lebensunterhalt verdiente er in der katholischen Steier mark. Das war ein Problem im Zeitalter der Glaubenskriege. Kepler verlor seinen Posten, und da traf es sich gut, dass man am (wesentlich toleranteren) Kaiserhof einen Mathe matiker brauchte. Dorthin war Tycho Brahe nämlich umge zogen, nachdem sein königlicher Förderer gestorben war. Mitgenommen hatte er sein gewaltiges Zahlenmaterial. Um das auszuwerten, brauchte er einen Mathematiker.
Man könnte nicht gerade behaupten, dass Kepler und Brahe sich auf den ersten Blick sympathisch waren, im Gegenteil. Brahe hielt die Zahlen zurück, liess Kepler gerade mal das sehen, was der für seine Rechnungen brauchte. Und der war schon dabei, die Arbeit hinzuschmeissen, als Brahe völlig überraschend starb. Für die Wissenschaft war das ein Glück. Kepler wurde Brahes Nachfolger als kaiserlicher Hofastronom. Er erbte das gesamte Zahlenmaterial. Auf dieser Basis entwickelte er seine berühmten Gesetze, die beschrieben, dass die Planeten die Sonne auf elliptischen Bahnen umkreisen. Kepler wurde zum grossen Unterstützer und Förderer von Galileo Galilei, der, wie er, ein heliozentri sches Bild des Kosmos entwarf, allerdings mit ganz anderen Argumenten.
Um 1600 blühte nämlich ein eigentlich schon seit der Antike bekanntes Handwerk auf: Die Glasproduktion. Die reichen Haushalte prunkten mit schönen, farbigen Gläsern, die mit aufwändig eingeschliffenen Mustern verziert waren. Viel wichtiger für unseren Zweck war aber die gestiegene Nach frage nach geschliffenen Linsen. Wer mit schlechten Augen beim flackernden Schein der Kerze lesen wollte, brauchte eine Brille. Die entwickelten sich zu einem begehrten Lu xusartikel, den die Glasbläser und Linsenschleifer im vene
Johann Kunckel (1630–1703), ein bedeutender Che miker und Glasma cher der Zeit der Aufklärung, über setzte das grundle gende Werk des Antonio Neri (1576–1614) zur Glasmacherei aus dem Italienischen ins Deutsche. Neri dokumentiert, welch hohen Stan dard die veneziani sche Glasherstel lung um 1600 hat te.
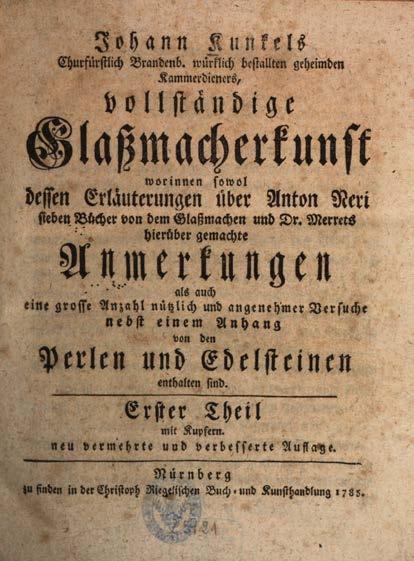
25/Strahlengang durch ein holländisches Fern rohr. cc by 3.0 Unported. LehrerCN.
zianischen Murano und in den Niederlanden herzustellen wussten. In diesen Zentren der Linsenproduktion entstand dann auch die neue Technologie, die die Astronomie revolutionierte.

Für das Jahr 1608 besitzen wir den ersten dokumentari schen Nachweis eines Fernrohrs. Ob es ein Zacharias Jans sen, ein Hans Lipperhey oder ein Jacob Metius erfunden hat, ist umstritten, auf jeden Fall war der Erfinder ein Linsen schleifer und die Herstellung eines solchen Rohrs ein Kin derspiel – für einen Linsenschleifer jedenfalls. Deshalb verbreitete sich das Instrument so schnell in ganz Europa. Und da traf es sich doch hervorragend, dass in Padua ein Mathematikprofessor sein bescheidenes Jahresgehalt mit dem Bau von wissenschaftlichen Instrumenten aufbesserte.
Der Instrumentenbauer, der seinen Nutzen aus dieser Entdeckung zog
Der Mathematikprofessor hiess Galileo Galilei. Er wurde am 15. Februar 1564 als Sohn eines Musikers und Gelegenheits tuchhändlers aus verarmtem Adel geboren. Als Galilei 1609 das erste Fernrohr in Händen hielt, war er nichts als ein mediokrer Dozent, der sein Amt dem Einfluss eines Gön ners verdankte. Doch dank seiner Instrumentenproduktion kannte Galilei die besten Glasbläser und Linsenschleifer von Murano. Sie waren der Konkurrenz überlegen, so dass Galileis Fernrohr es ebenfalls war. Mit diesem Fernrohr sah Galilei klarer und genauer als je ein Mensch vor ihm, was sich am Himmel ereignete.
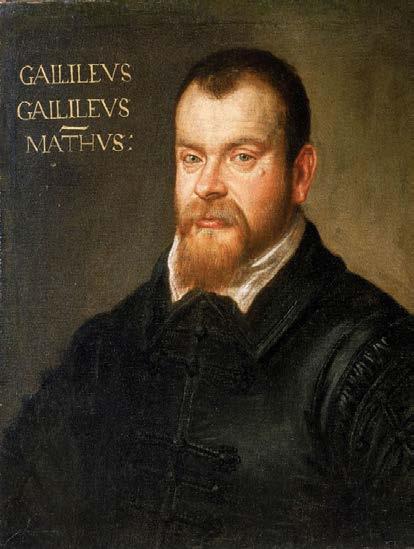
Er gilt als einer der Heroen, ja Märtyrer unserer modernen, wissenschaftlichen Welt, jener Galileo Galilei, dem die Ge schichtsschreibung unterstellt, er habe für die Freiheit der Forschung gekämpft. Tatsächlich war alles viel weniger idealistisch. Galilei ging es in erster Linie um Geld, und zwar um viel Geld, das sich mit seinem Fernrohr und den damit ge machten Entdeckungen generieren liess.
Im März des Jahres 1610 publizierte Galileo Galilei seinen «Sternenboten» in der für die damaligen Verhältnisse relativ grossen Auflage von 550 Exemplaren. In dieser Schrift präsentierte er – übrigens mit Druckerlaubnis der Kirche und Venedigs – die neuen Entdeckungen, die er mit Hilfe seines Fernrohrs gemacht hatte. So erläuterte er, dass es sich bei der Milchstrasse nicht um einen Nebel, sondern um eine Fülle von kleinen Sternen handle. Er beschrieb den Mond mit seiner rauen Oberfläche, seiner hellen und dunklen Seite. Am Vielversprechendsten waren vier kleine Sterne, ganz nahe bei Jupiter. Die Dinger verschwanden und tauch ten wieder auf. Das erklärte Galilei damit, dass ihre Bahn sie zeitweise hinter den Jupiter führte. Das barg wissenschaftli chen Zündstoff: Hatte Galilei recht, war bewiesen, dass
Porträt des Galileo Galilei, gemalt von Domenico Tinto retto.
1612 publizierte
Galileo Galilei seinen Disput über Dinge, die auf dem Wasser schwim men. Er widmete ihn seinem Auf traggeber, dem Herzog von Flo renz. Uns liegt die Neuauflage des Werks von 1655 vor, als die Werke Galileis theoretisch immer noch von der Inquisition verboten waren. Da sich aber dieses Buch nicht mit dem kopernikanischen System befasste, sah die Inquisition keinen Grund ein zuschreiten.

wenigstens vier Planeten nicht um die Erde, sondern einen anderen Planeten kreisten.
Und das bedeutete nicht nur wissenschaftliche Anerken nung, sondern die Chance, einen wirklich potenten Förde rer für die eigene Forschung zu interessieren. Galilei widme te dem jungen Cosimo de’ Medici, Grossherzog der Toskana, seinen Sternenboten. Als Draufgabe nannte er die Monde sidera medicea – Mediceische Gestirne.
Galilei hoffte, sich mit seiner Schrift als Anwärter auf einen Posten am Florentiner Hof zu qualifizieren. Doch dort wartete man erst einmal die Reaktion der anderen Astrono men ab, die mehr als positiv ausfiel. Johannes Kepler, als kaiserlicher Hofastronom eine der anerkannten Kapazitäten, gab seine Laudatio auf den Sternenboten sogar in Druck. Der päpstliche Hofastronom Christopher Clavius nahm die Mediceischen Gestirne in sein Lehrbuch auf. Nicht zu vergessen, die vielen Briefe, in denen selbst die höchsten Monarchen Europas demütig um ein von Galilei gebautes Fernrohr baten.
Europa interessierte sich für Galilei, und damit interes sierte sich auch der Florentiner Hof für ihn. Denn der Patron eines so begehrten Mannes zu sein, verschaffte Cosimo II. Prestige. Und dafür war er bereit, tief in die Tasche zu greifen. Cosimo ernannte Galilei noch im Herbst des Jahres 1610 zum Florentiner Hofmathematiker, Hofphilosophen und zum leitenden Mathematikprofessor der Universität von Pisa, selbstverständlich ohne jede Lehrverpflichtung. Das bedeutete ein üppiges Gehalt, zusätzliche Geschenke sowie alle Vergünstigungen, die ein fürstlicher Hof so zu bieten hatte.
Ein üppiges Gehalt aus der Kasse eines mächtigen Mannes bedeutete gleichzeitig, dass Galilei unter Druck stand, stän dig neue Erkenntnisse zu liefern. Ausserdem goutierte sein
Herr keine steilen Thesen, die den offiziellen Positionen der katholischen Kirche widersprachen. Galileo befand sich also in einem Interessenskonflikt. Er musste spektakuläre Erkenntnisse liefern, ohne an den kirchlichen Dogmen zu rütteln.
Einen Ausweg boten seine Forschungen zu schwimmen den Gegenständen. Jahrhundertelang hatten gelehrte Wissenschaftler in der Nachfolge von Aristoteles behauptet, dass es die Form sei, die Gegenstände auf dem Wasser schwimmen lasse. Gegenstände mit einer grossen Ober fläche wie Blätter oder Eis würden nicht sinken, weil sie die Wasseroberfläche nicht durchdringen könnten. Galilei ging dieses Problem von einer neuen Seite an – und das war wirklich brillant: Er experimentierte. Er legte Gegenstände aufs Wasser und betrachtete, was sank und was nicht sank. Danach formulierte er seine neue Theorie: Es gehe nicht um die Form, sondern allein um das spezifische Gewicht. Eis würde nicht sinken, weil es verdünntes Wasser sei.
Die wissenschaftliche Welt war elektrisiert. Galilei hatte eine Methode vorgeführt, mit der man Aristoteles ad ab surdum führen konnte. Natürlich empörte sich die Front der Aristoteliker, die vehement auf der Meinung ihres Ab gottes beharrten. Aber Galilei tat sich nicht schwer, den konkreten Beweis anzutreten – selbstverständlich in An wesenheit des Herzogs von Florenz und seines gesamten Hofes.
Als der Bologneser Buchdrucker Evangelista Dozza 1655 eine Neuauflage dieses Werks veröffentlichte, waren die Thesen von Galileo Galilei allgemein akzeptiert. Dass Dozzo trotzdem zwei längst widerlegte Streitschriften seiner Kon trahenten dazubinden liess, hatte nur einen Zweck: Galileis Genie durch den Kontrast noch heller erstrahlen zu lassen. Seine experimentellen und mathematischen Überlegungen waren wissenschaftlich um Klassen überzeugender, als die stilistisch geschliffenen, aber methodisch völlig veralte ten Entgegnungen der Aristoteliker.
Titelblatt der Streitschrift des Lodovico delle Colombe gegen Galileis Buch über schwimmende Gegenstände; es handelt sich um eine der beiden gegnerischen Streitschriften, die die Neuauflage des Werks von Galilei 1655 begleiteten.
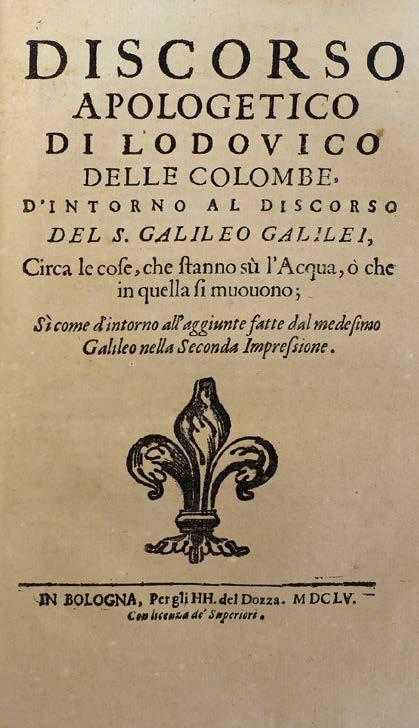
Mit der wissenschaftlichen communis opinio des 17. Jahr hunderts haben diese beiden Beiträge genauso wenig zu tun, wie die immer wieder zitierte Weigerung einiger weniger Gelehrter, durch Galileos Fernrohr zu schauen. Natürlich gab es solche Extremisten, aber ihre Ansicht als die massgebliche Meinung der Kirche zu betrachten, wäre genauso als würden wir heute behaupten, die Auf fassung der Kreationisten, Gott habe die Welt in sieben Tagen geschaffen, sei communis opinio aller jüdischen und christlichen Theologen.
Was die Zeitgenossen im Florenz des beginnenden 17. Jahrhunderts von Lodovico delle Colombe und seinen Anhängern hielten, lässt sich schön an ihrem Spottnamen zeigen. Man nannte sie die Liga der Pippione. Die Bezeichnung spielt mit dem Namen delle Colombe. Sie lehnte sich an piccione (= Taube) an und bot damit die Assoziation zu pippo für einen einfachen, naiven und ziemlich albernen Menschen.
Zu Beginn feierten auch die massgeblichen kirchlichen Astronomen Galileo Galilei und seine Entdeckungen. Das fiel ihnen nicht schwer, denn Galilei hielt sich geradezu vorbildlich zurück, sobald es darum ging, den Wahrheits gehalt der Bibel in Frage zu stellen, indem er ihre Aussagen mit dem heliozentrischen Weltbild konfrontierte. Andere waren da weniger zurückhaltend, so zum Beispiel der italienische Karmelitermönch Paolo Antonio Foscarini. Er versuchte, die Schrift mit den neuen Tatsachen insofern zu versöhnen, als er sich dafür aussprach, dass einige Passagen der Bibel metaphorisch gemeint sein müssten.
Sein Buch erschien 1615. Die Folgen der Reformation waren zu diesem Zeitpunkt auf einem Höhepunkt. Der Kirchenstaat hatte geradezu drastisch an Einfluss verloren,
weil 1517 ein Mönch in Wittenberg seine eigene Auffassung von der Bibel durchsetzen wollte. Wie hätten die kirchlichen Autoritäten dulden können, dass nun in Italien dieselbe Diskussion neu entfacht wurde? Der Papst sah keine andere Möglichkeit, als seine Deutungshoheit über die Heilige Schrift kompromisslos durchzusetzen. Und so machte man Foscarini den Prozess. Sein Buch wurde verdammt; Fos carini in seinen Konvent heimgeschickt. Während seines Prozesses wurde die offizielle Haltung der Kirche fixiert: Abhandlungen auf der Basis des kopernikanischen System waren erlaubt, aber nur solange das System nicht als Tatsa che, sondern lediglich als Hypothese behandelt wurde. Das bot für Forscher einen bequemen Ausweg. Auch Galilei nutzte ihn. 1623 schien wieder Bewegung in die Frage zu kommen. Der für seine wissenschaftlichen Neigungen bekannte Maffeo Barbarini bestieg als Urban VIII. den Papstthron. Er war seit vielen Jahren ein guter Bekannter und Förderer Galileis. Der reiste bereits 1624 nach Rom, um sich der Unterstützung eines so hochgestellten Gönners persönlich zu versichern. Sechsmal gewährte ihm Urban VIII. eine Audienz. Er soll ihn bei dieser Gelegenheit ermutigt haben, sein Buch über das kopernikanische System zu publizieren –selbstverständlich unter der Bedingung im hypothetischen Bereich zu bleiben.
Der inzwischen gut 60-jährige Galilei machte sich ans Werk. Wegen seines unzuverlässigen Gesundheitszustands war das Manuskript erst im Mai 1630 fertig. Sein Titel lautete Dialogo di Galileo Galilei sopra i due Massimi Sistemi del Mondo Tolemaico e Copernicano (= Dialog von Galileo Galilei über die zwei wichtigsten Weltsysteme, das ptole mäische und das kopernikanische). Für den Druck brauchte Galilei eine offizielle Erlaubnis. Urban VIII. unterstützte ihn dabei. Gelesen hatte der Papst das Buch nicht, sonst hätte er gemerkt, dass Galilei nicht beim Hypothetischen geblieben war. Stattdessen argumentierte der, dass Ebbe und Flut
einen Beweis für die Bewegung der Erde darstellen würden (was heute übrigens widerlegt ist). Wie gesagt, Urban VIII. wusste das nicht. Er befahl seinem eigenen Zensor mit Nachdruck, die Druckerlaubnis zu erteilen. Doch im Gegen satz zum Papst hatte der das Buch gelesen. Er äusserte Bedenken. Nun schaltete Galilei auch noch den Grossher zog von Florenz ein. Der Zensor gab klein bei und stellte lediglich die Bedingung, dass zu Beginn und am Ende des Buches klar ausgesprochen würde, dass der Heliozentris mus nur eine Hypothese sei.
Galilei tat das, fand aber dafür – vielleicht im Glauben, Urban VIII. habe sein Buch tatsächlich gelesen und stimme ihm zu – seine eigene Lösung. Sein Buch war nämlich ein literarisches Meisterwerk, geschrieben für das gebildete Bürgertum, und zwar nicht in lateinischer, sondern in italie nischer Sprache, ohne allzu viel Mathematik und Theorie. Stattdessen erfand Galilei ein Gespräch, bei dem der intelli gente Salviati und der ziemlich dumme Simplicius versu chen, einen gebildeten Bürger von ihrem Weltbild zu über zeugen. Natürlich sind die Argumente des Simplicius leicht zu durchschauen. Seine Art der Argumentation machen die kirchliche Position geradezu lächerlich. Und so kann man es nur einen schlechten Scherz nennen, dass Galilei die vom Zensor gewünschten Schlussworte ausgerechnet vom Ignoranten Simplicius sprechen lässt.
Damit beging Galilei eine krasse Fehleinschätzung. Auch ein Papst, der privat vielleicht seine Meinung teilte, konnte es sich nicht leisten, die eigene Position in Frage zu stellen, vor allem weil Urban VIII. im Jahr 1632 unter grossem politi schem Druck stand. Wir müssen hier nicht auf die päpstli che Politik eingehen. Es genügt, an dieser Stelle zu sagen, dass die Position Urbans derart gefährdet war, dass er sich nach Castel Gandolfo zurückzog, wo ihn seine Leibwache besser vor einem Attentat schützen konnte.
In dieser Situation konnte Urban VIII. es sich nicht leisten, ein Buch durchgehen zu lassen, das ihn wie einen
Idioten dastehen liess. Nach etlichen päpstlichen Zornaus brüchen kam es zum Inquisitionsprozess, der weder für die Kirche, noch für Galilei ein Ruhmesblatt ist. Galilei vertei digte den Heliozentrismus nicht. Im Rahmen des zweiten Verhörs argumentierte er sogar, er habe Kopernikus eigent lich widerlegen wollen, habe aber im Übereifer der Gegen seite zu gute Argumente in den Mund gelegt. Nun ja. Am 22. Juni 1633 schwor Galileo Galilei seinen «Irrtümern» ab. «Aufrichtigen Herzens und ungeheuchelten Glaubens» verabscheue er seine Ketzereien, so lesen wir es in den Prozessakten.
Irgendwann erfanden die Anhänger Galileis eine tröst liche Legende: Ihr Heros habe sich nach seinem Schwur erhoben und gemurmelt: «Und sie bewegt sich doch!»

Und warum verehren wir Galilei als einen Heroen der Wissenschaft?
Galilei verbrachte die letzten Jahre seines Lebens im ehren vollen und bequemen Hausarrest. Er starb am 8. Januar 1642 im Alter von 77 Jahren. Der Bann, den die Kirche über sein Werk ausgesprochen hatte, wurde 1718 aufgehoben, als ein Florentiner Drucker mit guten Verbindungen sein Ge samtwerk neu auflegen wollte.
Und damit erhebt sich die Frage, warum sich der reale so sehr vom «gefühlten» Galilei unterscheidet. Warum wurde ausgerechnet dieser Opportunist zum Märtyrer für die Freiheit der Wissenschaft stilisiert?
Tatsächlich ist dieser Galilei eine Erfindung der Histori ker des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert entstand ein neues historisches Konzept: Entwicklung wurde als Resultat eines Kampfes verstanden. Marx entdeckte den Klassen kampf. Französische Historiker behaupteten ernsthaft, mit der französischen Revolution hätte sich das gallorömische Bürgertum gegen die eingewanderten Merowinger durchge setzt. Und wieder andere Historiker deuteten den Fortschritt
Die Gesamtausga be der Werke des Galileo Galilei, die 1718 in Florenz publiziert wurde. Damit dieses Werk in Italien gedruckt werden konnte, hatte der Papst den Bann der Wer ke Galileos aufgehoben. Es fehlen lediglich die Dialo go, die zum Inqui sitionsprozess geführt hatten.
als eine Art Krieg zwischen Wissenschaft und katholischer Kirche. Nun gibt es viele historische Konzepte, die inzwi schen längst überholt sind. Nur zu dumm, dass sich die Deutungen mancher Historiker trotzdem noch im kollekti ven Gedächtnis halten.
Den Grundstein zur Heroisierung von Galilei legte John William Draper im Jahr 1874 mit seinem Buch «History of the Conflict between Religion and Science». Darin konstru ierte er künstlich einen Antagonismus zwischen Kirche und Wissenschaft. Galilei kam darin die Rolle des Kämpfers für die Erkenntnisfreiheit des Menschheit zu. Drapers Buch erlebte innert kürzester Zeit 50 Auflagen und wurde in zehn Fremdsprachen übersetzt. Mindestens genauso erfolgreich wurde Andrew Dickson Whites Kampfschrift von 1896. Sie trägt den Titel «A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom» und widmete viele Seiten dem «War upon Galilei», also dem «Krieg» gegen Galilei.
Die Kampfschrift Whites beeinflusst unser Bild von Galilei auch heute noch, ohne dass irgendeine Tatsache daran etwas zu ändern scheint. Wir zitieren aus diesem Buch in leicht gekürzter und übersetzter Form Whites Ausführungen zum Prozess des Galileo Galilei:
«...Galileo verfasste sorgfältig eine Abhandlung in Form eines Dialogs, in der er die Argumente für und wider das kopernikanische und das ptolemäische System darstellte, und er bot an, sich allen Bedingungen zu unterwerfen, die das Kirchentribunal ihm auferlegen könnte, falls man es ihm erlauben würde, es in Druck ausgehen zu lassen. Zu letzt, nach Verhandlungen, die sich über acht Jahre erstreck ten, stimmten sie zu, unter einer demütigenden Bedingung – ein Vorwort, geschrieben in Übereinstimmung mit den Ideen von Vater Ricciardi, unterzeichnet von Galileo.
Galileos neues Buch – der Dialog – erschien im Jahr 1632 und hatte gewaltigen Erfolg. ... Das rief die Feinde auf den Plan: die Jesuiten, Dominikaner und die grosse Mehr
heit der Kleriker starteten ihren brutalen Gegenangriff und in der Mitte stand Papst Urban VIII. ... Er warf seine gesam te Macht gegen Galileo in die Waagschale. ... Zu Beginn bestand die Strategie der Feinde darin, den Verkauf des Werks zu verbieten; aber das brachte nichts, weil sich die erste Auflage bereits in ganz Europa verbreitet hatte. Urban wurde nun noch ärgerlicher als zuvor, und beide – Galileo und seine Werke – wurden der Inquisition übergeben. ... Dort wurde er, so lange verborgen, aber jetzt vollständig enthüllt, immer und immer wieder mit der Folter bedroht, auf ausdrücklichen Befehl von Papst Urban, und – wie die Protokolle des Verfahrens detailliert schildern, unter Dro hungen gezwungen und auf Befehl des Papstes gefangen gesetzt. ... Die lange Serie von Versuchen, die im Interesse der Kirche unternommen wurden, dieses Geschehen zu verschleiern, ist letztlich gescheitert. Die Welt weiss heute, dass Galileo sicher Entwürdigung, Gefangenschaft und Drohungen schlimmer als Folter ausgesetzt war, und dass er letztlich gezwungen war, öffentlich zu widerrufen.»
Dieses Bild des Astronomen findet sich in vielen Romanen und populärhistorischen Darstellungen. Wahrer wird es dadurch nicht. Wir müssen uns endlich daran gewöhnen, Fiktion und Kunst nicht als realen Spiegel einer Vergangen heit zu begreifen, sondern als meist schlecht recherchierte Machwerke von Menschen, die ihre eigenen Ideale mit Hilfe der Autorität einer historischen Persönlichkeit vertreten sehen möchten.
Wolfgang Heinz als Galileo Galilei in einer Aufführung von Bertold Brechts Theaterstück Das Leben des Galilei, Ekkehard Schall (r.) und Dieter Knaup (l.) stellen Kardinäle dar.
Bundesarchiv, Bild 183 K1005 0020 / Katscherowski (verehel. Stark), / CC BY SA 3.0
 5 Das Phänomen Galileo Galilei
5 Das Phänomen Galileo Galilei
Am 22. Juni 1633 endete der Prozess gegen Galileo Galilei. Nur eine Generation später soll Newton in seinem «annus mirabilis» die Regeln der Gravitation entdeckt haben, die Keplers und Galileis heliozentrisches Weltbild als communis opinio der wissen schaftlichen Welt bestätigten. Deshalb gilt Newton als ein Heros der Wissenschaft. Zu Recht?
Am 28. November 1660 gab eine illustre Gesellschaft von Erfindern, Wissenschaftlern und Naturphilosophen in London bekannt, dass sie sich in Zukunft wöchentlich versammeln werde, um gemeinsam Experimente durchzu führen und wissenschaftliche Vorträge zu hören. Der engli sche König Charles II., der erst wenige Monate zuvor aus dem Exil zurückgekehrt war, erlaubte ihr, das Attribut könig lich zu benutzen. Die Royal Society war geboren. Sie wurde zu einem Motor des wissenschaftlichen Fortschritts. Durch den regelmässigen Kontakt, den die Royal Society ermög lichte, inspirierten sich die führenden Geister Grossbritan niens gegenseitig. Gleichzeitig sorgte der Sekretär der Ge sellschaft dafür, dass ihre Mitglieder stets auf dem neuesten Stand der ausländischen Forschung blieben. Vor allem
der ständige Austausch auf informeller Ebene beschleunigte die Wissenserweiterung enorm. Dauerte es früher mitunter Jahre, bis ein Wissenschaftler seine Ideen, Experimente, Beobachtungen und Ergebnisse zu einem Buch zusammen fasste und so die Forschung einen Schritt weiter brachte, diskutierten die Mitglieder der Royal Society bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt die gewonnenen Erkenntnisse. Damit dachte nicht nur der Mann über eine gute Idee nach, der sie ursprünglich gehabt hatte, sondern viele Männer – keine Frauen; sie wurden erst 1945 als Mitglieder der Royal Society zugelassen.
Die neue Vorgehensweise brachte einen unangeneh men Nebeneffekt: Hatte früher der Publikationstermin eines Buchs eindeutig festgelegt, wer der Urheber einer neuen Entdeckung war, verschwamm mit der Royal Society diese Genauigkeit. Wem sollte die Urheberschaft an einer Entde ckung zugeschrieben werden: Dem, der eine Idee erstmals geäussert hatte, oder dem, der den Beweis der These lieferte? Immer wieder kam es zu Plagiatsvorwürfen. In den Griff bekam die Royal Society dieses Problem nie. Kein Wunder, ihr Vorgehen beruhte ja auf der wissenschaftlichen Schwarmintelligenz ihrer Mitglieder. Und da war es unmöglich aus zumachen, wer den entscheidenden Beitrag zu einer Entdeckung geleistet hatte.

Eine Sammlung von Lichtmühlen, entwickelt von William Crooke, aus der Sammlung der Royal Society. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass auch im 19. Jahr hundert das wis senschaftliche Experiment von der Royal Society gepflegt wurde. Foto: cc by 4.0 / The wub / Wiki commons.

Dumm nur, dass zwei Dinge sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht geändert hatten: Den grössten finanziellen Gewinn machte immer noch derjenige, der als Urheber einer Theo rie gefeiert wurde. Und auch die Geschichtsschreibung tut sich bis heute mit Gruppenleistungen schwer. Deshalb feiern wir ausschliesslich Isaac Newton als genialen Erfinder des Gravitationsgesetzes und wissen nichts über sein wissenschaftliches Umfeld. Dabei arbeitete auch Newton nicht im luftleeren Raum, obwohl er selbst oft betonte, alle seine Entdeckungen in der ländlichen Einsam keit des Jahres 1666/7 gemacht zu haben. Das stimmt so sicher nicht. Deshalb werfen wir in diesem Kapitel auch einen Blick auf die Männer, mit denen sich Newton um die Urheberschaft seiner Ideen stritt.
Einer von hiess Robert Hooke (1635-1703) und stammte aus einer Familie von Priestern. Als sein Vater im Jahr 1648 starb, sorgten dessen Amtskollegen dafür, dass der begabte, aber mittellose Junge eine hervorragende Ausbildung erhielt.
Hooke zeigte eine Begabung für die Naturwissenschaften und entwickelte ein einzigartiges Talent dafür, auf Grund von Ideen und Plänen andere funktionierende Apparate zu bauen. Viele wohlhabende Privatgelehrte schätzten (und bezahlten) Hookes Unterstützung. Der wichtigste war Robert Boyle, das 14. Kind des Great Earl of Cork. Für ihn realisierte Hooke im Jahr 1659 eine Vakuumpumpe nach deutschem Vorbild.
Nun war Boyle eines der zwölf Gründungsmitglieder der Royal Society. Er führte Hooke als seinen Assistenten in die
Gesellschaft ein. Auch die wusste Hookes Talente zu schät zen und ernannte ihn im Jahr 1662 einstimmig zu ihrem (bezahlten) «Curator of Experiments». 1663 nahm sie ihn gar als (nicht zahlendes) Mitglied auf. Hooke war finanziell völlig auf die Unterstützung seiner Förderer angewiesen. Die verschafften ihm genügend Posten, damit er sich seinen Forschungen ohne wirtschaft liche Sorgen widmen konnte. Doch das bedeutete, dass Robert Hooke ständig unter Druck stand, Aussergewöhnli ches liefern zu müssen. Tatsächlich trug er enorm zu unserem modernen Weltbild bei. Wir nennen an dieser Stelle nur sein Auflichtmikroskop, mit dem er der Menschheit den Mikrokosmos erschloss. Das von Hooke geprägte Wort «cell – Zelle» gehört heute zum Allgemeinwissen.
Wie alle Wissenschaftler seiner Zeit beschäftigte sich Hooke mit den unterschiedlichsten Themen, und dazu gehörte auch die Astronomie. So konstruierte er ein verbes sertes Fernrohr, mit dem er erstmals nachwies, dass sich Jupiter und Mars um ihre eigene Achse drehten. Doch gerade in diesem Forschungsbereich erwuchs dem brillan ten Kopf ein Konkurrent um die Gunst der reichen Förderer: der um sieben Jahre jüngere Isaac Newton.
Newton: Ein Genie vom Lande Isaac Newton wurde am 25. Dezember 1642 als Sohn eines Schafzüchters geboren. Der Vater starb noch vor seiner
Der junge Newton führt einer interes sierten Öffentlich keit seine Experi mente mit dem Licht vor. Durch ein Prisma wird das farblose Licht in die Spektralfar ben aufgespalten. Wie viele Bilder Newtons entstand auch dieses lange nach seiner Kanonisierung als britischer Held der Wissenschaft. cc by 4.0; https:// wellcomecollecti on.org/works/ dfggz9ra

Geburt; durch die Heirat mit einem wohlhabenden Gutsbe sitzer gelang der Mutter ein gesellschaftlicher Aufstieg, der es ihrem Sohn Isaac ermöglichte, am Trinity College in Cambridge zu studieren. Doch die kompletten Studienge bühren konnte sich die Familie nicht leisten. Deshalb war der junge Newton in den ersten Jahren gezwungen, als Kammerdiener für Studenten aus wohlhabenden Familien zu arbeiten. Ob es das war, was zu Newtons Verbitterung führte, die ihn trotz all seiner Erfolge zu einem recht uner quicklichen Zeitgenossen machte?
Nach Abschluss des Bachelors im Jahr 1665 kehrte New ton auf das väterliche Landgut zurück. Nicht freiwillig. Die Universität von Cambridge stellte wegen der grossen Pest ihren Betrieb ein. Diese Zeit auf dem Lande verklärte New ton später als sein annus mirabilis , sein Jahr der Wunder. Er behauptete, in diesem Jahr seine drei grossen Entdeckun gen gemacht zu haben: seine Theorie des Lichts, die Infini tesimalrechnung und das Gravitationsgesetz.
Zumindest für das Gravitationsgesetz wissen wir, dass Newton es nicht in diesem wunderbaren Jahr bewies, son dern erst viel später. Und es war sicher nicht der vom Baum fallende Apfel, der ihn auf die Idee brachte, sondern gezielte Forschung. Denn die ganze Royal Society diskutierte damals darüber, wie sich Keplers aus Beobachtungen abgeleitetes drittes Planetengesetz mathematisch-physikalisch würde begründen lassen.
Sie erinnern sich: Kepler berechnete auf der Basis des Zahlenwerks von Tycho Brahe die Planetenbahnen. Er postulierte, dass es sich bei diesen Bahnen nicht um Kreise, sondern um Ellipsen handle und dass die Planeten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf diesen Bahnen bewegten. Mathematisch formuliert heisst das:
Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der grossen Halbachsen ihrer Bahnen.
Nicht dass Sie das verstehen oder sich gar merken müssten. Wichtig ist nur, dass Kepler mit diesem Gesetz beschrieb, was er anhand der vorgegebenen Zahlen berechnet hatte. Die Mitglieder der Royal Society stellten sich nun aber die Frage, wie die Kraft beschaffen sein musste, die dieses Ergebnis erzielte. Und hier kommt Edmond Halley ins Spiel. Wir kennen ihn heute als Namensgeber des Halleyschen Kometen. Seine Zeitgenossen schätzten ihn als wohlhaben den Gentleman, der seine Zeit astronomischen Studien widmete und – natürlich – ein Mitglied der Royal Society war. Selbstverständlich ein zahlendes. Schliesslich war sein Vater ein reicher Londoner Seifensieder. Damit hatte es Halley nicht nötig, um Ämter und Pfründen zu konkurrieren. Er förderte stattdessen seine weniger glücklichen Kollegen, sofern sie gute Ideen hatten.
Und dieser Edmond Halley interessierte sich nun dafür, welche Kraft die Sterne auf ihren Bahnen hielt. Was dann genau geschah? Nun, das werden wir wohl nie mit letzter Sicherheit wissen, denn alle Beteiligten erzählten die Ge schichte etwas anders. Eine mögliche Version wäre Folgen de: Im Januar 1684 sass Edmond Halley mit Robert Hooke und Christopher Wren (ja, genau, dem grossen Architekten) in einem Kaffeehaus und diskutierte mal wieder die Frage nach dem Beweis für Keplers drittes Gesetz. Robert Hooke soll sich damit gebrüstet haben, dass er diesen Beweis bereits zu Hause liegen habe. Doch als Halley ihn darauf festnagelte, musste Hooke nach einigen Monaten eingeste hen, dass er den Beweis einfach nicht mehr finden könne, und dass es ihm auch nicht gelang, ihn zu rekonstruieren. Daraufhin wandte sich Halley im August desselben Jahres an Isaac Newton, damals ein arrivierter, aber sicher nicht wohlhabender Wissenschaftler an der Universität von
Cambridge, der seit 1672 ebenfalls der Royal Society an gehörte.
Newton hielt seit 1669 den Lehrstuhl für Mathematik am Trinity College. Für ihn hatte man im April 1675 sogar die Sondergenehmigung erlassen, dass er sein Amt bekleiden dürfe, ohne sich zum Priester weihen zu lassen. Für Newton war das von entscheidender Bedeutung, denn seine finanzi elle Situation war alles andere als rosig. Zeitweise war seine Geldnot so gross, dass ihn die Royal Society von den Mit gliedsbeiträgen entband.
Und dieser relativ unbekannte Mathematikprofessor schilderte Halley im November 1684 brieflich, wie die Kraft beschaffen sein dürfte, die alle Planeten auf ihrer Bahn um die Sonne festhalte. Es handle sich um dieselbe Kraft, die auf der Erde Gegenstände auf den Boden fallen lasse.
Halley fuhr sofort nach Cambridge. Im persönlichen Gespräch überzeugte ihn Newton von der Richtigkeit seiner Theorie. Am 10. Dezember 1684 schrieb Halley an den Sekretär der Royal Society, um ihn darüber in Kenntnis zu setzen, dass Isaac Newton das Problem gelöst habe. Im Februar 1685 lag der Royal Society ein 24 Seiten umfassen der Aufsatz aus der Feder Newtons vor, der seine Thesen zusammenfasste. Der Titel des Traktats lautete De motu corporum , übersetzt: Über die Bewegung der Körper .
Damit galt Newton als Urheber der Gravitationsgesetze. Er formulierte sie weiter aus und legte mit ihrer ausführli chen Publikation im Jahr 1687 die Grundlagen der moder nen Physik. Sein epochales Werk nannte er Philosophiae naturalis principia mathematica , übersetzt: Die mathe matischen Grundlagen der Naturphilosophie. In die Wis senschaftsgeschichte ist dieses Werk als die «Principia» eingegangen. Den Druck bezahlte übrigens Edmond Halley, weil Newton sich das nicht leisten konnte und der Fond der Royal Society zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschöpft war.
Noch während Newton in Zusammenarbeit mit Halley den Druck vorbereitete, informierte ihn dieser, dass Robert Hooke erwarte, dass sein Anteil an den Entdeckungen gebühren gewürdigt werde.
Tatsächlich verdankte Newton seinem Kollegen einen entscheidenden Hinweis. Wir wissen, dass Hooke Newton brieflich auf die Idee brachte, dass die Anziehungskraft zwischen zwei Planeten nicht konstant sei, sondern mit der Entfernung abnehme. Diesen Denkanstoss sah Hooke im Vorwort Newtons zu den Principia nicht angemessen be rücksichtigt. Newton reagierte schroff. Er teilte Halley mit, dass er Hooke diese Ehre nicht zollen werde und strich alle Hinweise auf ihn aus seinem Text.
Robert Hooke ging damit an die wissenschaftliche Öf fentlichkeit. Doch die folgte Newtons Argumentation, dass nicht derjenige eine Entdeckung für sich in Anspruch neh men könne, der sie intuitiv als erster formuliert, sondern derjenige, der sie allgemeingültig bewiesen habe.
Heute, in einem Zeitalter, in dem die Geschichte aus dem Blickwinkel der Verlierer neu geschrieben wird, haben Robert Hookes Ansprüche viele Verteidiger gefunden. Nur so kann man es sich erklären, dass man derzeit Newton gerne unterstellt, er habe als Präsident der Royal Society das Porträt Robert Hookes aus ihren Räumlichkeiten entfernt –und zwar aus blankem Neid. Diese Behauptung hält sich, obwohl es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt ein Porträt gegeben hat (und falls doch, hing es sicher nicht in den Räumen der Royal Society).
Die Principia,
derart grossen Bedeutung waren Warum aber legte Hooke so grossen Wert darauf, ausgerech net in diesem Werk angemessen gewürdigt zu werden?
Das Titelblatt der 1687 erstmals pub lizierten Philoso phiae naturalis principia mathe matica. Die für den Druck notwendige Erlaubnis gab ein heute sehr bekann ter Tagebuch schreiber: Samuel Pepys. Auch die Royal Society wird auf dem Titel als Societatis Regiae erwähnt.

und warum sie von einer
Schliesslich hatte er selbst derart viele bedeutende Entde ckungen gemacht, dass wir uns nicht vorstellen können, dass er auf eine mehr oder weniger angewiesen war. Nun, die Principia besassen eine andere Qualität, das verstanden ihre Zeitgenossen sofort. Die Principia waren nicht einfach ein weiteres wissenschaftliches Werk, sondern veränderten den menschlichen Blick auf das Verhältnis zwischen Erde und Weltall grundlegend. Newton verband nämlich durch sein Gravitationsgesetz erstmals Erde und Kosmos derart, dass es zwischen beiden Sphären keinen Unterschied mehr gab. Sein revolutionäres Gesetz wird heute in folgende Worte gefasst:
Die zwischen zwei Körpern wirkende Gravitationskraft entspricht dem Produkt der Masse dieser beiden Körper geteilt durch den Abstand ihrer Massenmittelpunkte multipliziert mit der Gravitationskonstante.
Mit anderen Worten: der Apfel, der vom Baum fällt, wird vom Erdmittelpunkt angezogen, und dies geschieht auf Grund der gleichen Gesetzmässigkeiten, die den kleineren Mond auf seiner Bahn um die Erde halten resp. die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne.
Newton formulierte noch viele andere Ideen in den Principia, mit denen wir uns an dieser Stelle nicht beschäfti gen müssen. Wir wollen uns vielmehr ansehen, was seine Zeitgenossen aus dieser einen Kernaussage seines Buches machten.
Erinnern wir uns daran, dass Newtons Principia in einer Epoche publiziert wurden, in der sich die so genannte Aufklärung formierte. Der 30-jährige Krieg hatte allen den kenden Menschen vor Augen geführt, welch schrecklichen Folgen es haben konnte, wenn Fürsten die Religion vorscho ben, um ihre eigenen Machtansprüche zu bemänteln. Gleichzeitig war der Einfluss der katholischen Kirche zu rückgegangen, weil die Herrscher im Zeichen des Absolutis mus keine zweite Autorität in ihrem eigenen Staat dulden
mochten. Und damit war zumindest in den Augen einer kleinen intellektuellen Elite der Weg frei zu einer völlig neuen Form der Religion, einer Religion, in der nicht mehr Autoritäten die Glaubensinhalte vorschrieben, sondern der gesunde Menschenverstand.
Newtons Entdeckungen passten dazu: Nein, Gott war nicht der bärtige Greis, der in sieben Tagen den Kosmos und die Welt geschaffen hatte. Nein, Gott war nicht willens, seine eigenen Naturgesetze zu brechen. Und Gott war vor allem nicht der kleinliche Moralapostel, als den ihn manche seiner Vertreter erscheinen liessen. Gott wurde zum grossen Uhrmacher, der aus Liebe zum Menschen seine wunder bare Welt gebaut hatte, die wie ein Automat nach den immer gleichen Regeln funktionierte. Man musste diese Regeln nur verstehen, und genau das hatte Newton mit seinem Gravita tionsgesetz getan.
Deismus nannte man das neue Konzept. Die meisten grossen Wissenschaftler und Philosophen des 18. Jahr hunderts empfanden sich als Deisten. Sie glaubten an einen Gott, dessen Wirken auf der Erde ausschliesslich durch seine Naturgesetze erfahrbar war. Ein Deist war kein Atheist, die Schöpfung für ihn kein Zufall. Nicht einmal der grosse Kirchenkritiker Voltaire, der in seinem Candide so wortge waltig die These von der besten aller Welten widerlegt hatte, wollte ohne einen Gott auskommen.
Aber natürlich erkannte er, welch grosse Bedeutung das Werk Newtons für sein – das deistische – Weltbild hatte. Ob ihn seine damalige Geliebte, die Mathematikerin Émilie du Châtelet, auf Newton aufmerksam machte? Immerhin wissen wir, dass – obwohl Voltaire als alleiniger Autor der Elements de la philosophie de Newton verantwortlich zeich nete – die mathematischen Passagen aus der Feder von Émilie du Châtelet stammen. Das 1738 bei Jacques Desbor des in Amsterdam erschienene Werk popularisierte die Leistungen Newtons auf dem Kontinent und trug dazu bei, das Andenken an den Heros der Wissenschaft zu verklären.
Titelkupfer zu Voltaires Elements de la philosophie de Newton von 1738.

Die deutschspra chige Welt entwi ckelte eine eher kritische Sicht auf diese Überhöhung Newtons. Hier ein Bilderbogen des 19. Jahrhunderts. Wellcome Collecti on. Public Domain Mark.
Dies illustriert der Titelkupfer, den wir an dieser Stelle etwas genauer betrachten wollen. Newton ist darauf nicht als Mensch dargestellt, sondern entrückt in himmlische Sphären. Er trägt ein antikisches Gewand und ist so auf den ersten Blick nicht von einem Heiligen oder gar Jesus zu unterscheiden. Erst wer ihn genauer betrachtet, erkennt den Zirkel, mit dem Newton den Erdball vermisst. Die Darstel lung wird beherrscht von einem hell leuchtenden Lichts trahl, der über Newtons Kopf durch die Wolkendecke bricht, um durch den Spiegel der Klugheit auf den an seinem Pult sitzenden Voltaire weitergeleitet zu werden.

Seine Anhänger machten aus dem durchaus menschlichen Newton ein Genie, ein göttliches Wesen, dem man nur mit
Titelblatt von Henry Pembertons Erläuterungen zu Werk und Persön lichkeit Newtons mit dem Titel A View of Sir Isaac Newton’s Philoso phy, erschienen in Dublin im Jahr 1728.

höchster Verehrung begegnen durfte. Und auch im realen Leben hatten sich für ihn seine Entdeckungen gelohnt! 1696 ernannte man Newton zum Wardein der königlichen Münz stätte, ein Amt, das traditionell mit hohen Bezügen und geringem Arbeitsaufwand verbunden war. Es machte seinen Amtsinhaber reich. 1703 wurde Newton zum Präsidenten der Royal Society gewählt; 1705 adelte ihn der König. Sir Isaac Newton starb am 28. März 1727. Seine Beerdigung wurde zu einem Ereignis von europäischer Bedeutung. Er war der erste Wissenschaftler, der in der Westminster Abbey begraben wurde. Newton ruht an einem der prominente sten Plätze der wichtigsten Kirche des königlichen Gross britanniens, links vom Volksaltar im Kirchenschiff.
Als sein deutscher Konkurrent Gottfried Wilhelm Leibniz zu Grabe getragen wurde, war dagegen nur ein einziger Mann von Stand anwesend, und das Grab geriet schnell in Verges senheit. Grund dafür war der Reputationsschaden, den Newton willentlich dem etwas jüngeren Kollegen zufügte,
um sich selbst die Urheberschaft an der Infinitesimalrech nung zu sichern und vielleicht um zu verhindern, dass Leibniz nach London kam und so Newtons überragende Position im Wissenschaftsleben gefährdete.
Leibniz hatte nämlich die Infinitesimalrechnung – eine damals revolutionäre Form der Mathematik – entwickelt, und zwar unabhängig von Newton. Dabei fand er eine elegantere Form der Notierung, die von Mathematikern wesentlich lieber angewandt wurde, als die kompliziertere Notierung Newtons. Dazu war Leibniz’ Werk bereits 1684 erschienen, und damit mehr als zehn Jahre vor Newtons.
Trotzdem pochte Newton darauf, dass er der Urheber der Infinitesimalrechnung sei. Seine engsten Freunde bezichtig ten Leibniz, er habe bei einem Besuch der Royal Society im Jahr 1676 Newtons Notizen kopiert und so dessen Ideen gestohlen. Newton unterstützte diese Behauptung mit der gesamten Autorität, über die er als Präsident der Royal Society verfügte. Er berief eine offizielle Kommission, in der ausschliesslich seine Parteigänger sassen. Sie kamen 1712 zum gewünschten Ergebnis: Leibniz hatte seine Infinitesi malrechnung bei Newton abgeschrieben. So stand es im Abschlussbericht, den Newton zum grössten Teil selbst verfasst, und der im Namen der Kommission veröffentlicht wurde. Um seine Sicht der Dinge in der Gelehrtenwelt durchzusetzen, liess Newton den Abschlussbericht drucken und allen bekannten Wissenschaftlern Europas zustellen. Auch wenn viele von ihnen sich entsetzt über die rück sichtslose Vorgehensweise Newtons zeigten und Leibniz unterstützten, war dessen Reputation nachhaltig beschädigt. Sein Dienstherr, Georg Ludwig von Braunschweig-Lüne burg, der durch die (1712 übrigens bereits vorhersehbaren) Zufälle der Erbfolge im Jahr 1714 König von Grossbritannien wurde, entschloss sich, ausgerechnet Leibniz nicht nach Grossbritannien mitzunehmen, obwohl er fast seinen ge samten Hannoveraner Hofstaat nach London mitbrachte. Wahrscheinlich hatte das Leibniz Newton zu verdanken.
Auf diesen Seiten schildert Pember ton den Zeitpunkt, als Newton zur Gravitationstheo rie inspiriert wur de, und zwar lange, bevor er Hooke überhaupt kannte.
Übrigens, endgültig geklärt wurde der Prioritätenstreit erst im Jahr 1949, als es einem deutschen Mathematiker gelang nachzuweisen, dass beide Gelehrten unabhängig voneinan der die Infinitesimalrechnung erfunden hatten.
Newton war alles andere als ein liebenswerter Mensch. Moderne Wissenschaftler haben ihm gar Autismus vor geworfen. Und bereits seine Verehrer sahen sich genötigt, vor dem Hintergrund des in ganz Europa schwelenden Prioritätenstreits die Einzigartigkeit von Newtons Genie immer wieder herauszustellen. Nur so konnte man ent schuldigen, was man bei einem Durchschnittsmenschen für Bösartigkeit, Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit ge halten hätte.
Nun waren Newtons Principia so kompliziert, dass ein normaler, gebildeter Leser sie schlicht nicht verstand. Deshalb entwickelte sich eine viel gelesene Literatur von Newton-Interpretationen, die nicht nur seine Thesen für ein breiteres Publikum aufbereiteten, sondern diesem auch erklärten, welch überragendes, einzigartiges Genie Newton gewesen sei.
Ein gutes Beispiel ist Henry Pemberton, dessen Werk das MoneyMuseum kürzlich erwarb. Dass das MoneyMuseum keine Ausgabe der Principia besitzt, hat natürlich einen praktischen Grund: Newtons Principia erschienen bei ihrer lateinischen Erstausgabe in lediglich 80 Exemplaren; von der englischen Übersetzung wurden nur 400 Stück gedruckt. Beide sind für das MoneyMuseum nicht erschwinglich. So wurde eine lateinische Erstausgabe im Jahr 2016 bei Chris tie’s für 3,7 Mio. US Dollar verkauft.
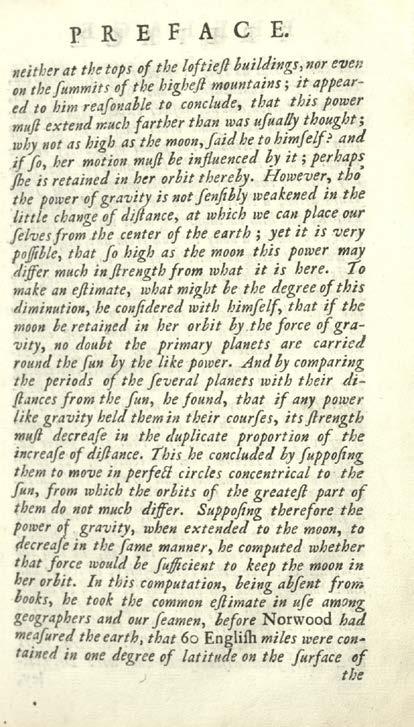
Es geht dem MoneyMuseum wie den meisten Bildungs bürgern zur Zeit der Aufklärung. Sie besassen nicht die Originalwerke von Newton, sondern die Interpretationen seiner Verehrer, Bücher wie das von Henry Pemberton mit
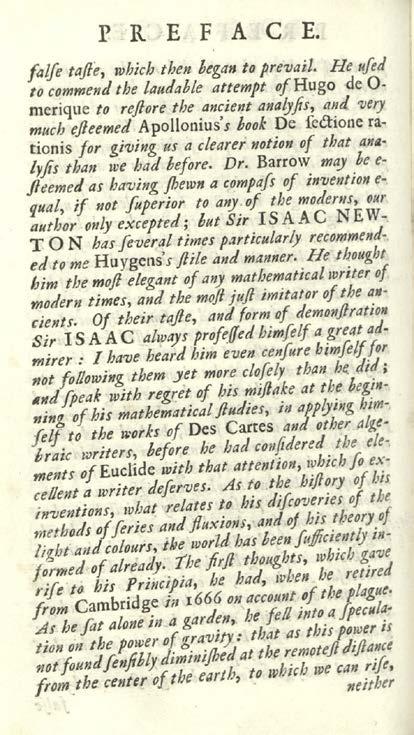
dem Titel A View of Sir Isaac Newton’s Philosophy .
Henry Pemberton kannte Newton noch persönlich. Er war ihm erstmals aufgefallen, weil er sich im Prioritäten streit kompromisslos auf seine Seite gestellt hatte. Newton nahm ihn in seinen engeren Kreis von Bekannten auf und betraute ihn mit der dritten Auflage der Principia, die 1726 erschien.
Nach Newtons Tod gab Henry Pemberton mit A View of Sir Isaac Newton’s Philosophy im Jahr 1728 seine Erklärung der wichtigsten Erkenntnisse von Newton heraus. Darin enthalten waren viele persönliche Reminiszenzen an das Genie. So behauptete Pemberton, Newton habe nur wenige Bücher anderer Mathematiker gelesen, was heute wohl niemand mehr für glaubhaft halten kann. Schon Pemberton verlegte die Inspiration Newtons zum Gravitationsgesetz in die ländliche Idylle des Jahres 1666/7. Damit schloss er jeglichen Einfluss aus, den ein Robert Hooke oder ein Gottfried Leibniz vielleicht gehabt haben mochten. Bei Pemberton sitzt der einsame Newton müssig im Garten. Von einem Apfel ist noch nicht die Rede. Das kam erst später, vielleicht durch Newtons Biographie, die William Stukeley 1752 veröffentlichte. Stukley erzählt: «Nach dem Abendessen, das Wetter war warm, gingen wir in den Garten und tranken Tee im Schatten einiger Apfel bäume, nur er [Newton] und ich. Mitten in einem anderen
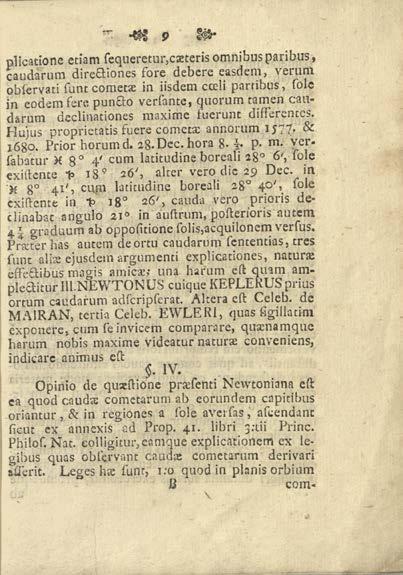
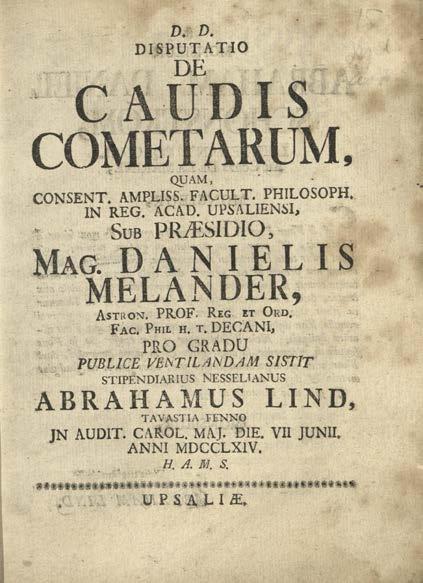
Das Titelblatt der Dissertation des Studenten Abra ham Lind über den Schwanz der Ko meten mit dem Titel Disputatio de caudis cometarum, sie wurde 1764 in Uppsala veröffent licht; der Doktor vater des erfolgrei chen Studenten war der schwedi sche Astronom Daniel Melanderh jelm. Seite 9 der insge samt 19 Seiten umfassenden Dis sertation: Student Lind zitiert die Forschungen von Newton und Kep ler, genauso souve rän wie die Überle gungen des franzö sischen Astronomen Jean Jacques d’Ortous de Mairan oder des russisch schweize rischen Mathema tikers Johann Alb recht Euler. James Ferguson, Astronomy exp lained upon Sir Isaac Newton’s Principles and made easy to those who have not stu died Mathematics. London 1756.
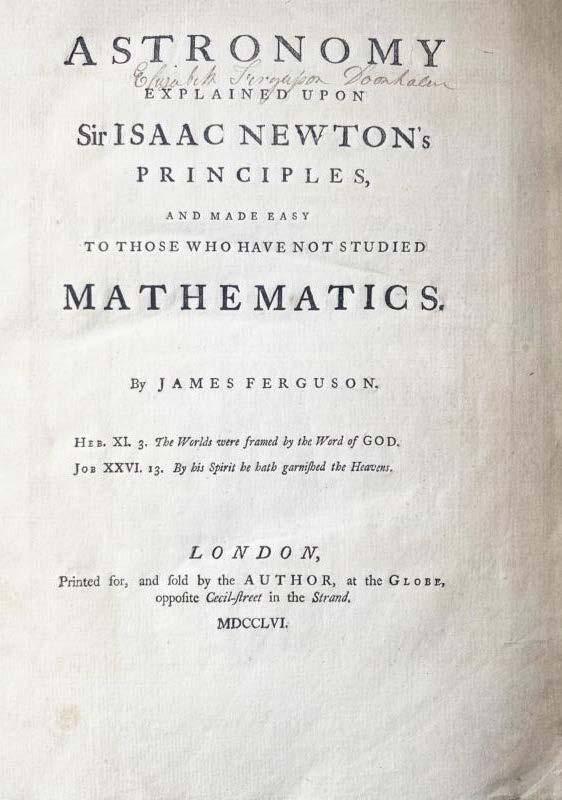
Fergusons mecha nisches Modell des Weltalls aus James Ferguson, Astro nomy explained upon Sir Isaac Newton’s Princip les and made easy to those who have not studied Mathe matics. London 1756.

Diskurs, sagte er mir, habe er sich gerade in der gleichen Situation befunden, als ihm die Idee der Gravitation in den Sinn kam. «Warum sollte dieser Apfel immer senkrecht zu Boden fallen», dachte er bei sich selbst: Anlass war der Fall eines Apfels, als er in nachdenklicher Stimmung war: «War um sollte er nicht seitwärts oder aufwärts gehen, sondern beständig zum Erdzentrum? Sicher, der Grund ist, dass die Erde ihn anzieht, es muss eine Anziehungskraft der Materie geben, und die Summe der Anziehungskraft der Materie der Erde muss im Erdzentrum liegen, nicht an irgendeiner Seite. Deshalb fällt dieser Apfel senkrecht oder gegen das Zentrum, wenn Materie Materie anzieht, muss sie proporti onal zu ihrer Quantität sein, darum zieht der Apfel die Erde und die Erde den Apfel an.»
Übrigens, nicht alle Wissenschaftler teilten Pembertons Auffassung, Newton sei ein Genie gewesen. Zu ihnen gehörte der Franzose Bernard le Bovier de Fontenelle. Er war ein beliebter Schriftsteller der Aufklärung und gehörte seit 1733 der Royal Society an. Fontenelle verehrte Descartes, dessen
Ansichten von denen Newtons abwichen. Von seiner Kritik zeugt ein Brief, der in Pembertons View of Sir Isaac Newton’s Philosophy angebunden ist. Vielleicht stand auch der Eigen tümer dieses Buchs Newton kritisch gegenüber.
Das heliozentrische Weltbild als wissenschaftlicher
Wie man es dreht und wendet, mit Newtons Principia galt das heliozentrische Weltbild als anerkannte Meinung der gesamten wissenschaftlichen Welt. Kein ernstzunehmender Forscher hätte es seitdem gewagt, Zweifel daran zu formu lieren. Die katholische Kirche, die offiziell noch bis 1822 daran festhielt, ihre Druckgenehmigung nur dann zu ertei len, wenn das heliozentrische Weltbild als Hypothese be handelt wurde, spielte in einer säkularisierten Welt keine Rolle mehr.
Wie schnell sich Newtons Erkenntnisse in Europa ver breiteten, illustriert eine Dissertation aus dem Jahr 1764, die ein nicht weiter bekannter Student namens Abraham Lind an der schwedischen Universität von Uppsala einreichte. Sein Doktorvater Daniel Melander(hjelm) war ein begeis terter Verfechter der Theorien Newtons.

Auch die breite Öffentlichkeit akzeptierte diese neue Wirklichkeit, weil sich viele darum bemühten, ihr den neues ten Stand der Forschung auf leicht fassbare Art und Weise nahe zu bringen. Einer der bekanntesten frühen Populärwis senschaftler war James Ferguson (1710–1776), dessen Buch Astronomy explained upon Sir Isaac Newton’s Principles and made easy to those who have not studied Mathematics das MoneyMuseum im Februar 2022 ankaufen konnte.
James Ferguson stammte aus noch wesentlich beschei deneren Verhältnissen als Newton. Er hatte in seiner Kind heit tatsächlich Schafe gehütet. Seine schulische Bildung beschränkte sich auf drei Monate in der Dorfschule von Keith. Wahrscheinlich war es Ferguson deshalb so ein
Brief des kriti schen Franzosen Bernard le Bovier de Fontenelle, der dem Exemplar des MoneyMuseums von Pembertons Werk vorgebunden ist.
wichtiges Anliegen, die Verbindung zwischen der hehren Wissenschaft und dem Mann auf der Strasse herzustellen. Ferguson hatte das Glück, dass ihm sein mechanisches Talent einen wohlhabenden Mäzen verschaffte. Der vertrau te ihm seine Uhrensammlung an und öffnete ihm seine Bibliothek. Mit der dort erworbenen Bildung war Ferguson für eine Karriere in Edinburgh und London gewappnet.
Basis des Erfolgs wurde sein astronomisches Modell, ein Automat, der die Vorgänge am Himmel sichtbar und begreif bar machte. Wer an der Kurbel des Modells unten links drehte, konnte tatsächlich sehen, wie sich die Erde um die Sonne, der Mond um die Erde drehte. Dies half all den Menschen, sich die modernen Theorien praktisch vorzustel len, die über genauso wenig räumliches Vorstellungsvermö gen verfügten wie die meisten von uns.
James Ferguson wurde damit zu einem der beliebtesten populären Astronomen des 18. Jahrhunderts. Er hielt in allen bedeutenden städtischen Zentren Englands Vorträge, in die unzählige Laien strömten. Sie liessen sich begeistert Fergusons Automaten vorführen. Und während sie glaubten, endlich zu verstehen, was da am Himmel passiert, machten sie den gleichen Fehler, den noch heute viele Menschen begehen: Sie hielten ein Modell, das den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Irrtums spiegelte, für die Realität.
Denn wir müssen uns über eines im Klaren sein: Auch wenn wir in Newtons Vorstellungen unser heutiges Bild vom Weltall bereits erahnen, blieben seine Überlegungen im 18. und 19. Jahrhundert Theorie; eine Theorie, die viele Möglichkeiten bot, darüber nachzudenken, was in einer Welt, die anscheinend der unseren so ähnlich war, vorgehen mochte.
Wenn im Weltall dieselben Gesetze gelten wie auf unserer Erde, dann ist die Erde nicht mehr einmalig. Es könnte viele weitere Erden geben, und das impliziert die Frage, wie es mit der Einmaligkeit des Menschen steht. Und wenn es weitere Erden gibt, kann man sie erobern?
Jahrhundertelang war allein der Gedanke, die knapp 400 000 Kilometer zum Mond zu fliegen, der Inbegriff von Unmög lichkeit. So ist die erste Beschreibung einer Reise zum Mond
Ein Blick mit Welt raumteleskop Hub ble auf den Taran telnebel: Ob ir gendwo da draussen intelli gentes Leben exis tiert? Urheber: NASA, ESA, ESO, D. Lennon and E. Sabbi (ESA/STScI), J. Anderson, S. E. de Mink, R. van der Marel, T. Sohn, and N. Walborn (STScI), N. Bastian (Excel lence Cluster, Mu nich), L. Bedin (INAF, Padua), E. Bressert (ESO), P. Crowther (Shef field), A. de Koter (Amsterdam), C. Evans (UKATC/ STFC, Edinburgh), A. Herrero (IAC, Tenerife), N. Lan ger (AifA, Bonn), I. Platais (JHU) and H. Sana (Amster dam).

Das Titelblatt von Keplers Traum, herausgegeben 1634, einige Jahre nach seinem Tod, von seinem Sohn Ludwig Kepler
auch keine ernst gemeinte Science-Fiction, sondern nichts anderes als ein guter Witz. Der erfolgreiche Unterhaltungs autor Lukian von Samosata schrieb im 2. Jahrhundert n. Chr. eine Satire auf die damalige Form der Geschichtsschrei bung: Zu seiner Zeit mischten nämlich Lokalhistoriker nur zu gerne gut bezeugte historische Ereignisse mit Mythen und Legenden. Und genau dies führt Lukian von Samosata in seiner Wahren Geschichte vor – so nämlich lautete in Übersetzung der Titel seiner Satire, in der ein paar aben teuerlustige Helden durch die Welt und den Weltraum vagabundieren.
Wenn Lukians Werk als erster Science-Fiction Roman präsentiert wird, ist das modernes Denken. Lukian wollte keine Science-Fiction schreiben. Für ihn stellte eine Reise zum Mond schlicht die allerhöchste Form der Unmöglich keit dar, gleichzusetzen mit einer Reise auf die Insel der Seligen oder durch den Bauch eines Wals.
Das macht Lukian typisch für die menschliche Vorstel lungswelt bis weit hinein in die frühe Neuzeit. Sonne, Mond und Sterne waren Teil der göttlichen Sphäre, die kein leben der Mensch bereisen konnte.
Wenn die Sterne nicht göttlich sind, kann der Mensch sie erreichen
Dies änderte sich mit Johannes Kepler, der mit seinem Bild vom Sonnensystem die Erde zu einem Planeten wie andere auch machte. Keplers Vorstellungen kannten keinen Unter schied zwischen irdischer und göttlicher Sphäre. Und wer wusste es schon? Sonne, Mond und Sterne mochten genau so besiedelt sein wie die Erde. Damit stellte sich Kepler die Frage, ob man wohl zum Mond gelangen könne, und wie dort die Lebensbedingungen seien.
Kepler dachte als Wissenschaftler. Er formulierte wohl überlegte Thesen. So war er überzeugt, dass das Fehlen von Luft und die extreme Kälte zwischen den Planeten das
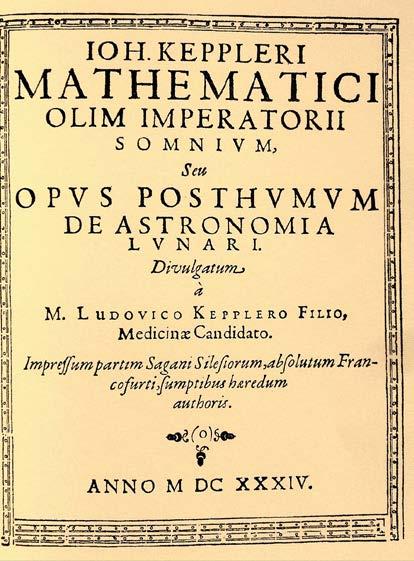
wesentliche Hindernis für eine Reise zum Mond darstellten. Als brillanter Mathematiker sagte er bereits voraus, dass es zwischen Erde und Mond einen Punkt geben müsse, an dem sich die Anziehungskräfte der beiden Planeten die Waage hielten, so dass ein Körper dort bis in alle Unendlichkeit schweben würde. Die Lebensbedingungen auf dem Mond knüpfte Kepler daran, ob es sich um die erdab- oder erd zugewandte Seite handle. Er glaubte, die beiden müssten unterschiedlichen Licht- und Klimaverhältnissen unter worfen sein.
Natürlich hätte Johannes Kepler diese Überlegungen in seiner Epoche nicht als wissenschaftliches Traktat veröffent lichen können. Schliesslich galt selbst der Heliozentrismus lediglich als Hypothese. Nie hätte die Kirche Spekulationen über ausserirdisches Leben erlaubt.
Deshalb erschienen Keplers Thesen nicht als wissen schaftliches Buch, und schon gar nicht zu seinen Lebzeiten. Erst sein Sohn Ludwig, der sich zu gerne als Poet etabliert hätte, veröffentlichte das väterliche Manuskript, allerdings nicht als wissenschaftliches Buch, sondern als komplizier ten Roman, in dem die eigentliche Geschichte in mehrere Rahmenhandlungen eingebettet war. Keplers Traum konnte niemand verurteilen, auch wenn er noch so viele nicht akzeptierte Wahrheiten enthielt.
Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation fand Kep lers Traum kaum ein Echo. Ganz anders in England, in je ner Nation, in der man sich daran gewöhnt zu haben schien, dass selbst Undenkbares zur Realität wurde. Denken wir daran, was sich alles in England zwischen 1575 und 1625 veränderte: 1580 kehrte Sir Francis Drake von seiner Welt umrundung zurück und brachte erbeutete Schätze im Wert von rund 600.000 Pfund Sterling heim. Das entsprach dem zweieinhalbfachen jährlichen Steueraufkommen des gan
John Wilkins dach te Keplers Ideen weiter. Sein Buch über eine Reise zum Mond er schien vier Jahre nach Keplers Traum, also 1638. Hier eine deutsche Ausgabe von 1713.
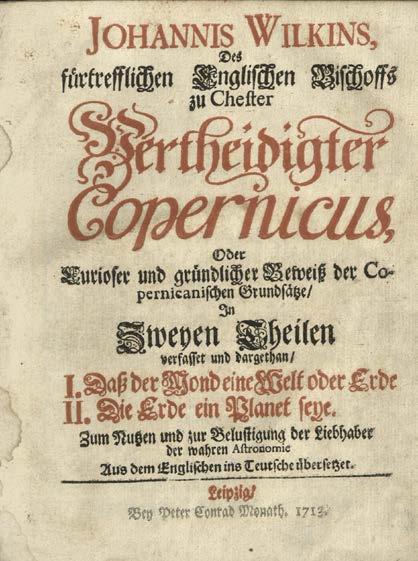
Ist da noch jemand?
zen Landes, eine unglaubliche Summe. 1588 besiegte das kleine England die unbesiegbare Armada des mächtigen Spaniens, in dessen Reich die Sonne nie unterging. Und 1625 liess das Parlament den englischen König köpfen und beendete so eine Institution, die mehr als ein halbes Jahr tausend lang England beherrscht hatte. Kurz: Alles schien einem Engländer dieser Epoche möglich. Was war schon eine Reise zum Mond im Vergleich mit dem Ende des König tums? Wenn man neue Kontinente, die noch kein Europäer gesehen hatte, entdecken und erobern konnte, wieso sollte der Mond unerreichbar bleiben, den doch jeder mit blos sem Auge sah? War es nicht Pflicht jedes loyalen Engländers, alles in Bewegung zu setzen, um den Mond zu erobern und so den anderen Mächten zuvorzukommen?
John Wilkins war 26 Jahre jung, als er Keplers Ideen weiterführte. Er hatte 1634 sein Studium in Oxford mit dem Magister abgeschlossen und danach Astronomie studiert. 1637 wurde er zum Vikar geweiht, doch das änderte nichts an seinem Interesse für die Naturwissenschaften. Wilkins veröffentlichte 1638 The Discovery of a World in the Moone . Nur zwei Jahre später erschien eine erweiterte Überarbei tung seines Werks mit dem Titel A Discourse Concerning the New Planet . Darin behauptete Wilkins, einen Beweis erbrin gen zu können, dass die Erde nichts anderes sei als ein Stern und dass auf dem Mond Menschen leben würden. Wilkins wurde nicht nur von Kopernikus angeregt, sondern auch von The Man in the Moone , einem sehr erfolgreichen, aber völlig fiktiven Werk, das Bischof Francis Godwin – ebenfalls ein Oxford-Absolvent – in den späten 1620er Jahren verfasst hatte, und das, bevor es 1638 in Druck ging, in Oxford sicher als Handschrift greifbar war.
John Wilkins wollte keine Fiktion schreiben. Er sah sich als Wissenschaftler und vertrat die Ansicht, dass es nicht schwer sein könne, die Erdanziehung zu überwinden, da diese sich nur etwa 20 Meilen in die Luft erstrecke. Für die Reise entwarf er eine Art geflügelter Kutsche, angetrieben
Titelkupfer der deutschen Ausgabe von John Wilkins, erschienen 1713 in Leipzig.
von einem Uhrwerk mit Federn, die mit Hilfe von Schiess pulver ins All geschossen werden sollte. Übrigens, Vorräte auf diese Reise mitzunehmen, hielt John Wilkins für unnötig, da der Magen im Weltall stets voll bleibe. Er glaubte, dass die Nahrung auf Erden durch die Schwerkraft durch den Körper gepresst und damit der Bauch leer werde. Im Vaku um bleibe der Bauch angenehm gefüllt. (Dass Nahrung noch einen anderen Zweck haben könnte, als den Bauch zu füllen, kam Wilkins nicht in den Sinn.)
Dass eine Reise zum Mond durchaus machtpolitische Motive haben könnte, darauf deutet auch der Titelkupfer unseres Buchs von 1713 an. Auf ihm sehen wir oben die Sonne, die in Form des Sonnengottes Apollon ihr Szepter schwingt. Direkt unter ihm steht ein König, vielleicht August der Starke von Sachsen, König von Polen. Schliesslich ge hörte der Verlagsort Leipzig zu seinem Herrschaftsbereich. Ikonographisch könnte der Adler zu Füssen des Herrschers auf August hinweisen, dessen Königreich Polen den Adler

Titelbild der deut schen Übersetzung zu Jules Vernes drit tem Roman: Von der Erde zum Mond.

im Wappen führte. Ein weiteres Indiz ist der Heraklesknoten, mit dem der Königsmantel zusammengehalten wird. August der Starke inszenierte sich zu gerne als Herakles.
Und dieser König führt an seiner Hand eine Gestalt, die vielleicht für den vom Christentum beherrschten Planeten Erde steht. Immerhin hält sie in der Linken den bekreuzten Reichsapfel. Wartet Selene, die uralte Mondgöttin, die ihre Hand auf einen realistisch wiedergegebenen Mond stützt, darauf, dass der König sie genauso führt wie die Erde? Selene scheint August und die Erde jedenfalls erwartungs voll anzublicken.
Dass all dies nicht friedlich vor sich gehen wird, darauf deutet Mars hin, der über Selene sein Schwert entblösst hat. Zu Linken steht Saturn-Chronos, der Gott der Zeit. Er wird bezeugen, ob es gelingen wird, sich den Mond und seine Bewohner zu unterwerfen.
Satire, wissenschaftliche Arbeiten, das alles ist noch keine Science Fiction im modernen Sinne. Dieses Genre wurde geformt von Jules Verne, den man dafür bezahlte, einem breiten Publikum die Naturwissenschaften (Science) näher zu bringen, indem er sie in packende Geschichten (Fiction) einbettete. Seine Romane erschienen in Fortsetzungen, abgedruckt in populären Magazinen. Ende des Jahres gab es – übrigens hervorragend als Weihnachtsgeschenk geeignet – noch einmal den ganzen Roman in Buchform. Jules Verne war brillant. Er recherchierte akribisch und sah so tatsächlich manche Entwicklung voraus, so zum Beispiel wenn er in seinem Roman De la Terre à la Lune den Ab schuss der Rakete nach Florida verlegt, wo die NASA tat sächlich ihre Abschussrampe hat.
Jules Vernes Roman über eine Reise zum Mond erschien 1865 und spiegelte die damalige Gegenwart. So sind die gelangweilten Ingenieure Baltimores seine Helden, die nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs nichts mehr zu tun haben. Sie kommen auf die Idee, eine gigantische Kano ne zu bauen, um ein bemanntes Geschoss bis zum Mond zu schiessen. Doch alle Mühen und Investitionen sind um sonst: Der Roman endet damit, dass die Rakete den Mond verfehlt. Erst fünf Jahre später folgte die Auflösung: Jules Verne publizierte 1870 Autour de la Lune (= Reise um den Mond). In diesem Roman bringt er seine Helden wieder auf die Erde zurück, ohne dass sie den Mond betreten haben.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zi vilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Intro der beliebten Serie «Raumschiff Enterprise» von 1966, in Deutschland erstmals ausgestrahlt im Mai 1972
Eigentlich waren sie als die ultimative Waffe der Nazis gebaut, jene V2-Raketen, die die Siegermacht USA als Kriegsbeute in die Vereinigten Staaten verbrachte. Dort schoss man sie nach dem Krieg ins Weltall, und so war es eine V2, die im Herbst des Jahres 1946 die ersten Fotos aus dem Weltall auf die Erde brachte. Bis zum Jahr 1950 verfüg ten die Forscher über mehr als 1.000 Fotographien von Sternen und Planeten. Sie teilten sie bereitwillig mit der Öffentlichkeit. Schliesslich musste diese ja motiviert werden, die teuren Investitionen in die Raumfahrt über Steuermittel zu finanzieren.
Durch die bemannte Raumfahrt änderten sich alle bisherigen Beschränkungen der Astronomie. Erstmals
8 Star Trek oder Star Wars?
entstand die Möglichkeit, Sterne nicht nur aus grosser Entfernung zu sehen, sondern sie vor Ort zu untersuchen. Oder sagen wir, wenigstens die Gestirne, die sich in nächster Nähe zur Erde befinden. So wurde es möglich, ein realisti scheres Bild vom Weltraum zu bekommen. Und während die Regierungen der Vereinigten Staaten und der Sowjetuni on darum konkurrierten, wer zuerst ein Raumschiff im Orbit, einen Mann im Weltraum, einen Mann auf dem Mond haben würde, dachten ihre Bürger über ganz andere Dinge nach. Sie waren fasziniert von den unendlich vielen Möglichkeiten, die da draussen im All schlummern mochten. Gleichzeitig erinnerte man sich an all das Böse, das bei der Kolonisation fremder Kontinente geschehen war. Begabte Autoren verarbeiteten diese Erfahrungen zu Romanen und Kurzgeschichten, die um die Frage kreisten, ob die Mensch heit aus all den Fehlern, etwas gelernt habe. Würde es auch im Weltall zu Kriegen kommen, wie sie Frankreich, Spanien und England um den Besitz der neuen Welt ausgefochten hatten? Wie würde sich der erste Kontakt zu Ausserirdi schen gestalten? Was, wenn diese der Erde an Technologie weit überlegen wären, und es nun der Menschheit so ergin ge, wie es einst den Ureinwohnern der Neuen Welt?
Während auf der einen Seite die Regierungen enorme Mittel aufwendeten, um sich ihre Machtposition im All zu sichern, begannen ihre Bürger von einer Besiedelung des Weltalls zu träumen. Es gab schöne Träume von einer ge meinsamen, besseren Zukunft auf einem neuen Planeten, es gab Alpträume von einem ewigen und immer brutaleren Kampf um die Macht. Eines aber hatten alle Träume ge meinsam: Sie spiegelten das politische Geschehen auf der Erde, dachten es weiter, formten es um, entstellten es, bis es fast nicht wiederzuerkennen war.
Nichtsdestotrotz hat Science Fiction ein Imageproblem. Sie
Titelbild eines Pulp Fiction Magazins aus dem Jahr 1948.
gilt als Genre, das eher als Trash denn als wertvolle Literatur bezeichnet wird. Das hängt damit zusammen, dass ScienceFiction-Geschichten gerne in den billigen Groschenheften (im Englischen Pulp Magazines) publiziert wurden. Die Pulp Magazines erlebten ihre Blütezeit von den 1920er bis zu den späten 1940er Jahren. Mehr als eine Million Exem plare wurden von den erfolgreichsten Magazinen pro Aus gabe verkauft. Ihre Autoren wollten nicht wie Jules Verne, ein breites Publikum erziehen. Ihre Beiträge unterhielten, verblüfften und boten ein sicheres Einkommen auch für Autoren, die fähig waren, weit mehr als Trash zu schaffen. Zu ihnen gehörten Talente wie Ray Bradbury oder Isaac Asimov, deren literarisches Schaffen stark von Pulp Magazi nes geprägt ist. Denn in diesen Sammelbänden, die Kurz geschichten verschiedener Autoren abdruckten, konnten sie keine komplexen Romane unterbringen. Stattdessen splitteten sie ihre Ideen in eine Vielzahl von kleinen und kleinsten Episoden, die erst viel später zu Gesamtausgaben zusammengestellt wurden.

8 Star Trek oder Star Wars?
Eines der bekanntesten Werke dieser Epoche sind die Mars Chroniken von Ray Bradbury. Der schrieb in den Jahren zwischen 1946 und 1950 für unterschiedliche Science Fic tion Magazine brillante Kurzgeschichten, in denen er sich mit verschiedenen Möglichkeiten auseinandersetzte, wie Erdbewohner und Marsianer bei einem Aufeinandertreffen miteinander umgehen könnten. Er verarbeitete dabei höchst irdische Gefühle wie Trauer, Liebe und Eifersucht; Momente der Hoffnung wechseln ab mit Hoffnungslosig keit; Erfahrungen wie die Kolonisation Amerikas, bei der durch eingeschleppte Krankheiten ganze Völker ausgerottet wurden, wiederholen sich auf dem Mars. Bradbury zeigt in seinen Episoden, dass das Weltall alles Mögliche sein kann: ein Objekt der Begierde, eine Möglichkeit für friedliches Miteinander und vielleicht die letzte Zuflucht einer vom Atomkrieg fast ausgelöschten Menschheit.
Die Mars-Chroniken sind nur ein relativ willkürlich ge wähltes Beispiel für unzählige einflussreiche Romane, Filme und Fernsehserien, die sich mit der Frage beschäftigen, wie unsere Zukunft im Weltall aussehen könnte. Eines ist dabei bemerkenswert: Die meisten Romane sehen die Menschheit vereint auf ihrer Reise ins All. Während Regie rungen in Ost und West den Weltraum als militärische Interessensphäre behandeln, hat eine breite Bevölkerung längst verstanden, dass die Menschheit auf ihrer winzigen Erde nur dann in den unendlichen Weiten des Weltraums überleben kann, wenn sie diese Herausforderung gemein sam meistert.
Die Himmelskörper waren schon immer da. Und schon immer schaute der Mensch nach oben, beobachtete und entdeckte Veränderungen, die seine Umgebung beein flussten. Ganz egal, wie man sich in den verschiedenen Kulturen und Religionen den Kosmos vorstellte und wie man sich erklärte, warum die Sonne morgens auf und abends unterging: durch die blosse Beobachtung von Sonne, Mond und Sternen liessen sich Muster erkennen, die den Menschen halfen, sich in Raum und Zeit zu orien tieren. Wer vermerkte, wie sich die Gestirne bewegten, konnte daraus Regeln für ihren zukünftigen Weg am Himmel ableiten, ohne eine genaue Vorstellung des Alls zu haben.
Die Bücher der ersten Station zeigen auf, wie der Mensch Sonne und Sterne nutzte, um die Zeit und seine geographische Position zu bestimmen. Sie zeigen ausserdem, wie diese Methoden im Laufe der Geschichte mit der Hilfe der Mathematik und Messinstrumenten verfeinert wurden.
Johann Friedrich Penther: Gnomo nica Fundamenta lis & Mechanica worinnen gewie sen wird, wie man sowol gründlich, als auf mechani sche Art, allerhand Sonnen Uhren regulaire, irregu laire, mit Minun ten und himmli schen Zeichen/ auf allerhand Flä chen ... verfertigen solle.
Erschienen bei Johann Georg Hertel in Augs burg, 1768.

Schon immer bestimmte der Lauf der Sonne den Alltag der Men schen. Schon früh erkannte man die Sonnenwenden als wichtige Fixpunkte im Jahr. Von Stonehenge bis nach Ägypten gibt es zahllose Beispiele von früher Architektur, die beweisen, wie genau man die Position der Sonne an diesen Tagen vorhersagen konnte. Ein um 3100 v. Chr. entstandenes Hügel grab in Irland wurde beispielswei se so ausgerichtet, dass die Grab kammer nur an den Tagen um die Wintersonnenwende von Sonnen strahlen erreicht wurde – eine Meisterleistung seiner Schöpfer,
Sonnenuhr aus dem Tal der Könige in Ägypten, ca. 1500 v. Chr.

die uns die religiöse Bedeutung der Sonnenwenden aufzeigt.
Ganz selbstverständlich be stimmte man mit Hilfe des Son nenstands die Tageszeit. Mit dem wandernden Schatten eines Stabes unterteilten die Ägypter bereits im 4. Jahrtausend vor Christus den Tag in so etwas wie Stunden. Bei den Griechen und Römern waren Sonnenuhren allgegenwärtig.
Man mag glauben, dass Sonnenuhren mit dem Aufkommen mechanischer Taschenuhren bedeutungs los geworden wären, aber dem war nicht so. In der Frühneuzeit erlebten die Sonnenuhren eine neue Blü te und blieben ins 18. Jahr hundert die wichtigste Form der Zeitmessung. Unser Buch, 1755 verfasst, zeugt davon. Es ist ein Kompendi um, das der Funktionsweise und dem Bau von Son nenuhren gewidmet ist.
Schon an seinem Umfang wird deutlich, dass Sonnenuhren inzwischen mehr waren als ein Stab und ein Paar Kerben im Stein. Fort geschrittene Kenntnisse der Astronomie und Mathema tik hatten aus ihnen hoch präzise Messinstrumente gemacht. Mit Sonnenuhren konnte man die Zeit zwar nicht minutengenau ermit teln, dafür gingen sie immer richtig. Taschenuhren muss ten wegen ihrer störungsan fälligen Uhrwerke jeden Tag neu justiert werden, bevor zugt zur Mittagsstunde anhand der Sonnenuhr.

1.1 Die Sonne als Zeitmesser


Frühe Sonnenuhren konn ten nur Stunden, keine Minuten messen. Im 18. Jahrhundert war das bis zu einem gewissen Grad mög lich. Die Uhren wurden deutlich genauer, sobald
man sie entsprechend dem Längengrad und der Jahres zeit justierte. Die abgebilde ten Seiten veranschaulichen die Theorie der verschiede nen Anpassungsmöglichkei ten.
Die Herstellung präziser Sonnenuhren war also ein komplexes Unterfangen, das auf astronomischen Kennt nissen basierte – und auf Mathematik. Die Lehre von den Sonnenuhren war daher eine eigene Disziplin, Gno monik genannt, abgeleitet von Gnomon, der griechi schen Bezeichnung für den Schattenstab der Sonnenuhr. Daher der Titel dieses Lehr buchs, Gnomonica Funda mentalis & Mechanica.
Der Autor unseres Buchs über die Sonnenuhren verstand sich als Mathemati ker. Johann Friedrich Pen ther (1693–1749) verdiente sich seinen Lebensunterhalt als Ingenieur, indem er verschiedene Aufgaben mit Hilfe angewandter Mathe matik löste. Er vermass Grundstücke oder berechne te die Flugbahn von Kano nenkugeln. Deutlich erkenn bar auf seinem Porträt ist übrigens die Sonnenuhr, die wir bereits von der vorletz ten Station kennen.


Eine gewisse Berühmtheit erlangte Penther für den Bau einer innovativen Sand steinfigur, die heute vor der Wolfenbütteler Biblio thek steht. An ihr befanden sich ganze 12 Sonnenuhren. Penther hielt in seinem grundlegenden Buch fest, was es brauchte, um so eine Sonnenuhr zu konstru ieren – und das war Mathe matik.


Foto: Okernick / CC BY SA 4.0
Bartolomeo Cre scenzio (Romano), Nautica Mediter ranea: nella quale si mostra la fabri ca delle galee...si manifesta l’error delle charte medi terranee...s’inseg na l’arte del navi gar ...Et un Porto lano di tutti i porti da stantiar vascelli co i loghi pericolo si di tutto il Mare Mediterraneo.
Zweite Auflage, herausgegeben in Rom bei Bartolo meo Bonfadino, 1607

1.2 Nach den Gestirnen
Schon in der Antike konnten die Menschen anhand der Bewegungen am Sternen himmel sich zu bestimmten Jahreszeiten wiederholende Naturphänomene vorhersa gen. Ein gutes Beispiel dafür ist der ausfällig helle Dop pelstern Sirius im Sternbild Grosser Hund, auch Hun destern genannt. Sein Auf tauchen verkündete für die Ägypter den baldigen Be ginn der wichtigen Nil schwemme. Die Römer
leiteten aus dem Erscheinen des Sterns ab, dass die wärmste Zeit des Jahres begann – die nach ihm benannten Hundstage. Praktischen Nutzen hatten Sterne für die Orien tierung. Besonders Seefah rer hielten ihren Kurs auch fernab der Küste in tiefer Nacht mit Hilfe von Sternen konstellationen wie dem Kreuz des Südens oder dem Polarstern.

Dieses im Jahr 1602 publi zierte Buch gibt uns einen Einblick, über welche astro nomischen Kenntnisse die Kapitäne und Steuermänner verfügten, um in der frühen Neuzeit ihren Weg über das Mittelmeer zu finden. Sein Titel lautet Nautica Mediter ranea. Sein Verfasser, Bar tolomeo Crescenzio Roma no, war als Kommandant der päpstlichen Flotte ein ausgewiesener Experte der Mittelmeer-Schifffahrt.
Er fasste darin alles, was es um 1600 über die Seefahrt auf dem Mittelmeer zu wissen gab, zusammen: Schiffbau und Wetterver hältnisse, die wichtigsten Häfen und die Gefahren, die von Seiten des Osmanischen Reiches drohten. Für uns sind vor allem seine Ausfüh rungen zur Navigation interessant. Er zeigte Metho den und Instrumente, mit denen Seefahrer die Zeit und ihre Position anhand der Sterne und der Sonne bestimmen konnten. Roma nos Werk macht deutlich, welche Fortschritte die Astronomie seiner Epoche gemacht hatte. Er griff auf den aktuellen Wissensstand zurück und erklärte dessen Anwendung für die Seefahrt.

Für Seeleute im Zeitalter der Segelschiffe war es von zentraler Bedeutung, die günstigsten Windströmun gen zu nutzen. Diese Seite illustriert, wie man den Nordwind Tramontana im Mittelmeer anhand von Sternenkonstellationen findet.

Sonnenuhren funktionieren in der Nacht nicht. Da See leute auch nachts auf eine grobe Zeiterfassung ange wiesen waren – beispiels weise, um festzustellen, wie viele Stunden man einen Kurs beibehalten hatte – be schrieb Romano Methoden, um zu zählen, wie viele Nachtstunden verstrichen sind.

Zum unverzichtbaren Hand werkszeug der Seeleute gehörte der Jakobstab, auf italienisch Balestriglia. Das abgebildete Exemplar stammt aus dem 17. Jahr hundert. Mit diesem simp len Gerät mass man mit Hilfe von verschiebbaren Querbalken den Winkel zwischen zwei Punkten, wie diese Skizze zeigt. Seeleute massen so den Winkel zwischen Horizont und angepeilten Sternen, um zu ermitteln, auf welchem Breitengrad sich ihr Schiff befand.
Gewidmet hatte der in päpstlichen Diensten ste hende Romano sein Buch Kardinal Pietro Aldobrandi ni, dem Neffen von Papst Clemens VIII. Die dürften
über die Widmung und den astronomischen Gehalt dieses Buch erfreut gewesen sein. Schliesslich unterstrich das Buch u. a. die Kompe tenz der Kirche in astrono mischen Fragen. Doch was hatte der Heilige Stuhl mit der Astronomie zu tun?


Die ganze Welt legt heute Termine nach dem gregoriani schen Kalender fest. Benannt ist er nach Papst Gregor XIII., der ihn als Verbesserung des Kalenders von Julius Cäsar einführen liess. Doch was kümmerte den Papst eigentlich der Kalender? Wieso war eine Reform nötig?
Und wer leistete die mathematische Arbeit für so eine so massgebliche Reform, die wir bis zum heutigen Tage unverändert beibehalten haben?
Diese Fragen führen uns mitten hinein in das Verhältnis zwischen Astronomie und Kirche. Zunächst stellen wir Ihnen einen Astronomen vor, dessen Werk aus dem 13. Jahrhundert 300 Jahre lang das Lehrbuch der Astrono mie in Europa sein sollte. Mit dem zweiten Buch kommen wir zu dem Mann, der die Einführung unseres heutigen Kalenders umgesetzt hat. Beide zeigen uns, dass Kirche und Wissenschaft sich nicht diametral entgegenstanden, wie es gern dargestellt wird, sondern die Wissenschaft innerhalb der Kirche stattfand.
Johannes von Sacrobosco, Spha era Ioannis De Sacrobosco Emen data Eliae Vineti Santonis scholia in eande[m] Spha era[m], ab ipso authore restituta. Quibus nunc ac cessere scholia Heronis. Erschienen 1591 in Köln bei Goswin Cholinus, verfasst um 1230.

Die Astronomie war im Mittelalter und darüber hinaus ein hochangesehe nes Fach. Sie war eine der sieben freien Künste, die jeder studiert haben musste, ob er nun Theologe, Jurist oder Mediziner werden wollte. Wer im frühen 13. Jahrhundert an der Universität von Paris stu dierte, hatte die Chance, dem einflussreichsten Astronomen des europäi schen Mittelalters zu lau schen, wie er aus seinem epochemachendem Werk Tractatus de Sphaera vorlas. Er hiess Johannes von Sacro bosco und war Mönch. Sein Werk entstand um 1230.
Johannes von Sacrobosco, geb. vermutlich 1195 in Schottland, gest. um 1256 in Paris

Das Revolutionäre an Sacro boscos Traktat waren nicht seine eigenen Erkenntnisse. Sein Verdienst war es, dass er die erst kürzlich wiederent deckten Astronomie-Kennt nisse der antiken Autoren verbreitete. Mehr noch: Er ergänzte, was die Gelehrten in Byzanz und im Orient in knapp 1000 Jahren der inten siven Beschäftigung mit den antiken Schriften herausge

funden hatten. Kurz: Er brachte Europa auf den aktuellen Stand der Forschung.
Über die Mitschriften seiner Studenten verbreitete sich das Traktat schon vor der Erfindung des Buch drucks über den ganzen Kontinent und wurde in diverse Sprachen übersetzt. Mit dem Buchdruck etablier te es sich endgültig als das Standartwerk der Zeit zum Thema Astronomie und bliebt es bis ins 16. Jahrhun dert. Bis zum Jahr 1650 erschienen 240 Drucke vom Tractatus de Sphaera.
Der Erfolg des Traktats hatte einen guten Grund. Es war nicht nur didaktisch hervor ragend aufbereitet, sondern auch auf dem neuesten Stand der Forschung. Sacro bosco benutzte die arabi schen Ziffern, mit denen es sich viel leichter rechnen liess. Damit war er einer der ersten westlichen Gelehrten, die dies taten.
Die Grundlage für Sacrobos cos Werk war die Mathema tike Syntaxis des Claudius Ptolemaios, die man damals unter dem arabischen Be griff Almagest kannte. Sacro bosco berücksichtige die Kommentare der arabischen Astronomen zu diesem Text, sofern sie in lateinischer Übersetzung vorlagen. Zu ihnen gehörte Al-Farghani, ein Astronom, der um 800 in Bagdad lebte. In Latein wurde aus ihm Alfraganus.


Bei der Beobachtung der Planeten von der Erde aus kamen Sacrobosco und andere Autoren zu einem merkwürdigen Ergebnis: Die Bahnen erschienen nicht linear, sondern zeig ten merkwürdige Schleifen. Ein Schönheitsfehler im göttlichen System, der die Vorausberechnung der Umlaufbahnen enorm kompliziert machte.

Basierend auf Aristoteles und Ptolemaios lag Sacro boscos Ausführungen ein geozentrisches Weltbild zu Grunde. In der Mitte des Kosmos sah Sacrobosco die Weltkugel, die von den Planeten und der Sonne umkreist wurde. Weiter aussen drehte sich das Firmament, eine Kugel, an der sich die Fixsterne befan den. Jenseits davon verorte te er die göttliche Sphäre, die den Kosmos umhüllte.

Unsere Fassung vom Tracta tus de Sphaera wurde 1591 in Köln gedruckt und um fasst die Kommentare meh rerer bedeutender Astrono men zu Sacroboscos Texten. Solche kommentierte Veröf fentlichungen waren in der Astronomie üblich. Auch das Werk, das den Traktat von Sacrobosco als wichtigs tes astronomisches Werk ablösen sollte, war dem Namen nach nur ein Kom mentar zu Sacrobosco. Verfasst hat ihn Christopher Clavius.

Christopher Clavi us: In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius. Erschienen in Venedig bei Ber nardo Basa, 1596. Erste Auflage von 1570.

Christopher Clavius, 1538 in Bamberg geboren, war einer der talentiertesten Mathe matiker seiner Zeit. Er hatte bei den Jesuiten eine hervor ragende Ausbildung genos sen und folgte später dem Ruf des Vatikans nach Rom. Schliesslich gehörte die Kirche zu den wichtigsten Förderern der Astronomie und leistete sich die schlaus ten Köpfe ihrer Zeit. Clavius und seine Kollegen arbeite ten als sogenannte Compu tisten. Ihre Aufgabe war es, den jüdischen Mondkalen der mit dem römischen, nach der Sonne berechneten Kirchenjahr in Einklang zu bringen. Das war nötig, um das Datum des Osterfestes zu berechnen. Solche Fragen fielen in das Aufgabengebiet des Papstes. Er erhob An spruch auf den römischen Titel des Pontifex Maximus, und in römischer Zeit war der Pontifex Maximus als oberster Priester unter anderem für die Erstellung des Kalenders zuständig gewesen.

Der letzte Pontifex Maxi mus, der eine Kalenderre form durchgeführt hatte, war
2.2 Was der Papst mit dem Kalender zu tun hat
Julius Caesar gewesen. Doch seine Astronomen hatten sich leicht verrechnet. Ihr Rechenfehler addierte sich nach ca. 1500 Jahren auf rund 10 Tage. Deshalb war eine neue Kalenderreform notwendig, die von päpstli chen Astronomen vorberei tet wurde. Wir sehen: Es war nicht so, dass sich der Vati kan nicht für den astronomi schen Fortschritt interessier te – im Gegenteil, er war es, der ihn ermöglichte.
2.2 Was der Papst mit dem Kalender zu tun hat
Die Umsetzung der Kalen derreform von 1582 legte Papst Gregor XIII. in die Hände des Computisten und Leiters der päpstlichen Sternwarte, Christopher Clavius. Clavius genoss europaweit den Ruf eines herausragenden Mathema tikers und Astronomen. Das lag hauptsächlich an seinem richtungsweisenden Werk zur Astronomie, von dem
wir ein Exemplar in unserer Bibliothek haben. Beschei den bezeichnete Clavius sein Buch von 1570 als einen weiteren Kommentar zu Sacrobosco. In Wahrheit war es viel mehr, wie wir daran sehen, dass es sich an den Universitäten als das grund legende Lehrbuch der Astronomie durchsetzte. Bis zu seinem Lebensende 1612 legte Clavius regelmässig aktualisierte Fassungen vor, um die neuesten For schungserkenntnisse zu berücksichtigen, beispiels weise die von Galileo Galilei.

Wie wir hier sehen, übertra fen die von Clavius verfass ten Passagen die Länge des kommentierten Textes von Sacrobosco, hier Kursiv, um ein Vielfaches. Teilweise werden einzelne Sätze von Sacrobosco durch ganze Kapitel kommentiert.


Die kirchlichen Computis ten verwendeten alles, was ihnen die Rechenarbeit erleichterte. Auch die Er kenntnisse von Kopernikus flossen daher in ihre Arbeit und dieses Buch mit ein. Legte man dessen heliozent risches Weltmodell zugrun de, fielen auf einen Schlag all die lästigen Schleifen der Gestirne weg, die so schwie rig zu berechnen waren.
Dieses praktische Zuge ständnis änderte nichts an der prinzipiellen Feststel lung von Clavius, dass nur die Erde im Zentrum des Kosmos sein könne, nicht die Sonne.
Wer In sphaeram Ionnis de Sacro Bosco commentarius durchblättert, merkt schnell: Astronomie ist Mathematik. Unser Exemplar besteht zu gut einem Fünftel aus Tabel len, in denen Messdaten zu Planetenbewegungen und Vorhersagen künftiger Planetenstellungen festge halten werden.
Clavius gab sein Lehrbuch sieben Mal neu heraus, um es auf dem neuesten Stand der Forschung zu halten. Unsere Ausgabe erschien 1596 in Venedig. In den sechs Jahren nach seinem Tod erschienen neun weite re Überarbeitungen. Warum explodierte das astronomi sche Wissen in der Zeit um 1600 derart, dass dieses grundlegende Werk ständig ergänzt werden musste? Und wieso schluckte der Buchmarkt derart viele Ausgaben?


Um 1600 veränderten sich die Bedingungen für Astronomen grundlegend. Das allgemeine Interesse am Fach stieg sprunghaft an. Auslöser dafür war vor allem die Einführung des neuen Gregorianischen Kalenders. Die Diskussionen über ihn sorgten dafür, dass die Astronomie plötzlich in aller Munde war und zur Modewissenschaft der Zeit wurde. Viel mehr Astronomen fanden eine Be schäftigung. Um sich für einen möglichst hoch dotierten Posten zu empfehlen, war es unabdingbar zu publizieren. So entstanden mehr astronomische Bücher als je zuvor, durch die das Wissen über die Gestirne explodierte. Mit dem ersten Buch dieser Station schauen wir uns an, wie sich die Kalenderreform auf den Alltag der Menschen auswirkte und wie die Astronomie im Alltag der Men schen ankam. Unser zweites Buch führt uns vor Augen, von welch entscheidender Bedeutung der technische Fortschritt für den astronomischen Erkenntnisstand war.
Nicolaus Winckler, Bedencken Von Künfftiger veren derung Weltlicher Policey vnd Ende der Welt auss hey liger Göttlicher Schrift vnnd Patri bus, auch auss dem Lauff der Natur des 83. Biss auff das 88 vnd 89. Jars.
Gedruckt in Augs burg bei Michael Manger, 1582.

Die Einführung des Gregori anischen Kalenders hatte zur Folge, dass 10 Tage im Oktober 1582 übersprungen wurden. Auf päpstlichen Erlass folgte in diesem Jahr auf den 4. der 15. Oktober –zumindest in den Teilen Europas, die dem Papst gehorchten. Die protestanti schen Länder und Fürsten in Nordeuropa lehnten die Kalenderreform ab. Mit der Übernahme des Kalenders hätten sie den Papst als Pontifex Maximus aner kannt, ein Titel, der nicht nur die Oberhoheit über den Kalender, sondern über alle Glaubensfragen implizierte – völlig unmöglich für Pro testanten. Nun gab es zwei abweichende Kalender in Europa. Besonders dort, wo die Religionen geographisch eng miteinander benachbart waren wie in der Eidgenos senschaft, führte das zu

Mit der Bulle Inter gravissimas ver kündete der Papst die Reform des Kalenders.
3.1 Die Welt aus den Fugen, die Astronomie in aller Munde
handfesten Problemen –plötzlich hatten beispiels weise manche Städte und ihr Umland Kalender, die um 10 Tage voneinander abwichen!
Das Thema betraf alle. Rege Diskussionen wurden über den Sinn der Reform geführt, weit ausserhalb der Kreise, die normalerweise über Fragen der Astronomie debattiert hätten. Die Astro nomie erreichte Märkte und Wirtshäuser.
Auf welchem Niveau die Bürger im Heiligen Römischen Reich damals diskutierten, darüber informiert uns die vorliegende Broschüre. Sie stammt aus dem Jahr der Kalen derreform. Ihr Autor, Nicolaus Winckler, reicherte seine Weltun tergangsprophezeiungen mit detaillierten Informationen zu bevorstehenden Planetenkonstel lationen an.

Für uns ist Wincklers Broschü re deshalb so interessant, weil sie zeigt, welches Vorwissen ein populärer Autor bei seiner Ziel gruppe, dem Deutsch lesenden, gebildeten Bürgertum, vorausset zen konnte. Seine Leser kannten Fachbegriffe wie den der Konjunk tion, also der scheinbaren Begeg nung zweier Himmelskörper. Sie wussten, wie die Planeten sowie die wichtigsten Sternzeichen hiessen und mit welchen Kürzeln sie bezeichnet wurden. Die Astro nomie war deutlich weiter in die bürgerlichen Kreise vorgedrungen, als das zuvor der Fall gewesen war.
Wie dem Titelblatt zu entnehmen ist, war Winckler eigentlich Doktor der Medizin und Stadtarzt von Schwäbisch Hall. Als Vorbedin gung seines Medizinstudiums musste er – wir erinnern uns –auch Astronomie-Kenntnisse erwerben. Die nutzte er, um mit diesem populären Thema seine Abhandlungen attraktiver zu machen. Wir können davon ausge hen, dass er auch Horoskope verkaufte. Die Astrologie galt damals genauso als Wissenschaft wie die Astronomie.

Ein kleiner Einblick in die astrologischen Schauerge schichten, die Winckler auftischt: Auf dieser Seite ist vom sehr blutdurstigen Stern Aldebaran die Rede sowie von der grossen und sehr gefährlichen Konjunk tion von Saturn und Mars. Die Folge: Tyrannei, Chris tenverfolgung und anrü ckende Türken; «dann wird es den Menschen Angst und Bang auff Erden werden zu leben.»
3.1 Die Welt aus den Fugen, die Astronomie in aller Munde
Winckler widmete dieses Buch dem Grafen Georg Friedrich von HohenloheNeuenstein-Weikersheim. Auch Fürsten pflegten damals gern das Image der astronomischen Bildung. Solche Widmungen entspre chender Werke wurden mit wertvollen Geschenken entlohnt.


Wer es sich leisten konnte, besoldete einen Hofastrono men. Einer von ihnen, der Protégé des dänischen Königs Tycho Brahe, erstell te in jahrelanger Kleinstar
beit ein aufwändiges Zah lenwerk, das zur Grundlage für die wegweisenden Forschungen eines Johan nes Kepler werden konnte.

Johannes Kunckel: Johann Kunkels vollständige Glas macherkunst, worinnen sowol dessen Erläute rungen über Anton Neri sieben Bücher von dem Glassma chen und Dr. Mer rets hierüber ge machte Anmer kungen. Erschienen in Nürnberg bei Christoph Riegel, 1785.

Um 1600 blühte nicht nur die Astronomie, sondern auch die Glasherstellung auf. Das Zentrum der Glas herstellung war in dieser Zeit Venedig. In den Werk stätten von Murano entdeck te man damals laufend neue Methoden, reineres oder besonders gefärbtes Glas
herzustellen. 1612 verfasste der Priester und Glasexperte Antonio Neri das erste systematische Kompendium zu Glas und Glasherstellung: L’Arte Vetraria – Die Kunst des Glases.

Unsere Ausgabe von Neris Werk beweist, dass es über Jahrhunderte europa weit das Standardwerk zur Glasherstellung blieb. Sie erschien 1785. Es handelt sich um einen Nachdruck der deutschen Erstausgabe, die der Glasmacher Johan nes Kunckel 1679 veröffent lichte. Seine Fassung basier te wiederrum auf der englischen Übersetzung von Neris Werk, die 1662 in London erschien.
Es ist kein Wunder, dass dieses Buch so lange ver breitet war, verliert es sich doch nicht in der Theorie, sondern beschreibt ganz praktisch, wie welche Arten, Farben und Formen von Glas herzustellen sind.
3.2 Was für den Blick in die Sterne nötig ist
Neris Arbeit beschreibt den Fortschritt, den die Glasblä ser von Murano vor anderen Glasfabrikanten hatten. Dieser Fortschritt trug entscheidend zu den Ent deckungen Galileo Galileis bei. Der arbeitete seit 1592 als Dozent an der veneziani schen Universität in Padua und besserte sich das kleine Einkommen mit der Herstel
lung von wissenschaftlichen Apparaten und Brillen auf.
In dieser Funktion hatte er engsten Kontakt mit den Glasbläsern von Murano.
Als er nun 1608 von der niederländischen Erfindung eines Fernrohrs hörte und diese mit eigenen Linsen nachbaute, waren seine Inst rumente besser als die seiner Konkurrenten. So sah er genauer als je ein Mensch vor ihm, was sich am Him mel ereignete. So entdeckte er unter anderem vier Jupi termonde.
Um seinen Vorsprung zu halten, bemühte sich Galilei ständig, die Linsen zu ver bessern. Er stellte sogar selbst Glas her, wozu er sicher Neris Abhandlung konsultierte. Es ist überlie fert, dass Galilei ein Exemp lar besass und eines an einen Kollegen in Rom schickte. Auch wegen des besseren Glases waren Galileos spätere Fernrohre deutlich stärker als seine ersten Versuche.

Auf dieser Seite sind die Grundlagen der Herstellung von Kristallglas beschrieben, dem Cristallo. Es galt als klarstes, reinstes Glas seiner Zeit und eignete sich her vorragend für die Herstel lung von Linsen. Galileo bemühte sich lange um den direkten Kontakt zu seinen Erzeugern.

1610 veröffentlichte Galilei seine astronomischen Beobachtungen mithilfe des Fernrohrs in der Schrift Sidereus Nuncius, was sich als der Sternenbote über setzen lässt. Er beschrieb darin die Funktionsweise eines Fernrohrs, die von ihm entdeckten vier grossen Jupitermonde und lieferte genauere Abbildungen des Mondes, als sie seine Zeit genossen je gesehen hatten.

Galileo Galilei war unbestritten einer der wichtigsten Astronomen der Geschichte. Doch tendiert die Nachwelt dazu, aus bedeutenden Menschen noch bedeutendere zu machen. So vergisst man, dass Galileis Schaffen auf den Leistungen anderer Astronomen wie Kepler, Brahe, Kopernikus und Clavius aufbaute – und er mit seinem Fernrohr auch die nötige Portion Glück hatte. Heute sehen wir Galilei gerne als eine Art Luther der Wissenschaft, der gegen das Joch der Kirche aufbegehrte. Ein genauerer Blick offenbart schnell: das war er keines wegs. Diese Station trennt den realen vom verklärten Galileo Galilei.
Galileo Galilei, Discorso al Se renissimo Don Cosimo II ... intor no alle cose, che stanno sù l’Acqua, ò che in quella si muovono ...
Gedruckt in Bolog na 1655 bei Dozza. Zweite Auflage. Zusammengebunden mit zwei Entgegnungen anderer Autoren.

Auch ein Galileo Galilei musste sein Auskommen sichern und war begierig darauf, Karriere zu ma chen. Sein Sternenbote war als Empfehlungsschreiben an Herzog Cosimo II de Medici angelegt. Gali lei widmete ihm dieses Werk und nannte die mit seinem Fernrohr entdeckten Jupitermonde Sterne der Medici. Als Cosimo erkannte, dass der Sternenbote tatsächlich europaweit Beifall fand, nahm er Galilei in seine Dienste. Allerdings hatte der Herzog kein Interesse daran, dass sein Schützling durch zu steile Thesen in Konflikt mit der Kirche geriet. Vielleicht hatte deshalb Galileos erste Schrift in Cosimos Diensten aus Rücksicht auf seinen neuen Schutzherren nichts mit Astronomie zu tun.
4.1 Der historische Galilei
Cosimo II de Medi ci, Gemälde von Cristofano Allori.

Sprengkraft hatte sie trotzdem, auch wenn der Titel zunächst nicht danach klingen mag. Im Diskurs über schwimmende Körper von 1612 ging es um die Frage, warum feste Körper wie Eis auf dem Wasser schwimmen. Dieser Veröf fentlichung folgten heftige Debat ten. Mit seiner – völlig korrekten –These, dass Objekte nicht wegen ihrer Form, sondern wegen ihrer geringeren Dichte auf dem Wasser schwimmen, widersprach Galilei nämlich Aristoteles. Der galt
manch einem noch immer als eine unantastbare Instanz, der man schlicht nicht widersprechen durfte. Die Aristoteles-Anhänger hielten also energisch dagegen. Es entstand also ein Streit darüber, wie die Welt in Zukunft erklärt werden sollte, mittels Hypothese und Beweis oder mittels Zitaten aus den Werken glorifizierter Autoritäten.

Gern wird behauptet, es sei ein grosser Teil der damali gen Gelehrtenwelt gewesen, der Galilei widersprochen hätte. Das stimmt nicht. Es waren einige wenige. Über die vehemente Sturheit der Aristoteles-Anhänger mach ten sich schon die Zeitge nossen lustig. Ludovico delle Colombe war der wichtigste Gegner Galileis in dieser Angelegenheit. Hier sehen wir das Titelbild seiner Antwort auf Galileis Traktat.
4.1 Der historische Galilei
Unsere Exemplar der Discor si Galileis wurde 1655 vom Bologneser Buchdrucker Evangelista Dozza veröffent licht. Er entschied, Galileis Traktat mit zwei Streitschrif ten der führenden Aristoteli ker zusammenzubinden: Colombe und Vincento Di Gratia. Zum Zeitpunkt der Publikation waren deren Meinungen längst widerlegt. Ihre Schriften abzudrucken konnte kaum einen anderen Zweck haben, als Galileis Genie heller glänzen zu lassen – und damit begann die Verklärung.


Galilei leitete seinen Trak tat zu den schwimmenden Körpern damit ein, sei nen Lesern zu versichern, er habe sich nicht von der Astronomie abgewandt. Das hatte er tatsächlich nicht getan. Doch auch in der Astronomie hätte er zu gerne mit Beweisen gear beitet, und das war zu sei nen Lebzeiten nicht erlaubt.

Opere di Galileo Galilei nobile fiorentino prima rio filosofo, e matematico del Serenissimo Gran Duca di Toscana. 3 Bände, gedruckt 1718 in Florenz bei Gaetano Tartini und Santi Franchi

Die Kirche, durch die Refor mation in die Defensive gedrängt, wehrte sich um 1600 strikt gegen alles, was ihre Autorität in Fragen der Schriftdeutung einzu schränken schien, beson ders in Italien. Als Karrierist liess Galilei in seinen astro nomischen Schriften des halb stets grosse Vorsicht walten. Alles, was den Wahr heitsgehalt der Bibel in Frage stellte, war tabu. Erlaubt war lediglich, das kopernikanische System,
dass die Erde um die Sonne kreiste, als Hypothese zu behandeln. Und so hütete sich Galilei davor, eigene Folgerungen aus seinen Entdeckungen zu formulie ren. Erst 1632 vergass er seine Vorsicht im berühm ten Dialog über die zwei Weltsysteme . Er gab die kirchlichen Positionen der Lächerlichkeit preis und schätzte damit völlig falsch ein, was ihm sein Förderer, der Papst, durchgehen lassen würde.

4.2 Der verklärte Galilei
Im berühmten Inquisitions prozess von 1633 ruderte Galilei sofort zurück. Er verteidigte das kopernikani sche System nicht, beteuer te, eigentlich sogar das Gegenteil gemeint zu haben, schwor dem Geschriebenen ab und bat um Gnade. Heute haben wir die Szene ganz anders vor
Augen, nämlich etwa so, wie sie uns dieses Historienge mälde von 1847 zeigt: Ein mutiger Galilei steht vor den Inquisitoren trotzig zur Wahrheit. Wie kommt es, dass wir ihn heute als gros sen Kämpfer gegen die kirchliche Unterdrückung der Wissenschaft kennen?

In der Aufklärung etablierte sich ein Mythos: In der Geschichte hätten Kirche und Wissenschaft gegenein ander gekämpft, der Vatikan sei ein Hort des Aberglau bens und des Stillstands gewesen. Wie wenig diese Interpretation zutrifft, das zeigen unsere letzten Statio nen. Dennoch setzte sich diese Erzählung durch. Den absolut herrschenden Fürsten und später den Nationalstaaten bot diese Lesart einen guten Vorwand, jede Einmischung des
Papstes zu unterbinden. Der bekannte, von der Kirche angeklagte Galilei eignete sich hervorragend, um zum Märtyrer stilisiert zu werden. Das Erstaunliche ist, dass diese Erzählung bis heute kaum hinterfragt wird. Die berühmten Worte Und sie bewegt sich doch , die Gali leo bei dem Prozess noch rebellisch gemurmelt haben soll, wurden erstmals 1757 niedergeschrieben – über ein Jahrhundert nach sei nem Tod.

4.2 Der verklärte Galilei
Am langen Nachwirken der Verklärung sind vor allem zwei Bücher des späten 19. Jahrhunderts schuld: John William Drapers History of the Conflict between Religi on and Science von 1874 und Andrew Dickson Whites A History of the Warfare of Science with Theology in

Christendom von 1896. Beide waren sehr erfolgreich, wurden vielfach aufgelegt und übersetzt. Sie sind massgeblich dafür verant wortlich, dass sich ihre antikatholische Lesart der Geschichte bis in die Klas senzimmer als gängige Erzählung etablieren konnte.

Auch durch Berthold Brecht wurde Galileis Kampf mit den Inquisitoren zu einem bekannten Thema. Freilich ging es Brecht in seinem Leben des Galilei um etwas ganz anderes als das Ver hältnis von Kirche und Wissenschaft: Geprägt vom Dritten Reich und Hiroshi ma thematisierte er den Machtmissbrauch durch Ideologien und die Verant wortung des Wissenschaft lers.

4.2 Der verklärte Galilei
Eine Aufführung von Brechts Leben des Galilei in Ber lin, 1971. Bundes archiv, Bild 183 K1005 0020 / Katscherowski (verehel. Stark), / CC BY SA 3.0.
Die Inquisition verurteilte den reumütigen Galilei zu einem recht bequemen Hausarrest. Andere waren weniger fügsam und hatten entsprechende Folgen zu tragen. Vor allem wenn sie wie Giordano Bruno ihre astronomischen Hypothe sen mit Angriffen auf die päpstliche Deutung der heiligen Schrift kombinier ten, war das schrecklich Ende vorherzusehen. Gior dano Bruno wurde 1600 als Ketzer verbrannt.
Denkmal für Giordano Bruno auf dem Campo de’Fiori in Rom. Foto: daryl_mitchell / CC BY SA

Die Richtigkeit des Heliozentrischen Weltbildes liess sich nicht totschweigen. Es brach die Zeit der Aufklärung an, in der die Gelehrten die Freiheit des rationalen Denkens zu ihrer Maxime machten. Sir Isaac Newton (1643–1727), der Mann mit dem Apfel wurde zum Symbol für den phäno menalen Fortschritt der Wissenschaft in dieser Epoche.
Newton legte die Grundlagen der modernen Physik. Sein Hauptwerk Principia Mathematica gilt als eines der bedeu tendsten Werke der Wissenschaft. Was der Meister jedoch überhaupt nicht konnte, war, seine Lorbeeren zu teilen. Unser erstes Buch der Station führt uns mitten hinein in die damaligen Grabenkämpfe um Ruhm und Anerkennung, aus denen Newton als Gewinner und völlig verklärtes Genie hervorging.
Hatte Newton noch seine Peers und Förderer im Kopf, wenn er seine Werke formulierte, kam nach ihm ein neuer Schlag von Wissenschaftlern. Sie wollten die komplexen Regeln der Natur so ausdrücken, dass auch die einfachen Menschen sie verstanden. Zu ihnen gehörte James Ferguson, um dessen Erklärungen zu Newton es im zweiten Teil der Station geht.
Henry Pemberton: A view of Sir Isaac Newton’s philoso phy.
Erschienen in Dublin, 1728

1660 wurde in London die Royal Society gegründet. In der wissenschaftlichen Gesellschaft diskutierten einige der schlausten Köpfe des Landes ihre aktuellen Ideen. Ein enorm produkti ver Austausch entstand; England wurde ein Zentrum der Wissenschaften. Die Zusammenarbeit hatte allerdings zur Folge, dass viel stärker als zuvor disku tiert wurde, wer der wahre Urheber einer Entdeckung sei – eine Frage von Ruhm und finanziellem Einkom men.
Isaac Newton war seit 1672 Mitglied der Royal Society. Er und viele seiner Kollegen diskutierten da mals die Frage, wie man die von Kepler postulierten Gesetzmässigkeiten der Planetenbewegung mathe matisch beweisen könnte. Newton gelang der Durch bruch – und er sorgte mit
5.1 Superstar Newton –Verklärung in der Aufklärung
allen Mittel dafür, dass keiner von seinen wissen schaftlichen Diskussions partnern irgendeine Aner kennung dafür bekam. Nein, als angenehmer Mensch war Newton nicht bekannt. Dennoch hatte er viele Anhänger, und die verherr lichten Newton bald zu einem nie dagewesen Ge nie – ein Image, dass schnell ins kollektive Bewusstsein einging.
Newton, entrückt in himmlische Sphären. Titelblatt von Elements de la philosophie de Newton, 1738.

Ein Beispiel für die Verklä rung Newtons ist das 1728 erschienene Buch A View of Sir Isaac Newton’s Philoso phy von Henry Pemberton. Ein Jahr nach Newtons Tod bot dieses Werk Erklärungen der wichtigsten Erkenntnis se des Meisters: den Gravita tionsgesetzen, der Theorie des Lichts und der Infinitesi malrechnung. Pemberton wollte allerdings nicht nur Newtons Entdeckungen
vermitteln, sondern auch dessen vermeintlich einzigartiges Genie verherrlichen. Selbst Mitglied der Royal Society, war ein treuer Parteigänger Newtons. Sein Werk ist voll des über schwänglichen Lobs für Newton und verteidigt seinen schon damals um strittenen Charakter. Es beinhaltet beispielsweise ein zutiefst pathetisches Gedicht von Richard Glover, dass den verehrten Newton abgöttisch preist – und das auf ganzen 14 Seiten.

5.1 Superstar Newton –Verklärung in der Aufklärung
Pemberton verteidigte Newton bei einem beson ders strittigen Thema: Dem Zeitpunkt, zu dem er seine Entdeckungen machte. Schon Newton hatte darauf bestanden, dass er alle seine Ideen im wunderbaren Jahr 1666/67 gehabt habe. Er habe sie später nur weiter verfeinert – was nachweis lich nicht stimmt. Das Datum war mit Bedacht gewählt. Damals lebte Newton auf dem Land, fernab von jeder fremden Beeinflussung. Das richtete sich vor allem gegen Robert Hooke, der lautstark den Anspruch erhob, Newton einen entscheidenden Hinweis gegeben zu haben.

Diese Vordatierung ent schied auch den Prioritä tenstreit mit Leibniz wegen der fast zeitgleich entwickel ten Methode der Infinitesi malrechnung. Erst dadurch wurde die mathematische Ableitung der Gesetze Kep lers möglich. Leibniz hatte sein Buch dazu eindeutig vor Newton publiziert. Der unterstellte Leibniz, seine im Archiv der Royal Society aufbewahrten Ideen gestoh len zu haben. Newton nutz te rücksichtslos seine Positi on als Präsident der Royal Society, um seine Sichtweise zu verbreiten und so den Konkurrenten zu diskredi tieren, was der Karriere von Leibniz nachhaltig schadete.

Schon Zeitgenossen waren von diesem Vorgehen scho ckiert – ein Grund, warum die euphorische Verklärung Newtons auf dem Festland verhaltener ausfiel. Anders in Grossbritannien. Dort wurde Newton zu einem Aushängeschild der Nation stilisiert. In der Widmung an den Premierminister Robert Walpole und im Vorwort preiste Pemberton Newton als Stolz des ganzen Landes, dessen Ruhm Grossbritan nien Ansehen in der Welt verschaffe. Auch das ist ein Grund für Newtons Verklä rung: Er wurde zum Aushän geschild für den wissen schaftlichen Fortschritt Grossbritanniens.


Noch zu Lebzeiten konnte sich Newton an den materi ellen und immateriellen Vorteilen dieser Wertschät zung erfreuen. Der Mann aus ärmlichen Verhältnissen wurde Präsidenten der Royal Society, erhielt den Adelstitel und das einträgli che Amt des Wardein der königlichen Münzstätte. Sir Isaac Newton war der erste Wissenschaftler, der in der Westminster Abbey beige setzt wurde. Hier ruht er an einem der prominentesten Plätze der bedeutenden Kirche.


James Ferguson: Astronomy Exp lained Upon Sir Isaac Newton’s Principles, and made easy to those who have not stu died mathematics. Erstauflage, er schienen London 1756, im Eigenver lag des Verfassers.

5.2 Astronomie für alle
Newtons fragwürdiger Charakter und seine Verherrlichung ändern nichts daran, dass die in den Principia festgehaltenen Erkennt nisse tatsächlich bahnbrechend waren. Sie veränderten den menschlichen Blick auf das Ver hältnis zwischen Erde und Weltall grundlegend. Newton verband nämlich durch sein Gravitations gesetz erstmals Erde und Kosmos derart, dass es zwischen beiden Sphären keinen Unterschied mehr gab.
Newtons Arbeit wurde auch deshalb so bekannt, weil man den
Leuten ausführlich vermittelte, wie revolutionär sie sei. Denn selbsterklärend war das, was in den hochkomplexen Principia stand, keineswegs. Die interessier ten Bildungsbürger der Zeit besas sen daher statt der Principia Interpretationen anderer Autoren, die ihnen den neuesten Stand der Forschung auf leicht verständliche Art und Weise nahebrachten. Zu den bekanntesten Werken dieser Art gehört das von James Fergus son mit dem Titel Astronomy Explained Upon Sir Isaac New ton’s Principles.

5.2 Astronomie für alle
Ferguson (1710–1776) war selbst ein hervorragendes Beispiel für die neuen Bil dungsmöglichkeiten seiner Zeit. Der Schotte hatte seine Kindheit als Schafhirte verbracht und nur für drei Monate die Schule besucht. Später erkannte ein Förderer sein Talent für die Mechanik und stellte ihm seine Biblio thek zur Verfügung. Auf dieser Basis sollte es Fergu son bis zur Mitgliedschaft in der Royal Society bringen.
Seine Leidenschaft war es, den Menschen die Wunder der Astronomie zu vermit teln. Als das, was man heute Populärwissenschaftler nennen würde, hielt er gut besuchte Vorträge im gan zen Land. Mit Astronomy Explained Upon Sir Isaac Newton‘s Principles wollte er Newton für die verständ lich zu machen, die keine Mathematik studiert hatten, wie es im Titel heisst.

Auf den einführenden Seiten erklärt Ferguson die Grund lagen der Astronomie so komprimiert und einfach, dass ein Kind sie verstehen konnte. Sterne wirken so klein, weil sie weit weg sind, und wäre die Sonne ebenso weit weg von der Erde, würde sie uns genau so klein vorkommen. Da die Sterne unmöglich vom Licht unse rer Sonne beleuchtet sein
können, müssen sie selbst wie unsere Sonne Licht ausstrahlen. Auch sind die Sterne unvorstellbar weit voneinander entfernt. Schaut man durch ein Teleskop, kann man noch viel mehr Sterne sehen als mit dem blossen Auge –alles wichtige Grundlagen, die ein Newton sich nie herabgelassen hätte nieder zuschreiben.

In den Kapiteln selbst geht Ferguson ins Detail, bemüht sich aber stets, verständlich zu bleiben. Zur Veranschau lichung liefert er Illustratio nen wie diese, die einen Eindruck von Grösse, Ausse hen und Position der Plane ten in unserem Sonnensys tem vermittelt.

Ferguson wollte den Men schen helfen, sich den Lauf der Planeten exakt vorzu stellen. Zu diesem Zweck entwarf der talentierte Mechaniker Automaten, wie er sie auf dieser Seite abbil det. Bei seinen Vorträgen führte er die beweglichen mechanischen Modelle mit enormem Erfolg vor.


Joseph Wright of Derby: Ein Philo soph hält einen Vortrag über das Planetensystem, Gemälde von 1766.
Ein zeitgenössisches Gemäl de gibt uns einen Eindruck von der Wirkung, die diese Automaten auf die Men schen hatten. Die neuen Dimensionen, die sie vor sich ausgebreitet sahen, beflügelten die Fantasie. Wie sah es auf den anderen Planeten aus? Waren sie bewohnt? Könnte man sie gar eines Tages bereisen?

Als sich die Menschen beim Betrachten von Himmelsmodellen fragten, ob man diese Planeten eines Tages erreichen könnte, war der Gedanke nicht neu. Astronomen hatten sich das schon lang gefragt – erst nur für sich, später öffentlich. Wir zeigen Ihnen eines der ersten Bü cher, dass sich ernsthaft mit einer Reise zum Mond und seinen potentiellen Bewohnern auseinandersetzt. Dass die Reise ins All weit mehr ist als eine Frage des technischen Fortschritts, wurde klar, als der Mond nach dem 2. Weltkrieg in greifbare Nähe rückte. Auch wenn der Mond nicht bewohnt war, irgendwo im All mochte es in telligentes Leben geben. Und wie würde sich der Kontakt zwischen Menschen und Ausserirdischen gestalten? Würde die Menschheit durch das Eingreifen überlegener, ausser irdischer Zivilisationen das gleiche, schreckliche Schicksal erleiden, das die Einwohner der Kolonien getroffen hatte? Oder bot das Weltall eine Chance für einen Neuanfang, bei dem eine friedliche Menschheit sich vereint aufmachen würde, die Zusammenarbeit mit jedem exterrestrischen Leben zu suchen. Diese Frage konfrontiert uns mit unse rem eigenen Wesen, unseren Ängsten und unserer Ge schichte. Science Fiction Romane wie Die Mars Chroniken dokumentieren das Ringen um eine Antwort.
John Wilkins: Ver teidiger Coperni cus, oder curioser und gründlicher Beweiss der Copernicanischen Grunsätze, in zweyen Theilen. Erschienen Leip zig bei Peter Con rad Monath 1713, erstmals veröf fentlicht 1638

Der deutlich am Nachthimmel stehende Mond regte die Fantasie der Menschen seit jeher an. Der erste, dessen Beschreibung einer Reise zum Mond wir besitzen, war Lukian von Samosata, der im 2. Jahrhundert n. Chr. seine Wahren Geschichten schrieb. Dies bedeutet nicht, dass Lukian diese Reise für möglich hielt. Sie galt ihm als Inbegriff des Unmöglichen. Sein Buch war eine Satire.
Die Astronomen des 17. Jahr hunderts verfolgten die Idee einer Mondreise dagegen ernsthaft. Für sie war der Mond kein Teil einer entrückten göttlichen Sphäre, sondern schlicht ein weiterer Himmelskörper. Und als solcher liess er sich theoretisch bereisen –auch wenn es in der Praxis unzäh lige Hindernisse gab.
Schon Johannes Kepler machte sich Gedanken über eine Reise zum Mond, und ob auf ihm Leben existiert. Veröffentlicht hat er diese Überlegungen nie. Das war viel zu riskant in einer Zeit, in der die Kirche nicht einmal bereit war, die Erde aus der Mitte des Kosmos zu setzen.
6.1 Die Reise zum Mond
Lukian schrieb von Riesenspinnen, die Netze zwischen den Planeten zie hen. Illustration von 1894.

1638 veröffentlichte ein anonymer englischer Autor eine aufsehener regende Schrift zum Thema Mond. Die landete natürlich auf dem päpstlichen Index, aber in seiner Heimat interessierte das kaum jemanden. Als der Text 1713 erst mals auf deutsch erschien – wir zeigen hier die deutsche Erstaus gabe – gab es keinen Grund, den Namen des Autoren John Wilkins zu verheimlichen. Der war kein weltfremder Fantast: Der anglika nische Bischof gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Royal Society und ist bis heute der Ein zige, die sowohl in Oxford als auch in Cambridge ein College leitete. Inspiriert von Fantasie-Roma nen seiner Zeit dachte er Keplers Ideen weiter: Wilkins verteidigte den Heliozentrismus und argu mentierte, dass der Mond be wohnt sei.
Wilkins meinte, dass die Erde und der Mond sich sehr ähnlich seien. Er ging davon aus, dass die Flecken des Monds Ozeane seien und dass der Mond wie die Erde eine Atmosphäre habe, samt Wind und Regen. Wegen der Ähnlichkeit beider Planeten sei es wahr scheinlich, dass auf dem Mond ebenfalls Leben existiere. Wie die Bewohner aussähen, darüber liesse sich freilich nur spekulieren.





Abschliessend erörtert Wilkins die Möglichkeit, «dass einige unserer Nachkommen ein Mittel ausfinden dörfften, wie man in dieser anderer Welt gelangen» könnte und, falls es Einwohner gäbe, «eine Bekand schaft mit denselben haben möge.» Wie man genau zu Mond fliegen könne, konnte er natürlich nicht angeben. Dennoch legt Wilkins einen wunderbaren Optimismus an den Tag: «Wenn wir genauer erwägen wie durchgehends alle Künste immer mehr und mehr empor steigen, so sollen wir fast nicht mehr zweifelen, dass dieses [= das Wissen, wie man zum Mond gelangt] unter anderen secretis auch mit der Zeit ausgefunden werden möge. Es hat jederzeit die göttliche Vorsehung diese Art an sich gehabt, dass sie uns eben nicht alles zugleich entdeckt, sondern dass sie uns bishero allgemacht von der Erkändtniss eines Dinges zu dem anderen geführtet.» Eine Begegnung mit den Mondmen schen sei also nur eine Frage der Zeit.
Im Jahr 1835 sah es kurz so aus, als würde Wilkins bezüglich der Mondbewoh ner recht behalten. Weltweit berichteten die Zeitungen, ein Astronom hätte mit einem neuartigen Teleskop Mondbewohner entdeckt, die wie eine Mischung aus Menschen und Fledermäu sen aussähen. Hier sehen wir eine Illustration aus der New York Sun, die als erstes über die Entdeckung berich tete – und Urheber der Ente war. Nichtsdestotrotz glaub ten einige Wochen lang viele Zeitungsleser an ein Leben auf dem Mond.


Jules Verne: Von der Erde zum Mond, Erstveröf fentlichung 1865
Bei den unglaublichen Fortschritten, die die Menschheit im 19. Jahrhun dert machte, stellte sich manch einer gern vor, was man alles noch erreichen werde. Es entstand ein literarisches Genre, das wir heute als Science-Fiction bezeichnen. Zwar gab es schon früher Geschichten über die Möglichkeiten der Zukunft, doch Jules Verne schuf etwas Neues: Er nutzte eine spannende Handlung, um in ihr die neuesten wissenschaftlichen Erkennt nisse didaktisch aufzuberei ten. Das Infotainment des 19. Jahrhunderts. Und so können sich seine Fans noch heute darüber freuen, dass Jules Verne bereits vieles vorweggenommen hat, auch in seinem Roman Von der Erde zum Mond .

Ray Bradbury: The Martian Chronicles. Erschienen bei Limited Editions Club in Avon, 1974. Erstausgabe von 1950.

6.2 Wir kommen in Frieden – oder?
«Erdaufgang», Foto von 1968.
War die Reise zum Mond vor dem 2. Weltkrieg eine Utopie gewesen, zeichnete sich danach ihre technische Machbarkeit ab. Während Regierungen der Sowjets und Amerikaner die ersten Menschen ins All brachten, bewegte ihre Bürger eine andere Frage: Wenn man «da draussen» wirklich auf Ausserirdische träfe, wie würde das Verhältnis mit ihnen aussehen? Würden sie uns unterwerfen – oder doch wir sie? Oder wäre eine friedliche Koexistenz mög lich? Dieses Thema trieb die Autoren des boomenden Science-Fiction-Genres seit den 1950er Jahren um und führte beim Blick in die Zukunft gleichzeitig tief in unsere Geschichte.

Ausgaben der Planet Stories von 1946 und 1953 mit Geschichten von Ray Bradbury


Ein hervorragendes Beispiel dafür sind die Mars-Chro niken von Ray Bradbury (1920–2012). Sie sind eine Sammlung von Geschichten, die Bradbury zwischen 1946 und 1950 in verschie denen der beliebten Zeit schriften-Reihen der Zeit veröffentlichte. Auf deren Titelseiten müssen zwar meistens spärlich bekleidete Damen von ausserirdischen Monstern gerettet werden, aber unabhängig davon sind
Bradburys Geschichten sehr tiefgründig. Immer wieder zu erkennen sind dabei die Parallelen zur Kolonialisie rung Amerikas. In seinen lose zusammenhängenden Episoden brechen die Men schen im fernen Jahr 2000 zum Mars auf und treffen dort auf die Einheimischen. Eine wechselvolle Geschich te beginnt, in denen Hoff nungen aufblühen und meist enttäuscht werden: Krankheiten und Kriege wüten, die Marsianer wer den ausgerottet, eine Kolo nie wird errichtet, wieder verlassen und dient doch als letzte Zuflucht der Mensch heit nach der Zerstörung der Erde.
Bradbury erhielt für die Mars-Chroniken zahlreiche Auszeichnungen und hat bis heute eine treue Fangemein de. Unsere Fassung entstand 1972 als Sammlerausgabe, mit einer Auflage von 2000 Exemplaren. Sie ist spekta kulär von Joseph Mugnaini illustriert und von Bradbury und dem Künstler signiert.

6.2 Wir kommen in Frieden – oder?
König Prempeh I. der Ashanti unter wirft sich den Briten, kolorierter Stich von 1896.
Nichts integriert besser die aktuelle Geschichte, als Romane, die über die Zu kunft reflektieren. Bradbury verarbeitete die Auseinan dersetzungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg über die Entkolonialisierung Asiens und Afrikas entstanden. Er schildert in seinen Marschroniken exakt die gleichen Typen, die er in seiner eigenen Zeit beim Umgang mit unterlegenen Kulturen beobachtete. Das Ergebnis ist eine Dystopie mit einem Hoffnungsschimmer: Die Marsianer sind ausgerottet, die Erde durch einen Atom krieg zerstört, die letzten Erdbewohner werden zu den neuen Marsianern.

Die Mars-Chroniken sind nur ein Beispiel für unzählige Romane, Filme und Fernsehserien, die sich mit der Frage beschäftigen, wie unsere Zukunft im Weltall ausse hen könnte. Ein weiteres spannen des Beispiel ist die Kultserie Star Trek von Gene Roddenberry. In der Welt von Star Trek sind Rassis mus, Nationalismus, Krieg, Hunger und Armut überwunden. Die Menschheit lebt friedlich vereint: auf der Brücke das Enterprise arbeiten Menschen aller Hautfar ben und Nationen. Die Mensch heit strebt die friedliche Zusam menarbeit mit anderen Spezies an. Dabei baute Roddenberry gezielt ausserirdische Kulturen ein, die unserem Egoismus einen Spiegel vorhielten. Wie ideologisch und gleichzeitig utopisch Star Trek ist, ist vielen nicht bewusst.


6.2 Wir kommen in Frieden – oder?
Schauspieler der Serie Star Trek vor dem NASA Shuttle Enterprise, be nannt nach «ih rem» Schiff. Foto von 1976.

Angesichts der Umweltprob leme verlor die Science Ficti on in den 1980er Jahren ihren Optimismus. Technik wurde mehr und mehr als Gefahr begriffen. Und so wichen die Hochglanz-Kor ridore der Enterprise herun tergekommenen Szenerien wie in Alien, Blade Runner und Terminator. Selbst Star Trek führte eine neue Bedro hung ein, ein hochtechnolo gisiertes Cyborg-Kollektiv, das seinen Opfern jede Menschlichkeit, jede Indivi dualität raubt.
Eine entmenschlichte «Borg Drohne» aus Star Trek: The Next Generation. Foto: Mar cin Wichary – CC BY 2.0

Und damit sind wir im hier und jetzt angelangt. Wo stehen wir heute? Das Thema Raumfahrt scheint momentan für kaum noch jemanden eine Rolle zu spielen. Öffentlich wahrnehmbar sind höchstens die Versuche von Elon Musks Privaten SpaceX-Initiative, den Mars zu erreichen – bisher eher mit mässigem Erfolg. Es scheint, als wären wir zurzeit eher auf unsere Erde und ihre Probleme fokussiert, statt hoffnungsvoll von den Sternen zu träumen – zurecht? Haben wir die Hoffnung auf eine bessere Zukunft in den Sternen verloren? Werden wir je in Kontakt mit extraterrestrischem Leben kommen, und wie werden wir mit ihm umgehen? Wird es uns gelin gen, als vereinte Menschheit ins All aufzubrechen, wie es sich die Science-Fiction-Autoren erträumt haben?
Das Team des MoneyMuseums freut sich, mit Ihnen über diese Themen zu diskutieren.
