27. April 2025
18:00 Uhr, Mittlerer Saal

27. April 2025
18:00 Uhr, Mittlerer Saal
Kammermusik IV
Saison 24–25
Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

So, 11. Mai 2025, 11:00
Großer Saal
Sabaini & Philharmonices mundi
Josef Sabaini und seine Philharmonices mundi zeigen mit Werken von Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart und Benjamin Britten, wie vielfältig die Form der Symphonie klingen kann.
Di, 27. Mai 2025, 19:30
Großer Saal
Gražinytė-Tyla, Kopatchinskaja & Orchestre Philharmonique de Radio France
Das Orchestre Philharmonique de Radio France und Mirga
Gražinytė-Tyla gastieren mit Werken von Joseph Haydn, Lili Boulanger und Richard Strauss sowie Alban Bergs Violinkonzert »Dem Andenken eines Engels«, gespielt von Patricia Kopatchinskaja.
Mi, 25. Jun 2025, 19:30
Großer Saal
Damrau, Kaufmann & Deutsch
Ein Liederabend der Superlative: Mit Diana Damrau und Jonas Kaufmann geben sich zwei Weltstars die Ehre. Begleitet werden sie am Klavier von Helmut Deutsch.
Das Programm auf einen Blick
Glanzvoller könnte die Reihe Kammermusik in dieser Saison wohl kaum beschlossen werden: Das Belcea Quartet feiert sein langersehntes Debüt am Brucknerhaus Linz! Und nicht minder prachtvoll ist auch das Programm, das mit Wolfgang Amadé Mozarts ›Hoffmeister‹-Quartett, Ludwig van Beethovens drittem ›Rasumowsky‹Quartett und Benjamin Brittens ergreifendem 3. Streichquartett drei absolute Meisterwerke der Quartettliteratur beinhaltet. Die Werke stellen dabei auch drei Marksteine im Schaffen der jeweiligen Komponisten dar: Während Beethoven mit seinem 9. Streichquartett gewissermaßen der Durchbruch zu seinem reifen Personalstil gelang, etablierte sich Mozart mit seinem ›Hoffmeister‹-Quartett zwanzig Jahre zuvor als wichtigster Komponist Wiens neben Joseph Haydn. Britten wiederum schuf mit seinem 3. Quartett wenige Monate vor seinem Tod sein letztes vollendetes Instrumentalwerk überhaupt.
Belcea Quartet
Corina Belcea | Violine
Suyeon Kang | Violine
Krzysztof Chorzelski | Viola
Antoine Lederlin | Violoncello
Brucknerhaus-Debüt
Wolfgang Amadé Mozart 1756–1791
Streichquartett Nr. 20 D-Dur KV 499 ›Hoffmeister‹ // 1786
I Allegretto
II Menuetto. Allegretto – Trio
III Adagio
IV Allegro
Benjamin Britten 1913–1976
Streichquartett Nr. 3 op. 94 // 1975
I Duets. With moderato movement
II Ostinato. Very fast
III Solo. Very calm
IV Burlesque. Fast, con fuoco – Quasi Trio
V Recitative and Passacaglia (La Serenissima). Slow – Slowly moving
// Pause //
Ludwig van Beethoven 1770–1827
Streichquartett Nr. 9 C-Dur op. 59, Nr. 3 ›Rasumowsky‹ // 1806
I Introduzione. Andante con moto – Allegro vivace
II Andante con moto quasi Allegretto
III Menuetto grazioso – Trio –
IV Allegro molto
Konzertende ca. 20:00 Uhr
Wolfgang Amadé Mozart // Streichquartett Nr. 20 D-Dur
Als Wolfgang Amadé Mozart sich 1785 zum ersten Mal der Gattung des Klavierquartetts zuwandte, geschah das auf Anstoß des Wiener Verlegers Franz Anton Hoffmeister, der beim Komponisten eine Serie von drei Werken für die Besetzung Klavier, Violine, Viola und Violoncello in Auftrag gegeben hatte. Als Mozarts erstes Klavierquartett g-Moll KV 478 nur mäßigen Absatz fand, was wohl vor allem auf die hohen spieltechnischen Anforderungen sowie die für das Wiener Musikleben bis dato weitgehend unbekannte Gattung zurückzuführen sein dürfte, trat Hoffmeister von der Veröffentlichung des im Juni 1786 vollendeten 2. Klavierquartetts Es-Dur KV 493 zurück, zu einem Zeitpunkt jedoch, an dem Teile der Partitur bereits in Kupfer gestochen vorlagen. Kurzerhand verkaufte der um kaufmännische Kniffe nicht verlegene Hoffmeister die Druckplatten an den konkurrierenden Verlag Artaria & Co., bei dem das Stück im Sommer 1787 erschien. Das geplante dritte Klavierquartett erblickte vor diesem Hintergrund nie das Licht der Welt, Hoffmeister, der Mozart in jenen Tagen immer wieder finanziell unter die Arme griff, schenkte dem Komponisten den Vorschuss. Ob das nur wenige Wochen nach Abschluss des

Beginn des Streichquartetts Nr. 20 D-Dur KV 499 in Mozarts Handschrift, 1786
2. Klavierquar tetts komponierte Streichquartett Nr. 20 D-Dur als ›Ersatz‹ für das entfallene dritte Klavierquar tett entstand, lässt sich heute nicht eindeutig belegen.
Erstaunlich ist jedenfalls, dass Hoffmeister das Stück gleichzeitig mit Joseph Haydns Streichquartett d-Moll Hob. III:43 entgegen der Konvention, Quartette in Dreier- oder Sechsergruppen zu publizieren, als Einzelwerk herausgab. Der verlegerische Aspekt liegt auf der Hand, hatte Mozart doch eineinhalb Jahre zuvor Haydn seine sechs Quartette KV 387, 421, 428, 458, 464 und 465 gewidmet und sich dem großen Vorbild darin als mindestens ebenbürtig erweisen. Der Plan Hoffmeisters, die Aufmerksamkeit

»liebster Hofmeister! –Ich nehme meine zuflucht zu ihnen, und bitte sie, mir unterdessen nur mit etwas gelde beÿzustehen, da ich es in diesem augenblick sehr nothwendig brauche. […] verzeihen sie daß ich sie immer überlästige, allein da sie mich kennen, und wissen wie sehr es mir daran liegt daß ihre sachen gut gehen möchten, so bin ich auch ganz überzeugt daß sie mir meine zudringlichkeit nicht übel nemmen werden, sondern mir eben so gerne behülflich seÿn werden, als ich ihnen.«
Woflgang Amadé Mozart am 20. November 1785 an Franz Anton Hoffmeister
des Publikums durch die zeitgleiche Veröffentlichung zweier Werke der beiden führenden Komponisten Wiens zu gewinnen, erwies sich als geschickter Schachzug, der den Misserfolg der beiden Klavierquartette mehr als wettmachte.
Chromatische und mediantische Modulationen
Überleitungen in andere Tonarten durch Halbtonschritte (Chromatik) oder durch um eine Terz, i. e. drei Töne, entfernte Klänge (Mediantik)
triolisch
Einteilung eines Notenwerts in drei kleinere Notenwerte
duolisch
Einteilung eines Notenwerts in zwei kleinere Notenwerte
Wie eine Verneigung vor dem Vorbild Haydn erscheint der Beginn des Allegrettos, dessen unisono vorgestellte Hauptmelodie sich fast monothematisch durch den Satz zieht, sodass die einzelnen Formenteile ineinanderzufließen scheinen. Die Art und Weise der Verarbeitung dieses Themas, das Mozart durch chromatische und mediantische Modulationen in entlegene Tonarten und Stimmungen führt, betritt hingegen schon weitaus ›romantischere‹ Gefilde in Vorausahnung Ludwig van Beethovens und Franz Schuberts. Das anschließende Menuett hat nur wenig mit dem gediegenen Gesellschaftstanz jener Zeit gemein. Fast scheint es, als würde jede der vier Stimmen mit komplex verschachtelter Melodik und rhythmischen Verschiebungen ihre eigene Schrittfolge aufs Parkett bringen. Ein Konflikt, der sich im nach Moll getrübten Mittelteil –Trio genannt – in einem musikalischen Disput entlädt, bei dem sich die vier Instrumente regelrecht ins Wort fallen. Diese Stimmung unaufgelöster Spannung führt Mozart auch im Adagio fort, dessen zwischen tiefer und hoher Lage alternierende Melodiebögen wie Suchende inmitten eines bedrückenden harmonischen Klangpanoramas wirken. Im Finale finden die Gegensätze schließlich zusammen, wenn die abwechselnd triolischen und duolischen Themen im Verlauf des Satzes miteinander verschränkt und in fast theatraler Dramatik ›in Einklang‹ gebracht werden. Eine Klangsprache, die nicht zufällig an die Schlusszeilen von Mozarts unmittelbar vor Komposition des Quartetts uraufgeführter Oper Le nozze di Figaro erinnert: »Alles, was an diesem Tage / uns verwirrte, uns betrübte, / kann allein die Liebe wandeln / in Vertraun und Freudigkeit.«
Benjamin Britten // Streichquartett Nr. 3 op. 94
Benjamin Britten war bereits schwer von Krankheit gezeichnet, als er 1975 sein Streichquartett Nr. 3 op. 94 vollendete. Obwohl er bereits seit vielen Jahren an einer Aortenklappeninsuffizienz litt, hatte er sich 1970 der gewaltigen Aufgabe gestellt, mit Death in Venice – basierend auf Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig – ein letztes großes Opernprojekt in Angriff zu nehmen, ehe er sich der längst überfälligen Operation unterzog. »Ich wollte dieses Werk mit aller Leidenschaft vollenden, bevor etwas passierte«, erklärte er 1974. »Ich musste weitermachen und mich dann, als ich es vollendet hatte, in die Hände der Ärzte begeben.« Nur durch die regelmäßige Einnahme starker Medikamente gelang es ihm letztlich, das Werk 1973 fertigzustellen, nachdem sein Lebensgefährte Peter Pears, dem Britten die Titelrolle des Gustav von Aschenbach auf den Leib schrieb, bereits zuvor gewarnt hatte: »Ben schreibt eine bösartige Oper, und sie bringt ihn um.« Schien die drohende Lebensgefahr durch die anschließende Operation zwar abgewendet, so verschlechterte sich Brittens Gesundheitszustand in den folgenden Monaten dennoch zusehends, aufgrund von Lähmungserscheinungen seiner rechten Hand konnte er nicht länger als Pianist und Dirigent auftreten und war schon bald auf einen Rollstuhl angewiesen. Nun also wandte er sich im Oktober 1975, 30 Jahre nach seinem letzten Beitrag zur Gattung, noch einmal dem Streichquartett zu. Während er die ersten vier Sätze seines dritten Quartetts im heimischen Suffolk schrieb, begab er sich für die
»Musik ist für mich Aufklärung; ich versuche zu klären, zu verfeinern, zu sensibilisieren.
Strawinski hat einmal gesagt, dass man ständig an seiner Technik arbeiten müsse. Aber was ist Technik? Schönbergs Technik ist oft die einer enormen Ausarbeitung. Meine Technik ist es, alles Unnütze wegzureißen; vollkommene Klarheit des Ausdrucks zu erreichen, das ist mein Ziel.«
Benjamin Britten im Gespräch mit dem Komponisten Raymond Murray Schafer, 1963
Vollendung des fünften Satzes ein letztes Mal nach Venedig, jene Stadt, die ihn seit vielen Jahren in ihren Bann gezogen und der er mit seiner Oper ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt hatte. Während der Musikkritiker Michael Kennedy Brittens 3. Streichquartett als »das bedeutendste aller Britten-Werke und eines der größten Streichquartette eines Jahrhunderts, das viele Meisterwerke dieses Genres hervorgebracht hat« bezeichnete, hob Peter Pears nach der öffentlichen Uraufführung durch das Amadeus Quartet am 19. Dezember 1976, kaum mehr als zwei Wochen nach Brittens Tod, dessen »tiefe Schönheit« hervor, »die einen mehr als alles andere berührt, leuchtend, weise, neu, geheimnisvoll – überwältigend«.
Tremolo
schnelle Wiederholung eines einzelnen Tons oder rasches Wechseln zwischen zwei Tönen oder Akkorden
Der Kopfsatz hebt mit einem musikalischen Dialog an, dessen satzbestimmendes Element durch die Überschrift Duets (Duette) verdeutlicht wird. Gleich in sich verschlungenen Tänzerinnen, suchend, flüsternd, sich berührend, umkreisen sich die Instrumente in eng verwobenen Sekundschritten, deren mehrdeutige Tonalität immer den Charakter des Fragenden, des Unaufgelösten in sich trägt. Nach einer hektischen Steigerungspassage, welche die wogenden Triolenfiguren des Beginns in raue Tremoli auflöst, führt ein kurzes Solo der 1. Violine in eine ruhige Coda, die sich nach einem letzten dynamischen Aufbäumen in einem ätherischen Akkord auflöst –noch einmal erhellt er die nebulöse Klangwelt des Satzes wie ein schwacher Lichtschein, ehe er verlischt. Im Angesicht des hier komponierten Verstummens wirkt das urplötzlich hereinbrechende Ostinato geradezu schockierend. Wild irrlichternde Melodiesprünge, deren motivische Blöcke sich verschränken, spiegeln und zersetzen, erzeugen im Verbund mit hektischen Rhythmen ein fast chaotisches Klangbild, dessen tragikomische Nervosität nur für kurze Zeit unter dem fahlen Schleier des Mittelteils verschwindet. Der einsam über den Notenlinien schwebende Gesang der 1. Violine im mit Solo betitelten dritten Satz wurde von Britten bewusst für den klaren, expressiven Ton Norbert Brainins, Primgeiger des Amadeus Quartets, komponiert. Frei und improvisatorisch singt das Instrument sein Lied, das der Komponist im Garten seines Hauses in Horham einem Vogel abgelauscht hatte und wird dabei im Mittelteil mit rhythmisch freien Pizzicati der 2. Violine, Triolenbewegungen der Viola und wogenden Glissandi des Violoncellos von einer ganzen Schar gefiederter Artgenossen begleitet.

Benjamin Britten auf dem Balkon des Hotel Danieli während seines letzten Venedig-Aufenthalts im November 1975
Wie der zweite Satz, so ist auch die an vierter Stelle stehende Burlesque im größtmöglichen Kontrast zur arkadischen Stimmung des Vorhergehenden konzipiert. Mit bizarren Klangeffekten, martialisch gehämmerten Akkordblöcken und scheinbar wahllos verstreuten Melodiefragmenten, die sich schließlich sogar an der Karikatur einer Fuge versuchen, entblößt Britten die Fratze des Dämonischen, wobei er sich nicht zuletzt mit der Wahl des Titels sowie der Tonart a-Moll auf die Rondo-Burleske des dritten Satzes von Gustav Mahlers Symphonie Nr. 9 – einem weiteren ›letzten Werk‹ – bezog. Der Titel des Schlusssatzes, La Serenissima, verweist schließlich auf Venedig. Im einleitenden Recitative zitiert er verschiedene Motive seiner Oper Death in Venice, etwa zu Beginn jene die Gondelfahrt auf dem Lido symbolisierenden Wellenbewegungen sowie das verzweifelte »I love you«, das der todkranke Gustav von Aschenbach dem angebeteten Knaben Tadzio nachruft. Über einer schlichten Melodie des Violoncellos, dem Klang der Glocken der venezianischen Kirche Santa Maria della Salute nachempfunden, die einmal jährlich am 21. November läuten, um der ›Befreiung‹ von der Pest im Jahre 1631 zu gedenken –
der 21. November ist dabei nicht nur der Todestag Henry Purcells, den Britten bewunderte und an dessen Werken er auch die Form der Passacaglia studierte, sondern gleichzeitig der Vorabend von Brittens eigenem Geburtstag –, entfaltet sich ein innig singendes, wiegenliedartiges Thema, das kanonisch durch alle Stimmen geführt wird und zuletzt in ätherische Höhen zu entschweben scheint, ehe die Musik in den letzten Takten wieder in irdische Sphären hinabsinkt. Noch einmal intoniert das Violoncello das Glockenthema, dessen finaler Ton nunmehr jedoch vom E zum D gewandelt ist und so den letzten Takt mit einer unaufgelösten Harmonie beschließt. D wie ›Death‹? »Ich möchte, dass das Werk mit einer Frage endet« (Britten).
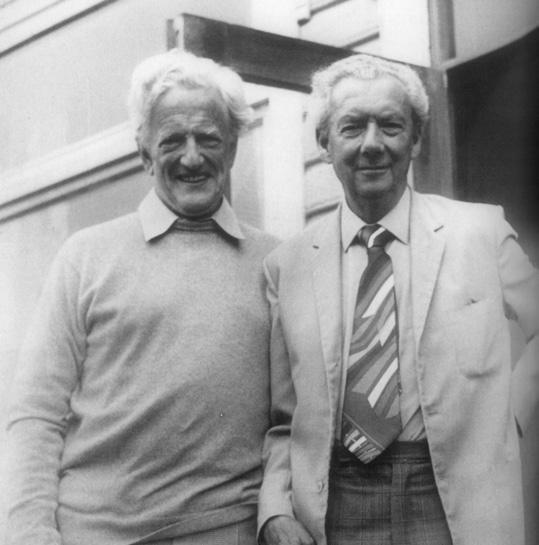
Ludwig van Beethoven // Streichquartett Nr. 9 C-Dur
»Eben so wie Du Dich hier in den Strudel der Gesellschaft stürzest, eben so möglich ist’s Opern trotz allen gesellschaftlichen Hindernissen zu schreiben. Kein Geheimniß sey Dein Nichthören mehr – auch bey der Kunst.« Mit diesen Worten sprach sich Ludwig van Beethoven auf einem Skizzenblatt zu seinen drei Quartetten op. 59 neuen Mut zu, nachdem ihn seine fortschreitende Ertaubung immer weiter in gesellschaftliche Isolation und bis hin zu Suizidgedanken getrieben hatte, wovon das bekannte ›Heiligenstädter Testament‹ des Jahres 1802 eindrücklich Zeugnis gibt. Auch aufgrund seines körperlichen und seelischen Leidens war Beethoven an einem Wendepunkt seines kompositorischen Schaffens angelangt: »Ich bin nur wenig zufrieden mit meinen bisherigen Arbeiten. Von heute an will ich einen neuen Weg einschlagen.« Zahlreiche Briefe, Dokumente und Berichte aus jener Zeit zeichnen das Bild eines Komponisten, der sich mit seiner 1. Symphonie, virtuosen Klaviersonaten und den aufsehenerregenden Streichquartetten op. 18 bereits einen Namen im Wiener Konzertleben gemacht hatte und nun kurz davor stand, all diese Gattungen zu neuen, ungeahnten Höhen zu führen.
Im Winter 1804 veranstaltete der Geiger Ignaz Schuppanzigh mit seinem Quartett erstmals öffentlich zugängliche Abonnementkonzerte, durch die der Besuch von Streichquartettaufführungen nicht länger der Klientel adeliger Salons vorbehalten war. Über die zunächst in einem Privathaus im Heiligenkreuzerhof, dann im Saal des Hotels Zum römischen Kaiser stattfindenden Aufführungen schrieb Eduard Hanslick 1869 in seiner Geschichte des Concertwesens in Wien: »Die Virtuosen ließen sich (öffentlich) zum Quartettspiel nicht herab, die Dilettanten wagten sich damit an die Oeffentlichkeit nicht hinauf; das Publicum endlich, an ein bunteres, effectvolleres Concertgenre gewöhnt, empfand lange Zeit nach öffentlichen Kammermusiken keinerlei Sehnsucht. Ja, bei dem großen Publicum stand die Quartettmusik als kalt, finster und gelehrt in einigem Verruf. […] Erst als der Ruf von Schuppanzigh’s Meisterschaft im Quartettspiel sich
van Beethoven //
verbreitete, fühlte auch das große Publicum in Wien den Wunsch, davon zu profitiren.« Beethoven hatte Schuppanzigh und dessen Quartett schon im Palais des Fürsten Karl Lichnowsky kennengelernt und in dem Geiger den idealen Partner für seinen »neuen Weg« gefunden. Dem heiteren Naturell und der mit den Jahren immer weiter zunehmenden Körperfülle seines Freundes setzte er auf der letzten Seite des Autographs seiner Klaviersonate Nr. 15 op. 28 mit einem Lob auf den Dicken betitelten musikalischen Scherz ein Denkmal: »Schuppanzigh ist ein Lump / wer kennt ihn nicht / den dicken Saumagen, den aufgeblasnen Eselskopf / o Lump, o Esel, wir stimmen alle ein / Du bist der größte Esel / Hi-hi-ha«. Im Jahr 1805 erhielt Beethoven, der sich zu dieser Zeit bereits mit der Konzeption neuer Werke beschäftigte, von Graf Andrei Rasumowsky den Auftrag, drei Streichquartette zu schreiben. Der russische Gesandte war einer der bedeutendsten Kunstmäzene am Wiener Hof und verpflichtete ab 1808 auch das Schuppanzigh-Quartett gegen eine lebenslange Pension für seine Dienste – wobei er anfangs gar als zweiter Geiger mitwirkte, ehe er »diesen letzten Rest dilettantischen Egoismus« (Hanslick) aufgab. Unter derlei günstigen Voraussetzungen und mit dem inneren Drang, sich neue Ausdrucksformen zu erschließen, gelang Beethoven mit den drei ›Rasumowsky‹-Quartetten eine bis dato ungehörte Symbiose von formaler Spannung und melodischer Expressivität.
Als einziges der drei Quartette op. 59 beginnt das Streichquartett Nr. 9 C-Dur – das zugleich kürzeste und konziseste der Trias – mit einer langsamen Einleitung. Ein Rückgriff auf die Tradition? Diesen Eindruck wischt Beethoven schon mit dem einleitenden verminderten Septakkord im schneidenden Forte vom Tisch, dem darüber hinaus keine Aufl ösung im klassischen Sinn, sondern eine Serie weiterer Septakkorde folgt. Und auch der Beginn des anschließenden Allegro vivace hält nicht, was die Tradition verspricht: So hebt nach einem erwartungsvollen Auftakt aller vier Stimmen ein floskelhaft auf und ab tänzelndes Solo der 1. Violine an, das sich auch durch einen zweiten, nun noch energischer vorgetragenen Auftakt nicht einfangen lässt. Erst nach einer vom Pianissimo ins Forte gesteigerten, fast gewaltsam wieder in die Grundtonart C-Dur gerückten Kadenz dürfen die anderen drei Instrumente miteinstimmen. Für das melancholische, über gleichmäßig schreitenden Pizzicati des Violoncellos singende Thema des zweiten Satzes griff Beethoven möglicherweise,
Ludwig
van Beethoven // Streichquartett Nr. 9 C-Dur

Ludwig van Beethoven, Porträt von Willibrord Joseph Mähler, 1804–05
wie im Fall der beiden anderen ›Rasumowsky‹-Quartetten nachgewiesen, auf eine russische Volksliedmelodie zurück. Der schwermütige, einzig im nach Dur aufgehellten Mittelteil durchbrochene Gestus wird durch chromatische Seufzerfiguren und schmerzhaft aufschreiende Sforzati noch verstärkt. Dagegen wirkt das ›grazioso‹ zum Tanz aufspielende Menuett wie ein verklärender Blick zurück in die höfische Musikkultur des 18. Jahrhunderts, in deren Behaglichkeit der attacca, ohne Pause, anschließende Finalsatz mit seinem im halsbrecherischen Tempo vorgetragenen Fugato hereinbricht und das Werk – und damit gleichsam die Trias der ›Rasumowsky‹-Quartette – mit einer ausgedehnten, fulminant gesteigerten Coda beschließt.
Andreas Meier
Leidenschaft, gepaart mit Präzision, unerhörter Expressivität und purer Emotionalität zeichnet das Belcea Quartet aus. Mit der rumänischen Violinistin Corina Belcea, der koreanisch-australischen Geigerin Suyeon Kang, dem polnischen Bratschisten Krzysztof Chorzelski und dem französischen Cellisten Antoine Lederlin treffen vier unterschiedliche künstlerische Herkünfte aufeinander und vereinen sich zu einzigartiger Exzellenz. Die große Bandbreite ihres Repertoires reicht von Mozart, Beethoven, Bartók, Janáček bis Szymanowski. Außerdem stellen sie dem Publikum immer wieder neue Werke von aktuellen Komponisten wie Julian Anderson, Guillaume Connesson, Joseph Phibbs, Krzysztof Penderecki, Thomas Larcher und Mark-Anthony Turnage vor. Neben den Gesamtaufnahmen der Streichquartette von Bartók, Beethoven, Brahms und Britten kann das Quartett auf Aufnahmen von Werken Bergs, Dutilleuxs, Mozarts, Schönbergs, Schuberts, Schostakowitschs,

Janáčeks und Ligetis verweisen. 2022 erschienen die beiden BrahmsStreichsextette zusammen mit Tabea Zimmermann und Jean-Guihen Queyras. Von 2017 bis 2020 war das Belcea Quartet Ensemble in Residence im Pierre Boulez Saal in Berlin. Seitdem tritt es dort regelmäßig auf. Darüber hinaus ist es seit 2010 Teil einer geteilten Streichquartettreihe im Wiener Konzerthaus, seit der Saison 2021/22 gemeinsam mit dem Quatuor Ébène. Konzerte werden das Belcea Quartet in dieser Saison in renommierte Häuser wie das Konserthuset Stockholm, die Wigmore Hall in London, das Théâtre des Champs- Elysées oder das Flagey in Brüssel bringen. Ein besonderes Highlight ist die Oktett-Tour mit dem Quatuor Ébène durch Nord- und Südamerika und Asien, bei der sie unter anderem in der Carnegie Hall in New York, im Teatro Cultura Artística in São Paulo und in der Grand Hall des Lee Shau Kee Lecture Centre in Hong Kong gastieren.

Impressum
Herausgeberin
Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz
Redaktion
Andreas Meier
Biografie & Lektorat
Romana Gillesberger
Gestaltung
Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer
Abbildungen
J. Wesely (S. 2), gemeinfrei (S. 6–7), W. Serveas (S. 11), H. H. Rowe (S. 12), Wien Museum (S. 15), M. Haas (S. 16–17)
Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten
LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz
Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Werke von Mozart, Liszt und Beethoven

VERANSTALTUNGSORT UND KARTEN
Brucknerhaus Linz · Untere Donaulände 7 · 4010 Linz +43 (0) 732 77 52 30 · kassa@liva.linz.at 8. Mai 2025 · 19:30 Uhr C. Bechstein Centrum Linz / Klaviersalon Merta GmbH
Bethlehemstraße 24 · A-4020 Linz · +43 (0) 732 77 80 05 20 linz@bechstein.de · bechstein-linz.de







