Yoav Levanon
22. November 2025 19:30 Uhr Mittlerer Saal Klavierrecitals I

22. November 2025 19:30 Uhr Mittlerer Saal Klavierrecitals I

Do, 11. Dez 2025, 19:30
Mittlerer Saal
Anna Leyerer
C. Bechstein Klavierabend
Liszts berühmt-berüchtigte ›Transzendentale Etüden‹, kombiniert mit Werken von Carl Vine, Joseph Haydn und Igor Strawinski
Mi, 7. Jän 2026, 19:30
Mittlerer Saal
Erika Baikoff & James Baillieu
Liederabend
Die preisgekrönte Sopranistin Erika Baikoff feiert ihr Brucknerhaus-Debüt mit Liedern von Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart, Franz Schubert und Antonín Dvořák.
Fr, 23. Jän 2026, 19:30
Mittlerer Saal
Wildschut, Barragán & Wiesensee
Balagan
Geigerin Noa Wildschut, Klarinettist Pablo Barragán und Pianist Amadeus Wiesensee präsentieren ein facettenreiches Programm mit Fokus auf jüdische Komponisten.
Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at
Das Programm auf einen Blick
Die Sechs Stücke in kanonischer Form op. 56 von Robert Schumann wurden für Pedalflügel konzipiert; wohlwissend, dass nicht jeder das zusätzliche Pedal am Instrument besitzen würde, erstellte Schumann auch eine Fassung für ›normales‹ Klavier. Ergänzt wird seine Komposition durch zwei ursprünglich für das Cembalo komponierte Stücke von François Couperin und Jean-Philippe Rameau sowie einer Auswahl aus Franz Liszts Études d’exécution transcendante, die vom Interpreten buchstäblich eine »übernatürliche Ausführung« verlangen.
Die zweite Hälfte steht ganz im Zeichen musikalischer Querverweise: Neben einem Thema von Frédéric Chopin, das Sergei Rachmaninoff zum Ausgangspunkt seiner Variationen nahm, verarbeitete Maurice Ravel Joseph Haydns Nachnamen zum Hauptmotiv eines Menuetts. Fulminantes Finale des Abends ist Mili Balakirews Fantasie Islamey, die aufgrund ihrer technischen Anforderungen lange als das schwierigste Stück für Klavier überhaupt galt.
François Couperin 1668–1733
La Couperin, Nr. 3 aus: Pièces de Clavecin. Quatrième livre, XXI. Ordre // 1730
Jean-Philippe Rameau 1683–1764
Les Cyclopes. Rondeau aus: Pièces de Clavessin // 1724
Robert Schumann 1810–1856
Studien für den Pedalflügel. Sechs Stücke in kanonischer Form op. 56 // 1845
Nr. 3 Andantino – Etwas schneller
Nr. 2 Mit innigem Ausdruck
Franz Liszt 1811–1886
Études d’exécution transcendante S. 139 // 1826, rev. 1839, 1851–52
Nr. 8 Wilde Jagd. Presto furioso
Nr. 9 Ricordanza. Andantino
Nr. 10 Allegro agitato molto
Nr. 11 Harmonies du soir. Andantino
Nr. 12 Chasseneige. Andante con moto
// Pause //
Sergei Rachmaninoff 1873–1943
Variationen über ein Thema von Chopin op. 22 // 1902–03
Maurice Ravel 1875–1937
Menuet sur le nom d’Haydn M. 58 // 1909
Mili Balakirew 1837–1910
Islamey. Fantaisie orientale // 1869
Konzertende: ca. 21:30 Uhr
Stücke von François Couperin & Jean-Philippe Rameau
Die musikalische Polarität zwischen Frankreich und Italien zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Barockzeit. Während in der französischen Musik das Augenmerk auf klar definierten Formen lag und jedes Detail der Ausführung dabei streng festgelegt wurde, lebt die italienische Musik von fast überbordender Theatralik und freier Improvisation. Einer der wenigen, die es wagten, beide so gegensätzlichen Auffassungen miteinander zu verbinden, war François Couperin. Hüteten sich die meisten seiner Landsleute, ihre französischen Gerichte vom ›schlechten Geschmack‹ der Italiener versalzen zu lassen, so reifte in ihm die Idee, den reich verzierten, vornehm schreitenden französischen Stil mit den kühnen harmonischen Wendungen und drängenden Figurationen Italiens zu vereinen.
Praktisch alle Facetten dieser stilistischen Vielfalt zeigte Couperin in den vier zwischen 1713 und 1730 erschienen Bänden seiner Pièces de Clavecin, in denen er kunstvolle Satztechnik mit einer Unmittelbarkeit des Ausdrucks verband, die nicht zuletzt in charakteristischen Titeln und Vortragsanweisungen sichtbar wird, wie er im Vorwort des ersten Bandes erläuterte: »Bei der Komposition dieser Stücke hatte ich stets einen Gegenstand vor Augen, den mir unterschiedliche Gelegenheiten lieferten und so entsprechen die Titel den Ideen, die ich dabei hatte; man wird es mir ersparen, darüber Rechenschaft abzulegen. Da jedoch einige unter den Titeln den Eindruck erwecken könnten, mir

selbst zu schmeicheln, sei darauf hingewiesen, dass die dazugehörigen
Stücke in gewissem Sinne Porträts darstellen, die zuweilen unter meinen Fingern den Originalen ziemlich ähnlich geworden sind; und weiterhin, dass die meisten dieser Titel eher den liebenswürdigen Originalen gelten als den Kopien, die ich angefertigt habe.« Das Stück La Couperin malt das Selbstporträt des Komponisten in den mild leuchtenden Farben perlender Sechzehntelketten und melancholischer Sequenzierungen, hinter denen sich tatsächlich ein durchaus »liebenswürdige[s] Original« vermuten lässt.

François Couperin, Gravur von Jean Charles Flipart nach einer Zeichnung von André Boüys, 1735
Praktisch zur selben Zeit arbeitete JeanPhilippe Rameau am zweiten
Band seiner Pièces de Clavessin, denen er, wie Couperin, in vielen Fällen programmatische Titel verlieh. Über die Hintergründe von Les Cyclopes (Die Zyklopen), äußerte sich Rameau am 25. Oktober 1727 gegenüber dem Schriftsteller Antoine Houdar de La Motte: »Sie müssen nur kommen und hören, wie ich den Gesang und den Tanz der Wilden



»Mit der immer fortschreitenden Mechanik des Clavierspiels […] wuchs auch das Instrument an Umfang und Bedeutung, und kömmt es noch dahin (wie ich glaube), daß man an ihm, wie bei der Orgel, ein Pedal in Anwendung bringt, so entstehen dem Komponisten neue Aussichten, und sich immermehr vom unterstützenden Orchester losmachend, wird er sich dann noch reicher, vollstimmiger und selbständiger zu bewegen wissen.« Fast prophetisch klingen Robert Schumanns Worte aus dem Jahr 1837, wenn man bedenkt, dass sich der Komponist acht Jahre später tatsächlich eine Pedalklaviatur vom Dresdener Musikdirektor Otto Kade leiht, nur um drei Tage später in seinem Tagebuch zu notieren:
»Das Clavier möchte ich oft zerdrücken und es wird mir zu eng zu meinen Gedanken.«
Robert Schumann am 14. April 1839 an Heinrich Dorn
»Idee f[ür] Pedalflügel zu componiren«. Und auch in den nächsten Wochen lässt seine Begeisterung für die kompositorischen Möglichkeiten des Instruments nicht nach. Im Gegenteil, Schumann und auch seine Frau Clara spielen, komponieren, theoretisieren, verfallen in eigenen Worten in eine wahre »Fugenpassion«. Zwischen April und November des Jahres 1845 entstehen die Vier Skizzen für Pedalflügel op. 58, Sechs Fugen über den Namen BACH op. 60 sowie die Studien für den Pedalflügel op. 56. Wie sehr Schumann von der Neuartigkeit seines Ansatzes der Komposition mit ›alten Formen‹ und zugleich neuen Ausdrucksmitteln überzeugt war, zeigt ein Brief, mit dem er sein Opus dem Verleger Friedrich Whistling anbot: »Es ist etwas Neues damit, darum ich unter der vorläufigen Anzeige einige erläuternde Worte für durchaus nöthig halte; Sie haben dann weiter nichts als Ihren Namen als Verleger darunter zu setzen. Diese Anzeige bitte ich Sie nun sogleich in der Härtelschen und Brendelschen Zeitung abdrucken zu lassen. Man kann in solchen Dingen
Robert Schumann // Studien für den Pedalflügel
nicht schnell genug sein, und es schnappt einem der erste Beste die Idee auf und weg. Darum bitt ich Sie auch auf Ihr Ehrenwort als Geschäftsmann, vor dem Abdruck der Anzeige gegen Niemanden, auch Ihre und unsere Freunde nicht, etwas verlauten zu lassen. Offen gesagt, ich lege einiges Gewichts auf die Idee, und glaube, daß sie mit der Zeit einen neuen Schwung in die Claviermusik bringen könnte. Ganz wundervolle Effecte lassen sich damit machen und meine Frau spielte einige der Studien schon recht schön.«

Robert Schumann, Stahlstich von Auguste Hüssener nach einem verschollenen Gemälde von Joseph Matthäus Aigner aus dem Jahr 1844
Franz Liszt // Études d’exécution transcendante
24 Grandes Études
Auf dem Titelblatt der Druckfahne hatte Liszt den schließlich wieder verworfenen Alternativtitel Virtuose Studien notiert
Ihren Ursprung haben Franz Liszts Études d’exécution transcendante im Jahr 1826, in dem der damals Fünfzehnjährige an Jenny Montgolfier schreibt: »Die erste Ausgabe meiner Etüden, die ich gerade zu Papier gebracht habe, wird bald erscheinen«. Der Titel dieser Ausgabe – »Etüden für Klavier in 48 Übungen in allen Dur und Molltonarten […] vom jungen Liszt. In vier Ausgaben zu je 12 Etüden« – verspricht drei weitere Bände und damit ein Gesamtwerk in der Tradition von Johann Sebastian Bachs ebenfalls 48teiligem Wohltemperierten Klavier. Letztlich erscheint allerdings nur dieser erste Band, mit dem Liszt dennoch für Furore sorgt, zeigt sich hier doch neben der offenkundigen technischen Raffinesse des ›Wunderkindes‹ bereits dessen erstaunliche melodische Originalität und formale Reife. Zehn Jahre später, während seiner Zeit als Klavierprofessor in Genf, spielt Liszt mit der Idee, das Werk zu erweitern und als »24 Grandes Études originales« zu veröffentlichen. 1839 erscheinen denn auch, parallel bei Ricordi in Mailand und Tobias Haslinger in Wien, die »24 Grandes Études« – allerdings nur in zwei der angekündigten vier Bände. Es bleibt also bei 12 Stücken, wobei Liszt ein einziges neu komponiert, eines durch ein schon 1826 komponiertes ersetzt und die übrigen zehn grundlegend überarbeitet hat. 1851, mittlerweile als Kapellmeister in Weimar sesshaft, nimmt sich Liszt seiner Etüden ein drittes und letztes Mal an, mit dem Ziel einer »neuen, vollständig überarbeiteten und hinreichend korrigierten Fassung«, die 1852 im Verlag Breitkopf &
»Folglich erkenne ich blos die Härtel’sche Ausgabe der 12 Etuden als die einzig rechtmässige [...] und wünsche deshalb, dass der Catalog von den früheren keine Notiz nimmt.«
Franz Liszt am 17. Jänner 1855 an Alfred Dörffel

Titelseite der Erstausgabe von Liszts Études d’exécution transcendante, 1852
Härtel unter dem letztgültigen Titel Études d’exécution transcendante (wörtlich etwa Etüden für übernatürliche Ausführung) erscheint. Hatte Liszt in der ersten umfassenden Revision des Jahres 1839 grundlegend an Form und Struktur der einzelnen Etüden gefeilt, so gilt sein Augenmerk nun vor allem dem Klaviersatz selbst, dessen dichte, oft nur dem Effekt der Virtuosität geschuldete Faktur er ausdünnt, die zahlreichen komplexen Spielanweisungen vereinfacht und das Klangbild damit transparenter und brillanter macht. Neu sind dabei auch die Titel einzelner Stücke mit denen Liszt die poetischen Ideen der zuvor abstrakt wirkenden Etüdenformen hervorhebt.
Sergei Rachmaninoff //
Variationen über ein Thema von Chopin
Wie kaum ein anderer Komponist ist Sergei Rachmaninoff mit einem, mit seinem Instrument, dem Klavier, verknüpft: Nicht nur als Interpret, der zunächst Europa, später die USA in seinen Bann zieht und der vielen als größter Pianist seiner Generationen gilt, sondern auch als Komponist, dessen Schaffen im Bereich der Kammermusik, des Lieds und allen voran der Konzerte das Klavier immer wieder in den Vordergrund stellt. Als Sprössling einer betuchten Gutsbesitzerfamilie am 1. April 1873 auf dem Landgut Semjonow im Gouvernement Nowgorod geboren, wird ihm die Affinität zu den schwarzen und weißen Tasten dabei gewissermaßen in die Wiege gelegt: Sowohl seine Mutter als auch sein Vater sind versierte und passionierte Musiker:innen, sein Großvater genießt als Pianist und Gelegenheitskomponist sogar einen gewissen lokalen Ruhm. Als sich zeigt, dass der junge Sergei das täglich Gehörte fast fehlerfrei aus dem Gedächtnis nachspielen kann, erhält er im Alter von sieben Jahren ersten professionellen Klavierunterricht, drei Jahre später wird er am St. Petersburger Konservatorium aufgenommen. 1885 erhält er durch die Vermittlung seines Cousins, des gefeierten Klaviervirtuosen Alexander Siloti, einen Platz als Schüler Nikolai Swerews am Moskauer Konservatorium. Unter der ebenso strengen wie fürsorglichen Hand Swerews entwickelt sich Rachmaninoff zu einem disziplinier ten Schüler, der bald auch mit eigenen Werken in Erscheinung tritt. 1889 jedoch kommt es zum Zerwürfnis der beiden, Rachmaninoff sucht und findet Zuflucht bei der Familie seiner Tante auf dem Landgut Iwanowka, deren Tochter Natalja Satina er dreizehn Jahre später heiratet. Unmittelbar im Anschluss an ihre dreimonatige Hochzeitsreise, die das Paar unter anderem nach Wien und Bayreuth führt, beginnt Rachmaninoff mit der Arbeit an seiner bis dahin umfangreichsten und ambitionier testen Klavierkomposition: den Variationen über ein Thema von Chopin op. 22.
Rachmaninoff verwendet das Prélude cMoll aus Frédéric Chopins 24 Préludes op. 28, ein 13taktiges, im Stile eines Trauermarsches gehaltenes Largo, als Grundlage für 22 Variationen, wobei er das Werk in drei übergeordnete Abschnitte gliedert. Während in den Variationen Nr. 1–10 figurative, zwischen barocker Strenge und harmonischer Modernität pendelnde Formen vorherrschen, sind Nr. 11–18 vornehmlich durch langsamere Tempi charakterisiert. Der Klaviersatz wird vollgriffiger, aber auch experimenteller. Immer wieder scheint dabei das gregorianische Dies iraeMotiv auf, jener mittelalterlichen Hymnus über das Jüngste Gericht, der sich in Werken wie der 1. Klaviersonate op. 28 den Symphonischen Tänzen op. 45 oder der Tondichtung Die Glocken op. 35 wie ein roter Faden durch Rachmaninoffs Werk zieht. Nr. 19–22 bilden schließlich das vierteilige Finale des Zyklus, im buchstäblichen Sinne ›eingeläutet‹ vom strahlenden ADurGlockenklang der Variation Nr. 19 und gekrönt von einer ausgedehnten, im Maestoso stolzierenden Polonaise der Nr. 22.
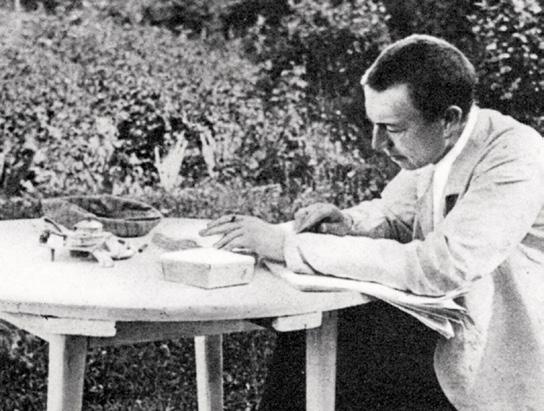
Maurice Ravel // Menuet sur le nom d’Haydn

»Lieber Freund, das Menuett ist maßgeschneidert. Willst du bei mir vorbeikommen, um es zu hören oder soll ich es dir schicken?«
Maurice Ravel am 12. September 1909 an Jules Ecorcheville
Beginn von Ravels Menuet sur le nom d’Haydn im 1910 erschienenen Erstdruck

Soggetto cavato dalle parole (dt. Thema aus den Wörtern geholt); von Josquin des Prez popularisierte Technik der Darstellung von Wörtern durch Tonnamen
Mili Balakirew // Islamey. Fantaisie orientale

1862, im selben Jahr, in dem er in Sankt Petersburg die ›Musikalische Freischule‹ als kostenfreie und dezidiert national ausgerichtete Alternative zum zeitgleich gegründeten Sankt Petersburger Konservatorium ins Leben gerufen hat, unternimmt Mili Balakirew eine Reise in den Kaukasus, während derer er erstmals in Kontakt mit der Volksmusik der Tscher kessen und Tschetschenen kommt. Welchen Einfluss diese Erfahrungen auf sein Werk und insbesondere auf sein im August und September 1869 komponiertes, im Untertitel als Fantaisie orientale bezeichnetes Klavierstück Islamey ausüben, beschreibt er in den frühen 1890erJahren seinem Freund Eduard Reis: »Islamey – dieses Stück habe ich damals im Kaukasus geplant. […] Die grandiose Schönheit der dortigen üppigen Natur und die mit ihr harmonisierende Schönheit der Menschen, die dieses Land bewohnen, das alles zusammen machte auf mich einen tiefen Eindruck. […] Da ich mich für die dortige Volksmusik interessierte, suchte ich die Bekanntschaft eines
Mili Balakirew, Zeichnung von Ilja Repin, 1870
Mili Balakirew // Islamey. Fantaisie orientale
Tscherkessenfürsten, der häufig zu mir kam und mir auf seinem Instrument, das ein wenig einer Geige ähnelt, Volksweisen spielte. Eine davon, ein Tanzlied, das Islamey genannt wird, gefiel mir besonders«. Neben dem gleich zu Beginn des Stückes in wirbelnd voranstürmenden Repetitionen vorgestellten IslameyThema greift Balakirew für den lyrischen Mitteilteil auf die Melodie eines Volksliedes der Krimtataren zurück, das er im Sommer 1869 im Hause Pjotr Iljitsch Tschaikowskis durch den armenischen Bariton Konstantin de Lazari, einem Mitglied des BolschoiTheaters, kennengelernt hat. Der Pianist und Widmungsträger des Werkes Nikolai Rubinstein beginnt sogleich nach Erhalt der Noten mit der Einstudierung: »Ich arbeite — armer, elender Tropf, der ich bin — an deinem Stück«, teilt er dem Komponisten im Oktober 1869 mit, »welches mich mit schrecklicher Wonne erfüllt, und wofür ich dir danke; ich werde es jedenfalls in meinem Moskauer Konzert spielen; aber es ist so schwer, dass nur wenige damit zurechtkommen werden; ich will einer dieser wenigen sein.« In diesem Sinne beginnt mit der Uraufführung am 12. Dezember 1869 im Rahmen eines Konzerts der ›Musikalischen Freischule‹ die erstaunliche Karriere des bald als ›unspielbar‹ mystifizierten Werkes, dessen ehrfurchtgebietende technische Schwierigkeiten ebenso wie seine mitreißende Melodik und Rhythmik durch Rubinstein, später auch Franz Liszt in ganz Europa populär werden.
»Die Originalität des Themas und meine tiefen kaukasischen Eindrücke, die sich in ihm widerspiegeln –dies muss der Komposition ihre Individualität verliehen und die Aufmerksamkeit des großen Liszt auf sich gezogen haben. Daher ist es wohl, soweit ich hörte, im Ausland so beliebt, während man es hier in Russland überhaupt nicht zu hören bekommt, da es heute keinen Pianisten gibt, der es spielen kann. Der einzige Pianist in Russland, der es technisch und ästhetisch angemessen aufführen konnte, war der verstorbene Nikolai Rubinstein, dem es auch gewidmet ist.«
Mili Balakirew an Eduard Reis über Islamey, 1892
Andreas Meier
Klavier
»Wunderschöner Klang, mühelos virtuos, mit großer innerer Sicherheit – Yoav Levanon zeigt bereits enorme Kraft und Reife«, kommentierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Auftritt des 21Jährigen bei den Burghofspielen im Rheingau. Weitere Höhepunkte der Saison 2025/26 umfassen RecitalAuftritte im Théâtre des ChampsElysées, im Brucknerhaus Linz, im Jerusalem Music Centre sowie im historischen Teatro Sociale di Rovigo in Italien und bei der angesehenen ChopinGesellschaft Hannover. Auch durch Konzerte mit führenden Orchestern wie dem Pacific Symphony Orchestra, dem WDR Sinfonieorchester und dem Israel Chamber Orchestra baut Yoav Levanon seinen Ruf auf internationaler Bühne weiter aus. Frühere Auftritte führten ihn in die Tonhalle Zürich, die Elbphilharmonie in Hamburg, das Théâtre des ChampsElysées, die Wigmore Hall in London, das Wiener Konzerthaus sowie zum Lucerne Piano Festival. Außerdem war er Gast bei renommierten Orchestern wie dem Antwerp Symphony Orchestra, dem Orquesta de la Comunidad de Madrid, dem Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, dem Poznan Philharmonic Orchestra und beim Lanaudière Festival in Québec. Yoav Levanon stand bereits im Alter von vier Jahren auf der Bühne und erhielt seither zahlreiche internationale Auszeichnungen. 2019 trat er als einer der jüngsten Pianisten in der Festivalgeschichte des renommierten Verbier Festivals auf. Sein DebütRecital, das weltweit auf medici.tv übertragen wurde, erreichte das größte OnlinePublikum aller Veranstaltungen des Festivals 2019. 2021 unterschrieb Levanon einen exklusiven Aufnahmevertrag mit Warner Classics. Sein Debütalbum A Monument for Beethoven erregte 2022 weltweit große Aufmerksamkeit und erhielt hervorragende Rezensionen. Im Februar 2024 folgte Rachmaninoff: Études-Tableaux Op. 39, im November desselben Jahres Liszt: Piano Concertos & Totentanz mit dem Luzerner Sinfonieorchester unter Michael Sanderling sowie zuletzt im Oktober 2025 Liszt: Transcendental Etudes

Herausgeberin
Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz
Künstlerischer Direktor
Norbert Trawöger
Programmplanung & Dramaturgie
Andreas Meier (Leitung), Paula Schlüter
Redaktion
Andreas Meier
Grafik
Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer
Abbildungen
Bibliothèque nationale de France, Paris (S. 6–7), gemeinfrei (S. 8, 11, 13, 15, 16–17 & 18), S. Fowler (S. 21)
Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten
LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz
Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!









