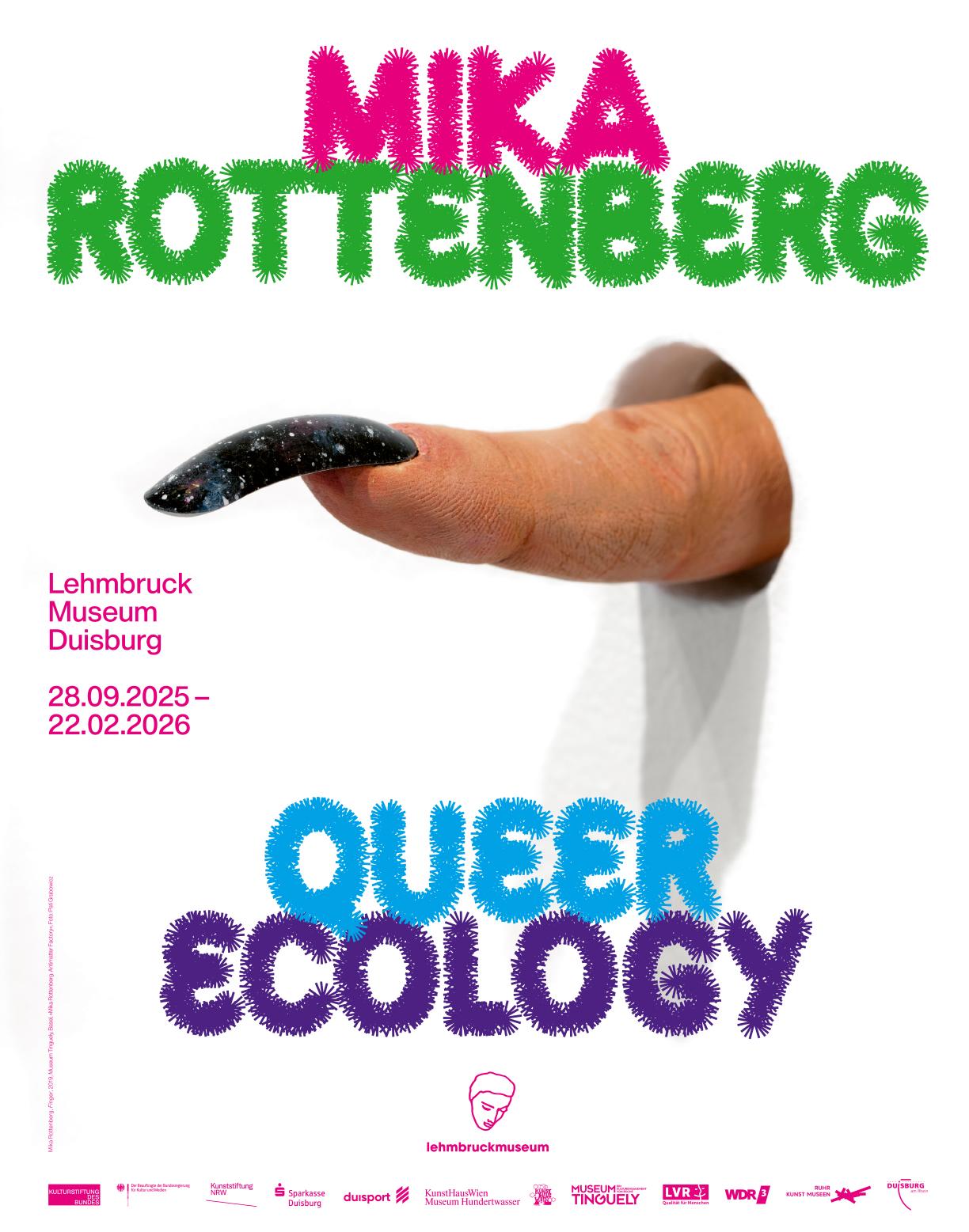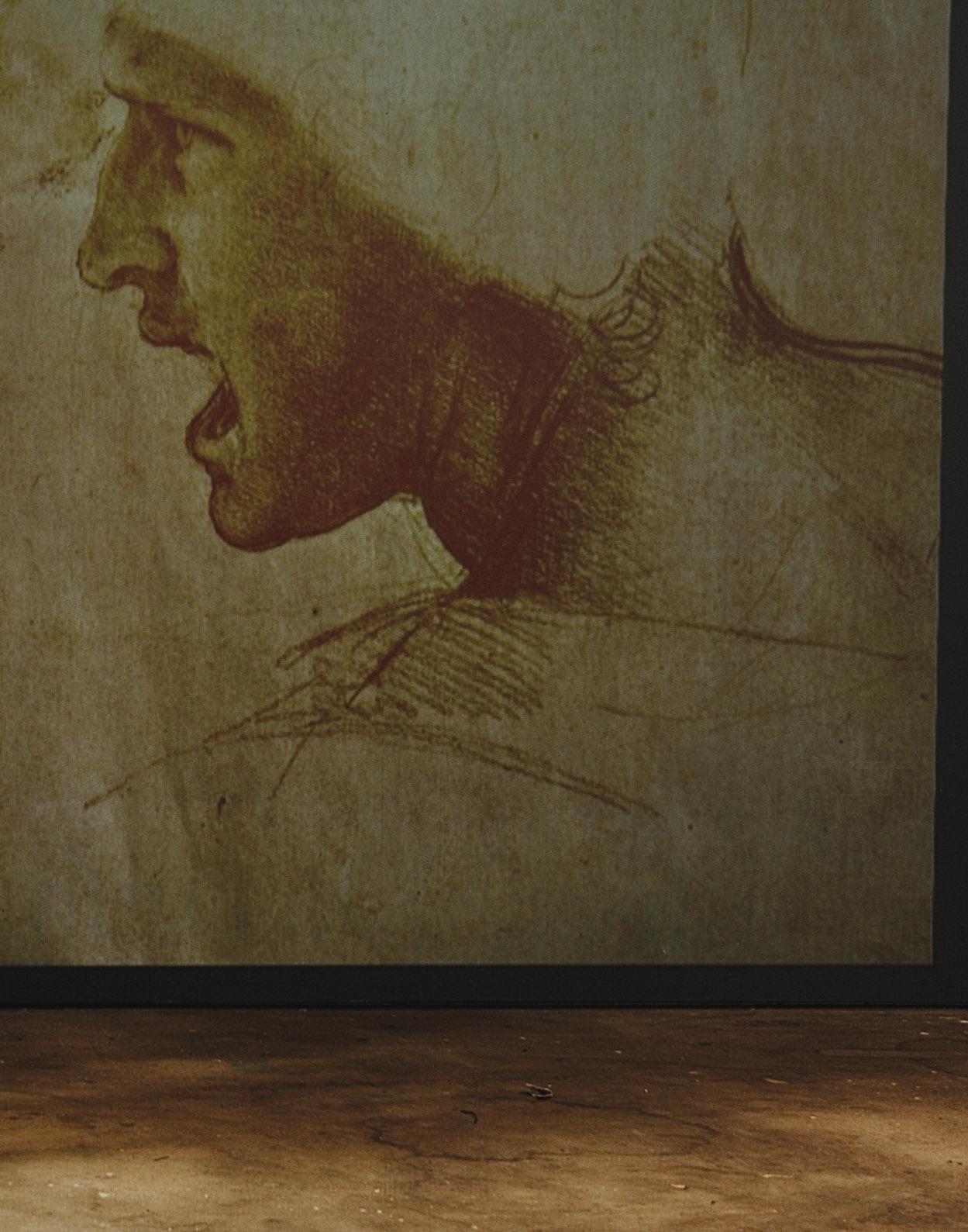
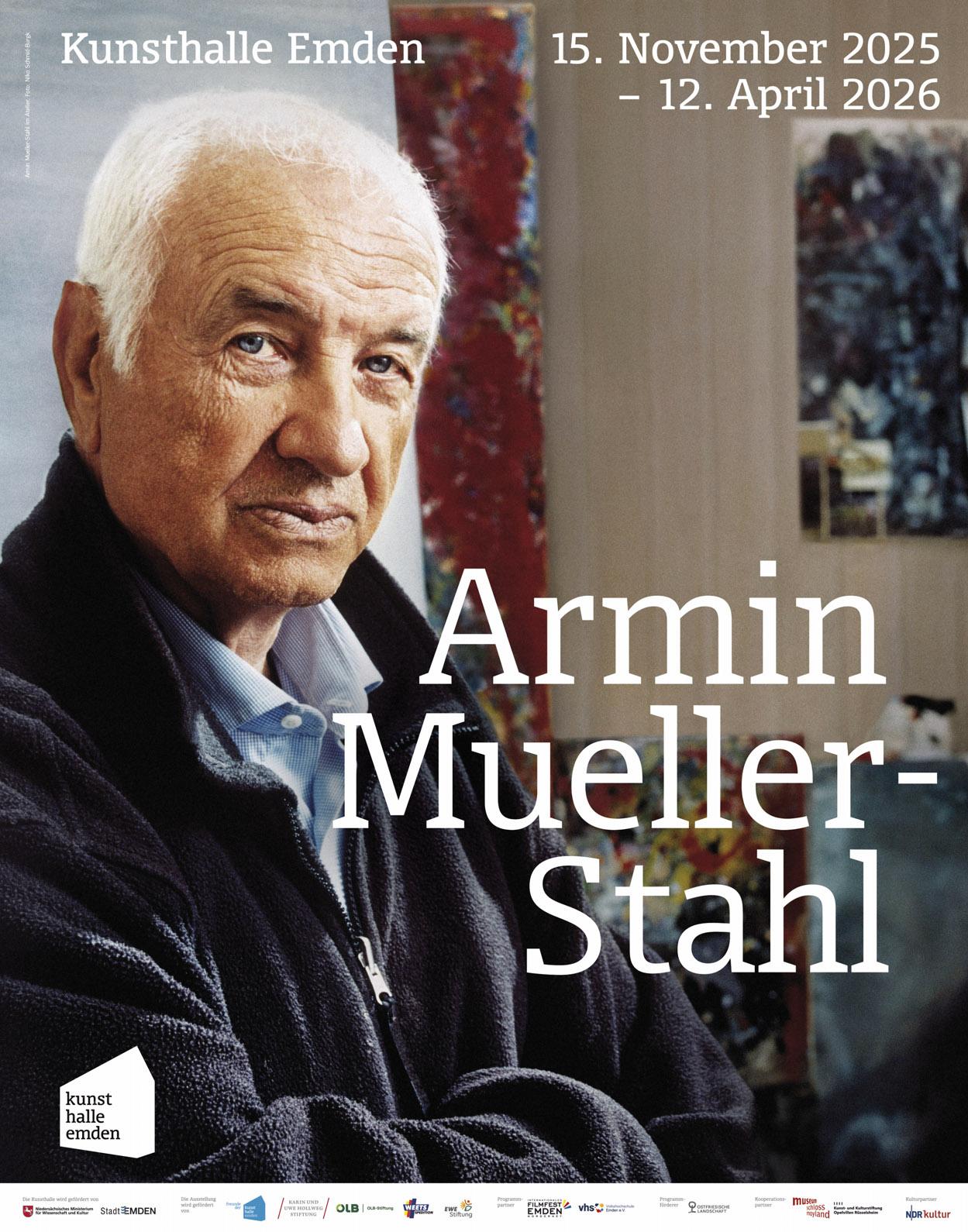

Liebe Leserin, lieber Leser, wofür sind wir dankbar? Eine nur vordergründig einfache Frage, schnell gestellt – und doch schwierig zu beantworten. Wer in sich hineinhorcht, kommt rasch großen Fragen auf die Spur: Gesundheit als höchstes Gut kommt wohl auf einen der vordersten Plätze, Hand in Hand mit Liebe, Familie und Freundschaft mit Menschen, die Gutes im Schilde führen. Die Seelenruhe, die Abwesenheit existenzieller Probleme und Sorgen stehen sicherlich auch auf der DankbarkeitsSkala ganz oben. Mancher wird auch die Wahrhaftigkeit in Begegnungen nennen – denn mitunter, das haben wir gelernt, trügt selbst der schönste Schein. Wann haben Sie sich zuletzt gewünscht, einmal hinter die Fassaden schauen zu können?
Die Malerei von Ute Fründt hat dies zu einem ihrer Themen gemacht: Sie blickt hinter das Vordergründige, befragt das Dasein des Menschen samt seinen Abgründen und Emotionen und sucht nach inneren Wahrheiten auch im Kleinen. Ihre Bilder entführen gleichermaßen vor und hinter die Kulissen und evozieren zumindest eine Ahnung von dem, was außerhalb der Darstellung liegen mag. Thomas Hirsch hat die Berliner Malerin für Kunst+Material in ihrem Atelier in Kreuzberg besucht.
Das Bild der Stadt Rom wird bis heute von den Ansichten bestimmt, die der gebürtige Venezianer Giovanni Battista Piranesi im 18. Jahrhundert großformatig radierte. Kühn und mit zahlreichen perspektivischen Kunstgriffen inszeniert, verankerten sich seine Vedute di Roma schnell im kollektiven Bildgedächtnis zur Ewigen Stadt. In seinem Sonderthema zeigt Stefan Morét, dass der berühmte Radierer, Bauforscher und Architekt eine schillernde Persönlichkeit der Kunstszene und ein gewiefter Geschäftsmann war, der mit antiken Marmorobjekten weithin Handel trieb – ein Blick in Werkstatt und Geschäftsbeziehungen ist dabei natürlich inbegriffen.
Dies sind zwei der vielen Beiträge, zu denen die neue Ausgabe von Kunst+Material einladen möchte: Entdecken Sie zudem die Vorzüge von klassischem Kreidegrund und faszinierende Monotypien, die zwischen Malerei und Zeichnung angesiedelt sind und mit Gel-Platten gedruckt werden. Der Bronzeguss steht im Fokus des Hintergrund-Themas, und natürlich bietet Ihnen diese Ausgabe auch wieder interessante Lektüreempfehlungen für entspannte Stunden auf dem Sofa sowie Tipps für sehenswerte Ausstellungen.
Last but not least möchten auch wir uns an dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedanken – für Ihr fortwährendes Interesse an unseren Themen, für Ihre Treue und Ihr kontinuierliches Feedback!
Einen unbeschwerten Jahresausklang wünscht
Dr. Sabine Burbaum-Machert









Porträt
6–19 Kulissen der Schönheit Die Berliner Malerin Ute Fründt
Thema
20–35 Giovanni Battista Piranesi Radierer, Bauforscher und Antikenhändler im Rom des 18. Jahrhunderts
36–43 Jeder Druck ein Unikat Monotypien mit Gel-Druckplatten
44–45 „Mein metaphysischer Fundus“ Nikola Jaensch arbeitet mit gefundenen Papieren
Hintergrund
46–49 „Aus der Hülse, blank und eben, Schält sich der metallne Kern“ Bemerkenswertes über den Bronzeguss
Technik
50–55 Gesso! Gesso! Gesso!
Bücher
56–65 Bücher, Buchtipps 89 Kunst+Material im Abonnement
Labor
66–67 Klare Linien
Titel: Ute Fründt, Welt (Ausschnitt), 2025, Öl auf Nessel, 60 x 50 cm, Foto: Archiv Ute Fründt, Berlin. 50 20
70–75 Die Kraft der Ambivalenz Tobias Pils im mumok in Wien
76–79 Liebe und Unendlichkeit „Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infinity“ im Sprengel Museum
80–88 Termine
90–91 Kurz notiert
92–95 Im Gespräch
96 Vorschau, Impressum
In ihrer Malerei entwickelt die Berliner Künstlerin Ute Fründt eine surreale Attraktivität und entlarvt sie zugleich als gesellschaftliche Konstruktion. Thomas Hirsch hat sie in ihrem Atelier in Kreuzberg besucht.
Es ist ein wunderbares Wiedersehen im Atelier nach einem Jahrzehnt. Der Ort ist geblieben, ein Seitenarm vom Mehringdamm, mitten in Berlin-Kreuzberg, dort, wohin der Lärm der rauen Hauptverkehrsstraßen kaum dringt. Stattdessen beginnen hier die Grünanlagen, der Kreuzberg selbst ist eine Ecke weiter. Der Weg zu Ute Fründt führt durch die Hofeinfahrt eines großen Wohnhauses. Die typischen Berliner Hinterhöfe. Vom Balkon im Hinterhaus winkt sie freundlich, verbindlich und still. Am Interesse an ihrer Malerei war sie schon immer etwas erstaunt, für sie ist das Malen eine selbstverständliche Tätigkeit zu allen Zeiten, nichts, was man besonders betonen müsste. Aber dann blättern wir auch jetzt in den Regalen mit ihren Gemälden. Nach langer Zeit einzelne der Bilder wieder zu sehen, ist eine großartige Erfahrung: Die Bilder verlieren nichts von ihrer Intensität, dem Rausch der Farben mit ihren ornamental anmutenden Binnenformen, der Simultaneität der Perspektiven und diesem erstaun[1] Ute Fründt im Atelier, Sommer 2025.
lichen vibrierenden Kippen der Linien, Kreise und Punkte von der Fläche in die räumliche Tiefe.
Im Atelier selbst hat Ute Fründt einige der neuesten Bilder auf dem Boden nebeneinandergestellt und an die Wand gehängt. Auf dem Tisch im Raum liegt eine Mappe mit großformatigen Papierarbeiten – im Grunde sind es Malereien auf Papier, ein Kapitel, das sie in dieser Intensität und Eigenständigkeit erst seit einigen Jahren ausformuliert und das noch weitgehend unveröffentlicht ist. Begonnen hat sie mit diesen Papierarbeiten während der Corona-Zeit und sie ist damit nach vielen Jahren wieder ganz zur menschlichen Figur als Sujet zurückgekehrt, parallel nun auch bei ihren Gemälden auf Leinwand. Die Protagonisten sind jetzt Männer mit Hüten, Zirkusartisten, Angler und Skiläufer. Auch wenn sie im Mittelgrund stehen oder von einem linearen Geflecht umhüllt werden oder wie in einer Schnee-

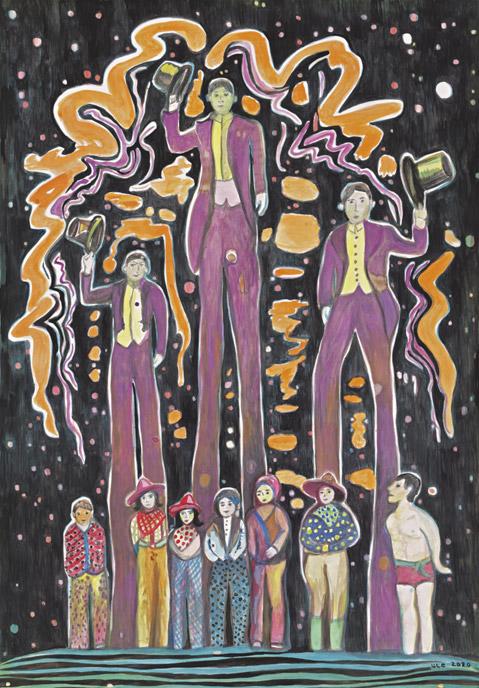
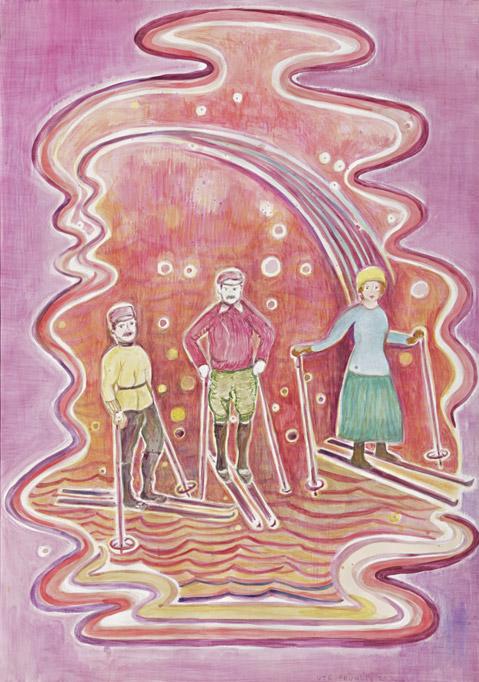
kugel zusammengedrängt sind, ziehen sie alle Blicke auf sich, werden noch fokussiert und stellen selbst ihre Befähigungen heraus. So initiieren sie gestenreiche zauberhafte Dinge, verrätseln das Bild und wirken zwischen schematisch flächiger Darstellung und plastischer Ausformulierung seltsam real und gleichzeitig seltsam fern. Mitunter erwecken sie die Natur und vielleicht sogar das ganze Universum zum Leben … Auch bei diesen Bildern sind das Programm und die Aura geblieben, die durchgehend zu den Qualitäten der Kunst von Ute Fründt gehören: Das betrifft den Klang des Feierlichen, Besonderen, in Verbindung mit der atmosphärischen Aufladung. Die Konzentration auf wenige, umso mehr sinntragende Motive, vorgetragen mit den Möglichkeiten des Realismus, oft unter Einbezug von Ornament und farbigen Bahnen, auch als Spiralen, die sich in die Tiefe und nach außen wölben. Der Hintergrund ist überhaupt mit Mustern aus Sternen, repetierenden Linien, Streifen und Bändern strukturiert, [2]
die zwischen Innenraum (Tapete) und landschaftlichem Außenraum (Blüten, Himmel) wechseln und dazu die Spannung zwischen beidem halten. Und schließlich ist da der sinnliche Glanz, das Leuchtende, das von den Motiven der Natur und den frei flottierenden Formen ausgeht und so mit seinen pastellenen, in mehreren Schichten aufgetragenen Farben eine andere Welt erhellt, die vom Nebenschauplatz ins Zentrum rückt. Wenn es nicht die Menschen sind, dann zeigt Ute Fründt eine Natur, die fremd und exotisch anmutet, tatsächlich aber der Wirklichkeit – teils in der Ferne – entnommen ist und uns staunen lässt. Wie wirken die Erscheinungen doch erst, wenn sie alleine zu sehen sind, im Gegenüber, aus der Untersicht. Schönheit, Pracht und Seltenheit stellen sich ein, denen meist noch ein Moment des Erhabenen oder des Vergangenen früherer Zeiten innewohnt. Zu sehen sind damit auch Klischees, Künstlichkeit und die Träume, die dazu bestimmt sind, im realen Leben Träume zu bleiben.
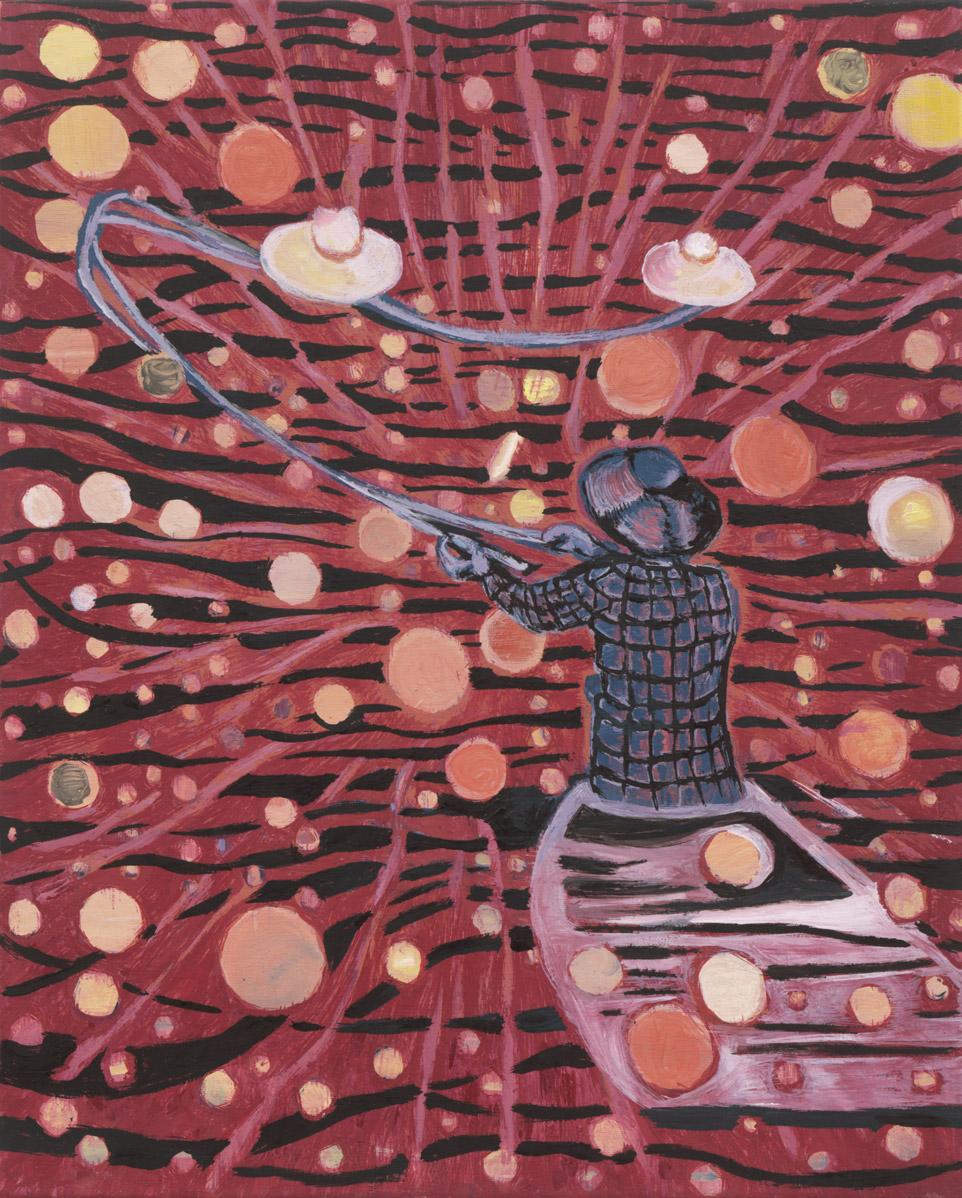

„Schönheit, Pracht und Seltenheit stellen sich ein, denen meist noch ein Moment des Erhabenen oder des Vergangenen früherer Zeiten innewohnt. Zu sehen sind damit auch Klischees, Künstlichkeit und die Träume, die dazu bestimmt sind, im realen Leben Träume zu bleiben.“
Hier nun muten sie als kollektive Sehnsucht an, vielleicht sogar als Rückerinnerung an die Kindheit, als alles riesig war und im Entdecken zum ersten Mal außerordentlich empfunden wurde. Ein eindrucksvolles, schon etwas älteres Beispiel dafür ist die verhältnismäßig kleine Ölmalerei Diva von 2008. Es zeigt eine Frau im rotvioletten Kleid, die in der Mitte vor den Vorhang einer Bühne tritt. So lässig sie gemalt scheint, so hingebungsvoll sind doch ihre Formen und der schimmernde Glanz des roten Kleides erfasst und das Schlanke und zugleich Zerbrechliche der Figur vermittelt. Die Detailliertheit des Vorhangs, durch den sie tritt, ist eindrucksvoll. Er wird begrenzt von weißen Fransen, die sie sanft berührt und dadurch für sich öffnet. Auf dem Boden aufliegend, verfügt er mit seinen welligen Faltungen über ein komplexes, schwarz eingezeichnetes, bedeutungsvoll wirkendes Linienmuster. Mitten im Spalt des Vorhangs nun bewegt sich die Diva, den Kopf zur Seite geneigt, auf die Bühne nach draußen in
die gleißende Helligkeit. Nur wenig Licht dringt von vorne in den hinteren, dunklen Bereich der Bühne. Zeichnet sich dort nicht eine Treppe ab, welche die Frau heruntergeschritten ist? Über sie ist die Diva von einer Sphäre der Verinnerlichung in den öffentlichen Bereich der Entäußerung getreten … Ute Fründt entnimmt derartige Darstellungen dem Glamour von Hollywood, den Konstruktionen des Films und den Abbildungen in Hochglanzmagazinen, hinter denen andererseits reale Menschen mit ihren persönlichen Geschichten stehen – mithin fließt bei ihren Malereien die Differenz zwischen Schein und Sein ein, der sie nachgeht und so noch hinter das Vordergründige blickt. Und selbst wenn sie stattdessen die Natur mit ihren Bäumen und Spinnennetzen zeigt, bleiben die Darstellungen existenziell. Während sie sinnlich verwirrend, wie ein Kaleidoskop ausstrahlen, befragen sie das Dasein des Menschen mit seinen Emotionen und Abgründen.



Bekannt wird Ute Fründt wenige Jahre nach ihrem Studium, das sie als Meisterschülerin von Bernd Koberling an der Universität der Künste in Berlin abgeschlossen hat, durch das Berliner „Goldrausch“-Stipendium 1996/97. Dazu ist ein Katalog, der die Serie Studio zeigt, erschienen: Auf 20 x 15 cm kleinen Malereien in Gouache auf Nessel sind Frauen in häuslichen Szenen zu sehen. Der Hintergrund ist schon hier farbig strukturiert – da noch im händisch-lässigen Auftrag der Linien, Überkreuzungen, rechteckigen Flächen –, sodass die Figur mit ihren unterschiedlichen Kleidern, Röcken oder in Unterwäsche wie auf einer Bühne auftritt und dort etwa Malerpaletten und Pinsel hält oder eine Tasche oder Besen trägt. Ute Fründt dekonstruiert hier Rollenbilder, auf einzelnen Bildern bezieht sie den Mythos Walt Disney mit der Mickey Mouse auf spielerische Art ein, das Ganze präsentiert sie ausgesprochen unspektakulär. Mit der anschließenden Serie der Holly Golightly aus „Frühstück bei Tiffany“ wendet sie sich dem Glamour zu. Sie zeigt das Porträt des leichthin das Leben feiernden Partygirls, das von Audrey Hepburn gespielt wird. Sie konzentriert sie als Ausschnitt, die Kleidung ganz im Trend, die Haare modisch frisiert, mit und ohne Sonnenbrille, mit laszivem Augenaufschlag, dazu die Farbe weitgehend herausgezogen, fast in Schwarz-Weiß. Hier kommt der Blick als Strategie der Verführung hinzu. Nicht nur die Accessoires und das Aussehen selbst, sondern auch das Anschauen vermittelt Reize. Unser Blick wird erwidert oder spiegelt sich geradezu in der Sonnenbrille. Holly Golightly träumt vom Wohlstand und vom „Schöner Wohnen“ als kollektive Wünsche, die aber eben doch Oberfläche sind und die Frage nach Glück aufwerfen. Ute Fründt geht dem noch in kleineren Bildtafeln nach, die in klaren, flächig getrennten Farben Architektur und Mobiliar zusammenschieben und durch die Bildtitel (Monte Carlo, Forty Deuce, Menotti, Pool, Broadway) assoziativ Attraktivität vermitteln. Da ist der Schminktisch von Karl Lagerfeld oder die Spirale eines Treppenhauses, gesehen steil von oben, oder eine Sitzgruppe mit ihren roten runden Kissen. „Fründt is painting a critical reference to western culture and encourages us to reflect upon its impact”, hat Helene Lundbye Peterson

dazu im Katalog zur Gruppenausstellung „Realism Reversed“ in Kopenhagen und Oslo 2005 geschrieben.
Ute Fründt hält inne, schüttelt energisch den Kopf und stützt sich auf dem Tisch auf: Die Bilder, um die es dabei geht, sind in den frühen 2000er-Jahren entstanden. Zu lange zurück, um noch mal auf sie einzugehen. Die nachfolgenden Bilder sind wichtiger, aktueller – die, mit denen sie sich der Natur zugewandt hat, die damit zugleich an Komplexität und Raffinesse gewonnen haben und die ebenso von unserem Sehen und Begehren berichten. Ein zentrales Sujet ist bis heute der Baum. Er wird etwa von Schnee ummantelt oder ist mit seinen Nadeln Tannenwald oder zeigt die Kirschblüte, überhaupt handelt es sich meist um exotische Gattungen. Vor allem die Palmen vermitteln einen Hauch von Sehnsucht. Die Vegetation selbst interagiert mit dem musterartigen Bildgrund und hebt sich doch in ihrer malerischen

Attraktion ab. In Absolute Stille (2005) umspannt eine kokonartige, milchig weiße Hülle einen Baum und verdeckt dabei ein aus Punkten und Strichen angelegtes Haus. Einzelne Zweige ragen nach vorne heraus. Im unteren Bereich liegt davor ein schwarz konturiertes, amorphes Rosa und erinnert an das Inkarnat der Haut. Wie eine Hand fokussiert es die Szene weiter und führt eine Distanz des Sehens ein. Zumal im Kontrast zum Wuchernden, das die Bäume zunächst gekennzeichnet hat, erinnern spätere Bilder an die flächig aufgefassten Holzschnitte der japanischen Kultur. Das domestiziert Künstliche ist bei ihnen durch die Anlage der Äste und merkwürdige, teils stachelige Früchte gesteigert. Zu sehen sind Naturschauspiele. Schließlich erfasst das Bewegte auch die Bäume selbst, deren Stämme weich und biegsam werden, ja, sich in der Balance halten müssen. Einzelne lassen vielleicht an Knochengerüste denken, um die als dichter Flaum mit einer leuchtenden Korona die Belaubung gelegt ist.
Die Verläufe des Baumes wechseln zwischen zackig und gebogen und reagieren damit noch auf die Bänder und Sterne im Hintergrund. In dem neuen Gemälde Welt (2025) kommen einige dieser Aspekte zusammen. Die beiden eng nebeneinanderstehenden, aus einem Hügel herauswachsenden Bäume wirken fast wie Scherenschnitte kommunizierender Lebewesen. In ihr helles Braun sind Strukturen eingeritzt, die das kantige Verzweigen der Äste ergänzen und begleiten. Auf ihnen sitzen Blüten auf, die mit ihren rötlichen Halbkugeln an die Hüte von Pilzen erinnern und von einer Vielzahl an blauen Farbkugeln begleitet werden, die noch wie Seifenblasen – oder die Flocken eines Schneegestöbers oder die Luftblasen einer Unterwasserwelt? – wirken. Andererseits evozieren die Verläufe der Lichtpunkte, die sich von einzelnen Zentren wie Seesterne ausbreiten, den Anschein von Sternbildern und von Feuerwerk, das sich nun wie Girlanden über das gesamte Bild legt. Dazu treten hier Schmetterlinge auf, die in der Verschiedenheit ihrer Arten die Schönheit und Natürlichkeit betonen und die eigentlichen Akteure dieses Bildes sind und dieses weiter verlebendigen.
Was für ein Potenzial für ihre künstlerischen Anliegen das Spinnennetz besitzt, hat Ute Fründt in ihrer Malerei erstmals Mitte der 2000er-Jahre untersucht, indem sie ein solches ausschließlich gemalt hat. Zur Wirkung trägt mitunter ein tiefschwarzer Bildgrund bei, der noch mit mäandernden, farblich nuancierten Bändern gegliedert sein kann. Die Netze davor setzen sich aus einzelnen, zögernd, aber auch elegant aufeinanderfolgenden gold-gelben Setzungen zusammen, die Fragilität mit Robustheit verknüpfen. Ute Fründt hat diese Farbtropfen, die an Perlen erinnern und hier wie Tau wirken, so aufgetragen, dass sie plastisch auf der Bildfläche stehen. Für sich auf ein Epizentrum hin angelegt, breiten sich die Netze nach allen Richtungen aus. Einzelne querstehende Stege stabilisieren die Konstruktion, dazwischen hängen Fäden durch oder sind in Parallelführungen eng zusammengerückt und konterkarieren so die Ordnung und Perfektion. Ein äußerer, umlaufender Faden hält das alles zusammen und ist, außerhalb der Darstellung, wie zwischen Ästen
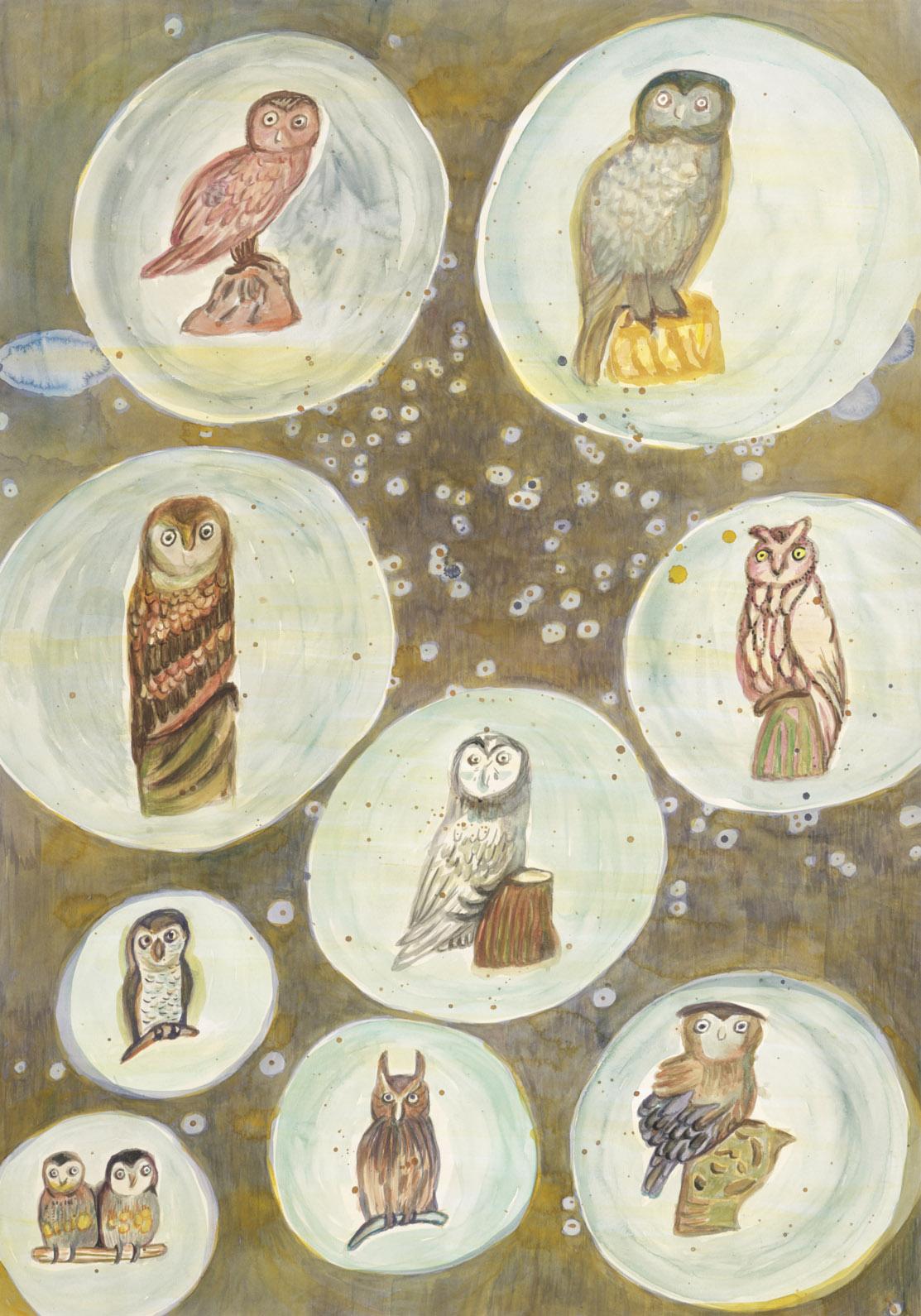
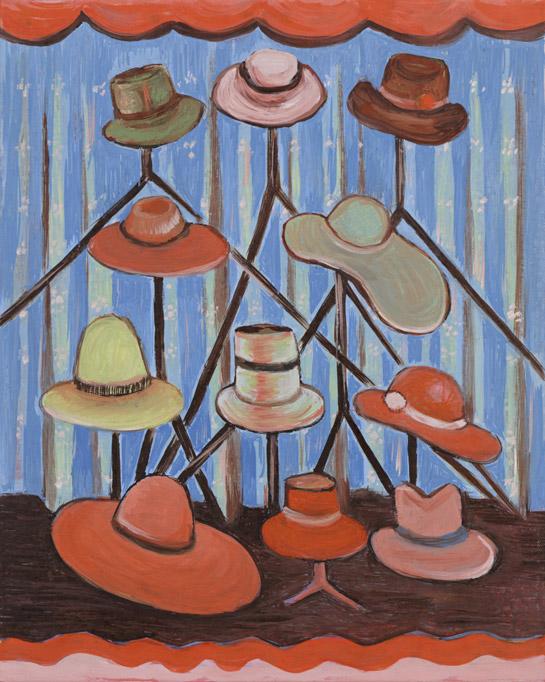
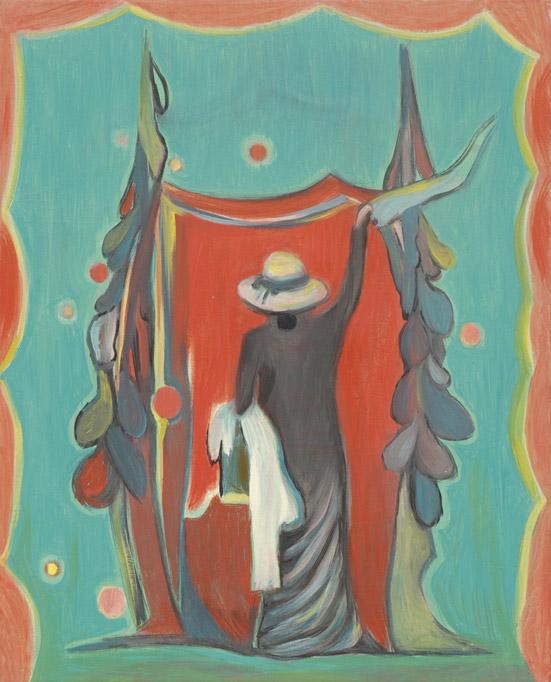
gespannt. Aber was ist bei diesen Gebilden auf der Bildfläche vorne und was hinten: das Zentrum oder der stufig sich nach draußen wölbende, ebenso genaue, wie verwackelte, weil noch vom Wind verrückte Aufbau der Netze? In dieser Malerei sind die Spinnennetze mit ihren Fäden größer, breiter als in der Realität. Zugleich klingen Assoziationen an Sternbilder und im übertragenen Sinne an Schallwellen an. Vor allem stehen die Spinnennetze für die Leistungen und das erstaunlich Widerstandsfähige der Natur und werden zu Parabeln für einen Plan und ein Geschehen, das sich nach allen Regeln der Kunst verselbständigt und bei dem Scheitern und Gelingen sich die Waage halten. Sie stehen für eine reine Schönheit dort, wo man sie wahrscheinlich nicht erwartet, und für einen Entwurf der Welt.
Seit dieser Zeit intensiviert Ute Fründt auch die Bänder und Muster und die Anordnung von Scheiben im Hinter- und im
Vordergrund. In den geschwungenen Verläufen erreicht sie eine Dynamisierung, bei der sie das gesamte Bildfeld zum Leuchten und Vibrieren bringt und das Schauen nie zur Ruhe kommt. „Farb- und Formereignisse verzahnen sich in der dichten Malerei zu einem polychromen, fluktuierenden Mosaik, die materielle Oberfläche löst sich in mehrschichtige, mehrfarbige Muster auf, die selbständig auf der Fläche tanzen, im und als Licht flimmern und strahlen“, hat Dorothée Bauerle-Willert geschrieben. „Sie arbeitet mit Dezentrierung und fremden Hierarchien, mit Wiederholung und Rhythmus, und das Bildfeld wird – auch in der durch den ornamentalen Grund in Gang gesetzten Expansion über den Bildrand hinaus – zu einer beweglichen Simultaneität, die die rigiden Zuordnungen von Zeichen und Sinn in Frage stellen“. (Kat. Herbert-Weisenburger-Stiftung, Rastatt 2010) Diese Bilder wirken psychedelisch, sie erinnern an Op Art und vereinen diese mit Motiven des Symbolismus. Dazu verwendet sie über-
zeitliche Topoi und Verfahren. Zugleich geht es um das Sehen und die Synästhesie der Wahrnehmung, um das Zusammenbringen von inneren und äußeren Bildern und Temperamenten.
In ihren neueren Malereien sucht sie nach einer inneren Wahrheit in kleinen besonderen Situationen mit einigen wenigen Motiven, die sie mit Energie auflädt. Zugleich nimmt sie das Ornament zurück. Daraus entstehen merkwürdige, teils groteske Szenen mit Menschen als Akteuren, die aus einer vergangenen Zeit zu kommen scheinen. Nun gewinnt die Bühne, jetzt in Verbindung mit Theatralik, wieder Bedeutung, der Zirkus und seine Formen der Präsentation spielen eine Rolle, Zelte öffnen sich. Ein Gemälde zeigt einen Angler, der in seinem Kahn mit dem Rücken zum Betrachter in das Bild hineintreibt. Wie ein Cowboy schwingt er die zwei Zügel über den Wellen der rot-schwarzen, holzschnittartigen Wasserfläche. Mit dieser Angelrute fängt er Hutformen ein. Auch hier liegt eine Vielzahl an Blasen, die alle einen gelb-roten Ton besitzen, über und im Ereignis selbst. Nun verwandeln sich die Kugeln aber auch in nierenartige Formen. Das trifft auf die Darstellung einer Schautafel zu, auf der, wie in Bernstein gegossen, Eulen abgebildet sind. Ein anderes Gemälde zeigt Hüte auf ihrer Ablage in einem Schaufenster, das mit Vorhängen begrenzt ist. Überhaupt verwendet sie immer wieder Hüte, die auch Pilze sein können oder an Seifenblasen anspielen, also auf Erinnerung, Fantasie und eine in sich abgeschlossene Welt weisen. Farewell (2021) schließlich zeigt eine aufgerichtete Frau in Rückenansicht vor einem grünen Durchgang, der an die verschobenen Rauten von Spielkarten erinnert und seinerseits von einem orangefarbenen Außenfeld umfangen ist. Sie trägt ein langes Kleid und einen Sonnenhut und hat ihren rechten Arm erhoben: Winkt sie oder schiebt sie ein grünes Band zur Seite, um durch die Öffnung zu gehen? Am linken Arm hält sie eine Tasche und ein Kleidungsstück. Zu sehen ist eine Szene des Abschieds, der immer auch ein Neubeginn ist: Die Bilder von Ute Fründt spielen vor und hinter den Kulissen.#
Thomas Hirsch
1965 geboren in Gifhorn
1988–1993 Studium Freie Kunst (BfA) an der UDK Berlin
1994 Meisterschülerin (MfA) bei Prof. Bernd Koberling
2007 Arbeitsstipendium Stiftung Kunstfonds Bonn
1997 DAAD-Stipendium, London
1996 Stipendium zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses (Nafög), Berlin
1996 Goldrausch-Stipendium, Berlin
1992 Arbeitsstipendium für Barcelona des Royal College of Art, London
1992 Förderung durch das Frauenprojekt der UDK
2024 Konnichiwa, Alte Schule, Wasbüttel
2022 Wie die Vöglein so lieblich singen, Jägerschere, Wiepersdorf
2021 Mein kleiner Mann im Ohr, DRK Kliniken Berlin Westend
2017 Zwanzig, Galerie Barbara Thumm, Berlin
2010 Herbert-Weisenburger-Stiftung, Rastatt
2005 Realism reversed, Christian Dam Galleries, Kopenhagen und Oslo
2001 Firemousegod – cult and fame, Galerie Barbara Thumm, Berlin
1999 Galeria Guido Carbone, Turin

Radierer, Bauforscher und Antikenhändler im Rom des 18. Jahrhunderts
Der Architekt, Radierer, Zeichner, Antikenforscher und -händler Giovanni Battista Piranesi (1720–1778) [1] war zu seinen Lebzeiten eine der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Persönlichkeiten im römischen Kunstbetrieb. Viele seiner künstlerischen und geschäftlichen Aktivitäten sind fast in Vergessenheit geraten. Heute wird der Name Piranesi vor allem mit seinen kühn inszenierten radierten Ansichten der Monumente Roms und seiner Umgebung in Verbindung gebracht. Viele der Radierungen Piranesis prägten und prägen bis heute die Vorstellung von der Ewigen Stadt und sind tief im kollektiven Bildgedächtnis verwurzelt.
Piranesi betrat 1740 im Alter von 20 Jahren das erste Mal römischen Boden, und zwar als Zeichner im Gefolge des venezianischen Botschafters Marco Foscarini, der nach der Wahl Papst Benedikts XIV. Lambertini aus der Lagunenstadt nach Rom entsandt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Piranesi bereits eine Ausbildung als Architekt und Wasserbauingenieur absolviert sowie Grundlagen der Perspektive und das Radieren gelernt. Der Künstler stammte aus einer Familie von Bauhandwerkern und Architekten, in der ihm offenbar schon sehr früh die Begeisterung für die Architektur und Kultur der Antike vermittelt worden war.
Nur zu gerne wüsste man heute, welche Gedanken dem jungen Architekten durch den Kopf gingen, als er Rom zum ersten Mal gegenüberstand. Dass er von der Großartigkeit der Stadt mit ihren mächtigen antiken Ruinen und Überresten, die noch heute überall das Stadtbild prägen, den prächtigen neuzeitlichen Kirchen, Palästen und Plätzen tief beeindruckt gewesen sein muss, lassen seine späteren Werke erkennen. Bis auf einen kurzen Zeitraum in den 1740er-Jahren, in dem er wegen Geldmangels gezwungen war, nach Venedig zurückzukehren, blieb Rom fortan Piranesis Lebensmittelpunkt.
Nach der Ankunft in der Ewigen Stadt musste der junge Architekt jedoch bald erkennen, dass hier keine Bauaufträge zu erhalten waren. In Rom gab es nach mehr als 200 Jahren einer kulturell außerordentlich glanzvollen Periode kaum noch Aufgaben für Maler, Bildhauer und Architekten. Tatsächlich wurden hier in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur wenige größere Bauten ausgeführt.
Die meisten, wie die Spanische Treppe von von Francesco De Sanctis (1679–1731) oder die Fassade von San Giovanni in Laterano von Alessandro Galilei (1691–1737), waren gerade abgeschlossen, andere waren seit einigen Jahren im Gange, wie der Neubau der Fontana di Trevi von Nicola Salvi (1697–1751).
So muss der junge Künstler nach Alternativen suchen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er tritt in die Werkstatt des auf Romansichten spezialisierten Stechers Giuseppe Vasi ein. Doch bereits nach wenigen Monaten verlässt er Vasi nach einem Streit wieder, denn er glaubt, dieser verrate ihm nicht alle Geheimnisse seiner Radierkunst.
Nach der Trennung von Vasi entstehen einige kleinformatige Darstellungen römischer Monumente als Illustrationen für den von Ridolfini und Amidei herausgegebenen Romführer Roma Moderna Distinta Per Rioni. Hier lässt sich bereits Piranesis Potenzial erkennen, das wenige Jahre später zur vollen Entfaltung kommen wird.
Gleichzeitig übt die die antike römische Architektur eine ungeheure Faszination auf den jungen Venezianer aus und er beginnt gemeinsam mit Gleichgesinnten, die antiken Ruinen zu studieren und zu vermessen. Diese Beschäftigung mündet 1743 in Piranesi eine erste Radierungsfolge mit dem Titel: Prima Parte
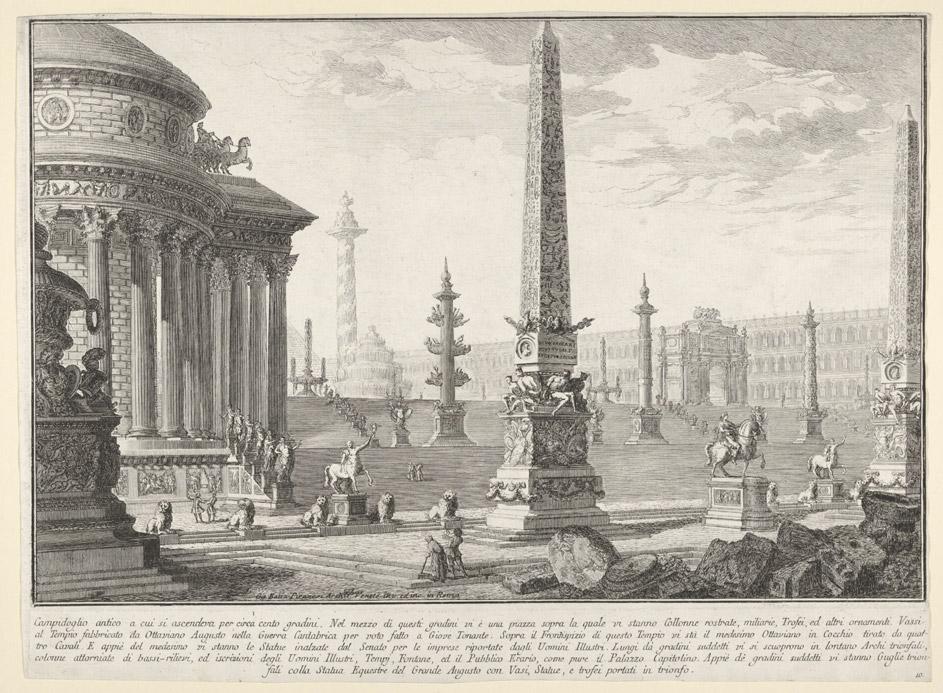
di Architetture e Prospettive …, in denen er seine Vision der antiken Stadt mit fantastischen Architekturen oder Ruinenlandschaften vor Augen stellt [2]
Im gleichen Jahr muss der junge Architekt Rom aus Geldmangel verlassen und kehrt nach Venedig zurück. Hier verbringt er einige Zeit im Atelier von Giovanni Battista Tiepolo, der als Maler und Grafiker zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Piranesi die aktuellen Tendenzen der venezianischen Druckgrafikproduktion genau studiert hat, wie etwa die Radierungen von Canaletto, dessen Technik der lockeren und virtuosen Linienführung den jungen Künstler vermutlich stark beeindruckt hat. In den Jahren, in denen sich Piranesi in Venedig aufhält, boomt die Produktion von Stadtansichten, den so genannten Vedute, und jene von Capricci, einer druckgrafischen Gattung, bei der schöpferische
Ideen und Erfindungen ohne vorgegebene Regeln dargestellt werden konnten.
Mit derartigen Anregungen im Gepäck kehrt Piranesi 1747 nach Rom zurück. Wenige Jahre später, 1749/50, erscheint seine berühmte Serie der Carceri, Kerkerdarstellungen, die nach den Prinzipien des Capriccio organisiert sind [3]. Diese Folge imaginierter, bedrohlich wirkender Kerker ruft durch die fantastischen und zugleich bedrückenden Raumstrukturen den Eindruck hervor, es gäbe aus ihnen kein Entrinnen. Ebenso lassen die selten explizit gezeigten, doch meist angedeuteten Folterszenen in den Kerkern die Betrachtenden tief verstört zurück.
Kurz vor den Carceri hatte Piranesi mit der Produktion einer weiteren außergewöhnlichen druckgrafischen Serie begonnen, den Vedute di Roma. Anders als die meisten anderen Radierungsserien Piranesis
[2] Giovanni Battista Piranesi, Campidoglio antico [...], Tafel 10 aus: Prima parte di Architetture, e prospettive inventate, ed incise da Gio. Batt'a Piranesi Architetto Veneziano [...], Rom 1743. [3] Giovanni Battista Piranesi, Die Treppe mit Trophäen, aus: Carceri, 1. Auflage, Rom 1749/50, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, Inv. 1984.54.128.
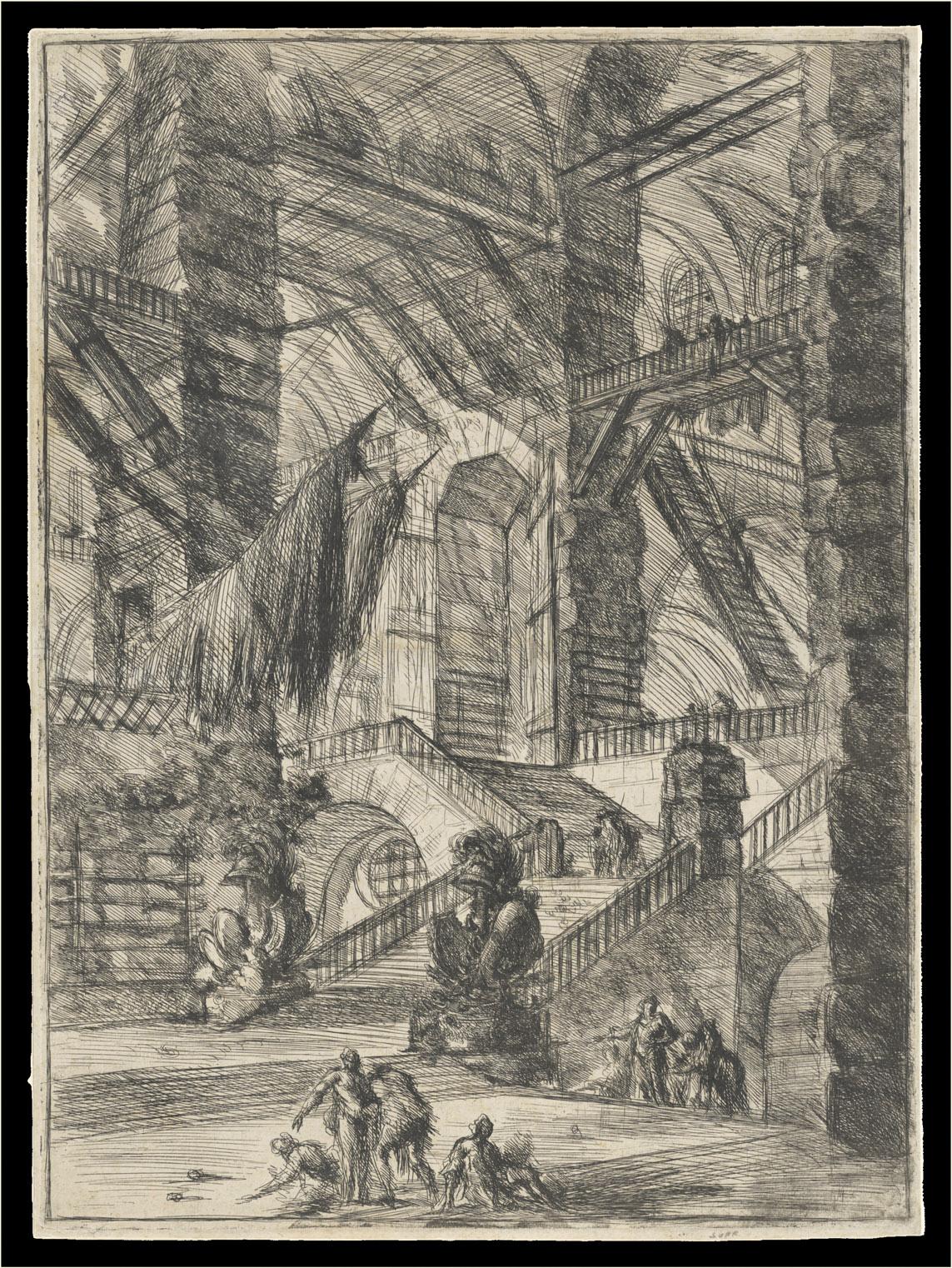

– auf die später noch eingegangen wird – erschienen diese großformatigen Ansichten der Monumente Roms und seiner Umgebung als Einzelblätter über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten.
Die Vedute di Roma sollten den Ruhm des Künstlers über seine eigene Lebenszeit hinaus bis in die Gegenwart begründen. Doch was war es, das Piranesis römische Ansichten so erfolgreich gemacht und für ihre Verbreitung in ganz Europa gesorgt hatte? Wie unterschieden sich Piranesis Romansichten von denen seiner Vorläufer seit dem 16. Jahrhundert? Wie inszenierte er die römischen Bauten und Monumente in seinen Radierungen, um zu seinen ikonischen Bildprägungen zu kommen? Dies soll an drei Beispielen hier gezeigt werden.
Bei seiner Darstellung der Kirche Santa Maria Maggiore [4] leitet Piranesi den Blick der Betrachtenden auf die Basilika durch so genannte Repoussoirarchitekturen, die als Begrenzung an den Bildrändern im Schatten liegen. Die Fassade erscheint in leichter Schrägansicht, wodurch erstens die Symmetrie der Darstellung vermieden und zweitens die Plastizität des wenige Jahre zuvor, 1741, von Ferdinando Fuga errichteten Portikus und der darüber liegenden Benediktionsloggia gesteigert wird.
Die Säule, die eigentlich vor der Mitte der Fassade auf dem Platz steht, hat Piranesi nahe an den vorderen Bildrand herangeschoben, so dass sogar die Madonna oben abgeschnitten wird. So wird die Wirkung der antiken Säule gesteigert, die 1614 aus der antiken Maxentiusbasilika auf dem Forum, dem vermeintlichen Friedenstempel, entnommen und als Friedenssäule auf dem Platz aufgestellt worden war. Die Säule und die Gebäude

werden in leichter Untersicht gezeigt, was gemeinsam mit den viel zu kleinen Staffagefiguren die Monumente erheblich größer erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind. Die im Vordergrund auf dem Platz liegenden antiken Architekturfragmente erinnern die Betrachtenden daran, dass die Antike stets gegenwärtig ist. Der Himmel mit seinen bewegten Wolken verleiht der Darstellung einen dramatischen Charakter.
Ähnliche Inszenierungsprinzipien bemerkt man auch bei einem anderen Blatt Piranesis, der in der zweiten Hälfte der 1740er-Jahre entstandenen Veduta della Piazza del Popolo [5] Die Piazza del Popolo liegt direkt am nördlichen Stadttor Roms und war somit der Platz, den die aus dem Norden kommenden Reisenden als erstes sahen. Von hier aus führen drei gerade Straßen als ein Dreistahl in die Stadt. Zwischen diesen liegen zwei kleine Zentralkirchen. Wieder vermeidet Piranesi eine
symmetrische Darstellung, wodurch die beiden gleich großen Kirchen mit ihren Kuppeln unterschiedlich groß dargestellt werden. Die Via del Corso in der Mitte zwischen den Kirchen erscheint extrem geweitet, obwohl sie tatsächlich nur etwa so breit ist wie die beiden flankierenden Straßen. Ähnlich wie die Säule vor Santa Maria Maggiore rückt Piranesi in seiner Radie rung den antiken Obelisken, der in der Mitte des Platzes steht, dicht an den vorderen Bildrand. Dort befinden sich wieder antike Spolien und sehr kleine Staffagefiguren, die die Monumente umso größer wirken lassen. Damit der Obelisk ganz ungestört wirken kann, platziert Piranesi ihn so, dass der Gloc kenturm der rechten Kirche, Santa Maria dei Miracoli, von ihm vollständig überschnitten wird.
Vergleicht man Piranesis Vedute mit der seines zeitweiligen Lehrers Giuseppe Vasi, der denselben Ort in einer streng sym-
[5] Giovanni Battista Piranesi, Veduta della Piazza del Popolo, um 1748, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv.

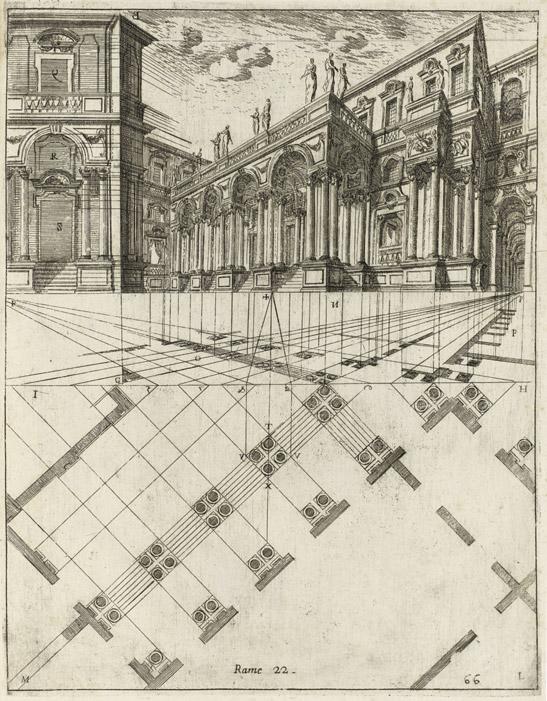
metrischen Komposition darstellte [6], wird Piranesis Originalität sehr deutlich.
Piranesi zeigte oft Gebäude oder antike Monumente über Eck und in Untersicht, so dass der Blick der Betrachtenden in zwei Richtungen gelenkt wird. Dabei machte er sich ein Kompo si tions prinzip aus der Theaterarchitektur zunutze und entwickelte es weiter, nämlich die so genannte scena per angolo, die der Bologneser Architekt und Szenograf Ferdinando Galli da Bibbiena (1657–1743) im Jahre 1711 zum ersten Mal publiziert hatte [7]. Es handelt sich dabei um eine schräg einzusehende Raumkonstruktion, die ausgehend von einer vorgezogenen Gebäudeecke über zwei Fluchtpunkte entwickelt wurde und sich in zwei diagonalen Richtungen scheinbar zu unendlichen Raumfolgen hin öffnete. Der Blick wurde dabei nicht auf einen zentralen Fluchtpunkt gelenkt, sondern gleichzeitig nach links und rechts gezogen. Es entstand so der Eindruck, die Architektur komme auf die Betrachtenden zu. Sehr deutlich wird dies bei Piranesis Veduta della Basilica di San Paolo fuori delle Mura aus den 1750er-Jahren [8]
Neben der Produktion der großformatigen Ansichten Roms beschäftigte sich Piranesi in den 1750er- und 1760er-Jahren verstärkt mit der Erforschung, Darstellung und Interpretation der römischen Architektur. Diese Forschungen mündeten in eine Reihe von archäologischen Publikationen. Man muss sich diese als großformatige Bücher vorstellen, die opulent mit radierten Abbildungen in zahlreichen Tafeln ausgestattet waren, die zum Teil herausgeklappt werden konnten. Dabei ergänzten sich Text und Bilder gegenseitig.
In seinem Werk Le Antichità Romane (Die Römischen Altertümer), das 1756 in vier Bänden erschien, beschäftigte sich Piranesi im ersten Band mit den Resten der antiken Gebäude, in Band II und III mit den römischen Grabmonumenten und im vierten Band mit den „ponti
[6] Giuseppe Vasi, Piazza del Popolo con Obelisco Egizio, aus : Le Piazze principali con obelischi, colonne ed altri ornamenti , Rom 1752. [7] Ferdinando Galli da Bibbiena, Scena per angolo, Tafel 22, aus: L’architettura civile..., Parma 1711, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.4.

antichi, gli avanzi de' teatri, de' portici e di altri monvmenti di Ro ma“, also den antiken Brücken, den Resten der Theater, den Portiken und den anderen Monumente von Rom. Die vier Bände enthalten insgesamt 252 radierte Darstellungen in kleinformatigen Abbildungen, ganzseitigen Tafeln sowie doppelt oder mehrfach gefaltete Tafeln zum Ausklappen. In seinem Vorwort beschreibt Piranesi ausführlich die Gründe, die ihn zu dieser Publikation geführt hätten und was er damit habe bezwecken wollen:
„Da ich sah, dass die Überreste der antiken Bauten Roms, die zum großen Teil über die Gärten und andere landwirtschaftlich genutzte Flächen verstreut sind, von Tag zu Tag mehr zusammenschrumpfen, teils durch die Verwüstungen der Zeit, teils durch die Habgier der Besitzer, die mit barbarischem Gleichmut die Ruinen heimlich abreißen und die Steine zur Verwendung bei Neubauten verkaufen,
habe ich mir vorgenommen, sie mit dem Mittel des Druckes zu bewahren […].
Deshalb habe ich in den vorliegenden Bänden mit aller erdenklichen Sorgfalt die erwähnten Relikte abgebildet: Ich habe bei vielen nicht nur ihr äußeres Erscheinungsbild wiedergegeben, sondern auch ihren Grundriss und das Innere, ich habe die einzelnen Teile durch Schnitte und Aufrisse unterschieden und die Materialien, gelegentlich auch die Konstruktionsweise der Bauten angegeben, wozu ich mir die Einsichten im Verlauf langer Jahre unermüdlicher und ge naues ter Beobachtungen Grabungen und Untersuchungen erworben habe.“ (Deutsche Übersetzung von Corinna Höper)
Blättert man durch die Bände der Antichità Romane, so findet man dieses Konzept anschaulich mit Radierungen der unterschiedlichsten Genres verwirklicht, die alle Piranesis Vorstellung
[8] Giovanni Battista Piranesi, Veduta della Basilica di S. Paolo fuor delle mura, 1748, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.11.46.
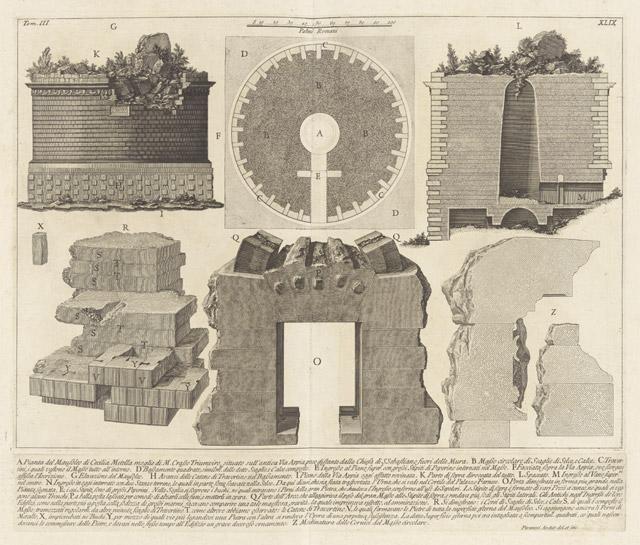

der antiken römischen Baukunst und Zivilisation dokumentieren. So findet man neben exakten Aufmaßen und Detailwiedergaben [9] auch fantastische Rekonstruktionen, wie die des Circus an der Via Appia [11] mit seinen Monumenten sowie Tafeln, die die antike Bautechnik erklären. Nicht selten fügt Piranesi kleinere Bilder ins Hauptbild ein [10], auf denen weitere Details gezeigt werden. Der Eindruck ähnelt einem heutigen Desktop mit mehreren geöffneten Fenstern.
Diese äußerst systematische und zugleich künstlerisch höchst anspruchsvolle Darstellungsweise in Kombination mit den Texten Pi ranesis sicherte den Antichità Romane europaweit einen durchschlagenden Erfolg. Wenige Monate nach Erscheinen der vier Bände wurde Piranesi am 24. Februar 1757 zum Ehrenmitglied der Society of Antiquaries of London ernannt.
1761, fünf Jahre nach der Publikation der vier Bände der Antichità Romane, setzte Piranesi die Reihe seiner archäologischen Publikationen mit dem Werk Della Magnificenza Ed Architettvra De' Romani (Über die Großartigkeit und Architektur der Römer) fort. Die Konzeption ist jedoch eine andere als bei den Antichità Romane, denn das Buch stellt Piranesis ersten theoretischen Beitrag zur Debatte um die Vorrangstellung der römischen oder griechischen Kunst dar, die in den 1750er- und 1760er-Jahren von Gelehrten und Architekten geführt wurde.
Ungeachtet des architekturtheoretischen Zusammenhanges, in den man das Werk Della Magnificenza … einordnen muss, ist auch hier, ebenso wie bei den Antichità Romane, die künstlerische Qualität der Radierungen außerordentlich hoch.
Piranesis antiquarische Werke stellten die Früchte einer unermüdlichen Arbeit des Forschens, Ausgrabens, Vermessens und Zeichnens dar. Seine Publikationen basierten auf hunderten, wenn nicht tausenden von Zeichnungen, die vor Ort und im Atelier angefertigt worden sein müssen.
[9] Giovanni Battista Piranesi, Aufnahmen von Details vom Grabmal der Cecilia Metella an der Via Appia, aus: Le Antichità Romane, vol. III, Rom 1756, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.12.3.1-54. [10] Giovanni Battista Piranesi, Erklärung der Technik, mit der die großen Steine am Grabmal der Cecilia Metella versetzt wurden, aus: Le Antichità Romane, vol. III, Rom 1756, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.12.3.1-54.
Bis vor wenigen Jahren waren nur sehr wenige dieser Zeichnungen bekannt. Die meisten von ihnen befinden sich in der New Yorker Morgan Library. Viele von diesen Blättern konnten und können nicht als Vorzeichnungen für die Radierungen der archäologischen Werke angesprochen werden. Es bestand also eine große Differenz zwischen den relativ wenigen bekannten Zeichnungen Piranesis und seinem großen druckgrafischen Werk.
Dieses Rätsel konnte die Forschung zum Teil lösen, nachdem 2014 ein Zeichnungskonvolut von etwa 300 Blättern in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe als Teil des Zeichnungsbe-
standes der Piranesiwerkstatt identifiziert werden konnte. Diese Zeichnungen waren mit dem Nachlass des klassizistischen Karlsruher Architekten Friedrich Weinbrenner (1766–1826) nach Karlsruhe gekommen. Er hatte sie in den 1790er-Jahren in Rom vom Sohn Piranesis erworben, um sie als Vorlagen für seine eigene Arbeit zu verwenden.
Die Karlsruher Blätter ergeben in Kombination mit den Zeichnungen der Morgan Library oftmals ein kohärentes Bild, wie in der Werkstatt Piranesis gezeichnet und wie die Zeichnungen genutzt wurden. Weiterhin wurde in den folgenden Jahren klar,
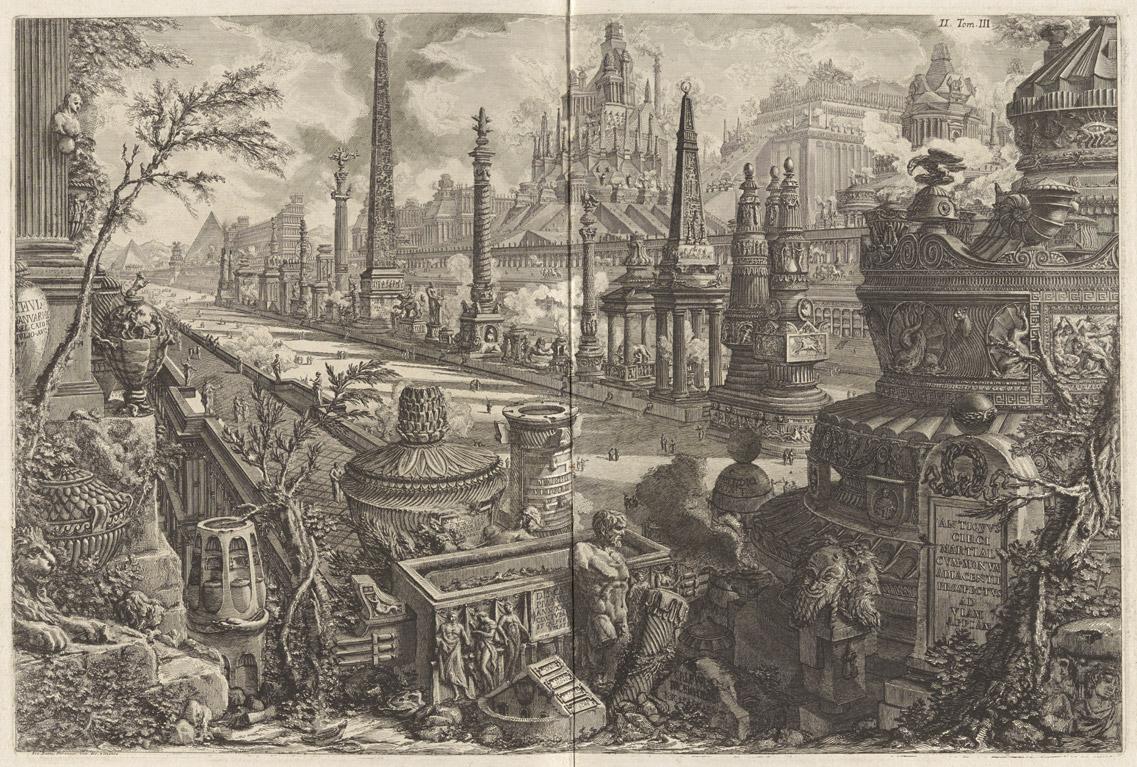
[11] Giovanni Battista Piranesi, Phantastische Rekonstruktion des Circus an der Via Appia, aus: Le Antichità Romane, vol. III, Rom 1756, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.12.3.1-54

dass Piranesi in seiner Werkstatt über die Jahre eine größere Anzahl von Zeichnern beschäftigt hatte und dass diese Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Aufgaben betraut gewesen waren. So waren es in der Regel die Mitarbeiter, die die Skizzen Piranesis ins Reine zeichneten. Dabei entstand im Laufe der Jahre ein umfangreiches Werkstattarchiv mit Nachzeichnungen von antiken Bauornamenten wie Kapitellen, ornamentalen Friesen oder Bauplastik.
Nach der Veröffentlichung der Antichità Romane war Piranesi schlagartig in ganz Europa berühmt geworden. In der Folge wurde er als Experte der antiken römischen Architektur zu einer Anlaufstelle für Architekten des beginnenden Klassizismus aus ganz Europa. Forschungen an der Kunsthalle Karlsruhe konnten zeigen, dass beispielsweise Architekten wie die Brüder Robert (1728–1792) und James Adam (1732–1794) aus London oder der
deutsche Architekt Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736–1800) nicht nur während ihrer jeweiligen Romaufenthalte mit Piranesi in Kontakt traten, sondern auch, dass sie Zeichnungen nach antiken Ornamenten erwarben, die im Laufe von Piranesis Forschungsarbeiten in seiner Werkstatt angefertigt worden waren [12]
Viele der Architekten aus Nordeuropa, die in den der 1750erund 1760er-Jahren nach Rom kamen, hatten einen großen Be darf an hochwertigen Darstellungen antiker Ornamente, die direkt nach den antiken Vorbildern gezeichnet waren, um sie als Motivvorrat für die eigene Arbeit zu nutzen. Doch meist hatten sie keine klassische Zeichenausbildung genossen wie die italienischen Künstler und dazu wenig Zeit. Daher erwarben sie eher Zeichnungen, als selbst zu Kreide und Papier zu greifen.
[12] Zeichner der Piranesiwerkstatt, Fries mit Löwengreifen, nach antikem Vorbild aus der Domus Flavia auf dem Palatin, Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Inv. Nr Inv. Nr. IX5159-35-15-2.
Die Untersuchung des Karlsruher Zeichnungskonvolutes offenbarte, dass in den Jahren vor und nach 1760 solche Zeichnungen für europäische Architekten geradezu manufakturmäßig in größerer Menge hergestellt wurden. Piranesis Mitarbeiter be dienten sich dazu des Verfahrens des Abklatsches. Dabei wird eine in Kreide ausgeführte Zeichnung mit der bezeichneten Seite auf ein zuvor angefeuchtetes Papier gelegt und dann werden bei de Blätter durch die Druckerpresse getrieben. Auf diese Weise entsteht eine seitenverkehrte, etwas schwächere Kopie der originalen Zeichnung. Das Abklatschen sparte Zeit und Arbeitskraft, denn eine einmal fertiggestellte Zeichnung konnte man so ohne großen Aufwand vervielfältigen und brauchte sie nicht noch einmal von Hand zu kopieren.
Oft wurden die Abklatsche noch einmal übergangen, das heißt die Linien wurden mit Kreide aufgefrischt, so dass man auch von einer solchen Kopie einen Abklatsch nehmen konnte. In verschiedenen Nachlässen von Architekten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus ganz Europa findet man solche Abklatschkopien nach Zeichnungen aus Piranesis Werkstatt.
Piranesi als Architekt und als Entwerfer von Kaminen
Nachdem am 6. Juli 1758 der Venezianer Carlo della Torre Rezzonico als Clemens XIII. Papst geworden war, verbesserten sich für Piranesi die Bedingungen seiner Arbeit und die Auftragslage seines Unternehmens. Der neue Papst und seine Verwandten förderten ihren Landsmann nicht nur mit Steuererleichterungen für den Erwerb von Druckpapier, sondern erteilten Piranesi auch verschiedene architektonische Aufträge, von denen jedoch nur der Umbau der Kirche des Malteserordens, Santa Maria del Priorato auf dem Aventin, und die Gestaltung des zugehörigen Vorplatzes realisiert wurden.
Piranesi entwarf eine neue Fassade [13] und schuf für den Innenraum der Kirche eine elegante weiße Stuckausstattung. Er kreierte für die Kirche eine eigene Ornamentik, bei der er
in höchst fantasievoller Weise antike römische Motive mit den Symbolen des Malteserordens und den Wappenbestandteilen der Familie Rezzonico kombinierte.
Den Platz vor dem eigentlichen Zugang zur Kirche des Malteserordens gestaltete Piranesi mit einem Torhaus sowie durch eine Reihe von Stelen und Obelisken, die er an zwei der drei Platzseiten errichtete. Die so geschaffene Platzsituation ist zweifellos von Piranesis Vorstellung antiker römischer Plätze und Straßen inspiriert, wie er sie mehrfach in seinen gedruckten Werken in Form fantasievoller Rekonstruktionen gezeigt hatte.

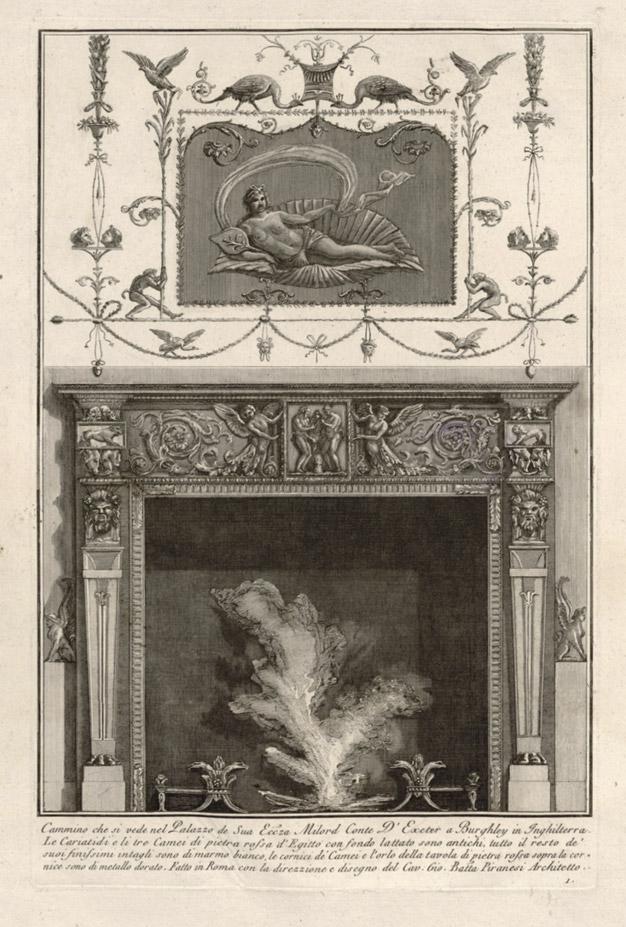
Von der Herstellung von Kaminen mit integrierten antiken Fundstücken war es nur ein kleiner Schritt zu den prächtigen pseudoantiken Dekorationsobjekten aus Marmorfragmenten, die vor allem bei englischen Romtouristen beliebt waren.
[14]
Noch ein weiteres Bauprojekt fällt in das Pontifikat Clemens XIII., nämlich der Plan für den Umbau des Chores der Basilika San Giovanni in Laterano. Dafür schuf Piranesi eine große Anzahl von Entwürfen, die allerdings nicht ausgeführt wurden.
Die kreative Beschäftigung Piranesis mit antiken römischen Ornamenten mündete 1769 in ein weiteres Buch, bei dem der Schwerpunkt jedoch mehr auf dem interior design lag. In seinem Werk Diverse maniere d’adornare i cammini (Verschiedene Arten die Kamine zu gestalten) präsentierte er eine große Zahl von Kamin- und Dekorationsentwürfen sowie Entwürfe für Möbel und verschiedene Geräte. Als Kenner der antiken Baukunst und ihrer Ornamente nahm Piranesi in seinen Kaminradierungen die verschiedensten ornamentalen Vorbilder als Ausgangspunkt, die ihm in den Zeichnungen seiner Werkstattmitarbeiter in großer Zahl zur Verfügung standen. Diese kombinierte er völlig frei und höchst fantasievoll zu neuen Schöpfungen, seinen eigenen Vorstellungen entsprechend.
Schon einige Jahre zuvor hatte Piranesi begonnen, für nordeuropäische Auftraggeber Kaminumrahmungen zu entwerfen. Dabei hatte er nicht auf sein Zeichnungsarchiv zurückgegriffen, sondern antike Fragmente aus dem eigenen Besitz zum Ausgangspunkt für seine Entwürfe genommen und diese in den jeweiligen Kamin integriert. Die Kamine wurden in Rom durch spezialisierte Steinmetzen und Bildhauer ausgeführt, die für Piranesi arbeiteten. In den Di verse Maniere … sind einzelne Kamine abgebildet, bei denen Piranesi in der Bildunterschrift darauf hinweist, dass sie bereits ausgeführt worden seien. Tatsächlich finden sich in englischen Landhäusern erhaltene Kamine, die von Piranesi an englische Adlige verkauft worden waren. Einer dieser Kamine befindet sich heute in Burghley House, dem Sitz des Earl of Exeter. Auf Tafel 1 der Diverse Maniere … [14] beschreibt Piranesi den Kamin wie folgt: „Kamin, den man im Palast seiner Excellenz Mylord Exeter in Burghley in England sieht. Die Karyatiden und die drei Kameen aus ägyptischem rotem Marmor mit hellem Hintergrund sind antik, der ganze Rest seiner feinsten Bildhauereien ist aus weißem Marmor, die
Rahmen der Kameen und der Rand der Tafel aus rotem Stein oberhalb des Rahmens sind aus vergoldetem Metall. Sie sind hergestellt in Rom unter der Aufsicht und nach dem Entwurf des Cavaliere Giovanni Battista Piranesi, Architekt“ (Übersetzung Autor)
Piranesi kreierte also unter Verwendung antiker Bestandteile nach seinem Entwurf Kamine, die dann von Rom aus zu ihren Auftraggebern gesandt wurden, wo sie als nützliche Statussymbole ihren Dienst versahen.
In den folgenden Jahren weitete Piranesi das lukrative Geschäft mit antiken bzw. meist semiantiken Marmorgegenständen aus. Ausgangspunkt für die zahlreichen Vasen, Kandelaber und anderen Gegenstände waren in der Regel antike Fundstücke, die von Piranesi zu prunkvollen Dekorationsobjekten gestaltet und ergänzt wurden. So besteht die nach ihrem ersten Besitzer, einem englischen Bankier, benannte Lyde-Browne-Vase [15] überwiegend aus einem antiken Brunnentrog, den Piranesi mit antiken und neuen Teilen zu einer Vase formte.
Auch ein Paar über zwei Meter hohe marmorne Kandelaber [16] wurden von Piranesi aus verschiedenen Bruchstücken zusammengesetzt, die in der Villa Adriana ausgegraben worden waren. Der englische Politiker Sir Roger Newdigate kaufte sie 1775 während seines Aufenthaltes in Rom direkt bei Piranesi. Die Stücke wurden dann in Teilen nach England verschifft. Piranesi hatte einen genauen Plan mitgeschickt, wie die Kandelaber wieder zusammenzusetzen seien. Newdigate schenkte die beiden Kandelaber später der Universität Oxford, an der er studiert hatte. Sie befinden sich heute im Ashmolean Museum in Oxford.
Die große Zahl von dekorativen Marmorgegenständen, die Piranesi seit den 1760er-Jahren nach seinen Entwürfen produzieren ließ und die ihren Weg in die unterschiedlichsten Sammlungen fanden, lässt darauf schließen, dass die Nachfrage enorm war. Piranesi unternahm eigene Ausgrabungen in der Villa Adriana, um den Nachschub an antiken marmornen Fragmenten sicherzustellen, die zu passenden Objekten verarbeitet werden konnten. Der Export solcher Objekte war relativ unproblematisch, ganz im Gegensatz zu antiken Statuen, deren Ausfuhr massiven Beschränkungen unterworfen war.
In zeitgenössischen Briefen, meist von Kunstagenten in Rom an ihre Auftraggeber in England, ist öfters von Piranesi die Rede. So beschreibt der Architekt Vincenzo Brenna (1747–1820) in einem Brief vom 20. Februar 1770 an den Londoner Sammler

[16] Giovanni Battista Piranesi, Veduta in prospettiva di un candelabro antico di marmo, aus: Vasi, Candelabri ..., Rom vor 1775, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 41.71.1.13.

Charles Townley (1737–1805) die Situation im Hause Piranesi wie folgt: „[Piranesi] hat das Radieren fast aufgegeben und sich ganz dem Handel mit antiken Marmoren verschrieben.“
Tatsächlich aber ging auch die Produktion der Druckgrafik, wie die der Vedute di Roma, weiter, wenn auch Piranesi vermutlich nicht mehr selbst alle Radierungen ausführte, sondern vieles seinen Mitarbeitern überließ. Die letzte große Publikation Piranesis war aufs Engste mit der Herstellung der antiken Marmorobjekte verbunden.
1778, kurz vor Piranesis Tod, erschien ein zweibändiges Werk mit dem Titel, Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne, ed ornamenti antichi disegnati ed incisi dal Cav. Gio. Batt. Piranesi. Das Format wird dem sperrigen Titel durchaus gerecht, sind doch die beiden Bände im Großfolioformat aufgeschlagen mehr als einen Meter fünfzig breit. In diesem Werk publizierte Piranesi dem Titel entsprechend eine Sammlung von antiken Vasen, Kandelabern, Grabaltären, Dreifüßen, Lampen und antiken Ornamenten. Einzelne der Radierungen waren schon vorher seit 1768 nach und nach erschienen.
Ein Teil der Tafeln zeigt Objekte, die sich in adligen römischen Sammlungen oder im Kapitolinischen Museum befanden. In der Mehrzahl aber handelt es sich um Stücke, die Piranesi bereits an – meist englische – adlige Romreisende verkauft hatte, sowie schließlich solche, die noch „nel Museo dell’Autore“ , also in Pira nesis eigener Kollektion zu erwerben waren.
Allen Tafeln waren Beschreibungen beigegeben, in denen Piranesi entweder die besonderen Eigenschaften des Stückes lobte, oder aber – und dies besonders bei den bereits verkauften Exemplaren – die jeweiligen Käufer und ihren guten Geschmack besonders hervorhob.
Die geschieht bei der sogenannten Stowe- oder Grenville-Vase [17][18], die sich heute im Los Angeles County Museum of Art befindet, in sehr ausführlicher Form:
„In die Gruppe derjenigen, die Geist und Geschmack für die freien Künste besitzen, muss man angesichts dieses Werks den Cavaliere Grenville rechnen. Von den vielen ausgezeichneten antiken Stücken, die er bei seinem Aufenthalt in Rom im Jahre 1774 erworben hat, ist eines die hier gezeigte antike Vase aus Marmor von großem Format, die 1769 in der Villa Adriana von dem englischen Maler Gavin Ha milton im Gebiet des Pantanello gefunden wurde, das heute der adeligen Familie Lolli aus Tivoli gehört.“
Hier nun folgt eine detaillierte Beschreibung der Vase. Im letzten Abschnitt bringt Piranesi dann noch einmal sich selbst ins Spiel,
indem er darauf hinweist, dass er den Vorzug genossen habe, dem adligen Herrn nicht nur mit dem Erwerb dieses Stückes gedient zu haben, sondern auch mit weiteren sowie mit einem marmornen Kamin, den er, Piranesi, entworfen habe. Alle diese Stücke befänden sich nun in Stowe, dem Landsitz der Familie Grenville.
Zweifellos verfolgte Piranesi mit den Tafeln und den Beschreibungen in den Vasi, Candelabri … mehr als ein Ziel: Diejenigen, die in den Jahren vor Erscheinen des Werkes bei Piranesi eines oder mehrere seiner antiken Objekte erworben hatten, sahen sich und ihre Erwerbungen gewürdigt. Damit man dies zurück in England auch entsprechend auskosten und genießen konnte, war es notwendig, auch das aufwendige Druckwerk Piranesis dazu zu erwerben. Piranesis Abbildungen und Beschreibungen von antiken Objekten im Buch, die sich noch im „Museo dell’autore“ befanden, also noch gekauft werden konnten, machte die Vasi, Candelabri … zugleich zu einem Verkaufskatalog, der ihm weitere Käufer erschlossen haben dürfte.
Schließlich ist jede Tafel einer meist hochgestellten Person gewidmet, oft mit dem Zusatz „amatore delle arti“ (Liebhaber der Kunst) oder ähnlich. Doch waren diejenigen, denen eine Tafel gewidmet wurde, nicht die Käufer oder Besitzer des jeweils darauf abgebildeten Objektes. Somit gab es auch für diejenigen, die nicht bei Piranesi Kunden waren, Gründe, das ganze Druckwerk oder zumindest die einzelne Tafel mit der entsprechenden Widmung zu erwerben.
Die Vasi, Candelabri… waren für Piranesis Antikengeschäft die perfekte public relation, mit der er die Nachfrage nach seinen Produkten innerhalb seines adligen Kundenkreises anzuheizen wusste. Zugleich waren die Bände – wie Piranesis frühere Publikationen auch – eine Mischung aus antiquarischer Wissenschaft und aufwendig gestaltetem Kunstwerk eigenen Wertes.
Piranesis marmorne Antikenerfindungen und seine archäologischen und architekturtheoretischen gedruckten Werke machten den venezianischen Architekten und Antiquar zu Lebzeiten im römischen Kunstbetrieb zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten. Seinen phantastischen Carceri war bei Kennern und Gelehrten eine lange, bis in die Gegenwart reichende Rezeptionsgeschichte beschieden.
Die Vedute di Roma dagegen entfalteten eine große Breitenwirkung und wirkten lange über Piranesi hinaus, indem sie das Bild und die Vorstellung von der Ewigen Stadt für Generationen prägten.
Stefan Morét

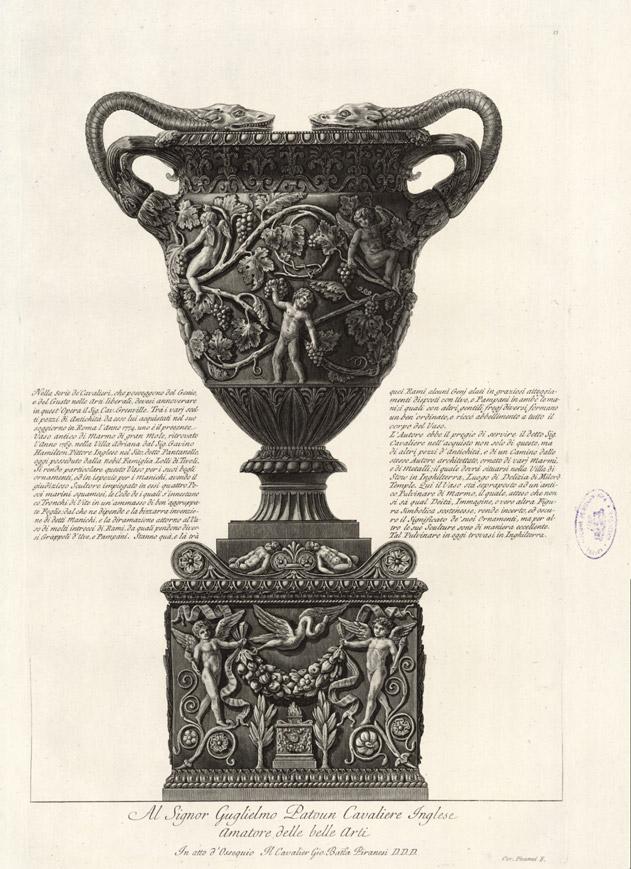




Monotypien bewegen sich künstlerisch zwischen Malerei und Grafik: Der Druckstock wird bemalt bzw. bezeichnet und abgedruckt, solange die Farbe noch feucht ist. Ein solcher Druck ist immer ein Unikat, weshalb die Monotypie üblicherweise nicht der herkömmlichen Druckgrafik zugewiesen wird, bei der viele, nahezu identische Abdrucke von einer Platte möglich sind. Monotypien mit der gummiartigen Gel-Platte sind Flachdrucke –denn hier druckt die gesamte, glatte Oberfläche, also weder erhabene Stellen wie beim Hochdruck (Holz- oder Linolschnitt) noch die Vertiefungen wie bei der Radierung oder beim Kupferstich. Eine Druckplatte – viele Möglichkeiten: Transparente Gel-Platten sind einfach zu handhaben, immer wieder verwendbar und gut zu reinigen. Sie sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich und eignen sich perfekt für den Einmaldruck, die Monotypie. Ohne besondere Hilfsmittel, einfach und schnell lassen sich mit Gel-Druckplatten auch auf einem kleinen Arbeitstisch verblüffende Ergebnisse erzielen.



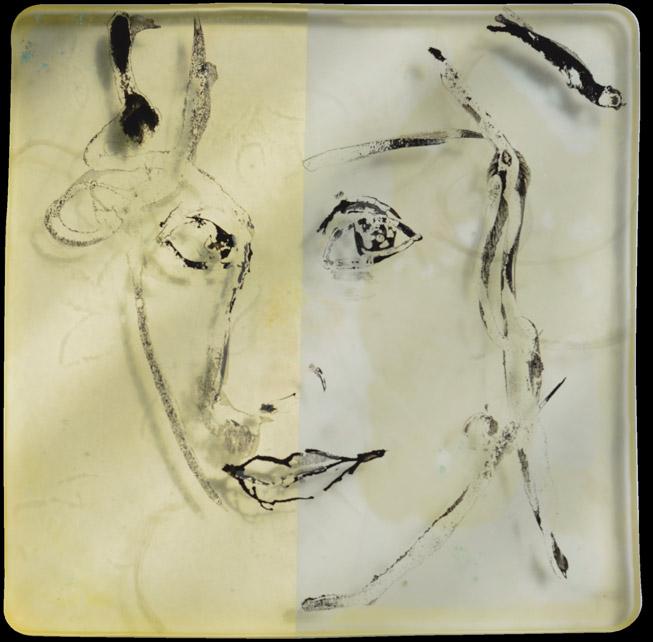



In der Welt der Druckkunst sind Gel-Platten ein vergleichsweise neues Medium und ein interessantes Instrument zur Umsetzung zeichnerisch-malerische Projekte. Mit Pinsel und Farben kann direkt auf die Platte gemalt bzw. gezeichnet werden – monochrom oder mehrfarbig. Als Farbe eignet sich eine flüssige Acrylfarbe ebenso wie eine entsprechend verdünnte Gouachefarbe oder Linoldruckfarbe auf Wasserbasis. Wer mag, kann auch Stoffe unter Verwendung von speziellen Stofffarben bedrucken. Sehr nass aufgetragen eignet sich auch eine wasserbasierte Ölfarbe, und selbst das Arbeiten mit Tuschen ist möglich (allerdings muss bei der Verarbeitung von Tuschen
darauf geachtet werden, dass die Tusche nicht zu stark verläuft, auch sollte das Papier nicht zu porös sein).
Wichtig ist bei allen Farben, dass sie beim Auftrag einen gewissen Nässegrad aufweisen, denn die Farbe muss noch feucht sein, wenn der eigentliche Druck beginnt und der Papierbogen auf aufgelegt wird. Ist die Farbe erst einmal angetrocknet, wird der Druck naturgemäß schwierig. Daher ist auch zügiges, wenig zögerliches Arbeiten gefragt – nicht zu fein, nicht zu genau, nicht zu detailreich: Gerade die spontane Skizze findet in den GelDruckplatten ihr ideales Medium.



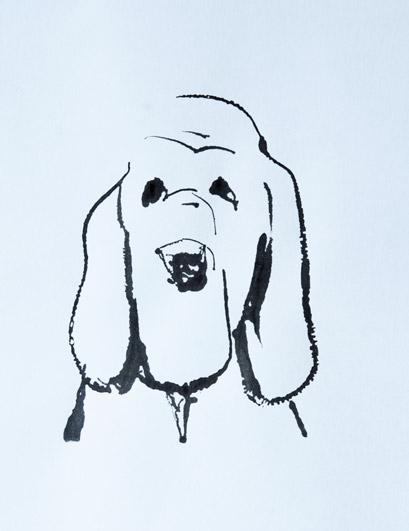


Monotypien bewegen sich künstlerisch zwischen Malerei und Grafk. Die Gel-Druckplatten werden bemalt bzw. bezeichnet und abgedruckt, solange die Farbe noch feucht ist.
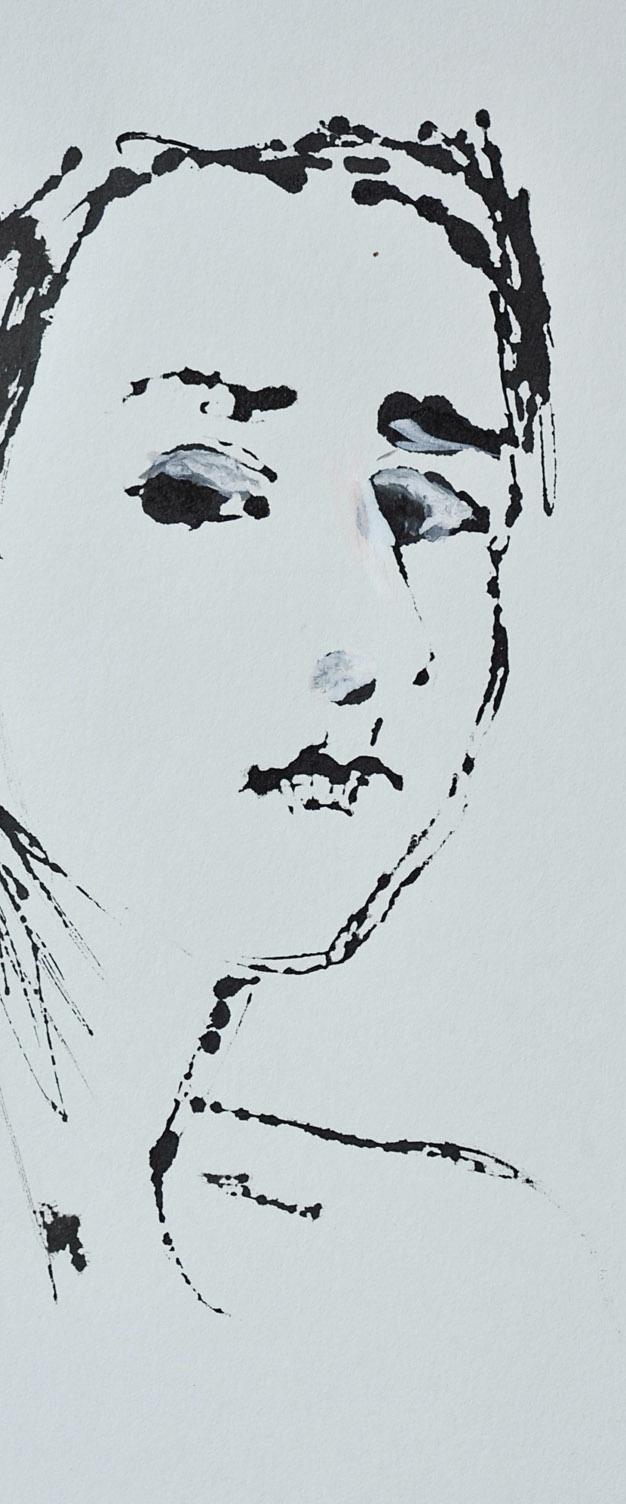
Nicht zu fein, nicht zu genau, nicht zu detailreich: Gerade die spontane Skizze fndet in den Gel-Druckplatten ihr ideales Medium.
Ist die Malerei bzw. Zeichnung vollendet, wird der Papierbogen auf die Platte gelegt und mit einer Gummiwalze oder einem Handreiber gut und gleichmäßig angedrückt oder mit der Hand mit leichtem Druck geglättet. Die Farbe wird auf das Papier übertragen, das behutsam abgezogen wird – fertig ist die Monotypie.
Dieses Blatt kann ebenso End- wie Zwischenergebnis sein: Da der Prozess des Malens und Druckens nur kurze Zeit in Anspruch nimmt, kann direkt ein erneuter Druck erfolgen, um etwa Linien zu vervollständigen oder Farben zu ergänzen. Zuvor sollte die Platte jedoch gründlich gereinigt werden: Am besten sofort, denn manche Farben lassen sich nach dem Antrocknen nur schwierig entfernen. Ideal ist lauwarmes Seifenwasser (mit Seife oder Spülmittel, aber ohne scharfe Substanzen). Sollten trotz aller Sorgfalt doch einmal Spuren auf der Platte zurückbleiben, lassen sie sich mit etwas Oliven- oder Babyöl wieder vollständig entfernen. Danach muss die Platte erneut mit Seife gereinigt werden, um sie von öligen Rückständen zu befreien.
Für mehrere aufeinanderfolgende Drucke kann man sich die Transparenz der Platte zunutze machen: Damit der nächste Druck passgenau auf dem ersten Druck zu stehen kommt, kann man die Platte mit der Farbseite nach unten auf das bereits bedruckte Papier setzen und so die Position genau bestimmen.#
Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe Text: Sabine Burbaum-Machert


Nikola Jaensch arbeitet mit gefundenen Papieren

Nikola Jaensch, geboren 1973 in Würzburg, lebt und arbeitet in Mainz und im Hegau/Bodensee. www.nikolajaensch.wordpress.com, Instagram: nikola_jaensch, Porträtfoto: Marlene J. Riesener.
2023 erschien der Roman „Das glückliche Geheimnis“ des Bestseller-Autors Arno Geiger, in dem er von seiner bis dato heimlichen Leidenschaft spricht, in die vom Wiener Abfallwirtschaftsamt bereitgestellten Papiercontainer wortwörtlich hineinzutauchen, um darin nach weggeworfenen persönlichen Schriftstücken verschiedenster Art zu forschen, die ihm dienen sollten als Materialsammlung, als Impulsgeber und nicht zuletzt als Erweiterung seines Wortschatzes, vor allem aber seines Horizonts möglicher menschlicher Gefühle und Leidenschaften überhaupt.
Mich erinnerte diese originelle Fischerei nach unvorhergesehenen Fundstücken aus dem Bodensatz des Verworfenen an meine eigene Sammelleidenschaft, die sich seit der Studienzeit in den letzten drei Jahrzehnten herausgebildet hatte, und die mich zwar nicht zum „Containern“ brachte, sondern eher in die stille Abgeschiedenheit der Antiquariate, aber auch auf jede Art von fröh-
lichen Floh- oder Trödelmärkten. Daneben suche ich regelmäßig Einrichtungshäuser auf, um nach Katalogen aus der Mode gekommener Möbel, Tapeten und sonstiger Accessoires zu fragen. Selbst an öffentlich aufgestellten Bücherschränken kann ich nicht vorbeigehen und bediene mich mitunter an ihnen. Selbstverständlich hebe ich auch alle Nummern der abonnierten Wochenzeitung Die Zeit auf, wegen ihres ebenso großzügigen wie großspurigen Sinnes für typografische Attacken aller Art. Aufgrund dieser orchestrierten Art von Sammelwut stapeln sich mittlerweile Kisten und Kästen voller Material in meinen Ateliers und inzwischen auch in den Kellerräumen. All das zusammen nenne ich meinen „metaphysischen Fundus“.
Bis zum Werk ist es allerdings ein weiter Weg. Als Beispiel greife ich das Gemälde Moi-même et le monde aus dem Jahre 2010/2011 heraus, entwickelt auf einer gespannten, vorgrundierten Leinwand im Format 80,5 x 66 cm.
Den malerischen Anteil bewältige ich meist mit Ölfarben, am liebsten von Schmincke, und mit 133 mir zur Verfügung stehenden Pigmenten aus dem Farbenklavier meines Vaters nach dem System des Farbtheoretikers Wilhelm Ostwald.
Betrachtet man die genannten Mittel der Realisation als materiellen Aspekt, so steht dem gleichwertig das Immaterielle von Reflexion und Recherche gegenüber, als tragendes Fundament meiner Arbeit.#
Nikola Jaensch

Wenn ich von einem Gemälde spreche, ist das unvollständig, denn es ist nicht nur gemalt im eigentlichen Sinne, sondern in Teilen lediglich gezeichnet – erscheint also auch teils grafisch – und ist darüber hinaus konstruiert, montiert und collagiert. Denn im eigentlichen Sinne bin ich Zeichnerin, da die Linie in ihrer Unmittelbarkeit am eindrücklichsten die Lebensspuren zu Papier bringt: Solche spontanen Niederschriften treffen auf vorgefundene grafische Elemente und weisen im bildnerischen Prozess unvorhergesehene neue Wege. Dieser Dialog zwischen meiner eigenen Zeichenwelt und der Welt der Fundstücke ist Motor (Motivation) und Inspirationsquelle für die nächsten Schritte. Dabei sind mir neben dem gut sortierten Werkzeugkasten der Zeichnerin, Malerin und Grafikerin weitere Materialien und Werkstoffe treue Helfer. Um die Begegnung von Zeichnung bzw. Malerei mit Collage-Elementen auf der Leinwand zu realisieren, verwende ich neben anderen Klebstoffen Kleister und Buchbinderleim. Mit dem Falzbein glätte ich unebene Stellen. Moi-même et le monde, 2010/11, Grafit- und Farbstifte, Tempera- und Ölfarbe, Collage (Fundpapiere), Wachsfirnis auf Leinwand, 80,5 x 66 cm, VG Bild-Kunst, Bonn 2025 / Nikola Jaensch, Foto: VG Bild-Kunst, Bonn

„Aus der Hülse,
Friedrich Schiller, Das Lied von der Glocke
Bronze, dieses Metall aus einer Legierung aus Kupfer und Zinn, ist bereits seit über 5000 Jahren in Gebrauch und hat auch einer Epoche ihren Namen gegeben. Es dient der Herstellung von ganz unterschiedlichen Gegenständen, darunter auch Kunstwerken. Der Guss, gerade von großen Figuren, ist auch heute noch mit Risiken verbunden. Friedrich Schiller (1759–1805) hat mit seiner Ballade von der Glocke nicht nur Schüler*innengenerationen gequält, sondern vor allem eindrücklich die Schwierigkeiten beim Guss beschrieben. Im Film Andrej Rubljow von 1966 schilderte Andrej Tarkowksi (1932–1986) in faszinierenden Bildern den Guss
einer Glocke. Und Wilhelm von Kaulbach (1804–1874) malte 1854 den Guss der Bavaria [1]
Der Titel täuscht. Nur der fertig gegossene Kopf der Bavaria wird aus der Gussgrube emporgehoben. Der eichenlaubbekränzte Kopf ist an Seilen befestigt, die zu einer Winde führen. Dort rackern sich sieben Männer ab, die all ihre Kräfte bündeln müssen, damit sich das Rad der Winde dreht. Links steht der Leiter der königlichen Erzgießerei in München, Ferdinand von Miller (1813–1887), und erteilt seine Anweisungen. Ihm zu Füßen achtet ein Geselle
[1] Wilhelm von Kaulbach, Die Erzgießerei in München: Das Personal ist beschäftigt, das kolossale Haupt der Bavaria aus der Gußgrube emporzuwinden, 1854, Öl auf Leinwand, 73,3 x 156,6 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, München, Foto: Wikimedia Commons.
darauf, dass der Kopf nirgends anstößt, ein anderer hält Bretter bereit, die zum Unterlegen gebraucht werden. Ganz links sind zwei Männer mit den Feinarbeiten an der bereits gegossenen Hand beschäftigt. Im Hintergrund erkennt man schemenhaft einige Skulpturen. Mit dem dunkel gekleideten Herrn rechts im Bild hinter der Winde hat Kaulbach dem kurz zuvor gestorbenen Gründer der Erzgießerei, Johann Baptist Stiglmaier (1791–1844), ein Denkmal gesetzt.
Das Bild gehört zu einem Zyklus von Entwürfen, die dann in Fresko an den Außenfassaden der damals neu eröffneten Neuen Pinakothek angebracht wurden, dem Wetter allerdings nicht lange standhielten. Der Zyklus sollte die Geschichte der Kunst unter Ludwig I. darstellen. Der bayerische König (1786–1868) hatte nicht nur den Bau der Neuen Pinakothek mitsamt diesem Zyklus veranlasst, sondern auch den Guss der Bavaria [2]. Sein Hofbildhauer Ludwig von Schwanthaler (1802–1848) schuf das Modell für die mit 18,52 Metern Höhe größte Bronzefigur seit der Antike, die Ausführung übernahm erst Johann Baptist Stiglmaier, dann Ferdinand von Miller. Es war eine gewaltige Herausforderung, diese innen hohle (und begehbare) Figur in mehreren Teilen zu gießen, die dann später zusammengefügt werden mussten. 1837 begann Schwanthaler mit der Planung, von 1844 bis 1849 dauerte der Guss, 1850 stand die Figur auf ihrem hohen Sockel vor der Ruhmeshalle auf der Theresienwiese, wo Jahr für Jahr zu ihren Füßen das Oktoberfest stattfindet. Und der Guss war so spektakulär, dass er nicht nur in den Freskenzyklus von Kaulbach Eingang fand, sondern die Münchner Erzgießerei weit über die Grenzen von Stadt und Land berühmt machte. Sie belieferte die ganze Welt bis hin nach Amerika und Australien mit Kolossalstatuen, Reiterstandbildern, Brunnen, Büsten und unzähligen kleineren Figuren.
Nach wie vor ist die Bavaria der größte Bronze-Hohlguss der Welt, die Technik, in der sie gegossen wurde, war seit tausenden von Jahren bekannt und hat bis heute Bestand: der Guss in der verlorenen Form, entweder mit dem Wachsausschmelz- oder dem Sandformverfahren. Doch über diese Techniken gibt es so viele Abhandlungen und Bücher, dass sie hier nicht weiter erörtert werden sollen, sondern stattdessen bestimmte Spezifika, die dem Bronzeguss vor allem im 20. Jahrhundert zu eigen sind.
Da ist einmal der Negativschnitt, den der in Vergessenheit geratene Moissey Kogan (1879–1943) in den Bronzeguss einführte. Der aus dem damaligen Bessarabien (heute Moldawien) stammende Kogan kam 1903 nach München, um dort Bildhauerei zu studieren, zog es dann aber vor, an der reformorientierten Debschitz-Schule zu lernen. Zu Anfang konzentrierte er sich auf die Herstellung von Medaillen, Plaketten, Vasen in Terrakotta und Stickereientwürfen, die er auch selbst ausführte, bis er 1908 in Idar-Oberstein die Kunst des Gemmenschneidens lernte. Schon
davor, 1905, hatte er in Paris Auguste Rodin (1840–1917) kennengelernt, der ihn dazu ermutigt hatte, sich der Bildhauerei zuzuwenden.
Durch den Gemmenschnitt, also den Negativschnitt, angeregt, schnitt Kogan seine Reliefs aus dem Gips und goss dort hinein flüssiges Wachs, das er dann für das Wachsausschmelzverfahren benutzte. So entstand zum Beispiel das nur kurz nach seinem Aufenthalt in Idar-Oberstein zu datierende Relief Das goldene Zeitalter, das sich heute im Münchner Lenbachhaus befindet [3]
[2] Ludwig von Schwanthaler, Bavaria, 1837–1850, Bronze, Höhe: 18,52 Meter, München, Theresienhöhe, Foto: Wikimedia Commons.


Kogan lebte ab 1911 überwiegend in Paris, hatte dort Kontakt auch zu Aristide Maillol (1861–1944), Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) und dem damals noch nicht völkisch gesinnten Arno Breker (1900–1991), der ihn mehrfach porträtierte. Von seinen Plastiken, die er aus Kostengründen häufig aus Terrakotta oder Zement formte, sind viele verloren. Nach 1933 wurden sie in Deutschland aus öffentlichen Sammlungen entfernt, nicht nur, weil sie zu modern anmuteten, sondern vor allem, weil Kogan aus einer jüdischen Familie stammte. Nachdem die Deutschen 1940 in Paris einmarschierten, floh er nicht, sondern versteckte sich. Allerdings ging er auch immer wieder hinaus und wurde so am 4. Februar 1943 von der Pariser Polizei aufgegriffen und über das Lager in Drancy nach Auschwitz deportiert, wo er sofort nach seiner Ankunft am 13. Februar in den Gaskammern ermordet wurde. Die Wiederentdeckung seines Werks hat lange gedauert.
Auguste Rodin, der nicht nur Kogan, sondern auch viele weitere Bildhauer*innen maßgeblich beeinflusste, gehörte zu den Künstler*innen, die das Material Bronze aus der Erstarrung des Heldendenkmals lösten, indem sie die geglätteten Oberflächen aufrissen und mit Furchen und Graten versahen. Ein Beispiel für diese andere Behandlung des Metalls ist die Figurengruppe der Bürger von Calais, von der nämlichen Stadt 1885 in Auftrag gegeben und 1895 vollendet, obwohl das Modell bereits 1889 für den Guss bereitstand. Das Denkmal, aber auch die einzelnen Figuren, hatte Rodin 1885 in kleinerem Format modelliert, die Modelle wurden zu unterschiedlichen Zeiten in Bronze gegossen. Das Modell eines der Bürger [4][5] zeigt einen in ein von einem Strick zusammengehaltenes Büßerhemd gekleideten Mann, dessen Gesten Todesbereitschaft, Verzweiflung, aber auch Mut ausdrücken. Das zer-

rissene Hemd fällt dabei nicht einfach faltenlos herunter, sondern bildet vor allem im Rücken tiefe Einschnitte. Das Denkmal verlor durch die Art der Darstellung, aber auch durch einen fehlenden hohen Sockel, seine Monumentalität, das Material durch die Art der Behandlung seine Nobilitierung.
Dieser Umgang mit dem Material Bronze findet eine Steigerung in den Figuren von Alberto Giacometti (1901–1966), bei denen die Modellierung im nicht geglätteten Gips sichtbar bleibt. Die Spuren der Fingerabdrücke, der Spachtel oder anderer Werkzeuge, derer sich Giacometti bediente, sind nicht eliminiert, was dazu führt, dass die Verletzlichkeit des Materials (Gips) im Bronzeguss nachvollzogen werden kann und darüber hinaus die Verletzlichkeit des dargestellten Wesens, sei es Mensch oder Tier, widerspiegelt. Zwei Beispiel dafür befinden sich im Kunstmuseum Basel, Die Katze von 19501 und Diego mit Jacke von 19532
[3] Moissey Kogan, Das Goldene Zeitalter, 1908/09, Bronzerelief, München, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München. [4][5] Auguste Rodin, Der Bürger von Calais Pierre di Wiessant, 1885 modelliert, um 1900/07 gegossen, Bronze, 45,1 x 22,5 x 21,6 cm, 9,2 kg, New York, Metropolitan Museum.

Bronze als Material ist teuer, viele Künstler*innen konnten und können sich den Guss erst leisten, wenn Käufer*innen gefunden sind. Heute stehen zudem zahlreiche Alternativen zur Verfügung. Dennoch gibt es nach wie vor in Bronze gegossene Figuren und die dafür notwendigen Gießereien, wenn auch nur wenige.
Susanna Partsch
1 https://www.giacometti-stiftung.ch/sammlung/ objekt/?tx_artcollection_single%5Bartpiece%5D= 421&cHash=2378a97eade7195ecf455185397c477b.
2 https://www.giacometti-stiftung.ch/sammlung/ objekt/?tx_artcollection_single%5Bartpiece%5D= 237&cHash=2dc21a86408a5d9042027f0786abc1b9.

Mit dem praxisbewährten Planatol Buchbinderleim für manuelle Klebebindungen und dem hochwertigen Falzbein für saubere Kanten gelingt jedes Projekt!

Zeichnen und Malen auf Kreidegrund
Immer wieder offenbart eine dickflüssig-zähe Mischung aus Kreide, Wasser, Weißpigment und Leim seine besonderen Qualitäten: Jeder Malerin und jedem Maler bekannt und unentbehrlich, ist ein selbst gemischter Kreidegrund oder gebrauchsfertiger Gesso das bewährte Grundiermittel für bespannte Keilrahmen mit Rohgeweben und die traditionelle Basis für Ölmalerei auf Leinwand oder Holz. Gesso kann auch zum Einfärben von Papieren, zum Bearbeiten von Holzrahmen und für viele weitere Zwecke eingesetzt werden.
Aber auch in weniger klassischer Hinsicht tut ein Kreidegrund gute Dienste: Er kann z.B. direkt bezeichnet werden. Zunächst wird die Grundierung kreuzweise (senkrecht/waagerecht) in zwei Schichten aufgetragen und muss zwischendurch antrocknen. Dann kommen Schleifpapier oder Stahlwolle (erst grob, dann fein) zum Einsatz, um die Oberfläche seidenglatt zu polieren.
Die Aquarell-Skizze rechts zeigt einen sonst weniger beachteten Vorzug: Vor allem selbst zubereitete Kreidegründe sind extrem saugfähig. Ein Aquarell kann daher sogar in senkrechter Position, z.B. auf der Staffelei, gemalt werden – im Vergleich zu fett oder halbfett grundierten Leinwänden ein großer Unterschied. Zwar läuft beim Aquarell mitunter ein Tropfen oder es entsteht eine kleine „Nase“, dies aber nur in geringem Maße. Die Aquarellskizze der Zeitung lesenden Frau wurde recht nass und mit vollem Pinsel gemalt, schnell und ohne Abtupfen. Vorausgesetzt, die Aquarellfarben sind lichtecht, eröffnet sich hiermit eine nicht-papiergebundene Möglichkeit der Aquarellmalerei.


Ob selbst gemacht oder gebrauchsfertig:
Kreidegrund und Gesso sind weithin bekannt und im Atelier unentbehrlich.


Kreidegrund oder Gesso kann mit wenig Pigment eingefärbt werden, um eine Art Grundstimmung des Gemäldes zu erzeugen. Im Beispiel links und den Step-by-Step-Abbildungen dazu auf dieser Seite links wurde der Kreidegrund in einem GrauBeige-Rosaton gefärbt, um eine tonige Hinterund Untergrundfarbe zu erzeugen, die mit den erdig-warmen Gouachen der Malerei harmoniert. Die Gouachen wurden recht dünn vermalt, manchmal überlagern sie die Blei-Zeichnung, manchmal bleibt diese komplett offen.
Auf den beiden Bildern rechts außen ist die Vorzeichnung gut sichtbar, der Himmel ist leicht rosa getönt. Hier wurde der Kreidegrund weiß belassen, die Malerei dagegen mit Ölfarbe ausgeführt. Die Farbe ist mal lasierend, mal deckend aufgetragen, die Blei-Zeichnung in Fenstern, Baum und Kontur blieben erhalten.



Bei diesem Stillleben mit Schalen ist die Bleizeichnung offenkundiger Teil der Bildabsicht. Hier ist alles zu sehen: Jede Schraffur schafft Modulationen und Tiefe, bleibt sichtbarer Teil der Malerei. Der Kreidegrund wurde weiß belassen, die Malerei in dünnen Ölfarben-Lasuren ausgeführt.
Übrigens kann jede Bleizeichnung auf Kreidegrund mit einer Lasur aus Leinöl und Balsamterpentinöl dauerhaft fixiert werden; eine solche Lasur kann auch durch Zugabe einer geringen Menge Ölfarbe getönt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Bleizeichnung auf die Mischung der Fixierung reagieren kann: Je stärker das Leinöl mit Balsamterpentinöl verdünnt wird, desto stärker wird die Bleizeichnung angelöst und verwischt. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Je höher der Leinöl-Anteil in der Lasur, desto klarer bleibt die Zeichnung.#
Malerei, Realisation und Fotografe: Ina Riepe Text: Sabine Burbaum-Machert



Das Farbenbuch
367 Pigmente und Farbstoffe, 17 Pigmentanalysen von Gemälden, 19 Farbgeschichten
Stefan Muntwyler, Juraj Lipscher, Hanspeter Schneider (Hrsg.), 496 S., durchg. farb. Abb., 24 x 33,5 cm, Halbleinen m. 3 Lesebändchen, dt., alataverlag 2022, ISBN 9783033088795, EUR 196,00 (D), EUR 196,00 (A), CHF 196,00 (CH)
Wir sind umgeben von Farben. Farbe erzeugt aus sich selbst heraus Wirkungen, sie kann aber auch einen bestimmten Zweck verfolgen. Wir empfinden sie einerseits als selbstverständlich, auf der anderen Seite sind wir fasziniert von ihrer Schönheit.
Farbe als Farbe ist Chemie, Physik, Optik, Biologie. Der Mensch gewinnt aus Mineralien, Pflanzen und tierischen Produkten seit Jahrtausenden Farbmittel. Das zeigen die bisher ältesten bekannten Höhlenmalereien, von denen man vermutet, dass sie vor über 30.000 Jahren entstanden sind. Damals standen offenbar nur ein paar Ockertöne zur Verfügung. Später kamen Kreide und Holzkohle hinzu. Im alten Ägypten konnte man künstlich Blau- und Grünpigmente herstellen und für die Bemalung antiker Skulpturen kamen in Griechenland und dem Römischen Reich Rot und Gelb dazu.
Angewandte Farben waren zu dieser Zeit bereits symbolträchtig aufgeladen. Sie galten als Kostbarkeit, als wertvolles Besitztum, waren Tausch- und Handelsware. Viele kulturelle Errungenschaften der Menschheit wie die Malerei, die Textilgestaltung, die materielle Kultur, weltliche und religiöse Rituale und die Kommunikation fußen auf den Möglichkeiten der Farbgestaltung und Deutung.
„Das Farbenbuch“ trägt diesem komplexen Phänomen Rechnung: Dreieinhalb Kilo, Großformat. Ein Statement. Für den 2022 im alataverlag erschienenen Buchklotz haben sich drei Farbbesessene zusammengeschlossen: Der Maler und Farbforscher Stefan Muntwyler, der Chemiker und Spezialist für Pigmentanalysen Juraj Lipscher sowie der Grafiker und Fachmann für Farbumsetzung Hanspeter Schneider. Nach acht Jahren ist aus der intensiven Zusammenarbeit ein aufschlussreiches Fachbuch entstanden. Die weite Palette der Farbmittel ist darin nach chemischen Kriterien gegliedert, der Einbezug von über 30 Gemälden und



anderen Kunstwerken (z.B. Fresken) aus allen Epochen der Malerei verknüpft die Welt der Farbmittel direkt mit der Kunstgeschichte. Das vermittelt nicht nur sehr anschaulich historisches und theoretisches Wissen, sondern auch Praxisbezug.
Ursprünglich wurden Farben fast ausschließlich aus der Natur geschöpft: Mineralien, Pflanzen und tierische Stoffe waren die materielle Basis zur Herstellung von Pigmenten und Farbstoffen. Durch tiefgreifende Entwicklungen in der Chemie wurden natürliche Farben seit dem 18. Jahrhundert immer mehr durch synthetisch hergestellte ersetzt, sodass heutzutage eine fast unbegrenzte Zahl an Pigmenten und Farbstoffen zur Verfügung steht.
Das Farbbuch stellt eine reichhaltige Auswahl davon vor: Alle Farbmittel, die historisch von Bedeutung waren, sind dargestellt, von der Ur- und Frühgeschichte bis hin zur Gegenwart.
Das Kompendium: 367 Pigmente und Farbstoffe werden mit Namen und Synonymen, mit ihrer chemischen Zusammensetzung und Formel vorgestellt, ebenso das Vorkommen, die Herstellung, Historisches, die Eigenschaften und Anwendungen. Um die unterschiedlichen Anmutungen vorstellen zu können, wurden 693 Farbmuster hergestellt sowie 78 Färbungen auf Wolle und Seide. Die systematische Ordnung der Pigmente und Farbstoffe richtet sich nach Herkunft und Entstehung. Auf diese Weise lassen sie sich in organische und anorganische Farbmittel unterteilen und nach natürlichen und synthetischen unterscheiden. Kurze Ausführungen u.a. zu Bindemitteln sowie eine Zeitachse der Pigmente und Farbstoffe schließt Kapitel 1.
Welche Gemeinsamkeit teilen Leonardo da Vinci und Andy Warhol? Mit 17 Pigmentanalysen im anschließenden Kapitel stellt „Das Farbenbuch“ einen fundierten Praxisbezug zu den wichtigs-

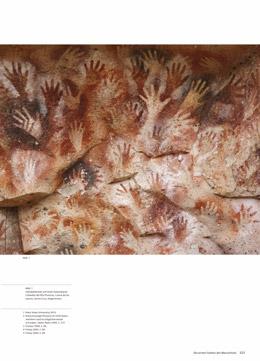

ten Epochen der Kunstgeschichte her. Juraj Lipscher hat die Auswahl der Gemälde und Wandmalereien, denen hier auf den Grund gegangen wird, kenntnisreich vorgenommen. Mit wissenschaftlicher Akribie werden die Malschichten optisch bis in die Tiefe untersucht. Selbstverständlich wird auch die Frage zu Beginn dieses Abschnitts beantwortet.
Es folgt ein Kapitel mit „19 Farbgeschichten“. Anschaulich, kenntnisreich und leicht nachvollziehbar geschrieben, vermittelt es Wissenswertes von den ersten Farben der Menschheit über Ägyptisch Blau und Grün bis zu DPP oder Ferrari-Rot. Ein Glossar beschließt das Buch.
Unterstützt werden die drei Herausgeber durch die konzentrierten Beiträge eines interdisziplinären Kollektivs aus Restauratoren, Chemikerinnen, Archäologen, Kuratorinnen, Architekten, Historikerinnen, Künstlern und Kulturwissenschaftlerinnen.
Und dann ist da noch die Umsetzung! Heute werden Büchern echte Farbaufstriche nicht mehr beigegeben, eine solche Publikation wäre unerschwinglich. Die Herausgeber haben sich daher für eine drucktechnische Wiedergabe der Farben entschieden, für einen Druck in CMYK plus sechs zusätzlicher Pantone-Farben. Manche Bogen hat Hanspeter Schneider mit bis zu 18 Farben bedrucken lassen.
Das Resultat der hohen Papier- und Druckqualität führt zu einer überdurchschnittlichen Farbtreue der abgebildeten Farbmuster und Kunstwerke. Dem Buch ist die Liebe anzumerken, mit der es hergestellt wurde, die Kenntnis und der Sachverstand. Das gewichtige Werk ist ein Fachbuch für Maltechniker*innen, Restaurator*innen, an Maltechnik interessierte Studierende der Kunst wie der Kunstgeschichte sowie für Kunstschaffende.#
Abbildungen aus dem Innenteil des Buches, © bei den Fotografen/alataverlag 2022.
Julie Louise Speck vermittelt in einem umfassenden Nachschlagewerk praktische Grundkenntnisse der Bühnenplastik und Bühnenmalerei






Bühnen gibt es nahezu überall: Ob klassische Kulissen für Theater, Film und Fernsehen oder die perfekte Geometrie des Messebaus, ob aufwendige Kostümplastiken für Werbung und Show oder Realisationen für Konzeptkünstler – Bühnenplastik und Bühnenmalerei lassen sich auf allen erdenklichen Bühnen finden. Kultur, Kunst und Show brauchen dieses besondere Handwerk und sein Know-how, um ihre Events perfekt in Szene zu setzen.
Dennoch finden diejenigen, die die Kulissen bauen, Hintergründe malen und Requisiten herstellen nur selten die Anerkennung, die ihrer Arbeit gebührt. Zum umfangreichen Aufgabenbereich der Bühnenmalerinnen und -plastiker „zählt allgemein das Anfertigen von Modellen, technische Zeichnungen, das Bearbeiten von Oberflächen und Untergründen, das Anfertigen von Schriften und Malereien.“ Darüber hinaus im Bereich „Plastik“ speziell die Auswahl und Anwendung von Werkstoffen und Techniken für das Herstellen von plastischen Elementen, „Ko-
pieren und Imitieren, das Anwenden von Klebe- und Verbindungstechniken sowie das Vervielfältigen von plastischen Ele menten“. Im Bereich „Malerei“ der Umgang mit Farben, „die Abstimmung auf die Beleuchtung, das Anfertigen von Kopien und Imitaten und das Herstellen von Bühnenmalerei.“
Diese Beschreibung des Berufsbildes stammt von Julie Louise Speck. Die Bühnenplastikerin und -malerin möchte das Ansehen dieses vielfältigen Berufs ändern – und auf diese Weise auch dessen Zukunft wahren. Deshalb hat sie das Lehrbuch „Praktische Grundlagen der Bühnenplastik und Bühnenmalerei – Einführung, Werkstoffe, Arbeitstechniken“ geschrieben. Auf gut 450 Seiten vermittelt sie erstmals die praktischen Grundkenntnisse der Bühnenplastik und Bühnenmalerei und die Kniffe ihres Handwerks. Auch auf die Projektvorbereitung und -kalkulation geht die Autorin ein. Sie selbst hat in den Werkstätten der Volksbühne in Berlin gelernt und wechselte nach
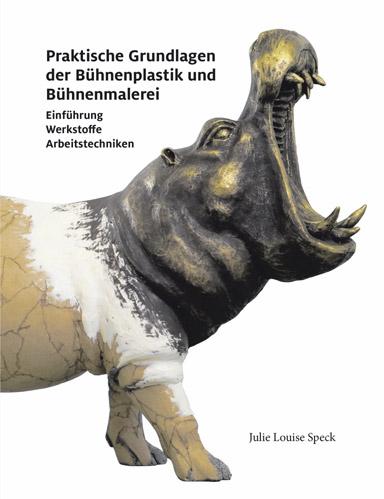

Praktische Grundlagen der Bühnenplastik und Bühnenmalerei
Einführung, Werkstoffe, Arbeitstechniken
Julie Louise Speck, 454 S., zahlr. farb. Abb., 17 x 22 cm, kart., dt, Verlag Julie Louise Speck 2023, ISBN 9783000759901, EUR 60,00 (D), EUR 60,00 (A)
einigen Jahren in der Selbstständigkeit 2019 an den Berliner Friedrichstadt-Palast, wo sie Leiterin der Bühnenplastik und als Ausbilderin tätig ist.
Schon beim Durchblättern des Buches wird deutlich: Bühnenplastiker und -malerinnen sind „Spezialisten der Materialkunde: Wir eignen uns ein großes Allgemeinwissen über Werkstoffe an und sind neugierig auf jedes neue Material, das wir kennenlernen. Wir besitzen die Fähigkeit der plastischen Gestaltung (Bildhauerei) und der Kunstmalerei sowie der Illusionsmalerei, um Materialien zu imitieren,“ stellt Julie Louise Speck fest.
„Die durchschnittliche Theaterwerkstatt ist heutzutage mit bestimmten Grundwerkstoffen ausgestattet: in der Malerei finden wir Baumwollnessel und Stofffarben, Lacke und Dispersionen und eine Vielfalt an Pinseln. In der Plastik sind es große Styroporblöcke, eine Bandsäge, eine große Auswahl an Klebstoffen,
sowie Strukturmassen, Gips und Ton. Es folgt eine Einführung in die meistverwendeten Werkstoffe des Berufs (…)“ ist in der Einleitung zum Kapitel „Werkstoffe“ zu lesen. Es spannt den Bogen von Textilien und Holz über Kunststoffe und Farben bis hin zu plastischen Massen, Putzen und Füllern. Darüber hinaus gibt es Tipps zur Handhabung oder zur passenden Literatur sowie Infos zu Arbeitsschutz und Nachhaltigkeit.
Im anschließenden Kapitel „Praktische Arbeitstechniken“ zeigt Julie Louise Speck auf fast 300 Seiten ausführlich, wie diese Werkstoffe angewendet werden. Die Vermittlung der Arbeitstechniken, die sowohl das Berufsfeld der Bühnenplastik als auch der Bühnenmalerei betreffen, sowie der Ausbau von Fähigkeiten stehen hier im Mittelpunkt. Dabei, so die Kapiteleinleitung, sind „die Anwendungstechniken (…) den klassischen Methoden im Bereich des Kulissenbaus entlehnt (…) und sollen auch niemals eine Begrenzung der Kreativität darstellen (…).“ Vielmehr sollen sie als Hilfestellung und Nachschlagewerk dienen. Themen sind unter anderem Übertragungstechniken, die Graumalerei, die Grundlagen der Farbgestaltung, Materialimitation wie Holz, Fels, Beton, Marmor, rostender Stahl usw. oder Formbauvarianten und Anleitungen zum plastischen Gestalten, etwa das Modellieren, das Schnitzen in Styropor, Kostümbau, Beflocken, Vergolden, Lackieren, Spachteln und vieles mehr. Eine Aufgliederung in die spezifischen Inhalte der Fachrichtungen „Plastik“ und „Malerei“ runden das Kapitel ab.
Zum Abschluss des Buches stellt Julie Louise Speck vier Projektbeispiele vor, bei denen sie „auf die klassischen Abläufe der Projektentwicklung, die Arbeitsplanung und Durchführung sowie auf unterwegs auftretende Probleme und deren Lösung“ eingeht. Gezeigt werden die Fertigung eines Babykrokodilkostüms (Kostümplastik), eine Felsenhöhle aus dem Kunststoff Polystyrol (Kulissenbau), ein halbtransparentes überdimensionales Bühnenbild nach Carl Spitzweg (Prospektmalerei) und das berühmte „Courage“-Huhn von Eduard Fischer (Theaterrequisiten).
„Praktische Grundlagen der Bühnenplastik und Bühnenmalerei" ist ein umfassendes Nachschlagewerk, das die wichtigsten Materialien und Arbeitstechniken des Berufs anschaulich in Wort und Bild vorstellt. Das kompakte, als Klappenbroschur eingebundene und von Julie Louise Speck im Eigenverlag hochwertig publizierte Buch überzeugt auch gestalterisch. Es ist reich illustriert, sehr übersichtlich aufgebaut und gestaltet. Die Fadenbindung stellt sicher, dass die Publikation auch nach vielfachem Zurateziehen nicht auseinanderfallen wird. Ein unentbehrliches und bislang konkurrenzloses Handbuch für alle, die sich kreativ auf dem Gebiet der Bühnenplastik und Bühnenmalerei bewegen wollen. Auch Kunstschaffenden im Bereich Bildende Kunst sei es aufgrund der Vielfalt an Werkstoffen, Techniken und Ideen empfohlen.#
Abbildungen aus dem Innenteil des Buches, © bei den Fotograf*innen/Verlag
Julie Louise Speck 2023.
Für manche ist Spielen ein scheinbar sinnloser Zeitvertreib. Doch Spielen ist nicht nur wichtig für unsere Entwicklung, es fördert auch unser Wohlbefnden – universell, egal ob für Jung oder Alt, Mensch oder Tier
Spielen hilft Kindern, sich die Welt zu erschließen. Vom explorativen Spiel, mit dem Babys die Welt über die Sinneswahrnehmung erkunden, über das nachahmende Rollenspiel sobald die Sprache hinzukommt und das Regelspiel, das soziale Strukturen einübt.
Erwachsene spielen wegen der sozialen Interaktion mit anderen oder um zu gewinnen. In jedem Fall ist Spielen als Auszeit vom Alltag entspannend und erholsam, es ist das Gegenteil von Sorge und Langeweile: Man kann sich in andere Rollen versetzen oder die geltende soziale Ordnung außer Kraft setzen. Beim Spiel werden Kreativität und Teamwork gefördert und man betrachtet Dinge aus einer anderen Perspektive. Denn: Man darf Fehler machen.
Da überrascht es nicht, dass die Spiele-Branche boomt. Der Spielemarkt ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Wir
haben aus dem großen Angebot der Spiele einige herausgesucht, die sich auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Herausforderungen auf die Kunst beziehen und Kinder wie Erwachsene ansprechen.
Das Quartett-Spiel ist ein vor allem bei Kindern beliebtes Kartenspiel, dessen Ziel es ist, möglichst viele „Quartette“ zu sammeln, also Sätze von vier zusammengehörigen Karten. „Das Kunstspiel“ basiert auf dieser Idee, wendet sich jedoch an Erwachsene und prüft u.a. mit Fun Facts deren Wissen über den Kunstmarkt. Das nicht mehr ganz neue, aber noch immer einzigartige Trumpf-Quartett lässt berühmte Künstler und Künstlerinnen in sechs Kategorien gegeneinander antreten: Piet Mondrian oder Andy Warhol, Frida Kahlo oder Georgia O’Keeffe … – Wessen Kunstwerke waren die einflussreichsten? Die schockierendsten?
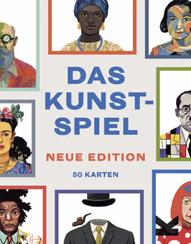

Das Kunstspiel, Neue Edition
ISBN 9783962441548, EUR 14,90 ( D), EUR 14,90 (A)
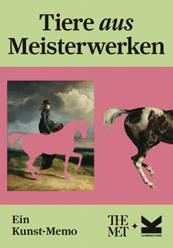

Tiere aus Meisterwerken.
Ein Kunst-Memo
ISBN 9783962444433, EUR 18,00 (D), EUR 18,00 (A)


Finde das Meisterwerk. Ein Kunst-Memo
ISBN 9783962444150, EUR 18,00 (D), EUR 18,00 (A) , CHF 24,90 (CH)
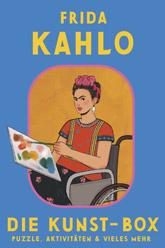

Die Kunst-Box
ISBN 9780500421338, EUR 24,00 (D), EUR 24,00 (A) , CHF 32,90 (CH)
Die teuersten? Nebenbei stellt das humorvoll illustrierte Spiel Geschlechtergleichheit in der Kunst her, denn der Anteil männlicher und weiblicher Kunstschaffender hält sich hier exakt die Waage. Es macht nicht nur Spaß, das eigene Wissen herauszufordern, sondern auch, es zu erweitern. Das beiliegende Booklet mit Kurzbiografien der Künstler*innen hilft dabei!
Ein Memory® ist ein Legespiel, bei dem Paare gleicher, verdeckt liegender Kärtchen durch Aufdecken im Wechsel der Spieler erkannt werden müssen. Die folgenden beiden Memos wandeln dieses kinderleichte Prinzip ab und fordern die Wahrnehmung besonders heraus: „Tiere aus Meisterwerken“ funktioniert nach dem Motto „Was fehlt denn da?“. Dabei müssen die Tiere, die aus 25 bekannten Kunstwerken des Metropolitan Museum of Art in New York herausgeschnitten wurden, diesen richtig zugeordnet werden. Wer die meisten passenden Pärchen findet, gewinnt! Das beigelegte Booklet erzählt von der Symbolik der Tiere in der Kunst.
Auch bei „Finde das Meisterwerk“ geht es um 25 Kunstwerke aus der Sammlung des Metropolitan Museum of Art. Hier werden die Arbeiten geteilt, und es gilt, die beiden Hälften bekannter Kunstwerke aus aller Welt zu finden. Ein Streifzug quer durch alle Jahrhunderte – von Gemälden und Keramiken bis hin zu Skulpturen und Kleidungsstücken. Das beiliegende Poster vermittelt Wissenswertes über die dargestellten Meisterwerke.
Puzzles und mehr – das bieten die abwechslungsreich bestückten Kunst-Boxen zu „Frida Kahlo“ und „Claude Monet“. Sie richten sich an Kinder und unterstützen diese dabei, die beiden Kunstschaffenden zu entdecken, indem sie sie deren Kunstwerke nachstellen, Rätsel lösen oder ein Puzzle zusammenfügen lassen. All das wird begleitet von einem umfassenden Leaflet mit jeder
Menge Wissenswertem, einer Zeitleiste und den wichtigsten Orten im Leben der Beiden.
Mit der „Henri Matisse“-Kunst-Box können Kinder ab 5 Jahren mittels Stanzformen und buntem Papier kleine Meisterwerke entstehen lassen, die von Henri Matisse inspiriert wurden: Paradiesische Inseln, zappelige Oktopusse, Fische mit ausgefallenen Schwänzen … Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt durch die Projekte – von einfachen Übungen zu Farben bis hin zu großen Gemeinschaftsprojekten mit gefundenen Materialien. Die altersgerechten Fakten zu Leben und Werk von Matisse wecken auf spielerische Weise das Interesse an Kunstgeschichte.
Zielgruppe für die „Marina Abramovic-Methode“ sind Erwachsene. 30 Karten geben wertvolle Hinweise, wie man kreative Blockaden durchbricht und sein Leben neu fokussieren kann. Die Künstlerin leitet dazu an, die Techniken zu erlernen, mit denen sie selbst nach einem höheren Bewusstsein strebt, den Herausforderungen des Lebens begegnet und sich auf ihre legendären Performances vorbereitet. Das beiliegende Booklet liefert ergänzend Fakten zur Künstlerin und ihren Werken.
Wer nach einem kooperativen Spiel mit Spaßfaktor für den Familien- oder Freundeskreis sucht, findet im „Krakel-Orakel“ ein Zeichenspiel für alle, die von sich meinen, nicht zeichnen zu können. Alle Zeichnungen sind auf der Zeichentafel schon da, sie warten nur darauf, dem Linien-Chaos entlockt zu werden! Gespielt wird mit 2–8 Personen ab 10 Jahren. Es geht darum, Begriffe zeichnerisch darzustellen, indem man ausschließlich den gestrichelten Linien folgt. Sobald das Gekrakel fertiggestellt und die Zeit abgelaufen ist, wird orakelt. Wer kann die Prophezeihungen der anderen entschlüsseln? Das Krakel-Orakel wurde zum Spiel des Jahres nominiert!#
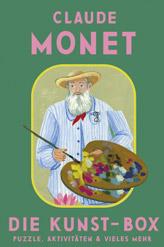

Die Kunst-Box
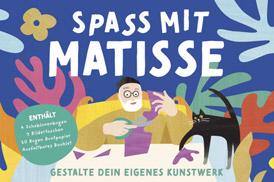

ISBN 9780500421284, EUR 24,00 (D), EUR 24,00 (A) , CHF 32,90 (CH)
Spaß mit Matisse
ISBN 9780500421260, EUR 20,00 (D), EUR 20,00 (A) , CHF 27,90 (CH)


Die Marina Abramovic-Methode
ISBN 9783962442538, EUR 20,00 (D), EUR 20,00 (A) , CHF 27,90 (CH)


Krakel-Orakel
7 Bazis, ISBN 4007742185435, EUR 24,99 (D), EUR 24,99 (A)
Eine visuelle Hommage an die zeitlose Schönheit der Königin der Blumen

Die Rose in Fotografie, Grafik, Kunst, Kunsthandwerk und Mode
248 S., durchg. farb. Abb., 23,3 x 27 cm, geb., dt., Prestel Verlag 2025, ISBN 9783791376622, EUR 45 ,00 (D), EUR 46,30 (A)
Abbildung aus dem Innenteil des Buches, © Prestel Verlag 2025
„Die Rose fasziniert uns mehr als jede andere Blume. Ihr unvergänglicher Zauber verleiht ihr seit jeher in nahezu jedem Bereich des menschlichen Lebens Bedeutung – sei es in der Medizin, in der Botanik, in der Politik, in der Kunst oder in der Mode“, heißt es in der Einleitung zu dem Buch „Die Rose in Fotografie, Grafik, Kunst, Kunsthandwerk und Mode“.
Aber was ist es, das diese blühende und häufig auch duftende Pflanze auszeichnet? Woher stammt sie? Fragen wie diesen geht der opulente Bildband nach, der eine beeindruckende Sammlung von über 200 Motiven und Objekten präsentiert und diese besondere Blume von ihren zarten Blütenblättern bis zu ihren stacheligen Dornen in Szene setzt. Die Gattung der Rosengewächse umfasst an die 150 Unterarten, Zehntausende von Varianten in unterschiedlichen Formen und Farben existieren.
Rosen schmücken nicht nur unsere Gärten, sondern prägen auch unsere Kultur auf ganz unterschiedliche Weise. Wir schätzen sie so, dass wir Speisen und Getränke aus ihnen zubereiten, uns mit ihrem Duft umgeben, unsere Wohnräume mit Rosenmotiven schmücken oder sie uns als Motiv in die Haut tätowieren lassen. Nicht zuletzt verehren wir die Rosen so sehr, dass wir sie zum Symbol der Liebe erhoben haben.
Über die Rose zu sprechen ist unmöglich, ohne ihre Symbolik und ihre Darstellungen in der Kunst, Literatur und Mode in den Blick zu nehmen. Sie ist nicht wegzudenken aus Mythen, Märchen und Sagen. Dichter und Philosophen greifen immer wieder auf ihr Bild zurück, und unzählige Sprichwörter und Redewendungen verbinden sie mit Romantik und verführerischer Anziehung.
In dem Buch „Die Rose in Fotografie, Grafik, Kunst, Kunsthandwerk und Mode“ werden verschiedenartigste Werke aus Kunst und Alltag vereint. Vom eleganten Dior-Kleid und einer rosenverzierten Barbie bis zu antiken Mosaiken und viktorianischen Valentinskarten, von den Fotografien Robert Mapplethorpes und den Arbeiten der Malerin Georgia O’Keeffe bis zu den Plattencovern der Rock-Band Grateful Dead – auf fast 250 Seiten feiert das üppige und bildreiche Buch die unverwechselbare Schönheit und Romantik der Rose in all ihren Facetten.#
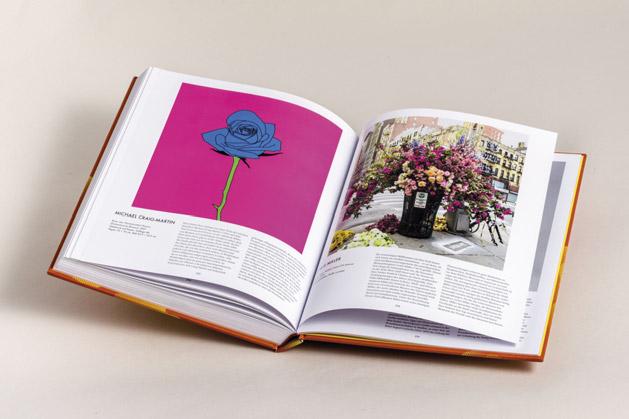
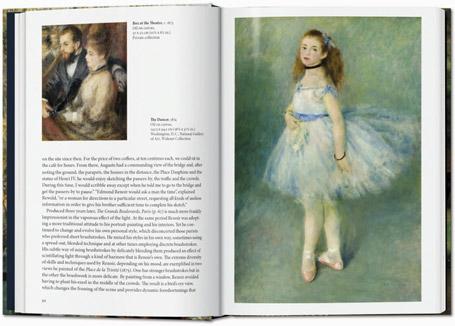
Renoir – Maler des Glücks
Gluck, Liebe und Schönheit – das sind die Ideale, die die Gemälde von Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) spiegeln. Aus Anlass seines 45. Bestehens beschenkt der Taschen Verlag sich und seine Leser mit einer Buch-Reihe, die vormals großformatige Titel im handlichen Format und zum moderaten Preis auflegt. Die kompakte Version der bisher umfangreichsten Buchretrospektive uber Renoirs Werk zeigt die persönliche Geschichte und die Beweggrunde hinter dem großen Maler.
Nach fruhen Landschaftsbildern im impressionistischen Stil entdeckte Renoir seine wahre Leidenschaft in der Porträtmalerei –und kehrte den Impressionisten den Rucken. Seine Werke strahlen Wärme und Zärtlichkeit aus, sicherlich ein Grund, warum er bis heute zu den beliebtesten Malern der Kunstgeschichte zählt.
Gilles Néret zeigt in einem aufschlussreichen Text, der die Karriere des Kunstlers und seine stilistische Entwicklung nachzeichnet, wie Renoir die gemalte weibliche Form neu erfand. Seine letzten Gemälde, vor allem die der „Badenden“-Serie, sind geprägt von der Ruckkehr zum weiblichen Akt. Sie bilden seine innovativste und stilistisch einflussreichste Phase, die später auch Matisse und Picasso inspirierte.
Die brillanten Reproduktionen der Werke sowie Fotos und Skizzen, eine Bibliografie und die vollständige Chronologie machen das Buch zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk zum Œuvre des großen Künstlers.#

„Warum
sollte Kunst nicht schön sein? Es gibt genug unschöne Dinge auf der Welt.“

Renoir. Maler des Glücks
Gilles Néret, 288 S., durchg. farb. Abb., 15,6 x 21,7 cm, geb., dt., Taschen Verlag 2025, ISBN 9783836592062, EUR 25,00 (D), EUR 25,00 (A)
Abbildungen aus dem Innenteil des Buches, © Taschen Verlag 2025


Hidden Portraits
Alte Meister – Neuer Blick
Volker Hermes, 128 S., 100 Abb., 23,8 x 32,7 cm, geb., dt.,
Elisabeth Sandmann Verlag 2024, ISBN 9783949582349, EUR 38,00 (D), EUR 39,10 (A)
Dieses Buch ist nicht nur eine Hommage an die Kunst der Vergangenheit, sondern auch Ausdruck der ewigen Suche nach Identität und Selbstausdruck.
Ein Spiel zwischen Verhüllen und Entblößen, nah und fern zugleich, ein Dialog zwischen Auge und Zeit. Volker Hermes zieht uns in den Bann. Männer- und Frauenporträts, gemalt von großen Meistern, werden mit Masken, Stoffen, Perücken, Kragen, Ketten verdeckt. Dabei spielt er mit alten Symbolen und Botschaften, mit Texturen und Materialien. Seine einzigartigen Porträts laden dazu ein, die verborgenen Codes der Vergangenheit zu erkunden, die Symbole der Selbstrepräsentation und des sozialen Status.


The Joinery Compendium
Learning from Traditional Woodworking
Sascha Bauer, Daniel Pauli, 896 S., mehr als 6.000 Zeichnungen, 17 x 24 cm, Leinen, engl., Ruby Press 2024, ISBN 9783944074528, EUR 96,00 (D), EUR 98,70 (A)
„The Joinery Compendium“ ist eine Sammlung mit über 400 handwerklich hergestellten Holzverbindungen aus aller Welt. Die einzigartige Zusammenstellung gibt Einblicke in die faszinierende Vielfalt dieser Verbindungen, ihrer Geschichte und Anwendung.
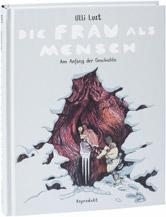

Die Frau als Mensch Am Anfang der Geschichte
Ulli Lust , 256 S., durchg. farb. illustr., 19 x 26 cm, geb., dt., Reprodukt 2025, ISBN 9783956404450, EUR 29,00 (D), EUR 29,90 (A)
Ein Sachcomic über die Anfänge der Kunst und die Bedeutung der Empathie für das Überleben unserer Spezies: Rund um die archaisch-weiblichen Figurinen entfaltet sich eine vergessene Welt, in der die Heldenreise Gruppensache war.


Rembrandt Sämtliche Gemälde
Marieke de Winkel, Rudie van Leeuwen, Volker Manuth, 744 S., zahlr. farb. Abb., 25 x 34 cm, geb., dt., Taschen Verlag 2025, ISBN 9783836599054, EUR 75,00 (D), EUR 75,00 (A)
Rembrandt wurde bereits zu Lebzeiten als Genie verehrt und hat seitdem Generationen von Künstlern fasziniert. Sein Markenzeichen, die raue, pastose Pinselschrift, seine einzigartige Lichtführung und Sensibilität wiesen nicht nur der Porträtkunst neue Wege. Dieser Band präsentiert sämtliche 330 Gemälde des Großmeisters.


Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt
Feministische Tiergedichte
Ella Carina Werner, Juliane Pieper, 160 S., durchg. farb. illustr., 16 x 21 cm, , geb., dt., Verlag Antje Kunstmann 2025, ISBN 9783956146251, EUR 22,00 (D), EUR 22,70 (A)
Feministische Themen sind wichtig und ernst – aber, das beweist dieses kongenial und farbenfroh illustrierte Buch, können auch sehr, sehr lustig sein!


Wilder Ozean
Eine Reise in die ungezähmte Natur der Weltmeere
Peter und Beverly Pickford, 400 S., zahlr. farb. Abb., 25 x 32,5 cm, geb., dt., Prestel 2025, ISBN 9783791391793, EUR 60,00 (D), EUR 61,70 (A)
Vier Jahre – fünf Ozeane: Von seinen Reisen über nahezu alle Kontinente hat das preisgekrönte Fotografenpaar Peter und Beverly Pickford Bilder von atemberaubender Schönheit und Kraft mitgebracht.

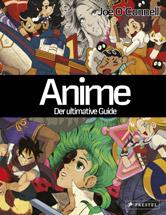
Anime − Der ultimative Guide
Joe O´Connell, 304 S., zahlr. farb. Abb., 21,5 x 28 cm, geb., dt., Prestel 2025, ISBN 9783791376318, EUR 40,00 (D), EUR 41,20 (A)
Gespickt mit zahlreichen Illustrationen und Standbildern präsentiert dieser ultimative Guide 100 Filme und Serien, die von Klassikern bis zu versteckten Juwelen reichen.


Dale Grant
Face: the Berlin Art Scene
Larissa Kikol, Benjamin Wolbergs, ca. 240 S., ca. 250 Abb., 23,5 x 28 cm, geb., engl, Kerber Verlag 2025, ISBN 9783735610171, EUR 45,00 (D), EUR 46,40 (A)
„Face: the Berlin Art Scene“ zeigt die lebendige Vielfalt der Berliner Kunstszene durch die Linse des Fotografen Dale Grant. Das Buch präsentiert 200 Künstler*innen in ihren Ateliers und bietet eine fesselnde Momentaufnahme der kreativen Landschaft der Stadt.


Farben der Freude
Entdecken Sie Ihre Kreativität mit farbigen Skizzenbüchern
Katie Moody, 160 S., zahlr. farb. Abb., 17 x 23 cm, kart., dt., Midas Verlag 2025, ISBN 9783038763284, EUR 20,00 (D), EUR 20,70 (A) , CHF 30,00 (CH)
Beginnen Sie Ihre kreative Reise mit diesem spannenden Leitfaden, um Ihre künstlerischen Fähigkeiten jeden Tag mit Ihrem Skizzenbuch zu entwickeln und die positive Kraft des Kunstschaffens für Ihr Leben zu verspüren.


Spirituelle Führung auf dem Weg des Künstlers
Julia Cameron, 240 S., 12,5 x 19 cm, kart., dt., Droemer Knaur 2025, ISBN 9783426560464, EUR 14,00 (D), EUR 14,40 (A)
In einer Welt voller Hektik lädt dieses Buch dazu ein, einen Gang zurückzuschalten, innezuhalten und sich auf die eigene innere Führung und spirituelle Praxis zu besinnen. Durch die Einbeziehung verschiedener Methoden zu Selbsterkundung und Selbstausdruck motiviert das Buch, die eigene Kreativität in neuer Tiefe zu leben.

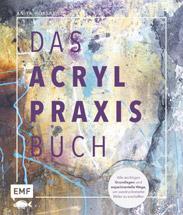
Das Acryl-Praxisbuch
Anita Hörskens, 160 S., zahlr. farb. Abb., 20,5 x 24 cm, geb., dt., Edition Michael Fischer 2025, ISBN 9783745929553, EUR 24,00 (D), EUR 24,70 (A) , CHF 32,90 (CH)
Die Autorin stellt alle wichtigen Informationen, begonnen beim Material über Werkzeuge und Hilfsmittel bis zur Farbenlehre, anschaulich dar. Mal- und Strukturtechniken finden dabei ebenso ihren Platz wie Ausführungen zur Bildkomposition.


Von Kunst leben
Selbstmarketing für bildende Künstler*innen
Andrea Jacobi, 304 S., 1 SW-Abb., 14,8 x 22,5 cm, kart., dt., transcript 2023, ISBN 9783837652796, EUR 27,00 (D), EUR27,80 (A) , CHF 37,50 (CH)
Die Kunsthistorikerin, Galeristin und Art Consulterin Andrea Jacobi vermittelt Grundkenntnisse über den Kunstmarkt, zeigt anhand konkreter Beispiele die vielfältigen Spielarten des Marketing auf und bietet dabei zahlreiche individuelle Möglichkeiten für die erfolgreiche Vermarktung eigener Arbeiten.
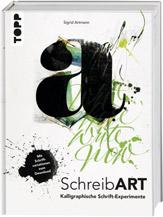

SchreibART
Kalligraphische Schrift-Experimente
Sigrid Artmann, 144 S., zahlr. Abb., 21 x 28 cm, geb., dt., frechverlag 2025, ISBN 9783735882257, EUR 22,00 (D), EUR 22,70 (A) , CHF 30,90 (CH)
Dieses Buch zeigt einen neuen Umgang mit Schrift und Kalligrafie. Das Ergebnis sind Schriftbilder und Schrift-Experimente mit ungewöhnlichen Untergründen und Schreibmaterialien. Mit Schriftvariationen zum Download.


Kreative Jobs für kreative Köpfe
Studienführer für: Kunst, Gestaltung, Architektur, Foto grafie, Fashion, Gaming und mehr
Andreas M. Modzelewski, 464 S., 14,8 x 21 cm, geb., dt., Edition Michael Fischer 2023, ISBN 9783745915433, EUR 45,00 (D), EUR 46,30 (A)
Einer für alle: der einzigartige Studienführer für alle kreativen Studiengänge und Hochschulen. Ob Architektur, Innendesign, Mode, Grafik, Kunst oder Gaming – dieser Guide bietet einen Einblick in alle kreativen Fächer und zeigt mögliche Berufsfelder kompakt auf.

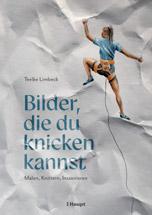
Bilder, die du knicken kannst Malen, Knittern, Inszenieren
Teelke Limbeck, 96 S., durchg. farb. illustr., 17 x 24 cm, kart., dt., Haupt Verlag 2025, ISBN 9783258603018, EUR 19,90 (D), EUR 20,50 (A) , CHF 20,00 (CH)
Dieses Buch zeigt, wie Bilder durch mehr oder weniger gezielte Knicke Strukturen erhalten, die etwa an Wasser, Sandstrände oder Bettwäsche erinnern und zum wertvollen Bestandteil eines Kunstwerks werden.
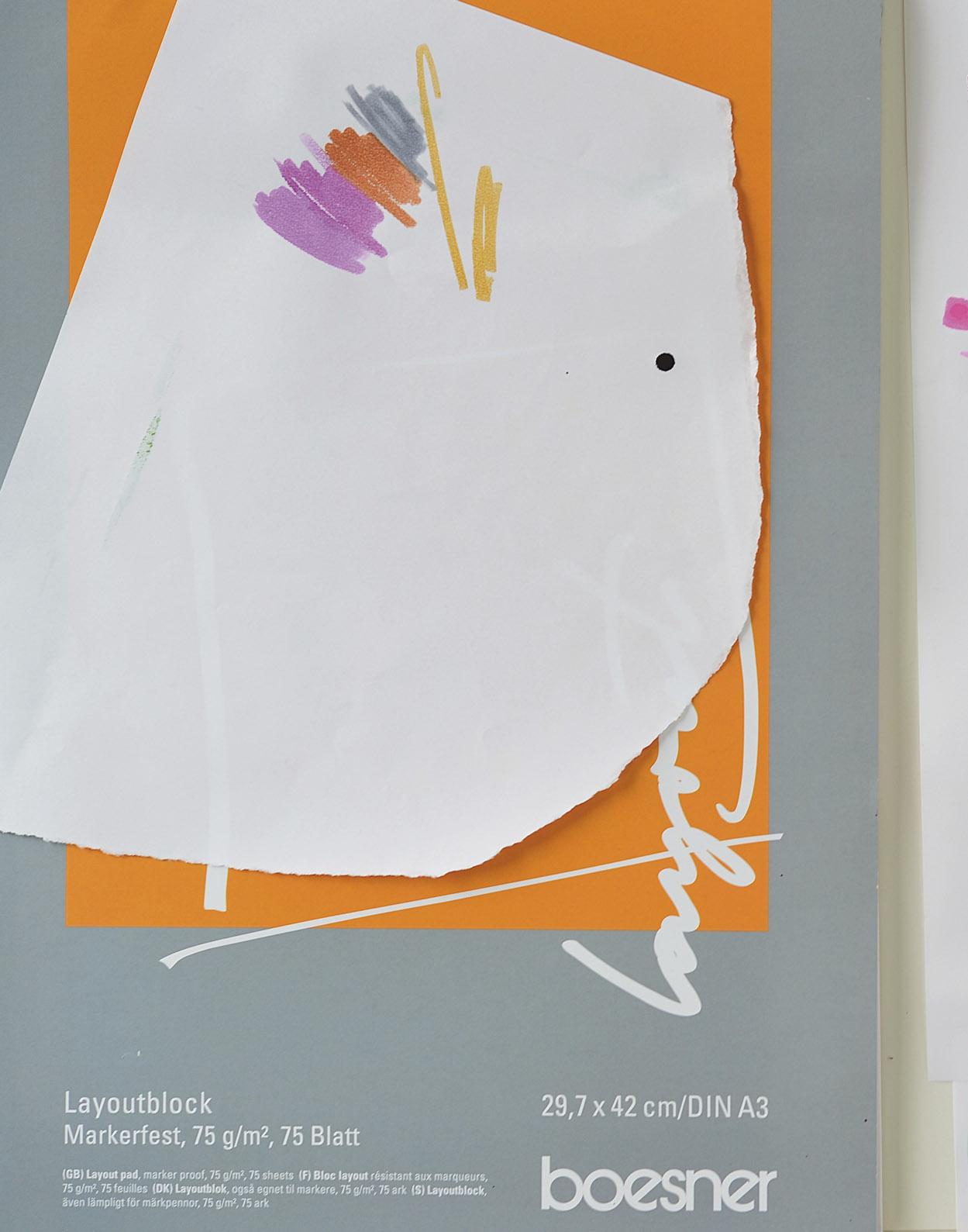

Ideen brauchen Raum – und ein Papier, das sie trägt. Der boesner Layoutblock bietet eine Oberfläche, die sich für un terschiedlichste Werkzeuge eignet: Fineliner und Marker, aber auch Bleistift oder Tusche gleiten präzise über das feste Papier. Ob für erste Skizzen oder komplexe Komposi tionen – dieser Block ist ein verlässlicher Partner im kreati ven Prozess. Er unterstützt nicht nur das Denken in Formen, sondern auch das Experimentieren mit Medien. Dabei verhindert die Papierbeschaffenheit ein Durchschlagen der Farben, gewährleistet optimalen Farbfluss und brillante Farbwiedergabe.


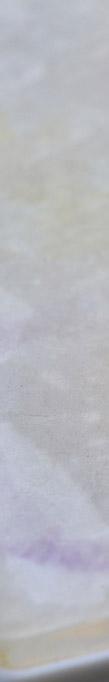


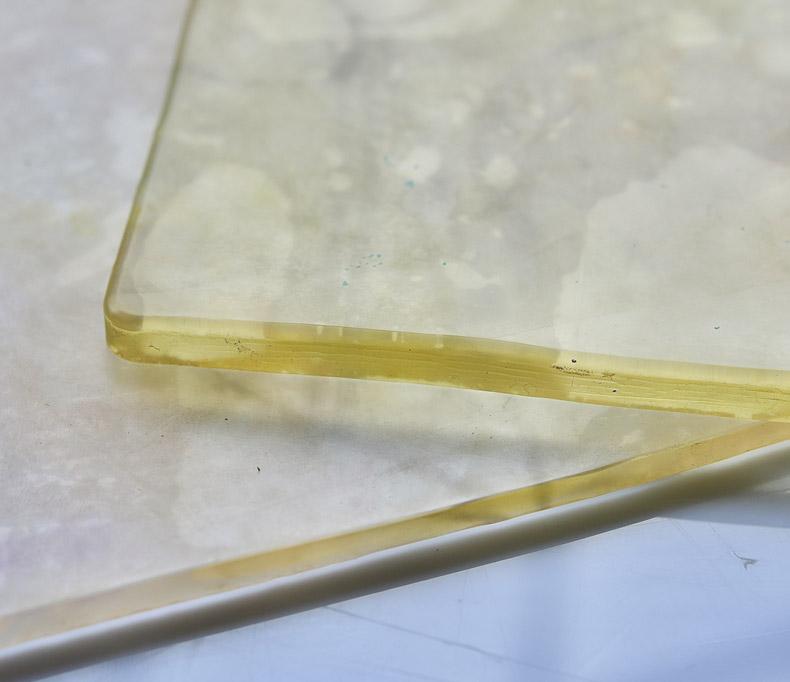

Linke Seite: boesner Scene Gouache in der 1 Liter-Flasche in 27 Farbtönen erhältlich. Rechte Seite oben: ars nova Stahlwolle in 4 Ausführungen von Nr. 000 sehr fein (rechte Abbildung) bis Nr. 4 grob (linke Abbildung) Rechte Seite unten: Gel Press Gel-Druckplatte (neu) für Monotypien, in 4 Formaten erhältlich. Wiederverwendbar und leicht zu reinigen. Rechte Seite rechts: boesner Universalpinsel Serie 50/1314-1, handgefertigt in 10 Größen erhältlich.
Tobias Pils im mumok in Wien

Er hat mit großer Konsequenz und Sensibilität eine eigene Bildsprache entwickelt, die auf die Kraft von Ambivalenzen setzt und sich der schnellen Lesbarkeit entzieht: Tobias Pils wird zu den spannendsten malerischen Positionen der Gegenwart gezählt. Das Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) präsentiert derzeit die bislang umfangreichste Ausstellung seines Werks und knupft damit an die hausinterne Tradition von MidCareer-Surveys österreichischer Kunstler*innen an, die auch international Erfolge feiern. Das Werk von Tobias Pils ist geprägt von einer tiefen Auseinandersetzung mit der Geschichte der Malerei und sucht zugleich aktiv den Dialog mit der Gegenwart. In einer reduzierten, oft fast enthaltsamen Farbwelt entfalten

sich Bildräume, in denen das Persönliche ins Allgemeine ubergeht und das Intime ins Monumentale wächst. Wiederholungen, Variationen und Bruche kreieren ein Spannungsfeld, das den Blick immer wieder neu ausrichtet und das Sehen selbst als eine fortwährende, offene Erkundung erleben lässt – wie ein vertrauter Ort, den man zum ersten Mal betritt.
mit Kommunikation zu tun, mit dem Körper, mit Emotionen und Atmosphäre – allesamt Dimensionen, die auch in Pils’ Malerei eine Rolle spielen.
Die Ausstellung im mumok fokussiert auf Pils’ Werk der vergangenen zehn Jahre und schließt damit an seine letzte institutionelle Präsentation in Wien an („Secession“, 2013). Auf zwei Ausstellungsebenen erschließt sich, wie Pils seine Malerei von der Abstraktion zur Gegenständlichkeit und vom Schwarzweiß in die Farbigkeit weiterentwickelt, ohne diesen Unterscheidungen jedoch grundlegende Bedeutung beizumessen: „Ich habe meine Arbeit nie als schwarzweiß gesehen, daher sehe ich sie jetzt nicht als besonders bunt.“
Der Ausstellungstitel „Shh“ trägt dieser Offenheit Rechnung: Es ist kein Wort, das etwas benennt, sondern ein Klang, der eine Wirkung erzielen will. Ein Laut, der zum Leise-Sein auffordert. Eine Geste, die beruhigend oder autoritär wirken kann, Intimität oder Distanz stiftet, einen Raum öffnet oder schließt. „Shh“ hat [2] Ausstellungsansicht, „Tobias Pils. Shh“, 27. September 2025 bis 12. April 2026, Tobias
mumok.
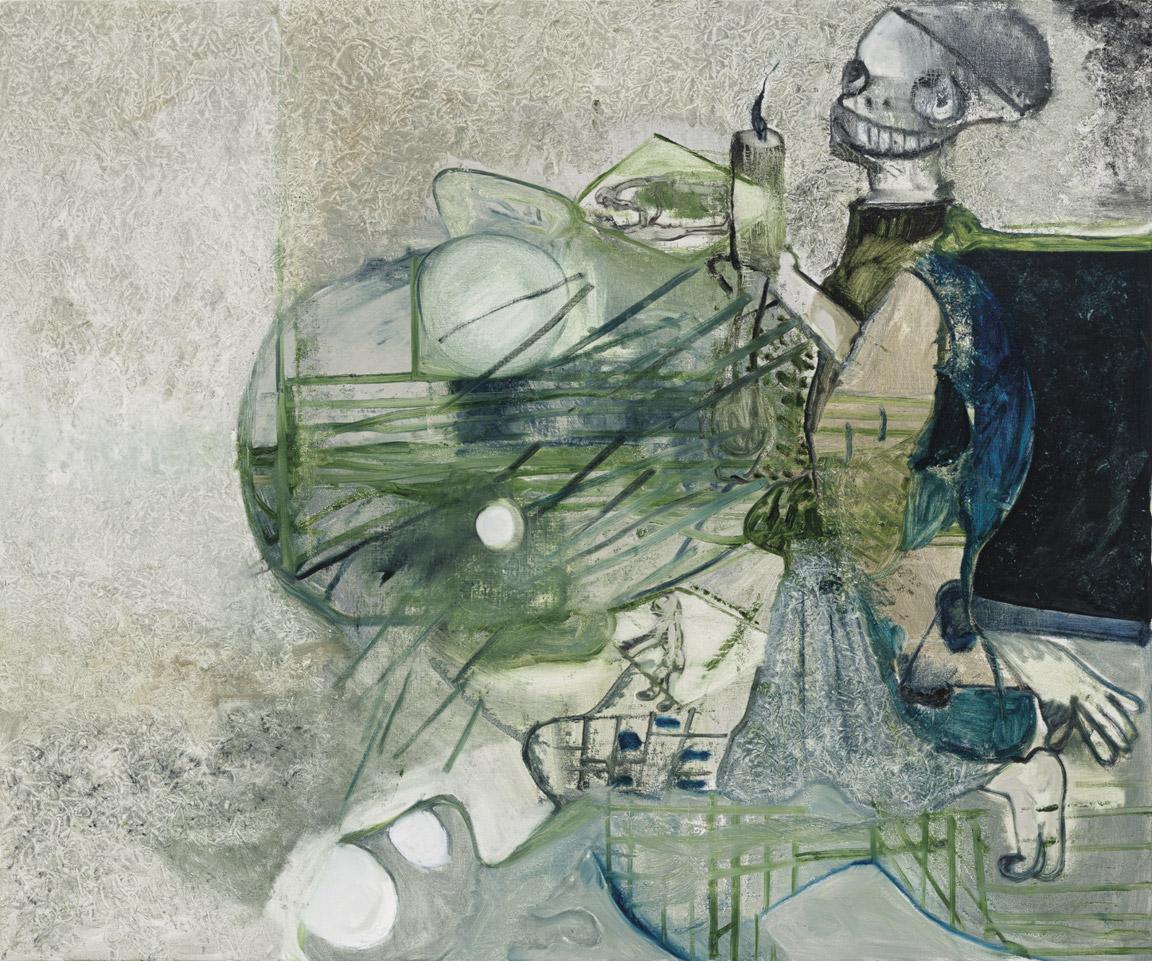
Charakteristisch fur Pils’ Arbeiten ist ein wiederkehrendes Repertoire an Motiven. Autobiografische Anspielungen verbinden sich mit klassischen Motiven der westlichen Kunstgeschichte, darunter die Heilige Familie, Erlöserfiguren und die Pietà. Der flächige Stil von Cartoons dient ebenso als Vorbild wie die prägnante Formensprache archaischer Bildwerke. Dabei geht es Pils primär um formale Aspekte: „Während ich male, denke ich uberhaupt nicht inhaltlich, sondern rein formal. Ich glaube, dass die Form den Inhalt bestimmt.“ Fur seine Bilder bedeutet dies, dass Motive mutieren, sich verlieren, um sich dann erneut aufzubauen. Die Thematik von Werden und Vergehen – der zyklische
Kreislauf des Lebens – dient als Ausgangspunkt, um zentrale Fragen der Malerei immer wieder neu zu stellen. Eine malerische Markierung fuhrt zur nächsten, ein Bild zu einem weiteren, als wurde auch die Malerei unausgesetzt ihren Tod und ihre Wiedergeburt inszenieren.
Bemerkenswert ist Pils’ Herkunft aus der Zeichnung. Nach einem Studium der Grafik an der Akademie der bildenden Kunste in Wien arbeitet er in den 1990er-Jahren vorwiegend mit Bleistift und Tusche auf Papier, bevor er 2005 an die Leinwand wechselt. Dieser langjährigen zeichnerischen Tätigkeit, auf deren Anfänge
eine Gemeinschaftsarbeit mit der Literatin Friederike Mayröcker verweist, ist die Vorliebe des Kunstlers fur das Schwarzweiß-Spektrum geschuldet. Daruber hinaus prägt sie auch den Herstellungsprozess der Malereien: Pils’ Bilder entstehen uber viele Jahre auf dem Boden, wo er die rohen Leinwände von allen vier Seiten bearbeitet. Erst 2020 beginnt er, grundierte Leinwände und eine Staffelei zu verwenden. Die Geister von 2024–2025 demonstrieren, dass Pils seine Bilder beim Malen gelegentlich auch heute noch – wie ein Blatt Papier – dreht.
Ein zentrales fruhes Werk der Ausstellung ist Untitled (Mädchen) von 2015, das das Cover der die Ausstellung begleitenden Publikation ziert. Diese monumentale Darstellung einer Strichfigur, die an eine Kreuzigung, aber auch an ein Verkehrsschild denken lässt, entsteht nach einem längeren Aufenthalt in New York, der die Weichen fur Pils’ Auseinandersetzung mit der Malerei als Fläche stellt. In den Folgejahren entwickelt er ein Repertoire von cartoonhaften Charakteren, die er „Wiener Vögel“ oder „Knilche“ nennt und zu flächigen Konstellationen verbindet. Diese Charaktere erhalten ein Geschlecht – gelegentlich auch mehrere – und pflanzen sich fort, was zum Sinnbild fur Bildergruppen wird, die gewissermaßen einen Genpool teilen.
Bei Tobias PIls dient die Thematik des Werdens und Vergehens als Ausgangspunkt, um zentrale Fragen der Malerei immer wieder zu stellen.

2018 spricht Pils in Zusammenhang mit seinen Bildern erstmals von „Familien“ und genealogische Überlegungen gewinnen an Bedeutung. Besonders deutlich wird dies in dem Zyklus Seven Days, in dem eine Schöpfungsgeschichte zur Metapher fur den kreativen Prozess wird. Pils’ Ausgangsidee war es, Figuren bei der Handhabung eines Passstuckes des österreichischen Ku nstlers Franz West zu zeigen. Tatsächlich muten seine Figuren selbst wie Passstucke an: Ihre hölzernen Körper sind dem Bildformat flächig eingepasst, während sie die eigentlichen Passstucke als Balken vor dem Gesicht, als eine Art Heiligenschein oder als Nasenprothese tragen. Seven Days verhandelt mit dem Ursprung der Schöpfung auch die Genese der eigenen Malerei. Im Großen wie im Kleinen entwickelt Pils eine Kosmologie der Formen, die sich fortlaufend selbst hervorzubringen scheinen. [4] Untitled (Mädchen), 2015, Mischtechnik auf Leinwand, 320 x 200 cm, mumok – Museum moderner


Auf anschauliche Weise demonstriert dies eine Gruppe von Baumbildern aus dem Jahr 2019, die in der Ausstellung Kante an Kante gehängt einen artifiziellen „Wald“ ergeben. Darin variiert Pils das paradiesische Motiv eines Liebespaares, das sich unter einem Apfelbaum dem Geschlechtsakt hingibt. Aus den Zutaten „Baum“, „Liebende“ und „Äpfel“ entstehen sechs ganz unterschiedliche Kompositionen, in denen Form und Inhalt, das Naturliche und das Kunstliche wiederholt die Plätze tauschen.
Das „Verkuppeln“ und die „Reproduktion“ sind Gegenstand der Darstellung und bestimmen zugleich den Aufbau der Bilder.
Die unkonventionelle Hängung der Baumbilder fuhrt vor, dass sich Pils’ Interesse am Ineinanderpassen der Formen, an Fragen von Rhythmus und Taktung, nicht auf einzelne Kompositionen beschränkt. Vielmehr betrachtet er seine Bilder als Teil eines größeren Ganzen, das auch das räumliche Gefuge umfasst. Dies zeigt sich uberall dort, wo die Hängung der Bilder von klassischen Präsentationsweisen abweicht – und ganz besonders in der von Pils speziell fur das mumok konzipierten Wandmalerei, in der sich die Figur aus Untitled (Mädchen) entlang einer fast zwanzig Meter langen Wand zur Ruhe begibt.
[5] A Found Egg, 2023, Öl auf Leinwand, 270 x 199 cm, Courtesy Eva Presenhuber, Zurich/Wien, Foto: Jorit Aust, © Tobias Pils.
[6] Hmm, 2025, Öl auf Leinwand, 130 x 90 cm, Courtesy Tobias Pils, Foto: Jorit Aust, © Tobias Pils.
Als Pils 2020 vom Boden an die Staffelei wechselt und damit den Malprozess buchstäblich auf „neue Beine“ stellt, erweitert sich sein motivisches Repertoire: Plötzlich tauchen Pferde auf, die Figuren tragen, und Augäpfel wie Köpfe, die das Geschehen in und außerhalb der Leinwand sondieren. Im ubertragenen
Sinne ist das Bild nun ein Körper, der getragen wird. Das Auge wiederum – das an der Staffelei Distanz zum Bild einnehmen kann – ist zu einem mobilen Organ geworden.
2022 bricht Pils sich bei einem Fahrradunfall die rechte Schulter. Als er nach einer längeren Pause die Arbeit wieder aufnehmen kann, entsteht eine Gruppe von Bildern mit dem Titel Sh, die das Cartoonhafte gänzlich ablegen. Die dargestellten Figuren erscheinen knochig und fragmentiert, mit Gliedmaßen, die grotesk verdreht sind oder durch prothesenhafte Fortsätze ersetzt wurden. Der Eindruck einer foltergleichen Behandlung stellt sich ein, und in fast jeder Komposition taucht ein kleiner alter Mann auf, der sich auf einen Stock stutzt.
Die in Sh verhandelte Erfahrung, „ein Körper zu sein“, wie Pils es formuliert, mundet in eine Werkfamilie mit dem Titel Us, in der der Begriff „Familie“ wörtlich zu verstehen ist. Die dargestellten Personen sind dem Kunstler vertraut. Er zeigt sie in unterschiedlichen Verhältnissen von Nähe und Distanz, während sich Posen und Gesten wiederholen – besonders markant eine Frau, die kniend ihr langes Haar wäscht, sowie Figuren, die ein Ei halten. Mit dem Körper findet auch die Farbe Eingang in Pils’ Werk. Gebrochenes Braun und Blau verleihen den Bildern Atmosphäre, erwärmen sie gleichsam von innen. Parallel dazu lässt sich ein stärkerer Fokus auf die Behandlung der Oberflächen beobachten, die mit Verwischungen, Gravuren und Tupfern versehen werden.
Pils’ jungste Bilder geben einen Ausblick in die Zukunft: In einer Reihe buntfarbiger Stillleben beschäftigt sich der Kunstler mit der Idee des Genrehaften – mit der existenziellen Dimension, die im Gewöhnlichen steckt. Die Tische in diesen Bildern muten wie Buhnen an, und Gefäße, Kerzen und Blumen werden zu Darstellern in Genrestucken, die das Verhältnis von Stillstand und Bewegung, von Fläche und Volumen erproben. „Im Grunde steht aber alles still“, schreibt Friederike Mayröcker 1993 zu einer von Pils’ Zeichnungen, „wer kann das verstehen“.
Die Ausstellung im mumok ist die bislang umfangreichste Prä sentation von Pils’ Werk. Neben einem Überblick uber sein malerisches Schaffen des letzten Jahrzehnts widmet sie sich auch dem umfassenden zeichnerischen Werk des Kunstlers. Ebenfalls Teil der Ausstellung ist eine fur den konkreten Ort konzipierte Wandmalerei, die sowohl auf die transitorische als auch die raumbezogene Dimension von Pils’ kunstlerischer Praxis verweist.#
Im Großen wie im Kleinen entwickelt sich eine Kosmologie der Formen, die sich fortlaufend selbst hervorzubringen scheinen.
Bis 12. April 2025
Tobias Pils. Shh.


Tobias Pils. Shh
Manuela Ammer (Hrsg.), Beiträge von Manuela Ammer, Ann Cotton, Bice Curiger, Friederike May röcker, Sophia Rohwetter, Richard Shiff und Ferdinand Schmatz, dt., Hardcover mit Schutzumschlag, 360 S. m. 300 (200 farb.), Abb., 24 x 30 cm, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, ISBN 9783753309309
Kontakt
Mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien Museumsplatz 1, 1070 Wien Tel. +43-1-52500-0 info@mumok.at, www.mumok.at
„Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infnity“ im Sprengel Museum
Das Sprengel Museum Hannover besitzt mit mehr als 400 Arbeiten die weltweit größte Sammlung von Werken von Niki de Saint Phalle (1930–2002), dem Museum vor einem Vierteljahrhundert geschenkt von der Künstlerin selbst. Aus Anlass des 25. Jahrestags dieser Schenkung zeigt das Haus nun bis zum 14. Februar 2026 die große, aufwendig inszenierte Schau „Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infinity“, in der erstmals Werke von Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama und Takashi Murakami gemeinsam präsentiert werden. Die Ausstellung umfasst rund 120 Exponate – darunter zahlreiche Großformate – aus Malerei, Skulptur, Installation, Grafik und Film. Auf einer Fläche von etwa 2.000 Quadratmetern führt sie durch zwölf thematisch gegliederte Räume, die mit farbenfrohen Inszenierungen und gezielten Setzungen überraschen.
Niki de Saint Phalles großzügige Schenkung im Jahr 2000 hat nicht nur das Sprengel Museum Hannover bereichert, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Identität der Landeshauptstadt geleistet. Ihre ikonischen „Nanas“ – 1974 am Leineufer aufgestellt und von einer Menge Protest, aber auch Befürwortung begleitet – sind heute ein weithin anerkanntes Symbol für eine lebensbejahende und farbenfrohe Kunst im öffentlichen Raum. Die Schenkung umfasst eine beeindruckende Vielfalt – von frühen Gemälden und Assemblagen bis hin zu
großformatigen Skulpturen. Sie bietet einen umfassenden Einblick in das Schaffen der Künstlerin und zeigt Niki de Saint Phalle als eine Persönlichkeit, die für ihre Kunst gesellschaftliche und politische Themen aufgriff und weit über ihre landläufig bekannten Skulpturen hinauswirkte. Kurator Stefan Gronert: „Niki de Saint Phalle war eine Außenseiterin, die es schaffte, berühmt zu werden – ein scheinbarer Widerspruch, der ihre Einzigartigkeit unterstreicht. Ihre Kunst entspringt nicht dem akademischen Diskurs, sondern dem Gefühl, der Lebensfreude und der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen, die damals oft übersehen wurden. Ihre Nanas machten sie bekannt, weil sie jeden in eine gute Stimmung versetzen, und zugleich steckt in ihrer Arbeit eine politische Sprengkraft, die wir vielleicht erst heute wirklich begreifen.“
Ähnlich prägnant sind die Werke von Yayoi Kusama (*1929), deren immersive Installationen und charakteristische PolkaDots eine unverwechselbare künstlerische Handschrift zeigen. Die Japanerin, ein Jahr vor Niki de Saint Phalle geboren, genießt weltweit große Anerkennung und thematisiert in ihren Arbeiten häufig Unendlichkeit, Selbstauflösung und Wiederholung – zentrale Aspekte, die sich in ihren berühmten Infinity Rooms manifestieren. Ihre Polka-Dots ziehen sich wie ein Leitmotiv durch ihr Œuvre und symbolisieren die Verbindung zwischen Individuum



und Universum. Auch in der Modewelt hinterließ Kusama Spuren: Ihre Kooperationen mit dem Mode-Label Louis Vuitton, bei denen die Punkte auf ikonische Taschenmodelle übertragen wurden, erreichten ein globales Publikum und überführten ihre Kunst in den Alltag.
Auch Takashi Murakami (*1962) hat mit seiner kommerzialisierten Bildsprache – geprägt von ikonischen Blumenmotiven im EmojiStil – eine unverkennbare Ästhetik geschaffen. Als Begründer des „Superflat“-Konzepts, das sogenannte „hohe“ Kunst und „niedrige“ Popkultur verbindet, verschränkt Murakami traditionelle japanische Kunst mit zeitgenössischen Themen aus Popkultur und Konsumwelt. Seine Werke bewegen sich gezielt zwischen Kunst und Massenkultur und reflektieren Themen wie Vergänglichkeit, Kommerz und Identität. Besonders populär wurden seine Kooperationen mit Louis Vuitton, bei denen seine leuchtenden Blumen- und Cartoon-Motive die klassische Monogramm-Serie des Modehauses neu interpretierten. Diese Arbeiten trugen entscheidend dazu bei, seine Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und seinen internationalen Erfolg weiter auszubauen.
Nach einer Einführung mit einem Überblick zu diesen drei künstlerischen Positionen widmet sich der erste Ausstellungsraum dem Thema Liebe in ihren unterschiedlichen Facetten – in Fa-
milie und Partnerschaft, in der Natur oder als Sehnsucht nach Unendlichkeit. Es folgen Niki de Saint Phalles frühe Schießbilder aus den 1960er-Jahren, die Konflikte zwischen den Geschlechtern und gesellschaftliche Rollenmuster aufgreifen. Weitere Kapitel befassen sich mit Monstern in Gestalt von Schlangen, Drachen und Comicfiguren, die – vordergründig oftmals bunt, verspielt und niedlich – Bedrohung und innere Abgründe hinter der Oberfläche bereithalten. Darstellungen von Sexualität treten als monumentale Phallusskulpturen und provokante Körperbilder hervor, die zwischen Bedrohung und ironischer Brechung changieren. Die Verknüpfung von Kunst und Kommerz findet sich als Schnittmenge im Werk aller drei Künstler*innen: Niki de Saint Phalles Design-Objekte wie Parfum-Flakons und Accessoires sind hier ebenso vertreten wie Kusamas und Murakamis Kooperationen mit der Modewelt.
Der Abschluss der Schau stellt die Verbindung von Lebensfreude und Vergänglichkeit in den Mittelpunkt. In der großen Ausstellungshalle entsteht ein immersiver Gesamteindruck: Ein verspiegelter Boden verdoppelt die gezeigten Werke und bezieht die Besucher*innen in die Szenerie ein. Präsentiert werden unter anderem Niki de Saint Phalles Skull (Meditation Room), ein begehbarer Raum in Form eines glitzernden Schädels, Kusamas Infinity Mirrored Room sowie Murakamis großformatige Blumenbilder,
[1] Niki de Saint Phalle, French-American sculptor, painter, and filmmaker Niki de Saint Phalle with one of her pieces, 1983, Foto: Norman Parkinson / Iconic Images, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025/Niki de Saint Phalle. [2] Yayoi Kusama at a press preview of her 2013 exhibition „I Who Have Arrived In Heaven“ at David Zwirner Gallery, New York, Foto: by Andrew Toth/Getty Images. [3] Artist Takashi Murakami poses for photographs, 8. Juli 2002, Foto: by Dominique Maître/WWD/Penske Media via Getty Images.


in denen sich die farbenfrohen Motive in ein dichtes Feld aus Totenköpfen verwandeln. Die Kombination der Werke und die räumliche Inszenierung eröffnen eine Erfahrung, in der Freude und Bedrohung, Fülle und Auflösung, Leben und Tod unmittelbar nebeneinander erfahrbar werden können.
sische Retrospektive, sondern eine lebendige, thematisch aufgeladene Gegenüberstellung. Die Besucher*innen erwartet kein bloßes Nebeneinander, sondern ein intensives, sinnlich erfahrbares Miteinander.“
Im Herzen der Ausstellung findet sich ein von der Museumsabteilung Bildung und Vermittlung gestalteter Raum. Hier können Besucher*innen selbst aktiv werden: In Anlehnung an Briefe von Niki de Saint Phalle lassen sich eigene Liebesbotschaften verfassen und verschicken. Ergänzend dazu wurden taktile Objekte entwickelt, die insbesondere blinden und sehbehinderten Personen einen barrierefreien Zugang zu zentralen Motiven
„Diese Ausstellung bringt drei Ikonen der Kunstgeschichte zusammen, die auf ganz unterschiedliche Weise universelle Themen berühren und dabei Brücken schlagen – zwischen Kunst, Popkultur und gesellschaftlicher Reflexion“, erläutert Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel Museums Hannover, und Ausstellungskurator Stefan Gronert ergänzt: „Wir zeigen keine klas[4] Niki de Saint Phalle, Gwendolyn, 1966–1990, Polyester, beschichtet, Farbe, auf Metallbasis, 252 x 200 x 125 cm, Sprengel Museum Hannover, Hannover, Schenkung Niki de Saint Phalle (2000), © Niki Charitable Art Foundation, Foto: Herling/Herling/Werner, Sprengel Museum Hannover, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025/Niki de Saint Phalle. [5] Yayoi Kusama, Infinity Mirrored Room – The Eternally Infinite Light of the Universe Illuminating the Quest for Truth, 2020, Holz, Metall, Glasspiegel, Kunststoff, Acrylplatte, Gummi, LED-Beleuchtungssystem, Schaumstoffkugeln, Edelstahlkugeln, 296 x 622,4 x 622,4 cm, LAS Art Foundation, © Yayoi Kusama. [6] Takashi Murakami, And Then, When That's Done...I change. What I Was Yesterday Is Cast Aside, Like An Insect Shedding Its Skin, 2009, Acryl/Leinwand, 300 x 300 cm, Fondation Louis Vuitton, © Takashi Murakami, Kaikai Kiki Co. Ltd.

[6]
Mit mehr als 400 Arbeiten, die Niki de Saint Phalle dem Haus im Jahr 2000 schenkte, besitzt das Sprengel Museum Hannover die weltweit größte Sammlung ihrer Werke.
ermöglichen. So verbindet die Ausstellung partizipative Elemente mit inklusiven Angeboten und eröffnet unterschiedliche Wege, sich den Themen der Schau anzunähern.
„Die Schenkung von Niki de Saint Phalle vor 25 Jahren war ein Meilenstein – nicht nur fur das Sprengel Museum Hannover, sondern für die gesamte Stadtgesellschaft“, so Belit Onay, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover. „Sie hat den internationalen Blick auf Hannover verändert und ein lebendiges Erbe hinterlassen, das bis heute wirkt. Ich bin überzeugt, dass diese Schau ein Publikumsmagnet sein wird und weit über die Stadtgrenzen hinaus Aufmerksamkeit findet.“#
Bis 14. Februar 2026 Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infinity.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, der exklusiv im Museum angeboten wird.
Kontakt
Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover Tel. +49-(0)511-16843875 www.sprengel-museum.de
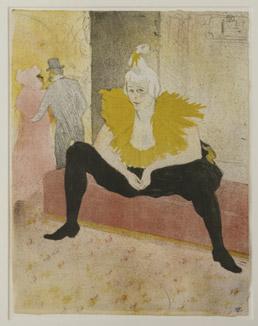
Henri de Toulouse-Lautrec, Die sitzende Clownin, Fräulein Chao-U-Kao, aus der Folge „Elles“, 1. Tafel, Lithografie, Schwarz auf Velin, 36,3 x 37 cm © The Scharf Collection, Foto: Peter Tijhuis
Bis 15. Februar 2026
The Scharf Collection. Goya – Monet – Cézanne –Bonnard – Grosse.
Alte Nationalgalerie www.smb.museum
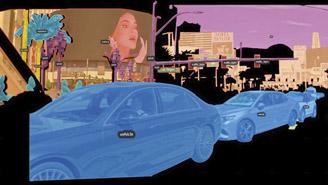
Nicolas Gourault, Unknown Label, (Film Still), 2023, © Nicolas Gourault.
Bis 23. November 2025
Human AI Award 2025. Nicolas Gourault
Kunstmuseum Bonn www.kunstmuseum-bonn.de
Aachen
Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicher Straße 97–109, 52070 Aachen Tel. +49-(0)241-1807-104 www.ludwigforum.de
Bis 14. Dezember 2025: Rochelle Feinstein. The Today Show. Bis 31. Dezember 2025: Zeitbild, Provokation, Kunst. Peter Ludwig zum 100. Geburtstag. Bis 31. Dezember 2025: Earth, Moon, Sun: Restaurierungslabor Nam June Paik. Bis 31. Dezember 2025: Oh, Clock! Sammlungspräsentation.
Baden-Baden
Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8b, 76530 Baden-Baden Tel. +49-(0)7221-398980 www.museum-frieder-burda.de
Bis 8. Februar 2026: Impressionismus in Deutschland. Max Liebermann und seine Zeit.
Berlin
Alte Nationalgalerie
Bodestraße, 10178 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242 www.smb.museum
Bis 15. Februar 2026: The Scharf Collection. Goya – Monet – Cézanne – Bonnard – Grosse.
Bode-Museum
Am Kupfergraben (Eingang über die Monbijoubrücke), 10117 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242 www.smb.museum
Bis auf Weiteres: Das Taufecken von Siena. Geschichte, Restaurierung und Wiederaufstellung eines Gipsmodells. Bis auf Weiteres: Das heilende Museum. Achtsamkeit und Meditation im Kunstraum. Bis 20. September 2026: Die Pazzi-Verschwörung. Macht, Gewalt und Kunst im Florenz der Renaissance.
Matthäikirchplatz, 10785 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242
www.smb.museum
Bis 30. November 2025: Das alles bin ich! Die. Schenkung Christoph Müller II. Begegnungen. 20. November 2025 bis 6. April 2026: Hommage an Vittore Carpaccio.
Hamburger Bahnhof –Nationalgalerie der Gegenwart
Invalidenstraße 50–51, 10557 Berlin Tel. +49-(0)30-266424242 www.smb.museum
Bis 4. Januar 2026: Toyin Ojih Odutola. U22 – Adijatu Straße. Bis 4. Januar 2026: Chanel Commission: Klára Hosnedlová. Embrace. Bis 25. Januar 2026: Delcy Morelos. Madre. Bis 31. Mai 2026: Petrit Halilaj. Syrigana. 14. November 2025 bis 3. Mai 2026: Annika Kahrs. 12. Dezember 2025 bis 13. September 2026: Saâdane Aff. Five Preludes.
Humboldt Forum
Schloßplatz, 10178 Berlin Tel. +49-30-992118989 www.humboldtforum.org
Bis 1. Dezember 2025: Gemeinsam gemacht. Netzwerke der Kreativität in Kunst aus Japan. Bis 31. Dezember 2025: Manatunga. Künstlerische Interventionen von George Nuku. Bis 26. Januar 2026: Freiheit, Gleichheit, Solidarność. Polnische Standpunkte in Berlin. Bis 23. Februar 2026: Ts’uu – Zeder. Von Bäumen und Menschen. Bis 16. März 2026: Naga Land. Stimmen aus Ostindien. Bis 25. Mai 2026: Geschichte(n) Tansanias. Bis 1. Juni 2026: Restaurierung im Dialog. Blick hinter die Kulissen.
Matthäikirchplatz, 19785 Berlin Tel. +49-(0)30-266424242 29 www.smb.museum
Bis 23. November 2025: Symbiotic Wood. Bis 30. Dezember 2025: Respiration. Atelier le balto im Kunstgewerbemuseum. Bis 7. Juni 2026: Mode aus Paris. Schenkung Erika Hofmann.
Museum für Fotografe
Jebensstraße 2, 10623 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242 www.smb.museum
Bis 4. Januar 2026: Seen By #20: Citylicious. Bis 15. Februar 2026: Rico Puhlmann. Fashion Photography 50s–90s. Bis 15. Februar 2026: Newton’s Riviera & Dialogues. Collection Photographs x Helmut Newton.
Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50, 10785 Berlin
Tel. +49-(0)30-266424242 www.smb.museum
Bis 1. März 2026: Max Ernst bis Dorothea Tanning. Netzwerke des Surrealismus. Provenienzen der Sammlung Ulla und Heiner Pietzsch. Bis auf Weiteres: Zerreißprobe. Kunst zwischen Politik und Gesellschaft. Sammlung der Nationalgalerie 1945–2000. Bis September 2026: Gerhard Richter. 100 Werke für Berlin.
Bonn
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 2, 53113 Bonn
Tel. +49-(0)228-776260
www.kunstmuseum-bonn.de
Bis 23. November 2025: Human AI Award 2025. Nicolas Gourault. Bis 18. Januar 2026: Douglas Swan. Bonn-Variationen. Bis 22. Februar 2026: Gregory Crewdson. Retrospektive. Bis 17. Mai 2026: Rune Mields. Zum 90. Geburtstag. Bis 19. September 2027: Menschen und Geschichten. Die Sammlung der Klassischen Moderne – August Macke und die Rheinischen Expressionisten. 13. November 2025 bis 22.März 2026: Ausgezeichnet#9: Felix Schramm. Stipendiat:innen der Stif tung Kunstfonds. 11.Dezember 2025 bis 12. April 2026: Kerstin Brätsch. M TAATEM.
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn
Tel. +49-(0)228-9171-0 www.bundeskunsthalle.de
Bis 11. Januar 2026: W.I.M. Die Kunst des Sehens. Bis 25. Januar 2026: Wetransform. Zur Zukunft des Bauens. Bis 6. April 2026: Expedition Weltmeere. Bis 4. Januar 2026: 27. Bundespreis für Kunststudierende.


Ausstellungsansicht:
Philippe Parreno, Snow Drift, 2014, Sammlung Haubrok; Shilpa Gupta, Untitled, 2020–21, Sû Collection, © Shilpa Gupta. Courtesy the artist and neugerriemschneider, Berlin, Foto: Tobias Hübel.
Bis 15. März 2026
Cold as Ice.
Kälte in Kunst und Gesellschaft
Neues Museum Weserburg Bremen www.weserburg.de

Sarah van Rij, Silent Season, 2020, Veluwe, © Sarah van Rij
Bis 4. Januar 2026
Sarah van Rij. Im Klang der Schatten
Deichtorhallen Hamburg www.deichtorhallen.de
Bremen
Kunsthalle Bremen
Am Wall 207, 28195 Bremen
Tel. +49-421-32908-0 www.kunsthalle-bremen.de
Bis 11. Januar 2026: Sibylle Springer. Ferne Spiegel. Bis 15. Februar 2026: Alberto Giacometti. Das Maß der Welt. 12. November 2025 bis 1. März 2026: Flirt und Fantasie. Grifelkunst von Max Klinger bis Peter Doig.
Teerhof 20, 28199 Bremen
Tel. +49-(0)421-59839-0
www.weserburg.de
Bis 15. März 2026: Cold as Ice. Kälte in Kunst und Gesellschaft. Bis 10. Mai 2026: Julika Rudelius. The Emperor’s New Mall. 22. November 2025 bis 4. Oktober 2026: Die Tödliche Doris.
Düsseldorf
Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen K 20
Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf
Tel. +49-(0)211-8381130
www.kunstsammlung.de
Bis 15. Februar 2026: Queere Moderne. Bis auf Weiteres: Raus ins Museum! Rein in Deine Sammlung. Meisterwerke von Etel Adnan bis Andy Warhol.
Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen K 21
Ständehausstraße 1, 40217 Düsseldorf
Tel. +49-(0)211-8381204
www.kunstsammlung.de
Bis 30. August 2026: Tadáskía. Preisträgerin K21 Global Art Award. 29. November 2025 bis 19. April 2026: Grund und Boden. Wie wir miteinander leben.
Kunstpalast
Ehrenhof 4–5, 40479 Düsseldorf
Tel. +49-(0)211-8996260
www.kunstpalast.de
Bis 11. Januar 2026: Hans-Peter Feldmann. Kunstausstellung. Bis 1. Februar 2026: Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter. Bis
8. März 2026: Die geheime Macht der Düfte. 26. November 2025 bis 22. März 2026: Das fünfte Element. Werke aus der Sammlung Kemp.
Duisburg
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum
Friedrich-Wilhelm-Straße 40 47049 Duisburg, Tel. +49-(0)203-2832630 www.lehmbruckmuseum.de
Bis 22. Februar 2026: Mika Rottenberg. Queer Ecology. Bis 1. Mai 2026: Plastik Fantastik.
Emden
Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden
Tel. +49-(0)4921-97500 www.kunsthalle-emden.de
Bis 2. November 2025: Dem Himmel so nah. Wolken in der Kunst. Bis 2. November 2025: Ostfriesland Biennale. 15. November 2025 bis 12. April 2026: Armin Mueller-Stahl. Nacht und Tag auf der Erde.
Frankfurt
Liebieghaus Skulpturensammlung
Schaumainkai 71, 60536 Frankfurt Tel. +49-(0)69-650049-0 www.liebieghaus.de
13. November 2025 bis 3. Mai 2026: Tiere sind auch nur Menschen.
Städel Museum
Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt Tel. +49-(0)69-6050980 www.staedelmuseum.de
Bis 23. November 2025: Gesichter der Zeit. Fotografen von Hugo Erfurth. Bis 18. Januar 2026: Bilderwelten der USA. Fotografe zwischen Stadt, Subkultur und Mythos. Bis 1. Februar 2026: Carl Schuch und Frankreich. Bis 12. April 2026: Asta Gröting. Ein Wolf, Primaten und eine Atemkurve. 3. Dezember 2025 bis 15. März 2026: Beckmann.
Hagen
Emil Schumacher Museum
Kunstquartier Hagen
Museumsplatz 1, 58095 Hagen
Tel. +49-(0)2331–2073138, www.esmh.de
Bis 11. Januar 2026: Informelle Künstlerinnen der 1950er/1960er-Jahre.
Hamburg
Bucerius Kunstforum
Alter Wall 12, 20457 Hamburg Tel. +49-(0)403609960 www.buceriuskunstforum.de
28. November 2025 bis 6. April 2026: Kinder, Kinder! Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit.
Deichtorhallen Hamburg
Deichtorstraße 1–2, 20095 Hamburg Tel. +49-(0)40-23103200,www.deichtorhallen.de
Bis 4. Januar 2026: Sarah van Rij. Im Klang der Schatten. Bis 26. April 2026: Daniel Spoerri. Ich liebe Widersprüche (Sammlung Falckenberg). Bis 26. April 2026: Huguette Caland. A Life in a few lines. Bis 26. April 2026: Into the unseen. The Walther Collection. Philip Montgomery. American Cycles.
Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall, 20095 Hamburg Tel. +49-(0)40-428131-200 www.hamburger-kunsthalle.de
Bis 4. Januar 2026: Das Gespenst in der Kurve. Schenkung: Kunstwerke von Hilka Nordhausen. Bis 11. Januar 2026: Impressionismus. DeutschFranzösische Begegnungen. Bis 25. Januar 2026: Anders Zorn. Schwedens Superstar.
Hannover
Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover Tel. +49-(0)511-168-43875 www.sprengel-museum.de
Bis 25. Januar 2026: Käte Steinitz. Von Hannover nach Los Angeles. Bis 14. Februar 2026: Niki. Kusama. Murakami. Love you for infnity. 22. November 2025 bis 1. März 2026: Sven-Julien Kanclerski. Sprengel Preis 2025. Niedersachsen in Europa.


Alexander Kanoldt, Sillleben IV, 1925 © Kunsthalle Mannheim, Foto: Kunsthalle Mannheim / Cem Yücetas
Bis 31. Dezember 2025 Fokus Sammlung. Neue Sachlichkeit
Kunsthalle Mannheim www.kuma.art

Guido Jendritzko, aus der vierteiligen Fotoarbeit Distribution XXXI, 1988, Collage, Vintage-Print, 81 x 61 cm, Von der Heydt-Museum Wuppertal, © Rechtsnachfolger:in
Bis 8. Februar 2026
Guido Jendritzko. Zum 100. Geburtstag
Von der Heydt-Museum www.von-der-heydt-museum.de
Köln
Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln
Tel. +49-(0)221-221-26165
www.museum-ludwig.de
Bis 11. Januar 2026: Fünf Freunde: John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Cy Twombly. Bis 22. März 2026: Smile! Wie das Lächeln in die Fotografe kam.
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
Obenmarspforten (am Kölner Rathaus)
50667 Köln, Tel. +49-(0)221-221-21119 www.wallraf.museum
Bis 31. Mai 2026: B{l}ooming. Barocke Blütenpracht. 14. November 2025 bis 15. März 2026: Expedition Zeichnung. Niederländische Meister unter der Lupe.
Mannheim
Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4, 68165 Mannheim
Tel. +49-(0)621-2936423, www.kuma.art
Bis 23. November 2025: Studio: Shimpei Yoshida. Bis 31. Dezember 2025: Fokus Sammlung. Neue Sachlichkeit. Bis 11. Januar 2026: Kirchner, Lehmbruck, Nolde. Bis 1. März 2026: Constantin Luser.
München
Alte Pinakothek
Barer Straße 27, 80333 München
Tel. +49-(0)89-23805-216 www.pinakothek.de
Bis 31. Dezember 2026: Von Turner bis van Gogh. Meisterwerke der Neuen Pinakothek in der Alten Pinakothek. Bis 11. Januar 2026: Rahmen machen Bilder.
Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1, 80538 München
Tel. +49-(0)89-21127-113 www.hausderkunst.de
Bis 1. Februar 2026: Archives in Residence: KEKS. Bis 1. Februar 2026: Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968. Bis 1. Februar 2026:
Koo Jeon A. Haus der Magnet. Bis 1. Februar 2026: Ei Arakawa-Nash. Please Draw Freely. Bis 22. Februar 2026: Gülbin Ünlü. Nostralgia. Bis 22. März 2026: Cyprien Gaillard. Wassermusik. 14. November 2025 bis 17. Mai 2026: Sandra Vásquez de la Horra. Soy Energia.
Pinakothek der Moderne
Barer Straße 40, 80333 München Tel. +49-(0)89-23805-360 www.pinakothek.de
Bis 31. Dezember 2025: Mix & Match. Die Sammlung neu entdecken. 11. Dezember 2025 bis 12. April 2026: Sweeter than Honey. Ein Panorama der Written Art.
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München
Luisenstraße 33, 80333 München
Tel.+49-(0)89-23396933 www.lenbachhaus.de
Bis 30. November 2025: Dan Flavin. Untitled (For Ksenija). Bis 25. Januar 2026: Der Blaue Reiter. Eine neue Sprache. Bis Frühjahr 2027: Was zu verschwinden droht, wird Bild. Mensch – Natur – Kunst. Bis auf Weiteres: Shifting the Silence. Die Stille verschieben. Gegenwartskunst im Lenbachhaus.
Stuttgart
Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1, 70173 Stuttgart
Tel. +49-(0)711-2162188 www.kunstmuseum-stuttgart.de
Bis 12. April 2026: Joseph Kosuth. „Non autem memoria“. Bis 12. April 2026: Hans-Molfenter-Preis 2025. Bis 12. April 2026: Vom Werk zum Display. Bis 12. April 2026: Anita Berber. „Orchideen“. Bis 12. April 2026: Romane Holderried Kaesdorf. Haltung bewahren. Bis 12. April 2026: 20 Jahre Frischzelle. Bis 12. April 2026: Prägungen und Entfaltungen.
Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30–32 70173 Stuttgart, Tel. +49-(0)711-47040-0 www.staatsgalerie.de
Bis 31. Dezember 2025: This is tomorrow. Neupräsentation der Sammlung des 20./21. Jahrhunderts. Bis 4. Januar 2026: Überfuss. Klingendes Papier von Clemens Schneider. Bis 11. Januar 2026: Katharina Grosse. The
Sprayed Dear. Bis 11. Januar 2026: Playlist. Ein fotografsches Mixtape von Studierenden der Merz Akademie und der ABK Stuttgart.
Weil am Rhein
Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 1, 79576 Weil am Rhein Tel. +49-(0)7621-7023200 www.design-museum.de
Bis 15. Februar 2026: Catwalk: The Art oft he Fashion Show. Bis 10. Mai 2026: Science Fiction Design. Vom Space Age zum Metaverse.
Von der Heydt-Museum
Turmhof 8, 42103 Wuppertal Tel.+49-(0)202-563-6231 www.von-der-heydt-museum.de
Bis 8. Februar 2026: Markus Karstiess. Freundschaftsanfrage No. 3. Bis 8. Februar 2026: Guido Jendritzko. Zum 100. Geburtstag. Bis 8. Februar 2026: Jaana Caspary. Dieter Krieg-Preis.
Paris
Musée d’Art Moderne de Paris
11 Avenue du Pr´seident Wilson, 75116 Paris Tel. +33-1-53674000, www.mam.paris.fr
Bis 8. Februar 2026: George Condo. Bis 22. Februar 2026: Otobong Nkanga. „I dreamt of you in colours“. Bis 22. Februar 2025: Prix Marcel Duchamp 2025.
Musée du Louvre
Rue de Rivoli, 75001 Paris Tel. +33-(0)1-40205050, www.louvre.fr
Bis 16. November 2025: Africa Rising II – Barbara Chase-Riboud. Bis 14. Dezember 2025: The Met at the Louvre. Near Eastern Antiquities in Dialogue. Bis 2. Februar 2026: The Carracci Drawings. 15. Oktober 2025 bis 26. Januar 2026: Jacques-Louis David.


Akseli Gallen-Kallela, Ad Astra (2. Version), 1907, Geschlossen: 120 cm x 196 cm x 12 cm, Öl auf Leinwand, bemalter und vergoldeter Holzschrein, Villa Gyllenberg, Stiftung Signe und Ane Gyllenberg, Helsinki, © Foto: Matias Uusikylä, Signe and Ane Gyllenberg Foundation
Bis 11. Januar 2026
Gothic Modern. Munch, Beckmann, Kollwitz
Albertina www.albertina.at

Paul Klee, Zeichen in Gelb, 1937, 210 (U 10), Pastell auf Baumwolle auf Kleisterfarbe auf Jute auf Keilrahmen, 83,5 x 50,3 cm, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Sammlung Beyeler
Bis 4. Januar 2026
Eine kleine Kunstgeschichte des Punktes
Fondation Beyeler www.fondationbeyeler.ch
Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries
Place de la Concorde, 75001 Paris Tel. +33-(0)1-44504300 www.musee-orangerie.fr
Bis 26. Januar 2026: Michel Payant. See Monet. Bis 26. Januar 2026: Berthe Weill. Avant-garde gallery owner.
Italien Florenz
Galleria degli Ufzi
Piazzale degli Ufzi 6, 50122 Florenz Tel. +39-055-294883, www.ufzi.it
Bis 28. November 2025: Florence and Europa. Eighteenth-Century Art at the Ufzi.
Fondazione Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi, 50123 Firenze Tel. +39-055-2645155
www.palazzostrozzi.org
Bis 25. Januar 2026: Beato Angelico.
Rom
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
Viale delle Belle Arti, 131, 00197 Roma Tel. +39-06-322981
www.gnamc.cultura.gov.it
Bis 11. Januar 2026: Ceroli Totale.
Palazzo delle Esposizioni Roma
Via Nazionale 194, 00184 Roma Tel. +39-06696271 www.palazzoesposizioniroma.it
Bis 18. Januar 2026: 18 th Quadriennal of Fantastic Art. Bis 18. Januar 2026: I Giovani e I Maestri: La Quadriennale del 1935. Bis 18. Januar 2026: Restituzioni 2025. Tesori d’arte restaurati.
Scuderie del Quirinale
Via 24 Maggio, 16, 00186 Roma
Tel. +39-02-92897722
www.scuderiequirinale.it
Bis 3. Mai 2026: The Treasures of the Pharaos.
Venedig
Peggy Guggenheim Collection
Palazzo Venier die Leoni
Dorsoduro 701, 30123 Venezia
Tel. +39-041-2405411
www.guggenheim-venice.it
Bis 2. März 2026: Manu-Facture: The Ceramics of Lucio Fontana.
Wien
Albertina
Albertinaplatz 1, A–1010 Wien
Tel. +43-(0)1-53483-0, www.albertina.at
Bis 11. Januar 2026: Gothic Modern. Munch, Beckmann, Kollwitz. Bis 22. Februar 2026: Lisette Model. Retrospektive. 14. November 2025 bis 6. April 2026: Leiko Ikemura. Motherscapes.
Albertina Modern
Karlsplatz 5, 1010 Wien
Tel. +43-(0)1-534830, www.albertina.at
Bis 1. März 2026: Marina Abramović.
MUMOK – Museum Moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, A-1070 Wien
Tel. +43-(0)1-525 00, www.mumok.at
Bis auf Weiteres: Jongsuk Yoon. Kumgangsan. Bis 16. November 2025: Kazuna Taguchi. I’ll never ask you. Bis 6. April 2026: Die Welt von morgen wird eine weitere Gegenwart gewesen sein. Bis 12. April 2026: Nie endgültig! Das Museum im Wandel. Bis 10. Mai 2026: Mapping the 60s. Kunst-Geschichten aus den Sammlungen des mumok. Bis 12. April 2026: Tobias Pils. Shh. 4. Dezember 2025 bis 31. Mai 2026: Claudia Pagès Rabal. Feudal Holes.
Kunsthistorisches Museum Wien
Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Tel. +43-(0)1-52524-0, www.khm.at
Bis 26. Januar 2026: Kurznachrichten aus der Antike. Bis 22. Februar 2026: Michaelina Wautier. Malerin. Bis 15. März 2026: Pieter Claesz: Stillleben. 11. November 2025 bis
6. September 2026: Kopf & Kragen. Münzen machen Mode.
Schweiz
Basel
Kunsthalle Basel
Steinenberg 7, 4051 Basel
Tel +41-(0)61-2069900 www.kunsthallebasel.ch
Bis 16. November 2025: Bagus Pandega. Sumber Alam. Bis 25. Januar 2026: The Jawbone Sings Blue. Troy Montes Michie. Bis 23. August 2026: Coumba Samba. Wild Wild Wall.
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16, 4010 Basel
Tel. +41-(0)61-2066262 www.kunstmuseumbasel.ch
Bis 11. Januar 2026: Cassidy Toner. Besides the Point. Manor Kunstpreis 2025. Bis 8. Februar 2026: Verso. Geschichten von Rückseiten. Bis 4. Januar 2026: Ofene Beziehung. Sammlung Gegenwart. Bis 28. März 2026: Geister. Dem Übernatürlichen auf der Spur.
Basel/Riehen
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101, 4125 Riehen/Basel
Tel. +41-(0)61-6459700 www.fondationbeyeler.ch
Bis 4.Januar 2026: Eine kleine Kunstgeschichte des Punktes. Bis 25. Januar 2026: Yayoi Kusama.
Zürich
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1, 8001 Zürich
Tel. +41-(0)44-2538484, www.kunsthaus.ch
Bis 30. November 2025: Yto Barrada. Bis 18. Januar 2026: O Mensch! Wilhelm Lehmbruck – Die letzten Jahre. Bis 25. Januar 2026: Druck gemacht! Meisterwerke auf Papier von Albrecht Dürer bis Dieter Roth. Bis 15. Februar 2026: Alice Bailly. Bis Sommer 2026: Wu Tsang. „La montaña invertida“. Bis 8. März 2026: Lygia Clark.
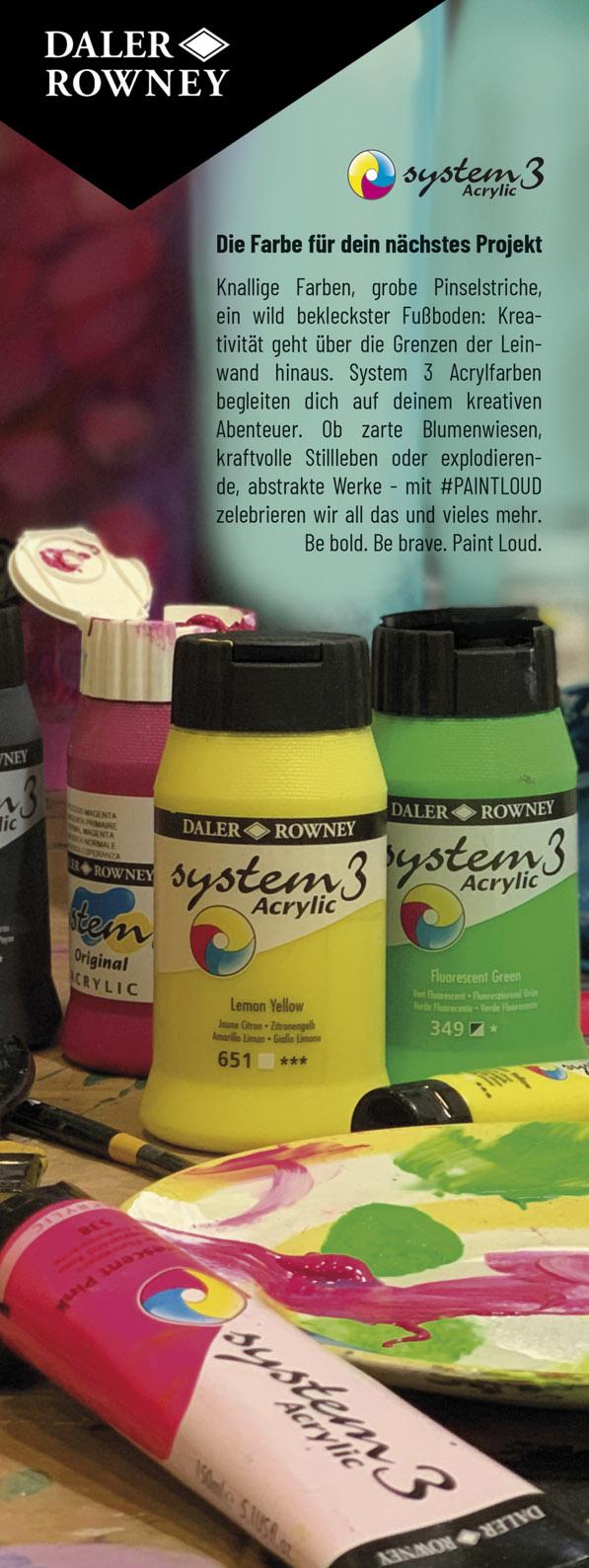
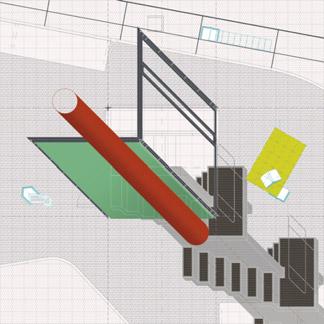
detritus., No bee-bee-beeps, 2025. Image: detritus
Bis 23. November 2025 Vers une architecture: Reflexionen.
Museum für Gestaltung Zürich www.museum-gestaltung.ch

Jorge Rando, O.T. Zyklus Pinturas sucias, 2019, Mischtechnik, 24 x 17 cm, © Jorge Rando, Foto: Fundación Jorge Rando
Bis 30. November 2025 Mis Mariposas
Museo Jorge Rando www.muesojorgerando.org
Museum für Gestaltung Zürich
Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zürich Tel. +41-43-4466767 www.museum-gestaltung.ch
Bis 23. November 2025: Vers une architecture: Refexionen. Bis 7. Dezember 2025: Susanne Bartsch – Transformation! Bis 1. Februar 2026: Museum of the Future – 17 digitale Experimente. Bis 6. April 2026: Junge Grafk Schweiz! 11. November 2025 bis 10. März 2026: Gib acht! Plakative Appelle.
Barcelona
Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona Tel. +34-934-439470, www.fmirobcn.org
Bis 18. Januar 2026: How from here. Bis 18. Januar 2026: Who is Afraid of Ideology? Part 5: right of Passage. Bis 15. Februar 2026: Some American Catalans and the Other Way Around. Bis 6. April 2026: Poetry has just begun. 50 Years of the Miró. Bis 22. Februar 2026: Miró and the United States.
Museu Picasso
Carrer de Montcada, 15-23, 08003 Barcelona Tel. +34-932563000 www.museupicassobcn.cat
27. November 2025 bis 5. April 2026: Ubú painter Alfred Jarry and the Arts.
Madrid
Museo Nacional del Prado
Calle Ruiz de Alarcón, 23, 28014 Madrid Tel. +34-(0)91-3302800 www.museodelprado.es
Bis 11. Januar 2026: The Painter Antonio Muñoz Degrain (1840–1924). Bis 22. Februar 2026: The Art Gallery of Cornelis van der Geest. Bis 30. Juni 2026: The Martyrdom of Saint Andrew. 8. November 2025 bis 8. März 2026: Juan Muñoz. 25. November 2025 bis 1. März 2026: Anton Raphael Mengs (1728–1779). 1. Dezember 2025 bis 24. Mai 2026: The Female Perspective II.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa
Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid Tel. +34-(0)91-7741000 www.museoreinasofa.es
Bis 16. Januar 2026: Miguel Àngel Tornero. Great Frieze. Bis 16. März 2026: Maruja Mallo. Mask and compass. 26. November 2025 bis 20. April 2026: Juan Uslé. That ship on the mountain. 17. Dezember 2025 bis 20. April 2026: Oliver Laxe. HU/وھ. Dance as if no one is watching you.
Museo Thyssen-Bornemisza
Palacio de Villahermosa, Paseo del Prado 8 28014 Madrid, Tel. +34-(0)91-690151 www.museothyssen.org
Bis 25. Januar 2026: Warhol, Pollock and other American spaces. Bis 1. Februar 2026: Picasso and Klee in the Heinz Berggruen Collection. Bis 8. Februar 2026: John Akomfrah. Listening All Night To The Rain.
Málaga
Museo Jorge Rando
Calle Cruz del Molinillo, 12, 29013 Málaga Tel. +34-(0)95-2210991 www.muesojorgerando.org
Bis 30. November 2025: Mis Mariposas.
Museo Picasso
Palacio de Buenavista, Calle San Agustín, 8, 29015 Málaga, Tel. +34-952-127600 museopicassomalaga.org
Bis 14. Dezember 2025: Farah Atassi. Genius Loci. 1 14. November 2025 bis 12. April 2026: Picasso. Memory and Desire.
Die Angaben beruhen auf den Informationen der Aussteller. Änderungen nach Redaktionsschluss vorbehalten.

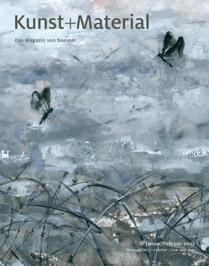




Kunst+Material erscheint zweimonatlich in einer Auflage von 30.000 Exemplaren und bietet Einblicke in Ateliers und Arbeitsweisen von porträtierten Künstler*innen, stellt interessante Inhalte im Sonderthema vor, präsentiert aktuelle Ausstellungen und gibt neben News aus der Kunstwelt viele spannende Buchempfehlungen an die Hand. Neu und exklusiv gibt es inspirierende Bildstrecken zu Materialien und künstlerischen Techniken. Hintergrundstories aus der Feder von Expert*innen informieren über die unterschiedlichsten Materialien und ihre Geschichte, und auch Künstlerinnen und Künstler selbst kommen zu Wort und stellen ihr Lieblingsmaterial vor.#
Bestellungen
boesner GmbH holding + innovations „Kunst+Material“ – Abonnement
Gewerkenstraße 2, D-58456 Witten oder abo@kunst-und-material.de Fax +49-(0)2302-97311-33
Bestellungen aus der Schweiz
boesner GmbH
Surenmattstrasse 31, CH-5035 Unterentfelden oder marketing@boesner.ch

[ ] Ja, ich bestelle das Kunst+Material-Abonnement mit jährlich sechs Ausgaben zum Abo-Preis inkl. Versand von 49,50 EUR bzw. 49,50 CHF (Schweiz). Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn es nicht mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Bezugsjahres gekündigt wird.
[ ] Ja, ich bestelle das Probe-Abonnement und beziehe die nächsten drei Ausgaben von Kunst+Material zum einmaligen Kennenlern-Preis von 14,50 EUR bzw. 14,50 CHF (Schweiz). Danach bekomme ich Kunst+Material bequem nach Hause – zum Jahresbezugspreis von 49,50 EUR/CHF für sechs Ausgaben. Dazu brauche ich nichts weiter zu veranlassen. Wenn ich Kunst+Material nicht weiterlesen möchte, kündige ich das Probe-Abo schriftlich bis spätestens eine Woche nach Erhalt des 2. Heftes. Dieses Angebot gilt in Deutschland und der Schweiz.
Rechnungsadresse
Vorname
Nachname
Straße
PLZ, Ort
Land
Telefon
Lieferadresse (falls abweichend)
Vorname
Nachname
Straße
PLZ, Ort
Land
Telefon
Widerrufsrecht: Diese Vertragserklärung kann innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) schriftlich gekündigt werden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist an die jeweilige Bestelladresse zu richten.
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift
Präzision beginnt dort, wo das Auge fürs Detail geschärft ist –und das Radiermesser von Fa ber-Castell setzt genau hier an. Mit seiner feinen Klinge erlaubt es kontrolliertes Entfernen von Grafit, Tusche oder Farbe, dient zum Spitzen oder für diffizile Schneidearbeiten. In der Hand Kunstschaffender wird es zum Werkzeug der Verfeinerung, zur Brücke zwischen Idee und Perfektion. Robust, ergonomisch und kompromisslos präzise..#

Preußen, 1704. Königin Charlotte vermisst ihren einstigen Lehrer Gottfried Wilhelm Leibniz. Weil er ihr im Schloss Lietzenburg nicht mehr persönlich mit seinen weisen Antworten auf die großen Fragen des Lebens zur Verfügung stehen kann, lässt sie ein Gemälde von ihm in Auftrag geben. Leibniz will ihr gern den Wunsch erfüllen, doch die Porträtsitzungen mit dem großen Denker werden zur Herausforderung. Einzig die junge Malerin Aaltje van de Meer vermag es, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Bald entspinnt sich zwischen ihr und dem Philosophen ein leidenschaftlicher Austausch über das Verhältnis von Kunst und Realität.
Mit „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ kehrt Meisterregisseur Edgar Reitz (* 1932) auf die große Kinobühne zurück und widmet sich einem der einflussreichsten Universalgelehrten der Neuzeit. „Wenn man einmal begonnen hat, sich mit Leibniz zu beschäftigen, begegnet er einem überall“, so Edgar Reitz. „Das Geheimnis seiner Universalität ist, dass er sich mit den fließenden Übergängen von allem zu allem befasst. Die Faszination der Übergänge zu entdecken ist der entscheidende Auftrag der Philosophie von Leibniz, zum Beispiel der Übergang vom Krieg zum Frieden, vom Denken zum Machen, vom Traum zum Wachsein, vom Lauten ins Stille, vom Schmerz zum Gluck. Meine jahrelange Beschäftigung mit Leibniz hat auch mein ästhetisches Verständnis fur den Film geprägt und meinen Blick auf die Übergänge gelenkt. Denn das ist genau das, was uns in der heutigen Weltsicht fehlt. (…) Auch das Kino kann eine Zone der Übergänge sein, ein Ort, an dem wir träumend das Denken neu entdecken und verstehen, dass nichts so ist, wie es scheint und dennoch existiert.“
Die hochkarätige Besetzung um Edgar Selge, Aenne Schwarz, Lars Eidinger und Barbara Sukowa sowie Reitz‘ unnachahmliche Erzählweise machen das Historiendrama, das seine Weltpremiere auf der 75. Berlinale feierte, zu einem ebenso geistreichen wie unterhaltsamen Filmvergnügen.
Zu sehen im Kino und ab Februar 2026 auch auf DVD, Blu-ray und VoD.



Der kurze Weg zur Kunst


www.instagram.com/ boesner_deutschland/ www.facebook.com/ boesner/
www.boesner.com/ kunstportal
Leibniz (Edgar Selge) und Liebfried Cantor (Michael Kranz) im Hintergrund © if... Productions, ERF Filmproduktion
In einer Welt, die sich oft der Geschwindigkeit verschreibt, laden diese gummierten, achteckigen Etiketten aus dem boesner-Sortiment zum Innehalten ein. Ihr Retro-Look erinnert an die stille Eleganz alter französischer Apothekergläser – ein Hauch von Geschichte, eingefangen auf elfenbeinfarbenem Papier. Der doppelte schwarze Schmuckrand rahmt nicht nur Worte, sondern auch Erinnerungen, Ideen, Sammlungen. Ob auf Zeichenbüchern, Vorratsdosen oder Black Boxes: Die ars nova Etiketten von boesner sind mehr als bloße Beschriftung – sie sind ein Statement für Stil, Ordnung und die Kunst des Details. Ein Tropfen Wasser genügt, und sie verbinden sich mit dem Objekt – dauerhaft, diskret, schön.#
33 x in Deutschland und 1 x Versandservice
3 x in Österreich
4 x in der Schweiz
5 x in Frankreich

34 ausgewogene Farbtöne, hochpigmentiert und untereinander mischbar: Die bewährte Las caux Gouache überzeugt durch Reinheit, Leuchtkraft, Farbtiefe und Lichtechtheit. „Durch die hohe Konzentration der Pigmente bewahrt sie ihre Farbintensität auch bei einer Verdünnung von 1:1 oder mehr“, so Barbara Diethelm, Leiterin des Unternehmens Lascaux Colours & Restauro. Als ausgebildete Künstlerin liegen ihr die handwerklichen Traditionen und die hohe Qualität ihrer Produkte sowie der verwendeten Rohstoffe besonders am Herzen. „Wir verarbeiten nur die besten Rohstoffe – Pigmente, Bindemittel und die vielen weiteren Ingredienzen –in den individuellen und komplexen Rezepturen jedes einzelnen Farbtons.“
Die dickflüssige Gouache besteht aus reinen, lichtechten Pigmenten und einem acrylmodifizierten Bindemittelsystem auf natürlicher Basis. Sie haftet auf den unterschiedlichsten Malgründen: Die Gouache kann auf allen saugenden Materialien wie Papier, Karton oder Leinwand aufgetragen werden; als Untergrund empfiehlt sich eine Gesso-Grundierung. Sie kann ebenso pur und kompakt deckend als auch beliebig mit Wasser verdünnt in allen Abstufungen lasierend verarbeitet werden, wobei die Farbtöne intensiv bleiben. Dank ihres speziellen Bindemittels lässt sie sich leicht und geschmeidig auftragen und trocknet elastisch, samtmatt und wasserlöslich auf. Die Farben sind verzögert wieder anlösbar: Ein bestehender Farbauftrag

kann erneut übermalt werden, ohne sich unmittelbar in der neuen Farbschicht aufzulösen.
Durch ihre hohe Konzentration an Pigmenten ist Lascaux Gouache sehr ergiebig. Dieser Aspekt der Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Unternehmenschefin Barbara Diethelm: „Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, Produkte hoher Qualität mit einer langen Lebensdauer und hoher Ergiebigkeit herzustellen.“ In diesem Sinne bleiben auch die Farbsortimente über Jahre beständig, damit Künstlerinnen und Künstler sich auf ein gleichbleibendes Sortiment stützen können. „Zudem erfolgt die Herstellung der Produkte achtsam und mit handwerklicher Sorgfalt“, so Barbara Diethelm, „wir
setzen auf ein beständiges und zeitloses Sortiment von höchster Qualität und verzichten auf kurzlebige Trendpodukte, die unnötig Ressourcen verbrauchen.“ Die acrylmodifizierte Temperafarbe ist alterungsbeständig und vergilbungsfrei.
Lascaux Gouache ist gewissermaßen ein Klassiker des Sortiments von Lascaux Colours & Restauro, anwendbar natürlich im Kunst- und Designbereich, in der Kunstpädagogik und Maltherapie und im kreativen Malunterricht. Erhältlich in Flaschen zu 85 ml, 250 ml und 500 ml.#
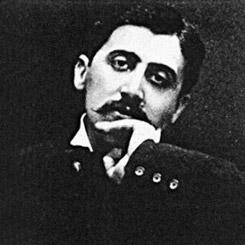

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, (1871–1922), französischer Schriftsteller, Kritiker und Intellektueller
Ute Fründt (*1965), Künstlerin aus Berlin
Streng genommen fragt hier gar nicht Marcel Proust selbst – vielmehr hat der berühmte Schriftsteller, dessen Werk „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ als einer der größten Romane der Weltliteratur gilt, dem berühmt gewordenen Fragebogen seinen Namen gegeben. Proust hat einen solchen Fragebogen wohl mindestens zweimal selbst beantwortet – um die Wende zum 20. Jahrhundert galt das Ausfüllen als beliebtes Gesellschaftsspiel in gehobenen Kreisen. Der erste Bogen, ausgefüllt vom heranwachsenden Proust während eines Festes, wurde posthum 1924 veröffentlicht. Den zweiten Fragebogen betitelte Proust mit „Marcel Proust par lui-même“ („Marcel Proust über sich selbst“). Die ursprünglich 33 Fragen wurden für Kunst+Material auf 29 reduziert – und bieten spannende und nachdenkliche Einblicke in die Gedankenund Gefühlswelt unserer Befragten.
Wo möchten Sie leben? Berlin-Kreuzberg. Was ist für sie das vollkommene irdische Glück? Ein Tag im Atelier. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Unpünklichkeit. Was ist für Sie das größte Unglück? Verlust von Freunden. Ihre liebsten Romanhelden? Oblomow. Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Nelson Mandela, Ghandi. Ihr Lieblingsmaler? Philip Guston. Ihr Lieblingsautor? T.C. Boyle, John Irving. Ihr Lieblingskomponist? John Cage, Kraftwerk. Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Men schen am meisten? Zuverlässigkeit. Ihre Lieblingstugend? Demut. Ihre Lieblingsbeschäftigung? Lesen. Wer oder was hätten Sie gern sein mögen? William Shakespeare. Ihr Hauptcharakterzug? Ge duld. Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am
meisten? Empathie. Ihr größter Fehler? Zu spät ins Bett gehen. Ihr Traum vom Glück? Endlos viel Zeit im Atelier zu verbringen. Ihre Lieblingsfarbe? Weiß. Ihre Lieblingsblume? Lilie. Ihr Lieblingsvogel? Eule. Ihre Helden der Wirklichkeit? Ehrenamtliche Helfer. Ihr Lieblingsname? Ella, Anna. Was verabscheuen Sie am meisten? Lügen. Welche geschichtlichen Gestalten verabscheuen Sie am meisten? Diktatoren, Psychopathen. Welche Reform bewundern Sie am meisten? Die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau. Welche natürliche Gabe möchten Sie be sitzen? Weisheit. Wie möchten Sie gern sterben? Schnell. Ihre gegenwärtige Geistesverfassung? Auf merksame Gelassenheit. Ihr Motto? Verlasse Dich auf Deinen Instinkt.
„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.“
Demokrit (ca. 460–370 v. Chr.)
Wer’s weiß, gewinnt!
Gestaltung plastischer Werke
zweijährliche Veranstaltung
poln. Maler und Graveur (Jankel)
Gemälde van Goghs: „Die Ebene von …“
französischer Maler (Edgar)
dt. Schriftkünstler (Rudolf)
Fotoselbstportrait
Bild von Hieronymus Bosch: „Das ...“ neodadaistische Kunstrichtung
französischer Maler (Antoine) Leitbild, Musterbild
einfarbig (französisch)
dt. Comiczeichner (Künstlername)
Zeichenmaterial

ungar.amerik. Malerin: Alice … Cahana
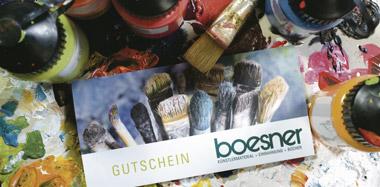
1. Preis boesner-Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro
2. Preis boesner-Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro
3. Preis
Ein Spiel „Finde das Meisterwerk. Ein Kunst-Memo“, siehe S. 60.


So nehmen Sie teil: Bitte senden Sie das Lösungswort per E-Mail an: raetsel.zeitung@boesner.com oder per Postkarte an: boesner holding GmbH holding + innovations, Gewerkenstr. 2, 58456 Witten. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2025.
5 6 7 8 9 3 2 4
Mitarbeiter von boesner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.
Das Lösungswort des Preisrätsels aus Kunst+Material September/Oktober 2025 ist: VOLLENDET
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Herausgeber
boesner GmbH holding + innovations Gewerkenstr. 2, 58456 Witten
Tel. +49-(0)2302-97311-10
Fax +49-(0)2302-97311-48 info@boesner.com
V.i.S.d.P.: Jörg Vester
Redaktion
Dr. Sabine Burbaum-Machert redaktion@kunst-und-material.de
Satz und Grafische Gestaltung
Birgit Boesner, Hattingen mail@bboes.de
Anzeigen
Dr. Sabine Burbaum-Machert anzeigen@kunst-und-material.de Anzeigenpreisliste Nr. 19 vom 01.01.2026
Herstellung
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Höchberg
Erscheinungsweise
zweimonatlich
© 2025 bei der boesner GmbH holding + innovations. Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeglicher Art, Aufnahmen in OnlineDienste und die Vervielfältigung auf Datenträgern wie CD-Rom, DVD-Rom etc. bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Unverlangte Manuskripte, Fotos und Dateien usw. sind nicht honorarfähig. Sie werden nicht zurückgesandt und für sie wird keine Haftung übernommen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Eine Veröffentlichung von Daten, insbesondere Terminen, erfolgt trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Redaktionsund Anzeigenschluss ist immer der 15. des jeweiligen Vormonats. Seiten 3, 49, 68–69, 90, 91 oben, U4: Ina Riepe. Seite 4: (6) Foto: Archiv Ute Fründt, Berlin; (20) Giovanni Battista Piranesi, Veduta della Basilica di S. Paolo fuor delle mura, 1748, New Haven, Connecticut, Yale University Art Gallery, The Arthur Ross Collection, Inv. 2012.159.11.46; (36), (50) Malerei und Fotografie: Ina Riepe; (70) Ausstellungsansicht „Tobias Pils. Shh“, 27. September 2025 bis 12. April 2026, Foto: Georg Petermichl/mumok; (76) Installationsansicht „Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infinity“, Sprengel Museum Hannover, 2025, Foto: Herling/Herling/Werner, Sprengel Museum Hannover. Seiten 7–10, 12–18: Fotos: Archiv Ute Fründt, Berlin. Seite 94 unten: Foto: Archiv Ute Fründt, Berlin.
Verlag und Redaktion danken den Rechteinhabern für die Reproduktionsgenehmigungen. Nicht nachgewiesene Abbildungen entstammen dem Archiv des Verlags. Konnten trotz sorgfältigster Recherche Inhaber von Rechten nicht ermittelt werden, wird freundlich um Meldung gebeten.
ISSN 1868-7946

Bettina Bülow-Böll im Atelier, Foto: Lukas Böll.
Porträt
Bettina Bülow-Böll
Die 1962 in Gelsenkirchen geborene Künstlerin Bettina Bülow-Böll ist seit Jahren für ihre farbstarke figurative Malerei bekannt. Ausgehend von Fotografien, bringt sie alltägliche Szenen auf die Leinwand, die sich durch ungewöhnliche Perspektiven, Ausschnitthaftigkeit und Flüchtigkeit auszeichnen. Durch ihre reflektierte Kom position und Malweise, die Gestik und abstrahierende Behandlung der Bildfläche vereinen, hinterfragt die Malerin das vermeintlich vertraute Sujet. Der Betrachtende ist gefordert, genau hinzusehen, um ihre ebenso kraftvollen wie subtilen Bilder zu erfassen.
Arbeit und Kunst
In dem Moment, wo Künstliche Intelligenz und Robotik verheißungsvoll und bedrohlich zugleich an die Tür der Erwerbswelt pochen (oder sich schon Einlass verschafft haben), scheint das Thema „Arbeit und Kunst“ brisanter denn je. So kommt eine Ausstellung im LVR-Landesmuseum in Bonn zum rechten Zeitpunkt. „Schöne neue Arbeitswelt. Traum und Trauma der Moderne“ lautet der Titel der Schau, die bis Mitte April 2026 zu sehen ist. In sechs Kapiteln und mit rund 300 Exponaten, entstanden zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Vorabend des Zweiten Weltkriegs, wird ein Panorama am Puls der Industriegesellschaft entworfen. Unser Autor Jörg Restorff nimmt die Bonner Schau zum Anlass für eine Bestandsaufnahme: Anhand ausgewählter Beispiele schildert er, wie Künstlerinnen und Künstler auf die Umwälzungen in der Arbeitswelt reagieren – von Adolph Menzels „Eisenwalzwerk“ (1872–75) bis zur KI-gestützten Bildgenerierung.
Weitere Themen: Inspiration | Persönlich | Bücher | Ausstellungen | Im Gespräch