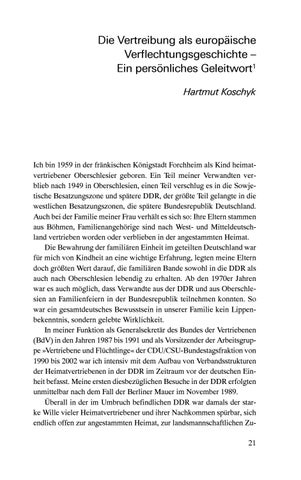Die Vertreibung als europäische Verflechtungsgeschichte – Ein persönliches Geleitwort1 Hartmut Koschyk
Ich bin 1959 in der fränkischen Königstadt Forchheim als Kind heimatvertriebener Oberschlesier geboren. Ein Teil meiner Verwandten verblieb nach 1949 in Oberschlesien, einen Teil verschlug es in die Sowjetische Besatzungszone und spätere DDR, der größte Teil gelangte in die westlichen Besatzungszonen, die spätere Bundesrepublik Deutschland. Auch bei der Familie meiner Frau verhält es sich so: Ihre Eltern stammen aus Böhmen, Familienangehörige sind nach West- und Mitteldeutschland vertrieben worden oder verblieben in der angestammten Heimat. Die Bewahrung der familiären Einheit im geteilten Deutschland war für mich von Kindheit an eine wichtige Erfahrung, legten meine Eltern doch größten Wert darauf, die familiären Bande sowohl in die DDR als auch nach Oberschlesien lebendig zu erhalten. Ab den 1970er Jahren war es auch möglich, dass Verwandte aus der DDR und aus Oberschlesien an Familienfeiern in der Bundesrepublik teilnehmen konnten. So war ein gesamtdeutsches Bewusstsein in unserer Familie kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Wirklichkeit. In meiner Funktion als Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen (BdV) in den Jahren 1987 bis 1991 und als Vorsitzender der Arbeitsgruppe »Vertriebene und Flüchtlinge« der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von 1990 bis 2002 war ich intensiv mit dem Aufbau von Verbandsstrukturen der Heimatvertriebenen in der DDR im Zeitraum vor der deutschen Einheit befasst. Meine ersten diesbezüglichen Besuche in der DDR erfolgten unmittelbar nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989. Überall in der im Umbruch befindlichen DDR war damals der starke Wille vieler Heimatvertriebener und ihrer Nachkommen spürbar, sich endlich offen zur angestammten Heimat, zur landsmannschaftlichen Zu21
Vertriebene_in_der_DDR.indd 21
5/6/2021 5:45:51 PM