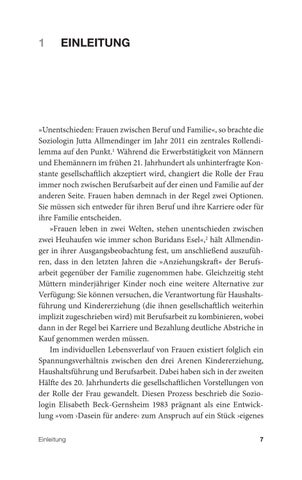1
EINLEITUNG
»Unentschieden: Frauen zwischen Beruf und Familie«, so brachte die Soziologin Jutta Allmendinger im Jahr 2011 ein zentrales Rollendilemma auf den Punkt.1 Während die Erwerbstätigkeit von Männern und Ehemännern im frühen 21. Jahrhundert als unhinterfragte Konstante gesellschaftlich akzeptiert wird, changiert die Rolle der Frau immer noch zwischen Berufsarbeit auf der einen und Familie auf der anderen Seite. Frauen haben demnach in der Regel zwei Optionen. Sie müssen sich entweder für ihren Beruf und ihre Karriere oder für ihre Familie entscheiden. »Frauen leben in zwei Welten, stehen unentschieden zwischen zwei Heuhaufen wie immer schon Buridans Esel«,2 hält Allmendinger in ihrer Ausgangsbeobachtung fest, um anschließend auszuführen, dass in den letzten Jahren die »Anziehungskraft« der Berufsarbeit gegenüber der Familie zugenommen habe. Gleichzeitig steht Müttern minderjähriger Kinder noch eine weitere Alternative zur Verfügung: Sie können versuchen, die Verantwortung für Haushaltsführung und Kindererziehung (die ihnen gesellschaftlich weiterhin implizit zugeschrieben wird) mit Berufsarbeit zu kombinieren, wobei dann in der Regel bei Karriere und Bezahlung deutliche Abstriche in Kauf genommen werden müssen. Im individuellen Lebensverlauf von Frauen existiert folglich ein Spannungsverhältnis zwischen den drei Arenen Kindererziehung, Haushaltsführung und Berufsarbeit. Dabei haben sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die gesellschaftlichen Vorstellungen von der Rolle der Frau gewandelt. Diesen Prozess beschrieb die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim 1983 prägnant als eine Entwicklung »vom ›Dasein für andere‹ zum Anspruch auf ein Stück ›eigenes Einleitung
GN04_Hausfrau.indd 7
7
15.03.22 17:24