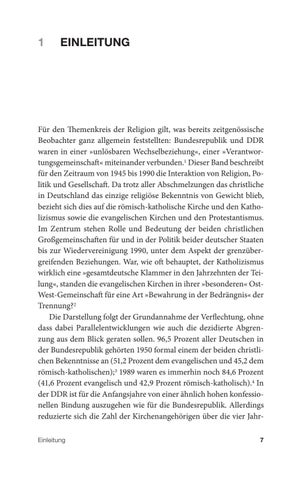1
EINLEITUNG
Für den Themenkreis der Religion gilt, was bereits zeitgenössische Beobachter ganz allgemein feststellten: Bundesrepublik und DDR waren in einer »unlösbaren Wechselbeziehung«, einer »Verantwortungsgemeinschaft« miteinander verbunden.1 Dieser Band beschreibt für den Zeitraum von 1945 bis 1990 die Interaktion von Religion, Politik und Gesellschaft. Da trotz aller Abschmelzungen das christliche in Deutschland das einzige religiöse Bekenntnis von Gewicht blieb, bezieht sich dies auf die römisch-katholische Kirche und den Katholizismus sowie die evangelischen Kirchen und den Protestantismus. Im Zentrum stehen Rolle und Bedeutung der beiden christlichen Großgemeinschaften für und in der Politik beider deutscher Staaten bis zur Wiedervereinigung 1990, unter dem Aspekt der grenzübergreifenden Beziehungen. War, wie oft behauptet, der Katholizismus wirklich eine »gesamtdeutsche Klammer in den Jahrzehnten der Teilung«, standen die evangelischen Kirchen in ihrer »besonderen« OstWest-Gemeinschaft für eine Art »Bewahrung in der Bedrängnis« der Trennung?2 Die Darstellung folgt der Grundannahme der Verflechtung, ohne dass dabei Parallelentwicklungen wie auch die dezidierte Abgrenzung aus dem Blick geraten sollen. 96,5 Prozent aller Deutschen in der Bundesrepublik gehörten 1950 formal einem der beiden christlichen Bekenntnisse an (51,2 Prozent dem evangelischen und 45,2 dem römisch-katholischen);3 1989 waren es immerhin noch 84,6 Prozent (41,6 Prozent evangelisch und 42,9 Prozent römisch-katholisch).4 In der DDR ist für die Anfangsjahre von einer ähnlich hohen konfessionellen Bindung auszugehen wie für die Bundesrepublik. Allerdings reduzierte sich die Zahl der Kirchenangehörigen über die vier JahrEinleitung
GN02_Säkularisation.indd 7
7
21.09.21 09:17