
Kaum Lehren aus der Multikrise:
Lieferketten nach wie vor verwundbar
Supply Chain Pulse Check



Kaum Lehren aus der Multikrise:
Lieferketten nach wie vor verwundbar
Supply Chain Pulse Check

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, der verschärfte Protektionismus und neue Zölle entfalten ihre Wirkung. Der Druck auf die Lieferketten hat sich erhöht und die Kosten für Resilienz steigen kontinuierlich. Viele Unternehmen haben auf die neuen Belastungen zunächst mit Kostenoptimierungen reagiert, Teile ihrer Lieferkette in günstigere Einkaufsländer verschoben und nur zum Teil in Technologien zur Steigerung ihrer Resilienz und Effizienz investiert.
Die aktuellen globalen Umwälzungen verdeutlichen aber: Die Lieferketten und die Produktion der meisten Unternehmen sind immer noch ungenügend transformiert. Aus den Erfahrungen der Covid-19-Pandemie wurden nicht ausreichend Konsequenzen gezogen und eine angemessene Vorbereitung auf zukünftige Krisen blieb großenteils aus. Der Aufbau langfristiger Resilienz in den Lieferketten und in der Produktion ist aber unabdingbar, um in einer von geopolitischen Unsicherheiten und sich überlagernden Krisen geprägten Welt künftig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Mit diesem Supply Chain Pulse Check von Deloitte, dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) und der International Service Logistics Association (ISLA) analysieren wir, wie Unternehmen des produzierenden Gewerbes derzeit mit geopolitischer Unsicherheit und steigendem Druck in den Lieferketten umgehen. Zudem betrachten wir, welche Strategien sie entwickeln, um ihre operative Tätigkeit künftig unabhängiger und resilienter auszurichten.
Die Ergebnisse zeigen großen Handlungsbedarf. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, durch einen geeigneten Maßnahmenmix eine ausgewogene Risikoverteilung in ihren Lieferketten sicherzustellen. In der Produktion geht die Auslandsverlagerung aufgrund des verschärften Protektionismus und neuer Zölle von wichtigen Handelspartnern
weiter, wobei Entscheidungen nicht einfacher werden angesichts einer Reduktion sicherer Standorte mit überschaubaren Risiken. Beim Thema Resilienz durch Technologie gibt es viel Verbesserungspotenzial in der Anwendung durch die Unternehmen und in deren Nutzung als Entscheidungshilfe. KI hat hier großes Potenzial vor allem für bessere Transparenz und Planungssicherheit in den Lieferketten. Für die Reaktionsfähigkeit bei Störfällen wird KI aber noch wenig angewendet. Viele dieser Implementierungen, die jetzt unter starkem Druck erfolgen müssen, werden schon seit Längerem diskutiert, sind aber bislang nur wenig umgesetzt. Unternehmen sollten jetzt entschlossen handeln und gezielt in Resilienz sowie eine nachhaltige Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit investieren.



Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe bereits die vierte Auflage des Deloitte Supply Chain Pulse Check zu präsentieren – diesmal mit Fokus auf die Resilienz der Lieferkette. Wir möchten uns bei allen LieferkettenVerantwortlichen bedanken, die an der Umfrage teilgenommen und ihre Einschätzungen zu diesen wichtigen Fragen abgegeben haben.
Der Deloitte Supply Chain Pulse Check soll einen fundierten Beitrag zur aktuellen Diskussion leisten und Unternehmen dabei unterstützen, bestehende sowie zukünftige Unsicherheiten und Komplexitäten in ihren Lieferketten besser zu bewältigen. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns über direktes Feedback und Anregungen.
Oliver Bendig
Partner
Lead Industrial Products & Construction
Deloitte
Dr. Jürgen Sandau
Partner
Lead Supply Chain & Network Operations
Deloitte
Matthias Krämer
Leiter der Abteilung Außenwirtschaftspolitik Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
92%
90% der Unternehmen haben dieses Jahr höhere Ausgaben für die Resilienz der Lieferkette.
wollen ihre operative Tätigkeit künftig neu aufstellen, um ihre Unabhängigkeit und Resilienz zu stärken.
Geopolitische Unsicherheit wirkt sich spürbar aus Der verschärfte Protektionismus und neue Zölle belasten die Unternehmen deutlich. Die Beschaffungskosten und Verwaltungsaufwände sind dieses Jahr gestiegen, die Margen wurden beeinträchtigt und Umsätze sind zurückgegangen. Unternehmen haben zwar ihr Sourcing aus Kostengründen teilweise angepasst und in neue Technologien für mehr Transparenz und Resilienz investiert. Viele Lieferketten sind aber immer noch nicht ausreichend transformiert.
Unternehmen haben die Lehren aus der Covid-19-Pandemie nicht genügend operationalisiert und sich in den letzten Jahren nicht besser auf die nächste(n) Krise(n) vorbereitet. Um „vor die Welle“ zu gelangen, müssen sie viel schneller handeln, Veränderungen aktiv annehmen und zügig in die Umsetzung gehen, anstatt lange zu zögern. Nur so können sie geopolitische Unsicherheiten heute und morgen besser bewältigen.
Lieferkette – unzureichende Transformation, notwendige Diversifizierung
Die Hälfte der Unternehmen will künftig bei der Neuaufstellung ihrer operativen Tätigkeit die Beschaffung noch weiter diversifizieren (Multisourcing), um größere Unabhängigkeit und eine höhere Resilienz zu erzielen. Geografische Diversifizierungsstrategien der Lieferketten –unter anderem Beschaffung in Europa (Nearshoring), lokales und regionales Sourcing, Friendshoring und Reshoring zurück nach Europa – gewinnen ebenfalls an Bedeutung zur Bewältigung geopolitischer Unsicherheit.
Unternehmen müssen langfristig in multiplen Lieferketten denken und potenzielle Krisen immer im Hinterkopf behalten. Die Abhängigkeit von wenigen Zulieferern muss proaktiv adressiert, die Lieferantenbasis aktiv erweitert und die Lieferkettenbeziehungen dauerhaft im Blick gehalten werden. Dazu braucht es eine ausgewogene Risikoverteilung mit einem Mix an diversen Maßnahmen.
68% 47%
planen, ihre Produktion in den nächsten zwei bis drei Jahren aufgrund von Protektionismus und Zöllen zu verlagern.
Produktion – Verlagerungstrend beschleunigt sich weiter Aufgrund des verschärften Protektionismus und neuer Zölle planen die Unternehmen noch stärker als vor zwei Jahren, ihre Produktion zu verlagern. Wichtigste Zielregionen sind die USA, (Ost-)Europa und auch wieder Teile Asiens. Weit stärker als im Herbst 2023 werden bei dieser Neuausrichtung neben der Produktion im Allgemeinen insbesondere die Vormontage und Endmontage verlagert – aber auch zentrale Unternehmensfunktionen sowie Forschung und Entwicklung wandern stärker ab.
Die Diversifizierung der Produktion sollte strategisch und mit Fokus auf Flexibilität für geopolitische Veränderungen erfolgen. Die Anzahl „sicherer Häfen“ bzw. Standorte haben abgenommen und klare Kosten-NutzenAnalysen zur Risikoreduktion sind notwendig. Strategische Partnerschaften und Kooperationen sind ebenso wichtig zur Flexibilisierung der Produktionskapazitäten wie die weitere Digitalisierung und Automatisierung an kostenintensiven Standorten wie zum Beispiel Deutschland.
investieren in neue Technologien, um Transparenz und Resilienz in der Lieferkette zu schaffen.
Resilienztechnologien – Potenzial erkannt, aber noch wenig genutzt Ein gewisses Maß an Transparenz und Datenanalytik ist in vielen Lieferketten bereits etabliert, es fehlt aber an umfassender und gezielter Anwendung, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Nur eine Minderheit hat bereits Frühwarnsysteme in der Lieferkette integriert und Szenarien für bessere Reaktionsfähigkeit bei Störfällen entwickelt. Die KI-Nutzung für größere Lieferkettenresilienz bleibt begrenzt, das Potenzial von KI für höhere Planungssicherheit in der Lieferkette wird aber durchwegs erkannt. Eine umfassende Überwachung und Risikobewertung in der Lieferkette sind notwendig, um schneller auf die Auswirkungen neuer Zölle und anderer Störfälle reagieren zu können. Unternehmen sollten digitale Frühwarnsysteme und KI- gestützte Planung gezielt zur Resilienzsteigerung implementieren. Die IT-Infrastruktur und Datenqualität müssen als Basis für die KINutzung in der Lieferkette verbessert und Cybersicherheit als Teil der Lieferkettenstrategie ausgebaut werden.
Protektionismus und neue Zölle lassen Lieferkettenkosten steigen Trotz aktuell höherer Lieferkettenstabilität als in den vergangenen Jahren sind bei 92 Prozent der befragten Unternehmen dieses Jahr die Ausgaben für die Resilienz ihrer Lieferketten insgesamt gestiegen, bei 39 Prozent sogar stark bis sehr stark (s. Abb. 1).
Der verschärfte Protektionismus und neue Zölle wichtiger Handelspartner haben deutsche Unternehmen in den letzten zwölf Monaten erheblich unter Druck gesetzt. Die Beschaffungskosten haben bei zwei Dritteln (66%) und die Verwaltungsaufwände bei der Hälfte (52%) der Befragten zugenommen. Zudem wurden bei vielen Teilnehmenden die Margen beeinträchtigt und die Umsätze sind zurückgegangen (53 resp. 33% der Befragten). Auswirkungen gab es bis in den Aftersales-Bereich hinein. Jedes zweite Unternehmen war mit höheren Transportkosten und längeren Lieferzeiten von Ersatzteilen konfrontiert. Die Verfügbarkeit von Ersatz- und Bauteilen wurde zum Problem für jedes dritte Unternehmen.
Abb. 1 – Ausgaben für Lieferkettenresilienz Frage: Wie stark sind Ihre Ausgaben für die Resilienz der Lieferkette gestiegen?
35% Stark gestiegen Ausgaben für Lieferkettenresilienz
53% Etwas gestiegen 8% Gleich geblieben 4% Sehr stark gestiegen
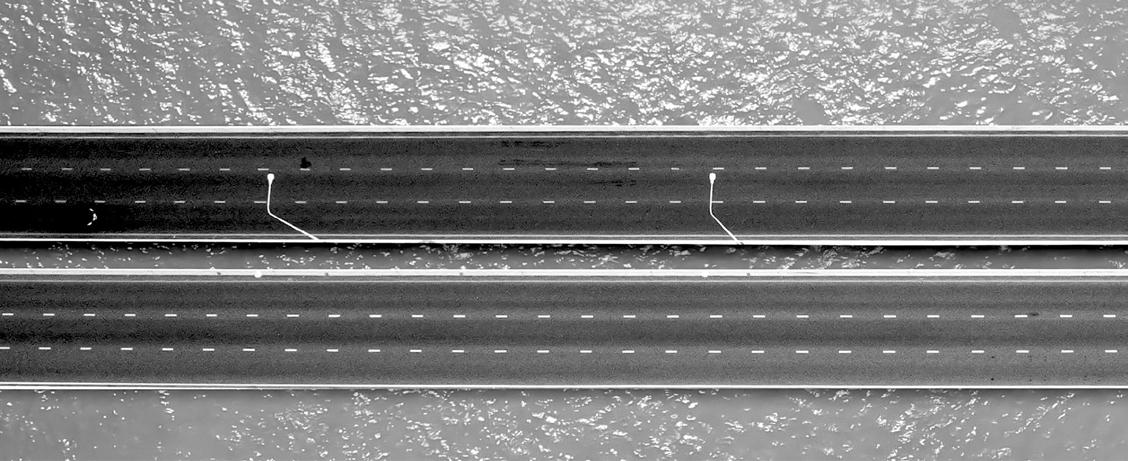
Vielfältige Belastungen in den Lieferketten
Die geopolitische Unsicherheit hat deutliche Spuren in den Lieferketten hinterlassen. Nur jedes zehnte Unternehmen blieb in den letzten zwölf Monaten verschont bzw. hat keine großen Veränderungen gespürt (s. Abb. 2). Die große Mehrheit der Teilnehmenden musste aber verstärkt Kosten optimieren, um zusätzliche Belastungen auszugleichen. 45 Prozent der Befragten haben ihre Lieferketten in günstigere Einkaufsländer verschoben, um Kosten zu sparen, und 41 Prozent haben ihr Sourcing aufgrund von Protektionismus und Zöllen angepasst. Höhere Kosten haben auch zu verstärktem Sourcing alternativer Rohstoffe geführt. Fast jedes zweite Unternehmen hat zudem in neue Technologien investiert, um mehr Transparenz und Resilienz in der Lieferkette zu schaffen. Wachsende Belastung in der Lieferkette gab es zudem durch den Wettbewerb um rüstungs- und infrastrukturrelevante Rohstoffe.
Abb. 2 – Veränderungen in Lieferketten Frage: Wie haben sich Ihre Lieferketten in den vergangenen zwölf Monaten verändert? (Mehrfachnennungen möglich)
Investitionen in neue Technologien, um Transparenz und Resilienz zu schaffen
Verschiebung in günstigere Einkaufsländer, um Kosten zu sparen
Verschiebung des Sourcing aufgrund von Protektionismus und Zöllen
Wachsende Belastung durch Wettbewerb um rüstungs- und infrastrukturrelevante Rohstoffe
alternativer Rohstoffe aus Kostengründen
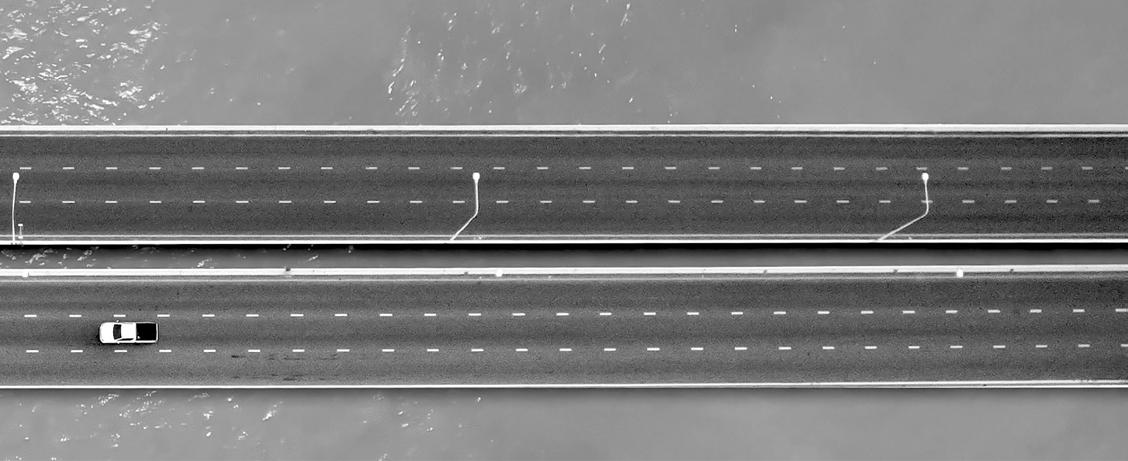
Zwei Lieferkettentrends zeichnen sich ab All diese Belastungen und Veränderungen unter dem Druck des verschärften Protektionismus und neuer Zölle verdeutlichen, dass die Lieferketten und auch die Produktion vieler Unternehmen noch viel zu wenig transformiert und auf Resilienz ausgerichtet sind. Viele Unternehmen haben zu wenige Schlüsse aus der Covid-19-Pandemie gezogen und sich in den letzten Jahren nicht ausreichend auf die nächste(n) Krise(n) vorbereitet. Die große Mehrheit (90% der Befragten) will aber ihre operative Tätigkeit künftig neu ausrichten, um höhere Unabhängigkeit und Resilienz zu erreichen (s. Abb. 3).
Am erfolgversprechendsten ist dies, wenn Unternehmen dabei entschlossen handeln, keine Scheu vor Veränderung zeigen und schneller in die Umsetzung gehen als bisher. Die unterschiedlichen Maßnahmen, mit denen sie ihre operative Tätigkeit künftig unabhängiger und resilienter ausrichten wollen, lassen sich in zwei Themenbereiche gruppieren:
1. Transformation der (physischen) Wertschöpfungskette
2. Resilienz durch Technologie
Kurzfristig (in den nächsten drei Monaten) erwartet zwar fast die Hälfte der Unternehmen (44%) keine Veränderung in der momentanen Stabilität ihrer Lieferketten und mittelfristig (12 Monate) befürchtet gar ein Viertel (25%) eine Verschlechterung. Langfristig (in zwei bis drei Jahren) erhofft sich aber doch die Mehrheit der Unternehmen (62%) dank gezielter Maßnahmen zur Transformation und Resilienz eine deutliche Verbesserung ihrer Lieferkettenstabilität.
Abb. 3 – Neuaufstellung der operativen Tätigkeit Frage: Haben Sie Maßnahmen geplant, um Ihre operative Tätigkeit zukünftig neu aufzustellen und damit Ihre Unabhängigkeit und Resilienz zu stärken?
10%
Keine Maßnahmen geplant/ keine Notwendigkeit
Neuaufstellung der operativen Tätigkeit
90% Maßnahmen geplant
„Was wir gerade beobachten, ist ein bekannter verbreiteter Effekt: Sobald eine Krise vorüber ist und der Normalbetrieb wieder läuft, wird die geplante Transformation in eine resiliente Lieferkette erstmal geparkt. Derzeit haben sich viele Unternehmen mit den aktuellen Zöllen arrangiert, indem sie Kosten punktuell optimieren oder diese weiterreichen. Das reicht ggf. bis zum nächsten Schock-Event. Notwendig wäre aber mehr Weitblick und Mut für größere Veränderung und Investitionen in ein funktionierendes Frühwarnsystem und eine darauf abgestimmte physisch resiliente Lieferkette, die man nach Bedarf skalieren kann.“

Starke Diversifizierung der Lieferketten geplant
In den vergangenen zwölf Monaten haben bereits 41 Prozent der Befragten eine Verschiebung des Sourcing aufgrund des verschärften Protektionismus und der neuen Zölle unternommen (s. Abb. 2). Zukünftig wollen aber bei der Neuaufstellung ihrer Lieferkette 49 Prozent die Beschaffung noch weiter diversifizieren (Multisourcing), um größere Unabhängigkeit und Resilienz zu erzielen (s. Abb. 4). Der Aufbau alternativer Lieferanten an mindestens einem zweiten Standort hilft, geopolitische Risiken für anspruchsvolle Fertigung wie auch reine Massenproduktion zu minimieren.
Die Risikoverteilung wird immer wichtiger; bei der Minimierung der Risiken in der Lieferkette helfen geografische Diversifizierungsstrategien. Jeweils mehr als ein Drittel der Befragten plant die verstärkte Beschaffung in Europa (Nearshoring), mehr Regionalfor-Regional- und Local-for-Local-Sourcing sowie Friendshoring und Reshoring zurück nach Europa. Die Beschaffung dürfte künftig wieder näher bei der Produktion erfolgen oder in Ländern stattfinden, die geopolitische Verbündete sind und/oder verlässliche Partnerschaften aufweisen. Auch Zirkularität wird als Resilienz-Chance wahrgenommen. 47 Prozent der Unternehmen wollen künftig verstärkt in Wiederverwertung, Aufarbeitung und Recycling von Ressourcen investieren, um ihre Lieferketten zu entlasten.
Verlagerungstrend bei der Produktion beschleunigt sich weiter Bei der Produktion verschärft sich der Verlagerungstrend der letzten Jahre weiter. Zwar wollen 54 Prozent der befragten Unternehmen die Digitalisierung und Automatisierung auf die gesamte Wertschöpfungskette ausdehnen, um weiterhin auch an kostenintensiven Standorten wie Deutschland produzieren zu können –jeweils ein Drittel will aber im Rahmen der künftigen Neuaufstellung ihrer Produktion die geografische Diversifizierung, die Lokalisierung der Produktion oder die Rückverlagerung von Teilen der Wertschöpfungskette nach Europa (Reshoring) vorantreiben (s. Abb. 4).
Abb. 4 – Maßnahmen zur Neuaufstellung der Lieferkette und der Produktion Frage: Mit welchen Maßnahmen wollen Sie Ihre Lieferkette oder Produktion zukünftig neu aufstellen, um Ihre Unabhängigkeit und Resilienz zu stärken? (Mehrfachnennungen möglich)
Diversifizierung der Beschaffung (Multisourcing)
Beschaffung in Europa (Nearshoring)
Wiederverwendung, Aufarbeitung und Recycling von Ressourcen (Kreislaufwirtschaft)
Heimische Beschaffung bzw. Local-for-Local-Sourcing
Beschaffung aus Ländern, die geopolitische Verbündete sind (Friendshoring)
Sourcing von alternativen Rohstoffen Lieferkette und Produktion
Ausweitung der Digitalisierung/ Automatisierung auf die gesamte Wertschöpfungskette
Outsourcing von nicht-essenziellen Funktionen und Fokussierung auf Kernkompetenzen
Rückführung zuvor ausgelagerter Teile der Wertschöpfung ins Unternehmen (Insourcing)
Rückverlagerung von Teilen der Wertschöpfungskette nach Europa (Reshoring)
Anpassung/Ergänzung von Produkten an neue Wachstumsindustrien (u.a. Rüstung, Infrastruktur)
Geografische Diversifizierung der Produktion
Lokalisierung der Produktion
Nutzung von Auftragsfertigung für flexible Produktion
Insgesamt planen aktuell 68 Prozent der Befragten, ihre Produktion oder Teile davon in den nächsten zwei bis drei Jahren aufgrund von Protektionismus und Zöllen zu verlagern – das sind 6 Prozent mehr als noch vor der Verschärfung des Zollkonflikts im Herbst 2023 (s. Abb. 5). Wichtigste Zielregionen sind Europa und verstärkt die USA. 30 Prozent der Befragten planen weiterhin, ihre Produktion aus Deutschland in andere europäische Länder zu verlegen (Herbst 2023: 32%). Als direkten Effekt auf den verschärften Protektionismus und neue Zölle wollen 26 Prozent künftig die Produktion aus Deutschland in die USA verlegen, mehr als noch vor zwei Jahren (23%). Eine lokale Produktion in den USA kann für viele Unternehmen längerfristig aus Kosten- wie auch Risikogründen sinnvoll sein. Verlagerungen aus Deutschland in das kostengünstigere Asien (insb. China und Indien) bleiben aber weiterhin geplant und sind in etwa auf vergleichbarem Niveau zu den letzten Jahren (Herbst 2023: 23% für Asien insgesamt). Auch wenn niedrigere Kosten oft Haupttreiber einer solchen Verlagerung nach Asien sind, dürfen potenziell höhere Risiken in diesen Ländern nicht unterschätzt werden. Jedes zehnte Unternehmen plant aktuell auch wieder Rückverlagerungen von Asien nach Europa.
Abb. 5 – Geplante Verlagerung
Frage: Planen Sie, Ihre Produktion in den nächsten zwei bis drei Jahren aufgrund von Protektionismus und Zöllen zu verlagern? (Mehrfachnennungen möglich)
Herbst 2023
„Die Lage ist dramatisch und die Situation könnte sich noch weiter verschärfen, wenn die europäische Wirtschaft nicht anspringt. Deutsche Industrieunternehmen müssen schleunigst handeln, neue Geschäftsmodelle als Wettbewerbsvorteile schaffen und jahrelangen perfektionistischen Entwicklungen Taten folgen lassen –z.B. den Ersatzteilbereich um digitale Services wie Remote Monitoring und Predictive Maintenance ergänzen oder neue Low-Spec-Produktlinien für die asiatischen, aber auch europäischen Märkte entwickeln. Nur so können sie sich gegen die chinesische Konkurrenz behaupten, die sich technologisch viel schneller entwickelt.“
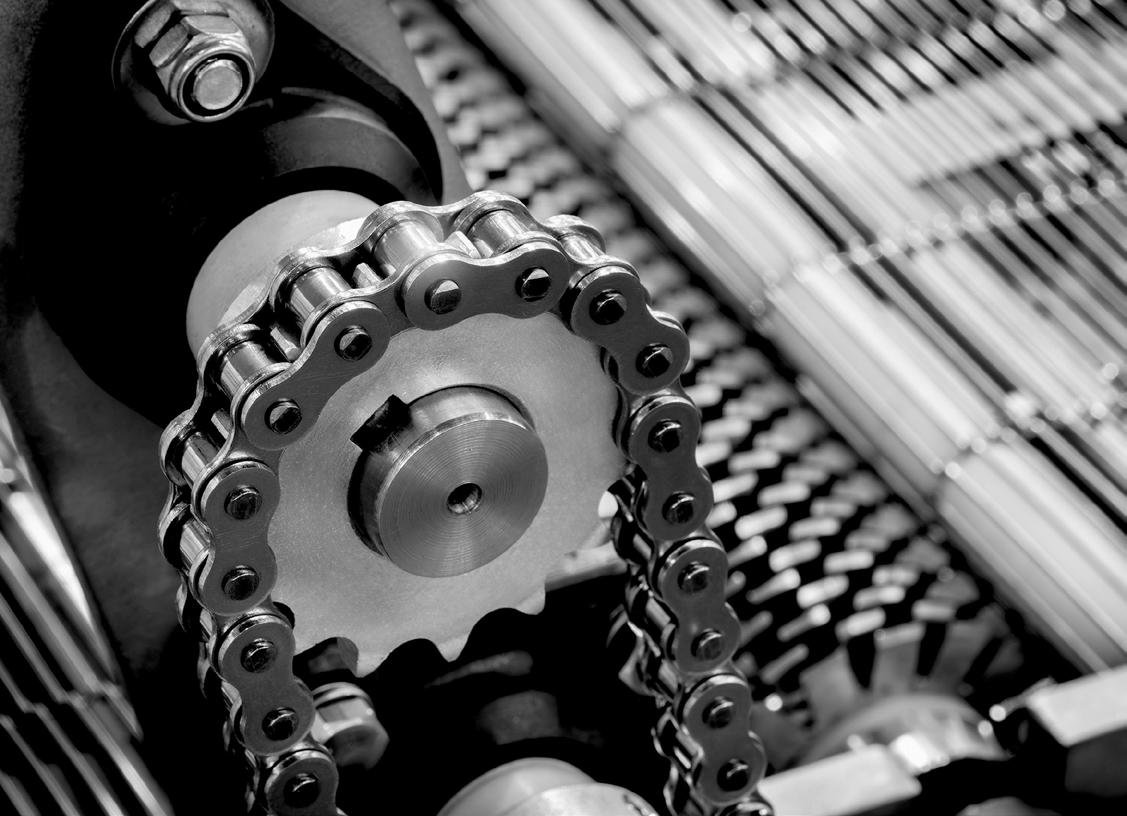
Abb. 6 – Geplante Verlagerung von Teilen der Wertschöpfungskette
Frage: Welche Teile der Wertschöpfungskette/Ihres Unternehmens haben Sie bereits verlagert oder planen Sie, in den nächsten zwei bis drei Jahren zumindest teilweise zu verlagern?
Die Tiefe des aktuellen Verlagerungstrends zeigt sich auch darin, dass aktuell deutlich mehr Unternehmen angeben, ihre Produktion oder Teile davon bereits verlagert zu haben, als noch im Herbst 2023 (19% vs. 11%; s. Abb. 6). Wie die Befragungsergebnisse zeigen, dürften zukünftig neben der Produktion im Allgemeinen (43%) insbesondere die Vormontage (47%) und die Endmontage (41%) noch stärker verlagert werden, anders als in der Vergangenheit, wo vor allem die Bauteilfertigung im Vordergrund stand. Diese wird jedoch auch
in gleichem Maße weiter verlagert. Ein wiederholtes geografisches Verschieben einzelner Teile der Produktion aus Kostengründen kann aber wiederum noch größere Lieferkettenrisiken erzeugen, weil Störfälle in einzelnen Produktionsschritten die Auslieferung der Endprodukte beeinträchtigen können. Weit größere Verlagerungspläne als in der Vergangenheit bestehen ebenfalls für zentrale Unternehmensfunktionen, Warehousing/Lagerhaltung sowie Forschung und Entwicklung.
Herbst 2023
Neuausrichtung auch entlang neuer Wachstumsfelder geplant
Die Nachfrage in Branchen wie Infrastruktur und Rüstung wächst. Auf der Suche nach neuem Wachstum wird von über 40 Prozent der Unternehmen auch schon eine Anpassung der Produktportfolios an solche Wachstumsindustrien angedacht (s. Abb. 4). Stark vertreten sind hier vor allem Unternehmen aus den Branchen Maschinenbau/Industriegüter, Technologie und Automobil. Die große Mehrheit will dabei die Erschließung dieser Wachstumsfelder entweder durch eine entsprechende Erweiterung der Produktion oder mittels Partnerschaften und Joint Ventures erreichen, um größtmögliche Synergieeffekte zu erzielen. Frühzeitige Kooperationen können den Zugang zu kritischen Rohstoffen und die gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen ermöglichen. Fabrikumstellungen auf Rüstungs- oder Infrastrukturprodukte erweisen sich aber oft als sehr aufwendig. Weitere Herausforderungen einer Umstellung sind der Umgang mit unterschiedlichen Expertisen bei Fachkräften, die notwendige Umschulung von Mitarbeitenden sowie längere Planungsprozesse und komplexe Bewilligungs- und Zertifizierungsverfahren.
Im Bereich der Kooperationen und Partnerschaften sind zudem das Outsourcing von nicht-essenziellen Funktionen und die Nutzung der Auftragsfertigung für die flexible Produktion bei gut einem Drittel der Befragten angedacht, um geopolitische Unsicherheiten besser zu bewältigen. Solche Auslagerungen gehen oft mit niedrigeren Kosten einher und stärken die Resilienz, da sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen und Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren können. Sie sind aber auch mit neuen Risiken behaftet, wenn es zu unkontrollierbaren Störfällen bei den externen Partnern kommt.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen
• Langfristig in multiplen Lieferketten denken und Krisen im Hinterkopf behalten: Die Zeiten, in denen SingleSourcing die vorherrschende Beschaffungsstrategie aufgrund niedriger Kosten war, sind endgültig vorbei. Allein der Verlust eines zentralen Lieferanten kann heute viel höhere Kosten verursachen als die dadurch möglichen Einsparungen. Um geopolitische Risiken heute und morgen zu minimieren, müssen Unternehmen ihre Abhängigkeiten von potenziell kritischen Kernlieferanten proaktiv reduzieren, ihre Lieferantenbasis selektiv erweitern und ihre Lieferkettenbeziehungen skalierungsfähig machen. Das Denken in Krisenszenarien ist nicht länger Ausnahme, sondern integraler Bestandteil der täglichen Entscheidungsfindung. Ein ausgewogener Mix aus Multisourcing-, Best-Cost- und Friendshoring-Strategien in politisch stabilen Ländern kann Unabhängigkeit von einzelnen Regionen schaffen und das Risiko von Lieferausfällen senken. Ergänzend sollten die Rückverlagerung besonders kritischer Vorproduktion, möglichst stark automatisiert, und die Nutzung alternativer Rohstoffe erwogen werden, um Engpässe bei kritischen Materialien zu vermeiden.
• Produktion strategisch und mit Fokus auf Flexibilität für geopolitische Veränderungen aufstellen: Die Verlagerung von Produktionskapazitäten ist eine zentrale Antwort auf verschärften Protektionismus und neue Zölle. Die Anzahl „sicherer Häfen“ hat aber in den letzten Jahren abgenommen, d.h., sichere Produktionsstandorte gibt es immer weniger. Eine schrittweise Umsetzung mit klaren Kosten-Nutzen-Analysen reduziert Risiken und ermöglicht Flexibilität bei geopolitischen Veränderungen. Unternehmen sollten prüfen, welche Teile der Wertschöpfungskette – wie Vor- und Endmontage – sich für Nearshoring oder Reshoring nach Europa eignen. Auch müssen die Lokalisierung und Regionalisierung der Produktion sowie die Entwicklung von regionalen Produktlinien für lokale Bedürfnisse geprüft werden, um Flexibilität und Sicherheit für wichtige Absatzmärkte zu gewährleisten. Spezifisch auf die Bedürfnisse in Asien zugeschnittene Produktlinien beispielsweise mit entsprechenden Spezifikationen auch gleich in Asien zu entwickeln, zu produzieren und zu verkaufen, hilft auch, globale Lieferketten zu entlasten.
• Digitalisierung und Automatisierung am kostenintensiven Standort Deutschland stärker nutzen: Bei der Digitalisierung und Automatisierung der Produktion gibt es weiterhin unausgeschöpftes Potenzial für Effizienzgewinne und Produktivitätssteigerungen. Durch KI ist dieses Potenzial zudem noch viel größer geworden. Effizienzen, die schon mit kleinen KI-Anwendungen erzielt werden können, sind enorm. Nebst höherer Effizienz und Produktivität können mithilfe der Digitalisierung und Automatisierung auch die Flexibilisierung von Produktionskapazitäten und die Fokussierung auf flexible Produktionsplattformen für höhere Resilienz vorangetrieben werden. Kunden sind teilweise bereit, für eine schnellere und vor allem sichere Versorgung einen Mehrpreis zu zahlen. Weitere Investitionen sind aber notwendig, um am kostenintensiven Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu produzieren.
Bestehende Maßnahmen für mehr Planungssicherheit Digitalisierung und Technologien spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei den unterschiedlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Lieferkettenstabilität und der Resilienz gegen geopolitische Unsicherheit. Jeweils gut die Hälfte der Befragten setzt weiterhin bei der Planungssicherheit auf klassische Maßnahmen wie vorausschauende Planung, engere Zusammenarbeit mit Lieferanten, Kunden und Partnern, Prüfung der Resilienz der Lieferanten sowie Erweiterung der Bezugsquellen (s. Abb. 7). 41 Prozent der Unternehmen wollen aber mittels Digitalisierung und im Speziellen mit Technologie zur Echtzeitverfolgung frühzeitig Probleme erkennen. 34 Prozent nutzen KI bereits zur besseren Lieferkettenplanung.
Transparenz und Datenanalytik in den Lieferketten ist teilweise vorhanden, es fehlt aber an umfassender und gezielter Anwendung, um bessere Entscheidungen zu treffen. Nur 29 Prozent haben gezielt Frühwarnsysteme und Szenarien für bessere Reaktionsfähigkeit bei Störfällen entwickelt und nur ein Drittel hat spezifische Verantwortlichkeiten für das Monitoring von geopolitischen Risiken in der Lieferkette definiert. Die Überwachung von geopolitischen Risiken ist mehrheitlich Teil des allgemeinen Risikomanagements und nicht der Lieferkettenfunktion.
Dezidierte Verantwortlichkeiten für geopolitische Themen, interdisziplinäres Zusammenarbeiten mit anderen Geschäftseinheiten und Nutzung externer Kompetenzen sind aber wichtige Voraussetzungen für Unternehmen, um geopolitische Risiken einzuschätzen und Entscheidungen zu einer (geografischen) Neuaufstellung von den Lieferketten und der Produktion zu treffen.
Abb. 7 – Maßnahmen für mehr Planungssicherheit in der Lieferkette Frage: Mit welchen Maßnahmen schaffen Sie mehr Planungssicherheit in der Lieferkette?
Vorausschauende Planung von Ressourcen und Kapazitäten 54%
Engere Zusammenarbeit mit Lieferanten, Kunden und anderen Partnern 49%
Regelmäßige Überprüfung von Lieferanten auf Zuverlässigkeit und Stabilität 48%
der Bezugsquellen
Digitalisierung/Technologien für Echtzeitverfolgung und frühzeitige Erkennung von Problemen
Aufbau von Sicherheitsbeständen bei kritischen Materialien und Komponenten
von KI zur Lieferkettenplanung
Entwicklung von Frühwarnsystemen und Szenarien für bessere Reaktionsfähigkeit bei Störfällen 29%
der Mitarbeitenden
Maßnahmen 10%
Zukünftige KI-Nutzung und Potenzial für Lieferkettenresilienz
Wenn es um den geplanten Einsatz von KI in der Lieferkette und den angrenzenden Bereichen geht, so haben der verschärfte Protektionismus und neue Zölle den KIEinsatz noch nicht groß vorangetrieben. Im Vergleich zum letzten Jahr planen die Unternehmen für die nächsten Jahre weiterhin am stärksten den Einsatz von KI im Bereich Vertrieb (s. Abb. 8). Im Einkauf und in Services/ Aftersales planen nur geringfügig mehr eine KI-Nutzung – und das trotz der Verschärfung des Zollkonflikts in diesem Jahr.
Abb. 8 – Geplanter KI-Einsatz in Lieferketten und angrenzenden Bereichen Frage: In welchen Teilen der Lieferkette und angrenzenden Bereichen planen Sie, in den nächsten Jahren künstliche Intelligenz vermehrt einzusetzen?
Anmerkung: Die Darstellung zeigt für die einzelnen Bereiche den „starken“ und den „sehr starken“ Einsatz zusammengezählt.

Die Unternehmen erkennen aber das große Zukunftspotenzial von KI für mehr Sicherheit in der Lieferkettenplanung. Zwei Drittel der Befragten erhoffen sich im Bestandsmanagement einen erhöhten Nutzen von KI, beispielsweise durch die proaktive Steuerung der Bestände oder Optimierung des Lagerlayouts (s. Abb. 9). Sehr starke Effekte von KI auf die betriebliche Effizienz (z.B. höhere Ressourcenauslastung, Abfallreduzierung), die Nachfrageprognose (z.B. bessere Vorhersagemodelle) oder die Optimierung der Lieferkette (z.B. bessere Routenplanung, Produktionsplanung, Echtzeittransparenz) werden von mehr als der Hälfte gesehen. Weitere Verbesserungen durch KI werden im Lieferantenmanagement – unter anderem bei der Lieferantenauswahl, Risikobewertung oder Leistungsüberwachung – und der Entscheidungsfindung (z.B. Szenarioplanung, Erkennung von Risiken/Störungen) erwartet.
Die Herausforderungen der Integration von KI in der Lieferkette dürfen hingegen auch nicht unterschätzt werden. Die große Mehrheit der Befragten sieht die Datenqualität als Haupthindernis (u.a. fehlende Datenintegration, Standardisierung und Interoperabilität). Für jedes zweite Unternehmen stellen Aufrüstung und Integration von KI in die bestehende IT-Infrastruktur sowie Datenschutz und -sicherheit eine Herausforderung dar. Letzteres hat in den vergangenen Jahren auch vor dem Hintergrund möglicher feindlicher Bedrohungen in Europa an Bedeutung gewonnen. 68 Prozent erwägen deswegen verstärkte Cyberschutz-Maßnahmen, um ihre Lieferketten und/oder Produktion abzusichern.
Abb. 9 – KI-Potenzial für Planungssicherheit in der Lieferkette Frage: Bei welchen Tätigkeiten in der Lieferkette sehen Sie das größte Potenzial von KI, höhere Planungssicherheit zu schaffen? Sehr stark
nicht
„Der Verlagerungstrend der deutschen Industrie der letzten Jahre beschleunigt sich weiter, der steigende Kostendruck spielt dabei eine zentrale Rolle. Ein umfassenderer Einsatz von künstlicher Intelligenz könnte hier durch Produktivitätssteigerungen gegensteuern und neue Wettbewerbsvorteile schaffen.“
Alexander Börsch, Director, Chefökonom & Leiter Research, Deloitte


Handlungsempfehlungen für Unternehmen
• Überwachung und Risikobewertung in der Lieferkette umfassend betreiben und KI-Potenzial ausschöpfen: Transparenz und Datenanalytik in der Lieferkette sollten noch stärker digitale Frühwarnsysteme integrieren, Simulationen und Szenarioanalysen für bessere Entscheidungshilfen anwenden und die neuen Möglichkeiten von Process Bionics und KI zur datengetriebenen Optimierung und Resilienz nutzen. Abhängigkeiten in der Lieferkette, wie beispielsweise Zollrisiken, können mit neuen Technologien in Echtzeit moduliert werden (z.B. durch eine Process Bionics App, die direkt ins ERP/SAP-System eingebunden ist).
Von Nachfrageprognosen und Bestandsoptimierung bis hin zu prädiktiven Analysen und automatisierter Entscheidungsfindung kann KI Unternehmen bei der Erhöhung der Lieferkettenresilienz unterstützen.
• IT-Infrastruktur und Datenqualität als Basis für KI-Nutzung in der Lieferkette verbessern: Die Einführung von KI in der Lieferkette hängt maßgeblich von der Datenqualität ab (u.a. Genauigkeit, Konsistenz, Aktualität etc.). Je präziser die Daten, desto besser das Analysepotenzial. Unternehmen sollten daher in robuste IT-Systeme für KI-Analysen investieren, eine solide Datenbereinigung vornehmen und agile Schnittstellen zwischen ERP-, SCM- und KI-Systemen einrichten. Gleichzeitig müssen Datenschutz und IT-Sicherheit gewährleistet sein, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen. All dies sind Grundvoraussetzungen, um mit KI künftig vertiefte Analysen durchzuführen, genaue Prognosen abzugeben, fundierte Strategien zu entwickeln und zu einer umfassenden Entscheidungsfindung beizutragen.
• Cybersicherheit als Teil der Lieferkettenstrategie ausbauen: Mit zunehmender Digitalisierung steigt auch die Bedrohung durch Cyberangriffe. Unternehmen müssen Cybersicherheit als integralen Bestandteil ihrer Lieferkettenstrategie etablieren. Dazu gehören unter anderem regelmäßige Penetrationstests, Absicherung von IoT-Geräten, Risikomanagement von Drittparteien (u.a. Cloud, SaaS-Plattformen) und Schulung von Mitarbeitenden. Ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept schützt vor Datenverlust und Betriebsunterbrechungen. Um auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, sollten Unternehmen ihre kritischen Lieferkettenteile und -pfade identifizieren, einen Plan B für einen kompromittierten Betriebsmodus entwickeln und im Business Continuity Planning (BCP) Maßnahmen mit Lieferanten und Kunden definieren.
Diese Publikation ist Teil der Studienreihe Supply Chain Pulse Check von Deloitte in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Mit unseren Insights betrachten wir aktuelle Entwicklungen, Trends und Umbrüche in der Industrie. Wenn Sie nach neuen Ideen suchen, um die Herausforderungen von heute und morgen anzugehen, dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen.



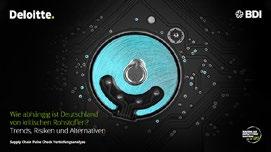
Resilienz im neuen geopolitischen Umfeld Was Industrieunternehmen tun können
Deutsche Ausgabe
Handelsschranken im europäischen Binnenmarkt
Exportplus durch Bürokratieabbau
Deutsche Ausgabe
Der neue Exportkompass für die deutsche Industrie Wie Geopolitik neue Handelswege prägt
Deutsche Ausgabe | English Version
Wie abhängig ist Deutschland von kritischen Rohstoffen?
Trends, Risiken und Alternativen
Deutsche Ausgabe

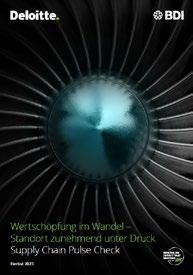

Supply Chain Pulse Check 2024
Lieferketten und Margen unter Druck –Technologie als Hoffnungsträger
Deutsche Ausgabe | English Version
Supply Chain Pulse Check Herbst 2023
Wertschöpfung im Wandel – Standort zunehmend unter Druck
Deutsche Ausgabe | English Version
Supply Chain Pulse Check Frühjahr 2023
Neue Risiken für die Lieferkette und den Standort Deutschland
Deutsche Ausgabe | English Version

Dr. Jürgen Sandau Partner
Lead Supply Chain & Network Operations
Tel: +49 151 58000222 jsandau@deloitte.de

Dr. Alexander Börsch Director
Chefökonom & Leiter Research
Tel: +49 89 29036 8689 aboersch@deloitte.de

Oliver Bendig Partner
Lead Industrial Products & Construction
Tel: +49 151 58078145 obendig@deloitte.de

Roman Morgenweck Manager
Supply Chain & Network Operations
Tel: +49 89 29036 5915 rmorgenweck@deloitte.de
Die Analysen und Publikation wurden mit Unterstützung durch Dr. Philipp Merkofer von Kimosabe Consulting durchgeführt.
Kontaktieren Sie uns gerne!
Mit unseren Insights betrachten wir aktuelle Entwicklungen, Trends und Umbrüche in der Branche. Wenn Sie nach neuen Ideen suchen, um die Herausforderungen von heute und morgen anzugehen, dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
Mit freundlicher Unterstützung von


Zum Supply Chain Pulse Check 2025
Die Befragung wurde im Zeitraum vom 15. September bis 31. Oktober 2025 durchgeführt. Teilgenommen haben 148
Lieferketten-Verantwortliche von Großunternehmen sowie von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMUs) in Deutschland, vorwiegend aus den Branchen Maschinenbau/Industriegüter, Automobil, Technologie, Chemie und Bauwesen.
84 Prozent der Befragten sind Lieferketten-Verantwortliche in Großunternehmen und 16 Prozent in KMUs. Bei drei Vierteln der Befragten handelt es sich um Unternehmen, die Services/Aftersales mit Kundendienst und Ersatzteilversorgung als Teil ihres Geschäfts aufweisen.
Die Prozentzahlen sind so gerundet, dass die Summe der Antworten jeweils 100 ergibt.
Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.
Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500 ® -Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 460.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte. com/de.
Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.
Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeitende oder Bevollmächtigte haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.
Stand 11/2025