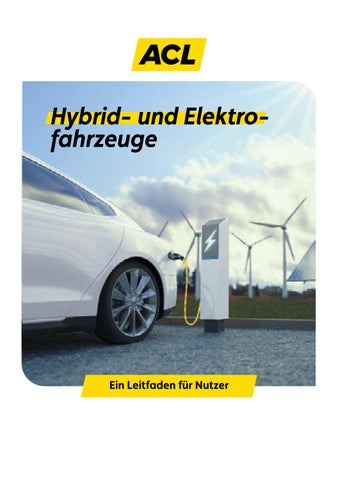Hybrid- und Elektrofahrzeuge



Einführung
Die Presse, die Medien, die Politiker – alle reden über die Wahl der Motorisierung unserer Autos, die nicht mehr einfach nur zwischen Benziner und Diesel zu treffen ist. Die Elektrifizierung hat zwar Einzug in unsere Fahrzeuge gehalten, ist jedoch noch nicht vollständig in unseren Gewohnheiten verankert. Deshalb hat der ACL beschlossen, diesen Leitfaden zu erstellen, der Ihnen helfen soll, nicht nur die verschiedenen auf dem Markt verfügbaren elektrifizierten Motorisierungen kennenzulernen, sondern auch ihre Lademöglichkeiten.

In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile der elektrifizierten Motorisierungen, um Ihnen eine Orientierungshilfe bei Ihrer Auswahl zu geben.

Elektrifizierte Fahrzeuge
Ein elektrifiziertes Auto ist ein Fahrzeug, das sich über einen oder mehrere Elektromotoren teilweise oder vollständig mit elektrischer Energie fortbewegt. Zu dieser Kategorie gehören mehrere Motorisierungsarten, nämlich das vollelektrische Auto, Plug-in-Hybride (über das Stromnetz aufladbar) und klassische Hybride (die sich selbst aufladen). Leichte Formen der Hybridisierung wie der 48 Volt Mild-Hybrid oder der 12 Volt Micro-Hybrid werden nicht berücksichtigt, da sie den Strom nur nutzen, um den Verbrennungsmotor beim Beschleunigen und bei der „StartStopp-Automatik“ zu unterstützen. Diese leichten Hybridvarianten ermöglichen es dem Fahrzeug nicht, sich allein mit dem Elektromotor fortzubewegen, und schränken damit Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch und die Verringerung der CO2-Emissionen ein.

Obwohl die Reichweite von Elektrofahrzeugen oft als Einschränkung wahrgenommen wird, verbessert sie sich Jahr für Jahr und beträgt mittlerweile bei den besseren Modellen unter realen Einsatzbedingungen etwa 600 Kilometer.

Voll-Hybrid / Klassisch
(HEV – Hybrid Electric Vehicle)
Vorteile:
Ein Voll-Hybrid-Fahrzeug oder klassischer Hybrid verfügt über zwei verschiedene Antriebsquellen: einen Verbrennungsmotor und einen oder zwei Elektromotoren, die von einer Batterie mit geringer Kapazität (etwa 2 kWh) angetrieben werden.
Der klassische Hybrid lädt seine Batterie während des Fahrens selbstständig auf, indem er Energie beim Bremsen zurückgewinnt bzw. indem er überschüssige Energie des Verbrennungsmotors auf seine Batterie überträgt, sodass sie sich nicht entlädt. Dennoch gelingt es den HEVs, geringe Verbrauchs- und CO2Emissionswerte zu erzielen, ohne dass ein Aufladen am Stromnetz erforderlich ist.
Flexibilität durch autonomes
Laden der Batterie (es muss kein Kabel angeschlossen werden)
Gleichwertig mit Verbrennern (es muss nur Kraftstoff getankt werden)
Günstiger als eine PHEV-Version
Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen im Vergleich zu einem gleichwertigen Verbrenner
Kaum höherer Kaufpreis bei einigen Herstellern
Nachteile:
Keine staatlichen Beihilfen
Zusätzliches Gewicht der Batterie und des Elektrosystems (ca. 80 kg)
Begrenzte Reichweite im vollelektrischen Betrieb (kürzere Stadtfahrten)
Höhere Wartungskosten im Vergleich zu vollelektrischen Fahrzeugen
Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Plug-In Hybrid (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
Vorteile:

Im Vergleich zu einem HEV-Fahrzeug ist ein aufladbarer Hybrid (PHEV) mit einer höheren Batteriekapazität (zwischen 10 und 40 kWh) ausgerüstet, die über das Stromnetz aufgeladen werden kann. Seine tatsächliche Reichweite im vollelektrischen Betrieb schwankt je nach Modell und Batteriekapazität zwischen 35 und 110 Kilometern.
Im Gegensatz zum klassischen Hybrid muss der PHEV regelmäßig an das Stromnetz angeschlossen werden, um einen niedrigen Kraftstoffverbrauch (Benzin oder Diesel) zu gewährleisten, da dieser sonst erheblich ansteigt. Die meisten PHEVs bieten je nach Ladezustand der Batterie und den Einsatzbedingungen die Wahl zwischen einem rein elektrischen, einem Hybrid- oder einem Verbrennungsmodus.
Höhere Reichweite im vollelektrischen Betrieb als ein Voll-Hybrid-Fahrzeug
Wahl zwischen den Betriebsarten elektrisch, hybrid und Verbrenner Hohe Flexibilität bei der Nutzung (ist die Batterie leer, übernimmt der Verbrenner den Antrieb)
Wenn die Batterie regelmäßig aufgeladen wird und das Fahrzeug im elektrischen Modus betrieben wird, lassen sich ein sehr geringer Kraftstoffverbrauch (+/- 2 l/100 km) und entsprechend geringe CO2Emissionen (< 50 g/km) erzielen
Kürzere Zeit zum Aufladen der Batterie als bei einem vollelektrischen Fahrzeug
Nachteile:
Keine staatlichen Beihilfen
Deutlich höherer Kaufpreis im Vergleich zu einem klassischen Hybridfahrzeug
Kaufpreis entspricht in etwa dem von einigen vollelektrischen Fahrzeugen
Sehr häufiges Aufladen aufgrund der geringen elektrischen Reichweite
Sehr hoher Verbrauch (vier bis fünf Mal so hoch wie der angegebene Wert), insbesondere bei Stadtfahrten, wenn die Batterie entladen ist
Wesentlich schwerer (bis zu 450 kg mehr) als ein Verbrenner (was sich auf Fahrverhalten, Komfort und Verbrauch bei entladener Batterie auswirkt)

Elektrofahrzeug
(BEV – Battery Electric Vehicle)
ELEKTROMOTOR
Hierbei handelt es sich um ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug, das seine Energie aus einer Batterie mit hoher Kapazität (bis zu 213 kWh beim Hummer EV) bezieht. Die Batterie muss am Stromnetz (an einer privaten oder öffentlichen Ladestation) aufgeladen werden, und die tatsächliche Reichweite schwankt je nach Modell zwischen 150 und 600 Kilometern.
Die Reichweite eines BEV hängt stark vom Fahrstil ab. Sie verringert sich erheblich bei hoher Geschwindigkeit (Autobahn), im Winter und bei dynamischer Fahrweise.
Vorteile:
Staatliche Beihilfen
Keine lokal umweltschädliche und CO2-Emissionen
Komfortableres Fahren (weniger Geräuschentwicklung und Vibrationen) als bei einem Verbrenner
Geringere Betriebskosten als bei einem Verbrenner aufgrund der einfacheren Wartung und zurzeit attraktiver Kosten für das Aufladen der Batterie
Müheloses Aufladen an einer privaten oder öffentlichen Ladestation
Gut ausgebautes
Netz von öffentlichen Ladestationen in Europa
Nachteile:
Höherer Kaufpreis ohne Beihilfen
Höheres Gewicht als ein gleichwertiger Verbrenner (bis zu 300 kg mehr)
Batterie entlädt sich schnell bei Autobahnfahrten oder dynamischer Fahrweise
Geringere Reichweite unter bestimmten
Witterungsbedingungen
Längere Ladezeiten im Vergleich zum Auftanken von Kraftstoff bei Autobahnfahrten
Hybrid- und Elektrofahrzeuge
PRÄMIEN
Elektrofahrzeuge
Der luxemburgische Staat fördert den Kauf von vollelektrischen Fahrzeugen (BEV). Für klassische Hybridfahrzeuge (HEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) gibt es keine staatlichen Beihilfen.

1.500 €
Für gebrauchte Elektrofahrzeuge, die älter als drei Jahre sind.
3.000 €
Für vollelektrische Fahrzeuge, die zwischen 16 und 18 kWh/100 km verbrauchen und für Fahrzeuge, die bis zu 20 kWh/100 km verbrauchen und eine Leistung bis zu maximal 150 kW haben.
6.000 €
Für Fahrzeuge mit 100 % Elektroantrieb und einem Verbrauch von bis zu 16 kWh/100km, Fahrzeuge mit 7 oder 9 Sitzplätzen (für Familien mit mindestens 5 Personen), leichte Nutzfahrzeuge mit 100 % Elektroantrieb sowie Wasserstofffahrzeuge (Brennstoffzelle).

Diese Bestimmungen gelten für Fahrzeuge, die ab dem 1. Oktober 2024 bestellt wurden. Diese Prämie kann nach der ersten Zulassung des Fahrzeugs beantragt werden. Die Haltedauer muss bei einem Neuwagen drei Jahre und bei Gebrauchtwagen zwei Jahre betragen.

Batterie und ökologischer Fußabdruck
Zum Abschluss dieses Kapitels über elektrifizierte Fahrzeuge wollen wir auf die Batterie eingehen. Diese muss weiter entwickelt werden, um bessere Reichweiten zu bieten, ihr Gewicht muss verringert werden, um die Auswirkungen auf das Gesamtgewicht und die Straßenlage des Fahrzeugs zu verringern, und sie muss gleichzeitig erschwinglicher werden, damit sich möglichst viele Personen ein elektrifiziertes Fahrzeug leisten können. Zudem werfen die für die Batterieproduktion erforderlichen natürlichen Ressourcen Probleme auf, da sie nicht unbegrenzt verfügbar sind, und die Erhöhung der Reichweite ist mit der Nutzung größerer Batterien verbunden, für die entsprechend mehr Seltene Erden und Metalle benötigt werden.
Am 14. Juni 2023 hat die Europäische Union eine neue Verordnung über Batterien und Akkuabfälle verabschiedet. Gemäß dieser Verordnung müssen ab Ende 2025 65 % des durchschnittlichen Gewichts von Lithium-Batterien recycelt werden.

2031 müssen neue Batterien 85 % Blei, 16 % Kobalt sowie 6 % Lithium und Nickel enthalten, die durch Recycling rückgewonnen wurden. In den Folgejahren werden die Vorgaben für das Recycling und die Produktion von Batterien noch strenger. Mit dieser Initiative soll ein besseres Lebenszyklusmanagement von Batterien in Europa gefördert werden – von ihrer Entwicklung bis zu ihrer Entsorgung.
Auch die Batterien von Elektrofahrzeugen können ein „zweites Leben“ erhalten und als Speicherbatterien in Photovoltaikanlagen wiederverwendet werden.
Die Batterietechnologie steckt noch mitten in ihrer Entwicklung, und es ist noch ein langer Weg zurückzulegen bis vollelektrische Fahrzeuge zu einer nachhaltigen und realistischen Lösung für alle werden.

Ladestationen

Das Aufladen der Batterie ist ein wichtiger Aspekt für die Nutzer von elektrifizierten Fahrzeugen. Denn mit Ausnahme des HEV, der sich automatisch auflädt, müssen PHEV und BEV an das Stromnetz oder eine spezielle Ladestation angeschlossen werden, um ihre Batterie zu laden. Es gibt verschiedene Lösungen, die von einem Kabel mit integriertem Steuergerät (ICCB, 230-V-Adapter) für langsames Laden über eine private oder öffentliche Ladestation für beschleunigtes Laden bis hin zu einer HPC-Schnellladestation (High Power Charging) reichen. Schauen wir uns einmal an, wie das alles funktioniert.

Kabel mit integrierter Steuerungsbox (In-Cable Control Box)

Dieses Kabel wird auch als mobile Ladestation bezeichnet und wird an eine 230 Volt Steckdose angeschlossen. Es ist mit einem Steuerungsgehäuse ausgestattet, das den Strom regelt und den Anschluss absichert. Alle PHEV und BEV werden normalerweise mit dieser Art von Kabel ausgeliefert, damit sie über eine Haushaltssteckdose aufgeladen werden können.
Da diese Steckdosen in der Regel nur für 10 A ausgelegt sind, erhält man eine Ladeleistung von 2,3 kW (230 Volt – 10 A) oder aber 3,7 kW (230 Volt – 16 A) bei entsprechend stärker ausgelegten Steckdosen.
Man kann ein Elektroauto mit dem ICCB auch durch die Verwendung eines speziellen Adapters laden, der an eine ein- oder dreiphasige CEE-Industriesteckdose angeschlossen wird. Ab einer Ladeleistung von 7 kW muss allerdings vom Netzbetreiber über den Smarty-Zähler ein Lastabwurf für die CEE-Steckdose eingerichtet werden.
Diese Option ist nicht zum Laden eines vollelektrischen Fahrzeugs geeignet, da die Steckdosen nicht für eine intensive Nutzung ausgelegt sind.
Die Entscheidung für das Laden an einer Steckdose würde die Ladeleistung einschränken und damit die zum Laden des Fahrzeugs erforderliche Zeit erheblich verlängern. Deshalb ist diese Methode besser geeignet für gelegentliches Laden oder für Batterien mit geringer Kapazität (PHEV). Denn beim Laden an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose sind die Ladeverluste aufgrund der Wärmeentwicklung recht hoch und liegen bei etwa 25 %.
Denken
Sie daran:
Jede Ladeausrüstung für Elektrofahrzeuge mit einer einphasigen Leistung von über 4,6 kW oder einer dreiphasigen Leistung von über 7 kW muss bei Creos gemeldet werden. Hierfür steht Ihnen das Meldeformular auf dem Kundenportal myCreos zur Verfügung.